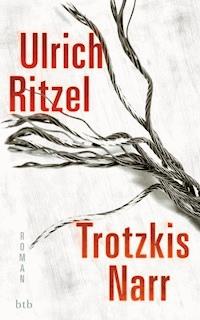7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Eigentlich will Ex-Kommissar Berndorf seinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Doch dann kommt alles ganz anders: Ein Journalist stellt zu viele Fragen nach Nazigold in jenen Bombenkratern, die zu stillen Waldteichen voll gelaufen sind. Und nach Mobbing in pazifistischen Kirchenkreisen. Als ein junger Sinti beschuldigt wird, den Lokalreporter und heimlichen Sexfotografen Hollerbach umgebracht zu haben, gerät Berndorf in ein explosives Geschiebe aus Waffenhändlern, alten Stasi-Seilschaften und behördlich abgesegneter US-Spionage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Ähnliche
Buch
Eigentlich will Ex-Kommissar Berndorf zu seiner Freundin nach Berlin ziehen und dort seinen Ruhestand genießen. Aber am Grab seines ehemaligen Kollegen Jonas Seiffert übernimmt er, nicht sehr willig, dessen Hund. Mehr noch verändert seinen Alltag, dass ihm Seiffert eine ungelöste Frage hinterlassen hat. Sie führt in die 60er Jahre, als über Nacht das Haus einer Zigeunerfamilie zerstört wurde. Die honorigen Täter waren im Politfilz der Staatspartei sicher gewesen. Den Kindern der Täter begegnet Berndorf nun in untergründigen Zusammenhängen. Als ein junger Sinti beschuldigt wird, den Lokalreporter und heimlichen Sexfotografen Hollerbach aus Lauternbürg umgebracht zu haben, gerät Berndorf in ein explosives Geschiebe aus Waffenhändlern, behördlich abgesegneter US-Spionage und alten Stasi-Seilschaften.
Autor
Ulrich Ritzel, geboren 1940 in Pforzheim, lebt heute in Ulm. Er studierte Jura in Tübingen, Berlin und Heidelberg. Danach schrieb er für verschiedene Zeitungen und wurde 1981 mit dem begehrten Wächter-Preis ausgezeichnet.
Sein Romanerstling »Der Schatten des Schwans« wurde zum Überraschungserfolg. Für »Schwemmholz« bekam er den Deutschen Krimipreis verliehen, für »Der Hund des Propheten« den Burgdorfer Krimipreis.
Inhaltsverzeichnis
Der Blautopf, um den sich sonst Busladungen von Touristen drängen, ist verlassen. Am Steinbild der Schönen Lau vorbei geht sie einige Schritte den baumbestandenen Weg hoch, der um das Quellbecken führt. Traurig sieht die Schöne aus, ausgezehrt vom sauren Regen. Tamar hat Mörikes Geschichte von der Schönen Lau in der Schule gelesen. In einer württembergischen Schule ist das unvermeidlich. Sie weiß noch, dass es eine traurige Geschichte gewesen sein muss: eine verbannte Halbnymphe, die erst in ihre Heimat zurückkehren darf, wenn sie das Lachen gelernt hat …
Und das ausgerechnet hier. Das leuchtende Blau des Quelltopfs kommt ihr vor wie Kupfervitriol. Ist das Depression? Ein Glassplitter im Auge, der einen alle Dinge hässlich und verfallen sehen lässt …
Samstag, 20. Oktober 2001
Ein Strom von Menschen fließt durch die Eingangshalle der Universitätsklinik, Besucher mit Blumensträußen in der Hand, Patienten im Bademantel auf dem Weg zur Cafeteria, Frauen mit Kindern, alte Frauen, dunkel gekleidete Frauen, Frauen mit Kopftüchern und der ganzen türkischen Großfamilie im Gefolge. Ein Pulk von Männern, rotgesichtig, schwitzend, unförmige schwarze Koffer in den Händen, strebt dem begrünten Innenhof zu. Ein grauhaariger Mann bahnt sich den Weg durch den Pulk, bis er zu dem Empfangsschalter kommt, hinter dem ein verdrossener Pförtner über dem Wochenend-Rätsel des »Tagblatts« brütet.
»COLTAN«, sagt der Mann, nachdem er ihm eine Weile zugesehen hat. »Das Erz mit den sechs Buchstaben, ohne das Ihr Handy nicht funktioniert, heißt Coltan.«
Der Pförtner blickt hoch.
»Bei der Gelegenheit«, fährt der Mann fort, »könnten Sie mir sagen, wo ich Herrn Seiffert finde, Jonas Seiffert.« Er buchstabiert den Nachnamen.
»Zimmer 317, dritter Stock«, sagt der Pförtner, nachdem er den Namen in seinem Computer gefunden hat. »Wie, haben Sie gesagt, soll das Zeugs heißen?«
»Coltan«, wiederholt Berndorf. Seit er pensioniert ist, hat er morgens sogar Zeit für das Kreuzworträtsel.
»Mit C?«
Berndorf nickt.
»Das kann hinkommen«, antwortet der Pförtner, und Berndorf geht zur Treppe. Wenn es nicht zu viele Stockwerke sind, verschmäht er Aufzüge. Während er das Treppenhaus hinaufsteigt, sieht er durch die gläserne Außenfront, wie die rotgesichtigen Männer auf dem Innenhof Aufstellung nehmen. Die Oktobersonne lässt das Messing der Musikinstrumente aufblitzen, die die Männer aus ihren Koffern auspacken.
Vom Treppenaufgang im dritten Stock gehen mehrere Korridore ab, schließlich findet er den richtigen. Die Tür zu Nummer 317 ist angelehnt, er klopft behutsam, mehr um anzuzeigen, dass ein Besucher eintreten will, dann schiebt er die Tür auf und tritt ein.
Das Zimmer mit den beiden Betten liegt im Halbdunkel, wegen der schon tief stehenden Herbstsonne sind die Jalousien heruntergelassen. Auf den ersten Blick weiß Berndorf nicht, ob er nicht doch eine falsche Zimmernummer bekommen hat. Im Bett an der Seite zur Tür liegt ein Patient, dessen Alter er nicht schätzen kann, das Gesicht ist spitznasig und seltsam aufgeschwemmt in einem. Eine Frau sitzt neben ihm, die blonden Haare straff nach hinten gebunden, sie erwidert seinen angedeuteten Gruß mit einem kurzen Nicken.
Zögernd geht Berndorf auf das zweite Bett zu, dann sieht er, dass sich dort eine knochige Hand hebt, begrüßend oder einladend. Auf dem hochgestellten Kissen liegt ein kahler Kopf mit gelblich verfärbtem Gesicht, der Hals wie angebunden an einen Infusionsständer, zu dem mehrere Schläuche führen. Wenigstens ist der Händedruck noch so – oder fast so –, wie Berndorf ihn von Jonas Seiffert kennt.
»Schön, Sie zu sehen«, sagt Seiffert, und Berndorf weiß nicht, was er antworten soll, denn es ist bei Gott nicht schön, den Propheten Jonas so zu sehen.
Seiffert enthebt ihn einer Antwort, er zeigt auf einen Stuhl, den Berndorf näher ans Bett heranziehen kann.
Als er schließlich Platz genommen hat, rafft Berndorf sich auf und fragt, was die Ärzte meinen. Eine täppische Frage, aber er kann den Propheten mit dem gelben Gesicht und dem Hals, der an drei Infusionsschläuchen hängt, nicht fragen, wie es ihm denn so geht. Ums Verrecken kann er das nicht.
»Alles hat seine Zeit«, antwortet Jonas Seiffert. »Ich hab meine gehabt. Die Ärzte sagen, ich hätte ein Rezidiv.« Er hebt die Hand an und lässt sie wieder auf die Bettdecke sinken. »Aber erzählen Sie mir doch von sich… Ich dachte, Sie gehen nach Berlin?«
Berlin, ach ja, denkt Berndorf, davon lässt sich einiges berichten, und beschreibt seine blauäugigen Versuche, für sich und Barbara ein Haus zu finden, in Dahlem oder wenigstens an einem der brandenburgischen Seen… Seiffert scheint zuzuhören, aber Berndorf drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass selbst das Zuhören zu viel von einer Kraft verbraucht, die schon fast gar nicht mehr da ist.
»Jedenfalls habe ich meine Ulmer Wohnung zum Jahresende gekündigt«, beschließt Berndorf seinen Bericht, »der Blick aufs Münster wird mir fehlen, anderes nicht …«
Schweigen – oder besser: Verlegenheit senkt sich über die beiden Männer. Was muss er an den Propheten hinreden, wer alles in Ulm ihm nicht fehlen wird? Auch am Bett nebenan wird nicht gesprochen.
»Wer kümmert sich eigentlich um Felix?«, fragt Berndorf schließlich, und heuchelt den Halbsatz hinterher: »Solange Sie hier sind.«
Felix ist des Propheten alter, knochiger, stummelschwänziger und sabbernder Boxerrüde.
»Marzens Erwin«, antwortet Seiffert knapp, und Berndorf sagt sich, dass er sich das auch hätte denken können. Erwin Marz ist Gemeindearbeiter und Feuerwehrkommandant in Wieshülen, dem Albdorf, zu dessen Ortsvorsteher Seiffert schon vor vielen Jahren gewählt worden war.
Dann sieht Berndorf, dass die knochige Hand ihn zu sich herwinkt. Er beugt sich über den Kranken.
»Da ist noch eine Geschichte …«, sagt Seiffert halblaut.
Berndorf sieht ihm ins Gesicht. Plötzlich erkennt er wieder die Augen des Kriminalbeamten Jonas Seiffert, über den sich keiner lustig je zu machen wagte. Höchstens, dass man ihn hinter vorgehaltener Hand den Propheten Jonas genannt hat.
Seiffert öffnet den Mund, aber kein Wort ist zu hören, für einen Augenblick bleibt die Zeit stehen, Berndorf starrt in den Mund, in dessen Zahnreihen zwei große Lücken klaffen, dröhnend stürzt eine Wand von Lärm ein und begräbt das Zimmer unter sich. Berndorf schrickt hoch und tauscht einen entsetzten Blick mit der blonden Frau am Bett nebenan. Der Lärm stürzt und stürzt und schüttet alles unter sich zu und nimmt kein Ende, denn er wird von dem Posaunenchor gemacht, der draußen vom Innenhof mit unermüdlicher frommer Kraft gegen die Glasfassaden des Klinikums anzublasen begonnen hat. Wenn Berndorf sich nicht sehr täuscht, fliegt ihm gerade der Choral »Näher mein Gott zu Dir …« um die Ohren.
Deutlicher können sie es den Patienten aber wirklich nicht sagen, denkt er.
Die Frau am Bett nebenan steht entschlossen auf und will aus dem Zimmer gehen. Eine Schwester kommt mit einem Tablett herein, und die Frau sagt: »Hören Sie – wer verantwortet diesen Posaunenchor da draußen? Dieser Choral ist für meinen Freund nicht zu ertragen, nicht in seiner Verfassung…«
Die Frau spricht schriftdeutsch, mit einer fast unmerklichen Einfärbung, die Berndorf aber nicht zuordnen kann. Eine Schwäbin ist sie nicht.
»Da kann ich Sie jetzt aber gar net verstehen«, sagt die Schwester, »das sind doch lauter nette Leute, die blasen da ganz umsonst, weil sie den Patienten eine Freude machen wollen, da können Sie doch nicht so sein…« Die Schwester bleibt stehen und betrachtet nun ihrerseits die blonde Frau, sichtlich empört.
»Wenn das so nette Leute sind«, antwortet die Frau, »dann können die doch sicher auch Choräle spielen, die fröhlicher sind, die gibt es nämlich auch, und die keine zusätzliche Belastung darstellen für Menschen, die mit ihrer letzten Kraft darum kämpfen, Fassung zu bewahren…«
»Ich hab jetzt keine Zeit, mit Ihnen zu streiten«, gibt die Schwester zurück und schiebt sich mit ihrem Tablett an ihr vorbei, zu Seifferts Bett. »Schauen Sie, der Herr Seiffert hier, der freut sich immer, wenn ein Posaunenchor da ist, aber das ist auch ein ganz ein lieber Herr …«
Dann erklärt die Schwester, dass sie den Besucher leider wegschicken muss, und Berndorf steht auf, fragt dann aber, ob er nicht draußen warten könne. Doch Seiffert entscheidet anders.
»Nein, nein«, sagt er, »das hier ist alles keine Unterhaltung mehr für einen jungen Mann …«
»Aber Sie wollten doch…«, widerspricht Berndorf.
Seiffert hebt die Hand. »Auch Fragen haben ihre Zeit, ich hab nur grad nicht dran gedacht… Nett, dass Sie da waren. Und grüßen Sie die junge Kollegin.«
Die Hand bewegt sich, Abschied nehmend und zugleich den Weg weisend.
Berndorf versteht. Er nickt und hebt grüßend beide Hände, mit der linken die zur Faust geballte rechte Hand fassend.
Dienstag, 6. November 2001
Der Bus hält am Dorfeingang, auf dem Platz vor der Alten Molke, Berndorf steigt aus und schlägt den Kragen seines Trenchcoats hoch. Dabei wirft er einen Blick zum Himmel, über den in rascher Folge regengraue Wolken aus Nordwest ziehen. Im Geäst der schon halb entlaubten Apfelbäume auf der anderen Straßenseite hat sich ein Schwarm Saatkrähen niedergelassen, unversehens fliegt einer der Vögel auf, kreischend und ratschend folgen die anderen und kreisen in der undurchschaubaren Ordnung ihrer Flugbahnen.
Berndorf zupft den Trauerflor zurecht, den er am Revers trägt, und geht ins Dorf hinein, so eilig, wie es mit einem Trauerflor am Revers gerade noch schicklich ist. Das Dorf scheint verlassen, giftfarben schliert Öl durch eine Pfütze, vor einem der Höfe ist ein magerer, großer gelber Hund an einer Laufleine angebunden und starrt die Straße hinauf. Für einen Augenblick bleibt Berndorf stehen und versucht, den Hund anzusprechen, aber der wendet ihm nur einen kurzen Blick zu und versucht ein Wedeln mit dem Stummelschwanz und äugt schon wieder die Dorfstraße hinauf.
Berndorf geht weiter und biegt an einem kleinen, mit Kastanien bestandenen Platz zur Kirche ab. Das Dorf gehört zu den wenigen, die noch keinen neuen Friedhof angelegt haben. In den Reihen der Gräber rund um die Kirche ist eines frisch ausgehoben. Der Trauergottesdienst hat bereits begonnen, er steigt die Wendeltreppe hinauf, die zur Glockenstube und zur Empore führt, auch die Empore ist dicht besetzt, und so geht er vor bis zur Brüstung und legt seine Hände auf den Querbalken. Der Balken ist braun gebeizt und grob behauen, Risse durchziehen ihn der Länge nach. Er will durchatmen, und lässt es sogleich bleiben. Die Luft ist dunstig von alten, feuchten dunklen Kleidern und Mänteln, in Schwaden steigt der Geruch der Mottenkugeln auf.
Er beugt sich leicht über die Brüstung. Köpfe, dicht gereiht und grau. Manche altersweißgelb, das Haar strähnig über dem durchscheinenden Schädel. Vorne der Sarg, poliertes Holz schimmert im Kerzenlicht, wieso poliert? Jonas wäre es nicht recht gewesen. Zwei Frauen, die eine noch jung. Kräftige Rücken, kerzengerade. Tochter und Enkelin? Berndorf erinnert sich dunkel an ein Foto auf dem Schreibtisch der Ortsverwaltung. Hinter dem Altar der Öldruck mit den drei Kreuzen unterm Himmel von Flandern 1917.
Eine Novemberböe wirft sich gegen die Kirchenfenster und lässt die Holzrahmen aufseufzen.
Da ließ der HErr einen großen Wind aufs Meer kommen und hub sich ein groß Ungewitter auf dem Meer, dass man meinete, das Schiff würde zerbrechen.
Den Propheten und Ortsvorsteher Jonas Seiffert, Kriminalinspektor in Ruhe, hat nicht das Meer verschlungen und nicht der Walfisch. Der steinige Boden der Alb wird ihn unter sich begraben und nicht mehr herausgeben, bis die Liegezeit gemäß kommunaler Friedhofsatzung abgelaufen ist. Falls nicht vorher, man kann nie wissen, der Jüngste Tag eintritt. Und dann? Auferstehung? Keine sehr appetitliche Vorstellung, denkt Berndorf. Hat der Prophet das geglaubt? Was glauben die Frommen wirklich? Manchmal hatten sie Gespräche geführt, in den Stunden, bevor die Bosheit der großen Landeshauptstadt Ninive heraufkam vom Nesenbach und anläutete im Dezernat I, Kapitalverbrechen.
Na, so groß auch wieder nicht.
Aber die Gespräche hatten, bei Gott, nicht vom HErrn oder sonst den letzten Dingen gehandelt. Dienst ist Dienst. Der Prophet nahm es auch damit genau.
Und wenn Jonas keine Schicht hatte und auf dem Wochenmarkt gepredigt hat gegen den Eigennutz und die Selbstgerechtigkeit und weiß der Himmel was sonst noch, hat sich Berndorf das nie angehört. Er wäre sich wie ein Voyeur vorgekommen.
Was glauben die Leute überhaupt? Er sieht sich um. Neben ihm: Bauernschädel, breitflächig, apoplektisch. Einzelne erwidern den Blick, kurzes Nicken. Angedeutet. Würdig. Fast, aber nur fast, gehört er schon dazu. Ein Blick drängt sich zu ihm her. Noch ein Trenchcoat, angeschmuddelt. Verbeugung über die Bankreihen hinweg. Fettiges Haar ringelt sich, nach hinten gekämmt, überm speckigen Nacken. »Tagblatt« oder Generalanzeiger? »Tagblatt«. Im Namen irgendetwas mit Holder. Der Rasende Reporter des Lautertals. Immer dabei, wenn das Blaulicht lockt oder der Posaunenchor spielt. Holderbaum? Höllerer? Ich muss mir diesen Namen nicht merken. Warum ärgere ich mich, dass ich ihn nicht weiß?
»Ein im Glauben gelebtes und erlittenes Leben.« Der Pfarrer nuschelt.
»Ein Christ, der zu seinem HErrn betete und, wenn es sein musste, auch mit ihm gerungen hat und gerechtet.« Mag sein, denkt Berndorf. Dass er mit ihm gerechtet hat, glaub ich aufs Wort. Trotzdem ist es mir zu wohlfeil.
»Ein treuer Wächter.« Wer? Jonas? Oder sein Hund? Und wer überhaupt hat den Felix in dieser Hofeinfahrt angebunden? Wer immer es war: dort kann der Hund nicht bleiben.
Einmal hat Jonas von seinem Enkelkind erzählt, und dass er es besuchen will, irgendwo in Neusüdwales. Das hört sich nicht gut an. Wer nimmt schon einen verwaisten, alten, sabbernden Boxer nach Neusüdwales mit? Außerdem würde er dort erst in Quarantäne müssen.
Wer jault da? Nein, es ist die Orgel.
»Was suchst du, Mensch, bis in den Tod? Du suchst so viel, und Eins ist not!« Wenn der Pastor nicht nuschelt, sondern singt, hat er einen schönen Bariton, der schwebt der Gemeinde voran.
»Wohlauf, wohlan zum letzten Gang.« Es hilft nichts. Berndorf weiß jetzt, dass er mit den Frauen reden muss. Unweigerlich werden sie ihn dann zum Essen einladen.
Und was, bitte, willst du mit des Propheten altem Hund?
Die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr Wieshülen wuchten den Sarg hoch. Rechts vorne Marzens Erwin, Kommandant. Rot das Gesicht, vor Würde oder Rührung oder beidem. Das Gewicht kann es nicht sein. Zeitlebens war Jonas Seiffert ein hoch gewachsener kräftiger Mann gewesen. Aber der Krebs oder die Therapie oder beides zusammen hatten zuletzt nicht mehr viel an ihm gelassen.
Der Sarg wird durchs Kirchenschiff getragen, und Berndorf wirft einen Blick auf das, was er für die australischen Seiffert-Frauen hält. Aber sie halten die Köpfe gesenkt.
Eine Bankreihe weiter wartet das »Tagblatt« darauf, dass Berndorf zu ihm aufschließt. Berndorf lässt einen schwergewichtig schnaufenden Lodenmantelträger vorbei, der nach dem Vorstand des Hegerings aussieht.
Keine Lust auf ein Geplauder. Was soll ich dir erzählen, dass es ein Zeitungsmensch wie du begreift und nicht durcheinanderbringt? Von einem Landgendarmen, der doch ein Prophet war und den der HErr in die große Stadt gesandt hat? Nein, es war nicht der HErr, dessen Namen wir nicht kennen. Es waren die Herren im Polizeipräsidium oder noch weiter oben, die ihn haben versetzen lassen, und ihre Namen will keiner mehr wissen.
Langsam, Stufe für Stufe, steigen die Männer die Wendeltreppe von der Empore herab. Der Vorstand vom Hegering ist womöglich doch keiner. Einen Kick zu lodenmantelmäßig. Drei Stufen weiter dieser Hollergoller.
Draußen fährt nassforscher Novemberwind in die Gesichter und vertreibt fürs Erste den Kirchendunst, diesen Geruch von Kerzenlicht und alten Leuten. Berndorf kommt an einem Familiengrab vorbei und nickt, wieder wartet vor ihm der Mensch, von dem Berndorf nun plötzlich weiß, daß er Hollerbach heißt, und diesmal gibt es kein Entrinnen.
Kurzer Händedruck.
»Sie waret doch au Kolleg zu ihm?«
Halblaut, aber mit voller Wucht schlägt ihm Mundgeruch ins Gesicht.
Kurzes Murmeln, das als Zustimmung gedeutet werden kann.
»In Stuttgart?«
Zu viel Magensäure. Kein Wunder. Immer im Stress. Die ewig unlösbaren Rätsel des deutschen Satzbaus und der Orthographie. Was sich die Leute aufregen, wenn ihr Name mal ein bisschen falsch in der Zeitung steht.
Eine von der Osteoporose nach vorne gekrümmte Frau blickt scharf zu Berndorf hoch und gleich wieder weg, noch ehe er grüßen kann.
Mit uns beiden wird es nichts mehr in diesem Leben.
»Ja, in Stuttgart.«
Warum geht es nicht weiter? Auch noch Reden am Grab?
»Ich hätt’ gern mal mit Ihnen über die Zeit damals…«
»Für den Nachruf?« Das fehlte noch.
»Nein, net direkt…«
Bis knapp unters Kreischen erhebt sich eine Stimme.
Der lodengrüne Rücken schiebt sich zurück und drängt den Reporter Hollerbach gegen Berndorf. Vorne, wo das offene Grab sein sollte, kommt Bewegung auf. Halblaute Anweisungen, mehr gezischt als gerufen, flehentlich fast und offenbar ungehört.
Ein Verdacht überkommt Berndorf. Er schiebt sich an dem Lodengrünen vorbei und steigt über ein Grab und noch ein zweites und umgeht auf dem äußeren Friedhofsweg den Zug der Trauermäntel, der irgendwie in Unordnung geraten ist, und kommt so schließlich zu dem Hügel aus Lehmbrocken und Albgestein, der neben einer offenen Grube aufgeworfen ist. Schräg davor, als habe man ihn hastig abgestellt, steht der Sarg auf dem Weg. Dahinter hat der Pfarrer Zuflucht gesucht und hinter ihm die beiden australischen Frauen und wiederum hinter ihnen ein jüngerer bebrillter Mann mit einem Gesichtsausdruck, als hätte er leider auch grad keinen passenden Paragraphen zur Hand.
Der neue Ortsvorsteher? Vor dem Sarg lauert Marzens Erwin, die Gesichtsfarbe ins Hochrot-Violette verfärbt, gebückt versucht er sich dem zu nähern, was vor dem ausgehobenen Grab steht.
Vor dem Grab steht der Hund. Groß und knochig und mit durchgebissener Leine hat Felix, der Boxer des Propheten, vor der Grube Aufstellung genommen und leidet es nicht, dass man seinen Herrn da hineintut. Auf seinem Rücken ist ein dichter Streifen Fell aufgerichtet.
»Wer lässt denn dieses Tier hier herein«, klagt der Pfarrer und blickt aus seinen großen runden Brillengläsern vorwurfsvoll zu Berndorf, als hätte er in diesem nun endlich eine zuständige Aufsichtsperson gefunden. »Sehen Sie denn nicht, dass wir hier eine Beerdigung haben …«
Vom Grab her antwortet, leise und doch unüberhörbar, ein tiefes Knurren, das Vibrieren einer aufgestörten und verzweifelten Hundeseele.
Aber als Marzens Erwin nach dem Hund greifen will, wird das Knurren scharf und warnend, Lefzen ziehen sich hoch und legen das Gebiss frei mit den großen gelblichen Reißzähnen, so dass die Hand von Marzens Erwin gleich wieder zurückzuckt.
»Können Sie denn gar nichts tun!«, jammert der Pfarrer.
Berndorf steigt über den Hügel mit der ausgehobenen Erde. Felix ist noch drei oder vier Schritte von ihm entfernt. Erst jetzt sieht er, wie mager der Hund geworden ist. Er ist grau um die Schnauze, und die Flanken sind eingefallen.
Überlege dir gut, was du tust. Wenn du ihn jetzt rufst und er kommt, gibt es kein Zurück.
Aber dann soll es so sein.
»Hier, Felix«, sagt er zu dem Hund. »Guter Hund. Hierher.« Er spricht ruhig, hebt nicht einmal die Stimme.
Es geschieht nichts. Der Hund steht weiter da, zur Menge gerichtet, den Kopf kampfbereit gesenkt. Hinter dem Sarg wartet die Trauergemeinde in stummem Vorwurf. »Braver Felix«, wiederholt Berndorf.
Der Hund rührt sich nicht. Aber der Stummelschwanz bewegt sich leise und schlägt dann aus, ein-, zweimal.
»Hier!«, sagt Berndorf. »Es ist gut. Wir gehen jetzt.«
Die Zeit löst sich von den Brillengläsern des Pfarrers und geht wieder ihren Gang, Felix wendet sich zögernd von der Menge ab und nähert sich Berndorf, widerstrebend, fast scheu, ohne hochzusehen.
»Braver Felix«, sagt Berndorf und dreht sich um. Als er durch das Friedhofstor geht, läuft Felix gebückt neben ihm her, aber der gesträubte Streifen Fell auf seinem Rücken ist schon nicht mehr ganz so hoch aufgerichtet.
»Ich kann Hunde nicht leiden«, sagt der Lokalredakteur Frentzel und blickt von seinem Bildschirm zu Hollerbach hoch. »Überhaupt ist das keine lustige Geschichte. Absolut nicht. Oder willst du, dass wir uns über Beerdigungen lustig machen? Was glaubst du, wie das werden wird, wenn wir dann beide in der Chefredaktion antanzen dürfen? Überhaupt nicht lustig wird das…«
»Chef«, sagt Hollerbach mit schmelzender Stimme, »Chef, du hast da was falsch verstanden …«
Frentzel nimmt seine Brille ab und reibt sich die rotgeäderten Augen. »Weißt du, wer hier heute Nachmittag auf der Matte gestanden hat? Da warst du noch beim Leichenschmaus und hast zugelangt, aber hallo! Und ich hatte den Bürgermeister von deinem Alb-Kaff in der Leitung, wir möchten doch…« Frentzel unterbricht sich und macht einen spitzen Mund. »Wir würden doch sicherlich diesen kleinen bedauerlichen Vorfall unerwähnt lassen…, das Andenken des Toten, nicht wahr, und die Gefühle der Pietät, und ich solle auch schön den Herrn Chefredakteur Dompfaff grüßen, man kenne sich von den Weikersheimer Schlossfestspielen …«
Hollerbach verzieht das Gesicht. »Vielleicht liegt der Fehler wirklich bei mir… Es soll ja auch keine lustige Geschichte sein, Chef. Eine rührende ist es.« Er erhebt seine Stimme. »Treuer Hund verteidigt seinen Herrn noch am Grab. Stell dir das doch mal in der Zeitung mit den großen Balken vor.«
»Untersteh dich«, sagt Frentzel, setzt seine Brille wieder auf und blickt Hollerbach strafend an. »Wenn ich diese Geschichte morgen sonstwo lese, sind wir geschiedene Leute.« »Aber Chef«, antwortet Hollerbach und breitet seine Hände aus, »von irgendwas muss unsereins doch auch leben…«
»Mir bricht das Herz«, unterbricht ihn Frentzel. »Weißt du, was den bedeutenden, den großen Journalisten ausmacht? Nein, Hollerbach, du weißt es nicht. Aber ich sag es dir. Der große Journalist weiß, wann er schweigen muss. Er kann nämlich etwas für sich behalten. Kann warten, bis die Zeit gekommen ist …«
»Chef«, sagt Hollerbach flehentlich, »kein Mensch will doch nächste Woche noch von einer Leich’ von heute lesen…«
»Aber das ist eben der Zeitgeist«, fährt Frentzel fort. »Die Leute haben keine Pietät mehr. Kein Gefühl für die Würde des Wortes, das ungeschrieben bleibt.« Er wendet sich wieder dem Bildschirm zu. »Was hast du vorhin gesagt? Treuer Hund verteidigt seinen Herrn noch am Grab? Für einen Zweispalter hab ich da noch Platz. 60 Zeilen. Kennwort Köter.« Er schaut auf die Uhr. »Du hast dich heute auf einer schönen Beerdigung durchfressen können. Ich aber nicht, und deshalb brauch ich jetzt was, was dem Vater aufs Fahrrad hilft. Bis ich zurückkomm’, hast du das blöde Vieh im Kasten .«
Vor Frentzel öffnet sich die Glastür auf den Platz mit dem Obelisken, den der Architekt des neuen »Tagblatt«-Gebäudes dort hatte errichten lassen. Es ist nur ein kleiner Obelisk, und fast nie verfängt sich ein Sonnenstrahl an seiner Spitze.
Aber Erleuchtung, denkt Frentzel, ist eine seltene Gabe Gottes. Wer wollte dem widersprechen, gerade beim »Tagblatt«? Er überquert die Straßenbahngleise und geht einen Block von Wohnhäusern entlang, die der Straße abwechselnd altersbraunen Backstein und schmutzig grauen Waschbeton zukehren. Nach dem Block weitet sich die Straße, Frentzel kommt am Landgericht vorbei und wirft einen wehmütigen Blick auf die Säulen und steinernen Löwen des Portals.
Noch immer ist die Schnauze des einen Löwen rot verschmiert. Wie viele Jahre schon? Mindestens seit dem Golfkrieg von Bush senior. Eigentlich lange genug her, dass man es hätte wegmachen können.
Er geht weiter, am Westportal des Justizgebäudes vorbei zu Tonios Café, und hängt sein Cape an einen der Garderobehaken. Dabei muss er erst einen Lodenmantel zur Seite schieben, der Lodenmantel sieht nach einem Messebesucher aus, denn derzeit findet im Ausstellungsgelände in der Au die SilvAqua statt, alles für den Jäger und Sportfischer. Noch ist es nicht spät am Nachmittag, die Aktentaschenträger sind noch nicht von ihren Büros ausgeschwärmt, Frentzel mag diese stille halbe Stunde. Am Tresen hockt das Paar, das dort schon immer hockt und Endstation Sehnsucht nachspielt, den Hüftspeck mit immer größerer Mühe in die Jeans gezwängt. Weiter hinten sitzt ein massiger Mensch, den Frentzel nicht kennt und der vermutlich zu dem ausladenden Lodenmantel gehört. An einem der Tischchen vorne lässt ein dunkelhaariger Mann die Zeitung sinken, in der er gelesen hat, und nickt Frentzel zu, es ist nicht ganz klar, ob er nur grüßen oder ihn an den Tisch einladen will.
Frentzel bleibt stehen und wirft einen Blick auf die Zeitung, bei der es sich nicht um das »Tagblatt« handelt, sondern um die »alternative zeitung«.
»Das können wir nicht billigen, Hochwürden«, bemerkt er streng.
»Um Vergebung«, antwortet Pfarrer Johannes Rübsam, »ich wusste nicht, dass Ihre Auflage Not leidend geworden ist. Aber wollen Sie sich nicht setzen?«
Frentzel zieht sich einen Hocker an den Tisch und setzt sich. Noch einmal wirft er einen Blick auf die aufgeschlagene Zeitungsseite. Ein großformatiges Foto zeigt Leichen, die von einem Panzer durch den Straßenstaub gezogen werden.
»Neues aus Afghanistan?«, fragt er. »Sind das die Guten, die wieder einmal siegen?«
»Nein«, antwortet Rübsam. »Das ist nicht Afghanistan. Ein Massaker in Katanga.«
Frentzel nickt der Bedienung zu. Maria heißt sie, weil alle Bedienungen bei Tonio so heißen. Außerdem ist sie neu, aber dass Frentzel um diese Zeit einen trockenen norditalienischen Weißen bekommt, gehört zu den ersten Dingen, die sie bei Tonio gelernt hat.
»Wer den tapferen Leuten den Panzer bezahlt hat, steht nicht in Ihrer Zeitung?«
»Irgendwelche Gnome«, meint Rübsam. »Gnome aus Zürich oder Manhattan. So genau wissen sie es auch nicht.«
»In diesen Tagen sollten Sie nicht von Gnomen reden.« Frentzel hebt die Hand. »Nicht von Gnomen in Manhattan. Bleiben Sie bei Ihrer Heimatzeitung. Hier spielt die Musik, hier bellt der Hund.«
Maria, das Weinglas auf dem Tablett, hat sich genähert und artig gewartet. Ihrem blassen, von langen schwarzen Haaren eingerahmten Gesicht ist weder Erstaunen noch Belustigung anzumerken. Nun stellt sie das hochstielige beschlagene Glas vor Frentzel ab. Er dankt und sieht ihr nach, wie sie zum Tresen zurückgeht.
Sie trägt einen schwarzen langen Rock, der zeigt, dass sie lange Beine hat und einen hübschen Hintern.
»Jetzt kann ich Ihnen nicht ganz folgen«, meint Rübsam.
Frentzel hebt die Hand. »Warten Sie es ab. Lesen Sie morgen unsere Zeitung. Alles über totgefahrene Füchse und losgerissene Hunde, unter besonderer Berücksichtung des kirchlichen Bestattungswesens. Katanga, dass ich nicht lache!«
Die Tür fliegt auf, mit einem Stoß frischer Luft weht herein eine auffallend große Frau, die ihr langes braunes Haar hoch gesteckt hat. Sie trägt Jeans und ein ausgebeultes graues Jackett in Fischgrätmuster. Grüßend nickt sie zu den beiden Männern und lehnt sich an den Tresen.
»Die Mordkommission«, sagt Frentzel. »Meine Verehrung! Sie haben nicht zufälligerweise eine Kleinigkeit übrig für einen ewig dankbaren Lokalredakteur? Eine unbedeutende Leiche vielleicht, oder ein wenig Brandstiftung?«
»Wenn Sie Ihrer Arbeit nachgehen würden«, antwortet die Besucherin, »hätten Sie jetzt durchaus etwas zu schreiben. Beispielsweise darüber, wie überarbeitete Polizisten mit sinnlosen, absurden und wichtigtuerischen Zeugenvorladungen zum Zweck der Prozessverschleppung behelligt werden.« Sie bestellt sich eine Latte Macchiato.
Frentzel sieht ihr zu, wie sie der neuen Bedienung zusieht und dem Hantieren der langen und zartgliedrigen Finger.
Dann nickt er betrübt. »Sie sehen mich als einen Verbannten. Als ein Opfer der Stiefelknechte.« Er wartet, aber dass das »Tagblatt« sich den Kaputtsanierer einer Schuhfabrik als Prokuristen ins Haus geholt hat, ist den Stammgästen schon etwas zu oft vorgetragen worden. »Ich betreue neuerdings die Seite ›Christ und Hund‹, um die Wahrheit zu sagen, ist das nicht schrecklich?«
Rübsam betrachtet ihn, dann holt er einen zusammengefalteten Zeitungsausschnitt aus seiner Brieftasche. »Ist das da auch Ihrem neuen Ressort entsprungen?«
Frentzel setzt seine Halbbrille auf und nimmt den Ausschnitt. »Ach das! Schöne Geschichte. Musik, weil mit Geräusch verbunden… Stuttgarter Theologin beschwert sich über Posaunenchor von der Alb, da ist doch alles drin. Zugereiste, aber fest besoldete Kirchenbeamtin vermiest ehrenamtlichen einheimischen Posaunenbläsern das Lob Gottes. Da wissen die Leute doch gleich wieder, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Hat Ihnen der Beitrag nicht gefallen?«
Rübsam sagt nichts, sondern winkt Maria zu sich her und bezahlt einen doppelten Espresso. Dann entschuldigt er sich, er müsse zu einer Sitzung.
»Eine Sitzung, nett«, sagt Frentzel. »Versuchen Sie wieder einmal, einen neuen Dekan zu wählen? Den letzten Kandidaten hatten Sie doch abgeschmettert. Hatte der nicht behauptet, die Erde sei eine Hohlkugel?«
»Nein, hat er nicht«, antwortet Rübsam missvergnügt.
»Gibt es denn diesmal weißen Rauch? Und könnten Sie mich das dann vielleicht gleich wissen lassen?«
»Sie werden lachen«, antwortet Rübsam. »Durch den Aufsatz über die Posaunenbläser sind verschiedene Dinge nicht unbedingt einfacher geworden. Aber ich will sehen, was ich für Sie tun kann.« Er verabschiedet sich und geht.
Weiter hinten bezahlt auch der Mensch, der zu dem Lodenmantel gehört, die Kommissarin Tamar Wegenast bekommt ihre Latte Macchiato, und als sie sie bekommt, schaut Frentzel noch einmal genau hin, aber es fällt ihm nichts daran auf, wie die Kommissarin die Maria ansieht. Wie soll sie sie schon anschauen, denkt er dann. Wie einen netten Menschen halt.
Wie es in der Bezirkssynode Brauch ist, beginnt auch die Sitzung des Wahlausschusses mit einer Andacht, die an diesem Abend Pfarrerin Schaich-Selblein hält. Sie spricht über das, was die Menschen seit dem Flugzeug-Anschlag von New York bewegt, über die Angst, dass diese Welt aus den Fugen geraten könnte, dass aber Frieden nicht mit Waffen, sondern nur durch das Gespräch geschaffen werde …
Vor seinen Augen hat Johannes Rübsam zum einen die gelblichen, vom Fliegendreck schwarz punktierten Kugellampen im Großen Saal des Evangelischen Gemeindehauses, ferner das leicht gerötete und entfernt an einen nicht mehr sehr jungen Cherub erinnernde Gesicht des Prälaten Wildenrath und schließlich die nächste Tischreihe, wo sich die Ausschussmitglieder der Frommen Gemeinde irgendwie von selbst um die Synodale Christa Fricke herum eingefunden haben.
Rübsams Gedanken schweifen und kreisen und machen unversehens fest an dem Busen der Pfarrerin Kollegin Schaich-Selblein sowie an ihren sehr langen, vorstehenden Zähnen, und so stellt er sich vor, die Kollegin sei in einem gottesfürchtigen Pietisten-Haushalt aufgewachsen und die vorstehenden Zähne dort als ein wertvolles Geschenk Gottes betrachtet worden, das die junge Tochter vor den Anfechtungen geschlechtlicher Gelüste bewahren werde.
Pfarrerin Schaich-Selblein hat indessen von Afghanistan übergeleitet zu den bisherigen Zusammenkünften des Ausschusses. Schon bisher habe man es sich nicht leicht gemacht, manch hartes Wort sei gefallen, vielleicht auch manche Verletzung zugefügt worden.
Rübsam ertappt sich bei dem Gedanken, dass sich – sollte er je in die Verlegenheit kommen – ein a tergo empfehlen würde, so dass die vorstehenden Zähne gar nicht weiter zu stören bräuchten… Um sich abzulenken, holt er den Zeitungsausschnitt aus seiner Brieftasche und liest ihn noch einmal.
Ehrenamtlichen Musikern schlecht gedankt
Von unserem Mitarbeiter Eugen Hollerbach
WINTERSINGEN • »Undank ist der Welt Lohn«, das hat Gottfried Buck schon immer gewusst. Aber in diesen Tagen muss Buck, Vorstand des Posaunenchors Wintersingen, besonders oft an diese alte Weisheit denken. Denn die Posaunenbläser, die seit Jahren an den Samstagen die Patienten der Universitätsklinik mit ihrem Spiel erfreuen und aufmuntern, sollen dort nicht mehr erwünscht sein. Eine aus Stuttgart angereiste Besucherin hat sich von dem Spiel der vielfach kirchenmusikalisch ausgezeichneten Wintersinger Posaunenbläser gestört gefühlt und sich jetzt sogar schriftlich beschwert.
»Bei unserem letzten Ständchen ist plötzlich eine Frau auf mich zugekommen und hat mich angefahren, ob wir nichts anderes spielen könnten«, berichtet Buck. »Ich war ganz sprachlos, denn wir sind ein kirchlicher Posaunenchor, sollen wir da vielleicht einen Rumba spielen?« Der Chor setzte dann sein Konzert fort, doch Tage später erhielt Buck einen Anruf vom Bezirkspräsidenten der Posaunenchöre, dass eine Beschwerde vorliege, weil das Spiel der Wintersinger Bläser einzelne Patienten »seelisch belaste«. Buck kann darüber nur den Kopf schütteln. Überhaupt kein Verständnis mehr aber hat er dafür, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine evangelische Religionslehrerin aus Stuttgart handelt. »Da sieht man doch«, sagt Buck, selbst Wintersinger Kirchengemeinderat, »wohin es mit der Kirche gekommen ist.«
Die Andacht kommt zu einem sinnträchtigen Schluss, denn Pfarrerin Schaich-Selblein bittet darum, dass das Vergangene nicht den Blick für die anstehende Aufgabe trüben möge. Rübsam blickt hoch und in die Augen des Prälaten Wildenrath. Der Prälat nickt Rübsam auf eine Weise zu, als wollte er sagen: Da haben wir die Bescherung!
Die haben wir allerdings, denkt Rübsam. Dem Wahlausschuss war bereits im Frühsommer ein erster Kandidat vorgeschlagen worden, ein Pfarrer aus einer Schwarzwaldgemeinde, der als Schützling des neuen pietistischen Landesbischofs ausgewiesen war. Bei seiner Vorstellung hatte sich herausgestellt, dass der Schwarzwaldpfarrer das Universum zwar nicht für eine Hohlkugel hielt, wohl aber der Ansicht war, es sei vor 7000 Jahren erschaffen worden, und zwar auf einen Sitz.
Nun ist man in Ulm sehr stolz auf einige kleine, aus Mammutzähnen geschnitzte Tier-Plastiken, die in den Trockentälern der Alb gefunden worden waren und die einige zehntausend Jahre alt sind. Da man entweder an die Radiokarbon-Methode glauben kann, mit der die Plastiken untersucht worden waren, oder aber an die Schwarzwälder Schöpfungsgeschichte, schloss sich die Mehrheit im Wahlausschuss dem Vorschlag Rübsams an, um einen neuen Kandidaten zu bitten, sehr zur Empörung der Frommen Gemeinde. Der Landeskirchenausschuss musste zähneknirschend sich von neuem umsehen und wurde schließlich in einer Problemgemeinde des Stuttgarter Ostens fündig, bei Dr. Guntram Hartlaub, einem Seelsorger, für den vor allem sprach, dass er sich bis dahin mit keinem der innerhalb der Landeskirche maßgeblichen Gesprächskreise angelegt hatte.
Fein gesponnen, denkt Rübsam. Leider hatte der Landeskirchenausschuss nicht bedacht, dass Dr. Hartlaub auch eine Frau hat, und Frauen gelegentlich dazu neigen, den Mund aufzumachen. Rübsam kennt das Ehepaar Hartlaub, wie man sich unter den Pfarrern und aus den Zeiten des Studiums so kennt, und so weiß er, dass die Stuttgarter Religionslehrerin, die sich mit den frommen Posaunisten angelegt hatte, Marielouise Hartlaub ist.
Und nicht nur er weiß das. Der Blick des Prälaten hat daran keinen Zweifel gelassen.
All mein Beginnen, Tun und Werk
Erfordert von Gott Kraft und Stärk’…
Zum Abschluss der Andacht wird gesungen, und da die Mitglieder des Ausschusses es gewohnt sind, ihren Gemeinden vorzusingen, gibt es einen kräftigen Klang.
»Sehr schöne, sehr angemessene Worte haben Sie da aufgesetzt«, sagt Wildenrath, und man kann zusehen, wie die Schaich-Selblein einen roten Kopf bekommt.
Was reitet den Prälaten, das einen Aufsatz zu nennen?, fragt sich Rübsam.
»Besonders gefallen hat mir Ihre Bemerkung über den Blick, den wir auf die künftigen Aufgaben richten sollten«, fährt Wildenrath fort, »ein Glück, dass hier niemand silberne Löffel gestohlen hat, meines Wissens jedenfalls nicht, man könnte es sonst falsch verstehen…«
»Nein«, sagt Rübsam und fasst den Prälaten ins Auge, »es hat hier niemand silberne Löffel gestohlen, und es gibt auch nichts falsch zu verstehen. Vielleicht aber könnten wir jetzt in die Tagesordnung eintreten?« Sein Blick richtet sich auf den Sparkassen-Weglein, der so heißt, weil er pensionierter Bankdirektor ist. Außerdem ist er der Vorsitzende der Bezirkssynode und stets bemüht, wie der Prälat einmal bemerkte, jedem Nadelöhr aus dem Weg zu gehen.
Weglein fährt erschrocken hoch und räuspert sich.
»Aber gewiss doch«, sagt Wildenrath, »die Tagesordnung, ei freilich! Sie haben ja zu wählen. Dass Ihnen diesmal nur keine Knochen dazwischenkommen, oder was sich sonst in der Vergangenheit so finden lässt…«
Er lächelt Rübsam an, freundlich und scheinbar ohne Arg.
Woran zündelst du jetzt schon wieder?, überlegt Rübsam, doch dann zuckt er zusammen, denn glasharfenzart dringt an sein Ohr die Stimme der Synodalen Christa Fricke. Sie findet, dass Pfarrerin Schaich-Selblein da eine sehr bewegende Andacht gehalten hat, und es gehe auch wirklich nicht darum, was in der Vergangenheit gewesen sei, aber man dürfe seine Augen auch nicht davor verschließen, welche Kränkungen gläubige Kirchenglieder in jüngster Zeit hätten erleiden müssen, »auch von einer Seite, von der sie es nicht hätten erwarten dürfen.«
Also doch, denkt Rübsam. Die Fromme Gemeinde will ihre Rache. »Ich nehme an«, sagt er und hält den zusammengefalteten Zeitungsausschnitt hoch, »Sie beziehen sich auf diesen Zeitungsartikel hier …« Und er beginnt, davon zu reden, dass man immer auch die andere Seite hören müsse, und dass nun wirklich nicht jeder Choral für jede Gelegenheit…
Während er redet, sieht er, wie Wildenrath unmerklich den Kopf schüttelt.
Tamar schlägt den langen braunen Mantel um sich und geht mit entschlossenen Schritten die Platzgasse hinauf. Es ist dunkel geworden, die Gasse öffnet sich auf den Münsterplatz, In dem weiß schimmernden runden Steinbau des Stadthauses leuchten die großen Fenster wie Transparente. Tamar hat kein Auge dafür, und auch nicht für das Münster, dessen Turm sich oben in der Dunkelheit verliert. An diesem Abend ist sie als Schichtführerin für den Bereitschaftsdienst eingeteilt, aus Erfahrung weiß sie, dass es mit dem Aufarbeiten der unerledigten Berichte doch nichts wird, und so hat sie sich einen der Ripley-Romane der Patricia Highsmith eingesteckt…
Auch so wird die Nacht lang genug werden. Sie verscheucht den Gedanken, wie es sein wird, wenn sie nach Hause kommt, ins Bett, zum weichen atmenden Körper der schlaftrunkenen Hannah, der Gedanke will sich nicht verscheuchen lassen, und so bleibt sie zur Ablenkung vor einem Plakat des »Tagblatts« stehen, das zu einer Diskussion mit einem eierköpfigen brillengesichtigen Menschen einlädt, auf dessen Gesichtszügen sich der Ausdruck einer habituellen Besserwisserei eingenistet hat.
Kein Wort würd’ ich dir glauben.
Anderes geht ihr durch den Kopf. Sie will nicht daran denken. Aber die Gedanken sind frei. Sie malen ein Bild, ein Gesicht, schwarz eingerahmt, um den Mund ein Zug von verborgener insgeheimer Aufsässigkeit.
Schnüss.
Berndorf hat einen Hund, der in die Landredaktion zwangsversetzte Gerichtsreporter Frentzel hat es ihr erzählt. Drollig? Eigentlich hätte auch sie zur Beerdigung gehen wollen, wäre da nicht diese Zeugenladung gewesen. Wieso eigentlich? Der Prophet war ein bigotter alter Mann.
Trotzdem.
Sie geht über den kopfsteingepflasterten Innenhof des Neuen Baus und passiert das Portal. Aus der aquariumsgläsernen Wache grüßt der Polizeihauptmeister Leissle, Orrie ist also in der gleichen Schicht, das ist schön, irgendwann wird sie einen Becher Kaffee mit ihm trinken. Besondere Vorkommnisse? »Nöh«, meint Orrie, »im Stadthaus redet ein Politiker, Englin ist drüben und was sonst verfügbar ist, außerdem hat der Mensch seinen eigenen Personenschutz mitgebracht, eigentlich kein schlechter Job, sollt’ ich mich auch mal drum bewerben…«
»Was glaubst du, was deine Frau dir dann erzählt.«
Tamar geht die Treppe hoch, vorbei an den gerahmten Schwarzweißfotos alter Ulmer Schutzpolizisten, Tschako auf dem Kopf, scharfgesichtig. Kein Foto zeigt, was alte Ulmer Schutzpolizisten in den Einsatzgruppen gemacht haben, im Baltikum oder sonst im Russlandkrieg.
In ihrem Büro knipst sie als Erstes die Stehlampe auf ihrem Schreibtisch an und löscht die Deckenlampe. Sie hängt ihren Mantel auf, zieht den Schreibtischstuhl hervor, setzt sich und legt die Füße auf den Schreibtisch.
So, haben wir jetzt alle Klischees beisammen über eine Polizistin im Nachtdienst? Nein, denkt sie, etwas fehlt noch, und sie holt das Taschenbuch aus ihrer ausgebeulten Jackentasche und schlägt es auf: »Es gibt keinen perfekten Mord«, sagte Tom abschließend zu Reeves …«
Die Herrentoilette riecht wie der Abtritt in einem alten Schulhaus. »Man legt sich nicht mit den Posaunenbläsern an«, sagt Prälat Wildenrath, der neben Rübsam steht. »Niemand darf das. Niemals. Die Posaunenchöre wird es noch geben, wenn es schon lange keine Volkskirche mehr gibt.«
»Wir wählen hier aber immer noch einen Dekan«, wendet Rübsam ein, »und nicht die Ehefrau. Was hier stattfindet, kommt mir nachgerade vor wie Sippenhaft.«
»Es wäre nicht die erste Wahl, bei der nicht der Mann, sondern die Ehefrau durchfällt«, widerspricht der Prälat. »Jedenfalls ist Hartlaub, wenn Sie so weitermachen, aus dem Spiel und wir kriegen womöglich noch den weinenden Scheuermann. Wollen Sie das verantworten?«
Theodor Scheuermann, ein Stadtpfarrer im Oberschwäbischen, der jederzeit und wie auf Wunsch in Tränen ausbrechen kann, lauert seit Jahren auf ein vakantes Dekanat.
»Ich glaube ja auch, dass es schief geht«, meint Rübsam und knöpft sich den Hosenladen zu. »Aber ich weiß nicht, wie man es noch retten kann.«
»Sie haben vorhin von Sippenhaft gesprochen«, antwortet der Prälat. »Ein großes Wort. Aber warum nicht? Spielen wir doch ein bisschen damit. Sippenhaft mag niemand. Aber wir müssen es über die Bande spielen. Darauf versteht sich die Fricke nicht. Überhaupt können Frauen das nicht. Es hat mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen zu tun.«
»Das alles ist mir ein wenig dunkel«, sagt Rübsam abweisend. Verschwörerisch sieht sich Wildenrath um, ob sie auch allein sind. »Sie sollten«, fährt er dann fort, »nach seinem Vater fragen. Nach dem alten Wilhelm Hartlaub. War Pfarrer hier im Bezirk, und für ein paar Wochen einer meiner Vorgänger, ein Deutscher Christ, wie er im Völkischen Beobachter stand… Sie brauchen bloß danach zu fragen, ganz freundlich, das reicht schon, und der Streit mit den Posaunisten ist vergessen, nicht mehr sie sind es, die in Schutz genommen werden müssen, sondern unser Kandidat, er ist die arme Sau, oder wenigstens sein toter Vater …«
»So etwas mach ich nicht«, erklärt Rübsam entschieden.
Wildenrath zieht mit beiden Händen an der Handtuchrolle, aber es kommt kein frisches Tuch mehr. »Sie Unschuldsengel!« , sagt er und trocknet sich die Hände missmutig am gebrauchten Leinen. »Wir haben hier eine Personalentscheidung, da geht es um Biographien, um Schicksale. Was wissen denn Sie, was da alles ausgegraben werden kann, worüber besser Gras wächst… Warum also nicht selbst ein bisschen Gras abrupfen, damit die Kamele sagen können, mit diesem alten braunen Heu soll man ihnen aber bitte vom Leib bleiben. Wenn Sie aber lieber die Tränen unseres Amtsbruders Scheuermann ertragen wollen…« Er horcht auf. Aus dem Sitzungssaal dringen wütende Proteste.
Rübsam geht zur Eingangstür des Sitzungssaals. Mehrere der Synodalen sind aufgesprungen und starren empört auf einen Mann, der am Kopfende der linken Tischreihe steht. Der Mann trägt Jeans, hat das graue Haar zu einem Zopf geflochten und versucht etwas zu sagen.
»Schweigen Sie«, ruft von der rechten Reihe ein hoch gewachsener Mann mit beschwörender Stimme und richtet einen anklagenden Zeigefinger auf den Mann mit dem Zopf, »schweigen Sie von diesen Dingen! Was wissen wir denn, wer Ihr Vater gewesen ist und was er getan hat in Zeiten, von denen auch Sie nicht wirklich wissen, wie sie gewesen sind …« »Keine Ahnung hat er!«, ruft eine andere Stimme dazwischen. »Jawohl, keine Ahnung!«, echot ein ganzer Chor. Mit einer eckigen Bewegung schüttelt sich der Hochgewachsene die geföhnten weißen Haare zurecht, die ihm in die Stirn gefallen sind, und hebt die Hand, um die Zwischenrufer zum Schweigen zu bringen.
»Niemand«, sagt er dann, »niemand soll unter dieser Asche nach Glut suchen, um sein Süppchen darauf zu kochen…« Der Prälat ist neben Rübsam getreten.
»Na also«, sagt er und betrachtet Rübsam spöttisch. »Lieben und Hassen hat seine Zeit. Irgendeiner musste ja davon anfangen …«
Die Schicht beginnt ruhig. Zwei Auffahrunfälle, ein betrunkener Freier im »Alten Württemberger«, ein verdächtig Unbekannter im Villenviertel auf dem Kuhberg, Orrie schaltet den kleinen transportablen Fernseher ein und will Fußball gucken, aber dann ruft seine Frau an und sagt, dass sie nach dem Volleyball noch zum Weiberstammtisch geht. Orrie verzieht ein wenig das Gesicht und meint, dass es recht sei.
Die Bayern führen, das müsste auch nicht sein, dann quäkt das Funktelefon, und Orrie dimmt den Lautsprecher des Fernsehers herunter, zum Glück, denn der Anrufer ist Kriminalrat Englin und er ist sehr erregt. Im Stadthaus ist Gefahr im Verzuge, die Punker stören gerade den Herrn Referenten, einen wahrhaftigen Staatssekretär, was macht denn das in Berlin für einen Eindruck! Tamar sagt, dass Orrie die eine Streife hinüberschicken soll, die gerade noch verfügbar ist… Zeit vergeht, die Bayern führen noch immer und die Streife bringt die Störer aus dem Stadthaus, das heißt, es sind der Stächele Frieder und eine Punkerin. Die Punkerin ist aus Düren /Westfalen und wegen Unterhaltspflichtverletzung und Beischlafdiebstahls zur Festnahme ausgeschrieben, was dann alles doch recht unangenehm wird, denn der Stächele Frieder hält eine längere Rede, die vom Krieg ums Öl handelt und von den Lügen der Politiker, vom Übermut der Behörden unter besonderer Berücksichtigung der Bosheit und Heimtücke kommunaler Jugendämter, von den Verbrechen an den Ländern der Dritten Welt ganz zu schweigen…
Orrie denkt, dass er sich das eigentlich nicht anhören will, aber Tamar macht unverändert ein höfliches Gesicht. Die Punkerin hat violette Haare und ist gelb um die Augen und kichert, wenn man es am wenigsten erwartet, und schnieft die Nase hoch und kichert wieder.
»…das da zum Beispiel«, sagt Stächele und holt eine zusammengefaltete Zeitungsseite hervor, »das zum Beispiel interessiert euch einen feuchten Kehricht, warum geht ihr denn nicht hin und fragt euren Herrn Staatssekretär: Wollen Sie uns vielleicht gütigst eine Aussage machen, Herr Staatssekretär, wo diese famosen Panzer herkommen, mit denen sie die armen Neger massakrieren, also die Eingeborenen, ich will ja nix Falsches sagen…«
Er faltet die Zeitungsseite auseinander, und Orrie sieht ein Foto mit Strohhütten und einem Panzer, und an dem Panzer sind die Überreste von etwas angebunden, was einmal menschliche Körper waren.
Die Punkerin sagt, dass ihr übel ist. »Aber nix«, fährt Stächele fort, »Herr Staatssekretär hinten, und Herr Staatssekretär vorne! Nur keine Aussage nicht…«
»Herr Stächele«, sagt Tamar sanft, »ich kann Sie gut verstehen. Aber vielleicht ist es doch besser, wenn wir Ihre Freundin jetzt erst einmal zu einem Arzt bringen, damit er sie sich ansieht, und dann schauen wir mal, wie sie ihre Angelegenheiten mit dem Jugendamt in Ordnung bringen kann …«
Irgendwann ist die Punkerin fürs Erste in der Frauenklinik untergebracht, weil das Mädchen schon wieder schwanger ist, und der Stächele Frieder nach Feststellung seiner Personalien in die Nacht entlassen. Orrie kann einen Kaffee kochen und schaltet, weil sich an der Führung der Bayern nichts geändert hat, die Harald-Schmidt-Show ein. Tamar setzt sich dazu, und Orrie ruft lieber nicht zu Hause an, weil der Weiberstammtisch möglicherweise noch immer nicht zu Ende ist. Eigentlich könnte die Schicht jetzt ganz ruhig und gemütlich zu Ende gehen, aber dann läuft ein Notruf ein, in Lauternbürg, irgendwo da draußen zwischen Alb und Donau und Pfuiteufel brennt ein Haus, gleich darauf kommen ein zweiter und ein dritter Anruf, irgendjemand fordert den Notarzt an, und dann meldet sich die Feuerwehr, sie hätten eine Person geborgen, aber den Notarzt bräuchten sie wohl doch nicht mehr, »der ist schon gut durch…«
Aber wie Orrie das weitergibt, ist die Kommissarin Tamar Wegenast schon draußen vor der Tür und auf der Bundesstraße 311 unterwegs nach Pfuiteufel.
Scheinwerfer beleuchten geschwärztes Mauerwerk. Angekohlte Dachsparren zeigen zu den Wolken, die in rascher Folge nach Osten ziehen. In der Luft hängt der giftige geschmorte Geruch nach kokelndem Schutt. Am Mauerwerk lehnt eine Leiter.
»Wir haben ihn oben gefunden«, sagt der Mann mit dem unterm Helm rußverschmierten Gesicht. Es ist ein schmales, von einem Bart eingerahmtes Gesicht.
Tamar betrachtet, was von dem Haus übrig ist. Es war eines der Häuser, wie sie sich einstöckig und spitzgieblig in Reih und Glied die Straße hinabziehen, kurz nach dem Krieg gebaut oder in den frühen 50er-Jahren. Wie eine dunkle Wand erhebt sich dahinter der Wald. Sie zwingt sich, wieder auf das hinabzusehen, was schwärzlich und irgendwie aufgeplatzt vor ihr auf einer Trage liegt, außerhalb des Lichtkegels der Scheinwerfer. Das Feuer hat die Gesichtshaut zusammenschnurren lassen, so dass das Gebiss freigelegt ist und zum Nachthimmel bleckt.
»Die Nachbarn hatten uns gesagt, dass er noch im Haus sein muss«, fährt der Mann fort. »Da haben wir ihn dann auf der Treppe gefunden.« Der Mann ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lauternbürg. Neuböckh, Landmaschinentechniker, hat Tamar notiert.
»Er hat hier gewohnt?«
Neuböckh schaltet seine Taschenlampe ein. Ein Lichtstrahl wandert über angekohltes Fleisch, verharrt auf dem Gesicht mit dem bleckenden Gebiss.
»Ich denk schon.« Er löscht das Licht.
»Allein?«
»Seit seine Mutter vor ein paar Jahren gestorben ist.«
»Und was hat er gemacht?«
»Er hat für die Zeitung geschrieben«. Neuböckh schiebt mit dem Fuß ein angekohltes Stück Papier weg. »Fürs ›Tagblatt‹. Darüber, was hier in den Dörfern so passiert. Und in den Vereinen. Gelernt hat er als Schriftsetzer, beim Übelhack in Ehingen. Aber dann ist er arbeitslos geworden.«
Ein Zeitungsschreiber. Jetzt weiß Tamar auch, woher sie den Namen kennt: Hollerbach, Eugen. Ihre Erinnerung kramt ein Gesicht hervor, Mundgeruch, aufdringliche Fragen, flinke hurtige Augen.
Mittwoch, 7. November 2001
Auf dem Münsterplatz ist Wochenmarkt, es riecht nach Kräutern und erdigen Kartoffeln und Kisten voll Obst, Tamar schiebt sich an Einkaufstaschen und Körben und Netzen vorbei und strebt zur Platzgasse, denn es ist später Vormittag und sie braucht einen Kaffee und ein Sandwich. Sie fühlt sich nicht beschwingt, aber doch merkwürdig leicht, als ob die Dinge und die Welt um sie herum kein Gewicht hätten, das kommt, weil ihr von den sieben Stunden Schlaf, die sie haben sollte, ziemlich genau sechs fehlen.
Über Mittag will sie nicht nach Hause fahren. Denn wenn sie sich hinlegt, kommt sie so schnell nicht mehr hoch. Außerdem ist Hannah in München, bei dieser Galeristin, die eine Ausstellung mit ihr vorbereitet.
Hannah fährt in letzter Zeit oft nach München.
In dem engen Schlauch von Tonios Café drängt sich die Kundschaft vor dem Tresen. Aber ein Tischchen ist noch frei. Nebenan sitzt der Zweirad-Schnäutz mit seinem Rauhhaardackel und lauert darauf, wem er ein Gespräch aufhängen kann.
Nicht mir.
Tamar sitzt kaum, als auch schon Maria vor ihr steht. Sie lächelt höflich und wohlerzogen und ganz und gar nicht aufsässig und nimmt die Bestellung entgegen. Bis der Kaffee und das Salami-Sandwich kommen, greift sich Tamar das »Tagblatt«. Von der Titelseite des Lokalen reckt sich ihr der Staatssekretär von gestern Abend entgegen…
»Wir wissen doch alle, dass die weltwirtschaftliche Stabilität und Sicherheit von dieser Region sehr stark beeinflusst werden kann, in der 70 Prozent der Erdölreserven des Globus und 40 Prozent der Erdgasreserven liegen…«
Tamar blättert weiter, die SilvAqua meldet Rekordzuspruch, der evangelische Kirchenbezirk Ulm hat einen neuen Dekan, Blocher vom Rauschgiftdezernat und eine dicke Schlagzeile, weil er auf dem Eselsberg einen ganzen Wintergarten voller Hanfpflanzen ausgegraben hat. Nur von dem Brand in Lauternbürg und dem toten Hollerbach steht nichts drin. Eine Überschrift springt ihr ins Auge:
Treuer Hund verteidigt seinen Herrn noch am Grab
»Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt«, teilt vom Nebentisch der Zweirad-Schnäutz mit. »Da soll noch einer sagen, die Tiere hätten keine Seele.« Er wendet sich seinem Hund zu. »Gell Purzel?« Purzel blickt gelb.
»Ihrem Sarg«, bemerkt Tamar, »wird dieses Tier nur folgen, wenn es glaubt, es sei eine Bratwurst darin.«
Schnäutz sucht entrüstet nach einer Widerrede, aber Tamar hebt nur die Hand und schneidet ihm mit einer brüsken Geste das Wort ab. Ihre Augen sind an einer Autorenzeile hängen geblieben:
Von unserem Mitarbeiter Eugen Hollerbach
Wieder sieht sie die Trage vor sich und riecht den Brandgeruch, und als sie zu lesen versucht, ist es ihr, als flüstere ihr Hollerbachs verkohlter Mund den Text ins Ohr.
Wirklich, zu wenig Schlaf.
Am Eingang zu Tonios Café gibt es Bewegung. Ein Mann hat die Tür aufgestoßen und hält sie offen, um einen großen, gelben grobknochigen Hund hereinzulassen, den er an der Leine führt. Plötzlich ist sehr viel freier Platz um ihn herum. Am Nebentisch bricht Purzel in schrilles Gekläff aus. »Bleiben S’ mit dem Köter da fort«, zetert Zweirad-Schnäutz und nimmt seinen Dackel auf den Arm. Der Mann setzt sich an Tamars Tisch, an der Seite, die dem Schnäutz abgewandt ist. Sein Boxer äugt kurz und eher gleichgültig zu dem Dackel am Nebentisch hinüber und lässt sich aufschnaufend zu den Füßen seines Herrn nieder. Der Durchgang zwischen den Tischreihen und dem Tresen freilich ist jetzt noch enger geworden, und Maria muss vorsichtig über das Tier hinwegsteigen, als sie Tamars spätes Frühstück bringt.
»Sie erlauben doch«, sagt Berndorf. »Felix kennen Sie ja.«
»Was um Gottes Willen«, sagt Johannes Rübsam und hängt seinen Mantel und seine Baskenmütze in den Kleiderschrank, »treiben Sie da?«
Mit gerötetem Gesicht blickt die Pfarramtssekretärin Kuchenbeck von ihrem Schreibtisch auf, der mit einem großen Heftordner und mehreren Stapeln dünn bedruckter, DIN-A5-großer Blätter zugedeckt ist.
»Ich wollt’ das einordnen, bevor Sie kommen«, sagt sie mit kläglicher Stimme, »das ist doch wichtig, und dabei wollen Sie nie etwas davon wissen…«
Die Verordnungen und Gesetze der Landeskirche sind für den Dienstgebrauch in einem blauen Handordner zusammengefasst, einer etwa 2000 Seiten umfassenden Loseblattsammlung, die ständig ergänzt wird. So wurden in den letzten Jahren sämtliche Texte im Sinne einer geschlechtsspezifisch korrekten Schreibweise überarbeitet und mussten Blatt für Blatt ausgetauscht werden.
»Worum geht es denn diesmal?«, fragt Rübsam und tritt an den Tisch heran. »Vielleicht um die korrekte Schreibweise bei der Instandhaltung der Orgelpfeifinnen und -pfeifen?«
Er nimmt einen der Stapel auf und beginnt zu lesen.
»Die Blickle hat angerufen, dass sie beim Altennachmittag morgen nicht spielen kann. Und dann kam noch ein Anruf.« Die Kuchenbeck senkt verschwörerisch die Stimme. »Ein Anruf vom Herrn Pfarrer Hartlaub. Er wollte Sie persönlich sprechen. Das ist doch unser neuer Dekan? Der mit der eigenartigen Frau …«
»Ich hab’s«, antwortet Rübsam. »Sie haben die Preise geändert. Wer was verdienen darf. Reisespesen und Tagessätze. Und was etwas kosten darf. Das alles wird jetzt nicht mehr in Mark, sondern in Euro angegeben. Wenn ich meine Wohnung tapezieren sollte, wovor Gott mich schützen möge, darf ich acht Euro für die Rolle ausgeben. Inklusive Mehrwertsteuer. Keinen Cent mehr. Steht hier.« Er deutet auf eines der Dünndruckblätter. »Sie sehen, unsere Kirche ist in guten Händen. Nichts bleibt, was nicht sorgsam bedacht worden wäre.« Er wendet sich zur Tür, die zu seinem Amtszimmer führt. »Wegen des Altennachmittags rufen Sie doch diese Musikstudentin an, die spielt sowieso viel seelenvoller.«
Während er in sein Zimmer geht, spürt er den Blick der Kuchenbeck in seinem Rücken. Das war gerade ein Fehler, denkt er. Ganz genau weiß die, dass ich genau weiß, wie die Studentin heißt.
Er setzt sich an seinen Schreibtisch und greift nach dem Telefon und lässt die Hand wieder sinken. Es ist klar, warum Hartlaub angerufen hat. Die Sitzungen des Wahlausschusses sind geheim. Aber trotzdem wird er wissen wollen, ob und wie viel Gegenstimmen es gegeben hat.
Eigentlich ein unsittliches Ansinnen. Schließlich ist er mein künftiger Chef. Er dürfte mir das nicht zumuten.
Aber es ist Hartlaubs Problem, wenn er jetzt schon Nerven zeigt. Rübsam zieht das Telefon zu sich her, Hartlaub meldet sich, kaum dass die Verbindung hergestellt ist.
»Danke, dass du zurückrufst …«
Hartlaub und Rübsam haben zu gleicher Zeit in Tübingen studiert, saßen beide morgens um acht Uhr beim eruptiven Michel und ließen sich die judaistischen Feinheiten der synoptischen Tradition ins Ohr brüllen. So etwas verbindet. Es wäre albern, würden sie sich nicht duzen.
»Ich bin vorhin vom Oberkirchenrat in Kenntnis gesetzt worden«, sagt Hartlaub, »dass ich jetzt doch nach Ulm gehen soll. Und das hat mich nun ein bisschen umgeworfen… Nach diesem dummen Zeitungsartikel konnten wir nicht mehr damit rechnen, verstehst du? Und ich weiß auch gar nicht, ob ich Marielouise das alles zumuten kann…«
Rübsam ertappt sich dabei, dass er den Hörer ein Stück weit von seinem Ohr entfernt hält. Die Stimme klingt ihm zu nah und zu vertraulich.
»Du weißt ja, wie Marielouise ist«, fährt die Stimme fort, und Rübsam überlegt, ob er das wirklich weiß.
»Sind die Anwürfe wegen dieses Posaunenchors denn nicht zur Sprache gekommen?« Die Stimme wird fast drängend. »Natürlich weiß ich, dass die Aussprache im Wahlausschuss vertraulich bleiben muss. Aber ich kann nicht nach Ulm gehen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wer da alles mit dem Dolch im Gesangbuch herumläuft…«
»Mit solchen Leuten musst du immer rechnen«, antwortet Rübsam. »Überall. Aber immerhin kann ich dir sagen, dass Marielouises Ärger mit den Posaunisten zur Sprache gekommen ist. Nur, und das musst du mir jetzt einfach glauben, dieser Ärger hat dann keine Rolle mehr gespielt. Und das Wahlergebnis ist so, dass du dich nicht beklagen kannst. Alles andere muss jetzt deine Entscheidung sein.«
Mehr sag ich dir nicht.
»Ich verstehe dich«, sagt die Stimme. »Und mit meiner Bewerbung habe ich mich eigentlich ja schon entschieden. Einen Rückzieher würde der Oberkirchenrat nicht verstehen… Hättest du denn am Nachmittag etwas Zeit für uns? Marielouise und ich würden uns gerne die Stadt etwas genauer ansehen, die Dienstwohnung vor allem. Wir müssten auch wissen, an welcher Schule wir Pascal anmelden sollen.«
Rübsam sagt, dass er sich den Nachmittag freinehmen kann. Erleichtert legt er auf.
»Tut mir Leid, dass ich nicht zur Beerdigung kommen konnte.«
Berndorf schüttelt unmerklich den Kopf. Soll er jetzt sagen, der Prophet werde es ihr nicht übel genommen haben? Sie gehen unter den hohen Bäumen des Ulmer Alten Friedhofs. Tamar hatte im Café gesagt, sie brauche ein paar Atemzüge frischer Luft, und so waren sie hierher gegangen, aber offenbar gibt jetzt der Ort das Thema vor. Berndorf bleibt neben dem Grabmal eines Ulmer Kommerzienrats stehen, dem der saure Regen tiefe Tränenrinnen ins Gesicht gegraben hat, und blickt auf den Hund.
Seit gestern trottet dieses Tier neben ihm her, in unerklärlichem Vertrauen darauf, dass Berndorf es zu seinem Herrn führen wird, frisst achtlos, gleichgültig einen halben Teller von dem feinen proteinreichen Diensthundefressi, das der Hundeführer der Ulmer Polizei gestern Abend noch vorbeigebracht hat, schläft im Flur vor der Wohnungstür, damit ihn nur ja niemand übersieht oder vergisst, wenn es wieder nach Wieshülen geht zu Jonas Seiffert, damit die Welt wieder sein wird, wie es sich gehört.
Aber in dieser Welt bleibt nichts, wie es sich gehört.
Berndorf überlegt, ob er Felix von der Leine lassen kann. Ob der Hund dann womöglich, wie von einer unsichtbaren Leine gezogen, den Weg nach Wieshülen einschlägt, unaufhaltsam trottend über die Straßen und den Autobahnzubringer und die Dörfer und Weiler… Ach was, denkt er, ich kann ihn nicht die ganze Zeit herumzerren – und er mich –, und macht die Leine los.
Aber Felix rennt nicht weg, sondern läuft zum Grabmal des Kommerzienrats und hebt sein Bein.
»Sie haben in Wieshülen diesen Reporter getroffen? Hollerbach heißt er.«
»Ja, hab ich.« Warum willst du das wissen?
Felix hat auf den von Rasen bedeckten Gräberfeldern des Alten Friedhofs einen Schwarm Saatkrähen entdeckt und sich unversehens in rumpelnde Bewegung gesetzt. Aufflatternd retten sich die Krähen und suchen Zuflucht im Geäst der hohen, dünn belaubten Bäume. Auslaufend schlägt Felix einen Bogen und trottet zu Berndorf zurück.
Hollerbach, ja. Berndorf wirft von der Seite einen Blick auf seine Begleiterin.
Im Tageslicht sieht Tamar blass und müde aus, überrascht bemerkt er Fältchen in den Augenwinkeln, zum ersten Mal sieht er das an ihr.
Falls du mich nach diesem Artikel fragen willst: den hab ich auch schon gelesen. Frentzel wird es mir büßen.
»Die Feuerwehr hat Hollerbach heute Nacht aus seiner Wohnung geholt.«
»Das ist brav«, sagt Berndorf. »Brave Feuerwehrleute.« Red nicht so mit ihr wie mit diesem Hund. Aber was soll er schon sagen? Wenn das Dezernat I sich nach Hollerbach erkundigt, spricht das nicht für den Zustand, in welchem ihn die Feuerwehr abgeliefert hat.
»Zum Glück war noch so viel an ihm dran, dass sie ihn identifizieren konnten.«
Du sollst keine Gedanken lesen. Berndorf bleibt stehen und betrachtet Tamar.
Sie hat wirklich erste Fältchen. Wo war Hollerbach zu Hause? Sie wird es dir erzählen.
»Hollerbach hat in Lauternbürg gelebt, in einem Häuschen, das er von seiner Mutter geerbt hat.«
In Lauternbürg. Hinter den Lutherischen Bergen. Wo die Äcker so steinig sind wie die Herzen fromm. Oder war das umgekehrt?
»Hollerbach kam gegen Mitternacht aus dem ›Dorfkrug‹. Bezahlt hat er vier Weizen und zwei Dujardin.«
Ein solcher Mundgeruch will gepflegt sein.
»Im Brandschutt haben wir einen alten Elektroofen gefunden. So ein Ding mit Glühdrähten.«