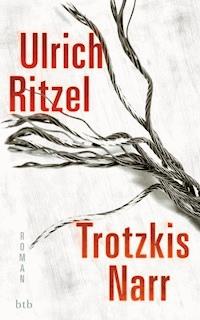Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
In den Bergen ist Schnee gefallen
Copyright
Buch
Der Mann, der sich im »IC Alpenland« um Kopf und Kragen redet und eingeholt wird von einer alten Schuld. Die reizende Schwiegermutter, die anhebt, ihren Sohn zu verteidigen, und fast wider Willen ein grässliches Geheimnis offenbart. Der von der Vergangenheit eingeholte Inhaber der Pension »Halders Ruh«, einst Dienststellenleiter im Jugendamt und Liebhaber von Modelleisenbahnen. Sie alle tragen Geheimnisse in sich, die sie lieber verdrängen und über die sie schließlich stolpern.
Ulrich Ritzels Erzählungen sind wie kleine Krimis, die noch lange nachwirken, nachdem man sie zu Ende gelesen hat.
Es sind sieben Geschichten, die um das Abgründige im Menschen kreisen, um die verheerenden Auswirkungen von moralisch problematischen Entscheidungen im Leben, die Beziehungen vergiften und Lebensentwürfe verfärben. Ritzel hat die Gabe, in kleinen Momentaufnahmen den Blick auf ein ganzes Leben zu werfen.
Autor
Ulrich Ritzel, Jahrgang 1940, geboren in Pforzheim, verbrachte Kindheit und Jugend auf der Schwäbischen Alb und lebt heute abwechselnd in Ulm und am Bodensee. Er studierte Jura in Tübingen, Berlin und Heidelberg. Danach schrieb er für verschiedene Zeitungen und wurde 1981 mit dem renommierten Wächter-Preis ausgezeichnet. Nach 35 Jahren Journalismus, in deren Verlauf er auch viele Gerichtsreportagen verfasste, hatte er genug. In wenigen Wochen entstand sein Erstling »Der Schatten des Schwans«, der bei seinem Erscheinen zum Überraschungserfolg wurde und seinen Autor zu einem gefeierten Hoffnungsträger des deutschsprachigen Kriminalromans machte. 2001 bekam er für »Schwemmholz« den Deutschen Krimipreis verliehen.
Ulrich Ritzel bei btb
Der Schatten des Schwans. Roman (72800)
Schwemmholz. Roman (72801)
Die schwarzen Ränder der Glut. Roman (73010)
Der Hund des Propheten. Roman (73256)
Uferwald. Roman (75144)
In den Bergen ist Schnee gefallen
Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Erinnern Sie sich? Das war, in den siebziger Jahren, ein Werbespruch der Deutschen Bahn. Seit die schlecht gewarteten Loks schon stehen bleiben, wenn ihnen der Novemberwind ins Getriebe fährt, sind es die Fahrgäste, die davon zu reden haben. Ich zum Beispiel nehme nur äußerst ungern einen Auftrag an, bei dem ich die Bahn benutzen muss. Sie ist nicht berechenbar, und in meinem Gewerbe kann man das nicht brauchen. Obwohl...
Der ICE »Alpenland« war bereits in Hamburg mit Verspätung abgefahren, und über die Norddeutsche Tiefebene hatte sich Dunkelheit gesenkt, als wir Hannover verließen. In Hamburg war noch Regen gefallen, jetzt musste ich nur mit dem Gesicht nahe genug ans Fenster gehen und die Augen abschirmen, um zu sehen, wie der Schnee wirbelnd am Zug vorbeitrieb. Ich war in den Speisewagen gegangen und hatte - im Bordrestaurant war eine österreichische Woche angekündigt - einen Tafelspitz bestellt. Als ich mich zurücklehnte und die Neue Zürcher aufschlug, die ich mir im Hamburger Bahnhof gekauft hatte, betrat ein mittelgroßer weißhaariger Herr den Speisewagen und blickte suchend über die voll besetzten Tische. Schließlich kam er auf mich zu und fragte, ob der Platz mir gegenüber noch frei sei.
Ich habe Professor Gerald Pracke sofort erkannt. Was kein Wunder ist. Wenn er Ihnen aus der politisch-zeitgeschichtlichen Literatur kein Begriff sein sollte, so haben Sie ihn sicherlich schon einmal in einer der anspruchsvolleren Talk-Shows des Fernsehens gesehen oder zumindest im Heiteren Beruferaten, wo er gelegentlich gemeinsam mit anderen Prominenten aus dem Showbusiness oder dem Medienbereich aufgetreten ist. Mit einer einladenden Handbewegung zeigte ich auf den freien Platz.
»Danke!«, sagte Pracke, »lassen Sie sich aber bitte in Ihrer Lektüre nicht von mir stören.«
Er setzte sich und nahm die Karte. Wie die meisten geschulten Stimmen war auch die seine auf den ersten Eindruck angenehm, aus dem einfachen Grund, weil sie dem Ohr keine Arbeit machte. Prackes weißes Haar sah aus, als sei es erst am Morgen gewaschen und sorgfältig geföhnt worden. Das Gesicht allerdings wirkte im Kunstlicht des Speisewagens ein wenig teigig und die Nase fleischiger, als ich sie von den Fotografien her in Erinnerung hatte.
Pracke bestellte einen Beaujolais, ich bemerkte, dass er sich dazu zwang, das Glas nach dem ersten Probeschluck eine Weile stehen zu lassen. Als der Tafelspitz serviert wurde, erbat sich Pracke die »Zürcher«, selbstverständlich überließ ich sie ihm. Er sah das Blatt eilig durch, als suche er einen bestimmten Artikel. Aber dass über die diesjährige Nordatlantikkonferenz der Barry-Goldwater-Foundation noch nichts geschrieben stehen konnte, hätte er sich eigentlich denken können. Auch nichts über das Referat, das Pracke am Vortag dort über den »Paradigmenwechsel im Internationalen Strafrecht« gehalten hatte.
Der Tafelspitz war ein wenig faserig und der Kren mit allzu großer Sorgfalt in Plastikfolie eingeschweißt. Aber heißt es nicht in der Bibel: Iss und trink und sei zufrieden? Als ich mir einen Espresso bestellte, reichte mir Pracke das Blatt zurück.
»Zuverlässig wie eine Schweizer Uhr. Da stimmt einfach alles, die Politik, der Wetterbericht und der Gebrauch von Perfekt und Imperfekt. In den Bergen ist Schnee gefallen. So ist es dann auch und steht da wie in Marmor gemeißelt«, sagte er und blickte mich taxierend an. »Wissen Sie«, fuhr er fort, »schuld ist wieder einmal mein Laptop. Ich wollte noch arbeiten, aber hinter Blankenese war der Akku schon wieder leer. Vielleicht liegt es daran, dass ich Hamburg nicht mag. Womöglich überträgt sich das auf das Gerät.«
»Lassen Sie den Akku auswechseln«, sagte ich. »Und trimmen Sie den neuen. Laden Sie ihn erst auf, wenn er ganz leer ist, und geben Sie ihm dann die gesamte Ladezeit.«
Pracke zeigte sich interessiert. »Das erinnert mich aber sehr an meine Studenten«, meinte er, »die müssten auch erst getrimmt werden, bis sie nicht mehr schnaufen können.« Er lachte unfroh. »Sie sind Fachmann für Computer oder den Umgang mit ihnen?«
»Durchaus nicht«, antwortete ich. »In meinem Gewerbe müssen Sie noch immer Hand anlegen.«
Er warf mir einen misstrauischen Blick zu. »Heiteres Beruferaten, wie? Aber bitte. Finde ich Sie denn in den Gelben Seiten?«
Eine Lautsprecherdurchsage teilte mit, dass wir in wenigen Minuten Göttingen erreichen würden. Ich brauchte nicht zu antworten. Leider hätten nicht alle fahrplanmäßigen Anschlusszüge warten können. »Wir bitten um Ihr Verständnis.« Die Unterbrechung kam mir gelegen. Es war nicht meine Absicht, mit Professor Pracke Heiteres Beruferaten zu spielen.
Bei der Abfahrt aus Göttingen hatte sich wenigstens keine weitere Verspätung aufgebaut. Weil unser Gespräch eingeschlafen schien, sprach ich Pracke auf die Hamburger Tagung an.
»Ich nehme an, Sie haben nach einem Artikel über die Goldwater-Foundation gesucht«, sagte ich, »aber die Neue Zürcher schätzt keine Schnellschüsse. Soweit ich weiß, haben Sie über die Grenzen des Strafrechts gesprochen...«
Über Prackes Gesicht ergoss sich eine leichte Röte, er wollte wissen, ob ich Teilnehmer gewesen sei.
Ich verneinte. »Allerdings habe ich im Abendblatt eine Vorankündigung gelesen, in der auch auf Ihren Vortrag hingewiesen wurde. Ich hätte ihn mir gerne angehört. Leider war ich verhindert.«
Pracke nickte gemessen. Offenbar fand er, dass es keine Hinderungsgründe geben dürfte, die das Versäumen seiner Vorträge rechtfertigten.
»Wobei mein Thema allerdings eher davon gehandelt hat, welche Grenzen einer internationalen Exekution von nationalstaatlichen Normen gesetzt sind...«
Er bestellte ein zweites Viertelliterfläschchen Beaujolais und begann mir zu erklären, warum die Bush-Administration durchaus recht daran tue, einen Internationalen Strafgerichtshof nicht anzuerkennen. Während er sprach, bemerkte ich, dass der Zug langsamer wurde, die Beleuchtung begann zu flackern und erlosch, und der ICE »Alpenland« blieb stehen, mitten im Schneetreiben und in einem Tal, das von ersten Höhenzügen umgeben schien.
Es dauerte eine Weile, bis eine Notbeleuchtung bläulich aufschimmerte, und etwas mehr als eine Weile, bis der Zugführer über Lautsprecher mitteilte, der Zug habe leider ein vorübergehendes technisches Problem. »Wir bitten um Ihr Verständnis.«
Professor Gerald Pracke holte sein Handy heraus, aber er bekam keine Verbindung. Unser Zug war in einem Funkloch stecken geblieben. An der Heißluftdüse unten an der Bordwand konnte ich fühlen, dass inzwischen auch die Heizung ausgefallen war. Ich sagte Pracke, dass wir unsere Mäntel holen sollten. Er zögerte.
»Es wäre ohnehin besser«, fügte ich hinzu, »wir sähen nach unserem Gepäck. Wenn der Zug stehen bleibt, könnten die Koffer Beine bekommen.« Außerdem hätte ich ein ordentliches Zwetschgenwasser dabei, sozusagen meinen Notvorrat, wie gerufen für Stunden ohne Licht und Heizung. Das schien ihn zu überzeugen, und so gingen wir zu unseren Abteilen, die - wie der Zufall oder die Platzreservierung es gefügt hatte - nebeneinander lagen. Da wir nun schon einmal Schicksalsgefährten waren, holte ich die Flasche mit dem wasserhellen Obstschnaps aus meinem Gepäck und setzte mich zu ihm. Er war plötzlich schweigsam geworden.
»Wir haben heute den fünften November, nicht wahr?«, fragte er mich schließlich, und ich nickte. Wieder schwieg er, und wir sahen zu, wie draußen der Schnee gegen das Fenster trieb und die Flocken abrutschten und unten an der Kante liegen blieben. Nach einer Weile schien es mir an der Zeit für den Schnaps, ich öffnete die Flasche und goss die beiden Zinnbecher voll, die ich mitgebracht hatte.
Wir tranken uns zu.
»Vorzüglich«, sagte er, als er den Becher gekippt hatte. »Ich habe mir übrigens erlaubt, auf das Gedächtnis eines Toten zu trinken. An einem fünften November habe ich einen Freund und Kollegen verloren, einen viel versprechenden Kollegen, jemanden, der ganz gewiss seinen Weg gegangen wäre. Aber das Schicksal hat es anders gewollt, wir heutigen Deutschen mögen dieses Wort ja nicht, es stört bei der Selbstverwirklichung, aber nichts hält das Schicksal auf, und manchmal kann es bitter und ungerecht sein...«
Ich fragte ihn, ob er mir die Geschichte seines Freundes erzählen wolle.
»Er ist im Schnee erfroren«, antwortete er und hielt bereitwillig seinen Becher hin, damit ich nachfüllen konnte. »Aber ich will es Ihnen gerne erzählen. Auch etwas, das die Deutschen verlernt haben: die Erzählung zu wagen. Aber hören Sie...« Er nahm einen Schluck, atmete tief durch und stellte dann den Becher auf das Fensterbord. »Das Wintersemester hatte eben begonnen, und zur Vorbereitung auf unser privates studium generale waren wir in eine Berghütte im Bregenzer Wald gefahren. Wer waren wir? Ein politisch ungebundener Kreis von Studenten und Assistenten, einige arbeiteten schon an ihrer Promotion, das Jahr 1968 lag noch in weiter Ferne, und dennoch ahnten wir, dass wir neue Wege gehen müssten, um die Welt zu verstehen und unsere Verantwortung darin zu finden...«
Wieder trank er einen Schluck und hielt den Becher fest, als könne er sich daran wärmen. Sein Blick war zum Fenster gewandt, dessen unterer Rand nun schon ganz vom Schnee zugeweht war.
»Die Berghütte gehörte Lindtheimer, dem Tübinger Staatsrechtler, er hatte Claudius als Assistenten angenommen, Claudius war unser intellektueller Kopf, sprühend vor Einfällen, seine Idee war es gewesen, uns im kommenden Semester mit Boris Vian und John D. Salinger und John Osborne als den Protagonisten einer zweiten Verlorenen Generation auseinanderzusetzen und - vor allem - Gegenentwürfe zu suchen. Natürlich hatten nicht alle kommen können, sondern nur der sozusagen engere Stab, also Claudius selbst, dazu Christoph, heute ein hochrangiger Banker, Eberhard war dabei, der später in die Politik ging, dann ich selbst, und schließlich auch die Frauen, Edda, damals Claudius’ wache und aufmerksame Gefährtin...« Er unterbrach sich und holte das Handy heraus. »Sie entschuldigen, aber ich muss es noch einmal versuchen.«
Aber ein Funkloch ist ein Funkloch. Da kann es noch so viel schneien.
Schließlich gab er auf und wandte sich wieder mir zu. »Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, unsere Gruppe in der Berghütte. Edda gehörte dazu, auch Elisabeth, ich war damals ihr ständiger Begleiter, aber verstehen Sie mich nicht falsch: Wir hatten uns zu einem Arbeitswochenende getroffen, stundenlang diskutierten wir und planten Referate, entwickelten Thesenpapiere gegen die Neue Weinerlichkeit, der wir das Vertrauen in das Gelingen des demokratischen Diskurses entgegensetzen wollten... Vielleicht dürfte ich Sie noch einmal um Ihren vorzüglichen Zwetschgenschnaps bitten...«
Ich schenkte nach.
»Wir waren am Freitag angereist, in einem alten VW-Bus, den Christian besorgt hatte. Es war ein schöner zartblauer Spätherbst, unvergesslich, schon als Kind hatte ich diese Tage in den Alpen geliebt... Lindtheimers Hütte war spartanisch eingerichtet, aber mit allem, was zur Grundversorgung nötig war. Sogar ein Radio gehörte dazu, allerdings ein schon damals äußerst altertümliches Gerät, dessen Antenne auf Radio Beromünster eingestellt war, wie der Schweizer Sender damals hieß, Nachrichten über kantonale Veranlassungen und Hausfrauen-Plauderstunden in helvetischer Mundart, schrecklich, irgendwer hat es fertig gebracht, dass wir wenigstens den Süddeutschen Rundfunk hören konnten, vielleicht war das falsch gewesen... aber wer konnte das damals wissen?«
»Dieses Radio«, fragte ich, »war das ein alter Volksempfänger?«
Er sah mich ratlos an, oder eher: ein wenig irritiert. »Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr... betrifft das Ihre Branche?«
Ich schüttelte den Kopf. »Es gibt Leute, die so etwas sammeln. War es vielleicht ein Mende? Mit einer hohen, fast rechteckigen Senderanzeige? Gutes Design, aber eben dreißiger Jahre.«
»Fast rechteckige Anzeigenskala?« Er hob eine Hand und ließ sie wieder fallen. »Könnte so gewesen sein. So genau weiß ich das wirklich nicht mehr, eigentlich weiß ich nur, dass man die Antenne oben auf dem Dachboden verstellen musste, wenn man einen anderen Sender haben wollte...«
Er nahm einen weiteren Schluck und betrachtete mich mit gerunzelter Stirn, als überlege er, ob er überhaupt weitererzählen solle.
Er liebt es nicht, unterbrochen zu werden, dachte ich.
»Ach ja«, sagte er schließlich. »Der Samstag, der nächste Tag, zog mit einem prachtvollen Morgenrot herauf, wie ich selten eines gesehen habe. Am Vormittag kamen wir mit der Arbeit zügig voran, über Mittag kochten unsere beiden Kommilitoninnen einen Eintopf, es war so mild, dass wir auf der kleinen Terrasse essen konnten, mit Blick auf die nahen Alpengipfel |... Es herrschte eine merkwürdige Stimmung, ich fühlte mich glücklich und wehmütig zugleich, wir waren im Aufbruch, wir würden neue Wege finden, sicher doch, aber ich wusste auch, dass dieser sonnenwarme Herbst nicht andauern würde. Konnten wir die Wege, die uns Claudius aufzeigte, auch dann gehen, wenn der Winter kam? So ging es mir durch den Kopf, oder jedenfalls erinnere ich mich heute so daran... Am Nachmittag arbeiteten wir weiter, bis schließlich Claudius fand, dass es genug sei. Er war nicht nur unser intellektueller Anführer, sondern überdies sehr sportlich, ein durchtrainierter Langstreckenläufer, und obwohl im Westen diese hohen Streifenwolken aufgezogen waren, wollte er noch eine Runde laufen. Mir genügte ein Spaziergang, ein oder zwei Kilometer, allein, nur so zum Auslüften des Kopfes, aber er, er hatte sich eine Strecke von zehn oder zwölf Kilometern mit ein paar fürchterlichen Anstiegen dazwischen ausgesucht...«
In diesem Augenblick meldete sich wieder der Lautsprecher, der Zugführer teilte mit, dass eine Diesellok in Anfahrt sei und den Zug in den nächsten Bahnhof schleppen werde. Pracke und ich wechselten einen Blick, ein kaum merkliches Rucken lief von Wagen zu Wagen, wir standen auf und traten auf den Gang hinaus und sahen zu, wie der ICE »Alpenland« an dem Vorhang von dichtem Schneefall vorbeigeschoben wurde, der das Tal verhüllte.
Nach einigen Minuten rollte der Zug aus, wir sahen auf einen von trüben Peitschenlampen erleuchteten Bahnsteig, dahinter waren weitere Gleise zu erkennen. Ein Bahnhofslautsprecher nannte einen dieser »-menau-Bahnhof«-Ortsnamen, die man sich nicht merken kann. Die Weiterfahrt sei derzeit leider nicht möglich, sagte die Stimme, der besonderen Umstände wegen bleibe aber die Bahnhofsrestauration geöffnet. Die Fahrgäste könnten diese ohne Besorgnis aufsuchen, die Weiterfahrt des Zuges werde rechtzeitig angekündigt.
Pracke und ich verständigten uns, dass eine Portion Kaffee oder ein Abendessen vielleicht doch eine willkommene Abwechslung zum Zwetschgenwasser seien, von dem wir ohnehin nicht wussten, wie lange wir es noch brauchen würden. Wir traten auf den Bahnsteig, auf dem der Schnee liegen geblieben und teilweise festgetreten war. Pracke ging mir voran, er trug einen pelzbesetzten Mantel und einen breitkrempigen Hut. Über der Bahnsteigkante vor mir sah ich ein Warnschild, das Piktogramm darauf zeigte ein unvorsichtiges Strichmännchen, das strampelnd vor eine Lok fällt.
Durch eine Unterführung folgten wir den anderen Reisenden aus unserem Zug zu einem mehrstöckigen Backsteingebäude, dessen Umrisse ich im Schneetreiben nicht erkennen konnte. Die Restauration befand sich in einem hohen, von Kugellampen ausgeleuchteten Saal. Wir fanden einen Tisch für uns, nach einiger Zeit erschien eine Kellnerin, der man ansah, dass ihre Schicht eigentlich schon zu Ende war. Ich bestellte eine Portion Kaffee, Pracke zögerte zunächst.
»Ich habe im Zug gegessen, Sie nicht«, sagte ich. »Unterschätzen Sie den Obstschnaps nicht und unterschätzen Sie nicht die Zeit, die der Zug noch bis München brauchen wird.«
»Sie sind sehr besorgt um mich«, meinte er plötzlich. »Woher wissen Sie eigentlich, dass ich nach München will?«
»Sie sind eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens«, antwortete ich. »Dass Sie am Starnberger See wohnen, steht in jedem Who is Who.«
Er warf mir einen misstrauischen Blick zu, entschied sich dann aber für einen Kalbsrollbraten mit Nudeln und Beilagensalat und ein frisch gezapftes Pils. Das ist in Ordnung so, dachte ich.
Als die Kellnerin gegangen war, holte er noch einmal sein Handy heraus. »Sie entschuldigen bitte«, sagte er zu mir. »Ich benutze dieses Gerät in der Öffentlichkeit sonst äußerst ungern...«
Diesmal bekam er ohne Probleme einen Netzanschluss, aber offenbar meldete sich unter der Nummer, die er gewählt hatte, nur der Anrufbeantworter:
»Edda, leider kann ich dich nicht erreichen, aber unser Zug ist mit einem Defekt hier irgendwo in Niedersachsen liegen geblieben. Ich habe keine Ahnung, wann ich in München sein werde. Ich umarme dich.«
Einer der französischen Moralisten hat einmal gesagt, in der Liebe gebe es keine Verstellung. Wo sie ist, lasse sie sich nicht verbergen, und wo sie nicht ist, lasse sie sich nicht vortäuschen. Aber diese Geschichte handelt nicht von der Liebe.
Auf das Essen musste Pracke nicht allzu lange warten, und mit dem Kalbsrollbraten kam er besser zurecht, als ich nach dem Wein und den Schnäpsen erwartet hätte. Mit dem frisch gezapften Pils hatte er ohnedies kein Problem. Danach bestellte er sich noch einen Apfelkuchen zum Kaffee. Auch das, so fand ich, war ganz in Ordnung.
Noch während sein Kaffee gebracht wurde, kam über den Lautsprecher die Mitteilung, dass für unseren Intercity eine Ersatzlok bereitgestellt werde, der voraussichtliche Zeitpunkt der Weiterfahrt leider aber noch nicht genannt werden könne. Pracke zuckte die Schultern und aß seinen Apfelkuchen. Er hatte etwas kurzfingrige Hände, aber die Kuchengabel handhabte er mit hurtiger, zupackender Geschicklichkeit.
»Ich habe Ihnen meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt«, meinte er schließlich und nahm mit der Kuchengabel sorgsam die letzten Krümel auf. »Ich sagte Ihnen bereits, dass es später Samstagnachmittag geworden war, und dass Wolken aufgezogen waren. Aber was rede ich! Es war eine ganze Wolkenfront, die mit einer für uns unvorstellbaren Geschwindigkeit von Westen her den Horizont ausfüllte und sich über uns auftürmte. Es wurde so schnell so dunkel, ja geradezu nachtfinster, dass ich schleunigst von meinem kleinen Spaziergang zurückkehrte, ich weiß noch, mit welcher Erleichterung ich die Tür der Hütte hinter mir zuschlug. Später erfuhren wir, dass wir von dem bevorstehenden Wettersturz hätten wissen müssen, Radio Beromünster hatte gewarnt, und im Alpengebiet gelten die Vorhersagen der Schweizer Meteorologen als besonders zuverlässig, bei uns hier gilt das Schweizer Wetter, hat mir später jemand gesagt. Aber Beromünster hatten wir ja abgeschaltet...«
Er nippte an seinem Kaffee und verzog das Gesicht und bestellte, weil die Kellnerin gerade vorbeikam, zwei Slivovitz.
»Der Sturm brach über uns herein«, fuhr er fort, »dass uns Hören und Sehen verging, wie gelähmt standen wir an den kleinen Fenstern und starrten in das Unwetter hinaus, die Hütte lag hoch, und was auf uns herunterstürzte, war nicht Regen, sondern Schnee... Plötzlich höre ich, wie eine klare, schneidende Stimme sagte: Da draußen ist Claudius, ist euch das eigentlich klar? In der Stube stand Edda in Bergschuhen und in ihrem noch halb sommerlichen Kleid und hatte einen Anorak darüber gezogen, als wolle sie damit hinaus, hinaus in diese Hölle. Er ist euer Freund!, fuhr sie fort. Wir müssen ihn suchen, es muss Laternen geben in diesem Haus, vielleicht genügen auch Taschenlampen, er ist sicher nicht mehr weit von hier entfernt...«
Die Kellnerin brachte den Schnaps, er schien schon darauf gewartet zu haben und kippte sein Glas. Ich ließ meines stehen.
»Ich weiß heute nicht mehr, ob sie das wirklich so gesagt hat«, fuhr er fort. »Tatsache ist, dass wir uns in unsere Anoraks vermummten und versuchten, mit Taschenlampen bewaffnet hinaus in das Schneetreiben zu gehen. Wir sind kaum aus der Türe gekommen, und als wir draußen waren, sahen wir nichts und hörten nichts und hatten keinen Atem für nichts, denn da war der Sturm und gab niemand sonst das Recht, dort zu sein. Nach ein paar Schritten sahen wir nicht einmal mehr unsere Hütte, das heißt: Wir - das waren Edda und ich, die anderen hatten sich sofort wieder ins Haus gerettet, und ich blieb auch nur so lange draußen, bis ich Edda an ihrem lächerlichen Anorak packen und sie zurückzerren konnte... Später hat sie mir gesagt, dass sie geschrien und um sich geschlagen habe, aber davon weiß ich nichts, ich weiß nur, wie die anderen uns in die Hütte zogen und mit Mühe die Türe zubrachten gegen die Wut und das Brüllen des Sturmes.«
Er schwieg.
Ich wartete.
»In der Nacht«, sagte Pracke in die Stille, »sind wir dann noch einmal hinaus. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber der Sturm hatte sich gelegt. Nur - da war kein Weg mehr, nirgends. Wir wateten durch Schnee, ohne jede Orientierung. Schließlich hatte Eberhard die rettende Idee. Er erklärte Edda, dass sich Claudius beim Losbrechen des Sturmes bereits auf dem Rückweg befunden haben müsse, dieser Rückweg aber über eine Hochalm geführt habe - Claudius habe ihm die Wegstrecke auf der Karte erklärt -, und auf dieser Hochalm gebe es ganz selbstverständlich auch Hütten und Stadel, so dass er dort ganz gewiss Zuflucht habe finden können, und dort würden wir ihn bei Tageslicht auch finden, wenn er nicht schon beim Morgengrauen vor der Türe stehe. Eberhard hat diese besondere Begabung, jeder vorhersehbaren Katastrophe die glücklichste Fügung anzudichten, es ist das, was ihn zum Politiker so begabt macht, und schließlich hat Edda ihm geglaubt, und wir konnten wieder zurück. Aber geschlafen hat keiner von uns in der Nacht...«
Bisher hatte er gesprochen, ohne mich anzusehen. Nun hob er den Blick.
»Wie Sie sich denken können, war nichts so, wie Eberhard es schöngeredet hatte. Claudius stand nicht am Morgen vor der Hütte, und es waren auch nicht wir, die ihn fanden, sondern die Bergwacht tat es, Suchhunde stöberten Tage später seine Leiche in einer Schneewehe am Rande eines Weges auf, den Claudius auf keinen Fall hätte nehmen dürfen...«
Er schwieg. Ich wartete.
»Haben Sie eine Erklärung, warum er diesen Weg genommen hat?«, fragte ich schließlich.
Pracke warf mir wieder einen dieser merkwürdigen, irritierten Blicke zu. »Ja«, sagte er, »es gibt eine Erklärung, aber sie ist nicht schön. Der Pfad, an dem seine Leiche gefunden wurde, zweigt von dem Hauptweg ab. An der Abzweigung stand ein Wegweiser zur Hütte des alten Lindtheimer. Aber der Wegweiser war verdreht.«
»Wie hat das geschehen können?«
»Die Gendarmerie nahm an, dass es ein Streich von Halbwüchsigen gewesen ist«, antwortete Pracke. »Von irgendwelchen Hauptschülern aus einem Landschulheim im Tal.«
»Der Wegweiser zeigte also dorthin, wo der Tote gefunden wurde?«
»Eben nicht«, antwortete Pracke. »Der Wegweiser zeigte zurück. Er zeigte dorthin, von wo Claudius gekommen war und wo die Hütte erkennbar nicht sein konnte, es sei denn, Claudius würde die ganze bis dahin absolvierte Strecke wieder zurücklaufen. Wenn er das nicht wollte, und angesichts des heraufziehenden Sturmes konnte er das nicht wollen, musste er sich auf seine Intuition verlassen, um zu entscheiden, welcher der zwei verbleibenden Wege der richtige war. Aber er hat den falschen Weg gewählt. Claudius, der uns allen den Weg zeigen wollte, hat sich selbst den falschen ausgesucht.«
»Tragisch«, sagte ich und sah zur Kellnerin, die am Nachbartisch kassierte. »Oder wie man das auch sonst nennen soll.«
Pracke zog die Augenbrauen hoch. »Wie würden Sie es denn nennen wollen?«
»Mir steht das zu oft in den Zeitungen, dass jemand auf tragische Weise zu Tode gekommen sei«, erklärte ich. »Ist ein Unfalltod ein tragischer? Ist ein Mord ein solcher? Bin ich übrigens richtig informiert, dass dann Sie die vakant gewordene Assistentenstelle bei Lindtheimer angetreten haben?«
Pracke lehnte sich zurück und betrachtete mich, die Arme über der Brust gekreuzt. »Dieses Gespräch nimmt eine sarkastische Wendung, mein Lieber. Ich schätze das nicht. Wie kommt es überhaupt, dass wir ein Gespräch führen? Ich kenne Sie nicht. Sie gehören nicht zu meinem Umfeld. Finden Sie nicht, dass hier ein Erklärungsbedarf besteht?«
»Ich gehöre nicht zu Ihrem Umfeld, das ist wahr«, antwortete ich. »Und was unser Gespräch angeht... Hatten nicht Sie sich an meinen Tisch gesetzt?«
Die Kellnerin kam und erklärte, sie müsse jetzt abrechnen. Ich sagte, dass ich für uns beide bezahlen wolle. Protestierend hob der Professor seine Hand. Ich wehrte ab. »Ihr Stil ist das doch auch nicht«, sagte ich zu ihm, »diese deutsche Erbsenzählerei, dass für jeden eine eigene Rechnung ausgestellt werden muss...«
Er ließ die Hand sinken, betrachtete mich aber mit hochgezogenen Augenbrauen und mit einem Blick, der mir unerwartet spöttisch und amüsiert erschien. Ich ließ mir einen Rechnungsbeleg ausstellen, zögerte dann aber, ihn in meine Brieftasche zu legen. Es ist so, dass ich meine Spesen leider steuerlich nicht geltend machen kann.
»Gehört es nicht zum Drehbuch«, fragte Pracke, »dass Sie mir jetzt den Rechnungsbeleg anbieten sollten?«
»Wie meinen?«, antwortete ich, schob ihm aber den Beleg über den Tisch. »Bitte.«
»Danke«, sagte Pracke, holte seine Brieftasche heraus und steckte den Beleg ein. »Ich bin in einer großbürgerlichen Familie aufgewachsen. Dort lernt man es früh, mit Geld umzugehen, und das heißt, es zusammenzuhalten. Edda - meine Frau, wie Sie wissen - hat Sie ohne Zweifel über diese meine Eigenheit in Kenntnis gesetzt.«
Ich betrachtete ihn aufmerksam. Seine Augen hielten mich fixiert.
»Eigentlich bin ich ein wenig ärgerlich mit Ihnen«, fuhr er fort. »Ich hätte früher aufhorchen müssen, nicht erst jetzt, als Sie sich vorgedrängt haben, die Rechnung zu bezahlen. Habe ich Ihr Gesicht nicht schon im Vier Jahreszeiten gesehen? Ich denke doch. Und als Sie mir dann wie ein verkleideter Bernhardinerhund Ihren Obstschnaps angeboten haben, hätten wirklich alle Alarmglocken anschlagen müssen. Dass ich einen guten Obstschnaps jedem Chivas Regal und jedem Armagnac vorziehe, steht natürlich nicht im Abendblatt, sondern es hat Ihnen das meine Frau gesagt... Wie ist sie eigentlich auf Sie verfallen?«
»Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt«, antwortete ich.
»Auf Deutsch heißt das: Sie haben nicht einmal eine Zulassung«, konstatierte Pracke. »Deswegen wollten Sie meine Frage nicht beantworten, ob man Sie in den Gelben Seiten findet. Sie sind ein Schnüffler, mein Lieber, aber ein lausiger. Einer von der Sorte, die ihre Kundschaft verkauft und erpresst. Vermutlich auch deshalb hat man Ihnen die Lizenz entzogen.«
»Es gibt keine Lizenzen in meinem Gewerbe. Nicht wirklich«, antwortete ich.
»Schweigen Sie!«, fuhr mich Pracke an. »Ich muss jetzt meine Interessen bedenken, aber auch die meiner Frau, dieser Törin... Natürlich haben Sie mir in Hamburg nachgeschnüffelt, das ist Ihr Job, ich bin froh und glücklich, dass ich einen anderen habe, da müssen wir kein Thema daraus machen.«
Wieder sah er mir in die Augen. »Und selbstverständlich wissen Sie von der jungen Dame, mit der ich die Hotelsuite geteilt habe.«
Allerdings wusste ich davon. Die junge Dame hieß Marie-Sophie Levasseur, war dreißig Jahre alt, außenpolitische Redakteurin eines konservativen französischen Wirtschaftsblattes, blond, grauäugig.
»Ich nehme an, Sie hatten den Auftrag, dies zu überwachen und zu dokumentieren. Wie das in Ihrer Branche gemacht wird. Nur halten Sie sich offenkundig nicht an die Regeln. Sie haben versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Warum? Es gibt nur einen einzigen Grund. Sie wollen, dass ich Ihre Informationen zurückkaufe...«
Er lehnte sich zurück und lächelte. Das heißt, es war nur die Andeutung eines Lächelns. Spöttisch und herablassend. »Nur - sehen Sie, alles, was Sie herausgefunden haben mögen, werde ich von mir aus meiner Frau offenlegen. Es wird das Erste sein, was ich zu Hause zu tun habe. Das Erste und das Letzte. Alles geht vorüber, auch eine gute, eine vorbildliche Ehe. Das Leben geht vorüber. Aber manchmal geschieht es, das Wunder, das Unerhörte, noch einmal streift einen der Flügelschlag des Schicksals... Vermutlich ist Ihnen das alles Hekuba. Aber sehen Sie - Sie haben keine Information, die Sie verkaufen könnten.« Er legte beide Hände auf den Tisch, die Handflächen nach oben gekehrt. »Trotzdem werde ich Ihnen ein Angebot machen. Sie warten bis übermorgen, ehe Sie meiner Frau berichten. Ich will nämlich, dass Edda die Geschichte mit Marie-Sophie von mir als erstem erfährt. Das wenigstens bin ich ihr schuldig. Wenn Sie sich daran halten, werden Sie auch Ihr Honorar bekommen. Andernfalls lasse ich Sie auffliegen. Wegen Erpressung oder Parteiverrats, oder was das Strafgesetzbuch sonst an Folterwerkzeugen für Leute wie Sie zu bieten hat.«
Ich stand auf und zog meinen Mantel an, den ich über eine Stuhllehne gelegt hatte. »Sie haben schon wieder vergessen, wer sich zu wem an den Tisch gesetzt hat.« Er wollte mich unterbrechen, und ich hob die Stimme. »Allerdings hätte ich Ihnen etwas mitzuteilen gehabt. Ein oder zwei Nachrichten. Aber niemand muss wissen, was er nicht erfahren will.« Mit wieder gedämpfter Stimme fügte ich hinzu: »Ich brauche jetzt ein wenig frische Luft. Sie finden mich auf dem Bahnsteig...«
Ich nahm meine Reisetasche, wandte mich zur Tür und verließ das Restaurant mit seinen wartenden, verdrossenen, übermüdeten Bahnkunden. War jemandem unser Disput aufgefallen? Ich sah mich um. Kein Blick, der meinem auswich. In der Bahnhofshalle gähnte neonbeleuchtete Leere. Ich ging nach draußen, auf der Straße lag Matsch, durch meine Lederschuhe hindurch spürte ich Nässe und Kälte. An einem Taxistand sah ich einen einzelnen Wagen. Ich ging hinüber und wechselte ein paar Worte mit dem Fahrer. Der Wagen war frei. Der Fahrer nahm meine Reisetasche und schaltete den Taxameter ein.
Dann kehrte ich zum Bahnhof zurück und ging durch die Unterführung zu dem Bahnsteig, auf dem der ICE »Alpenland« noch immer auf eine neue Lok wartete. Oben blieb ich stehen. Der Schneefall hatte wieder eingesetzt. Ich schlug meinen Mantelkragen hoch. Aus dem Schatten eines Kioskes trat ein Mann auf mich zu und legte seine Hand auf meinen Arm. Der Mann war so nah, dass ich seinen Atem roch und den Geruch von Schnaps darin. Ich bewegte mich nicht, obwohl mir sonst niemand die Hand auf den Arm legen darf.
»Sie sind mir noch immer eine Erklärung schuldig«, hörte ich Prackes Stimme, fast flüsternd. »Was also meinten Sie vorhin mit Ihrer Bemerkung über meine Assistentenstelle bei Lindtheimer?«
»Das kann man überall nachlesen«, antwortete ich. »Im Munzinger-Archiv ebenso wie im Who is who. Sie sind doch stolz darauf. Lindtheimer war schließlich eine erste Adresse.«
»Ich rede von etwas anderem. Sie haben einen Zusammenhang hergestellt, den ich nicht hinnehmen kann.« Pracke hielt mich noch immer am Arm gepackt. »Sie tun so, als hätten Sie ein gutes Blatt. Aber bisher habe ich nichts als läppische Zweien gesehen.«
Ich löste seine Hand von meinem Arm. »Sie wollen sich jetzt von Ihrer Frau trennen und glauben, dass Ihnen das keine Probleme bereiten wird«, antwortete ich. »Offenbar sind Sie ein glücklicher Mensch. Einer, dem alles den Weg ebnet. Vor allem das Unglück der anderen. Sie haben die Stelle Ihres Freundes Claudius geerbt, und seine Verlobte dazu. Da hat auch Ihre erste Freundin Elisabeth keine Probleme gemacht. Bescheiden ist sie zur Seite getreten, wie es sich gehört bei einem bedeutenden Mann. Und Sie glauben, das geht immer so?«
Wir standen uns nun gegenüber, neben uns der Intercity, sein Gesicht war von seinem Hut überschattet, trotzdem fiel mir auf, wie aufgedunsen es war und kalkig.
»Menschenskind«, sagte er halblaut, »was nehmen Sie sich heraus? Wissen Sie eigentlich, dass ich bei der Münchner Kriminalpolizei einen guten Freund habe, er ist ein hochrangiger Beamter, er wird dafür sorgen, dass Sie richtig Ärger bekommen...«
»Sie haben in den letzten Jahren keinen Kontakt mehr zu Elisabeth gehalten«, fuhr ich fort. »Ein Fehler. Man sollte niemals einen Menschen vergessen, der einem einmal einen Gefallen getan hat.«
»Einen Gefallen?« Er starrte mich an. »Unsinn...«
Scheppernd brach über uns ein Lautsprecher los und schüttete zu, was Pracke hatte sagen wollen.
»Bitte Vorsicht an Bahnsteig 4! In wenigen Minuten hält die Ersatz-Lok für den verspäteten Intercity nach München Einfahrt...«
Nun war ich es, der seinen Arm nahm und ihn von dem Intercity weg auf die andere Seite des Bahnsteigs führte. Außerhalb der Lichtkegel, die von den Bahnhofslampen durch das Schneetreiben fielen, blieben wir stehen. Ich blickte nach rechts. Ganz in der Ferne glaubte ich, das Scheinwerferlicht einer Lokomotive zu sehen.
»Elisabeth war es, die die Antenne auf den Süddeutschen Rundfunk gerichtet hat«, sagte ich. »Sie selbst haben es mir doch erzählt. Das Gerät war auf Radio Beromünster eingestellt gewesen, weil es da oben nur eine wichtige Sendung gibt, und das ist der Wetterbericht. Der Wetterbericht von Radio Beromünster. Und Elisabeth hat so lange mit der Antenne experimentiert, bis sie statt Beromünster den Stuttgarter Sender hereinbekam. Sie hat es gemacht, weil Sie sie darum gebeten hatten.«
»Absurd«, sagte Pracke. »Absolut gaga und plemplem. Wenn ich den verdammten Stuttgarter Sender hätte hören wollen, hätte ich doch auch selber umschalten können...«
»Nein«, sagte ich. »Sie wussten, was passieren würde. Von Kindheit an waren Sie immer wieder in den Bergen, Sie haben es mir selbst gesagt. Also müssen Sie gewusst haben, was das prachtvolle Morgenrot bedeutete. Und die Streifenwolken. Dass ein Wettersturz bevorstand. Und dass Radio Beromünster davor warnen würde. Aber weil die Gruppe fast die gesamte Zeit zusammen war, konnten Sie sich nicht selbst an der Antenne zu schaffen machen. Der Spaziergang allein war schon gefährlich genug.«
Das Scheinwerferlicht kam näher.
»Welcher Spaziergang?«
»Der Spaziergang, als Sie den Kopf auslüften wollten. Und bei dem Sie den Wegweiser verdreht haben. Bei dem Sie dafür gesorgt haben, dass Claudius sich zwischen dem falschen und dem richtigen Weg entscheiden musste.«
Ich lächelte kurz. »Vor ein paar Tagen habe ich einen Besuch gemacht, in einem Altenheim in Bludenz. Ein Besuch bei einem alten Polizisten. Er hat sich noch gut an den Toten im Schnee erinnert. Und wissen Sie, was er mir gesagt hat?«
Pracke blickte der Lok entgegen. Sie würde den Bahnhof durchfahren, bis sie von der anderen Seite her an den ICE ankoppeln konnte.
»Er glaubt nicht, dass es die Schüler aus dem Landschulheim waren, die den Wegweiser verdreht haben. In dem Heim waren damals Kinder aus dem X. Wiener Bezirk untergebracht, aus Favoriten, und von denen sei ganz gewiss keines hochgestiegen, nur um einen Wegweiser zu verdrehen. Eintausend
2. Auflage
Originalausgabe Juni 2005 bei btb Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright © 2005 btb Verlag
RK · Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN : 978-3-641-03502-0
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de