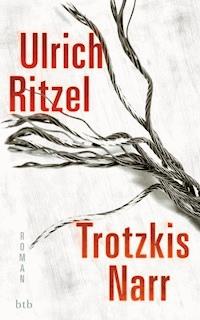4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Es ist ein regnerischer Abend, an dem Lukas Gsell – ein gescheiterter Schriftsteller – den Hund seines kranken Nachbarn auf der Promenade hoch über der Stadt ausführt. Von der Leine gelassen, verbellt der Hund einen allein auf einer Bank sitzenden Mann. Gsell eilt hinzu, leint den Hund an und entschuldigt sich. Doch der Mann winkt nur ab. Am nächsten Morgen erfährt Gsell, dass sich der wortkarge Mann noch in derselben Nacht eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Es handelt sich um einen gewissen Markus Morgart, einen international agierenden Investor. Er hat den Selbstmordversuch überlebt, aber eine partielle Amnesie davongetragen. Gsell, der sich in einer ihm selbst unklaren Weise für das Geschehen mitverantwortlich fühlt, besucht ihn in der Rehabilitation und wird nach einigem Zögern als Begleiter auf einer Reise akzeptiert, mit der Morgart in sein Leben zurückfinden will...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Ähnliche
Zum Buch
Es ist ein regnerischer Abend, an dem Lukas Gsell – ein gescheiterter Schriftsteller – den Hund seines kranken Nachbarn auf der Promenade hoch über der Stadt ausführt. Von der Leine gelassen, verbellt der Hund einen allein auf einer Bank sitzenden Mann. Gsell eilt hinzu, leint den Hund an und entschuldigt sich. Doch der Mann winkt nur ab. Am nächsten Morgen erfährt Gsell, dass sich der wortkarge Mann noch in derselben Nacht eine Kugel in den Kopf geschossen hat. Es handelt sich um einen gewissen Markus Morgart, einen international agierenden Investor. Er hat den Selbstmordversuch überlebt, aber eine partielle Amnesie davongetragen. Gsell, der sich in einer ihm selbst unklaren Weise für das Geschehen mitverantwortlich fühlt, besucht ihn in der Rehabilitation und wird nach einigem Zögern als Begleiter auf einer Reise akzeptiert, mit der Morgart in sein Leben zurückfinden will …
Zum Autor
ULRICH RITZEL, geboren 1940, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, arbeitete mehr als drei Jahrzehnte als Journalist und wurde 1980 mit dem Wächterpreis der deutschen Tagespresse ausgezeichnet. Mit dem Roman »Der Schatten des Schwans« debütierte er 1999 als freier Autor. Aus der Reihe seiner Romane um den Kommissar Berndorf erhielten »Schwemmholz« und »Beifang« den Deutschen Krimi-Preis, »Der Hund des Propheten« den Preis der Burgdorfer Krimi-Tage. Ulrich Ritzel lebt mit seiner Ehefrau Susanne und seinen beiden Hunden seit 2008 in der Schweiz.
ULRICH RITZEL
DIE 150 TAGE DES MARKUS MORGART
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Arcangel Images/Mark Owen
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-23497-3V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
I. LUKAS GSELL
Der Mann auf der Bank
Dienstag, 12. März
Gesichter und Gestalten, überall. Als Kind habe ich sie zuerst im Muster der verblichenen Tapete über meinem Bett entdeckt, später im Wolkenhimmel. Gerne spähen sie aus dem noch kahlen Apfelbaum und tückisch aus den Weiden unten am Fluss. Zuweilen sind es keine Menschengesichter, sondern Tiergestalten. An einem verregneten Spätnachmittag, wenn ich ans Fenster trete und in eine Welt blicke, in der nicht Tag ist und nicht Nacht und in der es keine Farbe mehr gibt, sondern nur graue Bleistiftschraffur – da kann es geschehen, dass die Schraffur mir an einigen Stellen etwas heller zu sein scheint, als seien dort Silhouetten mehr angedeutet als ausgespart. Zum Beispiel die Silhouette eines Mannes, der gebückt auf einer Bank hockt. Oder ich glaube ein Tier zu erkennen, nein, nicht einfach ein Tier …
Es ist Hexe, die Hündin des alten Rektors Haeberlin, und sie will, dass ich mit ihr spazieren gehe. Da ist nichts weiter dabei, es muss nicht immer solche Komplikationen geben wie an jenem Abend Anfang März … muss ich die Jahreszahl angeben? Nein, sie wird sich von selbst erschließen. Ich hatte den ganzen Nachmittag und auch den Abend an einem Text gearbeitet, der von mir handelt und keine Bedeutung hat. Es muss den Tag über geregnet haben, aber als ich endlich aufstand, meinen Mantel anzog und hinüber zu Haeberlin ging, war die Regenfront weitergezogen. Dafür stieg Nebel auf. Kaum hatte ich geklingelt, öffnete der alte Rektor und Hexe drängte sich an ihm vorbei, so dass ich Mühe hatte, sie anzuleinen. Und erst, als wir das Grundstück verlassen hatten, hörte sie auf, mich hinter sich her zu zerren. Außer dem Hund und mir war niemand unterwegs, das Licht der Straßenlampen spiegelte sich auf dem nassen Asphalt, argwöhnisch folgten uns die Bewegungsmelder, bis wir schließlich das letzte Haus hinter uns ließen und auf den Weg einbogen, der zum Galgenbuck führt.
Dort ließ ich Hexe von der Leine. Im Wald gab es Stellen, an denen sie schon einmal eine Maus gefangen haben muss, und für alle Zeit ihres Hundelebens würden das die Plätze bleiben, an denen es Mäuse gibt. Und während sie ihr Revier durchsuchte, konnte ich für mich gehen, ohne von ihr hierhin gerissen zu werden oder dorthin. Das ist auch der Grund, warum ich Hexe so spät ausführte – um diese Zeit waren keine Jogger mehr zu befürchten und auch keine Spaziergänger, die mich zurechtweisen, der Hund gehöre an die Leine! Der Wanderweg verläuft nahe an einem steilen Abhang, der von schnellwachsendem Gehölz überwuchert ist. Nur ein einzelner Aussichtspunkt bietet freien Blick auf die Stadt Bruggfelden, zu der die Siedlung gehört, in der ich seit ein paar Jahren lebe.
Bruggfelden ist – oder war – eine kleine freundliche Stadt, man wollte dort nichts oder fast nichts von mir, außer meiner Steuererklärung. Am Tag konnte man vom Aussichtspunkt das Treiben auf der Hauptstraße beobachten, wer wo einparkte und wie lange er dazu brauchte, wer über die Straße zur Apotheke ging oder in den Laden für Haushaltswaren. Im Nebel, der die Lichter verschwimmen ließ, sah die Stadt mit ihren Türmen und spitzgiebligen Dächern an diesem Abend so weichgezeichnet aus, als wäre man dort geborgen.
Ein Windstoß fuhr durch den Wald und platschte mir Wassertropfen ins Gesicht. Ich holte die Mütze aus meiner Manteltasche und zog sie mir über den Kopf. Einige Meter vor mir schnürte die Hündin aus dem Unterholz und lief mir auf dem Weg voran, ohne sich nach mir umzusehen, ein kleiner gedrungener dunkler Schatten zwischen hohen kahlen Bäumen, deren Stämme sich schwarz gegen graue Nebelschwaden abzeichneten. Ich folgte ihr, wohl in Gedanken versunken, was immer das heißt, vermutlich ging mir der Text nach, an dem ich gearbeitet hatte.
Drohendes Knurren ließ mich aufschrecken. Der Hund? Das Knurren schlug in zorniges Gebell um. Fuß! schrie ich, hierher! Lauter sinnloses Zeug; wenn Hexe am Kläffen war, hielt sie nichts mehr, also rannte ich ihr nach und entdeckte sie vor einer der Sitzbänke, die der Fremdenverkehrsverein aufgestellt hatte, als es dort noch eine Aussicht gab und nicht nur wucherndes Gebüsch.
Auf der Bank saß eine einzelne Gestalt – ein Mann, soviel erkannte ich, dunkler Mantel, dunkler Hut, näher mochte ich ihn gar nicht betrachten, ich packte Hexe am Halsband, zog sie weg, leinte sie wieder an und entschuldigte mich wortreich, ich habe Sie leider nicht gesehen! Der Hund ist eher ängstlich und nicht wirklich gefährlich! Lauter dummes Zeug, das ich nur deshalb notiere, weil es so dumm ist, wie ich mich – auch im Rückblick – selber fühle. Warum zum Teufel ließ ich ein Tier frei laufen, das mir nicht gehorcht?
Der Mann auf der Sitzbank allerdings hob nur die Hand – abwinkend oder beruhigend – und murmelte etwas, das sich nach »Schon gut« anhörte, mir aber in den Ohren klang, als seien meine Entschuldigungsversuche diesem Menschen mindestens ebenso lästig wie das Hundegekläff.
Ich dankte für das Verständnis, das vermutlich keines war, und wünschte einen guten Abend, tatsächlich wünschte ich das, und ging weiter, die Hündin an der Leine, ärgerlich sowohl über den Vorfall als auch über den Stachel, den sich meine Gedanken beim Anblick des Mannes auf der Bank eingefangen hatten. Was hat dieser Mensch zu nachtschlafender Zeit auf einer regennassen Bank zu sitzen? Ein Schwächeanfall? Die Stimme hatte – nun ja, nicht gerade fest oder dröhnend geklungen, gleichgültig eben, man trompetet das ja nicht, dieses: schon gut.
Ich ging weiter, kehrte dann aber bald um, wobei ich es vermied, noch einmal an der Bank mit dem Mann im dunklen Mantel vorbeizukommen, und lieferte die Hexe schließlich wieder ab, alles halb in Gedanken, und halb in Gedanken nahm ich für diesmal auch des Rektors Einladung auf ein Glas Wein an. Was tust du da?, fragte ich mich, als ich dem kurzatmigen kugeligen Mann folgte, der barfuß in Filzpantoffeln vor mir her watschelte, aber ich wusste mir keine Antwort. Sein Wohnzimmer war ein von einer Deckenlampe wartesaalmäßig erleuchteter Raum, an dessen Wände bunte Kinderbilder gepinnt waren, fröhlich wie aufgespießte Schmetterlinge. Ich müsse seinen legeren Anzug entschuldigen, sagte Haeberlin und wies auf die gerade knielangen Hosen – seine geschwollenen Beine bräuchten es luftig! Wenn es nur irgendwann wieder besser würde mit den Beinen, dann könnte er auch wieder selbst den Hund ausführen!
Er war in der Küche verschwunden, ich sah mir die Bilder und Zeichnungen an der Wand an, eines in auffällig großem Format war offenbar eine Gemeinschaftsarbeit gewesen und zeigte eine gewaltige Kinderschar, die einem rundlichen Mann nachwinkt, der gerade das Schulgelände verlässt und der Sonne entgegen geht. »Das haben mir die Kinder zu meinem Abschied geschenkt«, sagte der Alte, als er mit Weinflasche, zwei Gläsern und einer Schachtel Chips zurückgekommen war. Vor zwölf Jahren sei das gewesen … Er entkorkte die Flasche und erklärte, es sei ein Rotwein aus der Region, gekeltert von einem seiner Schüler, der mit vierzig Jahren beschlossen habe, das einfache Leben eines Winzers zu wählen. Er schenkte ein, wir stießen an und wünschten uns Gesundheit, der Wein war eher herb und schmeckte – ach, ich bin kein Weinkenner, aber ich stellte mir vor, er komme aus einer kargen, sonnenverbrannten Landschaft.
»Respekt!«, sagte ich. »Aber glauben Sie wirklich, dass das Leben eines Winzers einfach ist? Erst recht, wenn einer das von Grund auf neu lernen muss.«
»Oh!«, meinte Haeberlin, »da hatte ich keine Sorge, nicht für Pascal – der hat sich immer sorgfältig vorbereitet. Das ist einer der unschätzbaren Vorteile, die man von einem gutbürgerlichen Elternhaus mitbringen kann, wenn ich das so sagen darf. Er hat dann auch ein brillantes Abitur hingelegt, auch wenn ich als sein alter Lehrer so etwas« – fast entschuldigend hob er die kleine, etwas wulstige Hand – »nicht gar zu sehr rühmen sollte! Aber brillant war es nun einmal, und alle waren wir gespannt, welche Karriere er einschlagen würde … Und was tut der junge Mann? Er wird Priester!«
»Also ein Arbeiter im Weinberg des Herrn?«, fragte ich und hielt das Weinglas gegen das Licht, als verstünde ich etwas davon. »Das passt doch!«
»Er war noch keine dreißig«, fuhr Haeberlin fort, »als er auf einen Lehrstuhl für dogmatische Theologie berufen wurde, stellen Sie sich das mal vor! Damals dachte ich, es dauert nicht lange, und wir sehen ihn im Vatikan oder als Bischof in Herrenmünster … Was haben Sie?«
»Nichts«, sagte ich. Mir war nur die Frage durch den Kopf gegangen, ob denn bereits die Zeit gekommen sei, in der ein Pascal in der katholischen Hierarchie würde aufsteigen können.
»Nun, nichts davon trat ein, von einem Tag zum anderen warf dieser junge Mann alles hin, das Ordinariat, seinen Glauben, trat aus der Kirche aus und schrieb atheistische Bücher, Gott sei tot und solches Zeug … Und als ihm auch das zu langweilig wurde, hat er sich auf den Weinbau verlegt … Aber warten Sie!«
Er erhob sich mühsam und ging zu einem altersschwarzen Bücherregal, wo er sich schnaufend zu schaffen machte und schließlich mit einem Stapel Fotoalben zurückkehrte. Die Alben enthielten Fotos ganzer Generationen von Schulkindern, zu Klassenaufnahmen zusammengetrieben oder auf Ausflügen und in Schullandheimen abgelichtet. Unter den Bildern waren in sorgfältiger Handschrift Klasse, Jahrgang und der Anlass vermerkt. Eine bereits leicht ausgebleichte Farbfotografie, auf die der Rektor deutete, stammte aus einer Zeit, in der die Buben lange Haare tragen durften und das auch taten, unter ihnen das blonde wohlfrisierte Oberklassenkind Pascal, das in der letzten Reihe der Gruppenaufnahme zu sehen war und also zu den Größeren der Klasse gehörte. Eine Reihe weiter stand ein helläugiges Mädchen mit einer eigenwilligen hohen Stirn und blickte kühl, das war die Claudia, wie mir Haeberlin erklärte, »sie lebt jetzt wieder hier und unterrichtet Deutsch, am Gymnasium, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe!«
Ich warf einen Blick auf die Bildlegende, es handelte sich um eine Klasse im vierten Schuljahr, Pascal und Claudia waren damals also neun oder zehn und mussten jetzt um die 56 Jahre alt sein. Der Rektor a. D. fuhr fort, mir zu erklären, wer von seinen Schülern was geworden war, ein Junge mit herunterhängenden Augenlidern hatte es zum Direktor der Bezirkssparkasse gebracht, und ein rothaariges Mädchen saß seit acht Jahren für die Grünen im Gemeinderat. Mir fiel ein Bub auf, der auf dem Gruppenbild in der vordersten Reihe stand, ein gedrungenes Kerlchen mit offenbar nur mühsam gebändigtem struppigem Haar. Der Bub hatte etwas, das mich an den Clown erinnerte, den es – glaube ich – in jeder Schulklasse gibt. Den Jungen, der so tut, als sei es komisch, dass ausgerechnet er so anders ist als alle anderen.
»Ach!«, sagte Haeberlin, beugte sich über das Bild und setzte die Lesebrille auf, die er an einem Bändel um den Hals trug, »das muss … das ist der Markus … ein sehr lebhaftes Kind, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, das ist …« Er schüttelte den Kopf, als verwerfe er einen Gedanken. »Also das soll ja erst einmal gar nichts bedeuten. Manche Kinder sind eben so und sind dabei keineswegs die Dümmsten. Nun ja, damals gab es – Gott Lob! – kein Ritalin oder anderes solches Zeug, als Lehrer musste man so damit zurechtkommen, das ging nur mit geduldiger Konsequenz …«
Was war aus dem Kerlchen geworden?
Über das Gesicht des Rektors zog ein Schatten. »Die Mutter muss woanders eine neue Stelle gefunden haben, und sie sind weggezogen.«
Bevor er Anstalten machen konnte, mir die übrigen Alben zu zeigen, trank ich mein Glas aus und entschuldigte mich mit der Behauptung, ich müsse noch nach meinen Mails schauen und mindestens eine beantworten. Als ich die Straße überquerte, fiel mich der Gedanke an, noch einmal zu der Bank im Wald zu gehen und nachzusehen, ob dieser Mann noch immer dort sitzen würde … Und was dann? Sollte ich ihn vielleicht fragen, ob er Hilfe brauche? Ich würde ihn damit nur ein weiteres Mal belästigen. Wenn er auf Hilfe angewiesen war, hätte er es mir gesagt. Ich schloss die Haustür auf.
Am nächsten Morgen war der Himmel unerwartet blau und keine einzige Wolke mehr zu sehen. Nach dem Frühstück nahm ich nicht den Bus, sondern ging zu Fuß in die Stadt, wo ich für die nächsten Tage einkaufen wollte. Aus einem mir selbst nicht ganz klaren oder eingestandenen Grund schlug ich nicht den kürzesten Weg ein, sondern ging wie am Vorabend durch den neueren Teil der Siedlung, vorbei an den Heimstätten im Landhaus-Stil, und spürte die Sonne im Gesicht. Ich versuchte, an den Text zu denken, an dem ich arbeitete, und verwies es mir wieder. Der Tag war zu schade dafür.
Das rotweiße Plastikband sah ich erst kurz vor der Weggabel, an der es rechts hinab in die Stadt geht. Es versperrte den Wanderweg links, der zum Galgenbuck führt. Noch bevor ich das zusätzlich aufgestellte Verbotsschild der Polizei wahrnahm, ahnte ich, was geschehen sein musste.
Was tun? Nichts. Dass dieses Plastikband da gespannt sein würde, überraschte mich nicht. Nicht wirklich. Brauchte irgendwer mich oder meine Aussage? Kaum, und wenn doch, so würde die Polizei um sachdienliche Mitteilungen bitten. Ich nahm den Weg rechts, der in die Stadt führt, und verscheuchte einen Rechtsbegriff, der hässlich genug in meiner Hirnschale aufgetaucht war.
Unterlassene Hilfeleistung nannte sich dieser Begriff.
In der Stadt und ihren Läden war es nicht voll, und meine Einkäufe waren rasch erledigt. Auf dem Heimweg kehrte ich in das kleine, am Oberen Tor gelegene Café ein, das mit seinem abgestoßenen Mobiliar und den erblindenden Wandspiegeln immer noch der Treffpunkt und die Nachrichtenbörse sein wollte, die es in jeder richtigen Stadt gibt. Ich war dort inzwischen so weit bekannt, dass die Kellnerin mir ungefragt einen Espresso und ein Glas Mineralwasser brachte, während ich die Zeitungen durchblätterte, die das Café bereithält. Ich kann mich an die Schlagzeilen nicht mehr erinnern, aber es muss die Zeit gewesen sein, in der ein neugewählter US-Präsident die bis dahin vereinbarten internationalen Abkommen zum Schutz des Weltklimas aufkündigte, unter dem Beifall der Auto- und der Bergbaulobby. So las ich in einem der Kommentare, endlich bräuchten die Autofahrer kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn sie sich einen PS-stärkeren Wagen gönnen. Ich blätterte weiter, auf der Seite »Vermischtes« fand ich etwas über einen riesigen Eisberg, der sich vom Schelfeis der Antarktis gelöst hatte, was immer das zur Folge haben mochte.
Zwei Tische weiter saß Axel Stutz – Herausgeber und Redakteur des Wochenblatts – bei einem Weizenbier und tippte in seinen Laptop das Editorial der nächsten Ausgabe. Wir hatten uns mit einem knappen, sozusagen kollegialen Handzeichen gegrüßt, tatsächlich waren wir sogar auf Du, denn ich schrieb von Zeit zu Zeit einen kleinen Bericht für ihn. Wenn er fertig war, würde ich ihn nach der Absperrung fragen. Soviel Journalist musste er sein, um inzwischen Bescheid zu wissen.
Aber was würde er mir sagen können, was ich nicht selbst schon wusste? Ich erinnerte mich, dass der Mann im dunklen Mantel diese abwehrende oder beruhigende Bewegung mit der linken Hand gemacht hatte, die rechte war dabei in der Manteltasche geblieben. Ich ertappte mich dabei, wie ich mit der linken Hand seine Bewegung nachspielte, die rechte in der fiktiven Manteltasche versenkt, einen ebenso fiktiven Gegenstand im Griff, den Zeigefinger am Abzug … Unwillkürlich schüttelte ich den Kopf. Was wusste ich denn?
Ein mittelgroßer und eher schmächtiger Mann betrat in diesem Augenblick das Café und steuerte zielstrebig den Tisch des Redakteurs Stutz an. Dort angekommen, nickte er ihm zu, wartete, bis dieser eine einladende Handbewegung machte, zog dann den freien Stuhl ihm gegenüber zurück und setzte sich. Obwohl der Neuankömmling Zivil trug und nicht die Statur besaß, die man bei einem Polizisten erwartet, war er unverkennbar ein solcher – ein Kriminalbeamter also. Man kann an einer gewissen Bestimmtheit der Haltung und der Gesten erkennen, dass da jemand nicht einfach einen Espresso trinken geht, sondern eine Amtshandlung vollzieht.
Eine vertrauliche offenbar, wie ich so halb aus den Augenwinkeln mitbekam. Stutz schien nicht begeistert, äußerte wohl auch Einwände, hatte auf Dauer aber den energischen Handbewegungen seines Gegenübers nichts entgegenzusetzen. Der Fall war rasch entschieden, der Kieberer kippte seinen Espresso, nickte dem Redakteur zu und verließ das Café – nicht ohne zuvor einen prüfenden Blick auf mich geworfen zu haben.
Wenig später hatte ich bezahlt und meinen Rucksack mit den Einkäufen geschultert. Beim Hinausgehen hielt ich kurz an Stutz’ Tisch. »Seit heute Morgen ist der Weg zum Galgenbuck gesperrt«, sagte ich, »wenn ich das richtig sehe, wird man den Grund dafür in deinem Blatt nicht lesen.«
Stutz sah durch seine rechteckigen Brillengläser zu mir hoch. »Seit wann liest du …«, sagte er und musste sich räuspern, »du liest mein Blatt doch nur, wenn du selber was reingeschrieben hast!«
Zurück nahm ich den Weg entlang der Aesche, die mehr Wasser führte als sonst. Braun vom mitgeschwemmten Erdreich und dann wieder weißschäumend schoss sie unter der Neuen Brücke durch und schwappte bei dem öffentlichen Parkplatz, der unterhalb der Brücke eingerichtet war, bereits über das Ufer. Die Zufahrt war gesperrt und der Parkplatz selbst bereits geräumt, bis auf eine schwarze Limousine, die mir ebenso unauffällig vorkam wie gerade deshalb auffällig teuer und elegant. Marke? Typ? Ich kenne mich damit nicht aus. Das Kennzeichen? Ich glaube, es war eines mit dem Schweizer Kreuz und einem weiß-blau-weißen Kantonswappen. Vor allem aber fiel mir der Mann auf, der sich an der Limousine zu schaffen machte – es war der Kieberer aus dem Café, diesmal von einem uniformierten Ordnungshüter begleitet. Der Kriminalbeamte verfügte offenbar über die Autoschlüssel für den Wagen und öffnete ihn, stieg aber nicht sofort ein, ebenso wenig wie sein uniformierter Gehilfe, sondern sah sich das Innere erst einmal genau an.
Ich ging weiter, an der Fachhochschule vorbei, und das kleine Sträßchen hoch, das zur Siedlung hinauf führt. Kurz, bevor ich oben war, kam mir ein schwarzgelber hochbeiniger Mischlingshund entgegen, der ein paar Meter vor mir verharrte und kurz wedelte, dann aber feststellte, dass ich seine Freundin Hexe – Haeberlins Hündin – nicht bei mir hatte. Desinteressiert wandte er sich von mir ab und begann, ein Grasbüschel am Wegrand zu beschnüffeln. Dann erschien auch bereits der dazugehörige Herr – eine große, leicht nach vorn gebeugte Gestalt mit gepflegter weißer Mähne, der Syndikus Welsheim, der lange Jahre Bruggfelden und die zugehörige Landschaft politisch vertreten hatte (freilich für eine Partei, die mit meiner Stimme nicht hätte rechnen dürfen). Wäre ich nicht vor einigen Monaten darauf verfallen, des alten Rektors Hündin auszuführen, hätte ich kaum seine Bekanntschaft machen können. Inzwischen waren wir soweit miteinander bekannt, dass ich gelegentlich seinen Maxl mitnahm oder er des Rektors Hund. Natürlich wusste er bereits, dass der Weg zum Galgenbuck gesperrt war.
»Ein Kriminalfall?«, fragte ich ins Blaue hinein. Der Hund Maxl setzte sich neben mich hin und sah zu mir hoch, vermutlich um sich in Erinnerung zu bringen, falls ich was von dem feinen Trockenfutter übrig hatte.
»Wie man’s nimmt«, kam Welsheims Antwort. »Fremdverschulden wird offenbar ausgeschlossen.« Er hob die rechte Hand und setzte sie mit ausgestrecktem Zeigefinger an seine Schläfe. Dann ließ er die Hand wieder fallen und schüttelte sie ärgerlich, als erscheine ihm die Geste jetzt doch ungehörig. »Es ist etwas Seltsames an dem Fall.« Er blickte mich prüfend an. »Etwas seltsam Anrührendes. Ich überlege, ob das nicht ein Stoff für Sie sein könnte …«
»Dieser Mensch hat sich also eine Kugel durch den Kopf gejagt«, sagte ich. »So was ist gern mit einer ziemlichen Sauerei verbunden. Ich habe Mühe, das anrührend zu finden. War er denn wenigstens gleich tot?«
»Wohl nicht … Man hat ihn noch mit dem Rettungshubschrauber nach Herrenmünster in die Universitätsklinik gebracht, in die Neuro-Chirurgie dort.« Welsheim bewegte abwägend den Kopf. »Der Beamte, der die Ermittlungen leitet … ach, ist ja egal, warum oder woher ich den kenne! Also der behauptet, dieser Morgart habe sozusagen einen Anfängerfehler begangen … also die Waffe nicht so angesetzt, dass er zu hundert Prozent … Was soll’s! Bei so etwas sind die meisten ja Anfänger … Markus Morgart, den Namen haben Sie aber bitte nicht von mir!«
»Ein Einheimischer?«
»Da kann ich nur wiederholen: wie man’s nimmt«, antwortete Welsheim. »Morgart ist oder war sechsundfünfzig Jahre alt und gebürtig hier aus Bruggfelden … Er muss aber früh weggezogen sein …« Mir war, als hätte er noch etwas zu den Umständen sagen wollen, unter denen dieser Morgart die Stadt verlassen hatte. Offenbar waren dem Syndikus aber Bedenken bekommen, er habe schon zu viel geredet. Und so zog er es vor, seinen Hund zu betrachten. Der hatte die Hoffnung auf eine milde Gabe inzwischen aufgegeben und sich auf dem Trottoir ausgestreckt, den Kopf auf die Vorderläufe gelegt und die braungelben Augen wachsam auf seinen Herrn gerichtet.
»Aber warum hatten Sie gemeint, der Fall habe etwas Anrührendes?«
»Warum kommt er hierher zurück, um das zu tun?« Wieder zeigte er mit einer kurzen Bewegung auf seine rechte Schläfe. Er senkte den Kopf und sah mich über die Gläser seiner Halbbrille hinweg an. »Wenn er’s nicht überIebt, kann man ihn nicht mehr fragen. Wenn doch, wird er’s nicht erklären wollen. Aber Sie – Sie könnten es vielleicht herausfinden … rein intuitiv, oder wie immer Sie arbeiten.«
»Intuitiv bin ich überhaupt nie«, gab ich zurück. »Ich kann mir höchstens was ausdenken.«
»Na also!«, sagte der Syndikus. »Dann tun Sie das!« Er hob grüßend die Hand, und sein Hund stemmte sich erst mit dem Hinterteil, dann mit den Vorderläufen hoch.
Vor einigen Jahren war mir ein kleines Erbe zugefallen, das es mir erlaubte, ein Haus zu suchen, gerade groß genug für mich, allenfalls mit einem Gästezimmer als besonderem Luxus ausgestattet. Übers Internet geriet ich schließlich an einen grauen, zu Beginn der Sechziger Jahre in strenger Sachlichkeit entworfenen Würfel mit Lichtbändern aus Glasbausteinen und einer Garage, in der ich freilich nur ein Fahrrad unterzustellen hatte. Mir sah das alles danach aus, als sei es als Muster für diesen Teil der Siedlung gedacht gewesen, geradezu als Lebensentwurf für die aufstrebende, bereits zaghaft motorisierte junge Arbeiter- und Angestelltenfamilie jener Jahre, in denen es noch auf jeden Quadratmeter ankam, der eingespart werden konnte. Das störte die jungen Familien auch gar nicht, aber sie wollten lieber ein klein’ Häuschen mit spitzem Giebel, und der futuristische Wohnwürfel blieb ein aus vergangener Zukunft gefallener Solitär.
Gekauft habe ich es allerdings nicht darum, sondern weil der Preis gerade noch in dem mir gesetzten Rahmen blieb. So bin ich in das mir bis dahin völlig unbekannte Bruggfelden gekommen, das Wohnzimmer samt integrierter Küche und Essnische ist jetzt zugleich mein Arbeitszimmer, mit Blick auf den handtuchgroßen, von einer Hainbuchenhecke gesäumten Rasen – aber was heißt Arbeitszimmer! Meine Texte dümpeln als Flaschenpost im Ozean der Nichtbeachtung. Trotzdem habe ich keinen Grund zum Jammern: Meine Rente reicht für Strom, Grundsteuer, die Pasta und eine Flasche Wein alle zwei Tage. Ich fügte mich in die Dinge, und auch die Dinge schienen sich zu fügen und nahmen mich hin.
Als ich von meinem Morgenspaziergang zurückgekommen war, fand ich in meiner Post ein Schreiben der Stadtverwaltung. Man muss nicht alles lesen, was einem vorhersehbar kein Vergnügen bereiten wird, und so ließ ich den Brief liegen, setzte mich an meinen Laptop und schaltete das Internet ein. Der Name Morgart ist nicht häufig, und für Markus Morgart fand ich nur zwei Einträge, die ich hier kommentarlos wiedergeben will. In dem einen, datiert vom Januar diesen Jahres, war er vermerkt als Aufsichtsratsvorsitzender der »Real Estate Ararat AG« mit Sitz in Frankfurt am Main, an persönlichen Angaben dazu nur die Mitteilung, dass er 56 Jahre alt sei und in Bruggfelden/Regierungsbezirk Herrenmünster geboren. Eingeblockt in die Meldung war das Porträtfoto eines Mannes mit graumeliertem, im Stil »Großer Junge« verstrubbeltem Haar, das keinen Ansatz einer Stirnglatze erkennen ließ, und einem vollen, runden, gebräunten Gesicht, zu einem knappen Lächeln gezwungen, um eine Reihe tadelloser weißer Zähne freizulegen. Weitere besondere Merkmale? Breite Nasenflügel, schmale Oberlippe, die fleischige Unterlippe herunterhängend, als hätte eine Vorfahrin einst einem der Habsburger Herren gefällig sein müssen. Vor allem aber fiel mir auf, wie dieser Große Junge zur Kamera sah – es war ein abtastender, besorgter Blick, als müsse er vor jedermann, auch vor dem Fotografen, auf der Hut sein.
Der zweite Eintrag stammte von einer linksalternativen Wochenzeitung, die in einer bereits vor Jahren erschienenen Reportage über das Geschäft mit der Sozialhilfe die »legendären Millionengewinne« erwähnte, die ein gewisser Markus Morgart im Berlin der Neunziger Jahre durch die Nutzung abbruchreifer Häuser als Obdachlosenunterkünfte erzielt habe. Ich wollte beide Einträge ausdrucken, musste dazu aber erst neues Papier einlegen. Die Reportage über das Geschäft mit den Obdachlosen kam ohne Probleme aus dem Drucker, als ich aber die Notiz mit Morgarts Foto aufrufen wollte, war weder Notiz noch Foto mehr vorhanden … Ich schüttelte den Kopf, schaltete den Laptop aus und versuchte einen Neustart. Wieder Fehlanzeige. Wenige Minuten, nachdem ich vom Bildschirm den Firmennamen Real Estate Ararat AG abgeschrieben hatte, wollte das Internet eine solche Firma nicht mehr kennen, von deren Aufsichtsratsvorsitzendem ganz zu schweigen.
Ich ging in die Küche und schenkte mir ein Glas Rotwein ein (aus der Flasche, die ich am Vorabend dann doch noch geöffnet hatte), und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. So etwas gelingt allenfalls, wenn man es sich nicht vornimmt. Also setzte ich das Wasser für die Pasta auf, begann eine halbe Zwiebel zu schneiden, warf zwei Tomaten ins heiße Wasser, damit ich sie danach abschrecken und die Schale abziehen konnte – alles Verrichtungen von beruhigender Banalität, die einen davor bewahren sollten, auf der Suche nach einem Sinn des Lebens oder von sonst Irgendetwas zum Idioten zu werden.
Nach einem Teller Pasta, einem zweiten Glas Rotwein und einem Kaffee rief ich den Rektor an – der Tag sei so schön, ich würde die Hexe deshalb gerne früher ausführen, ob das möglich sei? Natürlich war es das, und ich machte mich – das Fernglas umgehängt – mit dem Hund wieder auf den Weg zum Galgenbuck, der aber noch immer gesperrt war. Also bog ich in nordwestlicher Richtung ab und ging mit Hexe hinab ins felsige Tal der Schlechta, einem kleinen Bach, der sich gleichwohl im Zuge der jüngeren Erdgeschichte tief ins Gelände eingeschnitten hat … einem Bach? Was unterhalb unseres höher gelegenen, manchmal über Stege an einer Felswand vorbeigeführten Wanderwegs talwärts strömte, war ein Fluss, der weiter oberhalb – als sich das Tal weitete – die Wiesen und Weideflächen unter einer in der Sonne schimmernden Wasserfläche hatte verschwinden lassen.
Dort ließ ich die Hündin frei, sie lief die Böschung hinunter zu dem neuen See, verharrte kurz und tatschte erst mit den Vorderpfoten hinein, um dann in einem Anfall von schierer Lebenslust durch das Wasser zu rennen, gerade da, wo es nicht so tief war, dass sie hätte schwimmen müssen, bis sie schließlich nass genug war, um wieder zu mir herzukommen und bei mir ihr Fell auszuschütteln, dass sich ein ganzer Sprühregen über mich ergoss.
Vor uns kam die Abzweigung in Sicht, die nach Graumichelbach hinaufführt. Ohne groß nachzudenken, nahm ich sie, es war endlich einmal wieder ein schöner Tag, oben auf der Anhöhe würde man weit ins Land sehen können, den Kopf lüften und die Lungen dazu! Es gehört zu des Menschen Glück, dachte ich, sich an solchen Dingen erfreuen zu können – und während ich das dachte, verwies ich es mir gleich wieder, denn der Mann auf der Bank fiel mir ein. Manche leben in einem so tiefen Elend, dass sie … Moment! Was weißt du denn von den Leuten, die sich eine Kugel in den Kopf schießen? Meinst du vielleicht, man müsste nur ein wenig Sonnenschein aufziehen, und sie ließen es bleiben? Lass sie doch mal aufleuchten, die triumphierende Sonne und mit ihr die allerblühendste Frühlingspracht, zaubere es her, das Brausen und Sprießen der Natur samt all ihren Vöglein und Bienen und ihren honigsüßen brunzdummen Trieben, lass schimmern den blauen See und die schneebedeckten Berggipfel – und dann schau dich mal um, ob es da nicht den einen oder anderen gibt, der das alles nicht ertragen kann, der sich verkriecht und sich die Augen und Ohren zuhält, um das Tirilieren nicht zu hören und die rosarothimmelblaukanariengelbe Blumenpracht nicht zu sehen, und der sich am liebsten gleich vor den nächsten Zug werfen würde, falls die Bahnlinie noch nicht eingestellt ist!
Wir kamen auf die Anhöhe, auf der das Dorf Graumichelbach liegt, und ich nahm die Hündin wieder an die Leine. Im Westen sah man blaue Hügel- und Bergketten wie eine Verheißung – schnüre die Stiefel, packe den Rucksack und nimm den Weg unter die Füße. Zu welchem Ziel? Zu keinem. Der Weg ist das Ziel, das ist eine der am meisten ausgetretenen Allerweltsweisheiten und peinlicherweise nicht einmal falsch. Mit dem Fernglas holte ich mir die Kammlinie vor das Auge, dabei rutschte ich ein wenig ab und entdeckte zwischen dem Hell- und Dunkelgrün der Bergwälder das braunrot gefleckte Walmdach eines alten Bauernhofes, umgeben von einer Lichtung, an deren oberem Ende ein zweites Gebäude stand, mit hellroten Ziegeln gedeckt, ein Ferien- oder Wochenendhaus. Mir fiel ein, dass der Bauernhof – der wohl längst nicht mehr bewirtschaftet wurde – letztes Überbleibsel einer Siedlung sein musste, die Ende des 19. Jahrhunderts wegen Missernten und allgemeinem Elend aufgegeben worden war; der Syndikus hatte mir davon erzählt.
Ich setzte das Fernglas wieder ab, und wir gingen weiter, bis wir in das Dorf Graumichelbach kamen. Jahrhundertelang hatte sich auch hier kaum Wohlstand blicken lassen, aber als in den Jahren nach dem deutschen Wirtschaftswunder doch mehr Geld hereinkam, hatte das Ortsbild den geringsten Gewinn davon. Vor dem Gasthof zur »Sonne« waren Autos geparkt; ich hätte Lust auf ein Weizenbier gehabt, aber ich wollte es nicht darauf ankommen lassen, dass mich der Wirt wegen des nassen Hundes hinauswies. Außerdem lockte der blaue Horizont. Eine Weile folgten wir der Straße, die nach Westen und bergauf führte, vorbei am letzten Gebäude des Dorfes, einem Raiffeisen-Lagerhaus, dessen ausladendes Dach mit Solarpaneelen vollgepackt war. An einer Kreuzung gingen wir links und nahmen einen gekiesten Weg hinab ins Tal. Einige Zeit blieben wir im Schatten, den der Mischwald warf, vorbei an grau bemoosten Felsen. Weiter unten wandte sich der Weg noch einmal nach rechts, wir kamen aus dem Schatten heraus, vor uns lag einer der alten Steinbrüche, die hier früher betrieben wurden. Halb von der Sonne geblendet, sah ich vor mir eine Gestalt, die mir mit einer Hand abwehrend Zeichen gab, ich solle zurückgehen oder jedenfalls nicht näher kommen. Ich zog die Hündin an der Leine zu mir her, blieb aber nicht stehen, sondern ging an der linken Seite des Wegs – halb im Wald – vorsichtig weiter.
Die Gestalt vor mir – eine schmale grauhaarige Frau in einem Overall – war es zufrieden, jedenfalls hatte sie aufgehört, mit der Hand zu fuchteln, und sich auch von uns abgewandt. Sie hantierte mit Kamera und Teleobjektiv und nahm offenbar ein Motiv in dem verwitterten, in der Sonne grau und manchmal gelb schimmernden Steinbruch ins Visier. Es kam mir so vor, als sei sie an der Struktur der Steine und ihrer Bruchlinien interessiert, dann sah ich, dass das Objektiv auf ein grau-schwarzes Knäuel gerichtet sein musste, das auf einem Felsblock in der Sonne lag.
Ich gab der Hündin einen Klapps als Zeichen, dass sie Sitz machen solle, und nahm mein Fernglas auf. Ich musste es erst auf die Nähe einstellen und brauchte dann eine Weile, das Knäuel ins Blickfeld zu bekommen.
Es war eine Schlange. Zusammengeringelt, wohl nicht größer als eine Ringelnatter, der graubraune Körper von dunklen Querstreifen oder Balken überzogen. Der wie eine altertümliche Speerspitze geformte Kopf mit dem unangenehm aufgestülpten Maul war ein wenig zurückgenommen, so, als wollte das Reptil jeden Augenblick zustoßen. Offenbar hatte es ein Sonnenbad genommen und die Fotografin inzwischen als mögliche Gefahr erkannt. Ich veränderte die Einstellung meines Fernglases, sah nun aber gar nichts mehr außer verschwommenen graubraunen Flecken, drehte weiter an der Einstellung … Unvermittelt starrten mich kalte gelbe Augen an, Augen mit senkrechten Pupillen, die so nahe schienen, so unvermittelt vor meinem Gesicht, dass mir ein Schauder über den Rücken lief. Entsetzt ließ ich das Fernglas sinken – und da war das Knäuel auch schon verschwunden. Der Felsblock lag allein in der nachmittäglichen besonnten Stille, und von der Schlange spürte ich nur noch den Blick dieser gelben Augen, die nun irgendwo zwischen Steinen und Unterholz verborgen sein mussten.
»Jetzt ist sie weg«, sagte die Frau und wandte sich mir zu. »Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen, aber Sie hätten nicht näher kommen sollen.«
Ich bat um Entschuldigung und sagte, ich hätte zunächst gar nicht begriffen … Schon wieder redest du dummes Zeug, dachte ich dann, ihr Handzeichen war ja eindeutig genug gewesen. Es tue mir aufrichtig leid, fuhr ich fort und fragte, ob das eine Kreuzotter gewesen sei.
»Eine Aspisviper«, kam die Antwort. »Nicht ganz so … oder vielmehr: anders giftig als die Kreuzotter. Man sollte sie nicht unterschätzen. Ich weiß von einem Fall, da ist jemand an ihrem Biss gestorben, vielleicht nicht am Gift selbst, sondern an einer besonders heftigen Abwehrreaktion oder am Schock, und wie es Ihrem Hund erginge, will ich lieber nicht wissen.«
Wie es Ihrem Hund erginge … Leute in Overalls reden sonst nicht so. Ich sah sie an. Auch ihr Gesicht war schmal, mit einer Habichtnase und lebhaften Augen, die den Hund neben mir und mich musterten, nicht einmal feindselig, sondern aufmerksam, wie das jemand tut, der sich ein Bild machen will.
Ich erkundigte mich, ob diese Viper hier heimisch sei.
»Aber ja«, kam die Antwort. »Sie braucht warmes trockenes steiniges Gelände, gerne in Südlage. Sonst findet man sie vor allem in den Alpen und in den Pyrenäen.«
»Sie sind …« Ich suchte nach dem richtigen Wort. »Zoologin? Wie nennt man das, wenn sich jemand auf Schlangen spezialisiert hat?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie dann, »keine Herpetologin. Ich bin Malerin.«
Ich machte ein höfliches Gesicht, wollte dann aber doch wissen, ob sie denn also Schlangen male? Um zu merken, wie blöd die Frage ist, muss man sie sich nur einmal laut vorsprechen.
Sie schien aber nicht beleidigt. »Ich habe einen Auftrag, bei dem es um die Darstellung einer Schlange geht … Sie muss so gezeigt werden, dass ihr Abbild etwas bewirkt. Aber eben nicht nur Schauder oder Angst oder Abscheu, oder jedenfalls nicht allein.« Sie begann, ihre Fotoausrüstung in einer Tragetasche zu verstauen. »Vielleicht werde ich … ach, ich weiß noch immer nicht, wie ich das darstellen will oder kann. Aber ich muss als Erstes etwas von dem verstanden haben, was eine Schlange ist.« Sie sah zu mir auf. »Deswegen kann ich auch nicht in die Reptilienabteilung eines Tiergartens gehen. Oder zu jemand, der Schlangen in Terrarien hält … Wenn ich ein Tier in Gefangenschaft beobachte, dann sehe ich nur die Gefangenschaft.«
Ich sagte, dass mir das einleuchte, und weil mir sonst nichts einfiel, stellte ich mich vor. »Und das da« – ich zeigte auf die Hündin, die das Sitzen leid geworden war und sich auf die Seite gelegt hatte – »ist die Hexe, ihr richtiger Herr ist der alte Rektor Haeberlin, aber für den ist das Hunde-Ausführen arg mühsam geworden.«
Die Malerin nickte höflich. Ihr Name sei Abendstern, sagte sie dann, »Vera Abendstern …« Mir fiel ein, dass ich den Namen schon einmal gehört hatte, aber ich konnte mich nicht erinnern, in welchem Zusammenhang das gewesen war. Also sagte ich vorsichtshalber nichts, außerdem wollte sie wissen, ob ich denn ebenfalls Pädagoge sei wie des Hundes richtiger Herr.
»Oh!«, sagte ich, »das hat von mir bisher noch niemand vermutet.« Ich erklärte ihr, dass ich in einem früheren Leben Journalist gewesen sei und jetzt als Rentner meine Tage verbringe.
»Sie waren Journalist?«, echote sie. »Im Feuilleton?« Irgendwie klang das etwas scharf, fast argwöhnisch.
Ich sagte ihr, dass ich Lokalredakteur gewesen sei. »Was man von unsereinem las, war von gestern und morgen Gottseidank schon wieder vergessen. Was will man mehr?« Inzwischen waren wir beide in derselben Richtung weitergegangen, ich überlegte, ob sie wohl ebenfalls nach Bruggfelden wollte.
»Da bin ich beruhigt«, meinte sie, erklärte sich aber nicht weiter. Vor uns kam eine Weggabel in Sicht, und sie blieb stehen. »Ich nehme an, Sie müssen nach Bruggfelden … Ich biege hier ab, zum Weiler Schwarzhalden, man hat mir dort ein Atelier überlassen …« Beim Abschied versprach ich noch, in den nächsten Tagen alle sonnenbeschienenen Steinbrüche und Geröllhalden zu meiden, um ihr nicht noch einmal die Studienobjekte zu vertreiben.
Als ich weiterging, fiel mir ein, dass Schwarzhalden der Name des aufgegebenen Dorfes war, von dem mir der Syndikus erzählt hatte.
Eine Dreiviertelstunde später klingelte ich an der Tür des Rektors. Als er öffnete, schien er verärgert, ja geradezu aufgebracht. Im ersten Augenblick dachte ich, er nehme es mir übel, weil ich länger unterwegs gewesen war als üblich, und wollte ihm erklären, dass der Weg zum Galgenbuck gesperrt sei, aber er ließ mich gar nicht zu Wort kommen. »Haben Sie das auch bekommen?«, fragte er und zeigte mir anklagend ein irgendwie amtliches Schreiben. »Die wollen Flüchtlinge bei mir einquartieren, hier bei mir, was denken die sich denn – vielleicht in meinem Schlafzimmer?«
»Flüchtlinge?«, fragte ich.
»Ja doch!«, stieß er hervor. »Dieses Hochwasser im Norden – schauen Sie denn kein Fernsehen? Auf allen Kanälen kommt das … ganze Wohnviertel – ach was! Ganze Städte müssen jetzt geräumt werden, aber es müsste doch genug Notunterkünfte geben, Turnhallen, Kirchen, Kasernen, was weiß ich! Aber doch nicht bei einem alten kranken Mann …«
Beruhigend sagte ich etwas in der Art, dass er der Stadt einfach mitteilen solle, er könne wegen seiner Erkrankung leider niemand aufnehmen. Auf das Wort »Erkrankung« hin würden bei den Beamten im Rathaus sofort die Warnlampen aufleuchten – und sei es nur darum, dass irgendjemand behaupten könnte, in Bruggfelden würden Obdachlose zur Betreuung von Schwerkranken eingesetzt. Aber das sagte ich nicht, sondern dachte es nur.
Immerhin war es mir gelungen, ihn zu beruhigen, und so konnte ich ihn bitten, ob ich das Fotoalbum seiner Schüler aus den späten Sechziger Jahren noch einmal sehen könne. Er blickte mich verwundert an, wies dann aber widerstrebend in Richtung seines Wohnzimmers. Dort ließ er mich am Tisch stehen, wollte dann aber genau wissen, welches Album ich meine, und ich sagte ihm, dass es das mit Pascal und Claudia sei.
»Ach so!« Er schlug sich vor die Stirn. »Ich hatte Ihnen ja von den beiden erzählt!« Er brachte das Album und schlug es an der Stelle auf, die er mir gestern gezeigt hatte, und ich deutete nicht auf Pascal und auch nicht auf Claudia, sondern auf das struppige Kerlchen – das sei doch Markus? Ob er mir den Nachnamen sagen könne?
Das Befremden in seinem Gesicht verstärkte sich. So ganz sicher sei er sich da nicht mehr, behauptete er plötzlich, nach so vielen Jahren!
»Außerdem sollte ich schon wissen, warum ich Ihnen eine solche Auskunft …«
Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern sah mich nur halb hilflos, halb entrüstet an. Haeberlin war zuckerkrank, irgendwoher glaube ich zu wissen, dass manche Diabetiker zu Wutausbrüchen neigen. Vom Selbstmordversuch eines seiner ehemaligen Schüler erzählte ich ihm besser nichts. Also murmelte ich etwas von einem Artikel über den CEO eines international operierenden Unternehmens, »einem gewissen Markus Morgart, er müsste so um die sechsundfünfzig Jahre alt sein und ist in Bruggfelden geboren, und weil Sie mir gestern dieses Foto …«
Er blickte noch immer misstrauisch, schien sich aber allmählich zu beruhigen. »Morgart? Markus Morgart? Hier geboren? Und sechsundfünfzig? Ja doch, das kommt hin …«
Ja, bitte?« Die Stimme der Frau klang höflich, aber kühl. Sie hieß Claudia Wronski, war Gymnasiallehrerin, und ihr Anschluss war nicht im Telefonbuch eingetragen. Haeberlin hatte mir die Nummer in einem Anfall von Hilfsbereitschaft gegeben, als wolle er sein anfängliches Misstrauen gutmachen. Ich nannte meinen Namen, und sofort unterbrach sie mich.
»Ich weiß, wer Sie sind.« Die Stimme klang nicht mehr ganz so kühl. »Sie führen die Hexe aus.«
Das war nicht zu bestreiten. Bruggfelden ist eben eine kleine Stadt. Warum aber rief ich sie an? »Mich beschäftigt …« – Ja was? Der Fall? Das Schicksal? – »mich beschäftigt das Schicksal eines gewissen Markus Morgart. Kann es sein, dass er ein Mitschüler …«
»Allerdings erinnere ich mich an einen Jungen, der so heißt«, kam es durch das Telefon. »Ihr Anruf überrascht mich auch keineswegs, denn Haeberlin hat mich vorgewarnt. Übrigens hatte er kein Recht, Ihnen meine Telefonnummer zu geben. Was mich aber mehr stört … nein, nicht stört, sondern beunruhigt, ist Ihre Formulierung – das Schicksal von … Das klingt nicht gut. Gestern Nacht soll sich jemand eine Kugel in den Kopf geschossen haben, auf der Promenade über der Stadt – so habe ich es jedenfalls heute Morgen gehört. Sie werden mir jetzt nicht sagen, dass …« Sie sprach den Satz nicht zu Ende, aber es war auch so klar, was sie wissen wollte. Ich sagte ihr, dass ich nur über Informationen aus zweiter Hand verfüge. Danach aber handle es sich bei dem 56jährigen Mann, der in der Nacht mit einer schweren Kopfverletzung in das Universitätsklinikum geflogen worden sei, tatsächlich um einen Markus Morgart, gebürtig aus Bruggfelden.
»Von wem haben Sie das?«
Der Syndikus Welsheim hatte mir das vertraulich gesagt. Das hatte ich nicht vergessen. Aber ich bin ein schwacher Mensch und sagte es ihr.
»Welsheim?«, fragte sie zurück. »Der hat doch immer noch überall seine Drähte … Haeberlin schien davon aber nichts zu wissen.«
»Das konnte er nicht. Ich habe es ihm nicht erzählt.«
»Warum nicht?«
»Er war mir zu rot im Gesicht.«
»Ah ja?«, kam es zurück. »Dann war das wohl richtig … Und nun wollen Sie mit mir über Markus reden … aber warum? Und was genau wollen Sie eigentlich von mir wissen?«
Ich erklärte ihr, dass ich Morgart gestern Abend noch getroffen habe, möglicherweise kurz vor seinem Suizidversuch, und deshalb gerne wüsste, ob er Angehörige hat, denen ich das mitteilen sollte. »Obwohl wir nur ein paar Worte gewechselt haben …«
»Angehörige?«, fragte sie zurück. »Hat er wohl nicht, soviel ich weiß … Im Übrigen sollten Sie sich besser an die Polizei wenden. Natürlich kann ich Ihnen ein paar Dinge über ihn sagen, aber am Telefon würde ich das ungern tun. Wissen Sie, wo ich wohne?«
Eine halbe Stunde später fuhr ich mit dem Lift in das oberste Stockwerk einer Wohnanlage im Westen der Stadt. Oben nahm mich eine große dunkelhaarige Frau in Empfang, einen Augenblick lag eine kräftige kompakte Hand in der meinen, dann ging sie mir voran in die Wohnung, ich registrierte ausgebleichte Jeans, einen grobmaschigen grauen Wollpullover sowie ruhige geschmeidige Bewegungen. Sie führte mich in einen sparsam möblierten Wohnraum, dessen Fensterfront den Blick auf die Stadt freigab. Die Dämmerung hatte eingesetzt, eine Stehlampe beleuchtete links eine Bücherwand, rechts zog ein großformatiges, etwas beunruhigendes Bild in Schwarz und Weiß und Rot den Blick auf sich, darunter stand ein Teetisch, bereits gedeckt, im Rechaud brannte das Teelicht, auch waren zwei Kerzen angezündet.
II. CLAUDIA WRONSKI
Warum ich keine Helga leiden kann
Mittwoch, 13. März
Lukas Gsell ist ein mittelgroßer, grauhaariger Mann, mit hagerem Gesicht und Dreitagebart. Bei der einen oder anderen Veranstaltung hatte ich ihn wohl schon gesehen. Auch in einer Stadt wie der unseren hat ein fremdes Gesicht zunächst keine Bedeutung, nur wenn man es das zweite oder dritte Mal sieht, wird es registriert: Wer ist das, was will der hier, zu wem gehört er? Vermutlich hat es damit zu tun, dass sich niemand vorstellen kann, es würde sich jemand ohne einen besonders zwingenden Grund gerade hier niederlassen.
Ich nahm ihn am Aufzug in Empfang, wir tauschten einen Händedruck, ich brachte ihn ins Wohnzimmer und bat ihn an den Teetisch. Dabei bemerkte ich, dass er die beiden brennenden Kerzen bemerkte, sie waren wirklich too much, was hatte ich mir nur dabei gedacht!
Ich wies ihm den Platz mit Blick zum Fenster an und schenkte ein und bot das Gebäck aus der Konditorei am Unteren Torturm an, war umsichtig und freundlich und ließ es zu, dass er mir zusah und mit den Augen den Bewegungen meines Körpers folgte. Er fand einige lobende Worte über den Tee, zu dem er keinen Zucker nahm, und knabberte anstandshalber an einer Madeleine, aber dann wollte ich doch lieber zur Sache kommen.
Es sei also Markus Morgart gewesen, der das getan habe, sagte ich dümmlich, und weil mir sonst nichts einfiel, schob ich die Frage nach, was ihn – Gsell – eigentlich mit Markus verbinde?
Nichts, kam die Antwort, nichts verbinde ihn mit Morgart, höchstens des Rektors Hund. Und er erzählte mir von dem nächtlichen Spaziergang, von dem Mann im dunklen Mantel und Hexes Bellerei, von seiner hastigen Entschuldigung und der resignierten, abwehrenden Handbewegung …
Ich unterbrach ihn und fragte, ob er sich jetzt Vorwürfe mache? Das könne er vergessen. Markus hätte sich von einem Fremden nichts sagen lassen. Und helfen schon gar nicht. Er schien es zu hören, aber ich hatte das Gefühl, dass er überhaupt nicht darauf achtete, was ich sagte. Haeberlin hatte behauptet, Gsell sei Schriftsteller. Wollte er über den Fall Morgart schreiben? Ich fragte nach, aber er schüttelte den Kopf. Er sei kein Schriftsteller. Oder keiner mehr. Und über den Mann auf der Bank am Waldweg würde er auf keinen Fall schreiben wollen.
Es folgte eine längere Erklärung. Er sei Morgart begegnet, als dieser sich in einer existenziellen Lebenskrise befunden habe, und was habe er – Gsell – da getan? Er sei blind und stumpf weitergelaufen, als ob ihn dieser andere Mensch nichts anginge. Zwar glaube er sofort, dass er ihm nicht hätte helfen können – er sei nicht gut im Helfen. Aber er habe ihn gestört. In einem Augenblick, in dem dieser Mensch vielleicht nichts so sehr gebraucht habe wie Ruhe, Besinnung oder einfach nur Schweigen – ausgerechnet in diesem Augenblick sei er, Gsell, erschienen und mit ihm dieser kläffende Hund, den er nicht unter Kontrolle gehabt hatte. Wie solle man damit umgehen?
Statt einer Antwort fragte ich, ob er diese Geschichte nicht auch eine Nummer kleiner habe, weniger melodramatisch? Ich betrachtete ihn und sah in seinem Gesicht, wie er die seelischen Rollläden herunterließ. Ich hätte völlig Recht, sagte er, er dürfe sich das Elend eines Anderen nicht ans Revers heften wie einen Trauerflor, so etwas sei ungehörig. Aber bevor ein Mensch so etwas tue … – er hob die rechte Hand und deutete mit dem Mittelfinger auf seine Schläfe –… bevor jemand so etwas tue, da müssten sich in seinem Kopf doch die Gedanken jagen, selbst dann, wenn er sich absolut sicher sei, dass es geschehen müsse, gerade dann … Solle er es jetzt gleich tun, sofort, auf der Stelle? Oder noch den nächsten Schlag der Kirchenglocke unten im Tal abwarten? Vielleicht wolle sich so jemand an etwas erinnern, das ihn fröhlich gemacht habe, an einen Augenblick des Glücks, und …
»Und da kommt dieser Hund und kläfft!«
Ich sagte ihm, er solle es jetzt mit diesem armen Hund gut sein lassen. Irgendetwas ritt mich, ihm ein wenig einzuheizen, und ich fragte ihn, welche Erinnerung denn er aufrufen würde?
Wie von selbst zogen sich die Rollläden wieder hoch und ließen taghelle Verlegenheit aufleuchten. Er hob den Kopf, sah mich an und versuchte ein schiefes Lächeln. Offenbar rede er von Dingen, sagte er, von denen er keine Ahnung habe. Er habe so etwas noch nie tun wollen.
Wirklich nicht?, ging es mir da durch den Kopf. Aber warum ich ihm nicht glauben wollte, weiß ich nicht. Tröstend sagte ich, er solle sich nichts daraus machen. Allerdings gehe das Bild, das er sich von dem Mann auf der Bank mache, mit meiner Erinnerung an Markus Morgart nicht zusammen … Ich schwieg einen Augenblick, und er setzte sofort nach: Ob ich etwas von ihm erzählen wolle?
Wollte ich das? Ich wusste es nicht. Er, der Besucher Gsell, sei mir sehr fremd, sagte ich zögernd, und er meinte, dass ich dem sehr Fremden gegenüber ja ganz unbefangen sein könne, und aus irgendeinem Grund oder weil ich nichts zu antworten wusste, hob ich beide Hände und griff hinter meinen Kopf und löste den Knoten, mit dem meine Haare zusammengebunden waren. Dann schüttelte ich den Kopf, dass die Haare frei fallen konnten, und hörte ihn sagen, dass ich das Haar immer so tragen solle.
Sie verstehen sich auf so etwas?, wollte ich wissen, aber bevor er antworten konnte, schob ich nach, ob sich der sehr Fremde nicht sehr wundern würde, wenn ich plötzlich ganz unbefangen wäre? Dann hielt ich endlich den Mund, es war diese gefährliche Stunde der Dämmerung, die Kerzen brannten, und wir sahen uns an.
Ein Klingeln brach in das Schweigen.
Ich hob die Hände und ließ sie wieder fallen, stand auf und ging zu dem Regal, auf dem das Telefon stand, und meldete mich. Durch die Leitung drang ein Wortschwall, aufgeregt und wichtigtuerisch zugleich teilte mir der Direktor unseres Gymnasiums mit, dass die Turnhalle für die Aufnahme von Obdachlosen aus den Hochwassergebieten hergerichtet werden müsse! Umgehend! Unverzüglich! Und so war die Teestunde bereits wieder beendet, denn ich bin in der Schulleitung für den Sportunterricht und damit auch für Turnhalle und Sportgerät zuständig.
Gsell war zu Fuß gekommen, so nahm ich ihn in meinem Auto mit in die Stadt, wo er abgesetzt werden wollte. Unterwegs sagte ich ihm, es sei offenbar die größte Sorge des Rektors, dass die Obdachlosen nur ja nicht mit schuleigenen Bällen herumkickten! So ein Mensch sei das, ob man sich so etwas vorstellen könne?
Von den Menschen könne er sich sehr viel, fast alles vorstellen, antwortete er, im Bösen mehr als im Guten, aber manchmal geschehe ganz Unerwartetes.
Und manchmal ist es, wie es ist, hörte ich mich sagen, als wir in die Hauptstraße einbogen. Ich steuerte einen freien Parkplatz an, legte ihm aber kurz die Hand auf den Arm, als er die Wagentür öffnen wollte. Nun hätte ich ihm gar nichts über Markus erzählt, sagte ich, deswegen sei er doch gekommen, und er schlug mir vor, dass wir uns an einem der nächsten Tage noch einmal treffen könnten. Wann immer es mir günstig sei, er richte sich nach mir. Solches Gesumms eben, aber aus irgendeinem Grund ging ich nicht darauf ein.
In der vierten Klasse, sagte ich und schaltete den Motor aus, in der vierten Klasse sei Markus in der zweiten Reihe gesessen, ein paar Plätze von mir entfernt. In der zweiten Reihe, damit ihn der Lehrer immer im Blick hatte. Es gebe Kinder, fuhr ich fort, die seien wie Quecksilber. Die platzen vor Energie. Vor Einfällen. Manchmal wäre es das Beste, man würde sie selbst den Unterricht halten lassen.
Er wollte wissen, was später war. Ob Markus mit auf das Gymnasium kam?
Ich schüttelte den Kopf. Nein, sagte ich, er kam nicht mit.
Und dann erzählte ich, wie es war. Wie es Markus auf einmal, mitten im Schuljahr, nicht mehr gab. Er war weg. Einfach so. Ich hatte nicht verstanden, wie das sein kann. Markus sei weggezogen, hatte der Lehrer nur gesagt und einem anderen Jungen seinen Platz gegeben.
Kinder nehmen so was doch hin, sagte er. Ich hätte das aber offenbar nicht getan. Warum nicht?
Richtig, antwortete ich, ich wollte es nicht hinnehmen. Und dann erklärte ich ihm, warum ich bis auf den heutigen Tag keine leiden kann, die Helga heißt. Denn die erste Helga war so eine, die immer was wusste, was die anderen nicht wissen.
Gehorsam fragte er nach, was das gewesen sei, das die anderen nicht gewusst hätten? Ich hob ein wenig die Stimme: dass dem Markus seine Mutter gestohlen hat. Deswegen haben sie weg müssen, der Markus und seine Mutter.
Gestohlen?, fragte er nach. Im Laden?
Nein, sagte ich, wieder mit normaler Stimme. Markus’ Mutter habe nicht im Laden gestohlen. Sie sei Kirchenpflegerin gewesen, in der Johannes-Gemeinde hier, habe also die Kasse verwaltet, und in der hätte irgendwann ein Tausender gefehlt, oder vielleicht auch ein paar mehr.
Gsell wollte wissen, ob die Frau vor Gericht gekommen sei, aber davon weiß ich ja nun wirklich nichts, das neunjährige Mädchen, das ich damals war, hatte ja nicht einmal verstanden, wieso in der Kirche Geld wegkommen kann. Es heißt doch: Jemand sei arm wie eine Kirchenmaus.
Als wir uns verabschiedeten, war über ein Wiedersehen nicht weiter gesprochen worden; ich versprach ihm nur, ich würde ihn anrufen, wenn ich noch etwas über Markus Morgart erfahren sollte. Die nächsten Stunden waren damit ausgefüllt, dass wir – also ich und die murrenden Kollegen, die sich von unserem Direktor hatten erreichen lassen – Matten, Turn- und anderes Sportgerät im Magazin verstauten. Ich kam sehr spät nach Hause zurück, und erst da fiel mir endlich ein, was ich noch vor dem Besuch dieses Lukas Gsell hätte tun sollen. Ich versuchte, Pascal anzurufen, denn es gehört zu dem Rest unserer Vertrautheit, dass ich dies auch zu später Stunde tun kann.
Tatsächlich erreichte ich ihn in seiner Penthouse-Wohnung in Herrenmünster. Wie immer klang er sehr herzlich, aber von dem, was Markus zugestoßen war, wusste er nichts. Das sei sehr seltsam, meinte er, und es klang fast aufgebracht, als dürfe sich niemand eine Kugel in den Kopf schießen, ohne vorher Pascal Helffenstein in Kenntnis zu setzen. Weiter behauptete er, Markus sei in den letzten Jahren nur mehr geschäftlich nach Herrenmünster gekommen, habe eine Zeitlang in New York gelebt und dann in Paris, und dass er in irgendeine finanzielle oder unternehmerische Schieflage geraten sei, daran glaube er nicht, außerdem habe es jetzt keine Bedeutung. Eine Kugel im Kopf könne einer auch überleben, glücklicherweise kenne er einen der Chefärzte in der Neuro-Chirurgie des Uni-Klinikums, den wolle er unverzüglich kontaktieren, er werde mich sofort zurückrufen, sobald er etwas erfahren habe.
Ich legte auf und ging ans Fenster und sah in die Dunkelheit hinaus. Es ist das Wesen der Bourgeoisie, dachte ich, dass ihre Angehörigen glücklicherweise immer jemanden kennen, der nützlich ist oder Nützliches weiß, aber warum nur hatte mich das Telefonat mit Pascal plötzlich so aufgebracht? Nein, nicht aufgebracht, er war mir nur auf die Nerven gegangen. Gewiss, wir waren noch immer befreundet, oder taten jedenfalls so, aber mit dem Jungen von damals hatte dieser Mensch nichts mehr gemein, absolut nichts, das Land, das lange zögert, eh es untergeht, hatte den Jungen Pascal mitgenommen, und mit Markus würde es mir wohl ebenso ergehen, wenn Markus überhaupt noch …
Eine Kugel im Kopf kann einer auch überleben.
Pascal rief an diesem Abend nicht mehr an und auch nicht am nächsten Tag, der außerdem damit ausgefüllt war, dass wir das Sportgerät, das wir am Vorabend weggeräumt hatten, wieder in die Turnhalle zurückbringen mussten, denn der Direktor hatte in seinem vorauseilenden Gehorsam wieder einmal alles falsch verstanden. Tatsächlich sollte nur in Abstimmung mit der Stadtverwaltung ermittelt werden, wie viele Flüchtlinge nach Maßgabe von Stellfläche, Toiletten und Waschgelegenheiten notfalls untergebracht werden könnten. Das sei alles aber kein Schaden, erklärte der Direktor in der Morgenkonferenz selbstgefällig und mit feuchter Aussprache, denn nun habe man eine Generalprobe absolviert und könne gefasst den Herausforderungen etc. …
Es sei doch schön, flüsterte Pfarrer Rübsam mir hinter vorgehaltener Hand zu, dass der Staat diese Direktorenposten geschaffen habe, für all diese armen Menschen, die sonst zu nichts zu gebrauchen seien. Ich gab zurück, dass ich ganz im Gegenteil auf den Unsinn, den diese Leute dann als Direktoren anrichten, gerne verzichten würde. – Rübsam ist Pfarrer der evangelischen Kirche und hält bei uns vier oder acht Stunden Religionsunterricht, aber ich schweife ab.
Es kam das Wochenende, und ich fuhr hinauf nach Schwarzhalden, wo mir noch immer das Ferienhaus meines verstorbenen Großvaters gehört. Der Wohnkomfort ist äußerst bescheiden, elektrisches Licht ebenso wie warmes Wasser gibt es erst seit letztem Jahr, als ich auf dem Dach Windrad und Solaranlage installieren ließ – der Alte hatte sich noch mit Petroleumlampen begnügt. Was würde er erst sagen, wenn er wüsste, dass wir inzwischen via Mobilfunk und also auch übers Internet erreichbar sind!
Das Haus ist mir … ach, ich wollte Zuflucht schreiben, aber das ist schon wieder zu hoch gehängt. Ich bin gern dort oben, und als ich den Kachelofen eingeheizt und sich auch noch Vera – eine Flasche Rotwein unterm Arm – eingefunden hatte, wurde es ein netter Abend. Vera ist Malerin, und ich war ihr behilflich gewesen, den alten Glotterhof zu mieten – irgendwer aus dem Kollegium hatte mir von ihr erzählt und dass sie gerne ein Anwesen auf dem Land mieten oder pachten würde. Das war gerade in der Zeit, in der die Erben des Glotterhofes händeringend jemanden suchten, der mit dem alten Gemäuer etwas anfangen konnte. Ich brachte die beiden Parteien zusammen, um auch einmal von einer guten Tat zu berichten. – Vera selbst malt mir zu gegenständlich, sie kommt mir vor wie eine späte Nachfahrin von Werner Tübke oder einem anderen der DDR-Maler – will sagen, ich respektiere sie, aber ihre Arbeiten treffen nicht meinen Geschmack.
Als ich spät am Sonntagabend zurück nach Bruggfelden und in meine Wohnung kam, blinkte der Anrufbeantworter meines Telefons, Pascal hatte die Nachricht hinterlassen, dass Markus Morgart außer Lebensgefahr sei und voraussichtlich in der kommenden Woche in die Neurologische Rehabilitationsklinik Niederzell verlegt werde.
Das war mir etwas zu dürftig, und so nahm ich das Telefon und wählte die Nummer der Penthouse-Wohnung in Herrenmünster. Es klingelte ein paar Mal, dann meldete sich eine … ach, eine junge Stimme eben, wie einem das so passieren kann, wenn man bei Pascal anruft. Aber ich wollte nicht stören und bat um Entschuldigung, aber da hatte dieses … dieses Geschöpf den Hörer bereits weitergegeben, Pascal meldete sich und versicherte eilends, nein! ich störe jetzt nicht, jetzt gerade nicht, aber mehr, als er auf den Anrufbeantworter gesprochen habe, wisse er wirklich nicht.
Das heißt, fügte er hinzu, was Markus mit sich angestellt habe, sei nicht ganz folgenlos geblieben. Er habe Bewusstseinsstörungen, oder jedenfalls eine Amnesie, ich dürfe mich also nicht wundern, wenn er mich nicht erkennen sollte – falls ich ihn denn besuchen werde. Ich sagte, dass ich das davon abhängig machen wolle, was Markus’ Ärzte meinten, und erzählte ihm kurz von diesem Lukas Gsell und dessen Begegnung mit dem Mann auf der Bank. Ob dieser Mensch nicht vielleicht ein interessanter Ansprechpartner sei, sei es für Morgart, sei es für die Ärzte?
Am nächsten, schon wieder unfreundlichen und grau verhangenen Tag rief ich Gsell an. Ob er noch immer an Markus Morgart interessiert sei und – wenn ja – heute Abend Zeit hätte? Beides traf zu, und so holte ich ihn am Abend in seiner Junggesellen-Klause ab. An dem Haus oder Häuschen war ich das eine oder andere Mal vorbeigefahren, der Anblick war mir nicht ganz fremd; innen war es mit einer Mischung aus Sperrmüll und schwedischem Allerweltdesign eingerichtet; in den Regalen aus unbehandeltem Fichtenholz stapelten sich vor allem Taschenbücher. Gsell selbst trug zu einem ausgebeulten Tweed-Sakko ein schwarzes Hemd und hatte sich sogar eine rote Krawatte um den Hals gezurrt – eine andere besitze er nicht, erklärte er mir.
Ich sagte ihm, dass ich ihn mit Pascal Helffenstein bekannt machen wolle. Er sei mit mir zur Schule gegangen, mit mir und also auch mit Markus.
Pascal?, fragte er. Ob das der Atheist im Weinberg des Herrn sei?