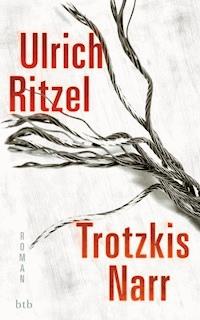9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berndorf ermittelt
- Sprache: Deutsch
Privatermittler Berndorf ermittelt in eigener Sache …
Auf der Suche nach vergessenen Autoren – ihrem Hobby – entdeckt die pensionierte Lehrerin Nadja Schwertfeger in einem Antiquariat ein Heft mit einer Erzählung über das Kriegsende 1945. Stunden vor dem Einmarsch der US-Army hören in einem kleinen Dorf Einheimische, Flüchtlinge und versprengte Soldaten gemeinsam die Rundfunkübertragung zu Hitlers bevorstehendem 56. Geburtstag. Doch als der Strom ausfällt, läuft die Zusammenkunft aus dem Ruder … Eine Erfindung?
Nadja stolpert über ein seltsames Detail: die Beschreibung einer schwarzen Stoffkatze mit rosa Tatzen. Sie selbst besitzt eine solche Stoffkatze – es ist die einzige Verbindung zu ihrer Mutter, die ihr dieses Kuscheltier mitgegeben hat, als sie sie nach Kriegsende einer anderen Frau überließ. Nadja beschließt zu recherchieren. Hat es ein solches Dorf – wie in der Erzählung beschrieben – wirklich gegeben? Bald scheint sie tatsächlich fündig zu werden. Doch niemand in dem Dorf will mit ihr reden. Schließlich wird sie auf jemanden verwiesen, der hier ebenfalls aufgewachsen ist und später Polizist wurde: Es ist der ehemalige Kriminalkommissar Hans Berndorf, den sie dazu überredet, mit ihr auf eine Zeitreise zu gehen, die in den wenigen Stunden kulminiert, in denen das Dritte Reich bereits zusammengebrochen ist und die Menschen, gleichermaßen von Angst und neuer Lebenshoffnung erfüllt, auf die Ankunft der Sieger warten. Es wird auch eine Zeitreise in Berndorfs eigene Kindheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Auf der Suche nach vergessenen Autoren – ihrem Hobby – entdeckt die pensionierte Lehrerin Nadja Schwertfeger in einem Antiquariat ein Heft mit einer Erzählung über das Kriegsende 1945. Stunden vor dem Einmarsch der US-Army hören in einem kleinen Dorf Einheimische, Flüchtlinge und versprengte Soldaten gemeinsam die Rundfunkübertragung zu Hitlers bevorstehendem 56. Geburtstag. Doch als der Strom ausfällt, läuft die Zusammenkunft aus dem Ruder … Eine Erfindung?
Nadja stolpert über ein seltsames Detail: die Beschreibung einer schwarzen Stoffkatze mit rosa Tatzen. Sie selbst besitzt eine solche Stoffkatze – es ist die einzige Verbindung zu ihrer Mutter, die ihr dieses Kuscheltier mitgegeben hat, als sie sie nach Kriegsende einer anderen Frau überließ. Nadja beschließt zu recherchieren. Hat es ein solches Dorf – wie in der Erzählung beschrieben – wirklich gegeben? Bald scheint sie tatsächlich fündig zu werden. Doch niemand in dem Dorf will mit ihr reden. Schließlich wird sie auf jemanden verwiesen, der hier ebenfalls aufgewachsen ist und später Polizist wurde: Es ist der ehemalige Kriminalkommissar Hans Berndorf, den sie dazu überredet, mit ihr auf eine Zeitreise zu gehen, die in den wenigen Stunden kulminiert, in denen das Dritte Reich bereits zusammengebrochen ist und die Menschen, gleichermaßen von Angst und neuer Lebenshoffnung erfüllt, auf die Ankunft der Sieger warten. Es wird auch eine Zeitreise in Berndorfs eigene Kindheit …
Zum Autor
ULRICH RITZEL, geboren 1940, gilt als einer der besten Kriminalautoren Deutschlands. Nach seinem Jurastudium arbeitete er jahrelang für verschiedene Zeitungen, 1981 erhielt er für seine Gerichtsreportagen den renommierten Wächterpreis. Seine Kommissar-Berndorf-Krimis »Schwemmholz« und »Der Hund des Propheten« waren preisgekrönt, »Beifang« wurde mit dem Deutschen Krimipreis 2010 ausgezeichnet, »Schlangenkopf« und »Trotzkis Narr« standen monatelang auf der Krimizeit-Bestenliste. Ulrich Ritzel lebt seit 2008 in der Schweiz.
Ulrich Ritzel
Nadjas Katze
Ein Berndorf-Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2016 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Anna Mutwil/Arcangel Images
ISBN 978-3-641-18196-3V002
Besuchen Sie unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de!
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
DONNERSTAG Besuch beim Trödler
Durch den Hinterhof führt der Weg an Parkplätzen und Abfallcontainern vorbei zu einem niedrigen Fachwerkbau mit Walmdach. Öffnet man die massive Tür an der Schmalseite des Gebäudes, so gelangt man in ein Lager mit wandhohen Regalen. Die Möbelfabrik, für die der Fachwerkbau als Werkzeug-Magazin diente, wurde bereits in den Achtziger Jahren aufgegeben, doch in dem langgestreckten Raum hängt noch immer der Geruch nach Werkstatt und Politur, inzwischen vermischt mit dem von altem staubbedeckten Papier. Was bis zur Decke gestapelt ist, sind keine Lackdosen, Schrauben und Holzdübel mehr, sondern Bücher, und zwar so viele, dass die Regale gar nicht mehr genügen, sondern vor ihnen weitere Stapel aus dem betonierten Boden wachsen und dem Besucher im Weg stehen – das heißt, es ist in diesem Fall eine Besucherin, Nadja Schwertfeger, eine nicht mehr junge Frau, schlank, das graue Haar kurz geschnitten. Unter ihrem Dufflecoat trägt sie Jeans und einen grobgestrickten Rollkragenpullover, das noch volle Gesicht mit den großen graublauen Augen ist kaum oder gar nicht geschminkt. Zwischen den Regalen bewegt sie sich achtsam und suchend, bis sie stehen bleibt und im Licht einer flackrigen Neonröhre einen Stapel von Büchern durchstöbert, angezogen von dem obersten Band, einer frühen Ausgabe von Kasacks Stadt hinter dem Strom, und schließlich ein dünnes Heft in den Händen hält, knapp vierzig graue brüchige Seiten umfassend, der Text in altmodischer Antiqua gesetzt. Über den verblichen-gelben Umschlag zieht sich in schwarzer Flammenschrift der Titel Die Nachtwache des Soldaten Pietzsch, als Autor ist ein Paul Anderweg angegeben. Der Name sagt Nadja nichts, und in dem Impressum auf der zweiten Seite steht nur, die Erzählung – oder was es sonst sein mochte – sei 1947 im Selbstverlag erschienen und in Nördlingen gedruckt worden. Sie wendet sich zum Gang, auf dem sich gerade der Antiquar mit einem Karton voller Bücher nähert, den er mit beiden Händen halten muss.
»Wie sind Sie zu dem da gekommen?« Sie fasst ihn über ihre Lesebrille hinweg ins Auge und zeigt ihm das Heft.
»Ist das aus diesem Stapel da?«, fragt der Antiquar und deutet mit dem Kinn auf den Bücherhaufen vor dem Regal. Dabei lehnt er sich im Stehen zurück, damit er den Karton nicht absetzen muss. Er ist ein weißbärtiger beleibter Mann und eigentlich gar kein Antiquar, sondern ein Trödler, der die Bibliotheken emeritierter Freiburger Professoren und Studienräte verramscht. »Der gehört zum Nachlass eines Journalisten, Kisten über Kisten, ein paar alte Sachen, das meiste aber wie neu, kein Fleck, nirgends, auch nichts hineingemalt, es sieht aus, als hätte er die Bücher nicht einmal aufgeschlagen …«
»Es werden Besprechungsexemplare gewesen sein«, bemerkt Nadja sanft und will wissen, was das Heft kostet. Aus ihr selbst nicht so ganz klaren Gründen hat sie vor einiger Zeit begonnen, Bücher und Texte vergessener Autoren zu sammeln, am liebsten von solchen, die es in der Literaturgeschichte noch nicht einmal zu einer Fußnote gebracht haben, und Paul Anderweg scheint ihr – auch wenn es sich bei dem Namen wohl um ein Pseudonym handelt – ein denkbarer Kandidat zu sein. Der Antiquar verlangt – ohne rot zu werden – fünf Euro, und sie bezahlt, ohne zu murren. Sie verstaut das Heft in ihrer Umhängetasche und verlässt den Laden; draußen regnet es, sie zieht sich die Kapuze ihres Dufflecoats über den Kopf und geht an den Abfallcontainern vorbei zur Straße und zur Haltestelle der Straßenbahn. Im überdachten Wartehäuschen fällt ihr ein Plakat auf, das ein Theater-Gastspiel mit Shakespeares Troilus und Cressida ankündigt, innerlich schüttelt sie sich, denn von allen Theaterstücken, die sie kennt, ist ihr dies das abscheulichste. In der überfüllten Straßenbahn steht eine Studentin auf und bietet ihr den Platz an, so etwas gibt ihr – noch immer – einen kleinen Stich. Aber sie bedankt sich und nimmt das Angebot an. An der Padua-Allee steigt sie in den Bus um, der sie in den Vorort bringt, wo sie sich vor Jahren bereits ein Zwei-Zimmer-Appartement gekauft hat – das heißt, es ist gar kein Vorort, sondern ein Dorf für sich, auch wenn es bereits vor Jahrzehnten von Freiburg eingemeindet wurde. Während der Fahrt läuft der Regen an den Busscheiben hinunter und erlaubt weder einen Blick auf die Weinberge des Kaiserstuhls noch auf die Höhen des Schwarzwalds. Sie freut sich auf eine Tasse Tee und eine CD – vielleicht die Goldberg-Variationen mit Glenn Gould?
Eine Viertelstunde später ist sie zu Hause, setzt das Teewasser auf und hört den Anrufbeantworter ab – Bastian von der Bürgerinitiative gibt einen Termin für die erweiterte Vorstandssitzung durch, und die Bäuerin vom Agnesenhof will wissen, ob Nadja ihr ein paar Gläser Quittengelee abnimmt. Nicht angerufen hat die Enkelin, die sich immerhin für das Geburtstagsgeschenk hätte bedanken können – wenn schon nicht für den afrikanischen Comic-Band, den Nadja ihr ausgesucht hat, so doch für den beigelegten Geldschein. Aber vielleicht weiß die Enkelin nicht, was sie zu einem Comic sagen soll, der das Leben eines Straßenkinds in Lagos schildert, und ruft deshalb nicht an. Nadja beschließt, nicht weiter darüber nachzudenken, gießt den Tee auf, lässt ihn kurz ziehen, legt nicht die CD mit Glenn Gould auf, sondern Searching for Sugar Man, setzt sich in ihren Lieblingssessel, schenkt sich ein und trinkt einen Schluck Tee … Während sie, zurückgelehnt in den Sessel, noch immer die Tasse in der Hand hält und Sixto Rodriguez hört, fällt ihr das Mitbringsel ein. Sie zögert, vielleicht deshalb, weil sie insgeheim die nächste Enttäuschung fürchtet. Nicht alles, was von der Literaturkritik ignoriert wird, muss deshalb schon lesenswert sein … Schließlich – nach Can’t Get Away – steht sie dann doch auf und holt das Heft, blättert es durch, zuckt die Achseln, trinkt noch einen Schluck Tee, nimmt das Heft wieder auf und liest den Anfang eines Absatzes:
Haben schwarze Katzen rosa Tatzen und eine rosa Schnauze? Pietzsch wusste es nicht …
Sie schüttelt den Kopf und will weiterblättern, hält dann aber plötzlich inne und liest die gesamte Passage, dann den Schluss der Geschichte. Aber von einer schwarzen Katze mit rosa Schnauze ist nicht mehr die Rede. Sie legt das Heft zur Seite und starrt zum Fenster hinaus, noch ist es nicht ganz dunkel, auch hat der Regen aufgehört, trotzdem nimmt sie nichts wahr, nicht einmal Rodriguez’ Stimme, auch nicht die buntscheckigen Dächer der alten Dorfhäuser oder die blauschwarze Linie der Berge dahinter. Irgendwann steht sie auf, nimmt den Schlüsselbund und fährt mit dem Lift in den Keller hinunter, wo sie ein eigenes Abteil hat – gerade genug Platz für das ausrangierte Fahrrad und ein Regal, das neben einer kaputten Kaffeemaschine und einem alten Tonbandgerät vor allem Kartons enthält, Kartons voller Mitschriften aus dem Studium, Lehrbücher, Unterrichtspläne, nichts Aufregendes, du lieber Himmel, was soll am Leben einer Studienrätin für Deutsch und Geschichte auch aufregend sein! Aus einem der Kartons bleckt ihr der Ordner mit den Gerichtsakten ihrer Scheidung entgegen, schnell wieder zugeklappt … Plötzlich Schulhefte, die akkurate linksgeneigte Schrift der Siebzehnjährigen, nein, was sie als Siebzehnjährige über Werther gedacht hat, will sie jetzt nicht nachlesen! Ein Karton enthält das zusammengelegte Gummiboot der Enkelin, darüber ist eine Plastiktüte gestopft, Nadja öffnet sie, greift hinein und ertastet etwas, das sich gepolstert anfühlt und so, als sei es mit einem aufgerauten Stoff bezogen. Sie lächelt, denn diese Berührung ist ihr sehr vertraut, von langer Zeit her. Entschlossen holt sie heraus, was in der Tüte steckt, und blickt in das Gesicht ihrer Kindheitskatze Maunz. Es ist ein vorwurfsvolles Gesicht, denn Maunz hat nur noch ein Auge, die andere grüne Glasperle ist abgerissen. Der schwarze Stoff scheint abgewetzt, die rosa Tatzen und die rosa Schnauze sind nicht mehr rein rosafarben, aber die Nähte haben gehalten – warum, ist selbst im schlechten Licht der Kellerlampe zu sehen: sie sind von Hand gearbeitet.
Entschuldige Maunz, sagt Nadja (oder denkt es), ich habe dich vernachlässigt … aber offenbar willst du zurück in mein Leben. Wir müssen jetzt nämlich etwas lesen, das uns beide betrifft. Oder zu betreffen scheint. Sie räumt die Kartons zurück, fährt mit der Stoffkatze unterm Arm wieder nach oben zu ihrem Appartement, setzt Maunz neben der Teekanne ab und schaltet die Stehlampe ein. Dann setzt sie sich und schlägt das Heft mit dem gelb-verblichenen Umschlag auf und beginnt zu lesen.
Die Nachtwache des Soldaten Pietzsch
Einer dieser Vorfrühlingsabende zog herauf, an denen es lange nicht Nacht werden will. Die bewaldeten Hügelketten im Westen sahen aus, als hätte man sie aus schwarzem Seidenpapier ausgeschnitten und vor das letzte Licht der untergegangenen Sonne gespannt. Nur im Südwesten stand vor dem allmählich fahl werdenden Himmelsblau noch immer scharf umrissen der dunkle Rauchpilz, der dort schon am Morgen aufgestiegen war.
Pietzsch ließ das Fernglas sinken und betrachtete die Straße, die sich wie ein graues Band durch das Tal schlängelte und unten am Dorf vorbeiführte. Ein steiler Fußweg führte von der Straße zum Dorf hinauf, vorbei an der Barrikade aus eilig zurechtgehauenen Baumstämmen. Zwei Kameraden aus Pietzsch’ Zug hielten hier Wache, der eine war ein in eine Uniformjacke gezwängter Buchhalter, der andere ein halbes Kind, keine siebzehn Jahre alt, beiden hatte man einen Karabiner in die Hand gedrückt, und so waren sie Soldaten. Pietzsch sagte ihnen, dass sie um Mitternacht abgelöst würden. Aber kaum dass er das gesagt hatte, duckte er sich, zwei Jabos waren am Horizont aufgetaucht, kurvten über das Dorf hinweg, drehten wieder nach Westen ab und gingen heulend in den Tiefflug über.
Pietzsch wartete, dann hörte er – nicht sehr laut – Einschläge, offenbar hatten die Jabos ein Angriffsziel entdeckt. Die Bahnlinie? Das wäre seltsam, dachte er. Ein oder zwei Tage noch, und sie würde dem Feind von Nutzen sein. Er zuckte mit den Schultern, wandte sich ab, stieg zum Schulgarten hinauf und ging an den abgedeckten Beeten vorbei und über den Pausenhof zurück zum Schulhaus, einem großen hellen Gebäude, das wohl erst in den letzten Jahren vor dem Krieg errichtet worden war. Das Schulzimmer lag im Erdgeschoss, aber die Bänke hatte man herausgetragen und im Vorraum gestapelt, um Platz für Strohschütten zu schaffen. Pietzsch’ Männer – oder was von ihnen noch übrig war – kampierten jetzt dort und waren dabei, sich aus den im Dorf erbettelten Resten einen Eintopf zu kochen; als Herd diente der Kanonenofen in der Ecke des Schulzimmers, und der Geruch nach Kohl und gestocktem Fett zog sich über den Schulhof.
Pietzsch betrat den Vorraum. Rechts von der Tür befand sich an der Wand ein steinernes Waschbecken mit einem Wasseranschluss, eine Frau stand davor und füllte einen Eimer mit Wasser. Er sah ihr zu und ertappte sich dabei, wie seine Augen über die Hüften und den Rücken glitten, der schlank war wie der eines Mädchens. Die Frau spürte, dass sie beobachtet wurde, stellte das Wasser ab und drehte sich zu Pietzsch um. Sie war noch jung, aber schon lange kein Mädchen mehr, trug ein dunkles kurzärmeliges Kleid und sah anders aus als die Frauen aus dem Dorf, aber auch nicht so, als gehöre sie zum Haushalt des Lehrers in der ersten Etage. Ein Flüchtling, dachte Pietzsch, oder sollte man sagen: eine Flüchtlingin? Das hörte sich merkwürdig an.
»Guten Abend«, sagte sie, das war schon wieder seltsam, aber es störte Pietzsch nicht weiter. Sollen die Leute neuerdings oder künftig grüßen, wie sie wollen! Er hob kurz die Hand, das mochte durchgehen als was auch immer. Er wollte wissen, ob sie hier im Schulhaus wohne, und sie sagte, »ja, ganz oben, da sind noch zwei Dachkammern, wissen Sie?«
»Wie ist das eigentlich …«, fuhr sie fort, hob den Eimer von dem steinernen Waschbecken herab und warf ihm aus dem schmalen, im Licht der Dämmerung verschatteten Gesicht einen scharfen Blick zu, »da unten am Dorfeingang hat man so Balken auffahren lassen … Sie werden sich da also verschanzen und den Feind zurückschlagen, ja? Es geht mich ja nichts an, aber wenn es wirklich losgeht, wäre ich mit meinem Sohn nicht gerne da oben.« Sie deutete zum Dach hinauf.
Pietzsch schüttelte unwillig den Kopf. Die Zeit war noch nicht vorbei, in der einen solche Fragerei um Kopf und Kragen bringen konnte – der Bluthund Schelmer und seine Schergen fuhren noch immer umher, vor ein paar Tagen waren Pietzsch und seine Leute durch ein Dorf gekommen, da war die Leiche einer Frau an einen Baum gebunden, mit dem Schild um den Hals: Ich bin eine Verräterin. Und niemand traute sich, sie loszubinden und ihr wenigstens ein Grab zu geben. »Nicht heute«, sagte er dann, »noch nicht morgen. Aber gehen Sie morgen Abend mit dem Kind in einen Luftschutzkeller. Muss es ja geben hier im Dorf.«
»Danke.« Im Dämmerlicht ahnte er die Andeutung eines Lächelns. »Und was dann kommt – sind das Franzosen oder Amerikaner?« Das Lächeln war verschwunden.
»Zuerst wohl Amerikaner. Aber bei denen passieren auch Dinge, da ist das Kind dann besser nicht dabei.« Er versuchte, ihr in die Augen zu sehen, aber in dem dämmrigen Licht des Vorraums ging das schlecht. Sie bückte sich und wollte den Eimer aufnehmen, »lassen Sie nur«, meinte Pietzsch und streckte die Hand aus. Die Frau zögerte und hob ein wenig die Augenbrauen. »Wir Frauen werden lernen müssen, noch ganz andere Sachen zu schleppen …«
»Wenn es so kommen sollte, dann kommt es früh genug«, antwortete Pietzsch und durfte den Eimer dann doch hochtragen, vorbei an der Lehrerswohnung, eine Holzstiege hinauf auf den Dachboden. Die Frau öffnete eine Tür und ging ihm voraus, er folgte ihr, beim Vorbeigehen sah er einen Zettel, mit einer Reißzwecke in Augenhöhe an die Tür geheftet, auf dem stand wohl ein Name, aber im Treppenhaus war es zu dunkel, um es genauer zu erkennen. Pietzsch trat in eine Kammer, in der Kartons gestapelt waren. Durch ein Mansardenfenster, das nach Norden ging, fiel dämmriges Licht; auf einem Holztisch stand Geschirr, daneben eine Spülschüssel und eine elektrische Kochplatte. Die Frau wies auf einen Hocker, auf dem er den Eimer abstellen konnte. Er wandte sich ihr zu, für einen Augenblick standen sie sich gegenüber, dann öffnete sich die Tür einer zweiten Kammer, und ein Bub – vielleicht vier oder fünf Jahre alt – erschien im Türrahmen, die Klinke in der Hand, und betrachtete ihn mit aufmerksamem, fast prüfendem Blick. »Das ist Lukas«, sagte die Frau, und – zu dem Buben gewandt –, dass der Soldat ihr den Eimer hochgetragen habe. Der Bub ließ die Klinke los und kam zu Pietzsch und reichte ihm die Hand und neigte dabei den Kopf. – Pietzsch brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass Lukas gerade einen Diener gemacht hatte.
»Haben Sie kein Gewehr?«, fragte der Bub und ließ die Hand los. In diesem Alter siezen einen Kinder doch nicht, dachte Pietzsch und meinte, das Gewehr sei beim Tragen von Wassereimern eher hinderlich. »Überhaupt ist es einem eigentlich immer nur im Weg, weißt du«, fuhr er fort. Aber Lukas sah ihn nur streng an, und ging dann zurück in die zweite Kammer, zu einem Tisch, der dort an das Mansardenfenster geschoben war.
Sie könne ihm leider nichts anbieten, sagte die Frau, höchstens eine Tasse Pfefferminztee. »Wollen Sie? Vorausgesetzt, wir haben noch Strom.« Pietzsch bedankte sich, ja doch, eine Tasse Tee wäre wunderbar, und die Frau schaltete die Kochplatte ein und legte prüfend die Hand darauf. Offenbar erwärmte sich die Platte, und so schöpfte sie aus dem Eimer zwei oder drei Tassen Wasser in einen kleinen Aluminiumtopf und setzte ihn auf. Mit der Hand wies sie einladend in die zweite Kammer, die offenbar das Wohnzimmer war, und Pietzsch setzte sich an den Tisch vor dem Fenster, durch das man in der Dämmerung draußen die Fichten sah, die sich am Rande des Schulhofs erhoben. In dem Zimmer standen zwei Betten mit Tagesdecken, an jeder Seitenwand eines. Außerdem gab es einen Kanonenofen, und auf dem Tisch lagen Wörterbücher, ein deutsch-französisches und ein deutsch-englisches, außerdem eine englische Grammatik. Ja doch, dachte er schwerfällig, wer damit umgehen kann, für den wird so etwas wohl bald von Nutzen sein. Unauffällig sah er sich um, ob irgendwo eine Fotografie mit einem Trauerflor aufgestellt war, aber er entdeckte nichts. Ihm gegenüber spielte Lukas mit Bauklötzen, es waren nur vier oder fünf, zu wenige, um damit ein Haus oder sonst etwas zu bauen, und so stellte der Junge sie alle auf, bis auf einen, und mit dem stieß er die anderen dann um.
»Das ist aber ein ungerechter Krieg«, stellte Pietzsch fest. »Die einen fallen nur um und können sich gar nicht wehren.« Doch der Junge sah ihn nur trotzig an und zog mit beiden Händen seine Bauklötze zu sich her, als müsste er sie verstecken. Sie möge es nicht, dass er so etwas spiele, erklärte seine Mutter, die an den Tisch getreten war, aber viel anderes gebe es ja nicht.
Weiter kam sie nicht, denn von unten hörte man rasche Schritte, im Flur rief jemand nach Pietzsch, er erhob sich, blieb einen Augenblick stehen, zuckte mit den Achseln und verabschiedete sich dann. »Schade um den Tee«, sagte er noch, und die Frau meinte, die eine Tasse habe er gut bei ihr.
Unten im Hausflur stand der 17-Jährige und äugte suchend zu Pietzsch hoch, als dieser die Treppe herunterkam. »Da ist einer gekommen, der sagt, er sei der Kampfkommandant.« Pietzsch runzelte die Stirn, dann ging er die Treppe zum Schulzimmer hinunter und auf den Hof hinaus. Ein schwerer, massiger Mann in Zivil, bebrillt, das Gesicht rußverschmiert, mit einer Wehrmachtsmütze auf dem Kopf, kam hinkend auf ihn zu und warf die Hand mit der nachlässigen, im Handgelenk nach hinten abknickenden Geste hoch, die nur den höheren Parteiführern vorbehalten war, auch wenn er es vorgezogen hatte, jetzt keine Parteiuniform zu tragen: Heilhittläh! Sein Sakko war von einer Militärkoppel eingeschnürt, an der eine Pistolentasche hing.
Ein Goldfasan also, dachte Pietzsch, zögerte kurz – eine Sekunde oder einen Bruchteil davon –, dann salutierte er und machte Meldung. Der Goldfasan hatte zwei oder drei Uniformierte im Gefolge, alle von der Sorte mit den Runen im Kragenspiegel, da machte man sich besser keine Gedanken, ob man es womöglich mit einem Verrückten zu tun hatte. Einer der SS-Leute trug den notdürftig verbundenen Arm in der Schlinge, das war wohl passiert, als die Jagdbomber den Treck angegriffen hatten. Auch der Goldfasan musste etwas abbekommen haben, ein Hosenbein war aufgerissen, rußverschmiert waren auch das Sakko und die zu langen weißen Haare, die zum Vorschein kamen, als er die Mütze abnahm und sich mit der Hand über die Stirn fuhr.
»Zehn Mann haben Sie noch?«, fragte der Goldfasan. »Alles solche Helden wie die zwei an dem Verhau dahinten? Nennen Sie das vielleicht eine Stellung?« Pietzsch sagte nichts, eine Antwort war auch nicht erwartet worden, und der Neuankömmling ging schnurstracks auf das Schulhaus zu. »Ist der Lehrer Beug noch da? Und haben wir Telefon-Verbindung?«, fragte er im Vorbeigehen. Pietzsch bestätigte, jedenfalls habe er am Morgen noch mit dem Bataillonsstab in der Kreisstadt sprechen können. Dazu machte er Anstalten, den Goldfasan zu der im ersten Stock gelegenen Lehrerswohnung zu begleiten. Aber der schickte ihn mit einer abwehrenden Handbewegung weg – er kenne sich hier aus, sagte er. Eine stämmige weißblonde Frau, die über ihrem schwarzen Kostüm einen Rucksack trug, löste sich aus der Gruppe und folgte ihm fast leichtfüßig. Mit einigem Abstand stapfte ein älterer Mann in Zivil hinter ihnen her, mit einem mächtigen Zinken, nach vorne gebeugt und zwei schwere Aktentaschen schleppend.
Die SS-Leute hatten inzwischen das Schulzimmer bezogen, Strohschütten gab es dort noch genug. Von dem Eintopf wollten sie nichts, aber sie fragten, ob es im Dorf einen Arzt gebe, der sich um ihren Verwundeten kümmern könne, und einer aus Pietzsch’ Zug machte sich auf den Weg zum Dorfgasthof, wo sich der russische Militärarzt einquartiert hatte, den die Wlassow-Leute dort vergessen hatten. Falls er es nicht selbst darauf angelegt hatte, vergessen zu werden. Ohnehin kam es für diese Leute nicht mehr darauf an, was sie taten oder unterließen, dachte Pietzsch, der Teufel hatte sie so oder so am Kragen. Von oben kam ein Mann mit spärlichem aschblonden, nach hinten gekämmtem Haar die Treppe herunter, der Dorflehrer und Ortsgruppenleiter Beug, und wandte sich mit geröteten Wangen an Pietzsch: der Kampfkommandant wolle ihn sprechen!
Der Goldfasan saß am Schreibtisch im Arbeitszimmer des Lehrers, das Telefon vor sich, auf einem Beistelltischchen standen die zwei schweren Aktenmappen. »Was haben Sie mir da für einen Dreck erzählt?«, fuhr er Pietzsch an und hielt ihm zornig den Telefonhörer entgegen. »Die Leitung ist tot, mausetot, wie halten Sie denn Kontakt zu Ihrem Bataillon?«
Er habe Weisung, sagte Pietzsch, die Stellung hier zu halten.
»Stellung!«, unterbrach ihn der Goldfasan und blickte zu dem SS-Mann, der Pietzsch nach oben begleitet hatte, »dass ich nicht lache … Wie soll ich jetzt von hier wegkommen, sagen Sie mir das mal! Ich habe kriegswichtiges Material dabei.« Fast anklagend wies er auf die beiden Aktentaschen. »Kriegswichtiges Wissen, das muss gerettet werden, Sie Stellungshalter, Sie!« Schließlich sprach er mit normaler Stimme weiter. Ob es im Dorf noch Autos oder Motorräder gebe? Pietzsch blickte zu Beug, aber der – noch immer im Türrahmen stehend – schüttelte nur den Kopf. »Dann vielleicht ein Pferdegespann?«
»Es ist so«, sagte Beug, »also, es gibt nur noch drei oder vier alte Klepper im Dorf … die gehen nicht so weit, die bleiben einfach stehen, und man weiß nicht, was sie tun, wenn Flieger kommen …«
Der Goldfasan nahm die Brille ab und rieb sich die Druckstellen an der Nasenwurzel. Pietzsch sah ihm zu, dann wurde sein Blick von dem großen hellen Rechteck angezogen, das in der angegrauten Tapete an der Wand hinter dem Schreibtisch prangte. Aus den Augenwinkeln sah er, dass auch der SS-Mann neben ihm dieses Rechteck musterte, mit einem verächtlichen Lächeln auf dem Gesicht. Es war ein Unterscharführer, ein Kerl wie ein Baumstamm, aber Pietzsch kam es vor, als brauchte man ihm und dem Goldfasan und einfach allen nur einen kleinen Stups zu geben, und es bliebe auch von ihnen nur noch eine leere Stelle übrig, ganz wie von dem Bild, das so viele Jahre dort an der Wand gehangen hatte.
»Mein lieber Beug«, seufzte der Goldfasan, »du bist mir so ein Held geworden … ich erkenn dich nicht wieder.« Zornig schlug er mit der Hand auf den Tisch. »Aber das ist es ja, was uns in diese Scheiße gebracht hat, fett sind wir geworden, bequem, niemals hätte der Führer das zulassen dürfen.« Er schüttelte den Kopf, dann setzte er die Brille wieder auf und fasste Pietzsch ins Auge. »Ich muss die Kreisleitung verständigen. Einer Ihrer Helden soll sich ein Fahrrad besorgen, so etwas wird sich doch wohl auftreiben lassen!«
Plötzlich war es nun doch Nacht geworden. Hinter der aus Baumstämmen improvisierten Schutzwehr hockte der verkleidete Buchhalter auf der Kiste mit den Panzerfäusten, die man ihnen dagelassen hatte, und nuckelte an einer kalten Stummelpfeife. Neben ihm kauerte einer der Überlebenden der Infanteriedivision 260, der noch aus dem Kessel von Tscherwan herausgekommen war, den Kopf gesenkt, vielleicht schlief er auch. Er war die Ablösung für den 17-Jährigen, der sich mit dem Damenfahrrad der Lehrersgattin Beug auf den Weg zur Kreisleitung gemacht hatte. Pietzsch betrachtete den Himmel im Westen, über den von Zeit zu Zeit Leuchtspurpatronen ihre Schussbahnen zogen wie Raketen an Silvester. Irgendwo, in regelmäßigen Abständen, schlug Artilleriefeuer durch die Stille. Er vermutete, dass eine Batterie ihre Munition verschoss, um es morgen beim Davonlaufen leichter zu haben.
Er spürte, dass jemand neben ihm stand. Es war die Frau aus dem Schulhaus, sie trug einen Mantel aus Schaffell, der war in der Dunkelheit wie ein leuchtend weißer Fleck. Auf der Straße seien noch immer Leute unterwegs, sagte sie, woher kommen sie und wohin gehen sie?
Es seien Flüchtlinge, antwortete er. »Flüchtlinge wie Sie.« Und Soldaten. »Soldaten auf dem Rückzug. Soldaten wie ich. Rückzug können wir inzwischen ganz gut.«
Rückzug wohin?
»Jetzt zum Beispiel in das Schulhaus«, antwortete er. »Ihr Mantel ist zu auffällig. Kommen Sie!« Pietzsch nickte dem Buchhalter zu und begleitete die Frau durch den Garten und über den Schulhof. Sie hätte den Tee inzwischen aufgegossen und in die Thermoskanne abgefüllt, sagte sie. Ob er eine Tasse wolle? Gerne, wollte er sagen, aber da waren sie schon im Schulhaus, wo auch der russische Arzt endlich eingetroffen war, ein großer ruhiger Mann mit einer schwarzen Haartolle über der ausgeprägten Stirn, der sich den Verwundeten und dessen halbzerfetzten Arm ansah. Der Verwundete hockte auf einer der Schulbänke, die in den Vorraum des Klassenzimmers gebracht worden waren, und wurde von seinen Kameraden festgehalten, weil der Russe ihm den einen oder anderen Splitter aus dem Arm holen wollte. Um das trübe Licht der Deckenlampe aufzuhellen, hielt einer der Soldaten eine Schreibtischlampe, die mit Hilfe einer Verlängerungsschnur ans Netz angeschlossen war, und richtete den Lichtschein auf die Wunde. Trotz dieser Erschwernisse wirkten die Bewegungen des Arztes behutsam und sicher, und der Verwundete schrie auch nicht und hielt still, der Arzt musste ihm etwas gegeben haben, Morphin oder wenigstens Evipan-Natrium. Pietzsch wollte keine Maulaffen feilhalten, aber die Frau war stehen geblieben und sah zu dem Arzt, als warte sie darauf, dass sie helfen könne. Einmal schaute der Arzt kurz zu ihr auf und bewegte fast unmerklich, aber irgendwie verneinend oder abweisend den Kopf. Schließlich begriff Pietzsch, dass er nicht weiter gefragt war, und ging ins Schulzimmer, wo die Kameraden noch einen Napf Zusammengekochtes für ihn übriggelassen hatten.
Später. Wie viel später? Pietzsch wusste es nicht. Einen Augenblick lang wusste er nicht einmal, wo er sich befand. Sein Blick fiel auf eine große, schlecht abgewischte Schiefertafel, auf der selbst im trüben Licht der abgedunkelten Lampen noch ein paar Buchstaben zu erkennen waren, wann immer hier zum letzten Mal Unterricht abgehalten worden war. Die Kuh macht m …, konnte er entziffern. Neben ihm stand der Schulmeister und Ortsgruppenleiter, hielt ihn am Arm und erzählte etwas von einer wichtigen Rundfunksendung. »Ja doch«, sagte Pietzsch, »danke!« Längst war es Zeit für eine wichtige Rundfunksendung, dachte er bei sich, allerhöchste Zeit war es dafür, wenn man ihn gefragt hätte oder sonst eines der Frontschweine. Wollte einer der Kameraden mitkommen? Die meisten winkten ab, nur der Unterscharführer kam mit hoch in die Lehrerswohnung. Als sie dort eintraten, war das Wohnzimmer bereits voll von Menschen, einige hatten rund um den Tisch Platz genommen, an den auch für den Goldfasan – von dem Pietzsch inzwischen erfahren hatte, dass er Johler hieß, Theodor Johler –, an den also auch für Johler ein Lehnstuhl herangeschoben war mit einem gepolsterten Schemel für das Bein, bei dem die Hose unterm Knie abgetrennt und der Unterschenkel bandagiert war. Andere Besucher saßen auf Schemeln und Stühlen, die man eilig hereingetragen hatte, wieder andere standen im Hintergrund. Pietzsch schob sich an eine Stelle, an der er sich gegen die Wand lehnen konnte; als er sich im Halbdunkel umsah, erkannte er neben sich die Flüchtlingin und nickte ihr zu. Sie antwortete mit einem kurzen Lächeln, wandte den Kopf aber gleich wieder ab.
Auf einer Kommode stand ein Radioapparat, ein DKE 38: im graublauen klotzförmigen Bakelit das große kreisrunde, mit Stoff bespannte Brüll-Loch. Daneben eine altväterliche Petroleumlampe, wie man sie in den Dörfern wieder vom Dachboden geholt hatte, seit immer öfter der Strom ausfiel. Der Lehrer hatte sich an dem Radioapparat zu schaffen gemacht, der Empfang war lausig, immer wieder von Rauschen und Pfeifen gestört. Noch kam Musik, irgendwie getragen, irgendwie weihevoll, vielleicht Wagner? Kein gutes Zeichen, dachte Pietzsch. Was ist das heute überhaupt für ein Tag? Der 19. April?
Ach so.
Der Schulmeister und Ortsgruppenleiter Beug hatte inzwischen den Reichssender etwas klarer eingestellt, die Musik brach ab, ein Sprecher kündigte – schon wieder irgendwie getragen, irgendwie weihevoll – eine Ansprache an, eine Ansprache zum Vorabend des 56. Geburtstags von … ja, von wem wohl? Und wer wohl ergriff da das Wort? Die Stimme seines Herrn ergriff das Wort, diese eine ganz besondere Stimme, die so jaulen und heulen konnte wie keine andere im ganzen Deutschen Reich.
Pietzsch zwang sich zuzuhören. Deutschlands Schicksal stehe auf des Messers Schneide, tönte die Stimme mit metallischem Klang, und Pietzsch dachte bei sich, dass Messers Schneide doch schon alles entschieden habe – weiß das der in Berlin nicht? Nein, fuhr die Stimme fort, in dieser Lage sei es nicht angebracht, den Geburtstag des Führers mit den – plötzlich schwenkte die Stimme ins Höhnische – traditionellen Glückwünschen zu begehen. Glückwünsche?, dachte Pietzsch und dachte an das leere helle Rechteck in des Lehrers Arbeitszimmer, das Rechteck, das so leer und hell war, dass es sogar im Halbdunkel leuchtete. Die Zeit in all ihrer dunklen und schmerzenden Größe habe im Führer den einzig würdigen Repräsentanten gefunden, sagte die Stimme – die jetzt auf wehende Ehrfurcht umgeschaltet hatte – und redete unverdrossen weiter in das Rauschen und Spotzen und Piepsen des Reichssenders hinein, wobei Pietzsch aber nur noch Bruchstücke verstand wie gesittetes Abendland, Kultur und Zivilisation, Strudel des Abgrundes, klar umrissenes Aufbauprogramm, menschen- und völkerbeglückend …
Beug hatte sich wieder an dem Radio zu schaffen gemacht, dabei für ein paar Zeittakte die Stimme ganz abgedreht, dann war sie plötzlich wieder da, röhrend wie auf dem Jahrmarkt, heulte von verwüsteter Landschaft, versprach neue und schönere Städte und Dörfer, bewohnt von glücklichen Menschen, und kam plötzlich klar und ohne Störung durch den Äther: »… Gott wird Luzifer, wie so oft schon, wenn er vor den Toren der Macht über alle Völker stand, wieder in den Abgrund zurückschleudern, aus dem er gekommen ist. Nicht die Unterwelt wird diesen Erdteil beherrschen, sondern …«
Damit brach die Stimme ab, als wäre ihr mit einem einzigen eisernen Griff die Gurgel abgedreht worden, die Zuhörer fanden sich in völliger Finsternis wieder, einen letzten Widerschein der erloschenen Lampe auf der Netzhaut. »Ach!«, sagte eine Stimme. »Reine Sabotage«, schnauzte ihr eine zweite ins Wort, es musste die von Johler sein, »wie die ganze Zeit schon, überall Saboteure, davon hätte er reden sollen!« Einen Augenblick lang herrschte verlegene Stille, dann erfüllte plötzlich eine erschreckend nahe, seltsam getragene Männerstimme das Zimmer: »Da sprach der Herr zu Mose: Recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägypterland, dass man sie greifen kann.«
Der Dorfpfarrer? Pietzsch schüttelte unwillkürlich den Kopf: Es hatte eher nach der Stimme eines Laien geklungen, nach der eines von den Pietisten oder Stundenleuten, die es in dieser Gegend wohl noch gab … Streichhölzer wurden angerissen und pfutzten nur, plötzlich hörte man das unverwechselbare jaulende schleifende Pumpen, mit dem eine Knijpkat angetrieben wurde, ein notdürftiges Licht funzelte auf und ließ die Rücken und Hinterköpfe der Leute, die vor Pietzsch und der Flüchtlingin saßen, aus der Dunkelheit hervortreten. Ein großgewachsener Mann, die Dynamo-Taschenlampe in der Hand und auf Touren haltend, schob sich an ihm vorbei, das Licht tastete sich zu der Kommode und erfasste die Petroleumlampe, Pietzsch erkannte den Russenarzt, der die Taschenlampe so hielt, dass die Lehrersfrau die Lampe anzünden konnte. Nach ein paar vergeblichen Versuchen zitterte ein gelbliches Licht auf und beruhigte sich dann. Schwarz zeichnete sich davor die untersetzte Silhouette der Lehrersfrau ab.
»Na, welcher Merkwürden hat denn da von der ägyptischen Finsternis gemunkelt?« Johler beugte sich ein wenig vor und suchte mit zornfunkelndem Blick die Gesichter der Männer rund um den Tisch ab. Schließlich blieb sein Blick an einem älteren, grobknochigen mageren Mann hängen, der ihm gerade ins Gesicht sah. Johler hob den Finger und deutete auf den Alten. Was er denn sagen wolle mit seinem frömmlerischen Spruch?
»Die Finsternis war nicht die letzte der Plagen«, kam die Antwort.
»Und, was soll dann die nächste sein, bitt schön? Schlangen, Heuschrecken, oder was?«
Unvermittelt und seltsam aufgeregt schaltete sich der Lehrer ein. »Unser Herr Reiff ist der Kirchenvorsteher hier«, erklärte er, »und ein treuer Volksgenosse dazu, aber ja doch! Außerdem ist er der Kommandant der Feuerwehr. Und wenn er mal den Zeigefinger hebt, dann hat er auch meistens Recht, unsere ländliche Jugend braucht manchmal ein wenig moralische Wegweisung!«
»Bekanntlich«, meinte Johler höhnisch, »bekanntlich sind moralische Fingerzeige genau das, was wir in diesen Zeiten am Allernotwendigsten brauchen!« Plötzlich verfiel er ins Brüllen. »Ja, Herrgottsakrament! Noch wenn uns das Messer am Hals sitzt, heben wir Deutschen den Finger und reden vom kategorischen Imperativ! Oder von den Zehn Geboten!« Er schlug auf den Tisch und blickte mit zornfunkelnden Augen um sich. »Wenn ihr hier nicht begreifen wollt, was die Stunde geschlagen hat, dann schicke ich euch den Parteigenossen Schelmer in seinem grauen Daimler, der lernt’s euch ganz schnell, noch schneller, als ihr an euren Mostbäumen baumelt!«
»Das mit Ägypten hab ich auch nicht ganz verstanden«, hörte Pietzsch neben sich die Flüchtlingin sagen. »Die Finsternis kam doch, damit der Pharao die Juden gehen ließ, nicht wahr? Aber gibt es denn überhaupt noch welche, die … die man gehen lassen kann?« Sie hatte nicht »man« sagen wollen, dachte Pietzsch: die unser Pharao gehen lassen kann, das hatte sie gemeint.
»Was reden Sie da!«, fuhr Johler auf und ließ gleich wieder die Stimme sinken, ins Halblaut-Lauernde. »Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt hab? Der Schelmer schert sich nix, der knüpft auch Frauen auf!« Er sah um sich, runzelte die Stirn und fuhr mit noch einmal anderer, beherrscht klingender Stimme fort. »Im Übrigen, junge Frau, haben wir alle jetzt gerade andere Sorgen, ein paar Jüdlein hin oder her fallen nicht mehr ins Gewicht, es geht jetzt um uns, allein um uns und um unsere nackte Existenz, auch um die Ihre, junge Frau, von allem Anfang an ist es nur darum gegangen, denken Sie an mich!« Wieder sah er um sich, und diesmal blieb sein Blick an dem Arzt hängen. »Fragen wir doch einmal unseren russischen Freund, was er davon hält!«
»Die Toten sind tot«, antwortete der Arzt. »Und die Lebenden müssen damit leben. Wenn zu viele Tote, es wird schwierig.« Johler runzelte die Stirn und legte den Kopf ein wenig schief, als hätte er nicht richtig verstanden.
»Jedenfalls war es eine sehr schöne Rede«, meinte der Lehrer Beug und nahm den nächsten Anlauf, das Gespräch zu entschärfen. »Eine bewegende, ja: eine beglückende Rede, die ganze Größe des … das Heroische … Vielleicht sollten wir …«
»Ich hab jetzt keine Lust zum Singen«, fiel ihm Johler ins Wort und blickte suchend um sich, bis er Pietzsch entdeckte. »Wann zum Teufel kommt denn Ihr Rad fahrender Bote zurück?« Pietzsch räusperte sich und sagte, dass es gut und gerne sieben Kilometer bis in die Kreisstadt seien.
»Sieben Kilometer!«, schnaubte Johler. »Das reiß ich in einer Viertelstunde runter, hätt ich nicht die Schramme an der Wade, und bin doch nicht mehr der Jüngste! Aber das hab ich gleich gesehen, dass ihr hier ganz besondere Helden seid.« Er wandte sich an den Lehrer. »Sag mal, Beug, hast du noch einen Schnaps im Haus? Den könntest du jetzt anbieten. So zum … ach, ist ja egal, was einer damit runterspült, ich zum Beispiel kann ein bestimmtes Gewäsch nicht mehr hören, und damit meine ich nicht nur die ganz besonders Frommen, mit Verlaub! Viel zu lange haben da viel zu viele solche Reden gehalten, und der mit dem Klumpfuß ist der Schlimmste von allen, wenn ich das nur höre: menschen- und völkerbeglückend, da lachen ja die Hühner, aber wir, die Frontschweine der Partei, sollen das Geschwätz vor den Leuten vertreten! Nun glotz nicht so, Beug, du tapferer Gesinnungsheld! Wenn schon der Führer keinen Schnaps trinkt, dann kippen wir jetzt einen auf das leere Rechteck an der Wand in deinem Schulmeisterzimmer!«
Der Lehrer brachte nur ein Krächzen heraus, und so fiel seine Frau ein und sagte, sie hätten leider nur noch ein wenig Franzbranntwein im Haus, und der Goldfasan warf einen Blick an die Zimmerdecke. Nein, meldete sich da der Lehrer Beug zurück und war wieder halbwegs bei Stimme, es wäre noch ein Fässchen Most da und vielleicht auch ein oder zwei Flaschen Trollinger, nein, es müssten sogar noch drei sein. »Her damit«, unterbrach ihn Johler, »Trollinger, Most, egal! Das Zeug muss weg, was glaubst du, was die Amis mit deiner sparsamen Hausfrau machen, wenn sie das Zeug gefunden und ausgesoffen haben, und erst ihre Nigger-Soldaten!« Er setzte eine Lache auf, beugte sich zur Seite und schlug der Lehrersgattin auf die Schenkel, die entsetzt aufsprang und in die Küche entfloh. »Wir holen nur rasch die Gläser«, sagte Beug und eilte ihr hinterher, beschwichtigend beide Hände hochhaltend, »gleich sind wir zurück!«
Pietzsch räusperte sich und sagte, dass er seinen Rundgang machen müsse. »Aber wenn Sie etwas zum Trinken ausgeben wollen, denken Sie bitte auch an die Kameraden unten im Schulzimmer!« Er hob grüßend die Hand und ging, aber als er die Tür der Lehrerswohnung hinter sich zuziehen wollte, sah er, dass ihm jemand gefolgt war, ein untersetzter Mann mit zerknautschtem Gesicht und einer Halbbrille. Es war der Dorfbürgermeister Pfeifle, Pietzsch hatte mit ihm schon zu tun gehabt, als es um die Einquartierung ins Schulhaus und um Stämme für die Barrikade ging. Der Schultes, wie es in dieser Gegend hieß, war ein pensionierter Schutzpolizist, und tatsächlich wollte er mit Pietzsch reden. Worüber? »Über diese Barrikade«, sagte Pfeifle, »Sie wissen doch, was da passiert?«
»Vermutlich«, antwortete Pietzsch. Sie hatten das Schulhaus verlassen, und Pietzsch dachte, sie würden zu dem Anbau gehen, in dem das Rathaus untergebracht war. Doch plötzlich blieb Pfeifle vor ihm stehen. Ob es ihm etwas ausmache, die Sache bei ihm zu Hause zu bereden? »Es ist nicht weit, und in der Stube hat es Licht.«
Pietzsch machte eine Handbewegung, die Einverständnis zeigen sollte, und so gingen sie schweigend durch die Dorfgasse. Als sie an der Kirche vorbeikamen, riss der nachtbleiche Wolkenhimmel auf, und im Schein des halben Mondes sahen sie den Turm mit seinem spitzen Helm unerwartet wuchtig und widerspenstig über sich aufragen. Unterhalb des Kirchhügels steuerte Pfeifle ein kleines Haus an, an das nur ein Schuppen angebaut war, kein Stall und keine Scheuer wie bei den richtigen Bauernhäusern im Dorf. Er stieß die Haustür auf, sie öffnete sich auf einen mit Steinplatten gedeckten Flur, eine zweite Tür führte in einen niedrigen Raum, der sowohl als Wohnzimmer wie auch als Werkstatt zu dienen schien. Im Schein einer Petroleumlampe arbeitete eine schwarz gekleidete Frau an einer Nähmaschine, die mit einem Trittbrett angetrieben wurde. Als die Frau bemerkte, dass Pfeifle einen Besucher mitgebracht hatte, hörte sie abrupt mit der Arbeit auf, erhob sich eilig und fuhr sich dabei mit der Hand übers Gesicht, als müsse sie eine Haarlocke aus der Stirn streifen. Dabei war das flachsfarbene Haar straff nach hinten gezogen und zu einem Dutt geknotet. Sie war nicht mehr ganz jung, konnte aber vom Alter her kaum Pfeifles Frau sein. Ihre Wangen waren gerötet, sei es von der Arbeit, sei es wegen des unerwarteten Besuchers; ihre vorstehenden Zähne verliehen ihrem Gesicht einen flehenden und zugleich bedrohlichen Ausdruck.
»Elfie, ich hab mit dem Herrn Soldat was zu besprechen«, sagte Pfeifle anstelle einer Begrüßung. Ob sie ihnen einen Krug Most hole? Aber von dem für sonntags! Er wandte sich Pietzsch zu und wies einladend auf einen der Stühle, die um den Wohnzimmertisch herum standen. Aber Pietzsch war noch dabei, sich umzusehen, auf einer Kommode stand ein gerahmtes Foto, es zeigte einen jungen Mann mit kantigem Gesicht und in Wehrmachtsuniform, unten war quer über das Foto der Trauerflor gezogen. »Juli dreiundvierzig, Kursker Bogen«, erklärte Pfeifle, Pietzsch nickte und wandte sich der Nähmaschine zu, auf der ein merkwürdig kleinteiliges Arbeitsstück lag.
»Elfie macht Puppen«, sagte Pfeifle. »Und Stofftiere. Aus Resten, die sie findet oder sich zusammensucht. Angefangen hat sie mit einer Puppe für das Kleine, aber das hat sie dann doch verloren. Und so …« Er nahm die Petroleumlampe und stellte sie behutsam auf den Wohnzimmertisch. Trotzdem flackerte die Flamme ein wenig, und der gedrungene Schatten des Bürgermeisters huschte zittrig über Wände und Decke. Pietzsch trat an den Arbeitstisch, der neben der Nähmaschine stand, und nahm eine Katze aus schwarzgrauem Uniformtuch auf, die auf der Platte saß, mit Tatzen und einer Schnauze aus rosa Stoff und einem Schwanz aus weicher schwarzer Wolle, der sich um sie legte. »Mittlerweile hat sie viele Kunden, kommt mit den Aufträgen kaum nach, in den Läden gibt es ja sonst nichts.«
Haben schwarze Katzen rosa Tatzen und eine rosa Schnauze? Pietzsch wusste es nicht. »Oh«, sagte eine Stimme in seinem Rücken, »es ist ja noch gar nicht fertig!« Elfie stand im Zimmer, ein Tablett mit einem Steingutkrug und zwei Gläsern in den Händen, und starrte vorwurfsvoll und mit geröteten Wangen zu ihm herüber. Pietzsch bat um Entschuldigung, setzte die Stoffkatze behutsam wieder auf den Arbeitstisch und nahm selbst Platz. Elfie stellte Krug und Gläser ab und ließ – als sie an Pietzsch vorbeikam – noch einmal ihre vorstehenden Zähne sehen. Es sei jetzt gut, meinte Pfeifle, sie solle in ihr Zimmer gehen, »morgen ist auch ein Tag!«
Als sie allein waren, schenkte der Bürgermeister die beiden Gläser voll und schob Pietzsch das seine zu. Die beiden Männer tranken sich zu, der Most perlte leicht und hatte einen kaum spürbaren Beigeschmack von Birne. »Ja«, sagte Pfeifle, »Mostbirne kannst du dazugeben, aber nur wenig, sonst bleibt der Most trüb!« Plötzlich kehrte Schweigen ein, die beiden Männer sahen sich an, das heißt, Pfeifle hatte den Kopf ein wenig gesenkt und musterte Pietzsch über die Halbbrille hinweg, und Pietzsch gab den Blick zurück.
»Das ist doch ein kleines Dorf«, sagte Pfeifle schließlich. »Ein kleines armseliges Dorf, und alles kleine Bauernhöfe. Haus und Scheuer unter einem Dach. Wie bei kleinen armseligen Leuten eben. Und in den Scheuern Stroh und Spreu und ein Rest Heu. Eine Panzergranate hinein und alles brennt wie Zunder, verstehst du?« Offenbar hatte er beschlossen, Pietzsch als Kollegen anzusehen oder als einen vom Dorf.
Er verstehe das sehr gut, antwortete Pietzsch. Aber das Kommando habe der da drüben – er deutete mit dem Daumen seitwärts.
»Der will doch weg. Lieber jetzt als gleich!«
»Er bräuchte halt ein Fuhrwerk, wenn sie aus der Kreisstadt schon keine Kutschen schicken und keinen Lastwagen und nichts«, sagte Pietzsch, worauf der Bürgermeister meinte, dass er das schon verstanden habe. »Nur, das ist ein großer Herr, ein grausig großer. Dem schiebst du ungefragt kein Fuhrwerk unter den Arsch!«
»Der hätt sich aber draufgesetzt«, wandte Pietzsch ein. »Vorhin jedenfalls. Da wollte er ein Pferdegespann. Angeblich habt Ihr so was nicht im Dorf.«
»Kühe tun es auch«, erwiderte Pfeifle. »Aber …« Er brach ab und wandte sich um, denn es hatte geklopft, die Tür öffnete sich, und herein kam die Flüchtlingin im weißen Schaffellmantel, zwei alte krumme Leute im Gefolge. Es waren keine Leute von hier, der Mann – weißhaarig, mit einem weißen Kinnbart – schleppte einen Rucksack und einen Lederkoffer, mit dem er anderswo und zu einer anderen Zeit an die Rezeption eines Grandhotels hätte treten können; die Frau trug unterm offenen Stoffmantel ein Tweedkostüm und hatte einen Hut auf, der in Pietzsch’ Augen irgendwie nach Sylter Strandpromenade 1938 aussah. Mit unsicheren Schritten ging die Frau bis zum Tisch und hielt sich an einer Stuhllehne fest. Pietzsch stand auf und zog einen zweiten Stuhl herbei, dass sie sich setzen konnte, und fing den Rucksack auf, den sie von ihren Schultern gleiten ließ.
»Sie sind schon die ganze Nacht unterwegs«, erklärte die Flüchtlingin aus dem Schulhaus, »und wollen noch in die Kreisstadt.«
»Wir kennen dort jemanden«, erklärte der Weißhaarige, »einen Geschäftsfreund, es ist der Direktor der Kreissparkasse, er würde sich gewiss erkenntlich zeigen, und auch wir …« Er sprach ein s-teifes Norddeutsch, und Pietzsch überlegte sich, ob diese armen Leute wohl wüssten, wie gerne man in diesem Landstrich einen solchen Tonfall hören mochte.
Für diese eine Nacht könne er sie schon unterbringen, meinte Pfeifle, aber das wollte der Norddeutsche nicht hören. »Sicher geht in der Früh doch das eine oder andere Fuhrwerk in die Stadt, nicht wahr? Das kann doch gar nicht anders sein, wir können auch gut bezahlen, wirklich!« Beschwörend beugte er sich vor und legte die Hand auf Pfeifles Oberarm. »Sie sind doch der Herr Bürgermeister, nicht wahr? Sie müssen wissen, die Amerikaner sind keine dreißig Kilometer von hier entfernt, und dazwischen ist nichts mehr, keine Wehrmacht, kein Volkssturm, gar nichts!«
Ja, das kenne er schon, unterbrach ihn Pfeifle und trat einen Schritt zurück, aber er wisse von durchaus keinem Fuhrwerk. Er sprach nicht weiter, denn Pietzsch hatte ihm ein Zeichen gegeben. Die beiden Männer wechselten einen Blick, Pfeifle runzelte die Stirn, dann schien er zu begreifen. »Höchstens«, sagte er langsam, »dass wir den Vöhringer fragen. Aber man muss ihm sagen, dass es für den Führer ist.« Er warf einen Blick zu Pietzsch. »Für den gibt er alles!«
Das Dorf lag im Dunklen, ebenso wie das Schulhaus, aber man schlief nicht, keineswegs schlief man, die Klänge eines Akkordeons dudelten bis auf den Schulhof hinaus und mischten sich seltsam mit dem Muhen der beiden Kühe, die irgendjemand in der Nacht aus ihrem Stall und auf die Dorfstraße geholt hatte.
Pietzsch stieß die Tür zum Vorraum auf, der seltsam weihnachtlich erleuchtet war, denn überall – auf Schulbänken und Mauersimsen – waren funzelnde Hindenburglichter aufgestellt. Vor den aufgestapelten Bänken tanzten zwei Paare, eine Blonde mit langen Zöpfen ließ sich von dem Unterscharführer schwenken, eine Rothaarige schob ihren Unterbauch gegen die Hüften eines der Halbwüchsigen aus Pietzsch’ Zug, drei oder vier andere von seinen Leuten standen um die Tanzenden herum, eine Rotweinflasche kreiste und war nicht die erste in dieser Runde. Auf der Treppe saß der Akkordeonspieler, auch er war einer aus Pietzsch’ Zug, ein nicht mehr ganz junger Mann, der zuvor Musiker in einem ziemlich bekannten Orchester gewesen war, so dass ihn der Heldenklau erst ganz zuletzt einkassiert hatte.
Er konnte nicht nur spielen, sondern sang auch dazu, mit einer Altstimme, als wäre er eine verkleidete Frau. »In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine.« In einer solchen erst recht nicht, dachte Pietzsch. »Denn die Liebe im hellen Mondenscheine …« Unsinn, Blasenverkühlung und kalter Arsch! »Ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine …« Im Halbdunkel am oberen Ende der Treppe lehnte eine schlanke Gestalt an der Wand, die Arme vor der Brust gekreuzt, und sah dem Akkordeonisten zu, Pietzsch versuchte ein Lächeln und ließ es gleich wieder bleiben. »Einesteils und andrerseits und außerdem!«
Mindestens, dachte Pietzsch und klatschte wie die anderen auch, denn der Akkordeonspieler spielte den letzten Akkord und salutierte verlegen zu Pietzsch. Das Gerät da habe er vom Schulmeister bekommen, sagte er, als das Klatschen aufgehört hatte. Pietzsch warf einen Blick ins Schulzimmer, aber in einer Ecke lag dort nur der SS-Mann mit dem frikassierten Arm, auf einer Holzkiste neben ihm brannte wie zum Trost ein Hindenburglicht.
Der Akkordeonspieler hatte den nächsten Schlager intoniert, Pietzsch erkannte ihn, noch bevor der Spieler seinen Alt losließ: »Davon geht die Welt nicht unter«, und so schob er sich am Akkordeonisten vorbei die Treppe hinauf. Die schmale schwarze Gestalt, die eben noch an der Wand gelehnt und der Musik zugehört hatte, war verschwunden. Er ging weiter zur Lehrerswohnung, die Tür war offen, aus dem Wohnzimmer drangen Tabakqualm und der Lärm von lautem Streitgespräch, Pietzsch blieb im Türrahmen stehen und blickte hinein. Um den Tisch voller Gläser, Weinflaschen und Aschenbecher saßen nur noch einige wenige Männer, der Goldfasan Johler, der Lehrer Beug, der Aktentaschen-Mann mit der Rübennase, ein Bauersmann mit einem Gesicht wie ein eingeschrumpelter Apfel und der Kappe neben sich auf dem Tisch. Die meisten anderen, die sich zur Sondersendung eingefunden hatten, waren wieder gegangen.
»Wir alle müssen doch sehen, dass unser Vaterland in einem elenderen Zustand ist als selbst 1648, geschändet, zerstört, verwüstet!« Pietzsch beugte sich vor, der da redete, war ein noch nicht alter, aber bereits grauhaariger Mann mit amputiertem Unterschenkel, und während er redete, hatte er seine Krücke auf den Goldfasan gerichtet und stieß sie wie zur Bekräftigung vor, bei jedem einzelnen Wort, geschändet, zerstört, verwüstet!
Pietzsch blickte zu dem Goldfasan, der einen Römer in der Hand hielt und davon oder von der Rede des Einbeinigen ganz schmale Augen bekommen hatte. »Mit der Krücke brauchen Sie nicht nach mir zu stoßen«, sagte Johler schließlich, als dem anderen der Atem ausgegangen war, »wenn Sie nur zugehört hätten, was ich sage! Bin ich denn vielleicht ein Freund vom Klumpfuß, hä? Die ganze Partei weiß das, dass der Klumpfuß und ich uns auf den Tod nicht …« Er wandte sich zum Lehrer, »sag ihm das, Beug! Auf den Tod nicht! Und das mit den neueren und schöneren Dörfern und Städten, dieses Gesäusel ist nicht auf meinem Mist gewachsen, Armut und Mangel und das allereinfachste Leben, das ist meine Predigt!« Er brach ab und blickte auf, »haben Sie jetzt verdammt noch mal Nachricht, Sie an der Tür?«
Pietzsch salutierte und erklärte, leider sei noch kein Bote eingetroffen. Außerdem müsse er den Kampfkommandanten davon in Kenntnis setzen, dass die Amerikaner nur noch zwanzig Kilometer entfernt seien. »Da es im Augenblick westlich von uns keine Widerstandslinie mehr gibt, kann der Feind bereits im Morgengrauen hier eintreffen. Vermutlich geht das Bataillonskommando davon aus …«
»Hören Sie auf!«, fiel ihm Johler ins Wort. »Keine Widerstandslinie mehr! Das ist doch einfach lachhaft, zum Wiehern lachhaft!« Er blickte sich um, aber niemandem schien nach Lachen zumute.
»Das Bataillonskommando wird davon ausgehen, dass der Feind bereits hier ist«, fuhr Pietzsch ungerührt fort. »Im Übrigen wird im Dorf ein Fuhrwerk bereitgestellt, um besonders gefährdete Personen noch in die Kreisstadt zu bringen.«
»Was sagen Sie da?« Johler stemmte sich mit beiden Armen am Tisch hoch. Warum er das erst jetzt erfahre? Und ob man im Dorf da nicht ein bisschen früher hätte draufkommen können? Ohne eine Antwort abzuwarten, kippte er den letzten Rest aus seinem Römer in sich hinein, warf das Glas mit angewiderter Miene ins Zimmer, dass es klirrend in Stücke sprang, und hob die Hand. »Heilhittläh!«
Zornig brüllten die Kühe und scheuten die Dunkelheit, und einen Leiterwagen wollten sie schon gar nicht ziehen. Die umliegenden Gehöfte hatten schattenhafte Gestalten hervorgebracht, als müssten sie sich der Abreise des hohen Besuchs vergewissern. Für Johlers Frau hatte man eine Decke gefunden, in die sie sich einwickeln konnte, und einen Packen Stroh als Sitzplatz. Die zwei SS-Männer hatten sich auf den Boden des Leiterwagens gehockt, der dritte von ihnen, der Verwundete, wurde im Schulhaus zurückgelassen; er sei nicht transportfähig, hatte der Russenarzt gesagt. Dicht beieinander kauernd hatte auch das Flüchtlingspaar aus Norddeutschland ein Plätzchen auf dem Leiterwagen gefunden und war still und froh, dass die anderen es duldeten. Johler selbst stand breitbeinig im Wagen, die Hände auf den vorderen Querbalken gelegt, ganz so, wie er sich zu anderer Zeit im offenen Daimler oder Maybach durch Stuttgart oder Friedrichshafen hatte kutschieren lassen.
Der Bauer Vöhringer hielt eine der beiden Kühe an einem Halfter und redete ihr zu, aber sie war unwillig und stieß mit dem Kopf nach ihm, das störte die andere Kuh auf, und plötzlich setzten sich beide in Bewegung, und der Leiterwagen nahm rumpelnd bescheidene Fahrt auf, als dahinter Geschrei aufkam. »Halt! So haltet doch!« Jeder zwei Koffer in den Händen und dick in Mäntel verpackt kamen die Eheleute Beug angerannt, mit Mühe stoppte Vöhringer seine Kühe, eilig huschten schattenhafte Gestalten herbei und halfen den Beugs auf den Leiterwagen, und kaum waren sie oben, ließen sich die Kühe auch schon nicht mehr halten. Pietzsch legte grüßend die Hand an die Uniformmütze, aber für diesmal musste sich Johler mit beiden Händen am vorderen Querbalken festhalten, also kein Heilhittläh! und nichts, dafür rutschte eine schwere Aktentasche vom Leiterwagen und plumpste Pfeifle vor die Füße.
»Lass fahren dahin!«, sagte der und hob die Aktentasche auf.
Es roch nach kaltem Tabakqualm und dem Mief von alten Männern. Eine Stalllaterne verbreitete ihr unfreundliches Licht. Auf dem Sitzungstisch des Rathauses war ausgeleert, was sich in der zurückgelassenen Aktentasche an hochgeheimen Staatspapieren gefunden hatte: blanko Kennkarten und Reisepässe des Deutschen Reiches, ferner ein Stapel Entlassungspapiere der Wehrmacht, dazu Stempel, Stempelkissen für die Fingerabdrücke und Hefter für die Passfotos.
»Ausfüllen tu das besser ich«, sagte Pfeifle, »damit es wenigstens ungefähr nach Kanzleischrift aussieht. Und wenn du einen neuen Namen willst, brauch ich noch ein Foto. Und die Unterschrift musst du vorher einüben, damit sie locker von der Hand geht. Noch was …« Er blickte zur Seite, als ob er plötzlich verlegen wäre. »Ich bin hier sozusagen auch die Ortspolizeibehörde – wenn du willst, stell ich dir eine Anmeldebestätigung aus, dann kannst du fürs Erste bei uns wohnen.«
Ihm sei sein alter Name recht, gab Pietzsch zurück.
»Schön für dich«, meinte Pfeifle. »Das mit dem Zimmer wär kein Problem, und Arbeit hat es im Dorf auch für dich, überleg dir’s! Und schick mir deine Kameraden! Eine Sache von zwei Minuten, und der Krieg ist für sie aus.« Pietzsch zögerte. »Ich weiß nicht, ob die so ohne Weiteres mitziehen. Muss erst mit ihnen reden.«
»Dass sie mitreden sollen, sind die nicht gewohnt.« Pfeifle schüttelte den Kopf. »Der Johler – der hat doch gesagt, er sei jetzt der Kampfkommandant? Dann sag ihnen, es sei ein Befehl von ihm!«
Pietzsch verließ das Rathaus und ging die Außentreppe hinab, die zum Schulhof führte. Niemand war mehr zu sehen, nicht einmal ein Schatten von jemandem. Am Himmel jagte der halbe Mond durch ein Wolkenmeer. Pietzsch kam auf die Terrasse, von der aus es zu den Schülerklos im Untergeschoss des Rathauses ging, in der Ecke lehnte das Tier mit den zwei Füßen und den zwei Rücken an einer Wand und kam bereits ins Keuchen, Pietzsch sah nicht näher hin und bemerkte doch das eine weiße Bein und den in einem Streifen Mondlicht zuckenden blonden Zopf. Der Unterscharführer fiel ihm ein: Wie schnell einer ersetzt werden kann!
Als er über den Hof ging und genug Abstand vom Schulhaus hatte, blickte er hinauf zu dem Mansardenfenster des Dachkämmerchens. Dann verzog er das Gesicht und ging weiter, bis zu dem Verhau, an dem noch immer zwei von den Leuten aus seinem Zug Wache schoben. »Besondere Vorkommnisse? Noch keine Ami-Panzer da unten?«
»Nein, nichts.«
»Dann ist es gut«, sagte Pietzsch und schnüffelte. »Haben euch die Kameraden keinen Wein gebracht? Oder wenigstens einen Most?«
»Wein? Most? Uns doch nicht.«
»Dann kommt mit!« Die beiden Wachsoldaten sahen sich an.
»Wir haben was zu bereden«, erklärte Pietzsch. »Nein, nichts zu bereden. Ein Befehl vom Kampfkommandant.«
Zu dritt überquerten sie den Hof und traten in den Vorraum. Die meisten der Hindenburglichter waren ausgebrannt und das Akkordeonspiel verstummt. Im Halbdunkel waren noch zwei oder drei Männer zu ahnen. Pietzsch wollte wissen, wo die anderen seien. »Einer ist schon im Stroh«, sagte eine Stimme, »und zwei …« Irgendwo erhob sich eine Hand, den Daumen zwischen Mittel- und Zeigefinger eingeklemmt.
»Also«, sagte Pietzsch, »ich hab jetzt keine Lust, hier rumzubrüllen. Überhaupt hat es sich ausgebrüllt. Ich will nur einen schönen Gruß vom Kampfkommandanten Johler ausrichten, und ihr geht jetzt einer nach dem anderen nach nebenan ins Rathaus und lasst euch eure Entlassungspapiere geben. Und sagt gefälligst den anderen Bescheid.« »Jetzt?« »Ja, jetzt, sofort.«
Er sah sich um und blickte in leere, ratlose und verwirrte Gesichter. Plötzlich begriff er, dass seine Kameraden Angst hatten, Angst vor dem Bluthund Schelmer im grauen Daimler und seinem fliegenden Standgericht, das jeden aufknüpfen ließ, der auch nur mit einem weißen Taschentuch angetroffen wurde. Aber auch Angst davor, dass ihnen von nun an niemand mehr sagte, was sie zu tun hätten.
»Ich hab’s euch doch gesagt, dass das ein Befehl ist. Punkt. Weiter hab ich euch nichts mehr zu sagen, zu befehlen oder vorzuschreiben. Lasst euch die Papiere geben oder lasst es bleiben, geht nach Hause oder fragt die Bauern, ob sie Arbeit für euch haben, oder verkriecht euch, bis die Amis kommen, die sind in ein paar Stunden da oder am Abend! Und wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann rennt dem Kampfkommandanten und seinen Kühen hinterher und bittet um Erlaubnis, den Heldentod sterben zu dürfen. Was immer ihr macht, macht es gut! Es war mir – na ja, ein direktes Vergnügen war es wohl nicht.«
Er nickte ihnen zu, wandte sich um und füllte an dem Handwaschbecken seine Feldflasche mit frischem Wasser auf und schraubte sie wieder zu. Einen Augenblick blieb er stehen, als horchte er auf das, was seine Kameraden halblaut beratschlagten. Dann zuckte er die Achseln wie jemand, bei dem es auf nichts mehr ankommt, also auch nicht auf einen letzten Versuch, und stieg das stockdunkle Treppenhaus hoch, vorsichtig, damit er nicht über irgendwelche Reste der Geburtstagsfeier stolperte, und weiter die Treppe zu den beiden Dachkämmerchen und klopfte an der Tür, erst behutsam, dann stärker, wartete, horchte, klopfte noch einmal. Plötzlich hörte er dieses schleifende, jaulende Geräusch, zum zweiten Mal an diesem Abend, die Tür vor ihm wurde aufgeschlossen, jemand leuchtete ihm ins Gesicht.
»Sie wecken meinen Sohn«, sagte die Flüchtlingin, und in ihrer Stimme schwang nichts von dem, was er sich eingebildet haben mochte. Hastig und verlegen bat er um Entschuldigung, er habe nicht stören wollen. »Aber falls Sie eine Kennkarte brauchen oder einen Reisepass, für sich oder jemand anderen … im Rathaus sind jetzt welche zu erhalten, jetzt gleich, verstehen Sie, heute Nacht noch! Keine Geburtsurkunde notwendig, kein Staatsangehörigkeitsnachweis, aber es geht wirklich nur heute Nacht!«
Von Osten her dämmerte der Morgen herauf, grau und unausgeschlafen. Pietzsch, in seinen Uniformmantel gehüllt, saß auf einem Baumstamm, einem Überbleibsel der Barrikade, die vor zwei oder drei Stunden von dem Feuerwehrkommandanten Reiff und ein paar alten Bauern abgebaut worden war, ein weißes Badehandtuch neben sich, das er in der verlassenen Lehrerswohnung requiriert hatte. Er schaute auf das Tal, durch das sich die Straße von Westen her schlängelte, als käme sie aus der Nacht. Niemand war unterwegs, weder Flüchtling noch Soldat, und die Marauders und Spitfires hatten – vermutlich gerade deshalb – ihre Jagdflüge noch nicht wieder aufgenommen. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen und spürte, wie abgrundtief müde er war … Schlafen? Er tastete nach dem Tablettenröhrchen in seiner Manteltasche, holte es heraus und schraubte es auf. Ein paar Pillen waren noch darin, er nahm eine davon und spülte mit einem Schluck aus der Feldflasche nach. In einer halben Stunde würde es ihm besser gehen.
Ein neuer Tag. Was würde er ihm bringen? Pietzsch schaute zum Wolkenhimmel hinauf, der ihm gerade so kalt und gleichgültig vorkam wie der Himmel über der endlosen Straße, durch die er frühmorgens zur Schule musste, den schweren Ranzen auf dem Kinderrücken. Aber die Kindheit war vorbei, und ob jenes ferne Straßendorf nun abgebrannt war oder vielleicht doch so halbwegs davongekommen, so hatten sie dort jedenfalls anderes zu tun, als auf ihn zu warten. Aber egal! Das Leben war ihm noch etwas schuldig. Zumindest eine Tasse Tee. Die war ihm versprochen, und so würde nicht einmal er mit ganz leeren Händen aus dem Krieg heimkehren.