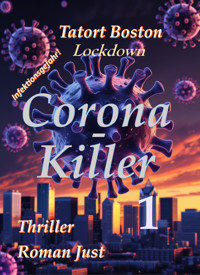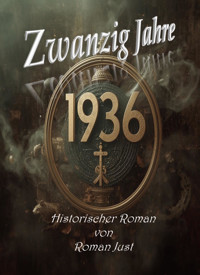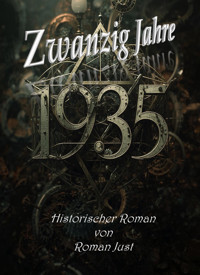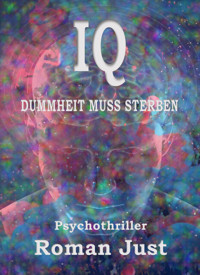9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gelsenecke
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Inhalt: Durch verschwundene Frauen, die nach einem Jahr tot aufgefunden werden und eine verblüffende Ähnlichkeit zu verunglückten und lebenden weiblichen Personen haben, kommt eine Kettenreaktion von Verbrechen ins Rollen. Während der Ermittlungen vereinen sich Vergangenheit und Gegenwart zu einer Tragödie, die weitere Opfer fordert und aufzeigt, wie eng Genialität und Wahnsinn, Glück und Zufall sowie Traum und Realität beieinander liegen. Wird es unter den gegebenen Voraussetzungen ein Happy End geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17.Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Übersicht der Blutgruppensysteme:
Veröffentlichungen des Autors:
Kontakt zum Autor:
Impressum
Tatort-Boston
Band 1
Alle Thriller der Tatort-Boston-Reihe sind unabhängig voneinander lesbar.
Über den Autor
Roman Just ist in der Welt der Literatur in verschiedenen Genres unterwegs. Mit den Thrillern der "Tatort-BostonReihe" hat er den Einstieg in die Literaturwelt begonnen, sie dann mit den "Gelsenkrimis" fortgesetzt. Neben den Thrillern und Krimis arbeitet er an einer mehrteiligen Dystopie und einer historischen Familiensaga, hinzu kommen Ausflüge in andere Genres.
Der Autor und bekennender Selfpublisher ist Jahrgang 1961, lebt in Gelsenkirchen, leidet mit dem vor Ort ansässigen Fußballclub zu allen Zeiten mit, spielt außerdem gerne Schach und beschäftigt sich gelegentlich mit der Astronomie.
Zur Person:
Sternzeichen: Jungfrau
Gewicht: Im Moment viel zu viel
Erlernter Beruf: Kellner
Derzeit tätig als: Autor/Selfpublisher
Charaktereigenschaften: Impulsiv/Hilfsbereit
Laster: Nie zufrieden mit einem Ergebnis
Vorteil: Meistens sehr geduldig
Er mag: Klare Aussagen
Er mag nicht: Gier und Neid
Er kann nicht: Den Mund halten
Er kann: Zuhören
Tatort Boston
Blutender
Tod
1. Kapitel
So fing es an ...
D
as Jahr 1953 war politisch und militärisch betrachtet nicht aufregender als die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Chaos regierte allerorts. Der Ton zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion wurde schärfer. Der Kalte Krieg wurde erbitterter geführt und das Wettrüsten erfuhr eine neue Dimension. Die Geschichte beschritt gnadenlos den Weg, der von Menschenhand geschrieben wurde. Unbedeutend blieben dabei die Schicksale Einzelner. Einige wenige erlangten einen zweifelhaften sowie furchterregenden Ruf. Sie brachten durch die übernommene Macht großes Leid, Folter, Terror und den Tod über das Volk. Es war Januar, der Partisanenkämpfer und Volksheld Tito, dessen wahrer Name Josip Broz lautete, wurde Staatspräsident des ehemaligen Jugoslawiens. Damals war niemand darauf vorbereitet, dass der Kriegsheld zwei Gesichter besaß, und zum Despoten werden würde. Im Februar schrie wieder einmal die Natur auf und sorgte für eine verheerende Sturmflut in England und Belgien. Hart traf es die Niederlande: Das Land stand zu einem Drittel unter Wasser und es gab zahlreiche Todesopfer zu beklagen. Im März 1953 starb der neben Adolf Hitler grausamste Diktator, den die Welt je hervorgebracht und gesehen hatte: Josef W. Stalin! Väterchen wurde der Tyrann von den Landsleuten genannt. Der Kremlchef entpuppte sich bald zu einem Monster in Menschengestalt. Er ließ verfolgen, quälen, unschuldig einsperren und töten. Unzählige Menschenleben forderte dessen Regentschaft. Der neue Gewaltherrscher hieß ab September Nikita S. Chruschtschow.
Der Osten Europas versank unter dem Hammer und der Sichel des kommunistischen Regimes. Die Freiheit der Menschen existierte praktisch nicht mehr. Die Armut nahm zu und der Lebensstandard wurde durch den Mangel an Waren unerträglicher.
Dafür erfuhr die Demokratie in Westdeutschland im April einen neuen Höhepunkt: Mann und Frau wurden vor dem Gesetz gleichgestellt. In Ostdeutschland wurde aus Chemnitz zum Leidwesen der Einwohner Karl-Marx-Stadt. Im Mai wurde der Mount Everest, der höchste Berg der Erde, erstmals von Menschen bestiegen. Im Juni wurde Elisabeth II. zur Königin von Großbritannien gekrönt. Vierzehn Tage später walzten sowjetische Panzer einen Arbeiteraufstand in der DDR nieder. Im selben Monat kam es in der bayerischen Landeshauptstadt, München, zu schweren Unruhen. Der Grund dafür war, dass zwei Textilhäuser die Geschäfte am Samstagnachmittag zu öffnen beabsichtigten. Der Würger von Nottinghill, John Reginald H. Christie, ein Frauenmörder, wurde im Juli in London hingerichtet. Fidel Castro scheiterte auf der Karibikinsel Kuba mit einem Putschversuch. Es war im August als die Sowjetunion erstmals eine Wasserstoffbombe getestet und die Welt damit in Angst und Schrecken versetzt hatte. Bei den zweiten Wahlen zum Deutschen Bundestag triumphierte Konrad Adenauer mit der CDU/CSU. In diesem September heiratete John F. Kennedy Jacqueline Bouvier. Für seine historisch-biografischen Werke erhielt Winston Churchill, durch und durch ein Politiker, im Oktober den begehrten Literaturnobelpreis. Friedrich Paulus, der Befehlshaber der sechsten Armee in Stalingrad, wurde in diesem Herbstmonat aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Er kehrte in die Heimat zurück: Sie lag nicht mehr im Dritten Reich, sondern in Ostdeutschland. In den letzten acht Wochen des Jahres fiel der Interzonenpass zwischen Ost- und Westdeutschland für immer weg. Walter Hallstein, Staatssekretär im Außenministerium, forderte in jenen Tagen energisch die Freilassung sämtlicher deutscher Kriegsgefangener. David Ben Gurion, Staatsgründer Israels und Ministerpräsident trat von dem Amt zurück. Der "Playboy" brach zum Entsetzen aller Moralapostel das NacktTabu. Am Jahresende waren dreihunderttausend Menschen aus der DDR in den Westen geflohen. Das und mehr geschah 1953.
Unbemerkt von den Medien und der Öffentlichkeit blieb in diesem Jahr der Erfolg von zwei Wissenschaftlern. Sie hatten einen Weg gefunden, der es ihnen ermöglichte, die Molekularstruktur der menschlichen DNA zu entschlüsseln. Diese Entdeckung forderte die Forscher auf der ganzen Welt, die sich mit der DNA des Menschen befassten. Sie sorgte dafür, dass unter diesen teilweise genialen Spezialisten der Medizin in Bezug auf die vollständige Erkennung der Erbgutsubstanz ein radikaler Wettkampf entbrannte. Das lag in erster Linie an den Geldgebern. Egal, ob sie staatlicher oder privater Art waren. Sie waren es, die unerbittlich auf eine schnelle Auflösung der menschlichen DNA drängten. Die Entschlüsselung der Bausubstanz bedeutete für die Investoren einen in der Höhe unmöglich abzuschätzenden Profit. Insbesondere dem, der sie vor der Konkurrenz in den Händen hielt. Die Decodierung der DNA bot die Möglichkeit, das Äußere und Innere eines Menschen oder Tieres zu manipulieren.
Bei den finanziellen Überlegungen hatte niemand die kompletten wirtschaftlichen und denkbaren militärischen Vorteile berücksichtigt. Trotz der großen Bemühungen ist es der Wissenschaft bis heute nicht gelungen, die menschliche Bausubstanz vollständig zu decodieren. In der Gegenwart sind den Forschern auf der ganzen Welt vierzig Prozent der DNA ein Rätsel. Die einzelnen Abschnitte der DNA wurden Gene genannt. Diese Einheiten und Sequenzabschnitte verfügten über Steuerungsfunktionen im Körper, die den gentechnischen Laboren im großen Umfang nach wie vor unbekannt geblieben sind. Die schwarzen Schafe in diesem Metier der Medizin schreckte das von waghalsigen Experimenten nicht ab. Die Forschungen in und um die DNA wurden laufend intensiviert. Das auf verschiedenen Ebenen und in vielen Ländern auf der ganzen Welt. In den Anfangsjahren der Erbgutanalyse standen nicht der Fortschritt und die Wissenschaft im Vordergrund. Es zählte einzig und allein der persönliche Erfolg. Jeder eiferte darum, der Erste zu sein, dem es gelingen würde, die Molekularstruktur des Menschen zu entschlüsseln. Es war eine logische Folge, dass die meisten Institutionen und Organisationen für sich tätig waren. Das erlangte Wissen wurde nicht mit der Konkurrenz geteilt. Mit den Jahren änderte sich dieses Verhalten. Bedingt durch deutlich mehr Rückschläge anstatt der ersehnten Erfolge, wurde der lächerliche und sture Egoismus aufgegeben. Die Forschung in dieser Branche erlebte einen regelrechten Boom. Die Welt, das Leben und die Menschen waren im Begriff, sich zu erklären. Es war eine eigene Galaxie, in die versucht wurde einzudringen. Es wurde ein Universum für sich, es war der Kosmos der DNA. Um in der umstrittenen Genforschung tätig zu werden, wäre ein hoher Grad an Menschlichkeit erforderlich. Bald wurde klar, dass ein vernünftiger Forscher und die Humanität in diesem Metier unerwünscht waren. Den Unternehmen und Sponsoren waren die Wissenschaft und der bahnbrechende medizinische Fortschritt unwichtig. Ihnen lagen der persönliche Profit und der eigene, leibliche Vorteil am Herzen. Schnell versuchten manche Geldgeber und Firmen, ein Kapital aus dieser Forschung zu schlagen. Wenige mit Erfolg, wesentlich mehr mit dem Verlust der gesamten Existenz und Zukunft. Einige Wissenschaftler, die den Aufbau des Lebens, die DNA, vergeblich erforscht hatten, zerstörten, ohne es zu merken, ihr eigenes Dasein. Merkwürdigerweise wurden vor allem die sogenannten schwarzen Schafe in diesem Sektor der Wissenschaft am stärksten gefördert. Sie bekamen die besten Geräte und das meiste Geld. Ethik und Moral brachten keinen Gewinn. Die Profite bei einer Erfindung im Kampf gegen den Krebs oder das Alter, waren in den Beträgen überhaupt nicht kalkulierbar. Somit war es zu erwarten, dass bei den Firmen und Investoren die Seriosität und sämtliche ethischen Bedenken völlig verschwanden. Die Konsequenz daraus war, dass die Zahl der schwarzen Schafe in diesem Berufsfeld zunahm. Die menschliche Bausubstanz wurde für die Forscher im Lauf der Zeit eine eigene Galaxie. Das Unbekannte zeigte den Wissenschaftlern die Grenzen auf. Erst im Juni 1970 gelang es einem Biochemiker, der zwei Jahre zuvor den Nobelpreis in der Medizin erhalten hatte, ein synthetisches Gen mit siebenundsiebzig Grundbausteinen des Lebens herzustellen. Es waren Tage, in der die Gentechnik und die Genmedizin immer mehr in das Blickfeld der Medien und damit der Öffentlichkeit rückten. Das Schaf Dolly verstarb am 14. Februar 2003, das Tier war erst sechseinhalb Jahre alt. Einige Monate vor dem Tod wurden bei dem geklonten Geschöpf deutliche Alterserscheinungen festgestellt. Das vierbeinige Lebewesen war aus wissenschaftlicher Sicht ein unvollkommener Klon. Fälschlicherweise wurde es von den Medien anders beschrieben. Die Art, wie das Schaf erschaffen worden war, ließ eine hundertprozentige Übereinstimmung mit dem Ausgangstier nicht zu. Deshalb war Dolly streng genommen kein perfekter Klon. Das Projekt wurde in Schottland, im Roslin-Institut, nahe Edinburgh, in die Realität umgesetzt. Bei der Öffentlichkeit rief das Tier allerorts zwiespältige Reaktionen hervor. Einerseits wurde es als eine Sensation angesehen. Die Gegner der Genforschung äußerten hingegen erhebliche Bedenken. Sie sahen in dem geklonten Wesen die Vorstufe von einem Doktor Frankenstein und dessen Brut. In der Politik waren die Meinungen nicht minder gespalten. Die Leute auf der Straße distanzierten sich mehr von dem Projekt, anstatt dass sie es guthießen. Das Schaf Dolly war eine Weltsensation, zugleich ein schreckliches Weltwunder! Diese wissenschaftlichen Arbeiten wurden in der Folge zunehmend durch skrupellose Idealisten missbraucht. Die neuen technischen Geräte, die auf den Markt gekommen waren, boten den Genforschern bessere Arbeitsmöglichkeiten. Je tiefer sie in das Universum der DNA vordrangen, umso schneller vergaßen sie die Regeln der Ethik und Moral. Jede Kritik an ihrer Arbeit prallte an ihnen ab, wurde für sie trotzdem zu einem Hindernis. Die Vorgehensweise wurde immer unseriöser, daran änderten selbst die neu entstandenen Gesetze nichts.Die Decodierung der Bausubstanz schritt trotz aller Bemühungen langsam voran. Das verhinderte nicht, dass zahlreiche Wissenschaftler die Forschung an den menschlichen Zellen weiter betrieben. Gewonnene Ergebnisse wurden in der Folge an lebendigen Tieren illegal getestet. Der Natur und dem Leben stand ein massiver Einschnitt bevor. Einige wahnsinnig gewordene Genforscher, sahen sich dazu berufen, Gott zu spielen! Die Gesetzgebung war außerdem nicht fähig, dass im Fall Dolly nur eine Person den gesamten Erfolg für sich verbuchte. Es wurde ignoriert, dass ein zweiter Zellbiologe maßgeblich an diesem Klon-Projekt beteiligt war. Wäre es gerecht zugegangen, hätte der übergangene Forscher den Ruhm, die finanziellen Quellen sowie die Ehrungen und Preise erhalten. Dolly, dass einzige von neunundzwanzig Embryonen, welches überlebt hatte, brachte somit ein weiteres menschliches, schwarzes Schaf hervor. Es wurde zum Leidwesen der Gentechnologie nicht das Letzte, das in diesem Zweig der Wissenschaft alle Werte des Lebens vergaß.
Unbedeutend blieb, dass 1953 auch der Professor geboren wurde.
2. Kapitel
Sonntag, 01. Oktober
Morgen
E
s war nicht einmal fünf Uhr, da wurde Detective Forrest Waterspoon von der Einsatzzentrale geweckt und zu der Fundstelle einer Leiche beordert wurde. Vor Ort wurde er von seinem Partner empfangen. Er arbeitete seit wenigen Wochen mit Henry McClure zusammen und das Eis zwischen ihnen war längst nicht aufgetaut. Der erfahrene Ermittler war kaum aus dem alten Ford ausgestiegen, da wurde er von dem unausgeschlafen wirkendenden neuen Kollegen mit einem lächerlich bunten Regenschirm in der Hand begrüßt. Ein anonymer Anrufer hatte sich in der Notrufzentrale gemeldet und die Stelle ausführlich beschrieben, wo angeblich die Leiche einer jungen Frau lag. Forrest trottete im strömenden Regen, gefolgt von Henry, zum naheliegenden Flussufer. Dort angekommen, begab er sich neben einem gleichaltrigen Mann in die Hocke. Mit dem Hut auf seinem Kopf sah er sich wie der Pathologe das Opfer an. Über der Toten war eine Plane aufgespannt worden, um vom Täter hinterlassene Spuren vor dem Guss zu retten. Ein kleiner, rundlicher, auf einem dreibeinigen Stativ befestigter Scheinwerfer erleuchtete den zarten, nassen und vollkommen nackten Körper. Die langsam einsetzende Morgendämmerung hatte nicht die Macht, sich gegen den grauen Himmel durchzusetzen. Die Regentropfen wirkten wie Tränen, die jemand aus Trauer wegen der auf dem Bauch liegenden Toten vergoss. Wie die suchenden Augen des Pathologen sah Forrest zunächst keine sichtbaren Verletzungen an dem leblosen Frauenkörper. Henry McClure stand mit seinem grotesken Regenschirm neben ihnen und sah zu, wie der Facharzt für Pathologie das Opfer umdrehte. Ohne ein Wort wandte er sich von dem Leichnam ab und rannte einige Meter am Flussufer entlang, um sich zu übergeben. Kopfschüttelnd sah ihm der Detective hinterher. Die Arbeit mit dem Anfänger wurde ihm eine Last. Den Zögling mitzuschleppen und zu behüten, war eine Aufgabe, die ihm nicht behagte.
Der Pathologe begutachtete die Leiche mithilfe einer Taschenlampe und deutete nach ein paar Sekunden auf den Bauch und den Arm des leblosen Körpers. Forrest hatte die Einstiche in den Ellenbogen und die Nähte inmitten ihres Oberkörpers ebenfalls registriert. Die Brust und die Magengegend der Frau waren ekelhaft anzusehen. Die obere Region der Toten sah aus, wie schon obduziert.
Die Augen des Detectives wanderten zu den Streifenpolizisten, die verdrossen und gelangweilt dafür sorgten, dass niemand in die Nähe der Leiche kam. Zum Dank wurden sie vom Regen durchnässt und dem Wind gepiesackt. Die beißende Brise ließ die Männer vor Kälte erzittern und schubste ihre Körper hin und her, womit er zu sagen versuchte, dass man hier überflüssig war und sofort zu verschwinden hatte. Die Regenmäntel sollten sie zwar zu schützen, aber konnten nicht verhindern, dass sich das Regenwasser über die Ärmelenden und dem zu breiten Kragen den Weg bis auf die Haut bahnte. Forrest bemitleidete die Kollegen, die Arbeit der Polizisten war undankbar, deswegen verstand er deren Gemütslage. Zu dem Verdruss wegen dem Wetter kam hinzu, dass im sichtbaren Umkreis keine einzige Menschenseele zu sehen war. Er wandte sich wieder Neil zu, der sich ebenfalls aufgerichtet und die Tote mit einem Tuch abgedeckt hatte.
Der Ermittler schätzte den Pathologen und dessen Arbeit. Der ihm vorausgeeilte Ruf besagte, dass er auf dem ausgeübten Gebiet eine Koryphäe war. »Was kannst du mir zu der Art und zum Zeitpunkt des Todes sagen?«, fragte der Detective, um eine grobe Einschätzung zu erhalten.
Neil Sesse zuckte mit den Schultern. »Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Frau ungefähr sechs bis acht Stunden tot ist. Mehr kann ich dir erst nach der Obduktion mitteilen.«
Der Detective sah auf die Leuchtziffern der Armbanduhr, die er zum Hochzeitstag geschenkt bekommen hatte. Zu welchem, daran fehlte ihm die Erinnerung. Seine Stimmung wurde nachteiliger. »Also trat der Tod auf jeden Fall gegen Mitternacht ein«, rechnete er die Uhrzeit zurück und erhielt eine zustimmende Geste des Pathologen. »Unabhängig von den Nähten und den Nadeleinstichen: Wie ist sie gestoben? Ich habe keine Verletzungen gesehen, die auf einen Mord hindeuten«, deutete er auf die abgedeckte Frauenleiche.
»Ich habe keine Ahnung«, gab Neil Sesse zu und knipste die kleine Taschenlampe aus. Die Aktion unterstrich den ausgesprochenen Satz eindrucksvoll.
»Wann kann ich mit Ergebnissen rechnen?«, fragte der Detective und sah den Pathologen erwartungsvoll an.
Der Facharzt antwortete abwägend: »Bei dem Zustand des Opfers, frühestens heute Abend, spätestens morgen früh«, gefiel ihm das eigene Wortspiel.
Forrest bedankte sich für die Information und wandte sich von Neil und der Toten ab, die zum Abtransport vorbereitet wurde. Er trabte, wegen der Kopfbedeckung, den Regen ignorierend gemütlich Henry entgegen, der etwas wankend auf ihn zukam. Der unerfahrene Kollege sah elend aus, daran war das schicke Outfit, das er trug, in den Augen des Ermittlers Mitschuld. Die jungen Leute von heute bereiteten dem Detective, selbst dreifacher Vater, immer wieder Kopfzerbrechen. Sie gaben ihm manchmal Rätsel auf, die er unfähig war zu lösen, überraschten ihn gelegentlich, zu seinem Bedauern selten positiv. Als er und Henry McClure sich gegenüberstanden drehte er sich erneut der Toten zu. Die Leichen, die er bis jetzt in seiner Karriere gesehen hatte, waren in dem aufreibenden Berufsleben wegen der Aufenthaltsdauer im Langzeitgedächtnis unmöglich zu zählen. Ein Mord löste den nächsten ab, mitunter waren Gewaltdelikte dabei, die den Glauben an die Vernunft des Menschen verzweifeln ließen. Zum Glück waren die meisten Opfer in der hintersten Ecke der Erinnerungen begraben, nur deshalb war er in der Lage, sich an die Mehrzahl der Ermordeten nicht zu erinnern. Der Anblick der leblosen Frau war unangenehm und zudem Mitleid erregend. Die Nacktheit drückte eine gewisse Unschuld und Wehrlosigkeit aus. Nachdem sie am Flussufer angekommen waren, riss das tosende Wasser des Mystic River ständig an den Beinen der Toten. Es schien, dass die Strömung des Flusses die bewegungsunfähige Frau aufzuwecken versuchte, sie anschrie, aufzustehen und zu leben. Das Wetter wurde mit jeder Sekunde unangenehmer. Die Kälte, die der Wind scheinbar mit voller Absicht aus Norden herbeiwehte, ließ die ohnehin für diese Jahreszeit niedrige Temperatur deutlich kühler erscheinen. Die Regentropfen fielen durch die gelegentlich auftretenden Böen seitlich zur Erde, bekamen dadurch eine Wirkung, wie sie kleine, feine Nadelstiche hervorriefen. Der Toten am Ufer des Mystic River war es vorbehalten, den kalten, nassen und trüben Tag desaströser erscheinen zu lassen, als er es wettermäßig ohnehin schon war. Die Silhouetten der Stadt, die flussaufwärts lagen, waren eingehüllt in Wolken und Dunst. Der Herbst und das Leben, im Moment vor allem der Tod, zeigten sich an diesem frühen und durch die Frauenleiche frostig empfundenen Oktobermorgen von der widerlichsten Seite. War das der Grund, dass selbst die Presse sich bis jetzt nicht sehen gelassen hatte? In die verwahrloste und heruntergekommene Zone der Stadt verlief sich ohnehin kaum einmal eine Menschenseele.
Das alte Hafenviertel von Boston war ein trostloser, verlassener und äußerst dreckiger Fleck auf dieser Erde. Die Gegend wurde durch die Ruinen der Lagerhäuser und Hallen sowie der hier stillgelegten Reedereien und Werften geprägt. Die Betriebe waren näher an die Stadt gezogen, um die Vorteile der sich ständig erweiternden und besseren Infrastruktur zu nutzen. Der neuen Anlegestellen und Liegeplätze hatte sich vollkommen verändert. Die Anlage war in ihren Ausmaßen gewachsen, sie wurde moderner und es gelang, sie an die Bedürfnisse der Schifffahrt anzupassen.
Jetzt boomte der Hafen und gehörte zu den größten an der amerikanischen Ostküste. Die alte Hafengegend hatte sich durch die Umbaumaßnahmen im Laufe der Jahre von der Stadt entfernt. Trotz einiger historischer Plätze aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert war das Gebiet in eine Art Isolation und in Vergessenheit geraten. Die Geschäfte waren wichtiger als die Vergangenheit. Der trostlose Hafen bot einen traurigen Anblick. Er lag verwahrlost da, glich praktisch einer Geisterstadt, die etwas Unheimliches und Gespenstisches ausstrahlte. Es stand fest: Wenn hier außer Ratten sonst jemand unterwegs war, der gehörte den Menschen an, die wie das Areal ins Abseits getrieben worden waren. Bei ihnen handelte es sich um Drogensüchtige, Obdachlose, Dealer, Ganoven aller Art und Alkoholiker. Forrest beobachtete, wie die Gerichtsmediziner die zum Abtransport vorbereitete Tote emporhoben und davontrugen. Er sah auf die Stelle, wo sie gelegen hatte. Mit ausgestreckten Armen war sie neben einer Betonplatte von dem Mörder abgelegt worden. Die Männer von der Spurensicherung waren aufgrund des Wetters arbeitslos. Der Regen hatte alle Spuren, falls es überhaupt welche gegeben hatte, im Nu weggewaschen. Bei den nostalgischen Überlegungen zu dem Hafen bekamen die Sinne von Forrest ein Warnzeichen zugestellt. Ihm wurde bewusst, dass er fror und am ganzen Körper zitterte. Er war sich nicht sicher, was seinem Gemüt mehr zusetzte, die Kälte oder die Leiche. Womöglich neigte seine massive Statur aus beiden Gründen zu dem gefühlten und äußerlich sichtbaren Symptom. Er griff in die Innentasche des Mantels und holte eine Zigarre hervor. Das Rauchen von Zigaretten hatte er aufgegeben, stattdessen gönnte er sich gelegentlich eine dicke Havanna. Schon nach dem ersten Zug wurde ihm wärmer. Mit dem Zweiten erhielt er ein besseres Gefühl. Durch den Dritten wurde ihm wohler in seiner Haut. Das Empfinden war beileibe nicht perfekt, aber der Zustand des Körpers und der Moral war erheblich gestiegen. Er sah zu Henry. Der blasse Kollege war wesentlich gefasster, dennoch stellte sich der Detective die Frage, was der junge Mann bei der Polizei zu bewirken gedachte. Er hatte mit vielen Anforderungen in diesem Beruf Probleme und war entgegen der geschmeidigen Figur zumindest an einem Tatort schwerfällig. Diese Schwäche barg eine Gefahr, die sie beide bei einem lapidaren Verhör in Schwierigkeiten und im Ernstfall Kopf und Kragen kosten würde. Er bewertete unübersichtliche Situationen oft naiv und sah das Gemeine auf der Welt mit kindlichen Augen. Dementsprechend benutzte er den Verstand. Auf eine gewisse Art war McClure für den Polizeidienst seelisch zu zart besaitet. Henry war mittelgroß, in der Statur schlank und im Gesicht knabenhaft. Er hatte ständig suchende braune Augen, die erst etwas erkannten und sahen, wenn sie durch eine Harry-Potter-Brille ergänzt wurden. Dem Detective war es schleierhaft, wie er es mit diesen körperlichen und moralischen Voraussetzungen geschafft hatte, bei der Polizei aufgenommen zu werden. Er vermutete, dass er Fürsprecher hatte, die entweder die erforderlichen Kompetenzen besaßen oder über maßgebliche Verbindungen verfügten.
Er sah sich darin durch den Umstand bestätigt, dass der Kollege nicht tadellos, sondern stets wahrhaft exzellent angezogen zum Dienst erschien. Er selbst, hätte für die Anzüge, wie Henry sie anzog, mit seinem Gehalt einen Kredit-antrag vergeblich beantragt. Keiner Bank wäre bereit, ihm für solche Kleidungsstücke ein Darlehen zu geben. Forrest hatte schroffe, kantige, wie Leder gegerbte Gesichtszüge. Das Haar war mit den vierundfünfzig Jahren, die er auf dem Buckel hatte, zurecht angegraut.
Deswegen sah er deutlich älter aus, hinzu kam der Hut, den er, seit einer Ewigkeit trug. Es gab Beamten auf dem Revier, die der Meinung waren, dass er mit der Kopfbedeckung nicht nur schlief, sondern mit dem Hut, der ein Markenzeichen von ihm war, sich zum Duschen und in die Badewanne begab. Solche Aussagen wurden in der Gegenwart des Detectives unterlassen. Forrest war zwar bei den meisten Kollegen beliebt, aber nicht als ein Spaßvogel und Kommunikationsgenie bekannt. Er hatte innerhalb der Behörde den Status eines kooperativen Einzelgängers, den man klugerweise in Ruhe ließ. Für Henry waren das keine idealen Voraussetzungen in Hinsicht auf eine Zusammenarbeit.
Forrest war seit dreiunddreißig Jahren glücklich verheiratet und Vater von zwei leiblichen Kindern sowie einer Adoptivtochter. Er war ein erfahrener Polizist, inzwischen sechsunddreißig Lenze im Dienst, achtzehn davon im Rang eines Detectives. Drei Mal hatte er eine Beförderung in einen höheren Dienstgrad abgelehnt. Es lag nicht in seiner Absicht, wegen einer gemütlicheren Position zu einem trägen Schreibtischhengst zu verkommen. Sein Arbeitsgebiet war die Straße, egal wie dreckig sie sich gab. Am Anfang seiner Laufbahn wurde er zwischen den Vorstädten von Boston und den Abteilungen hin- und hergeschoben. Erste Erfahrungen hatte er bei der Sitte und der Drogenfahndung gesammelt, dort ebenso das Leid, den Schmerz und den Tod gesehen. Inzwischen war er für das Morddezernat der Stadt genauso lange tätig, wie er den Dienstgrad innehatte. Das größte Wissen, das Forrest besaß, wurde im Lauf der Zeit die Erkenntnis, dass es absolut gleichgültig war, in welcher Sparte er den Dienst versah. Das Elend und Leid, die Qual und der Tod waren überall präsent. Das gewaltsame Ableben eines Menschen wog bei der Rauschgiftfahndung nicht weniger, wie bei der Sitte. Es war stets gleich schwer, immer identisch und allerorts grausam.
Der Detective, dessen Augen manchmal in eine nicht vorhandene Leere sahen, wandte sich wieder dem Fundort der Leiche zu. Wie wurde das Opfer hierhergelockt? War die Fundstelle zugleich der Tatort? Wenn, was hatte die junge Frau in dieser Gegend zu suchen? Wer war Sie? Eine Geste mit dem Kopf reichte aus, um Henry McClure anzudeuten, ihm zu folgen. An diesem Ort gab es nichts mehr zu erledigen, außer sich zu freuen, ihn zu verlassen. Was jetzt notwendig war, lag auf der Hand. Die Identität der Toten zu ermitteln, besaß Priorität, parallel war es Pflicht, ihr Leben und Umfeld zu durchleuchten. Eines war nicht zu leugnen: Einen Montagmorgen im Herbst bei herrlichem Wetter am Mystic River zu verbringen, hätte seine Reize besessen, aber es herrschte ein Dreckswetter, welches durch die Tote als saumäßig empfunden wurde. Forrest sträubte sich dagegen, aber die Wahrheit log nicht. Er war im alten Hafen auf eine tote Frau gestoßen, da ein geheimnisvoller Anrufer den Fundort preisgegeben hatte. Der Detective wies Henry an, ins Department zu fahren, stieg betrübt in seinen Wagen, öffnete das Fahrerfenster einen Spalt und zog an der Zigarre.
Bevor er den Motor anmachte und sich auf den Weg ins Büro begab, versuchte er vergeblich, für einige Minuten abzuschalten. Das ließ seine Herkunft nicht zu. Die dunkle Hautfarbe, war ein Grund, für eine alles andere als unbeschwerte Kindheit und Jugend. Ebenso der Stadtteil, in dem er aufgewachsen war und der damals dem Areal ähnlichsah, auf dem er im Moment stand. Vor all dem Bösen, dem Leid und dem Tod versuchten er und seine Frau, Betty, die leiblichen Töchter und ihre Adoptivtochter zu beschützen. Er und sie befürchteten, dass dieses Unterfangen vom Alltag und Lebensschicksal eines Tages torpediert werden würde. Sie gaben ihr Bestes, ein Unglück oder eine Tragödie zu verhindern, war unmöglich. Der Schmerz und der Tod waren stets präsent, egal wo, immer in schrecklicher Form. Ebenso der Rassenhass und die Intoleranz gegenüber Dritten. Anders aussehende sowie hinterfragende Menschen waren nicht beliebt, außer man war in manchen Fällen weißer Hautfarbe. Forrest brütete bei der Fahrt zum Revier über das Opfer. In welchem Alter war sie? Woher kam sie?
Vermisste sie jemand? Er schätzte sie auf dreißig Jahre, eher Mitte zwanzig, und schon tot! Für ihn gab es keinen Zweifel, obwohl er es sich anders wünschte, die junge Frau war definitiv das Opfer einer Gewalttat. Der anonyme Hinweis in der Zentrale war der Beweis dafür. Mit was für einer Art von Kapitalverbrechen er konfrontiert wurde, vermochte er nicht einzuordnen, dazu war es zu früh. Er fragte sich, mit welcher Art von Verbrechen er konfrontiert wurde: War es Vorsatz, eine Fahrlässigkeit oder eine Affekttat? Der Anrufer, welchen Bezug hatte er zu der Toten? War er am Ende sogar der Schuldige für das Ableben der jungen Frau?
Tausend Fragen, keine Antworten. Dieser Umstand sowie das Bauchgefühl und die langjährige Berufserfahrung verhießen nichts, was ihm in irgendeiner Form beneidenswert erschienen wäre. Im Gegenteil, er befürchtete, dass die Tote der Auftakt von einem Horrorszenario war.
Er sollte sich nicht täuschen!
3. Kapitel
Montag, 02. Oktober
Morgen/Vormittag
E
r nannte sich Sad! Vor langer Zeit hatte er seine Tochter in den Arm genommen. Sie war damals drei Jahre jung, und er hatte ihr hoch und heilig versprochen, stets auf sie aufzupassen. Als ob es das kleine Mädchen, von Natur aus ein herumwirbelnder, pflegeleichter und ein rund um die Uhr lächelnder Sonnenschein, gespürt hätte, dass er sein Versprechen nicht einhalten würde, fing es, ohne einen ersichtlichen Grund, zu weinen an. Das traurige Gesicht des Kindes, die auf den Wangen hinab rollenden Tränen, der unerklärliche Schmerz in den blauen Augen und die verschwundene Frohnatur brannten sich in das Herz des Vaters. Dort blieben sie bis in die Gegenwart haften.
Es gab Tage, an denen er wegen des Ereignisses wie ein Häufchen Elend dasaß, vor sich hin sinnierte und nicht ansprechbar war. Dieser Vorfall hatte ihn deutlich heftiger erschüttert als der Verlust der Existenz. Für Sad hatte sich das Leben zu einem Trümmerhaufen entwickelt. Er war ein stiller Zeitgenosse, ein Einzelgänger, er lachte nie und besaß scheinbar keinen Humor. Er zog im Land umher. Rastlos, ziellos, war er und das in sich gekehrte Wesen ließ einen Einblick auf dessen Charakter nicht zu. Die traurigen grauen Augen offenbarten den betrübten psychischen Zustand, unter dem er litt. Deswegen nannte er sich Sad!
D
ie Nacht von Sonntag auf Montag erschien ihm wie eine Ewigkeit. Sad hatte vergeblich gehofft und gewartet, nichts war geschehen, das ihn von der aufgezwungenen Tatenlosigkeit erlöst hätte. Er fragte sich, ob seine Rückkehr nicht umsonst angetreten worden war. Die ihn belastenden, ausschweifenden und wild in der Ferne umherirrenden Gedanken wurden durch seltsame Abläufe an den selbst gewählten Aufenthaltsort zurückgeholt. Am Seiteneingang des dreistöckigen Gebäudes hatte ein Lichtschein sein Interesse geweckt. Was dann geschah, raubte ihm den Atem. Bekam er endlich die Chance, auf die er vier Wochen lang gewartet hatte? War das die Möglichkeit, um agieren und aktiv zu werden? Hatte sich die Geduld gelohnt? Er lag regungslos in einem Erdloch und verfolgte angespannt das Geschehen. Erst begriff er nicht, was vor seinen Augen ablief. Als er es erkannt hatte, stieg eine ekelerregende Übelkeit in ihm auf. Zwei Kerle in Regenmänteln mit Kapuzen hatten eine dunkle, undurchsichtige Plastikplane aus dem Gebäude getragen und in den Wald gebracht, in dem er sich ohne deren Wissen aufhielt. Sad sah angewidert, dass in der Folie ein toter Mensch eingewickelt war. Er kannte die Männer nicht, zu lange war er auf der Flucht vor der Vergangenheit. Solche obskuren Kerle nicht zu kennen, ähnelte in manchen Momenten einer glücklichen Fügung. Die dunklen Elemente der menschlichen Gesellschaft waren alle gleich. Problemlos ließen sich diese schwarzen Seelen in heruntergekommenen Vierteln an jeder Straßenecke finden. Sie waren für lächerliche Bezahlung bereit, einiges zu erledigen, selbst vor einem Mord schreckten sie nicht zurück. In Augenblicken, in denen jemand von Hass oder Rachsucht zerfressen wurde, kam es einem zugute, diese Personen nicht zu kennen. Es war kalt, windig und der Regen prasselte dermaßen heftig, als ob der Himmel alle Schleusen geöffnet hatte. Wegen des Wetters versteckten sie die Plane unter Ästen und verkrochen sich schnell wieder ins Trockene. Er wartete eine halbe Stunde, um sicherzugehen, dass die zwei obskuren Gestalten nicht doch auf die Idee kamen, die Leiche zu verscharren. Nachdem er sicher war, dass es bei diesem Unwetter nicht geschehen würde, verließ er das Versteck. Mit einem flauen Gefühl in der Magengegend begab er sich zu der Plane. Er zerrte sie unter den Ästen hervor und rollte sie aus. Unbewusst wich er vor der Toten zurück. Bei dem Leichnam handelte es sich um eine Frau. Sie war jung, um die fünfundzwanzig, auf keinen Fall bedeutend älter. Sie hatte eine schlanke Figur und eine dermaßen helle Haut, wie er sie nie zuvor bei einem Menschen gesehen hatte. Die geübten Augen von Sad fanden Einstichstellen in der Armbeuge und eine kreuzartige Narbe auf dem Oberkörper. Die Nähte hätten bei Unwissenden die Vermutung aufkommen lassen, dass die Tote unmittelbar nach ihrem Ableben obduziert wurde. Sad hingegen befürchtete, dass dem Opfer die Organe entnommen worden waren. Er erschauderte. Der Tod hatte die Wärme des Lebens nicht vollständig vertrieben. Für die Leblose empfand er Mitleid und es fiel ihm schwer, sie wieder in die Plane einzuwickeln. Kaum geschehen, hob er sie auf die Schulter und trug sie auf die andere Seite des Waldes. Dort kam er an eine Mauer und zog eine Eisentür auf, die er für gewöhnlich nicht mehr zu benutzen pflegte. Er vergewisserte sich trotz des Wetters und der Uhrzeit, dass niemand zugegen war. Er schleppte die Fracht über eine schmale Straße zu seinem im Dickicht geparkten Wagen. Er legte die Unbekannte vorsichtig in den Kofferraum des an manchen Stellen zerbeulten Autos und fuhr mit der Toten zu dem unweit gelegenen Fluss. Um diese Zeit und an diesem Ort, er war in den alten Hafen gefahren, brauchte er keine Befürchtungen hegen, von jemandem gesehen zu werden. Er nahm die Leiche wie eine Braut in die Arme. Wie ein frisch angetrauter Ehemann, der die Gattin über die Schwelle trägt, begab er sich zum Ufer. Schließlich legte er sie nackt, wie sie ohne die Folie war, neben einer beschädigten Betonplatte ab. Sad vergewisserte sich, dass der Leichnam von der Strömung nicht mitgerissen wurde, bückte sich und sprach ein leises Gebet. Entschuldigend verabschiedete er sich danach im Stillen von ihr. Das Mitleid für sie und dem, was er ihrem leblosen Körper zugemutet hatte, war ehrlich. Er verdrängte das aufkommende schlechte Gewissen, schritt zurück zu dem alten Ford-Mustang und fuhr ohne Eile in Richtung Stadt davon. Neben einer offenen Telefonzelle, deren Apparat wundersamerweise funktionierte, blieb er stehen. In aller Ruhe rauchte er eine Zigarette und begab sich anschließend zu dem Telefon. Bedächtig wählte er die Nummer des Polizeinotrufs. Er beschrieb den Ort, an dem er die Frauenleiche abgelegt hatte, und ohne einen Namen genannt zu haben, legte er den Hörer wieder auf. Nachdem getätigten Telefonat fuhr er zum Fluss zurück. Aus einer sicheren Entfernung im Schutz einer der verkommenen Lagerhallen beobachtete er das Treiben der Polizei mit einem Fernglas. Die frühe Morgenstunde, das Wetter und das dadurch düstere Tageslicht erschwerten ihm die Sicht erheblich. Da er kaum etwas erkennen konnte, gab er das Vorhaben auf und begab sich zurück in das Erdloch, um die wichtigste Mission fortzusetzen, die ihm das Leben beschert hatte. In der Folge ließ ihn die hingerichtete Frau nicht allein. Sie peinigte seine Gedanken und es gelang ihm nicht, sie aus dem Kopf zu verdrängen. Sad gab sich keinen Illusionen hin, was der aufgekommenen Schwermut einen zusätzlichen Schub verlieh. Es war ihm bewusst, dass er weder damals noch heute in der Lage gewesen wäre, die verübte Exekution zu verhindern. Nur unter Einsatz seines Lebens hätte er die Frau womöglich retten können. Die Bereitschaft dazu war vorhanden, doch er war zu spät gekommen. Deswegen plagten ihn Schuldgefühle.
Der zerbrechliche Frauenkörper malträtierte ihn. Er lag sonderbarerweise nach wie vor auf seiner Schulter und schien ihn mit aller Macht mit dem Gewicht eines schlechten Gewissens erdrücken zu wollen. Er sah das junge Gesicht vor sich und die Miene besagte, dass er an ihrem Tod eine große Mitschuld trug. Der dünne und nackte Körper ließ ihn unaufhörlich innerlich vor Kälte frieren und äußerlich unkontrolliert zittern. Dass er das Hafengelände verlassen und die Beobachtung des vor Ort herrschenden Treibens eingestellt hatte, war dem Wetter geschuldet. Außerdem lag es daran, dass er wenig durch das Fernglas gesehen hatte. Mit etwas mehr Geduld und den später besseren Sichtverhältnissen hätte Sad das Team um Forrest Waterspoon vielleicht erkannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch einige Tragödien nie passiert wären, wuchs aus dieser Sicht ins Unermessliche. Es war Pech, seinerseits zugleich der erste nicht wiedergutzumachende Fehler!
Ω
E
ine der Erfahrungen, die Forrest Waterspoon während der Jahre der absolvierten Dienstzeit gewonnen hatte, war, wenn möglich, die Pathologie am frühen Morgen zu meiden. Der Tagesbeginn hatte wie am Vortag, kein Erbarmen mit ihm. Neil Sesse bückte sich über den Obduktionstisch, stütze sich mit beiden Händen an diesem ab und begutachtete die Tote vom Mystic River. »Fällt dir etwas auf?«, fragte er den Detective, der unmittelbar hinter ihm stand.
Der Ermittler trat neben den Pathologen. Es war seltsam. Der Anblick der Leiche hatte sich zum Morgen von gestern sonderbar und unangenehm verändert. Hatte die namenlose Tote am Vortag Mitleid, Hilflosigkeit und eine Zerbrechlichkeit ausgelöst und ausgestrahlt, so war davon nichts mehr übrig. Die Frauenleiche stieß einen ab. Nicht in der Art, wie es normal Verstorbene häufig bei Trauernden zu verursachen pflegten. Dabei handelte es sich stets um pure Angst vor dem Unbekannten. Durch den Anblick eines leblosen Körpers wurde der Tod sichtbar. Hier und jetzt verhielt es sich anders und das vehement. Das weibliche Opfer rief Ekel in einem hervor. Ihr Aussehen war in höchstem Maß unangenehm. Die am Flussufer anwesende Schönheit und Jugend von ihr, waren in etwas mumienhaftes übergegangen.
Forrest räusperte sich, um die in ihm vorhandene Abscheu zu lindern. »Sie kommt mir wesentlich dünner als gestern vor«, beantwortete er nach einem Zögern die Frage. Was ein ironischer oder ein sarkastisch veranlagter Mensch als einen makabren Gag empfunden hätte, war absolut kein Witz.
Neil Sesse nickte bejahend und sah den Beamten des Morddezernats aus den Augenwinkeln an. »Das ist nicht ganz richtig, allerdings nicht vollkommen falsch. Was du vor dir siehst, ist eine leere Hülle.« Dem Detective fiel es nicht leicht, dem Facharzt zu folgen, was dieser erkannte und erklärte: »Der Frau wurden sämtliche und damit meine ich wirklich alle Organe entnommen. Alle, ohne Ausnahme: Lunge, Leber, Nieren, Milz, Herz, Eierstöcke, Gebärmutter, es ist nichts mehr da. Ich habe schon viel gesehen, so etwas bisher nicht.«
Der Pathologe richtete den Blick wieder vollends auf die Tote. »Wie lautet die genaue Todesursache?«, kam dem Ermittler die Frage obskur vor.
»Ist unmöglich, zu bestimmen«, erhielt Forrest eine ratlose Antwort. »Fakt ist, dass der Tod Sonntag gegen Mitternacht eingetreten ist. Wie, kann ich nicht sagen«, ließ Neil den Blick auf der Toten ruhen.
»Was noch?« Der Detective sah, dass der Pathologe ihm mehr zu erzählen hatte. Er atmete erleichtert durch, als dieser sich endlich von der Leiche löste und sich quer durch den unpersönlichen, kalten Raum zum Waschbecken begab. Umgehend folgte er ihm.
Neil Sesse streifte sich die äußerst lästigen, aber enorm wichtigen Gummihandschuhe ab. Er wusch sich gründlich die Hände, desinfizierte sie und drehte sich dem Ermittler zu. »Ich habe gestern Morgen eine Blutprobe in das Labor geschickt und, kurz bevor du gekommen bist, die Analyse per Fax bekommen«, nahm er Schritt auf und trottete zu einer Arbeitsfläche, auf der das Schriftstück lag. Er studierte es in der Art, als ob er es nie zuvor gelesen hätte, und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe das nicht«, sah er zu Forrest auf und erntete von diesem einen fragenden Blick. »Blut besteht, wie du ganz sicher weißt, aus Zellen und Blutplasma und das Blutplasma beinhaltet etwa neunzig Prozent Wasser«, klärte er den Detective auf.
»Sehr interessant«, knurrte der dunkelhäutige Mann.
»Bei unserer jungen Dame hat das Blutplasma einen Wasseranteil von siebzig Prozent«, erklärte Neil und sah zum Obduktionstisch.
»Was soll mir das sagen?« Der Detective kam sich wie ein Medizinstudent im ersten Semester vor. Er besaß null Wissen über die Zusammensetzung des Blutes und es war eine Schlussfolgerung, dass der Pathologe genau davon ausgegangen war. Deshalb hatte er das Gefühl, dass der Kollege ihn zu verarschen versuchte.
»Ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung«, schüttelte der Facharzt unwissend den Kopf.
»Oh Gott«, entfuhr es Forrest säuerlich und begab sich auf den Weg, um die Pathologie zu verlassen.
»Im Labor machen sie weitere Testreihen, mal sehen, ob uns das weiterhilft«, rief im Neil Sesse schmunzelnd hinterher.
Der Detective erklomm die Treppen zum Büro in der zweiten Etage. Kaum, dass er hinter dem Schreibtisch etwas außer Atem Platz genommen hatte, öffnete sich die Tür und Henry trat mit erhobenem Kopf in den Raum. Er kam näher an den ungeliebten Arbeitsplatz seines Lehrmeisters, und überreichte ihm, ein großes und ein kleines Blatt Papier. Auf dem schwarzweißen Computerausdruck war eindeutig die Tote vom Mystic River zu erkennen. Das Bild war unscharf, das Opfer deutlich jünger, aber es zeigte die Frau, die in der Pathologie lag. Forrest sah sich den dazu erhaltenen Notizzettel an, der ihm die Adresse der Verstorbenen offenbarte. »Hervorragende Arbeit, Henry«, lobte er die Leistung des Kollegen. Nach dem Lob erhielt der knabenhaft aussehende Mann die wichtigste Anweisung, die ein Frischling von einem höher gestellten Beamten zugeteilt bekam und die auf der Stelle durchzuführen war: Er wurde im militärischen Ton gebeten, einen Kaffee zu holen, da die Kaffeemaschine im Büro den Dienst versagt hatte. In den wenigen Minuten, die der Detective allein war, überdachte er die Worte von Neil Sesse in der Pathologie. Die Identität des Opfers hatte sein Partner herausgefunden, ebenso wo die Frau gewohnt hatte. Blieb zu klären, wie und an welchem Ort sie gestorben war. Handelte es sich um Mord? Der Ermittler zeigte sich aufgrund der vorhandenen Indizien davon überzeugt. Der Zustand der Leiche bekräftigte, dass ein Verbrechen begangen wurde. Deutete die Tote auf ein Delikt, der in irgendeiner Art mit Organhandel in Verbindung stand? Es kam öfter vor, dass Forrest seinen Job wegen diversen Details zu hassen anfing, nicht anders verhielt es sich in diesem Fall.
Ω
F
ür viele Bewohner und Touristen war Boston eine Traumstadt. Das sahen die ärmeren Bürger differenzierter, insbesondere die Obdachlosen. Wie überall, unabhängig der Stadt und Nation, hatten die von der Gesellschaft Ausgestoßenen Plätze, die sie wie die Pest mieden. Ebenso bevorzugte Orte, an denen sie sich trafen. Der größte Teil, der auf der Straße lebenden Männer und Frauen war friedlich. Die meisten von ihnen, es betraf auch das weibliche Geschlecht, waren abhängig von Drogen oder Alkohol. Einige Personen in diesem Kreis, benötigten beides für die Befriedigung ihrer Sucht. Sie alle sahen es als harmlos an, von den Leuten auf der Straße gemieden zu werden. Mehr Gewicht auf ihren Seelen hatte etwas anderes: Jene, die eine Familie hatten, warfen ihren Angehörigen Abartigkeit vor, da sie von den Blutsverwandten verleugnet wurden. Die Geschwister ließen sie vor der Tür stehen und die Eltern jagten sie mit Schimpf und Schande vom Grundstück. Man schämte sich ihrer Existenz! Wie sie in Schieflage gekommen waren, das wollte niemand erfahren. Warum sie alles verloren hatten, war der eigenen Frau, den Kindern, dem Bruder oder der Schwester, und falls es sie gab, selbst den Eltern, egal. Es war in den frühen Morgenstunden, als ein Obdachloser mitten in der City, durch einen Streit mit einem Mitbürger unangenehm auffiel. Der wohnungslose Mann hatte vor, sich ein paar Münzen zu erbetteln. Dabei geriet er ausgerechnet an einen Börsenmakler, der nichts zu verschenken hatte und es dem Bettler mit einer eindeutig herabwertenden Geste zu verstehen gab. Der auf der Straße Lebende hatte daraufhin den Snob als einen schwulen Pavian beschimpft und wurde mangels Papiere und wegen Beleidigung festgenommen. Dem Kerl ohne ein Dach über dem Kopf war es gleichgültig. Eine warme Mahlzeit hatte er mit der Aktion sicher. Einige Straßenzüge weiter, fing er an, sich zu wundern. Die Fahrt führte nicht, wie er angenommen hatte, in das Polizeipräsidium, sondern stadtauswärts. Ihm wurde unbehaglich und auf die Fragen an die Polizisten erhielt er keine Antworten. Die Handschellen um seine Gelenke unterbanden jeden Versuch von Widerstand. Nach einer Tour von einer halben Stunde, die auf einem von einer Mauer umgebenen Areal ein Ende fand, stellte er konstatiert fest, dass er in eine Nervenklinik gebracht worden war. Widerwillig ließ er sich aus dem Streifenwagen und in das dreistöckige Gebäude zerren. Spätestens jetzt erstaunte es ihn nicht mehr, dass einer der Cops ihm vor der Fahrt Fußfesseln verpasst hatte.
Ω
S
ad lag nicht in dem Versteck, das aus einem Erdloch bestand. Er saß auf einem dicken Ast in der Krone einer Fichte und beobachtete die Szene. Er wunderte sich nicht über die Einlieferung eines, wie es aus der Ferne schien, verwirrten Mannes. Was ihn nachdenklich werden ließ, war die Tatsache, dass die Polizisten, die zwei Kerle waren, die in der vergangenen Nacht das tote Mädchen in der Plane unter einigen Ästen versteckt hatten. Er kannte die Nervenheilanstalt, er wusste, was sich vor Jahren in dem Gebäude abgespielt hatte. Als die Tür der Klinik hinter dem scheinbar aggressiven Patienten ins Schloss gefallen war, erinnerte er sich zurück.
S
ad kam in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre zum Professor, dem er viel zu verdanken hatte. In einem Haus, in dem Kinder ohne Familie lebten, wurden sie zu Freunden. Was sie verbunden hatte, war die schmerzhafte Erfahrung, Mutter und Vater verloren zu haben. Sad war sieben, als er seiner Eltern beraubt wurde. Ein Zugunglück hatte dafür gesorgt, dass ihr Leben auf brutale Art ausgelöscht worden war. Da er keine Verwandten besaß, blieb den Behörden gar nichts anderes übrig, als ihn in ein Waisenhaus zu stecken. In diesem lernte er den reiferen Jungen kennen, den Professor. Er war acht Lenze älter und verließ das Heim mit achtzehn. Nachdem Sad die Gunst von ihm gewonnen hatte, verbrachten sie fast drei Jahre zusammen in dem Haus, dass Jugendstrafanstalt, Erziehungsheim und Internat zugleich waren. Das Leben in dem Gebäude gestaltete sich nicht einfach. Die Freundschaft trotzte den schwierigen Umständen und die Verbindung war nie abgebrochen, auch nicht als der Professor das Waisenhaus verlassen hatte. Er hielt Wort und hatte Sad regelmäßig besucht. Spätestens nach zwei Monaten ohne Kontakt tauchte er unangemeldet auf und brachte ihm ein Geschenk mit. Als Sad in das Waisenheim eingeliefert worden war, nahm er von dem älteren Knaben wenig Notiz. Bald gab ihm der angehende Mann Rätsel auf und Sad fragte sich, warum er immer abseits und allein saß. Zudem hing er jede Sekunde über irgendwelchen Büchern. Wie er erfuhr, war der Professor, so wurde er wegen des Lerneifers schon damals gerufen, seit fünf Jahren in dem Heim. Er war vollkommen anders als alle sonst anwesenden Waisenkinder. Er spielte nie mit ihnen, er nahm nicht an deren Gesprächen teil, er ignorierte sie immer und überall. Er unterließ jede Teilnahme an einem Unsinn und selbst der Sport schaffte es nicht, ihn von der trockenen Literatur wegzulocken. Er war in allen Punkten auf eigenes Bestreben völlig isoliert. Das Verhalten entsprach auf keinen Fall dem Alter des Professors. Während sich die Heiminsassen über ihn laufend lustig machten, war Sad von ihm angetan. Er fand es imponierend, wie er die Häme ignorierte und sich nicht beeinflussen ließ. Er blieb den dicken Büchern treu, schrieb unentwegt irgendwelche Notizen und lernte und lernte. Das Radio war für ihn fast schon so etwas wie eine Lärmbelästigung und der Fernseher ein Gerät, das wesentlich zur Volksverdummung beitrug. Der Lerneifer grenzte an einen Wahn, er sprach nicht mit jedem und wenn, nur das Nötigste. Selbst die Obrigkeit des Hauses war davon nicht ausgeschlossen. Wie Sad bald erkannte, saß er über allen möglichen Büchern aus dem Metier der Medizin. Er fing an, sich intensiver für dieses Thema zu interessieren. So kamen sie sich näher und wurden Freunde. Sad wurde ebenso fleißig, aber das Lernen, fiel ihm mit zunehmendem Niveau schwerer. Eines Tages, es war, kurz bevor der Professor das Waisenhaus verlassen und zu studieren begonnen hatte, erfuhr er alles über dessen Motive. Es war der frühe Krebstod der Großeltern und Eltern. Er hatte den Vater und Großvater an einer damals fast völlig unbekannten Krebsform verloren, dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Mutter und Oma wurden vom Brustkrebs getötet. Sad hatte großes Mitleid mit ihm. Ab dieser Zeit und mit dem erhaltenen Wissen war es möglich, den Professor und dessen Verhalten zu verstehen. Ab diesem Zeitpunkt sah er das Handeln und Denken des Freundes aus einer vollkommen anderen Perspektive. Den Tod der Großeltern hatte der Professor nicht hautnah miterlebt, dafür den des Vaters und der Mutter. Wie er erzählt hatte, war es ein langsames und ein qualvolles Sterben. Das einschneidende Erlebnis hatte ihn geprägt und angetrieben. Er hatte ein Ziel: Entgegen den Widerständen sah er sich gezwungen, den aussichtslosen Kampf gegen den Krebs aufnehmen. Deswegen hatte er derartig verbissen gelernt. Zunächst hatte er vor, die verschiedenen Krebsarten zu besiegen, danach alle anderen Krankheiten. Es war das erste und letzte Mal, dass der Professor ausführlich über sich und das eigene Leben gesprochen hatte. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er eine Schwester, zu der er keinen Kontakt mehr hatte. Sie, die jüngere, war nach dem Tod der Eltern von einer kinderlosen Familie adoptiert worden.
Sad selbst war unentschlossen, was er für einen Beruf auszuüben gedachte. Vom Freund mitgerissen und angespornt entschied er sich für ein Medizinstudium. Die Freundschaft war so gewachsen, dass es sich der Gelehrte nicht nehmen ließ, dass Studium in Form eines Darlehens zu finanzieren. Im Gegensatz zu Sad konnte er es sich leisten, da ihm von den Eltern eine nicht unerhebliche Erbschaft hinterlassen worden war. Sad nahm das Angebot unter der Bedingung an und versprach den Kredit zurückzuzahlen. Der Professor absolvierte die Abschlussprüfung mit Bravour in dem Jahr, in dem Sad das erste Semester angefangen hatte. In der folgenden Zeit erwies sich der Freund als ein zuverlässiger und treuer Mensch. Gleichzeitig hatte dieser die eigene Zukunft und Visionen fest geplant. Ihm war irgendwann klar geworden, dass er den bis dahin aussichtslosen Kampf gegen den Krebs nur mithilfe der Gentechnologie gewinnen würde. Er war bereit, den Weg in diese Branche einzuschlagen. Sad hingegen fiel es deutlich schwerer, sich die Zahlen und Formeln sowie die Fachausdrücke zu merken. Wenn sie sich endlich im Kopf festgesetzt hatten, versagte er bei den Klausuren. Die enorme Prüfungsangst ließ sich nicht bezwingen, durch und mit nichts. Der Professor versuchte, zu helfen, wo es möglich war, paukte mit ihm, gab Nachhilfeunterricht, es war vergeblich. Bei den Prüfungen scheiterte Sad ständig. Trotzdem erhielt er nach dem Studium ohne Abschluss eine Stellung in der Nervenheilanstalt. Er war zunächst als Pfleger tätig. Mit den Jahren wurde er ein besserer Handlanger in den Operationssälen und Laboren.
Dann kam der Tag, an dem Sad gezwungen worden war zu erkennen, dass sein Freund nicht mehr derselbe war. Er hatte sich gravierend verändert. Aus dem Ziel, den Krebs zu besiegen, wurde ein Wahn, dem er alles untergeordnet hatte. Er war der Vision verfallen. Das setzte sich so weit fort, dass er ohne irgendwelche Bedenken dazu bereit war, den Hypokratischen Eid zu brechen. Sad erkannte es, zu spät. Inzwischen hatte er die Verbindlichkeiten beim Professor abgestottert, die Tätigkeit für diesen hatte ihm dabei geholfen. Stolz konnte er darauf nicht sein.
Die späte Einsicht hatte damals furchtbare Konsequenzen. Das Grauen schien zu seinem Entsetzen in der Gegenwart nach wie vor zu existieren. Einige Indizien waren in der Lage, diese Befürchtung zu bestätigen. Es war an der Zeit, dem Professor die Rechnung zu präsentieren. Ihm wurde mehr denn je bewusst, was er sich vorgenommen hatte. Es war kein Himmelfahrtskommando, stattdessen beschritt er den geraden Weg in die Hölle! Gegen neun Uhr verließ Sad das Areal. Er fuhr in die Stadt, parkte in einem Parkhaus und begab sich über die Ein und Ausfahrt aus dem Gebäude. Die Sorge, beobachtet und verfolgt zu werden, war unbegründet. Noch wusste niemand, dass er zurück war. Die an den Tag gelegte Vorsicht bezog sich auf die Lebenserfahrung, die er sich in den Jahren der Flucht angeeignet hatte. Sein Bestreben, nicht aufzufallen, gelang, obwohl das in der Kluft eines Obdachlosen unmöglich war. Die bewusst gewählte, schäbige Kleidung rückte ihn in das Blickfeld, das es ihm gestattete, sich frei zu bewegen. Durch sein Äußeres wurde er gemieden und erhielt somit die Freiheit, die er für das weitere Vorgehen benötigte. Die dreckige Tarnung hätte nicht vermuten lassen, dass er ein Fahrzeug besaß, über Erspartes verfügte und einen Weg der Gerechtigkeit verfolgte. Gemütlich war er in die Stadtmitte geschlendert, hatte ein Sandwich gegessen, auf einer Bank die Tageszeitung gelesen und im Anschluss daran eine Telefonzelle aufgesucht.
Der Anruf galt George Fermont.
Ω
M
aria Koslowski öffnete die Tür. Sie war klein, rundlich und hatte ein buntes Kopftuch um das dünne, graue Haar gewickelt. Auf ungewollte Art verkörperte die Frau das perfekte Bild von einer Bäuerin auf irgendeiner Kolchose, in der ehemaligen Sowjetunion. Es war der älteren Dame anzusehen, dass sie erheblich eingeschüchtert war. Die zwei Männer vor der Tür rangen ihr einen großen Respekt ab. Forrest wies sich aus und stellte Maria Koslowski, Henry, vor. Der Detective kannte die Gesichter solcher Leute. Sie waren irgendwann aus dem Ostblock, voller Hoffnung in die Vereinigten Staaten von Amerika gekommen. Vor allem in den ersten Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges waren die Einwanderungszahlen hoch. Die Menschen kamen, aber die gelebte Vergangenheit in einem anderen Land hatten sie nicht hinter sich gelassen.
Die Angst dem Staat und dessen Vertretern gegenüber, der Respekt und die Furcht vor den Beamten und der Uniform, sie war geblieben. Sie ließ sich durch die neu gewonnene Freiheit nicht vertreiben. Forrest bat sie mit seiner tiefen Stimme um ein Gespräch. Er sah der Frau an, dass zu der Hochachtung vor dem Ausweis unausgesprochene Sorgen hinzukamen. Maria Koslowski schritt den Besuchern voraus und führte sie in eine kleine Küche. Der Raum besaß ein Fenster zum Hinterhof und wurde von einer halb abgebrannten, flackernden Kerze, erhellt. Das Küchenmobiliar war fast schon schäbig und bei den wenigen Küchengeräten waren erhebliche Zweifel wegen deren Funktionstauglichkeit angebracht. Über dem Esstisch hing eine Glühbirne an einem Kabel herab, brannte allerdings nicht. Entweder war die Birne defekt oder Maria Koslowski wurde von den scheinbar finanziellen Engpässen dazu gezwungen, Strom zu sparen. Der Detective hatte sich beim Durchqueren des Flurs umgesehen, in die Räume, zu denen die Tür offenstand, einen Blick geworfen, und ihm war die ärmliche Ausstattung der Wohnung nicht entgangen.
Es war bitter anzusehen, die Frau lebte unterhalb der Armutsgrenze. So sah die Freiheit im goldenen Westen aus. Maria Koslowski war bieder angezogen. Nicht schlampig, eher altmodisch, eben so, wie es der Geldbeutel zuließ und wie es die Gewohnheit war. Sie lud die Männer mit einer Geste ein, sich zu setzen. Sie nahm selbst Platz, wobei sie die faltigen Hände in den mit einer Schürze bedeckten Schoß legte und ineinander verschränkte. Forrest hatte Mitleid mit der alten Dame, ihr waren die Furcht und der Schmerz vor dem, was kommen würde, anzusehen. Sie schien durch die von der Natur mitgegebenen Muttergefühle in der Lage zu sein, zu fühlen, dass der Tochter etwas Schreckliches zugestoßen war. Dem Detective war es als einem männlichen Wesen nicht angeboren, die Trauer der Frau nachempfinden zu können. Wer war dazu fähig, die Qualen einer fremden Person nachzuvollziehen? Anteilnahme und Schmerz wurden bei solchen Angelegenheiten leicht verwechselt. Der Mensch war ein individuelles Geschöpf, jeder verarbeitete einen Verlust anders, jedermann trauerte auf seine Art. Maria, litt still, und leise, sie wehklagte innerlich und fraß den Kummer in sich hinein. Alle Menschenseelen nahmen durch diese Art der Trauer einen unsichtbaren und irreparablen Schaden. »Es tut mir leid, Frau Koslowski«, brachte Forrest den Familiennamen schwer über die Lippen, nachdem er von Annas traurigem Schicksal berichtet hatte. Die Witwe hatte den Mann in Polen wegen einer Lungenentzündung verloren. Sie sah den Detective betrübt an und schien sich durch dessen ehrliches Mitgefühl etwas sicherer zu fühlen.
»Ich vermisse Anna seit über einem Jahr«, sagte die Frau in gebrochenem Englisch. »Schlimm ist, dass sie erst jetzt gestorben ist. Was ist passiert in all der Zeit, wo war sie, was hat sie getan, wie ging es ihr? Wieso ist sie von mir gegangen damals und jetzt schon wieder?«, hatte sie so viele Fragen an das Leben oder das Schicksal, für die der Ermittler Verständnis hatte, die er aber nicht sofort korrekt registrierte.
Der Detective überdachte die Worte und sah Henry an, von dem er einen ahnungslosen Blick erhielt. »Moment mal«, wandte er sich wieder an die Frau aus Polen, die ungefähr sechzig Winter in ihrem Leben miterlebt hatte. »Wie darf ich die Aussage verstehen, dass Sie Ihre Tochter vor einem Jahr verloren haben?« Forrest ließ der Witwe für die Antwort Zeit, lächelte sie verständnisvoll an, obwohl Geduld nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft war, die zu seinen Stärken zählte.
Maria Koslowski schluchzte, wischte sich dem Taschentuch, das sie in den Händen hielt, die Tränen aus den Augen und erinnerte sich. »Sie war weg, über Nacht blieb Anna fort«, war es ihr nicht möglich, dass Geschehene zu begreifen. »Ich habe gewartet, sie kam nicht. Ich habe gewartet, bis heute, bis sie kamen. Ich verstehe es nicht«, unterdrückte die Mutter der Toten mühsam die Tränen. »Sie müssen wissen, dass ich Anna spät geboren habe, mit fünfunddreißig erst, und Anna war ein Einzelkind.«
»Gab es zwischen Ihnen und Anna vielleicht einen Streit?«. Mitfühlend sah der Detective die alleinstehende Frau an. Menschlich fand er die Frage fast beleidigend.
»Unter uns? Nein, niemals«, erhielt er die Aussage, die er erwartet hatte.
»Warum haben Sie das Verschwinden der Tochter nicht der Polizei gemeldet?«
Forrest erntete einen vorwurfsvollen, strafenden Blick. »Das habe ich«, traf ihn die Antwort wie ein elektrischer Schlag.
»Sie haben Ihre Tochter als vermisst gemeldet?« Der erfahrene Detective weigerte sich, zu glauben, was eben an seine Ohren gedrungen war. Wenn es sich so verhielt, wie es die Mutter des Opfers von sich gegeben hatte, hätte sein junger Kollege die Identität der Toten im Zentralcomputer der Polizeibehörde im Handumdrehen herausgefunden. Der Suchprozess nach Annas Namen, Herkunft und Wohnort hatte sich stattdessen komplizierter gestaltet und hatte Henry gezwungen, seine Suche auszuweiten. Fündig wurde er im Computer der Einwanderungsbehörde, was aufgrund der Umstände keinen Sinn ergab. Die Tochter von Maria war im Rechner des Departments nicht existent, somit wurde ihrem spurlosen Verschwinden nicht nachgegangen. Laut der Mutter lag hier einiges im Widerspruch und es sah vorsichtig ausgedrückt im Moment so aus, als ob der Behörde ein fataler Fehler unterlaufen war. Das Gefühl des Detectives bekam eine Eigendynamik, die er in dieser Form lange nicht empfunden hatte. Alle Alarmglocken in ihm fingen an, hellauf zu läuten. Er wollte der Frau aus Polen eine Frage stellen, aber diese ergriff das Wort eher.
»Anna hat oft geweint, nicht wegen mir oder uns, sondern wegen mehreren Freundinnen. Ja, das tat sie«, bestätigte sich Maria und putzte sich die Nase. »Sie hat viel geweint. Sie waren plötzlich alle weg. Zuerst Viktoria, anschließend Olga, schließlich verschwand Mathilda, zum Schluss war meine Anna weg«, sagte sie in einem Ton, der dem Detective verriet, wie unzufrieden sie mit der Situation war.
»Wie?«, sah Forrest irritiert zu Henry und wieder zu der leidenden Mutter. »Vor Anna sind schon andere Frauen verschwunden?« Maria nickte in einer Art, die Betroffenheit auslöste. »Wurde das den Behörden gemeldet?«, fragte er völlig perplex und eine kleine Hoffnung wurde in ihm wach, als die Frage bejaht wurde. Die Zuversicht bezog sich auf die Daten der drei Personen, die ebenfalls gesucht wurden. Vielleicht war es möglich, über deren Lebensläufe an den Mörder von Anna heranzukommen. »Wie heißen die verschwundenen Frauen?« Forrest ließ sich die schwer auszusprechenden Familiennamen aufschreiben und überlegte kurz, bevor er fragte: »Kennen Sie die Eltern der anderen vermissten Mädchen?«
»Vom Namen her. Anna hat mir die Adressen und Telefonnummern aufgeschrieben, falls ich sie einmal brauchen sollte, wenn sie nicht da ist«, erklärte die Mutter die Umstände. »Wir haben mal telefoniert und hatten vor, uns zu treffen, alle, dazu ist es nie gekommen. Trotz gleichen Schicksals geht jeder den eigenen Weg«, schien sie die Situation zu bedauern und sah den Detective mit einem Blick an, der ihn um Nachsicht bat.
Forrest umging das Thema. »Wie hat Anna die Freundinnen kennengelernt?«, erkundigte er sich und hoffte auf einen weiteren Anhaltspunkt. Maria Koslowski enttäuschte ihn diesmal. Sie konnte nicht sagen, wie, wo und wann sich die Mädchen zum ersten Mal getroffen hatten. Der Ermittler bat die trauernde Mutter, sich das Zimmer der Tochter ansehen zu dürfen. Beim Betreten der Wohnung war ihm eine Tür aufgefallen, die nicht offen gestanden hatte. Wie er es vermutet hatte, war es der seit einem Jahr unberührte und unbenutzte Raum der spurlos verschwundenen und nun ermordeten Anna. Mit Respekt vor der Toten und unter der Beobachtung von Maria durchsuchten er und Henry einige Fächer des Mobiliars. Sie sahen in Schränke und Schubläden und fanden nichts Auffälliges. Der Detective wandte sich erneut an die Mutter der Verstorbenen, die er am Flussufer des Mystic River im Jahrgang ordentlich eingeschätzt hatte. Mit erst fünfundzwanzig Jahren hatte Anna das Leben vor sich, stattdessen wurde sie dazu verurteilt, dass Tor zur Ewigkeit zu durchschreiten. War es möglich, in Frieden zu ruhen, nachdem man mit Gewalt seines Daseins beraubt wurde, fragte sich Forrest und drehte sich mit den düsteren Überlegungen der Mutter zu: »Wo hat Ihre Tochter gearbeitet?«
»Sie hatte keinen festen Job. Sie hat ausgeholfen, da mal geputzt, dort mal im Lager gearbeitet.« Sie begaben sich zurück in die Küche. Der Ermittler und Henry waren weit davon entfernt, den ihnen angebotenen Tee abzulehnen. Der Detective sah sich die Namen der Familien an, die ebenfalls ihre Kinder vermissten. »Ich weiß nicht genau, was passiert ist«, sagte Maria Koslowski den Tee vorbereitend und deswegen mit dem Rücken zu Forrest stehend. »Ich weiß nicht, warum es zu keinem Treffen mit den Eltern gekommen ist. Ich glaube, dass ein Ehepaar ums Leben gekommen war.« Sie drehte sich um, kam näher und deutete auf den Namen Jablonski. »Vielleicht ist das der Grund, dass wir uns nie getroffen haben.«
Waterspoon beschlich erneut ein ungutes Gefühl. Er hatte eine Leiche in der Gegenwart. So, wie er es empfand und zu hören bekommen hatte, gab es wesentlich mehr Tote im Umfeld der ermordeten Anna. Es war nur eine Vermutung, eine unheimliche Vorahnung, die er vergeblich zu verdrängen versuchte. »Wie es passiert ist, wissen Sie nicht?«, fragte er nach den Todesumständen des Elternpaares.
Maria servierte den Tee. Sie hatte ihn in einem Samowar zubereitet und dementsprechend köstlich schmeckte er. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe davon gehört. Ich glaube, es war beim Einkaufen. Da fiel einmal der Name Jablonski, und dass sie tot wären, mehr weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgefragt, die Leute, die sich damals darüber unterhielten, waren mir fremd. Ich wollte nicht aufdringlich oder neugierig erscheinen«, setzte sich Maria, griff nach der Tasse und probierte den herrlich duftenden Tee.