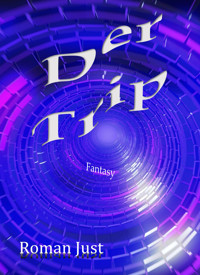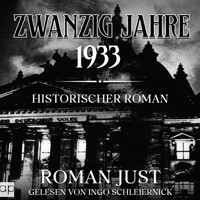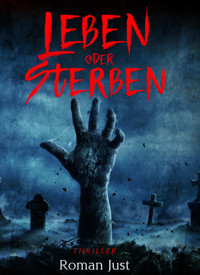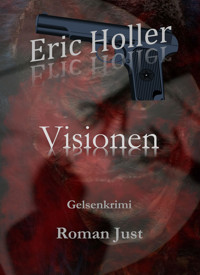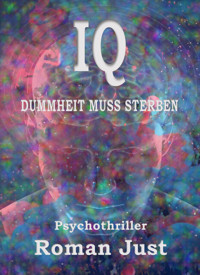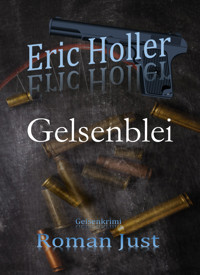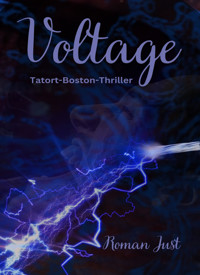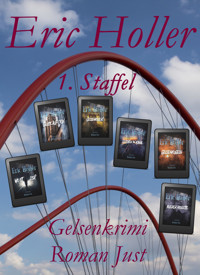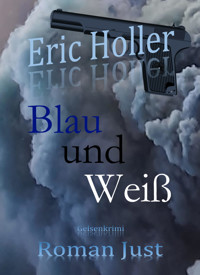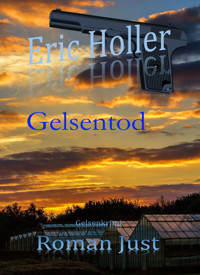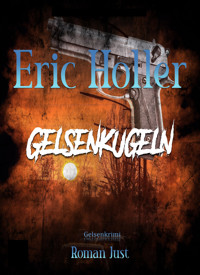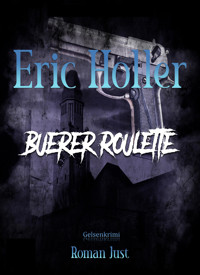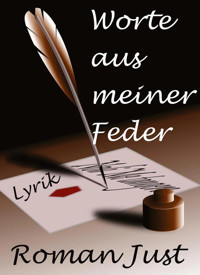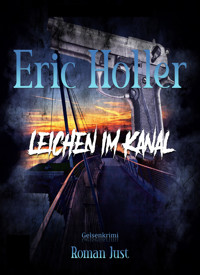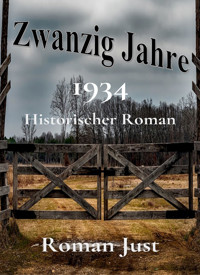
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gelsenecke
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Januar 1934 stehen die Familien McKenzie und von Dannenburg vor den Trümmern, die ihnen das Jahr 1933 hinterlassen hat. Kämpferisch und optimistisch wird das neue Jahr angegangen, doch vieles läuft anders als geplant oder erwünscht. Während die Diktatur in Deutschland zementiert wird, erleben die durch den atlantischen Ozean getrennte Freunde und Geschäftspartner Höhen und Tiefen, die an Leid, Schmerz, Unterdrückung und Verlust kaum zu überbieten sind. Doch Lichtblicke setzen Kräfte frei, die das Leben trotz allen Schicksalen lebenswert erscheinen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Zur Person:
Mitwirkende im Buch:
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Die Sturmabteilung, kurz SA
Röhm-Putsch
Juli
Ernst J. G. Röhm, Franz von Papen
Kurt von Schleicher, Georg Strasser
August
September
Oktober
November
Dezember
Hinweise:
Impressum:
Zwanzig Jahre
1934
Historischer Roman
Band 2
Über den Autor
Roman Just ist in der Welt der Literatur in verschiedenen Genres unterwegs. Mit den Thrillern der "Tatort-Boston-Reihe" hat er den Einstieg in die Literaturwelt begonnen, sie dann mit den "Gelsenkrimis" fortgesetzt. Neben den Thrillern und Krimis arbeitet er an einer mehrteiligen Dystopie und einer historischen Familiensaga, hinzu kommen Ausflüge in andere Genres.
Der Autor und bekennender Selfpublisher ist Jahrgang 1961, lebt in Gelsenkirchen, leidet mit dem vor Ort ansässigen Fußballclub seit 1971 zu allen Zeiten mit, spielt außerdem gerne mit Mitmenschen Schach und beschäftigt sich leider nur noch gelegentlich mit der Astronomie.
Der Selfpublisher betreibt auf seiner Homepage zu allen seinen veröffentlichten Titeln Leserunden, außerdem bietet er einen Leserkreis, an dem ebenfalls aktiv teilgenommen werden kann.
Mehr über den Autor und seine Titel gibt es hier:
https://www.gelsenkrimi.de
https://www.gelsenkrimi.de/ueber-mich
https://www.gelsenkrimi.de/leserkreis/leserunden
https://www.gelsenkrimi.de/leserkreis
https://www.gelsenkrimi.de/gelsenshop
Zur Person:
Sternzeichen: Jungfrau
Gewicht: Im Moment viel zu viel
Erlernter Beruf: Kellner
Derzeit tätig als: Autor/Selfpublisher
Charaktereigenschaften: Impulsiv/Hilfsbereit
Laster: Nie zufrieden mit einem Ergebnis
Vorteil: Meistens sehr geduldig
Er mag: Klare Aussagen
Er mag nicht: Gier und Neid
Er kann nicht: Den Mund halten
Er kann: Zuhören
Er hasst: Tyrannen und selbstverliebte Subjekte
Er liebt: Das Leben
Er will: Ziele erreichen
Er will nicht: Unterordnen
Er steht für: Menschlichkeit
Er verachtet: Hass, Mobbing, Eitelkeit
Er denkt: Auch Einfaches ist nicht einfach zu erledigen
Er meint: Die Achtung und der Respekt vor der Würde eines Menschen werden durch das Gendern nicht gestärkt.
Mitwirkende im Buch:
Familie von Dannenburg:
Hermine von Dannenburg, Mutter
Otto von Dannenburg, Sohn
Walter von Dannenburg, Sohn
Hildegard, Ottos Frau,
Luise, Walters Frau, geborene Fahrenbrecht,
Peter von Dannenburg, Ottos und Hildegards Sohn
Familie McKenzie:John James McKenzie, Rancher
Patricia, seine Frau
Amanda und Susan, deren Töchter
Peter Dannenberg ist Peter von Dannenburg,
Familie Rothenbaum:
Gottlieb Rothenbaum, Schneider
Maria, seine Frau
Jakob und Sarah, deren Kinder,
Zum Teil Haupt- und Nebendarsteller
Paul Bruchthaler, Verwalter auf Ottos Gut
Charles& Henry Chester, Rechtsanwälte, Privatdetektive
Guy Smithy, Liebhaber Amandas, Gauner,
Siglinde, Sekretärin von Walter von Dannenburg,
Emily, Zimmerkollegin Amandas auf der Uni,
Ehepaar Speck, Freunde der Familie von Dannenburg,
Historische Figuren:
Adolf Hitler, Reichskanzler,
Ernst Röhm, zuletzt SA-Anführer,
General Freiherr Karl von Plettenberg, Freund Ottos,
Magnus von Levetzow, Polizeipräsident Berlin,
Hilmar Wäckerle, erster Lagerkommandant Dachau,
Igor Iwanowitsch Sikorski, Flugzeugkonstrukteur,
Benito Mussolini, italienischer Diktator,
Bonnie und Clyde
Babyface Nelson
John Dillinger
u. v. m.
Information zu historischen Figuren:
Alle in dem Buch beschriebenen Werdegänge und Handlungen der Personen sind nachweislich belegt. Davon ausgeschlossen sind die Begegnungen mit den fiktiven Romanfiguren. Auf Abweichungen, die der Dramaturgie des Inhalts dienen sollen, wird am Ende des Inhalts hingewiesen.
Januar
D
er Rancher und Pferdeliebhaber John James McKenzie, in Amerika lebend, und sein Freund Otto von Dannenberg, seinerseits Pferdezüchter und Inhaber eines Gestüts, befanden sich zum Jahresanfang in der gleichen Situation. Obwohl durch tausende Kilometer getrennt, teilten sie ein Schicksal. Auf der Ranch der McKenzies, weit außerhalb Bostons, war das Wohnhaus schwer beschädigt. Schneemassen hatten das Dach zum Einsturz gebracht, glücklicherweise gab es keine Verletzten.
In Pommern, rund zehn Kilometer außerhalb Greifswalds, war auf dem Besitz der Familie von Dannenburg ein komplett umgebautes und um eine Etage erweitertes Haus durch Blitzeinschlag abgebrannt, auch hier hatte es zum Glück keinen Toten und körperlich Geschädigte gegeben. Erst vor wenigen Tagen wurde das Objekt fertiggestellt, dass dem Gutsbesitzer so am Herzen lag. In dem Gebäude waren Wohnungen für die befreundeten Familien Rothenbaum und die des Verwalters Paul Bruchthaler errichtet worden. Im Erdgeschoss hätte die Verwaltung der von Otto geplanten Schneiderei, die Kleidung für Pferdesportliebhaber produzieren sollte, in diesen Tagen ihren Betrieb aufnehmen sollen, doch der Plan war in Rauch und Asche aufgegangen.
Ω
Gestüt von Dannenburg, Pommern
O
tto von Dannenburg gab sich nicht geschlagen. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", dachte er sich und stand schon am ersten Januartag mit Paul Bruchthaler und seinem besten Freund, Gottlieb Rothenbaum, vor den Überresten der an einigen Ecken immer noch Rauch ausspuckenden Ruine.
Gottlieb, ein gelernter Hofschneider, der mit seiner Frau den Betrieb im Bereich der Kleiderentwürfe hätte leiten sollen, war zum Weinen zumute. Vor Monaten hatte Ottos Bruder, Walter, seinen Besitz mutwillig in Brand gesteckt, weswegen ihm Otto einen Neuanfang ermöglichen wollte. Nun war erneut alles vernichtet, die höhere Gewalt, die sich dahinter verbarg, konnte kein Trost sein. »Otto, deine Hingabe und Ziele in Ehren, lass es sein, du schaufelst dir finanziell sonst dein eigenes Grab.«
Der Pferdezüchter ignorierte die Worte seines Freundes, wandte sich an seinen Verwalter. »Paul, du hast gesagt, du hättest Leute an der Hand, die bereit wären für mich zu arbeiten, wenn die Sicherheit auf meinem Besitz in Gefahr wäre. Können diese Burschen auch mit den Händen anpacken?«
»Ganz gewiss, Herr von Dannenburg.«
»Paul, erstens heiße ich Ott, zweitens: Kannst du dich für jeden Einzelnen verbürgen?«
»Es kommt keiner auf das Grundstück, für den ich nicht die Hand ins Feuer legen würde«, erwiderte der Verwalter.
»Die Leute sind unter einer Bedingung eingestellt.«
»Die wäre?«, fragte Paul Bruchthaler, dessen Frau und drei Kinder im Moment wie Maria und Gottlieb Rothenbaum im Haus des Gutsbesitzers lebten.
Otto kratzte sich hinter dem Ohr. »Ich muss finanziell einige Dinge regeln, es könnte länger dauern, als ich denke. Wenn deine Leute ohne zu murren damit einverstanden wären, dass Lohnzahlungen in den ersten Wochen verspätet geleistet werden, dann können alle morgen anfangen. Maximal zwanzig Mann.«
»Kein Problem! Ich bürge auch für Sie, Otto! Die Männer werden morgen vor Ort sein.«
Der Pferdezüchter trat einen Schritt zurück, sah seinen langjährigen Kameraden Gottlieb an. »Wenn, mein Freund, gehen wir zusammen unter. Ich schwöre dir, nichts und niemand wird die Schneiderei für Reiterkleidung verhindern! Heute ist der erste Januar«, drehte sich Otto ein wenig dem Verwalter zu. »In einem halben Jahr werden wir die ersten Bestellungen verschicken, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt?«
»Mit Fleiß und ein bisschen Glück schon im Mai«, erwiderte Paul
»Du bist wahnsinnig«, stellte Gottlieb liebevoll fest.
Otto machte die Bewegung rückgängig, blickte zu Gottlieb. »Ihr bleibt bei uns im Haus, auch wenn es im Augenblick ein wenig hektisch ist. Meine Mutter und Hildegard würden es mir nie verzeihen, wenn ihr gehen solltet. Gottlieb, eure Kinder haben mit ihrem Nachwuchs genug zu tun, bei beiden wäre es noch enger als hier. Lass deinen Pessimismus, mein Haus ist euer Haus, so ist es, so wird es bleiben!«
»Ich werde versuchen, dass sich unsere Kinder etwas ruhiger verhalten«, warf Paul ein.
Otto winkte ab. »Es sind Kinder, lass sie laufen und spielen. Meiner Mutter tut es gut, meiner Hildegard macht es Freude, dass die bedrückende Stille im Haus verschwunden ist. Sicher, es gibt da und dort vor dem Bad oder in der Küche manchmal einen Stau, aber Herrgott, wir sind erwachsen, sollten fähig sein, damit umzugehen. Ich wiederhole: Heute ist der erste Januar, wir genießen den Tag, morgen fangen wir an zu schuften. Einverstanden?«
»Ich bin dabei«, entgegnete Paul.
»Du kannst dich auf mich verlassen«, sagte Gottlieb.
So begann das Jahr 1934 auf dem Gut der Familie von Dannenburg. Es sollten schwere, tragische, traurige und dramatische, ebenso abwechslungsreiche und auch erfreuliche Monate folgen, doch Hellsehen konnte niemand. Die eingeleitete und in den wichtigsten Bereichen fast schon abgeschlossene Diktatur der NSDAP sollte in den negativen Aspekten eine tragende Rolle spielen.
Ω
Ranch McKenzie, Massachusetts
B
lieb der Zeitunterschied unbeachtet, stand John James McKenzie mit seiner Frau Patricia, seiner Tochter Susan und Peter, dem Sohn Otto von Dannenburg, der in Amerika einfach nur Dannenberg hieß, vor dem eingestürzten Teil seines Wohnhauses.
»Wir werden die Hütte wieder aufbauen und da sie schon in Trümmern liegt, auch ausbauen, was meinst du Peter?«
»Sorry, muss ich das jetzt verstehen?«
John James drehte sich Peter zu, legte einen Arm über die Schulter seiner Frau. »Ach, weißt du, Patricia und ich finden, dass du und Susan ein wundervolles Paar bildet. Wir glauben, euer Weg ist vorbestimmt, auch wenn es im Moment zu früh wäre. Susan wird erst siebzehn, aber irgendwann wird sie achtzehn oder älter sein. Jedenfalls haben wir nichts dagegen, wenn ihr eure Gefühle in angemessener Form auch vor uns auslebt. Wir wissen, wie sehr Susan die Ranch am Herzen liegt, umgekehrt können wir uns vorstellen, wie sehr dir dieses Stück Land bei der Bewältigung deines Heimwehs geholfen hat und weiterhin helfen wird. Bei Heimweh verhält es sich wie bei der ersten Liebe: Ein Stück weit bleibt sie immer ein Teil von uns allen. Zum Punkt: Patricia und ich wären überglücklich, wenn Ihr in dem mir vorschwebenden Anbau für alle Zeit eure Heimat und zuhause finden würdet.«
»JJ, ich weiß nicht, was ich sagen soll«, entgegnete Peter verlegen.
»Dad!«, schrie Susan auf, fiel ihrem Vater um den Hals.
John James drückte seine Tochter, die mit einem Arm auch ihre Mutter in die Umarmung einschloss, trotzdem schaffte es der Rancher, dem Sohn seines Freundes, den er fast schon als ein leibliches Kind ansah, zu antworten. »Sag einfach ja.«
»Es ist mir eine Ehre, Freude und ja, ich sage ja«, antworte Peter, woraufhin sich die vier Personen in einem Kreis in den Armen lagen.
Peter von Dannenburg, in Amerika als Peter Dannenberg auftretend, wusste, dass seine Zusage mit keinen Forderungen verbunden war. In dieser Hinsicht war der Rancher John James McKenzie anders als sein Vater, zumindest empfand er es so, obwohl ihm John James diesbezüglich schon einige belehrende Gesprächsstunden gegeben hatte. Der Rancher zwang ihm keineswegs etwas auf, erwartete von der Zustimmung nichts, außer dass er Susan glücklich machen würde. Ansonsten konnte Peter sein Leben so gestalten, wie er es für richtig hielt, die Pläne verfolgen, die ihm wichtig waren. Auf dem Gut seines Vaters wäre ihm diese Freiheit nicht gewährt worden, glaubte Peter. Die Gesinnung, die auf dem Pferdegestüt herrschte, hätte irgendwann dazu geführt, in die Fußstapfen seines Erzeugers treten zu müssen. "Amerika war so anders, viel liberaler und freiheitsliebender", dachte sich Peter, während er und seine neue Familie sich in Abwesenheit von Susans Schwester, Amanda, wie ein eingeschworener Haufen umarmte.
Das neue Jahr auf der Ranch begann somit hoffnungsfroh, doch die Geschichte ging unaufhaltsam ihren Weg.
Ω
Januar 1934
D
as neue Jahr begann gleich am ersten Tag mit einer Schreckensmeldung. In vielen Köpfen machte sie Sinn, doch bei den Betroffenen und ihren Angehörigen löste sie blankes Entsetzen aus. Es lag vor allem an dem Ausdruck und der Feststellung der "Erbkranken", die willkürlich zu solchen erklärt werden konnten. Dazu gehörten Kritiker des Regimes, Andersdenkende, Ausreisewillige deutsche Staatsbürger, eben jeder, der dem Kurs der Regierung nicht folgen wollte.
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 war ein deutsches Sterilisationsgesetz. Es trat an diesem 1. Januar 1934 in Kraft. Das Gesetz diente im NS-Staat der sogenannten Rassenhygiene durch "Unfruchtbarmachung" vermeintlicher "Erbkranker" und Alkoholiker. Die Sterilisationsverfahren wurden durch Gutachten von sogenannten Erbgesundheitsgerichten legalisiert. Die Sterilisation wurde auf Antrag des beamteten Arztes "für die Insassen einer Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt oder eines Anstaltsleiters einer Strafanstalt" durchgeführt, über den Erbgesundheitsgerichte entschieden, die einem Amtsgericht angegliedert waren. Dadurch wurde die eugenische Zwangssterilisation legalisiert.
Das Gesetz basierte auf einem bereits vor der nationalsozialistischen Machtübernahme geplanten Entwurf, welcher 1932 vom preußischen Gesundheitsamt unter Federführung von Eugenikern wie Hermann Muckermann, Arthur Ostermann, dem zweiten Direktor des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie, Richard Goldschmidt, und anderen ausgearbeitet wurde. Der Entwurf enthielt Sterilisationen auf freiwilliger Basis. Allerdings erfuhr dieser Punkt bei den Beratungen Kritik seitens des Gesundheitsexperten der sozialdemokratischen Fraktion im preußischen Parlament namens Benno Chajes, welcher mit Hinweis auf die Gesetzgebung in einigen Bundesstaaten der USA und dem Schweizer Kanton Waadt Zwangssterilisation für bestimmte Fälle vorschlug. Außerdem forderte er, neben der eugenischen und medizinischen auch soziale Indikationen in den Entwurf einzuführen. Obwohl dieser Gesetzesvorschlag breite Unterstützung erhielt, wurde er auch auf Grund des politischen Chaos infolge der Absetzung der preußischen Regierung nicht mehr als Gesetz angenommen.
Im Gegensatz zu diesem frühen Gesetzentwurf, welcher Sterilisation auf freiwilliger Basis vorsah, war das unter den Nationalsozialisten beschlossene Gesetz in mehreren Punkten verschärft. So war nun die Möglichkeit der Zwangssterilisation gegeben, die von Amtsärzten oder Anstaltsleitern der "Kranken-, Heil-, Pflege- oder Strafanstalten" beantragt werden konnte. Der regierungsamtliche Gesetzeskommentar einschließlich zweier fachchirurgischer Beiträge erschien 1934 im J. F. Lehmanns Verlag, München: Arthur Gütt, Ernst Rüdin, Falk Ruttke: "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933".
Was 1934 noch niemand ahnte und kommen sah, ereignete sich ein Jahr später in der Form, dass dieses Gesetz erweitert wurde. Die erste Änderung des Sterilisationsgesetzes, das "Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 26. Juni 1935 erlaubte einerseits die sogenannte "freiwillige" Kastration von Männern, "um sie von einem entarteten Geschlechtstrieb zu befreien", womit Homosexuelle und Sexualstraftäter gemeint waren. Das Gesetz definierte zugleich die "Entfernung der Keimdrüsen" oder "Entkeimung" geschlechterneutral, führte damit auch die Kastration an Frauen ein, was die beidseitige Eierstockentfernung nach sich zog.
Andererseits wurde das Sterilisationsgesetz zu einem Abtreibungsgesetz erweitert. Bei Abtreibungen aus rassenhygienischen Gründen oder bei medizinischer Indikation wurde Straffreiheit zugesichert und bei "erbkranken" Schwangeren die Sterilisation mit Abtreibung gekoppelt, was bedeutete, nur wenn eine Zwangssterilisation beschlossen worden war, fand bis einschließlich zum sechsten Monat auch eine eugenische Abtreibung statt. Dies betraf "erbgesunde" Frauen nicht, die von einem "erbkranken" Mann geschwängert worden waren. Zunächst verlangte das Gesetz die Einwilligung der Schwangeren, allerdings hieß es in der "Vierten Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 18. Juli 1935, dass der Eingriff auch bei Einwilligung "des gesetzlichen Vertreters oder des Pflegers" vorgenommen werden könne, wenn der Frau "die Bedeutung der Maßnahme nicht verständlich gemacht werden" konnte. Im Grunde handelte es sich dabei um einen Freibrief, um bei einer werdenden Mutter aus fadenscheinigen Gründen einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen zu können.
Ω
D
er erste Januar 1934 wurde ein turbulenter Tag, der erst am frühen Abend im Volksempfänger seinen Höhepunkt finden sollte. Während auf dem Gestüt von Otto von Dannenburg in Pommern und auf der Ranch von John James McKenzie in Massachusetts die Ärmel hochgekrempelt wurden, saßen Walter von Dannenburg und seine Lebensgefährtin Luise, die inzwischen als eine Art "Dauerverlobte" bezeichnet werden konnte, in der Villa, die seine Geliebte von ihren bei einem brutalen häuslichen Raubüberfall ermordeten Eltern geerbt hatte.
Nicht viele Leute besaßen ein Hintergrundwissen über den mysteriösen Einbruch, bei dem die Mutter und der Vater von Luise im Schlaf erschlagen worden waren. Einer der Mitwisser, bei ihm handelte es sich um Magnus von Levetzow, immerhin gegenwärtiger Polizeipräsident Berlins, außerdem überzeugter Gefolgsmann des NS-Regimes, war jedoch vom "Führer" noch nicht so geblendet worden, dass er unfähig gewesen wäre, die wahren Abläufe des Verbrechens zu erkennen. Für ihn waren Luise und Walter die Täter, ohne sich die Hände mit Blut beschmiert zu haben, was ihm und der Partei eine Beteiligung am Erbanteil einbrachte. Den Doppelmord vollumfänglich aufzuklären, lag letztlich nicht im Interesse der NSDAP-Funktionäre und des Polizeipräsidenten. Das Regime hätte in Walter einen willigen Handlanger verloren, dem Mann aus Berlin wären etliche finanzielle Zuwendungen entgangen. Dennoch blieb das Kapitalverbrechen an Luises Eltern nicht ungesühnt. Walter von Dannenburg gab einige Namen von Personen preis, die ihm und der Diktatur im Weg standen, schon war der Gerechtigkeit genüge getan. Der von Walter organisierte und von Luise ausgedachte Einbruch, der dem Zweck diente, schneller an das Erbe der Eltern zu kommen, war im Mai 1933 geschehen, inzwischen in Greifswald nur noch ein Thema hinter vorgehaltener Hand. Das aus gutem Grund: Walter war Parteimitglied, zudem Leiter des drastisch operierenden statistischen Amts in Greifswald, darüber hinaus als Mensch verschrien, der weder ein Herz noch eine Seele besaß.
Nebensächlichkeiten dieser Art interessierten Walter von Dannenburg nicht. Ihm waren nur zwei Dinge wichtig: Sein Leumund und Aufstieg innerhalb der Partei. Ganz weit nach oben wollte er, am besten links oder rechts vom Führer stehen, dafür war er bereit, über Leichen zu gehen. Das Motiv erschien niederträchtig, für Walter beinhaltete es den Aspekt einer Überlebensgarantie. Nur die Starken würden sich ab einem gewissen Zeitpunkt durchsetzen können und niemand außer seinem Idol Adolf Hitler war in der Lage, dem Kommunismus und dem Judentum die Stirn zu bieten. Deswegen war er seit Monaten in seinem Amt voller Eifer, listete Namen auf, die entweder zu den Regimegegnern und Juden gehörten. Ebenso registrierte er Namen und Adressen von Personen, die eines Tages für die Sturmabteilung, aber auch für die Allgemeine- und Waffenschutzstaffel Dienst am Staat leisten könnten. In der Erfüllung der Bürgerpflicht eines jeden Einzelnen sah Walter ein gigantisches Deutsches Reich entstehen, dass sich nie wieder einer anderen Nation unterwerfen müsste. Um dieses Ziel zu erreichen waren ihm die Namen auf der Liste völlig gleichgültig, ob bekannt oder unbekannt, ob Freund oder Feind, jeder Name wurde in der Spalte eingetragen, die ein unsägliches Schicksal bedeutete, ein Menschenleben entweder auf dem Schlachtfeld oder in einem Konzentrationslager beenden würde. Noch existierten fast keine Säuberungslager, um den jüdischen und abartig veranlagt menschlichen Abschaum loszuwerden, aber es gab bereits die Pläne für solche Bauten. Die Frage war nicht, ob sie entstehen würden, sondern wann sie endlich in Betrieb gehen könnten.
Wie an diesem Tag ging Walter mit Luise ein paar Namen durch, die ihnen bekannt waren, diskutierte mit ihr aus, wer am Ende wo landen sollte. Dachau war vom Namen her bereits ein Begriff, aber da gab es noch Auschwitz, Birkenfeld und viele weitere Ortschaften, wo unliebsame Wegbegleiter bestens aufgehoben wären. Aus der Sichtweise Walters kam es einer Fahnenflucht oder Desertation gleich, wenn er vor der Obrigkeit der Partei hätte zugeben müssen, dass die besten Freunde seiner geachteten Familie Juden waren. Für ihn kam das Geständnis nicht in Frage. Vorrangig sah er seine Karriere in Gefahr, zweitrangig befürchtete er Konsequenzen für seine Mutter. Auch die anderen Familienmitglieder wollte er nicht in Schwierigkeiten bringen, vorausgesetzt, es würde nicht notwendig werden, was auf die Familie Rothenbaum nicht zutraf. Walter musste die Leute auf irgendeine Weise aus seiner Vergangenheit löschen, mit Juden im Sandkasten gespielt zu haben, machte sich in der Akte eines aufstrebenden NSDAP-Funktionärs mit Sicherheit nicht positiv bemerkbar.
Ω
W
ährend sich Walter von Dannenburg in Anwesenheit seiner Lebensgefährtin mit den eigenen Sorgen beschäftigte, verkündete der Volksempfänger eine scheinbar unbedeutende Nachricht, die jedoch eine Brisanz besaß, die niemand vorhersehen konnte. Die Botschaft an die Zuhörer gab bekannt, dass Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin zu dem das Land Mecklenburg vereint wurden und der Gauleiter Friedrich Hildebrandt zum neuen Reichsstatthalter von Mecklenburg ernannt worden war. Es war keine Meldung, die für Aufsehen sorgte, dafür eine, die im Nachhinein ein Spiegelbild der NS-Diktatur darstellte.
Der neue Gauleiter Friedrich Hildebrandt wurde als jüngerer Sohn des namensgleichen Landarbeiters und Steinschlägers Friedrich Johann Theodor Hildebrandt und dessen Frau Bertha Anna Emma geboren. Als er vier Jahre alt war, ließen sich seine Eltern am 1. August 1903 in Schwerin scheiden. Beide Elternteile heirateten später erneut. Hildebrandt besuchte von 1905 bis 1912 die Volksschule in Benzin bei Lübz, Groß Lüben und Legde, arbeitete anschließend von 1912 bis 1914 als Tagelöhner in der Landwirtschaft und fand dann in Wilsnack eine Beschäftigung als Eisenbahnhilfsarbeiter. Eine Ausbildung zum Betriebsanwärter konnte er wegen des Kriegsausbruches nicht mehr beginnen. Während des Ersten Weltkrieges meldete er sich am 25. November 1916 als Kriegsfreiwilliger. Hildebrandt wurde dem Rekruten-Ersatz-Depot des Ersatzbataillons des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 24 in Neuruppin zugeteilt. Anfang 1917 folgte der Kriegseinsatz an der Westfront.
In seinem ersten Einsatzjahr wurde er durch Bauchschuss und Giftgas schwer verletzt. Am 6. August 1918 wurde das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 24 aufgelöst und verteilt. Dadurch gelangte er zum Infanterie-Regiment "Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin" Nr. 24. Nach einem Lazarettaufenthalt in Wittenberg kehrte er im November 1918 nach Legde zurück und trat dort im Dezember in die neu gegründete Deutschnationale Volkspartei ein. Am 13. Januar 1919 schloss er sich dem von seinem ehemaligen Vorgesetzten Hauptmann Cordt von Brandis gegründeten Freikorps an. Dieses Freikorps kam in Schlesien und im Baltikum zum Einsatz, dabei wurde Hildebrandt am 6. Juli 1919 in Riga gefangen genommen. Nach dem Verhör durch lettische und britische Offiziere konnte er wieder zu seiner Kompanie zurückkehren. Zuvor noch zum Vizefeldwebel befördert, wurde er am 15. Januar 1920 aus der Truppe entlassen. Unmittelbar danach kam er zur vierten Einsatzhundertschaft der Sicherheitspolizei in Halle-Merseburg. Die Einsatzhundertschaft war in Ohrdruf zusammengestellt worden und kam vorwiegend im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch zum Einsatz. Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Angehörige der proletarischen Arbeiterwehren vom 16. bis 20. März 1920 in Osterfeld und Weißenfels, die auf beiden Seiten zu zahlreichen Todesopfern führten, wurde Wachtmeister Hildebrandt später angeklagt, in einem Prozess jedoch freigesprochen. Im Juni 1920 wurde er wegen "verbaler Entgleisungen" aus dem Dienst entlassen. Danach arbeitete er als Landarbeiter und war von 1921 bis 1922 Vorsitzender der Kreisgruppe Westprignitz des Brandenburgischen Landarbeiterbundes. Schließlich, im September 1922, nahm er als Delegierter am Görlitzer Parteitag der DNVP teil und sympathisierte dort mit dem von Albrecht von Graefe geführten rechten Parteiflügel. Kurze Zeit später wurde Hildebrandt aufgrund innerparteilicher Streitigkeiten aus der DNVP ausgeschlossen. Daraufhin schloss er sich der Organisation Roßbach an. Am 19. Oktober 1923 heiratete Hildebrandt die aus Groß Breesen/Güstrow stammende Elise Else Christine Krüger in Pinnow. Aus der Ehe gingen bis 1946 sechs Kinder hervor. Tochter Ingeburg erkrankte im Alter von drei Jahren schwer und litt zeitlebens unter den Folgen. Der 1925 geborene Sohn Teutobert fiel am 14. März 1945 bei Danzig.
1924 wurde Hildebrandt Mitglied der Deutschvölkischen Freiheitspartei. Für die DVFP war er von 1924 bis März 1925 Abgeordneter im Landtag von Mecklenburg-Schwerin. Nach einem persönlichen Treffen mit Adolf Hitler am 16. Februar 1925 in München trat er der NSDAP bei. Die offizielle Aufnahme erfolgte am 8. Mai 1925 unter der Mitgliedsnummer 3.653. Hildebrandt behielt sein Landtagsmandat und wurde so zum ersten NSDAP-Abgeordneten im Mecklenburg-Schwerinschen Landtag. Am 27. März 1925 ernannte ihn Gregor Strasser zum Gauleiter für den neu geschaffenen Gau Mecklenburg-Lübeck. Im Juni desselben Jahres gründete er das Parteiorgan Niederdeutscher Beobachter. Zudem verfasste er 1925 das Manuskript "Lösung der Judenfrage". Seine Schrift befasste sich hauptsächlich mit dem mecklenburgischen Landadel, den er als "stark verjudet" ansah. Die Münchener Parteizentrale war wenig begeistert, wie die Beurteilung zeigte: "Viel Phantastereien, die obendrein sehr gefährlich sind, wenn sie in die Hände von Gegnern kommen." Mit dieser Zensur kam die Beurteilung einer Ohrfeige gleich.
Mit der Wahlniederlage der NSDAP am 6. Juni 1926 verlor Hildebrandt sein Landtagsmandat. Ihm fehlten fortan die regelmäßigen Geldbezüge, wodurch er und seine Familie zeitweilig in eine Notlage gerieten. Nur durch die finanzielle Unterstützung einiger Spender, zu denen auch Rittmeister Adolf von der Lühe gehörte, konnte er seine Parteiarbeit fortsetzen. Noch im selben Jahr zog er mit seiner Familie nach Parchim, wohin auch die Gauzentrale verlegt worden war. An seinem neuen Wohnsitz wirkte er von November 1927 bis Januar 1930 als Stadtverordneter. Am 23. Juni 1929 wurde er erneut für die NSDAP in den Schweriner Landtag gewählt.
Nach der Trennung Otto Strassers von der NSDAP meldete die von Strasser herausgegebene Zeitung "Nationaler Sozialist", Hildebrandt habe sich Strassers neuer Gruppierung angeschlossen. Daraufhin wurde Friedrich Hildebrandt am 1. Mai 1930 als Gauleiter beurlaubt und zum stellvertretenden geschäftsführenden Gauleiter degradiert. Am 11. Juli 1930 erschien im Niederdeutschen Beobachter eine Erklärung, in der er sich mit den "revolutionären Nationalsozialisten" solidarisierte. Nach einer Diffamierungskampagne im Völkischen Beobachter, die sich gegen die "disziplinlosen Quertreiber" und das "Literatengesindel" richtete, distanzierte sich Hildebrandt von Otto Strasser und dessen Ideen. Zudem ließ er der Presse gegenüber verlautbaren, dass er nicht vorhabe, zu Strasser überzulaufen. Bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 wurde Hildebrandt zum Reichstagsabgeordneten für den Reichstagswahlkreis 35 gewählt, der den Freistaat Mecklenburg-Schwerin, den Freistaat Mecklenburg-Strelitz und die Freie und Hansestadt Lübeck umfasste. Anfang März 1931 erfolgte seine Wiedereinsetzung als Gauleiter. Hildebrandt reiste anschließend nach München, um sich dort am 4. März mit Hitler zu treffen. Hildebrandt stand in dieser Zeit im regen persönlichen und brieflichen Kontakt zum abgedankten Großherzog Friedrich Franz IV., dessen Sohn Friedrich Franz im Mai 1931 in NSDAP und SS eingetreten war. Das gute Einvernehmen ging sogar so weit, dass der Erbgroßherzog den Wahlkampf von Hildebrandt aktiv unterstützte.
Friedrich Franz hatte wenig Berührungsängste, so kommentierte er gegenüber Hildebrandt erfreut die Ermordung zweier Kommunisten in Doberan: "Zum Glück sind mal zwei von der anderen Seite umgekippt", lautete seine gleichgültige Version des Ereignisses. In den Jahren 1931/32 kam es fast regelmäßig zu zahlreichen Zusammenstößen zwischen den politischen Gegnern. Hildebrandt wusste die Situation für seine Propaganda geschickt auszunutzen. Verletzte und Tote, wie der angeblich ermordete SA-Mann Karl Friedrich Wittenburg, stilisierte er zu "Blutopfern der Bewegung". Die Auseinandersetzung zwischen Bergedorfer Reichsbanner-Angehörigen und SA am 10. Juli 1932 in Hagenow bildete einen blutigen Höhepunkt. An diesem Tag stürmten SA-Angehörige in Anwesenheit von Hildebrandt das Hagenower Gewerkschaftshaus, in dem die Reichsbanner-Angehörigen ihre Versammlung abhielten. Das Inventar wurde zertrümmert und vor dem Haus entwickelte sich eine wilde Schießerei. Während der bewaffnete Reichsbanner-Angehörige Alfred Hinze von der Ordnungspolizei verhaftet wurde, blieb der mit einer Pistole bewaffnete NSDAP-Gauleiter Hildebrandt unbehelligt. Bei der Landtagswahl am 5. Juni 1932 errang er erneut ein Landtagsmandat. Die NSDAP verfügte nach der Wahl über die absolute Mehrheit der Landtagssitze. Nunmehr wurde der Freistaat Mecklenburg-Schwerin von einer nationalsozialistischen Landesregierung regiert. Hildebrandt suchte nicht nur die Auseinandersetzung mit anderen politischen Parteien und Organisationen. Er war auch selbsterklärter Gegner der katholischen Kirche. In Parchim äußerte er bereits vor der Machtübernahme: "Wenn ich erst einmal am Ruder bin, werde ich dafür sorgen, dass innerhalb von zwei Jahren kein Katholik mehr in Mecklenburg ist."
Nach der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten behielt Hildebrandt sein Mandat im Reichstag bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 24. März 1933 wurde er als Reichskommissar für beide Mecklenburg eingesetzt. Seine Ernennung zum Reichsstatthalter für Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und Lübeck folgte am 26. Mai 1933. Die Ernennung hatte sich jedoch verzögert, da es seitens des Reichspräsidenten Hindenburg Bedenken gab. Führende Vertreter der mecklenburgischen Ritterschaft hatten persönlich Einspruch erhoben. Hildebrandts Verwicklung in den Mord an Andreas von Flotow, der angeblich auf der Flucht erschossen wurde, war bei der Ritterschaft noch nicht in Vergessenheit geraten. Das Verhältnis zwischen mecklenburgischen Adel und Reichsstatthalter blieb nachhaltig gestört. 1933 wurde Hildebrandt zum NSDAP-Reichsredner ernannt. Er galt als befähigter Redner, der meist ohne Manuskript auskam. Nachdem die Machtposition gefestigt war, setzte Hildebrandt die Vereinigung der beiden mecklenburgischen Freistaaten durch. Am 13. Oktober 1933 beschlossen die beiden Landesparlamente im Rostocker Ständehaus die Vereinigung von Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz zum 1. Januar 1934. Der erhebliche innerparteiliche Widerstand gegen die Vereinigung blieb wirkungslos.
Am 5. Dezember 1933 trat Hildebrandt im Rang eines SS-Oberführers in die SS ein und wurde der 22. SS-Standarte in Schwerin zugeteilt. In der SS wurde er am 27. Januar 1934 zum Gruppenführer und am 30. Januar 1942 zum Obergruppenführer befördert. Er gehörte dem Personalstab des Reichsführers der SS an und war stellvertretender Oberabschnittsleiter der SS in Stettin.
Im Frühsommer 1934 entging Hildebrandt einem Sturzversuch, den Ministerpräsident Hans Egon Engell und Oberst der Landespolizei Hans Heidemann sowie weitere Parteigenossen vorbereitet hatten. Sie wollten Hildebrandt aus seinem Amt drängen, mit der Anschuldigung, dass er an beginnender erblicher Geisteskrankheit leide und daher sein Amt nicht mehr ausüben könne. Als Begründung musste der Anstaltsaufenthalt von Hildebrandts Mutter Bertha und die geistige Entwicklungsstörung seiner Tochter herhalten. Nur durch das Einschreiten des Landesbischofs Walther Schulz, der persönlich bei Rudolf Heß intervenierte, und des Beauftragten der Reichsparteileitung Seidel überstand er die Intrige. Für Ministerpräsident Engell endete die Intrige mit der unmittelbar erzwungenen Amtsaufgabe. Hans Heidemann musste sich Ende September 1934 einem Disziplinarverfahren stellen. Im September 1935 wurde Hildebrandt Mitglied in der von Hans Frank geleiteten Akademie für Deutsches Recht, ohne jemals ein Studium absolviert zu haben. Er verfügte höchstens über einen 7-klassigen Volksschulabschluss. Zudem wurde er im Februar 1936 Mitglied im Ehrenführerring des Reichsbundes der Kinderreichen, der seinerseits die menschenverachtende NS-Erbgesundheitspolitik unterstützte. Auch mit Friedrich Scharf, dem Nachfolger von Hans Egon Engell, verband Hildebrandt eine innige Feindschaft. 1937 stellte er einen Antrag auf Abberufung des Staatsministers. Scharf genoss jedoch die Protektion der Reichsleitung der NSDAP und der SS-Führung. Nach Ablehnung des Antrages wurde Hildebrandt von der Parteiführung in aller Deutlichkeit zurechtgewiesen, er galt fortan als "Stänkerer, der sich mit jedem" im Streit befände.
Am 1. April 1937 musste Hildebrandt die NSDAP-Kreise Lübeck-Stadt und -Land an Gauleiter Hinrich Lohse abtreten, da Lübeck nach den Bestimmungen des Gross-Hamburg-Gesetzes seine Eigenständigkeit verlor. Fortan war er nur noch Gauleiter und Reichsstatthalter von Mecklenburg. Zur Stärkung seiner politischen Position setzte er 1937/1938 selbstherrlich den Zusammenschluss mehrere Ortschaften seines Amtsgebietes durch, ohne dazu eine Zustimmung in den betreffenden regionalen Körperschaften einzuholen. Das betraf die Städte Rerik und Kühlungsborn mit großer politischer Inszenierung auf seine Person bezogen am 1. April 1938. Während seiner Amtszeit bereicherte sich Hildebrandt und übervorteilte sein gesellschaftliches Umfeld. So besorgte er Parteigenossen günstige Hausbaukredite und stellte Baugrundstücke in bester Lage zur Verfügung. Zur Bewirtschaftung und Erholung erwarb Hildebrandt 1938 das 383 Hektar große Gut Gößlow bei Lübtheen, für einen äußerst günstigen Kaufpreis von 50.000 RM. Zum Missfallen einiger Volksgenossen, wie aus einem anonymen Brief hervorging: "Aufgeblasener Knecht! Unser teurer Führer hat eine schlechte Wahl getroffen, als er sie mit unserer Führung beauftragte. Gehen sie doch auf ihre Güter, die sie vom Volksvermögen gestohlen haben." Der geschäftlich umtriebige Gauleiter war zudem zeitweise Herausgeber und Besitzer der publizistischen NSDAP-Parteiorgane "Niederdeutscher Beobachter", "Lübecker Beobachter" und "Strelitzer Beobachter". Ende August 1939 übernahm er auch den Posten des Gaujägermeisters und löste damit Martin Kliefoth ab, der in den Kriegseinsatz musste.
Hildebrandt nutzte seine Machtfülle auch zur Durchsetzung von Euthanasie-Maßnahmen. Im April 1941 veranlasste er die Enteignung und Zwangsräumung des Diakonissenhauses Lobetal. Die dort untergebrachten geistig behinderten Kinder wurden daraufhin in die Kinderabteilung Lewenberg nach Schwerin verbracht. Dort wurden sie später in Verantwortung des Abteilungsarztes Alfred Leu getötet. Zynisch äußerte sich Hildebrandt bei einer Tagung am 15. April 1941 in Schwerin: "Lobetal habe ich säubern lassen. Die Idioten habe ich dahin bringen lassen, wo sie hingehören." Hildebrandts Skrupellosigkeit zeigte sich erneut im Winter 1941/42, als mehrere tausend russische Kriegsgefangene in Mecklenburg verhungerten. So äußerte er in einem Schreiben an die NSDAP-Parteikanzlei seine Besorgnis über die nun fehlenden Arbeitskräfte. Das Problem könne man jedoch umgehen, wenn noch "genug Russen nachgeliefert werden". Während der Sitzung des Reichsverteidigungsausschusses am 17. März 1942 trat Hildebrandts Hemmungslosigkeit erneut zu Tage, so äußerte er: "Für den Führer und die Sache Adolf Hitlers verfolge ich das Recht, und wenn es über Leichen geht." Ende 1943 gab es in Mecklenburg 152.148 ausländische Arbeitskräfte, die aus Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen bestanden, deren Arbeitskraft erbarmungslos ausgebeutet wurde.
Das Amt des Gauleiters war im Zweiten Weltkrieg mit weiteren Ämtern verbunden. So wurde Hildebrandt im September 1939 zum Beauftragten des Reichsverteidigungskommissars im Wehrkreis II im Gau Mecklenburg und zum Verteidigungskommissar des Wehrkreises ernannt. Ab dem 15. November 1940 fungierte er zudem als Gauwohnungskommissar. Am 6. April 1942 ernannte ihn Fritz Sauckel zum Beauftragten des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und nach Neuordnung der Reichsverteidigungsbezirke wurde er am 16. November 1942 Reichsverteidigungskommissar für Mecklenburg. Gegen Kriegsende führte er ab dem 25. September 1944 den Deutschen Volkssturm in seinem Gau. Am 24. Februar 1945 traf er sich ein letztes Mal mit Hitler im Bunker der Reichskanzlei. Hitler hatte die Gauleiter zu sich befohlen, um ihnen die üblichen Durchhalteparolen und den späteren Einsatz von Wunderwaffen zu verkünden. Hildebrandt gehörte wohl zu den wenigen Gauleitern, die sich beeindrucken ließen. In den darauffolgenden zwei Wochen beschwor er vor Bataillons- und Kompanieführern des Mecklenburger Volkssturms in Rostock, Hagenow und Ludwigslust den Durchhaltewillen. Vom Volkssturm erwartete er "bedingungslosen Widerstandswillen" und "fanatischen Hass". Noch am 5. April 1945 ließ er im Rostocker Anzeiger verbreiten: "Wo sich auch nur die allergeringste Andeutung einer Lockerung der Kampfmoral zeigt, wird mit rücksichtsloser Härte durchgegriffen". Ein von Hildebrandt gebildetes Standgericht sollte sämtliche Straftaten verfolgen, welche die "Kampfkraft und Kampfentschlossenheit" gefährdeten. In den letzten Wochen des Krieges hielt sich der Gauleiter zumeist in seinem unterirdischen Befehlsstand in der Schweriner Gauschule auf. Seinen letzten dokumentierten Auftritt in seiner Funktion als Gauleiter hatte er am 25. April bei der von Großadmiral Karl Dönitz einberufenen Zusammenkunft der norddeutschen Gauleiter in Plön. Hildebrandt flüchtete am 1. Mai 1945 vor den anrückenden amerikanischen Truppen aus Schwerin.
Am 12. Mai 1945 wurde Friedrich Hildebrandt von britischen Militärpolizisten in Cismar verhaftet, im Internierungslager Gadeland interniert und nach seiner Überstellung am 1. April 1946 an die US-Armee in den Fliegerprozessen angeklagt. Wegen der Beteiligung an der Tötung abgeschossener alliierter Flieger, einem Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung, wurde Hildebrandt am 31. März 1947 von einem amerikanischen Militärgericht in Dachau zum Tod durch Erhängen verurteilt. Aufgrund von Hildebrandts Anordnungen und Weisungen, die er den mitangeklagten NSDAP-Parteiangehörigen erteilte, waren von Juni bis Dezember 1944 bei Pingelshagen, Klink, Veelböken und Möllin gefangen genommene Angehörige der United States Army Air Forces getötet worden. Hildebrandt und seine Frau stellten zwei Gnadengesuche, die beide abgelehnt wurden. Das Urteil wurde zuletzt am 22. März 1948 von General Lucius D. Clay bestätigt. Die Hinrichtung wurde am 5. November 1948 um 10.46 Uhr im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg vollzogen.
Hildebrandts Verwicklung in die Euthanasiemorde in der Heil- und Pflegeanstalt Lewenberg-Sachsenberg führten zu einem weiteren Strafverfahren. Von 1946 bis 1948 versuchte die von der Sowjetischen Militäradministration eingesetzte Schweriner Staatsanwaltschaft die Auslieferung des ehemaligen Gauleiters zu erwirken. Hildebrandt sollte sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Briten und Amerikaner lehnten jedoch eine Auslieferung des Beschuldigten ab. Am Morgen des 1. Mai 1945 begaben sich Hildebrandt, sein Sohn Dietrich und weitere Vertraute in die Gauschule Schwerin, um dort sein Privatarchiv zu sichern und abzutransportieren. Im Anschluss ließ er die in Munitionskisten verpackten Unterlagen in einem Wald bei Hagenow und in einer Kiesgrube bei Gut Gößlow vergraben. Nach dem Ende der DDR erinnerten sich die Kinder des damaligen Gauleiters an die Vergrabungsaktion vom Mai 1945. So kam es 1992 und 1994 zu aufsehenerregenden Such- und Grabungsaktionen, bei denen die Kisten schließlich gefunden wurden. Einige Gegenstände von Wert, die der Gauleiter auch versteckt hatte, wurden verkauft oder verblieben in Familienbesitz. Das aufgefundene Archivgut fand zunächst wenig Beachtung und wurde zumeist unsachgemäß eingelagert. Erst in den Jahren 1998/99 konnte das Landeshauptarchiv Schwerin den aufgefundenen Archivbestand über private Anbieter erwerben und sichern. Der schriftliche Nachlass wird seither im Schweriner Landeshauptarchiv aufbewahrt. Die schriftlichen Unterlagen sind für gau- und reichsbezogene Forschungen zum Nationalsozialismus von erheblicher Bedeutung. Friedrich Hildebrandts Tagebuch und sein Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP befinden sich seit 1991 in Besitz der Stiftung Mecklenburg.
Zahlreiche Städte Mecklenburgs verliehen Friedrich Hildebrandt die Ehrenbürgerschaft. Zu den Städten gehörten unter anderem Güstrow, Rehna, Ribnitz, Rostock, Stavenhagen und Neustrelitz. Die Ehrenbürgerschaften wurden nach dem Krieg größtenteils aberkannt. Eine Aberkennung war allerdings nicht zwingend notwendig, da die Ehrenbürgerschaft mit dem Tode des Inhabers formaljuristisch endete. Nach der politischen Wende in der DDR folgten weitere Aberkennungen, so am 4. Juli 1990 in Rostock. Am 16. März 2006 folgte die Stadtvertretung von Güstrow dem Vorschlag zur Aberkennung der im Mai 1933 verliehenen Ehrenbürgerschaft Hildebrandts. Stavenhagen beschloss im Oktober 2013 die Aberkennung der am 27. Mai 1933 verliehenen Ehrenbürgerschaft.
Die Auszeichnungen eines Kriegsverbrechers lassen sich dennoch in dieser Form lesen:
Schnalle zum Eisernen Kreuz
Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse
Königlicher sächsischer Albrechts-Orden (1915)
Mecklenburg-Schweriner Militärverdienstkreuz 1. und 2. Klasse
Ritterlicher Militärorden des Heiligen Heinrichs (1917)
Verwundetenabzeichen in Silber (1918)
Der fürstliche Orden des Hauses Hohenzollern. Ritterkreuz mit Schwertern (1918)
Baltenkreuz 1. und 2. Klasse (1920)
Nürnberger Parteitagsabzeichen 1929
Ehrenwinkel der Alten Kämpfer
Ritterkreuz des militärischen Verdienstkreuzes mit Schwertern
Orden des deutschen Adlers 1. Grades mit Schwertern
Orden des deutschen Adlers 2. Grades mit Schwertern
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP (November 1933)
Gau-Ehrenzeichen für Mecklenburg 1925 (1933)
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914–1918 mit Schwertern (1934)
Blutorden
Ehrendolch des SS-Reichsführers
Ehrensäbel des SS-Reichsführers
SS-Ehrenring
Medaille für Dienstjahre in der SS 2. Grades
SS-Zivilabzeichen (Verleihungsnummer 139.296)
Goldenes HJ-Ehrenzeichen
Deutsches SS-Vlies in Bronze
Luftschutz-Ehrenzeichen 1. und 2. Stufe (1938)
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Kriegsverdienstkreuz 1. und 2. Klasse mit Schwertern (1942)
Dienstauszeichnung der NSDAP in Bronze/Silber/Gold (1943)
Ergänzendes
Familienwappen
1935 ließ Hildebrandt für seine Familie ein Wappen entwerfen, das in seiner Gestaltung dem Zeitgeist entsprach. In rot der Dreieckschild, auf ihm ein goldener Amboss mit silbernen Eisen, darüber der goldgestielte Schmiedehammer, flankiert von zwei silbernen Pflugscharen. Stechhelm mit rot-silberner Helmdecke und offenen roten Flug als Helmzier, rechts belegt mit einer Pflugschare, links belegt mit einem Schmiedehammer.
Wäre all das Otto von Dannenburg im Nachhinein bekannt geworden, hätte er umgehend den Wunsch gehegt, dass jeder Mensch von Geburt an begreifen könnte, dass Freiheit durch nichts ersetzt werden kann.
Ω
J
ohn James McKenzie gehörte zu einer Sorte Mensch, die vieles sehr gelassen nahm, sich dennoch in Ausnahmesituationen in eine Rage versetzen oder reden konnte, die durchaus eine angsteinflößende Wirkung zu verbreiten wusste. Von daher kam es selten dazu, eigentlich nie, ihn so zu erleben, wie es in der zweiten Januarwoche geschah.
Sein künftiger Schwiegersohn, Peter, also Otto von Dannenburgs Junge, befand sich wegen des Studiums wieder in Boston. Patricia, seine Frau, und Susan, seine jüngste Tochter, waren einer Einladung einer Nachbarsfamilie gefolgt, wodurch John James allein zuhause war, sah man von den Angestellten ab, die sich auf seinem Anwesen um alles Mögliche kümmerten. Es galt die Rinder zu versorgen, die Pferde zu pflegen, die Reparatur- und Umbauarbeiten am Wohnhaus fortzusetzen, da und dort mussten Zäune repariert werden, kurzum, auf einer Ranch gab es immer etwas zu tun. Der Rancher, obwohl es den Ausdruck damals noch nicht gab, ein "Workaholic" im wahrsten Sinne des Wortes, musste jedoch zwangsweise kürzertreten, ihm drohte bei weiterer Überlastung ein Bandscheibenvorfall und für diese Diagnose benötigte er keinen Arzt. Aus diesem Grund hatte er es sich in dem von seiner Familie vorübergehend bewohnten Gästehaus gemütlich gemacht, sich im Aufenthaltsraum auf ein Sofa gelegt und nichts tuend die Decke angestarrt. Nicht zu vergessen, es wurde das Jahr 1934 geschrieben. Handy, Tablet oder PC, Videospiele, Streamingdienste, all das, was neunzig Jahre später wie selbstverständlich zum Alltag gehören sollte, existierte noch nicht einmal in utopischen Zukunftsträumen. Doch eines hatten Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit gemeinsam. Glück und Pech, Schicksal und Zufall, es waren zeitunabhängige Faktoren, die zu jeder Stunde und an jedem Tag zuschlagen konnten, wann und wie sie wollten. Bei John James McKenzie gestaltete es sich eben so, wie man es von ihm nicht kannte.
Der Rancher hatte auf der Couch noch nicht die richtige und damit schmerzfreie Liegeposition gefunden, da hämmerte jemand gegen die Haustür. John James quälte sich auf die Beine, schritt zur Tür, öffnete sie und blickte seiner Tochter Amanda und ihrem Begleiter ins Gesicht. Im Nu gehörten die Rückenschmerzen vorübergehend der Vergangenheit an. »Amanda!«, entkam dem Rancher der Vorname seiner älteren Tochter in einem überraschten und zugleich anklagenden Ton.
»Dad! Schön dich zu sehen. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht ein paar Fragen hätte. Abgesehen davon, willst du uns hier draußen erfrieren lassen?«, fragte Amanda in einem Ton, der dermaßen rebellisch klang, dass er jeder Mutter und jedem Vater das Herz aus dem Leib gerissen hätte.
Noch blieb John James ruhig, trat zur Seite, ließ Tochter samt Begleiter eintreten, deutete mit skeptischer und finsterer Miene an, in welche Richtung sie gehen und wo sie im Wohnraum Platz nehmen sollten. Er selbst hätte sich gern auf dem Sofa platziert, setzte sich gezwungenermaßen in einen der Sessel. Der Rancher befand sich in einem Gefühlszustand, der mehr als heikel war. Seine Tochter hatte ihn enttäuscht, belogen und war mittendrin unauffindbar gewesen, wofür sie so oder so eine Tracht Prügel verdient hätte. Nun saß sie vor ihm, in Begleitung eines Schweinskopfs, den er am liebsten sofort erschossen hätte. Bedauerlicherweise waren die Regeln des Westens im Osten der Vereinigten Staaten nicht mehr gültig. John James, beseelt von den Gefühlen eines liebenden und wütenden Vaters, deutete auf Amandas Begleiter. »Deine sich um dich sorgende Mutter und Schwester sind ausnahmsweise unterwegs, du kommst mit diesem "Bleistift" unangemeldet her, bringst nicht den Charakter auf, dich vorab für dein Verhalten zu entschuldigen. Amanda! Bist du von uns so erzogen worden?«
»Sir!«, brachte der Begleiter protestierend hervor. »Ich darf doch bitten! Sie sprechen von Ihrer Tochter, meiner Ehefrau, außerdem mit Charles Chester, Teilhaber und Mitinhaber von Chester & Chester, mit Sitz in New York.«
Für einen Moment verschlug es John James komplett die Sprache, es geschah unbestritten in einem Moment der väterlichen Machtlosigkeit, in der ein Vater einsehen musste, dass er gegen den Liebhaber oder Ehemann seiner Tochter nichts ausrichten konnte. Der Rancher gehörte jedoch nicht zu der Sorte von Mann, die sich belehren oder einschüchtern ließen. Hinzu kam der Umstand, dass ihm der Name "Chester" mehr als geläufig war. Immerhin hatte er der Anwalts- und Detektivkanzlei gleichen Namens, den sogar für seine Verhältnisse kostspieligen Auftrag erteilt, nach seiner Tochter zu suchen. Eine Frage entkam John James: »Sie sind also der Bruder von Henry Chester?«
»So ist es, Sir.«
John James McKenzie erhob sich, begab sich scheinbar schmerzlos zu dem im Wohnzimmer des Gästehauses dominierendem Waffenschrank, holte ein Gewehr hervor und lud es durch. Der Lauf der Waffe zielte im Anschluss auf Charles Chester, dessen Gesicht plötzlich die Farbe einer Tomate verloren, dafür die einer unreifen Banane angenommen hatte. John James lächelte den bedrohten Mann gefährlich an, stellte fest: »Das heißt, Ihr Kompagnon gleichgültig des Verwandtschaftsverhältnisses, ließ sich von mir für einen Auftrag bezahlen, obwohl er schon wusste, wo meine Tochter steckt.«
Der vermutlich unmittelbar vor einem Nervenzusammenbruch stehende Charles Chester widersprach: »Das nicht, Sir! Ihre Tochter und ich sind erst ein Paar geworden, nachdem wir Sie ausfindig machen konnten.«
Der Rancher ließ den Lauf der Waffe auf den Mann gerichtet, sah zu seiner Tochter. »Wenn ich ihn hier und jetzt erschießen würde, ich denke, einen größeren Gefallen könnte ich dir nicht tun, deswegen unterlasse ich es. Allerdings kennst du mich so gut, macht er eine falsche Bewegung, wird er stets Krücken brauchen. Wäre ich nicht dein Vater, müsste ich dich abknallen, mein Kind. Amanda! Du bist durch und durch verdorben, keine Ahnung, was ich oder deine Mutter falsch gemacht haben, aber warum bist du hier, nachdem du weißt, wie sehr du uns enttäuscht und verletzt hast?«
Amanda war es sichtlich zuwider, ihrem Mann nach der Erniedrigung durch ihren Vater Kraft und Trost zu spenden, indem sie ihn umarmt oder seine Hand ergriffen hätte. Stattdessen lächelte sie, schüttelte gelangweilt den Kopf und gab ihrem Dad durch eine Geste zu verstehen, dass er ihr mit dem Gewehr in der Hand keine Angst einjagen konnte. Sie hob ihre Hand, deutete an, er möge die Waffe senken und sich setzen. Als ob ihre Finger eine magische Wirkung ausgeübt hätten, folgte John ihrer Anweisung, aber nicht wegen ihrem Willen, sondern ausschließlich aus Neugier und einer nicht definierbaren Vorahnung. In ihren Augen, auch in ihrem Gesicht und an ihrer Haltung konnte er erkennen, dass Amanda einen Trumpf im Ärmel hatte, der noch nicht zur Sprache gekommen war. Wie eine Elfe ergriff sie das Wort, hörte sich dennoch wie eine böse Hexe an: »Dad! Charles, mein lieber Ehemann, hat sich zwar vor Angst in die Hose gemacht, ändert nichts daran, was ich dir zu sagen habe. Wenn alles gut läuft, wirst du bald Opa, aber abgesehen davon, wir haben unsere herrlichen Flitterwochen in Österreich verbracht.«
John James knirschte mit den Zähnen, ein Geräusch, welches auf unangenehme Art auch in seinem Rücken einen Schmerz verursachte. »Glückwunsch, was willst du mir damit sagen?«
»Lege endlich das Gewehr weg, vielleicht wärst du auch so nett, uns Kaffee, Kuchen oder Plätzchen anzubieten«, sagte Amanda, sah zu ihrem Gatten. »Denk dir nichts Schatz, auch wenn wir uns in Massachusetts befinden, mein Dad glaubt von je her, dass man auch hier nur mit den Methoden des Wilden Westens weiterkommt.«
»Amanda, ich warne dich!«, entkam es John James, dem der Kragen zu platzen drohte. Er rief nach Sally, einer dunkelhäutigen Haushaltshilfe, die er erst vor wenigen Tagen auf Probe eingestellt hatte. Er bat sie um Kaffee für die Gäste, gab an, dass die Gäste weder Kuchen noch Gebäck wollten. Schließlich nahm er zwangsweise wieder im Sessel Platz, legte das Gewehr über seine Oberschenkel. Er wandte sich an Amanda, fuhr sie scharf an: »Du hältst die nächsten Minuten den Mund, ich will zuerst einige Auskünfte von deinem angeblichen Mann«, drehte er den Kopf zu Charles. Es war unglaublich: Unabhängig des Charakters seiner Tochter, der Rancher hätte nie gedacht, dass sie sich von einem Kerl wie Charles Chester aushalten lassen würde. Der Mann war ein wenig kleiner als Amanda, rundlich, fast schon dick. Er hatte ein Doppelkinn, ein glattrasiertes ovales Gesicht, zudem eine sehr dünne graubraune Haarpracht, die befürchten ließ, dass er bald glatzköpfig werden könnte. »Sir, den Auftrag nach meiner Tochter zu suchen, habe ich Henry Chester Ende November des vergangenen Jahres erteilt. Wie stehen Sie verwandtschaftlich zu ihm?«
»Mit Verlaub Sir, Henry ist mein älterer Bruder.«
»Sagen Sie mir eines, Mister Chester: Wann und wo wurde Amanda von Ihnen gefunden, weshalb wurde ich als Auftraggeber nicht darüber informiert. Ich meine, wir schreiben Januar, stehen am Beginn der zweiten Woche des neuen Jahres und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass Sie der Mann meiner Tochter sind«, brachte John James seine Worte anklagend hervor. Charles blickte kurz zu Amanda, was den aufgebrachten John James weiter erzürnte: »Schauen Sie nicht das Mädchen an, welches Ihre Tochter sein könnte, sondern mich. Noch eine Warnung: Wagen Sie es nicht mich anzulügen, sonst mache ich tatsächlich noch von der Waffe Gebrauch.« John James bemerkte, dass seine Tochter etwas sagen wollte, fuhr ihr über den Mund. »Du bist still«, schrie er sie an, drehte den Kopf wieder zu ihrem männlichen Begleiter: Sie kennen Amanda allerhöchstens fünf Wochen, sind angeblich Ihr Mann, stimmt das überhaupt? Meiner Tochter traue ich durchaus zu, dass Sie von ihr so um den Finger gewickelt wurden, um mir hier eine Lüge nach der anderen aufzutischen.«
Charles Chester war anzusehen, dass er sich unwohl in seiner Haut fühlte, die Situation ihm peinlich war. »Sir, ich bin zutiefst bestürzt, befinde mich im Moment in einer desaströsen Lage. Ich versichere Ihnen, Amanda und ich müssen diesbezüglich ein klärendes Gespräch führen«, sagte er, warf einen bösen Blick auf seine Frau.
John James McKenzie fiel es nicht schwer, verständnisvoll zu schmunzeln. »Aha, hört sich so an, als ob Sie in eine von meiner Tochter aufgestellte Falle gelaufen sind. Nun, willkommen im Club. Erzählen Sie von Anfang an!«
»Wie Sie bereits feststellten, bei Ihrer Auftragserteilung war ich in der Kanzlei nicht anwesend, erfuhr erst am nächsten Tag von Ihrem Anliegen. Ich besprach mich mit meinem Bruder über unser Vorgehen in dieser Sache, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, denn drei Tage später stand Ihre Tochter in unserer Kanzlei.« Der Rancher sah aus den Augenwinkel auf Amanda, ahnte zwar nicht, was für ein durchtriebenes Spiel sie inszeniert hatte, doch obwohl er die Geschichte noch nicht kannte, war ihm klar, dass Charles und womöglich auch Henry Chester seiner Tochter auf den Leim gegangen waren. Interessiert hörte er zu, ohne Charles auch nur einmal zu unterbrechen. »»Wie aus dem Nichts stand Sie vor uns, weinte sich die Augen aus und klagte uns ihr Leid. Ihre Erzählung klang glaubwürdig, war erschütternd, auch weckte sie unser Mitgefühl, woraufhin wir ihr unsere Hilfe anboten«, erklärte Charles, wollte im gleichen Atemzug ein Teil der Ereignisse überspringen und auf die Gegenwart zu sprechen kommen.
John James fiel ihm ins Wort: »Bleiben Sie bitte bei der Story, danach können Sie mir erzählen, welche Pläne Sie geschmiedet haben, um dem bemitleidenswerten und berechnenden Miststück zu helfen.«
Charles Chester nickte. »Sir, so sehr ich es bedauere, aber Amanda hat uns geblendet. Ihre Tränen und Trauer, zugegebenermaßen ebenso Ihre Ausstrahlung. Wir sahen uns gezwungen Einschreiten zu müssen. Wir bekamen zu hören, dass Sie zum Studium gezwungen wurde, ohne Abschluss Ihren Erbanteil verlieren sollte, dazu kamen familiäre Horrorstorys, die einem das Herz zerreißen konnten. Amanda behauptete, stets im Schatten Ihrer jüngeren Schwester zu stehen, zur Arbeit auf dem Anwesen gezwungen worden zu sein. Ich kann gar nicht alles wiedergeben, so haben uns die Ohren geklungen.«
Der Rancher verzog die Lippen, den letzten Satz konnte er sofort mit seiner Tochter in Verbindung bringen. »Verstehe, kombiniere: Sie kamen zu dem glorreichen Entschluss, dass arme Kind vor der unsäglichen häuslichen Willkür durch eine Scheinehe zu retten. Richtig?«
»Korrekt, Sir. Vertraglich ist alles geregelt, die Ehe wird geschieden, sobald Sie Ihrer Tochter den Erbanteil auszahlen«, entgegnete der Rechtsanwalt und Detektiv.
»Das glauben auch nur Sie«, lächelte John James.
»Sir?«, verstand Charles nicht, worauf sich der Rancher bezog.
»Also ist die Ehe echt und es gibt einen Ehevertrag«, stellte John James amüsiert fest.
»Ja, Sir.«
»Mister Chester, keine Ahnung, wie Amandas Zukunftspläne aussehen, aber so schnell wie Sie denken, werden Sie meine Tochter nicht los. Gut, ich habe genug gehört, der Rest ist Ihr Problem«, meinte John James, blickte zu Amanda, dabei gefror sein Lächeln schlagartig. »Klug eingefädelt, doch dein Plan besitzt einen Denkfehler: Du hast andere Leute durch Lügen betrogen, weswegen du auf deinen Erbanteil sehr lange warten wirst. Du bist nicht volljährig, hast unter falschem Vorwand geheiratet, dazu ohne den Segen deiner Eltern. Deine erfundenen Märchen können ohne Schwierigkeiten komplett widerlegt werden, welche Konsequenzen Charles und Henry Chester daraus ziehen, soll mir egal sein. Womöglich hast du den Chesters einen Teil deines Erbes als Honorar versprochen, sieh zu, wie du aus der Nummer herauskommst.« John James sah wieder zu Charles. »Da haben Sie sich was angelacht, Mister Chester. Wenn Sie Amanda richtig bestrafen wollen, lassen Sie sich nicht scheiden, mehr weh tun können Sie ihr nicht. Falls Sie es in Erwägung ziehen, warne ich Sie: Seien Sie jede Minute auf der Hut, meine Tochter ist nicht nur boshaft, sie ist an Gemeinheiten zudem äußerst erfindungsreich.«
Amanda schien in jede Richtung auf der Verliererstraße zu stehen, doch plötzlich ergriff sie das Wort, wirkte weder eingeschüchtert noch peinlich berührt. »Dad, wenn es Charles zulässt, wird er noch früh genug erfahren, wie sehr ich ihn liebe. Gleichgültig welche Geschichten ich erfunden habe, einige sind wahr, zum Beispiel die über meine Schwester. Susan durfte mit nach Europa, ich nie!«, warf Amanda ihrem Vater vor.
John James winkte verärgert ab. »Höre auf, dir etwas einzureden. Deine Schwester war ein einziges mal mit uns unterwegs. Damals warst du krank, weswegen du bei deiner Tante Maureen in Tennessee warst.«
»Wie auch immer«, erwiderte Amanda in einem Ton, der verriet, dass sie die Wahrheit nicht hören wollte. »Weißt du, mein Schatz hat mich mehr oder weniger nach Europa entführt, unsere Flitterwochen waren ein Traum. Die Schweiz hat mir ziemlich gut gefallen. Genf, Zürich und Basel, traumhafte Städtchen, dass Matterhorn, wow, was für ein imposanter Berg. Aber um ehrlich zu sein, prächtiger war Österreich: Salzburg, Innsbruck und Wien, paradiesisch. Beeindruckend für mich waren vor allem die Tage in Zell am See. Stell dir vor, ein Peter von Dannenburg ist dort völlig unbekannt, er ist da nicht geboren. Wenn ich nun eins und eins zusammenzähle, deine und Mutters jahrelange freundschaftlichen Verbindungen ins Deutsche Reich berücksichtige, irgendwie kommen mir Zweifel, ob Peter sich legal in den Staaten aufhält.«
John James blieb in diesem Moment ruhig, obwohl er seine Tochter nur allzu gern über das Knie gelegt hätte. »Dein Ehemann ist Privatdetektiv und Rechtsanwalt in einer Person, lass es ihn doch herausfinden. Den Erbanteil bekommst du so oder so nicht früher«, sagte der Rancher abfällig.
»Wir werden sehen«, entgegnete Amanda, fügte im arroganten und provozierenden Ton hinzu: »Du kannst es dir in den nächsten vier Wochen überlegen. Mal sehen, ob Charles auf dich und deine Warnungen Rücksicht nimmt, oder, mir und damit seiner Frau die Liebe verweigern kann.«
John James sah zu dem alles andere als attraktiven Mann, ließ sich nichts ansehen, aber hätte er die Unterhaltung mit einem Kartenspiel verglichen, wäre sein Blatt unterirdisch schlecht gewesen. Trotzdem behielt er die Ruhe, erhob sich und sagte: »Darf ich euch nun bitten, mein Haus zu verlassen und Amanda, dass hier ist endgültig nicht mehr dein Zuhause. Irgendwann kommst du vielleicht auf Knien angekrochen, doch die Tür bleibt für dich zu. Du selbst hast sie zugeschlagen. Egal, wann und wo, irgendwann wirst du es bitterlich bereuen.«
Amanda lächelte abwertend, schüttelte den Kopf. »Das ist dein Wunsch, Dad. Er wird niemals in Erfüllung gehen, immerhin heiße ich nicht Susan, bin eine McKenzie, unabhängig davon, ob es dir gefällt.«
Es war das Einzige, was John James McKenzie seiner Tochter Amanda zugutehalten konnte. In der Tat, sie war mutig, kämpferisch, willensstark, jedoch nur dann, wenn sich daraus Vorteile für sie ergaben. John James wandte sich noch einmal an Charles Chester: »Sir, ich erwarte das mir zumindest ein Teil des Honorars zurückerstattet wird, nachdem Sie bezüglich meines Auftrags kaum Umstände hatten«, sagte er, streckte die Hand aus, um Amanda und ihrem Mann in Richtung der Haustür den Vortritt zu lassen. Auf dem Weg dahin, ergriff der Rancher erneut das Wort: »Mister Chester, ich kann Ihnen nichts befehlen oder raten, aber eines möchte ich Ihnen doch empfehlen: »An Ihrer Stelle würde ich mich schon dafür interessieren, wie Amanda ausgerechnet auf Sie gekommen ist, da ich Ihnen den Auftrag gab, sie zu suchen. Weiterhin wäre ich an Ihrer Stelle neugierig, hätte meinem Erfahrungsschatz sehr gern das Wissen hinzugefügt, wo sich meine Frau in der Zeit seit dem Verlassen der Universität bis zum Auftauchen in der Kanzlei aufgehalten hatte«, versetzte er dem Gemüt des Rechtsanwalts einige Tritte.