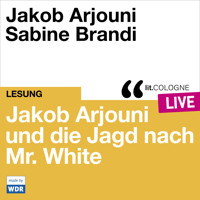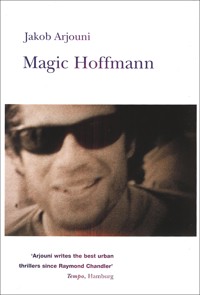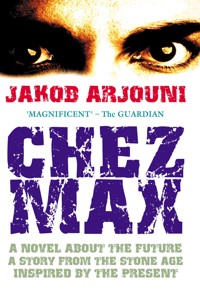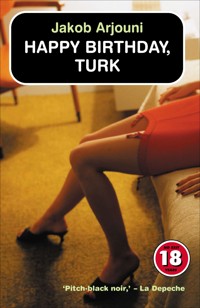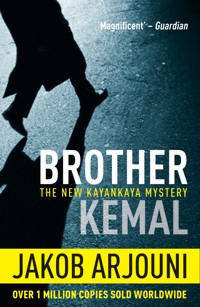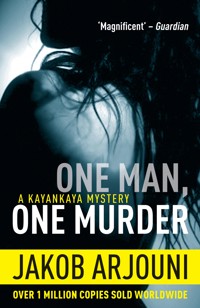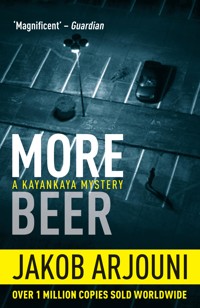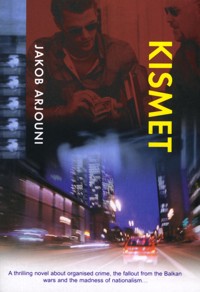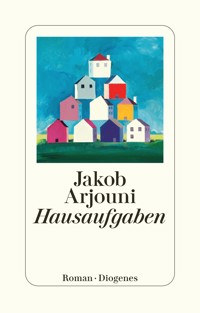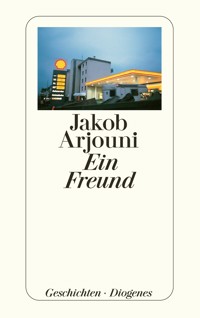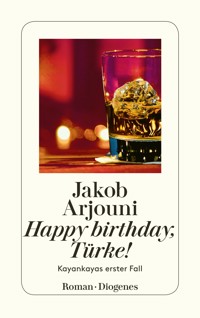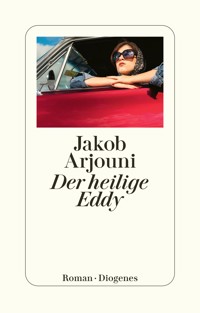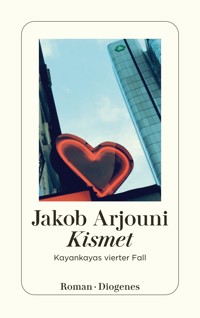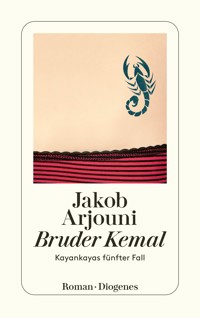
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kayankaya
- Sprache: Deutsch
Der Frankfurter Privatdetektiv Kayankaya ist zurück: älter, entspannter, cooler – und sogar in festen Händen. Ein Mädchen verschwindet, und Kayankaya soll während der Frankfurter Buchmesse einen marokkanischen Schriftsteller beschützen. Zwei scheinbar einfache Fälle, doch zusammen führen sie zu Mord, Vergewaltigung, Entführung. Und Kayankaya kommt in den Verdacht, ein Auftragskiller zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jakob Arjouni
Bruder Kemal
Kayankayasfünfter Fall
Roman
Die Erstausgabe erschien
2012 im Diogenes Verlag
Umschlagfoto von
Philip J. Brittan (Ausschnitt)
Copyright © Philip J. Brittan/
Photographer’s Choice/Getty Images
Für Lucy, Emil und Miranda
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24255 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60182 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] 1
Marieke war sechzehn und nach den Worten ihrer Mutter »sehr talentiert, belesen, politisch engagiert, neugierig, voller Humor – einfach eine tolle, junge, intelligente Person, verstehen Sie? Keine Rumhängerin, keine Computersüchtige und sonst nur Shoppen und Ist-das-Leben-öd. Im Gegenteil: Klassensprecherin, Mitglied bei Greenpeace, malt wunderschön, interessiert sich für moderne Kunst, spielt Klavier und Tennis – oder hat jedenfalls gespielt…«
Die Mutter sah kurz zu Boden und strich sich mit ihren rotlackierten Fingernägeln eine blonde Strähne aus der Stirn.
»Wie das eben so ist, nicht wahr? Vor zwei Jahren kamen plötzlich neue Interessen dazu. Marieke war wohl das, was man frühreif nennt. Mit vierzehn hatte sie ihren ersten Freund. Jack oder Jeff oder so was, ein Amerikaner, Diplomatenkind, er ging in die Klasse über ihr. Irgendwann war’s dann ein anderer Junge und so weiter. Marieke wurde ein ziemlicher Feger, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Ich wusste, was sie meinte. Allerdings nicht wegen der Fotos von Marieke, die ich in der Hand hielt. Die zeigten ein leicht dunkelhäutiges, streng durch eine viereckige schwarze Designerbrille blickendes Mädchen mit blonden Rastazöpfen, das bemüht und ein wenig herablassend in die [6] Kamera lächelte. Hübsch, möglicherweise charmant, vielleicht süß, wenn sie die Brille abnahm und freundlich gucken mochte, aber sicher nicht das, was man einen Feger nannte. Eher einen Besen. Die Anführerin eines Schulstreiks oder die Sängerin einer Popband, die Texte gegen Tierversuche sang.
Was die Mutter meinte, traf auf sie selbst zu. Sie war das, was man einen Feger nennt. Auf den zweiten Blick. Auf den ersten war sie einfach nur eine dieser sportlichen Solarium-Blondinen, deren Körper aus hellbraunem Hartgummi gegossen zu sein schien: eine kleine spitze Nase, volle, für ein Werk der Natur vielleicht etwas zu volle Lippen und zu fadendünnen Halbkreisen gezupfte Augenbrauen, um die Augen größer wirken zu lassen. Sie waren tatsächlich eher schmal, aber daran änderten auch die gezupften Brauen nichts, und sowieso ging es bei ihren Augen nicht um die Größe. Was aus Valerie de Chavannes einen Feger machte, war der Himmel und Hölle versprechende blaue Stahl in den Augen, mit dem sie einen so unverschämt direkt und verschlagen anblitzte, als hauchte sie einem ins Ohr: Ich denke immer nur ans eine! Natürlich – oder jedenfalls höchstvermutlich – dachte sie an dem Morgen an das eine eher nicht, schließlich wollte sie mich beauftragen, ihre verschwundene Tochter zu suchen. Aber in irgendeiner Phase ihres Lebens musste ihr diese Art zu gucken zur Gewohnheit geworden sein.
Als sie mir eine halbe Stunde zuvor die Tür zu der Villa in der oberen Zeppelinallee geöffnet und sich nicht gleich mit Namen vorgestellt hatte, war ich ziemlich sicher gewesen, dass es sich bei ihr um Besuch handelte: die [7] verlotterte jüngere Schwester oder eine aufdringliche Tennisclubbekanntschaft, die gerade unangemeldet hereingeplatzt war, um den neuesten Umkleidekabinen-Klatsch loszuwerden. Zu ihrem Ich-denke-immer-nur-ans-eine-Blick trug Valerie de Chavannes lange, weit ausgestellte, weiße, sehr durchsichtige Seidenhosen, durch die sich ihre schlanken Beine und ein weißer Slip deutlich abzeichneten, silberne Sandalen mit ungefähr zwanzig Zentimeter hohen Plateausohlen aus Kork und ein enges, für eine Dame der gehobenen Frankfurter Gesellschaft bemerkenswert ballermannkurzes gelbes T-Shirt, das wenig Geheimnis um ihren kleinen, festen Busen machte und so viel Haut bis zum Hosenbund frei ließ, dass das Mittelstück einer tätowierten Schlange zu sehen war. Eine Frau mit dem Namen Valerie de Chavannes, Tochter eines französischen Bankiers, verheiratet mit dem international erfolgreichen holländischen Maler Edgar Hasselbaink, Bewohnerin einer Fünfhundert-Quadratmeter-Villa mit Garten und Tiefgarage mitten im Frankfurter Diplomatenviertel hatte ich mir anders vorgestellt.
Inzwischen saßen wir uns im sonnendurchfluteten, mit weißem Teppichboden ausgelegten, moderner Kunst behängten und wertvollen Möbeln eingerichteten, fast das gesamte Erdgeschoss einnehmenden Wohnzimmer in Sesselwerken aus Leder, Chrom und Tierfellimitat gegenüber und nippten an Porzellanschalen mit grünem Tee, den uns eine ungefähr fünfzigjährige Haushälterin mit polnischem Akzent serviert hatte. Die für mich drängende Frage war: Schlängelte sich die Schlange von ihrer Scham Richtung Bauchnabel oder umgekehrt? Und was sollte das eine oder das andere bedeuten?
[8] Stattdessen fragte ich: »Seit wann genau ist Marieke verschwunden?«
»Seit Montagmittag. Sie war morgens in der Schule, Mathekurs, dann eine Französischarbeit, danach hat sie ihrer besten Freundin gesagt, sie wolle kurz in die Stadt, eine Hose kaufen. Zum Sportkurs sei sie zurück.«
Valerie de Chavannes schlug die Beine übereinander, und ein schmales Knie drückte sich durch die Seide. Die Plateausohle beschrieb kleine Kreise.
»Wollen Sie mir den Namen der Freundin geben?«
»Es wäre mir lieber… Ich habe Ihnen ja gesagt…«
»Ich weiß, kein Aufsehen, keine Polizei, alles diskret, aber irgendeinen Hinweis, mit wem Ihre Tochter um die Häuser zieht, brauche ich schon. Oder ich fange an, in Frankfurt an jede Wohnungstür zu klopfen, arbeite mich langsam hoch nach Bad Homburg, dann durch Kassel, Hannover, Berlin, danach vielleicht Warschau oder Prag – alles Städte für junge Leute, die was erleben wollen. Außer Kassel natürlich.«
Sie betrachtete mich humorlos. Die Plateausohle war kurz in der Luft stehengeblieben, nun wurden die Kreise schneller und größer.
Als spräche sie mit einem begriffsstutzigen Bediensteten, erklärte sie: »Falls alles in Ordnung ist und Marieke sich einfach nur ein paar Tage herumtreiben will, würde sie es mir nie verzeihen, wenn ich ihr einen Detektiv hinterhergeschickt hätte. Sie würde mir vorwerfen, ich wolle sie ausspionieren, mich in ihr Leben mischen. Unsere Beziehung ist zurzeit nicht ganz einfach. Ich denke, zwischen einer Mutter und einer Tochter in dem Alter ist das normal.«
[9] Valerie de Chavannes hatte für eine Französin praktisch keinen Akzent. Nur manchmal betonte sie die Vokale am Ende eines Wortes ein wenig zu sehr: Tochteer, Alteer.
»Na schön, wo soll ich denn dann Ihrer Meinung nach mit der Suche beginnen? Im Hosengeschäft?«
Wieder blieb die Sohle kurz in der Luft stehen, und Valerie de Chavannes betrachtete mich mit kaum versteckter Abneigung. Trotzdem war da auch nach wie vor etwas vom Ich-denke-immer-nur-ans-eine-Blick. Als mache sie das an, so ein unrasierter, leicht übergewichtiger, müde Witze reißender Privatdetektiv mit türkischem Namen und Büroadresse in der berüchtigten Gutleutstraße.
Es war natürlich andersrum: Sie machte mich an, und was ich den Ich-denke-immer-nur-ans-eine-Blick nannte, war vermutlich ein Ich-kann-nicht-glauben-dass-ich-so-ein-Kanackenarschloch-hier-in-meinen-Art-Cologne-Sessel-furzen-lasse-Augenausdruck. Aus irgendeinem Grund schien sie zu glauben, auf mich angewiesen zu sein.
»Nun… Ich habe Ihnen am Telefon ja erzählt, dass Marieke in letzter Zeit Kontakt zu einem älteren Mann hatte – also, älter als Marieke, meine ich, so um die dreißig. Er ist Fotograf, das behauptet er jedenfalls. Marieke hat erzählt, er wolle Modefotos mit ihr machen, die übliche Tour. Sein Studio oder Büro, oder vielleicht auch einfach nur seine Wohnung, ist irgendwo in Sachsenhausen. In letzter Zeit fielen ein paarmal die Namen Brücken- und Schifferstraße. Da gibt’s so einen kleinen Platz mit Bäumen. Marieke hat beim Abendessen von einem Café an der Ecke dort erzählt…«
Sie warf mir einen prüfenden Blick zu. Ob ich das Café [10] kannte? Den Platz? Sachsenhausen? Oder war die Gutleutstraße meine einzige Welt? War ich genau das, was zu finden sie befürchtet hatte, als sie im Internet auf der Suche nach einem Privatdetektiv gewesen war: ein versoffener, grobschlächtiger, in sämtlichen vorherigen Berufen gescheiterter Problemviertelbewohner? Ärger mit der Ex? Betäubungsmittelrechnung nicht bezahlt? Der Mann vom Pizzaservice behandelt Sie schlecht? Kemal Kayankaya, private Ermittlungen und Personenschutz, Ihr Mann im äußeren Zentrum Frankfurts!
Ich nahm einen Schluck von dem grünen Tee, der wie flüssige Fischhaut schmeckte – oder so, wie ich mir vorstellte, dass flüssige Fischhaut schmeckte – und fragte: »Warum hat sie Ihnen davon erzählt?«
»Wovon?«
»Von dem Café.«
Zum ersten Mal wirkte sie irritiert. »Wieso ›warum‹?«
»Na ja, Sie sagen, Ihre Beziehung sei zurzeit nicht ganz einfach. Warum erzählt sie Ihnen von einem Café, in dem sie sich mit einem Mann trifft, den ihre Mutter für schlechten Umgang hält. Kennen Sie ihn persönlich?« Ich lächelte Valerie de Chavannes freundlich an.
»Ich, äh, nein…« Sie beugte sich vor und stellte ihre Teeschale auf den flachen, wolkenförmigen Glastisch zwischen uns. »Also, ich habe ihn einmal gesehen, zufällig, als er Marieke im Auto nach Hause brachte. Ich kam gerade aus der Haustür. Wir haben uns kurz die Hand geschüttelt.«
»Was für ein Auto fuhr er?«
»Was für ein Auto…?«
Wieder zögerte sie. Vielleicht war es ein formales [11] Problem, vielleicht war sie es einfach nicht gewohnt, dass ihr jemand, den sie bezahlte, Fragen stellte. Oder aber sie brauchte gar keinen Detektiv, jedenfalls keinen, der etwas herausfand.
»Keine Ahnung, mit Autos kenne ich mich nicht aus. Irgend so was Angeberisches, ein Jeep oder SUV oder wie das heißt, schwarz, getönte Scheiben – vielleicht BMW, ja, ich denke, es war ein BMW.«
»Na, ist doch prima für jemanden, der sich mit Autos nicht auskennt. Kennen Sie sich vielleicht auch mit Nummernschildern nicht aus?«
Sie stutzte. Dabei öffneten sich ihre vollen, mit Pflegecreme bestrichenen Lippen ganz sachte zu einem schmalen, feuchten Spalt, und sie guckte, als hätte ich gefragt, ob ich sie mal zum leckeren Tiefkühlgericht mit Frauencatchen im Fernsehen einladen dürfe. Ich nahm mir vor, sie noch möglichst oft zum Stutzen zu bringen.
Ich hob lächelnd die Hand. »Kleiner Scherz, Frau de Chavannes, kleiner Scherz. Sagen Sie mir doch bitte, wie der Mann aussieht: Größe, Haarfarbe und so weiter.«
Diesmal sorgte ihr Hass auf ihn für eine prompte Antwort: »Mittelgroß, was weiß ich, weder besonders klein noch besonders groß, schlank, durchtrainiert, lange schwarze Locken, so ölig nach hinten gelegt, dunkle Augen, Dreitagebart – gutaussehend, wenn man den Typ mag.«
»Und der Typ ist…?«
»Na, Aufreißer in der Disco oder so was.«
»Sie meinen den schmierigen, glutäugigen Lackaffentyp mit etwas zu hohen Absätzen und Migrationshintergrund?«
[12] Ich blinzelte ihr aufmunternd zu.
»Wenn… wenn Sie das so beschreiben würden…« Für einen Moment wusste sie nicht, wohin mit dem Blick, den Händen. Dann sah sie auf und betrachtete mich skeptisch und neugierig zugleich. »Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich denke nicht so.«
»Natürlich nicht. Ist nur zur Verständigung: Jetzt weiß ich, welchen Typ Sie meinen. Außerdem: Darum haben Sie mich doch angerufen, oder?«
»Darum habe ich Sie angerufen…?«
»Darum haben Sie Kayankaya angerufen und nicht Müller oder Meier. Weil Sie dachten, ein Kayankaya sollte wissen, wie man mit Migrationshintergründen umgeht. Wie heißt der Mann?«
Sie überlegte kurz, ob sie widersprechen sollte, dann antwortete sie: »Ich weiß nicht genau, Erdem, Evren – Marieke hat den Namen nur ein, zwei Mal erwähnt.«
»Mit den Namen der Freunde Ihrer Tochter haben Sie’s nicht so, was?«
»Bitte?«
»Jack oder Jeff, Erdem oder Evren…«
»Was wollen Sie damit sagen?« Sie schaute verblüfft, ehe sie sich im Sessel aufsetzte und mich anfuhr: »Und was fällt Ihnen überhaupt ein? Wie reden Sie mit mir?!« Mit einem Ruck erhob sie sich und ging mit schnellen Schritten zu einem Bücherregal am anderen Ende des Wohnzimmers. Das machte ungefähr fünfzehn Meter. Ich sah zu, wie sie sich trotz ihrer Wut schön in den Hüften wiegte. Von hinten hätte sie ohne weiteres als Mitte zwanzig durchgehen können. So rund und prall wie ihr Po heraustrat, verbrachte [13] sie entweder eine Menge Zeit im Fitness-Studio, oder ihre Gene meinten es gut mit Edgar Hasselbaink.
»Ich habe Sie angerufen, damit Sie mir meine Tochter zurückbringen! Ich komme um vor Sorgen, und Sie sitzen hier grinsend rum und fragen mich irgendwelchen Unsinn!«
Sie griff ins Regal und zog eine Schachtel Zigaretten heraus.
»Na ja, so unsinnig sind die Fragen, wie der Mann heißt, bei dem Ihre Tochter sich vermutlich aufhält, was er für ein Auto fährt und wo er wohnt, nun auch wieder nicht.«
»Sie wissen genau, was ich meine!« Sie schnippte ein Feuerzeug an, hielt die Flamme an die Zigarette, inhalierte und blies den Rauch wütend aus. »Ob ich mich mit Nummernschildern auskenne! Mir die Namen der Freunde meiner Tochter wohl nicht merken könne! Ihre ganze Art…!«
Wieder nahm sie einen Zug. »Diese blöde Ironie! Und dabei gucken Sie wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf meine Titten!« Sie kam durchs halbe Wohnzimmer auf mich zu, blieb abrupt stehen und stieß mit den Fingern, die die Zigarette hielten, in meine Richtung. »Entweder Sie arbeiten für mich und machen, was ich von Ihnen verlange, oder ich suche mir jemand anders!«
Ich ließ sie wüten und betrachtete ihren Busen, als hätte sie mich auf ein interessantes Detail bei der Wohnzimmereinrichtung hingewiesen. Ich fand das lustig. Sie nahm es sportlich: Ihr Kopfschütteln und trockenes Auflachen war ebenso sehr Ausdruck von »Ich-glaub’s-ja-nicht!« wie von »Sie-haben-Nerven!«.
»Ehrlich gesagt habe ich bisher nur hin und wieder einen [14] Blick auf Ihre Schlange geworfen. Ich nehme jedenfalls an, es ist eine Schlange, der Kopf ist ja leider nicht zu sehen – Pardon: Der Kopf ist nicht zu sehen.«
Sie ging dazu über, mich anzuschauen wie einen netten Irren, freundlich, mitleidig, ein bisschen abgestoßen. Sie zog an der Zigarette, »Was Sie nicht sagen«, und ging in Gedanken wahrscheinlich schon die Liste mit Frankfurter Privatdetektiven durch, wen sie als Nächsten anrufen könnte.
»Na schön.« Ich stellte meine Schale Fischhautbrühe auf den Glastisch und lehnte mich im Sessel zurück. »Sie wollen also, dass ich mache, was Sie von mir verlangen. Das würde ich gerne, Frau de Chavannes, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Sie wissen, was genau Sie von mir verlangen wollen.«
»Bitte?«
»Sehen Sie, ich stell’s mir ungefähr so vor: Sie haben den Mann – Erdem oder Evren – irgendwo kennengelernt, im Fitness-Studio oder bei einer Vernissage oder so was. Er hat sich an Sie rangemacht, und Sie wurden ein bisschen neugierig. Vielleicht einfach nur so: Migrationshintergrund, Goldkettchen, ölige Haare – so jemanden treffen Sie nicht jeden Tag, wollten Sie sich mal anhören, was der zu sagen hat. Und als nicht nur der erwartete Angeberblödsinn kam – vermutlich war er witzig, charmant, ein bisschen frech, und auf jeden Fall konnte er Geschichten erzählen, die man am oberen Ende der Zeppelinallee eher selten hört –, jedenfalls da dachten Sie so was wie: Lad ich ihn doch mal zu ’ner Party ein, da werden Frau von Tüddelplüsch und Konsul Hoppelpopp mächtig staunen: Was die de Chavannes da wieder für ’ne Type aufgetrieben hat! Na [15] ja, alles lief glatt, Erdem oder Evren wurde die erhoffte originelle Partynummer, schäkerte mal mit der Tüddelplüsch, ließ sich mal von Hoppelpopp irgendwas erklären, was keinen Menschen interessiert, und erzählte verrückte Dinge von Kumpels, Frauen, Autos, der weiten Welt, ein bisschen was Schlüpfriges, ein bisschen was Orientalisches, bis…«
Ich hielt kurz inne. Bei Valerie de Chavannes bewegte sich nur noch die zu Boden fallende Zigarettenasche, und ihr Blick lag auf mir, als schaute mich der Fisch an, von dessen Haut ich gerade getrunken hatte.
»…Ihre Tochter nach Hause kam. In dem Alter sind Partys der Eltern normalerweise nichts, weshalb man nicht ausnahmsweise mal früh ins Bett geht, um für die eigenen Partys in den nächsten Tagen Kraft zu tanken. Aber dann sah Ihre Tochter Erdem oder Evren, und das war doch mal ein erfrischender Anblick auf einer der normalerweise so öden Veranstaltungen mit Tüddelplüschs und Hoppelpopps und Papas besoffenen Malerfreunden – und so weiter. Die Details mögen nicht stimmen, aber die Richtung, aus der Ihre Probleme kommen, dürfte das in etwa sein. Natürlich geht so die harmlose Variante. Es gibt auch eine ohne Party, ohne Ehemann…«
»Halten Sie den Mund!«
Ihre Zigarette war bis zum Filter runtergebrannt und erloschen. Trotzdem hielt sie den Stummel noch so, als würde sie rauchen.
»Ich nehme an, das ist der Grund, warum Sie nicht wollen, dass ich mit Mariekes Freunden spreche. Ich würde erfahren, dass Marieke mit einem Bekannten ihrer Mutter rumzieht. Marieke ist sechzehn, das darf sie, und wenn ihr [16] die Situation Spaß macht… Sie wäre nicht die erste pubertierende Tochter, die es ihrer Mutter zeigen will.«
Sie sah abwesend zu Boden. Der Zigarettenstummel fiel ihr aus der Hand, sie schien es nicht zu merken. Plötzlich hob sie den Kopf und fragte ungeduldig: »Und jetzt?«
»Und jetzt was?«
»Was schlagen Sie vor?« Ihre Stimme war hart und streng, aber das ging nicht gegen mich, das ging gegen sie selber.
»Sie meinen, was Sie von mir verlangen sollen?«
»Ich will, dass Sie mir meine Tochter zurückbringen!«
»Schon klar, Frau de Chavannes. Aber wie wär’s, Sie versuchen es erst mal damit, bei Erdem oder Evren…«
»Erden! Erden Abakay. Er wohnt über dem erwähnten Café, Schiffer-, Ecke Brückenstraße. Er ist dort ziemlich bekannt, Sie hätten ihn ohne weiteres gefunden.«
»Und dann?«
»Dann hätten Sie meine Tochter rausgeholt!«
»Und hätte ihr verschwiegen, dass Sie mich beauftragt haben?«
»Ja, selbstverständlich.«
»Und am besten Abakay verprügelt und gedroht, wenn er noch einmal in die Nähe von Marieke kommt – und so weiter?«
Sie antwortete nicht.
»Frau de Chavannes, ich bin Privatdetektiv, kein Schlägertrupp. Nochmal: Wie wär’s, Sie rufen erst mal bei Abakay an und versuchen, mit Ihrer Tochter zu sprechen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Unmöglich.«
»Warum?«
[17] »Weil ich Angst habe, etwas Falsches zu sagen, etwas, was sie noch mehr in die Arme dieses Scheißkerls treibt. Es braucht zurzeit nicht viel, damit meine Tochter findet, ich hätte etwas Falsches gesagt.«
»Und wenn Ihr Mann anruft?«
»Mein Mann?« Sie schaute mich an, als sei das eine erstaunlich dusselige Frage. »Den möchte ich da bestimmt nicht mit reinziehen.« Sie wandte sich ab und ging zurück zum Regal, um sich eine weitere Zigarette zu nehmen. »Außerdem ist er verreist. Er hat eine Gastprofessur an der Kunstakademie in Den Haag. Er ist erst in zwei Wochen wieder da.« Sie zündete sich die Zigarette an, drehte sich zu mir um und sagte bestimmt: »Bis dahin muss die Geschichte aus der Welt sein!«
»Okay, aber dann erzählen Sie mir bitte, wie die Geschichte ungefähr geht. Falls ich Abakay in die Quere komme, möchte ich keine umwerfenden Neuigkeiten erfahren. ›Frau de Chavannes ist die beste Freundin meiner Schwester‹ oder so was.«
»Unsinn. Es war in etwa so, wie Sie’s vermutet haben. Er hat mich im Café angesprochen, und ich wurde ein bisschen neugierig. Einer, der Frauen im Café anspricht, allein das, wo gibt’s denn so was heute noch? Und wahrscheinlich war mir an dem Morgen auch einfach langweilig. Wir haben geredet, und er war tatsächlich amüsant – also, auf so eine Nachtleben-Zocker-WaskostdieWelt-Art amüsant. Dazu behauptete er, Fotograf zu sein und dass er eine Serie mit dem Titel ›Frankfurt im Schatten der Bankentürme‹ gemacht habe. Porträts von Ganoven, Prostituierten, Hip-Hoppern…«
[18] Sie warf mir einen Blick zu. »Ich weiß, nicht sehr originell, aber…«
Sie suchte nach Worten.
Ich sagte: »Aber zusammen mit der Nachtleben-Zocker-WaskostdieWelt-Migrationshintergrund-Art…«
Sie betrachtete mich einen Moment, als kämen ihr erneut starke Zweifel, ob sie einem wie mir Einblick in ihr Leben geben sollte. Dann nahm sie einen Zug von der Zigarette, blies den Rauch, wie um die Zweifel zu verscheuchen, kräftig aus und fuhr fort: »Möglich. Vor allem habe ich an meinen Mann gedacht.«
»Klar.«
»Ich wusste, dass Sie das sagen.«
»Was soll man sonst sagen?«
»Hören Sie: Ich habe Ihnen am Anfang nicht die Wahrheit erzählt in der Hoffnung, die Angelegenheit ließe sich auch so lösen. Ich bin bekannt in der Stadt, mein Mann ist bekannt in der Welt, Sie sind, mir zumindest, ein völlig Unbekannter. Und Sie sind Privatdetektiv. Was weiß ich über Privatdetektive? Wenn ich nicht so dringend Hilfe bräuchte… Verstehen Sie? Warum sollte ich Ihnen trauen? Es gibt sicher Schmierblätter, die für eine Mutter-Tochter-Hasselbaink-Story um geheimnisvollen Underground-Fotografen ein paar Euro zahlen.«
»Kann sein, aber für ein paar Euro riskiert kein Privatdetektiv seinen Ruf. Unser Ruf ist sozusagen unser Geschäftsmodell – unser einziges.«
Während sie darüber nachdachte, schoben sich ihre gezupften Augenbrauen zusammen, und auf ihrer Stirn entstanden zwei kleine Falten. Es gefiel mir, dass sie kein [19] Botox spritzte. Vielleicht waren ja auch ihre Lippen echt. Ich hatte einmal aufgespritzte Lippen geküsst und gefunden, es sei, als schüttle man eine Handprothese.
Sie ging zurück zum Regal und drückte die Zigarette in einen Aschenbecher. »Ich kann Ihnen also vertrauen?«
»Ich verkaufe Ihre Geschichte keinem Schmierblatt, wenn Sie das meinen. Abgesehen davon denke ich, dass Sie die Wucht der Geschichte etwas überschätzen.«
»Kennen Sie sich in der Kunstwelt aus?«
»Ich weiß, dass Ihr Mann dort eine ziemlich große Nummer ist. Gesichter ohne Augen, nicht wahr?«
»Das ist eine seiner berühmten Serien, ja. ›Die Blinden von Babylon‹.«
»Ich habe Ihren Mann gegoogelt. Internationale Preise und so weiter. Trotzdem: Die Sorte Schmierblätter, die Sie im Sinn haben, versuchen ihre Leser nicht mit Leuten zu unterhalten, die Serien malen, die ›Die Blinden von Babylon‹ heißen. Sagen Sie mir bitte, was Sie damit meinten: Sie hätten vor allem an Ihren Mann gedacht?«
»Werden Sie mir ab jetzt glauben, was ich Ihnen erzähle?«
»Kommt drauf an, was Sie mir erzählen.« Ich grinste fröhlich. »Spucken Sie’s einfach aus. Oder möchten Sie es sich lieber noch mal überlegen, ob Sie mich engagieren wollen?«
»Ich möchte…« Sie zögerte, und einen Augenblick sah es so aus, als unterdrückte sie Tränen. Sie sah zu Boden und verschränkte fröstelnd die nackten Arme. Dabei schob sich das gelbe T-Shirt noch weiter den straffen Bauch hoch, und ich glaubte, trotz der fünfzehn Meter Abstand einen [20] Schlangenkopf zu erkennen. Gerne hätte ich erfahren, in welchem Moment ihres Lebens sie den Entschluss gefasst hatte: So, ich geh jetzt ins Tattoo-Studio und lass mir eine Schlange stechen, die mir zwischen den Beinen hervorkriecht. Und was ihre Eltern, Madame und Monsieur de Chavannes, Adlige aus Lyon, davon gehalten hatten. (Ich ging davon aus, dass man sich ein Schlangentattoo eher in einem Alter stechen ließ, in dem das Urteil der Eltern noch eine Rolle spielte.) Laut Google lebten sie, seit Georges de Chavannes seinen Posten bei Magnon & Koch, einer Privatbank für Vermögensverwaltung, aufgegeben hatte, in einem kleinen Schloss an der Loire und stellten eigenen Wein her. Ob sie manchmal abends bei einer Flasche auf der Terrasse saßen, den Sonnenuntergang betrachteten, ihren Gedanken nachhingen, und irgendwann fragte Bernadette de Chavannes in die Vogelzwitscher-Grillenzirpen-Gläserklirren-Ruhe: »Glaubst du, Valerie hat immer noch dieses terrible…?«
»Bitte, chérie! Lass uns den Abend genießen.«
Und was dachte Edgar Hasselbaink über die Schlange? Oder entsprang sie womöglich einem Entwurf von ihm? Und Marieke? Wie lief das auf dem Schulhof? Die Jungs: Hey, Marieke, ich hab auch ’ne Schlange da unten, die würde ich gerne mal der Schlange von deiner Mama vorstellen!
»Mein Mann hat Frankfurt schon immer furchtbar gefunden: langweilig, provinziell, unkultiviert. Würstchen, Aktien, Bankerschnösel, und das Lieblingsgetränk der Einheimischen sei ein Abführmittel, sagt Edgar. Vor zehn Jahren kamen wir aus Paris hierher. Paris war uns zu teuer [21] geworden, und sowieso wollten wir wegen Marieke irgendwohin, wo es weniger Autoabgase und mehr Grün gab. Da boten uns meine Eltern das Haus hier an. Mein Vater hat über zwanzig Jahre die Frankfurter Niederlassung von Magnon & Koch geleitet. Als er in Rente ging, wollten meine Eltern zurück nach Frankreich.«
»Verzeihung, aber wenn Sie das Haus verkaufen – mit dem Geld, das Sie dafür kriegen, können Sie sich doch fast jeden Wohnort der Welt leisten.«
»Wenn ich sagte, meine Eltern boten mir das Haus an, meinte ich nicht, dass sie es mir geschenkt haben. Wir zahlen sogar Miete, wenn auch eine verhältnismäßig niedrige – das Symbol war meinen Eltern wichtig.«
Sie machte eine Pause, ging zu einem mit grauem Cord bezogenen Sofa von der Größe meines Gästezimmers und nahm eine weiße Strickjacke von der Lehne. Während sie sich die Jacke um die Schultern legte, sagte sie: »Meine Eltern und ich haben es nicht immer leicht miteinander.«
»Sind Sie als Kind in dem Haus hier aufgewachsen?«
»Ja. Ich war sieben, als meine Eltern nach Frankfurt zogen, und bis sechzehn habe ich hier gewohnt. Jedenfalls: Wir haben gedacht, es sei nur für den Übergang, bis wir uns entschieden haben, wo wir leben wollen. Aber dann… Die Bilder meines Mannes begannen, sich schlechter zu verkaufen, gleichzeitig gewöhnten wir uns an die Größe und den Komfort des Hauses, Marieke machte Frankfurt zu ihrer Heimat und so weiter – viele, zum Teil gute Gründe, warum wir immer noch hier sind. Mein Mann allerdings hat seine Meinung über Frankfurt und besonders dieses Viertel hier nie geändert. Sehen Sie, er ist in Amsterdam aufgewachsen, [22] hat in New York gelebt, Barcelona, Paris – in den schäbigen Gegenden, nicht dass Sie denken, er vermisse irgendwelchen Glamour. In Amsterdam, als er noch Medizin studiert hat, im Studentenwohnheim, später oft in ungeheizten Ateliers, und in Paris hatten wir ein Vier-Zimmer-Souterrain-Appartement in Belleville. Was er vermisst, ist das Leben, sind die Überraschungen. Das einzig Überraschende, das einem hier auf der Straße passieren kann, ist, dass eine der Pelzmantel-Zicken mit ihren ondulierten Hunden einem freundlich guten Tag sagt.«
Valerie de Chavannes setzte sich zurück in den Art-Cologne-Sessel mir gegenüber, und ich fragte mich, wie viele Pelzmäntel sie wohl im Schrank hängen hatte. Oder bedeuteten die Mietzahlungen an die Eltern, dass an finanzieller Unterstützung aus dem Loire-Schlösschen gar nichts floss? Aber wer bezahlte die Haushälterin, die Luxusmöbel, das funkelnde Rennrad im Eingangsflur?
»Und da versuchten Sie mit Abakay ein bisschen vom vermissten Leben in die Bude zu bringen? »
»Er war nicht der Erste. Immer wenn ich jemanden treffe, von dem ich glaube, er könnte Edgar interessieren, bringe ich ihn mit nach Hause. Verstehen Sie? Ich würde mir so sehr wünschen, dass Edgar Frankfurt ein bisschen Spaß macht. Und ich dachte: Abakay, das ist auf jeden Fall nicht Würstchen und Aktien. Ich habe ihn also zum Abendessen eingeladen, und es ging gründlich schief. Edgar fand, er sei ein aufgeblasener Schwätzer, und Marieke hat sich bei einer sinnlosen Diskussion über die Freiheit der Kunst auf Abakays Seite geschlagen. Natürlich nur, um uns eins auszuwischen…«
[23] Plötzlich schien ihr etwas Unangenehmes einzufallen. Oder besser: etwas im Moment Unpassendes, etwas, das mit mir zu tun hatte. Einen Augenblick schaute sie mich an, als sei ihr gerade aufgegangen, dass ich genauso aussah wie irgendein Schweinehund aus ihrer Vergangenheit: ein aus dem Mund stinkender Lehrer, der sie beim Nachhilfeunterricht betatscht, oder ein Exfreund, der sich mit ihrem Schmuck davongemacht hatte, etwas in der Richtung.
Sie senkte den Blick und begann, ihre Hände zu massieren. »Jetzt wissen Sie, was ich meinte, als ich sagte, dass ich vor allem an meinen Mann gedacht habe.«
»Hmm. Eine Diskussion über die Freiheit der Kunst? Um was ging’s da?«
Sie zögerte, schaute kurz hoch, dann wieder auf ihre Hände. Sie massierte ruhig und gleichmäßig. Überhaupt war sie gut darin, Ruhe und Gleichmäßigkeit vorzuführen, manchmal auch Wut und Verachtung, nur hin und wieder verrutschte die Maske, und dahinter, so kam es mir vor, zitterte Valerie de Chavannes vor Angst.
»Um diese blöden Karikaturen.«
Ich ahnte, was sie meinte. »Keinen Schimmer, wovon Sie reden.«
»Na, von den Mohammed-Karikaturen. Das Theater damals – wie lange ist das jetzt her, drei oder vier Jahre? – haben Sie ja wohl mitgekriegt?«
Diesmal blieb ihr Blick auf mich gerichtet, und ihre Miene schwankte zwischen Sorge und Missmut: Trat sie einem Kerl namens Kemal Kayankaya mit dem Thema auf den Schlips, oder war der Privatdetektiv, der ihr im Laufe des Gesprächs schließlich einen einigermaßen zivilisierten [24] Eindruck gemacht hatte, am Ende doch nur eine bildungsferne Nulpe?
»Verstehe. Ja, habe ich mitgekriegt. Welche Position vertrat Abakay?«
»Nun… Es ging ihm wohl weniger um sich – Abakay ist bestimmt kein besonders Gottgläubiger –, sondern ganz allgemein um Respekt gegenüber Religionen. Irgendein Verwandter, ich glaube sein Onkel, ist Geistlicher in einer Frankfurter Moschee.«
»Ist Marieke anfällig für solches Zeug?« Ich sah auf den Glastisch zu den Fotos mit dem streng blickenden Mädchen.
»Sie meinen Religionen?«
Ich nickte. »Vielleicht ist sie gar nicht mit Abakay weg, sondern mit dem lieben Gott?«
»Nein, nein, sie…« Valerie de Chavannes schüttelte den Kopf, sah verzweifelt zur Zimmerdecke, wo ihr Blick kurz verharrte, als erschienen ihr dort die Bilder des verpatzten Abends. »Es war nur wegen uns oder vielleicht auch nur wegen meinem Mann. Sehen Sie, wir sind aufgeklärte, moderne Menschen, Religion hat bei uns und für Marieke nie eine Rolle gespielt. An dem Abend hat sie einfach gespürt, dass sie ihren Vater zur Weißglut bringen konnte. Edgar ist, wenn’s auf das Thema kommt, lautstarker Atheist, er hasst jede Form von Religion. Und da fängt seine Tochter plötzlich an, den Schleier als Kulturerbe, orientalisches Modeaccessoire, Möglichkeit der Frau, sich vor den Blicken der Männer zu schützen, und was nicht noch alles zu verteidigen. Sogar Abakay hat ihr widersprochen, sich vielleicht insgeheim eins gegrinst, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es war [25] einfach nur sinnlos. Edgar liebt Marieke über alles, und zurzeit versucht sie, sich von dieser Liebe zu befreien.« Valerie de Chavannes machte eine Pause, und es war offensichtlich, dass sie überlegte, ob sie mir etwas anvertrauen sollte. »Sie haben vorhin bemerkt, dass ich es mit den Namen der Freunde meiner Tochter wohl nicht so hätte. Im Vergleich zu Edgar haben Sie fraglos recht: Er kann Ihnen wahrscheinlich jeden Freund Mariekes seit der Grundschule mit Vor- und Nachnamen aufzählen. Haben Sie Kinder?«
Die Frage kam überraschend, und ich dachte an Deborah, wie sie zwei Tage zuvor beim »Aperitif« (die Bezeichnung hatte Deborah eingeführt, ich wäre beim »Ich trink noch zwei Bier vorm Essen« geblieben) über ihren Kinderwunsch gesprochen hatte.
»Nein.«
»Die Liebe zu ihnen kann ziemlich monströs werden. Ich hoffe, Ihnen ist klar, wie wichtig es ist, dass Edgar auf keinen Fall erfährt, dass Marieke bei Abakay war. Er würde es ihr nie verzeihen.«
»Würde er es nicht eher Ihnen nie verzeihen?«
Valerie de Chavannes sah mich unverwandt an. Langsam schloss sich ihr Mund, und der Ich-denke-immer-nur-ans-eine-Blick war wieder da. Tatsächlich wohl einfach nur ein Blick herab und zwar auf Männer, von denen sie annahm, dass sie bei ihr immer nur ans eine dachten.
Nach einer Pause sagte sie: »Sie hätten’s gerne ein bisschen üblicher, ein bisschen schäbiger, hm? Oder können Sie sich nur einfach nicht vorstellen, dass eine Frau wie ich – Schlangentattoo und so weiter – nicht mit jedem halbwegs attraktiven Typen gleich ins Bett springt? Von mir aus – [26] aber dass Sie denken, ich wäre so blöd, den Typen zu mir nach Hause zum Abendessen einzuladen, empfinde ich als echte Beleidigung. Nebenbei und falls es Sie interessiert: Mein Mann und ich führen eine glückliche Ehe.«