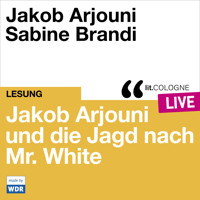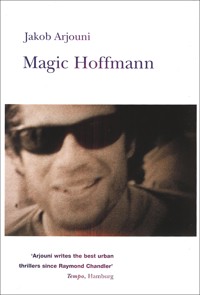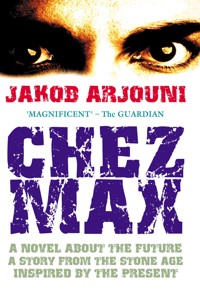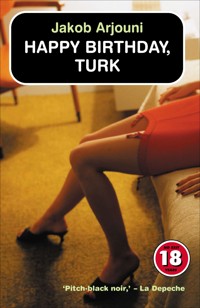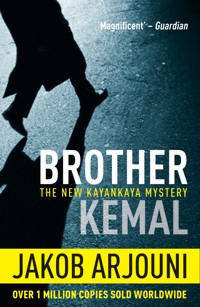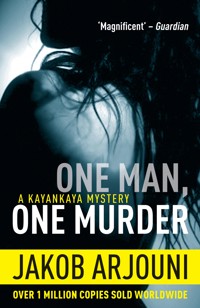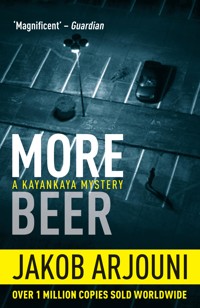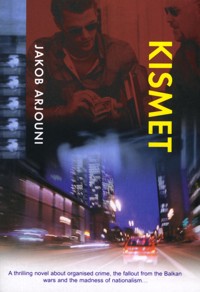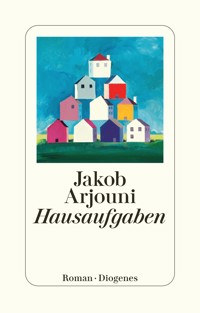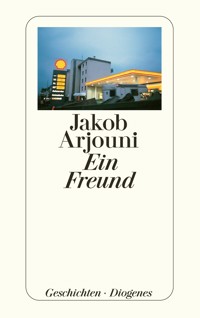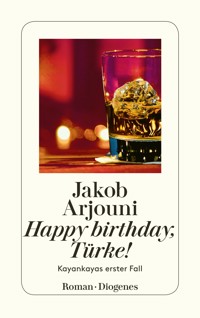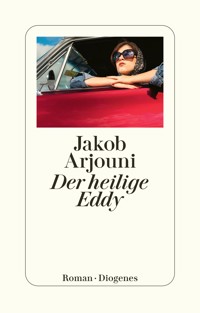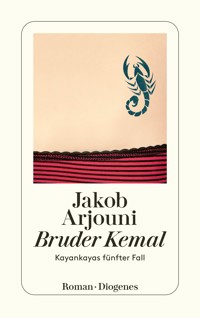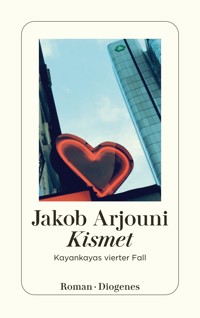9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fred, Nickel und Annette träumen einen Traum, und der trägt den Namen ›Kanada‹. Dort könnte man leben, wie man will, fischen und fotografieren, weit weg vom Muff der Provinz. Doch von Dieburg nach Vancouver kommt man nicht ohne Umweg. Für Fred führt dieser über den Knast in das Berlin nach dem Mauerfall, wo er Nickel, Annette und sein Geld abholen will. So war's besprochen – doch ›the times they are a-changin'‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jakob Arjouni
Magic Hoffmann
Roman
Die Erstausgabe erschien 1996
im Diogenes Verlag
Umschlagfoto: Sophie Rois, Schauspielerin
Foto von Ute Mahler (1996)
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22951 6 (14. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60004 9
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Autorenbiographie
Mehr Informationen
[5] 1
Die Tausendmarkscheine flatterten wie Schwalben am Himmel und drehten im Schwarm ein paar Kreise gegen die untergehende Abendsonne. Als Fred auf zwei Fingern pfiff, kamen sie und schlüpften zurück in seine Hosentasche …
»Ich find’s Schwachsinn!« sagte Nickel und riß Fred aus seinen Träumen.
Sie lagen im Gras, zwischen ihnen ein Kasten Apfelwein, die Sonne schien.
Mit geschlossenen Augen brummte Fred: »Wir könnten unsere Schulden zahlen und nach Kanada – das willst du doch die ganze Zeit.« Er schlug die Augen auf und blinzelte gegen den blauen Himmel. »Und alles für ’ne halbe Stunde … Arbeit.«
Nickel lag seitlich auf den Ellbogen gestützt und sah über Felder und Weiden aufs Dorf hinunter. Dreißig Meter weiter stand Annette am Zaun, streichelte ein Kalb und flößte ihm Apfelwein ein. Dem Kalb schien es zu schmecken. Die anderen Kühe verfolgten das Geschehen neugierig.
»Könntest dir das Dingsda kaufen«, sagte Fred, »das Fotogerät, das … na, du weißt schon …«
»Das Objektiv.«
»… Genau! Und noch ’n Haufen Sachen. ’ne ganze Ausrüstung. Machst tolle Fotos von kanadischen Wäldern und Eishockeyspielern und was es dort sonst noch so gibt, wirst [6] berühmt, und in zwanzig Jahren fragt keiner mehr, ob du mal in Oberroden ’ne Bank ausgeraubt hast.«
»Tolle Fotos … Vom Knast vielleicht.«
Nickel trank seinen Wein aus, stellte die leere Flasche zurück in den Kasten und angelte sich die nächste. Seine Bewegungen waren wie immer präzise und deutlich, als wollte er ein für allemal zeigen, wie Apfelweinflasche zurückstellen und neue nehmen auszusehen hat.
»Mit Rumhocken und am Wochenende Kellnern kommen wir jedenfalls kaum nach Kanada.«
Fred nahm sich ebenfalls eine Flasche. Das Kalb hatte die erste intus, und Annette setzte die zweite an.
»Und du«, fragte Nickel, »was willst du mit dem Geld?«
»Vermutlich wird auch in Kanada Essen und Trinken ’n paar Pfennige kosten.«
»Zweihunderttausend Mark sind eine Menge Pfennige.«
Fred zuckte die Schultern. »Mir reicht’s, das Geld einfach nur zu haben.«
»Und dann?«
»Nichts dann.«
»Versteh ich nicht.«
»Von reichen Berühmtheiten hört man in Interviews doch immer, Geld wär ihnen egal, aber sie würden’s zum Leben brauchen. Bei mir ist es umgekehrt: Zum Leben brauch ich nicht viel, aber ich hab’s gern. Im Schrank oder unterm Bett. Ich faß es gerne an, zähl’s, schau aufs Datum …«, er trank einen Schluck, »… abgesehen davon brauchen wir ja wohl was zum Wohnen, ’n Jeep, Bärenfallen und so was.«
»Bärenfallen …!«
[7] Nickel lachte. Doch im selben Moment überlief ihn bei der Vorstellung, wie sie zu dritt in Kanada wären, ein sehnsüchtiger Schauer. Vancouver, ein Haus am Meer, endlose Wälder, Fotos für internationale Magazine …
Annette kam mit leeren Flaschen im Arm zurück. Sie trug ein rotes Sommerkleid mit gelben Tupfern und sah gegen die grüne Wiese wie eine große Blume aus. Eine leicht torkelnde Blume. Sie warf die Flaschen ins Gras und sich daneben. »Also?« fragte sie und sah von einem zum anderen.
»Möcht mal wissen«, brummte Nickel, »warum ausgerechnet ihr, ausgerechnet in Dieburg, ausgerechnet jetzt, den perfekten Banküberfall erfunden haben wollt. Immerhin probieren die Leute den schon seit Jahrhunderten.«
»Wenn Einstein so gedacht hätte, wäre er Kartoffelbauer geworden«, sagte Annette schnippisch, schloß die Augen und wandte ihr Gesicht genießerisch der Sonne zu. »Sobald ich richtig Englisch kann, geh ich in Kanada auf die Schauspielschule.«
Sie tranken Apfelwein und schmiedeten Pläne. Die Pläne wurden größer und bunter, der Banküberfall kleiner und einfacher, der Apfelweinkasten leerer. Während sie lachend zusahen, wie das Kalb über die Weide wankte und immer ausgelassener vor sich hin muhte, war Nickel irgendwann überzeugt: Ihnen gehörte die Welt, und der Welt gehörte die Bank!
Als Fred abends nach Hause kam und sich an den Tisch setzte, sagte Oma Ranunkel, während sie Kohlrouladen und Kartoffeln auftat: »Du siehst aus wie dein Vater, wenn er was im Schilde führte.«
[8] Sie trug ihr grün-gelb gestreiftes Kleid, eine dunkle Schürze und die hundertmal gestopfte braune Strickjacke. Ihre grauen Haare waren wie immer streng nach hinten gekämmt und zu einem Knoten hochgesteckt.
»Ich hab Arbeit gefunden, Oma.«
»So?« Nicht sehr überzeugt.
Fred nickte. »Und was für eine: Spezialistenjob!«
Oma Ranunkel ließ den Löffel sinken, und ihre Augen hinter den dicken Brillengläsern betrachteten ihn skeptisch. »… Spezialist? Für was?«
»Für …weißt du, es gibt noch keinen richtigen Begriff dafür. Ich würd’s nennen …«, er überlegte, »… im Lotto gewinnen, aber ohne Lotto.«
»Bitte …?!«
»Na ja …«, er schaute auf die dampfende Roulade vor sich, »… jemand träumt davon, Rockstar zu werden oder ’ne Weltreise zu machen. Nickel zum Beispiel würde gerne nach Kanada gehen und Fotograf werden, aber insgeheim glaubt er zu wissen, daß er’s nie wirklich machen wird, und dann komm ich!«
Oma Ranunkel runzelte die Stirn. »Und?«
»Ich entwickle den Leuten Strategien, wie sie’s wenigstens versuchen können«, und lässig fügte er hinzu, »gegen Bezahlung natürlich.«
Oma Ranunkels Gesicht bekam etwas Mitleidiges.
»Wer würde für so was Geld ausgeben?«
»Wirst sehen, nächsten Freitag hab ich meine erste Beratung, und von dem Honorar gehen wir beide ganz groß …«
»Aber«, unterbrach sie, »wer hat dich denn wo eingestellt?«
[9] »Das läuft über Anzeige, erklär ich dir später.«
Kopfschüttelnd setzte sich Oma Ranunkel ihm gegenüber an den Tisch. »Kind, Kind, was ist das nur wieder für ein Unsinn!«
»Mach dir keine Sorgen, Oma, das is ’n Job für die Zukunft …«
Vier Jahre später wurde Fred aus der Jugendvollzugsanstalt Dieburg entlassen.
[10] 2
Weiße Turnschuhe, knöchelhoch, mit schwarzen Streifen. Ob man so was heute noch trug? Fred zog die Schnürsenkel fest und machte einen Knoten. Draußen gingen die anderen zur Werkstatt. Manche klopften gegen die Tür.
»Mach’s gut, Magic!«
»Worauf ihr euch verlassen könnt!«
Fred hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan. Übermüdet und euphorisch wie er war, kam ihm das Leben an diesem Morgen cowboyeinfach vor. Vier Jahre abgerissen, Tasche packen, Sonnenaufgang. Jetzt konnte ihm niemand mehr was! Und wenn die Schuhe außer Mode waren, würde er sie eben wieder in Mode bringen. Wäre schließlich nicht das erste Mal. Früher im Dance 2000 …
Er schloß den Reißverschluß des blauen Overalls und betrachtete sich im Spiegel. Das breite, kantige Kinn, auf dem kein richtiger Bart wachsen wollte, die heraustretenden, immer leicht verdutzt wirkenden Augen, die abstehenden Ohren und die halblangen, dunkelblonden Haare, die er sich seit seinem vierzehnten Lebensjahr selber schnitt: Er nahm sie auf der Kopfmitte in die Faust und stutzte, was überstand. Er war der alte geblieben – keine Frage. Und er war stolz drauf. Sie hatten ihn nicht kleingekriegt. Weder Sozialisierungsversuche von oben noch kriminelle Mitmach-Angebote von unten hatten ihm etwas anhaben können. Das Gefängnis war nur ein Wartezimmer gewesen, in dem er die [11] meiste Zeit mit geschlossenen Augen gesessen und sich die Ohren zugehalten hatte.
Die anfängliche Bewunderung seiner Mitgefangenen für den geschickt gemachten Banküberfall und Freds Weigerung vor Gericht, seine Kumpel zu verraten, war schnell der Gleichgültigkeit gewichen gegenüber einem, der sich aus allem raushielt und sich für nichts zu interessieren schien, außer für Fischfang und Blockhüttenbau. Einige hielten ihn für dumm, andere für ein Großmaul, manche für beides. Tatsächlich war Fred dumm ebenso wie klug. Sagenhafte Einfalt wechselte sich mit überraschender Schlauheit ab. So hatte er sehr schnell begriffen, welche Wärter er für sich gewinnen mußte, um in Ruhe gelassen zu werden, war aber lange Zeit nicht dahintergekommen, warum sein eigentlich sehr friedlicher Zellennachbar ihn in der Turnhalle immer wieder zum Ringkampf herausforderte, obwohl Fred viel kräftiger war. Einmal hatte Fred ihn zum Spaß gewinnen lassen und zum ersten Mal unter ihm liegend einen spitzen Druck am Bauchnabel verspürt. Was Fred nicht interessierte, kapierte er auch nicht, und dabei wurde er zum »Großmaul«. Denn Nichtkapieren tat er nicht still und heimlich, sondern laut und anmaßend, mit fliegenden Fahnen. So erklärte er den Jungs in der Gefängnisschreinerei, die alle besser waren als er: Sich mit Schwalbenschwanzverzinkungen und Furnier das Hirn zu verstopfen mache nur für Idioten Sinn. Nicht von ungefähr hatten sich seine Kontakte zu den Mitgefangenen bald auf Tischfußball und den Austausch von Sexheften beschränkt. Außerdem mochte Fred den Jammer oder die Wut der anderen nicht – im Knast durfte man keine traurige Figur abgeben, fand er. Frei, reich und [12] gesund, da konnte man schon mal heulen. Aber gefangen, von Wärtern tyrannisiert, ohne Frauen und dann auch noch unglücklich …?!
Fred fuhr sich durch die Haare: Mit den Heften war es nun endlich vorbei! Er war nicht schön, hatte aber früher mit mehr oder weniger bewußt angewandtem Trottel-Charme und unbekümmerter Art jede Menge Erfolg bei Mädchen gehabt. Warum sollte es inzwischen anders sein? … Gleich würde er entlassen, würde er Blusen, Röcke, Hintern und Beine sehen, würde das Leben wieder anfangen – so wie es früher gewesen war, nur mit zweihunderttausend Mark anstatt Pfennigen in der Tasche!
Fred schloß den Koffer, hockte sich auf die Bettkante und rauchte eine letzte Zigarette.
Wenig später holte ihn der Gefängniswärter und brachte ihn zum Tor. Durch die Gegensprechanlage informierte der Wärter den Wachmann: »Fred Hoffmann zur Entlassung.«
Die erste Lage Stahl schob sich beiseite, und sie gingen in die Schleuse. Der Wachmann beäugte sie prüfend durchs Panzerglas, dann drückte er einen Knopf, und die zweite Lage öffnete sich.
»Viel Glück, Hoffmann.«
»Thanks, aber jetzt brauch ich keins mehr.«
»Gerade jetzt.«
Fred schüttelte den Kopf. »I have friends.« Und money, dachte er, aber das konnte er natürlich nicht sagen.
Der Wärter seufzte. »Und gewöhn dir das alberne Englisch ab. Damit hält dich jeder für schwachsinnig, und du kriegst nie ’ne Arbeit.«
»Im Gegenteil«, sagte Fred, »wo ich hingehe, krieg ich [13] nur Arbeit, wenn ich englisch spreche – falls ich überhaupt welche will, Mister.«
Sie gaben sich die Hand, und Fred trat auf die sonnenüberflutete, leere Straße. Hinter ihm schloß sich das Tor. Es dauerte einen Moment, bis er sich ans Licht gewöhnte. Gegenüber stand ein Kiosk, dahinter waren helle Wohnhäuser mit offenen Fenstern und bunt leuchtenden Blumenkästen. Es roch nach Flieder, und die Bäume längs der Straße waren grün. Blätter raschelten im Wind, Vögel zwitscherten, sonst war es still. Wenn das kein Frühlingstag, wenn das kein Anfang war, dachte Fred, what a wonderful world!
Er stellte den Koffer ab und zog die Jacke aus. Außer dem Kioskverkäufer war weit und breit kein Mensch zu sehen. Auf die Postkarten hatte er geschrieben: zwischen zehn und elf. Auf seiner Uhr war es kurz vor elf.
Er nahm den Koffer und schlenderte zum Kiosk. Der Verkäufer, ein Mann um die Vierzig mit schütterem Haar, döste über einer Zeitung.
»Morning!«
Der Verkäufer fuhr auf. »… Oh! Morgen.«
Fred lachte. »Frühjahrsmüdigkeit, was?!«
»Mhmhm. Was wünschen Sie?«
»Eine Flasche Sekt, und zwar vom besten!«
Seit seiner Verhaftung hatte Fred, bis auf heimlich in Zellennischen gebrannte Blindmacher, keinen Alkohol mehr getrunken. Eine lange Zeit für einen, dem er in jeder halbwegs genießbaren Form schmeckte.
»Vom besten?«, der Verkäufer kratzte sich am Kinn, »Faber?«
»Ist das Ihr bester?«
[14] »Wenn man so will, ja, der einzige.«
Während der Verkäufer zur Kühltruhe schlurfte, sah Fred erneut links und rechts die Straße runter.
»Wieviel Uhr ist es?«
Der Verkäufer stellte die Flasche ab und sah auf seine Armbanduhr.
»Kurz nach halb zwölf.«
»Muß meine wohl stehengeblieben sein …«
»Möchten Sie ’n Becher?«
Anstatt zu antworten, klopfte Fred aufs Zifferblatt. Der Verkäufer gähnte. »Nicht mehr ’s neuste Modell, hm?«
Fred sah auf und starrte den Verkäufer einen Moment lang ausdruckslos an. Dann wandte er sich wieder der Uhr zu. Der Verkäufer hob die Augenbrauen. Wie empfindlich die jungen Leute heutzutage in Modefragen waren! Freundlich fragte er: »Also ’n Becher?«
»Für Sie auch einen.«
»Für mich?«
Nickend zog Fred die Uhr vom Arm und warf sie in den Kiosk-Mülleimer. »Gibt was zu feiern!«
Der Verkäufer wollte schon den Kopf schütteln, als sein Blick auf Freds Koffer fiel. Er hatte den Kiosk gegenüber vom Gefängnistor lange genug, um zu wissen, was kleine schäbige Koffer hier zu bedeuten hatten. Ein Jugendknast, keine wirklich schweren Jungs, keine, die es einfach wegsteckten, nach Jahren plötzlich wieder auf der anderen Seite der Mauer zu stehen. Viele wollten dann mit ihm einen trinken, und meistens tat er ihnen den Gefallen. Wieder schlurfte er nach hinten, holte zwei Plastikbecher.
»Aber nur zum Anstoßen.«
[15] Fred lachte. »Sure, und wie oft wir anstoßen, werden wir dann ja sehen.«
Den ersten Becher stürzte er in einem Zug runter und schloß kurz die Augen. »What a feeling!«
Danach tranken sie stumm. Fred beobachtete die Straße, und der Verkäufer musterte ihn. Dämliche Augen, dachte er, wie sie so herausglupschten. Andererseits hatte noch keiner der Jungs bei seiner ersten Flasche in Freiheit einen so bestimmten und zielstrebigen Blick gehabt. Keine Neugierde, keine Unsicherheit, nichts. Als hätte er für einen Boxkampf trainiert, zu dem jeden Moment der Gong ertönen konnte.
Tatsächlich war in Freds Kopf alles fast auf die Minute vorbereitet: Wiedersehen mit Annette und Nickel, dann ins Clash, später ins Dance 2000, er mit irgendeiner Frau, und am nächsten Morgen Kanada-Besprechung. Wenn das Gefängnis zu irgend etwas taugte, dann als eine Art höhere Schule fürs Pläneschmieden, und die hatte Fred mit Eins abgeschlossen.
Ein junges Paar bog in die Straße ein und kam schnell näher. Sie blond und rundlich, er dunkelhaarig und groß. Beide trugen etwas unterm Arm und schienen es eilig zu haben. Annette und Nickel, kein Zweifel. Fred wandte sich abrupt dem Verkäufer zu und griff nach der Flasche. »Trinken wir noch einen.« Sie sollten ihn nicht warten sehen.
»Danke, ich nicht mehr.«
Der Verkäufer leerte seinen Becher und warf ihn in den Müll. Als er danach aufsah, fuhr er leicht zusammen. Wieder starrte der junge Mann ihn an. Diesmal erinnerte ihn der Blick an die Verrückten vom Johanniterheim draußen am Wald.
[16] »Ich muß noch arbeiten.«
»Dann reden wir …!«
Fred beugte sich vor und begann unvermittelt von einem Landstreicher zu sprechen, den ganz Dieburg kannte, und der, obwohl schon seit Jahren nicht mehr gesehen, immer wieder in Anekdoten auftauchte, die sich die Dieburger wie Witze erzählten. Je näher das Paar kam, desto lauter sprach Fred und desto wilder wurde die Geschichte. Dann war das Paar fast am Kiosk angelangt, und Fred drehte sich, während er weitersprach, wie zufällig um, die Straße, die Bäume und nebenbei auch die beiden jungen Leute anstrahlend … Doch es waren die falschen. Mit Waschmittelkartons, Katzenstreutüten und Windeln bepackt, gingen sie, mit einem kurzen Blick Richtung Kiosk, vorbei.
Fred verstummte.
»Und dann«, fragte der Verkäufer, »was hat er mit der Leiter gemacht?«
»Mit der Leiter?« Fred schaute abwesend. Die Schritte des Paares wurden leiser, bis sie im nächsten Hauseingang verschwanden.
»Wieviel Uhr ist es jetzt?«
»Viertel vor zwölf.«
Fred leerte den Becher und schenkte sich nach, den Blick auf die Straßenecke, hinter der das Paar aufgetaucht war, geheftet. Der Verkäufer wartete noch einen Moment, dann zuckte er mit den Achseln, setzte sich zurück auf seinen Stuhl und schlug eine Illustrierte auf.
»… Hat sie erst mal versteckt«, sagte Fred nach einer Weile, »da ist sie feucht und morsch geworden, und am Ende konnte er sie wegschmeißen. Woran man mal wieder sieht«, [17] er gab sich Mühe, lässig zu grinsen, »Verbrechen lohnt sich nicht … Wieviel kriegen Sie?«
Der Verkäufer nannte den Preis, und Fred zog eine Rolle Geldscheine in einem Gummiband aus der Tasche. Hatte er im Fernsehen gesehen. Er löste das Gummi, legte einen Zwanzigmarkschein auf die Theke, ließ das Gummi zurückschnappen und nickte. »Stimmt so. Wenn Sie heute vorm Tor da drüben zwei warten sehen, könnten Sie ihnen bitte ausrichten, Fred feiert heute abend im Clash?«
Der Verkäufer meinte, er würde versuchen, ein Auge drauf zu haben. Fred nahm seinen Koffer auf, tippte sich an die Stirn, »Bye-bye«, und schlenderte die Straße hinunter. Ein warmer Wind streichelte ihm über den Nacken.
Nein, er war nicht wütend. Ein bißchen irritiert, aber nicht wütend. Vielleicht hatten Annette und Nickel den Zug verpaßt. Kein Grund zur Sorge. Jeder kam mal zu spät …
Im Anpassen an veränderte Umstände war Fred fast noch besser als im Schmieden unumstößlicher Pläne.
Oma Ranunkels kleines weißes Haus stand am Waldrand zwischen einer stillgelegten Vlieseline-Fabrik und einer Baumschule. Der Wald leuchtete im ersten hellen Grün, und einige Äste überwucherten Dach und Mauern. Ein Zeichen, daß das Haus schon seit längerem nicht mehr bewohnt war. Ungestutzte Äste waren in Dieburg nicht üblich.
Innen schlug Fred abgestandene, muffige Luft entgegen. Die Zimmer waren dunkel, der Strom abgestellt. Fred tastete sich durchs Wohnzimmer. Als er die Rolläden hochzog und die Fenster öffnete, erschienen billige Fünfziger-Jahre-Möbel unter dicken Staubschichten. Er blieb einen [18] Moment stehen und sah sich um … Da war er also wieder! Doch der Anblick der vertrauten Gegenstände rührte ihn nicht, oder besser gesagt, ließ er es nicht zu. Er würde ein neues Leben beginnen, und darin hatte dieses Haus keinen Platz. Er würde es verkaufen. Auch das hatte er schon lange geplant.
Er ging in die Küche, schaute in Schränke und Schubladen und durchstöberte die Speisekammer. Dann nahm er sich die anderen Zimmer vor, bis er in Oma Ranunkels Nachttisch eine angebrochene Flasche Dujardin fand. Er setzte sich mit ihr ans offene Küchenfenster und hielt Ausschau, ob Annette und Nickel die Straße entlangkamen.
Und wenn er die Postkarten zu spät abgeschickt hatte? Oder wenn Annette und Nickel erneut umgezogen waren?
Er trank, bis er einen Schwips hatte. Gegen vier verließ er das Haus und ging zur nächsten Telefonzelle.
Aus Vorsicht hatte er mit Annette und Nickel seit seiner Verhaftung weder telefoniert, noch hatten sie ihn im Gefängnis besucht. Aus den wenigen, bewußt belanglosen Briefen Annettes war hervorgegangen, daß sie sich von Nickel getrennt hatte und von ihm weggezogen war. Die neue Adresse hatte sie Fred zwar dazugeschrieben, doch der letzte Brief war ohne Absender gewesen und hatte einen weiteren Umzug angekündigt. Von Nickel, dem Ängstlichsten von ihnen, waren ohnehin immer nur Postkarten ohne Nachnamen gekommen. Kein Wort über Dieburg, geschweige denn über Annette – die Postprüfer vom Gefängnis mußten Nickels Karten für Routinegrüße eines entfernten Verwandten gehalten haben.
Trotzdem: Es war abgemacht, daß er ihnen Karten [19] schickte, sobald er seinen Entlassungstermin wüßte, und daß sie ihn abholten, und es war egal, wie lange die Abmachung her war, sie blieb eine Abmachung, und es hätte an Annette und Nickel gelegen, dafür zu sorgen, daß er ihre richtigen Adressen hatte …
Fred faltete Annettes Brief mit ihrer Berliner Telefonnummer auseinander. Dabei wurde ihm plötzlich mulmig. Er hängte den Hörer wieder ein und suchte nach Zigaretten. Vier Jahre hatte er auf diesen Moment gewartet, vier Jahre und achtzehn Tage. Wenn Annette nicht im Zug saß oder schon in Dieburg war, würde er jetzt ihre Stimme hören. Nicht die, mit der er sich die ganze Zeit in der Zelle unterhalten hatte, die ihm vertraut war und die meistens sagte, was er hören wollte, sondern ihre echte Stimme – eine Vier-Jahre-später-Stimme. Das Blut klopfte ihm in den Schläfen. Er rauchte zwei Zigaretten und versuchte, sich die Worte zurechtzulegen. Schließlich wählte er die Nummer und hielt den Atem an. Es tutete kurz.
»Zernikow?!« meldete sich eine Frau. Im Hintergrund lärmte ein Fernseher.
Fred räusperte sich. »… Guten Tag, ich hätte gerne Annette Schöller gesprochen.«
»Wat, wen?!« Sie schrie gegen den Fernseher an.
»Annette Schöller«, wiederholte Fred.
»Nie jehört! Wer soll dit … Ey, Jessica! Hau von det Pörssenell-Commputer ab! Ick hab dir hundert Mal jesacht, dit is keen Spielzeuch, dit is Deddis seins! Und Deddi hauta uffs Maul, wenna dit mitkricht! …Hallo?!«
»Annette Schöller. Sie … Sie war wahrscheinlich Ihre Vormieterin.«
[20] »Ja und?! Ha ick deshalb wat jewonnen?!«
»Wie? Nein, aber …«
»Wat denn nu?!«
»Also, wenn Sie mir die neue Adresse von …«
»Ick wes, ick wes: Annettchen! Aba Adressen von Vormietern is nun nich dit, womit ick mir belaste! Kieken Se doch ins Telefonbuch!«
»Okay, mach ich. Aber vielleicht können Sie mir sagen, ob Annettes Post nachgesendet wird?«
»Bin ick Briefträjer?«
Die Frau legte auf, und Fred drückte auf die Gabel. Einen Moment fühlte er sich wie in den ersten Tagen im Gefängnis, als alles an ihm vorbeigerauscht war und die Jungs ihn bei jeder Gelegenheit auf die Schippe genommen hatten. Eigenartig, der Berliner Ton.
Dann rief er die Auskunft an, ohne Erfolg: Annettes Name war nicht verzeichnet. Anschließend wählte er Nickels alte Berliner Nummer, doch niemand hob ab.
Er ging zurück zu Oma Ranunkels Haus und klebte einen Zettel an die Tür: Bin im Clash. Dann machte er sich auf, ein paar alte Freunde zu besuchen. Doch überall gab man ihm die gleiche Auskunft: Der oder die sei »seit zwei oder drei Jahren in München«, »in Frankfurt«, »Hannover«, »Berlin«, »Tübingen« …
[21] 3
Früher war das Clash eine verrauchte Saufgrotte gewesen, mit schwarzen Wänden, Sperrmüllmöbeln, Kerzen auf leeren Bierflaschen, einer winzigen Tanzfläche und krachender Musik. Dort hatte Fred seine halbe Jugend verbracht: Oft war das Clash tagelang sein Wohn- und Schlafzimmer gewesen, und es war der Ort, an dem er fast alles zum ersten Mal gemacht hatte – jedenfalls die Sachen, für die es noch ein erstes Mal gab, wenn Laufen und Sprechen schon eine Weile klappten.
Seit zwei Jahren hieß das Clash jetzt Coconut Beach und war eine Mischung aus griechischer Taverne und Karibikurlaub. Die Wände hatte man weiß gegipst, den Boden braun gekachelt, und über der Bambustheke drehte sich ein nachgemachter Dreißiger-Jahre-Ventilator. Korbsessel und -tische waren zu Grüppchen zusammengestellt, und auf den Tischen standen Cocktailkarten und Schüsseln mit getrockneten Bananenchips. Aus unsichtbaren Boxen wehte leise Gitarrenmusik.
Beim Hereinkommen hatte Fred gehofft, er habe sich im Haus geirrt. Langsam war er durch den frühabends noch fast leeren Saal gegangen und hatte nicht aufgehört, sich ungläubig umzusehen. Erst mehrere Biere und Schnäpse halfen ihm, mit der neuen Einrichtung zurechtzukommen. Das hieß, sie als Mist abzutun. Diese Art eleganter Hula-Hula-Schuppen, sagte er sich, war vielleicht zu Oma Ranunkels [22] Zeiten modern gewesen. Hier mußte er sich keine Sorgen machen, ob er irgendwas verpaßt hatte. Und daß es das Clash nicht mehr gab, na ja, er würde Dieburg sowieso bald auf Nimmerwiedersehen sagen.
Inzwischen war es kurz nach elf, Fred trank, was das Zeug hielt, und fühlte sich prächtig. Er saß mit zwei jungen Frauen am Tisch, die ihn aus der Zeitung kannten und ihn genauso angesprochen hatten, wie er sich ausgedacht hatte, daß Frauen ihn ansprechen würden: bewundernd. »Bist du nicht der, der damals die Bank überfallen hat?« Fred hatte das locker bestätigt.
Die eine, mit langen dunklen Haaren, Mittelscheitel und einem spitznäsigen, leicht zerknirschten Gesicht, erinnerte ihn an Joan Baez. Sie trug ein hauchdünnes, buntbesticktes Wallewalle-Kleid, durch das man ihre Unterwäsche sehen konnte. Die andere hatte ein rundes, pausbäckiges Gesicht mit eckiger Haarlackfrisur und klemmte in einem Matrosenkostüm. Bei Scherzen jeder Art quietschte sie begeistert, worauf sie jedesmal Ausschnitt und Busen zurechtrückte.
Immer öfter hob Fred sein Glas und krakeelte durch den mit Gästen halb gefüllten Saal: »He, Gerda, hasta la vista!« und winkte zur Theke, während es links neben ihm quietschte. Gerda, die schon damals im Clash gearbeitet hatte, hoffte, Fred würde bald verschwinden. Seit seiner Ankunft waren die Sprüche über Sonnenöl, Lambada und Pils mit Kiwistückchen nicht abgerissen. Vier Jahre Gefängnis entschuldigten zwar einiges, aber wie hoffnungslos man seiner Zeit hinterher war, mußte man darum noch lange nicht wie ein Marktschreier verkünden. Bier und Korn! Gerda [23] schüttelte es. Der Korn war nur wegen der Handwerker da, die das Aquarium einbauten.
Fred lehnte sich zu Joan Baez. »Ich kenn Bowle, das da …«, er deutete grinsend auf ihren Melonen-Maracuja-Sundream mit Zuckerrand und Rosenblüte, »… läuft für mich unter Nachtisch!«
Wieder quietschte es begeistert. Joan Baez verzog keine Miene. Seit einer Stunde wollte sie etwas über das Gefängnis und die Ängste und Probleme eines Gefangenen erfahren und mußte sich statt dessen Halbstarkensprüche und plumpe Witze anhören.
»Scheint mir ziemlich sinnlos, abends wegzugehen, um sich mit Obstsalat vollzuschlagen! Als würde man ’ne Bank überfallen, um die Kugelschreiber mitzunehmen!«
Das Quietschen schwoll zu einem kleinen hysterischen Anfall, bis Joan Baez entnervt meinte, so lustig sei das nun auch wieder nicht. Augenblicklich verstummte die Matrosin. In der Parfümerie, in der beide arbeiteten, war Joan Baez ihre Vorgesetzte. Irritiert rückte die Matrosin ihren Busen zurecht, wobei Fred jedesmal einen leicht rindviechigen Ausdruck bekam. Dann langte sie nach ihrem Cocktail und verschwand hinter einem Busch aus Pfefferminzblättern und Orangenschalenkringeln.
Fred sah vergnügt zwischen beiden hin und her. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, daß Annette und Nickel ihn nicht abgeholt hatten … Nachher würde er mit den Mädchen ins Dance 2000 gehen und dann … Es war seine erste Nacht in Freiheit – his first night in freedom! Er nahm einen Schluck Bier und winkte Gerda. Die süße Gerda! Schade für sie, daß sie jetzt in so einem Saftladen arbeiten mußte.
[24] Joan Baez beugte sich vor. »… Ob man im Gefängnis was lernt?!« Sie stellte die Frage bereits zum dritten Mal, und die Matrosin mußte sich hinter den Pfefferminzblättern mächtig zusammenreißen.
Fred nickte, »Tischfußball«, und rief zur Bar, daß sich sämtliche Gäste nach ihm umdrehten: »He Gerda, wo is eigentlich der Kicker?!«
Gerda wandte sich ab.
Fred schaute verdutzt auf ihren Rücken. Dann murmelte er: »Na ja, hat’s nicht leicht«, und erläuterte mit erhobenem Zeigefinger: »Früher war hier nämlich ’n Kicker«, als wäre das so was Ähnliches wie ein echter Rembrandt.
Joan Baez verdrehte seufzend die Augen zur Decke.
»… Aber damals war ich nur gutes Mittelfeld, jetzt bin ich unschlagbar! Magic Hoffmann haben sie mich im Knast genannt. Ich schieß gar nicht mehr, laß den Ball nur noch im Zickzack rollen. Like this …« Fred vollführte mit Armen und Händen links und rechts vom Bauch eine Bewegung, als würde er zwei unsichtbare Seile durch die Finger gleiten lassen.
»Ich meinte eigentlich eine Lehre, einen Beruf oder so was.«
»Ach das«, Fred winkte ab, »ich geh mit Freunden nach Kanada.«
»Das ist natürlich ein toller Beruf! Und was verdient man da so im Monat?«
Der Satz war noch nicht verklungen, da tauchte die Matrosin schon hinter den Pfefferminzblättern auf und ergriff die Gelegenheit, ihren Schnitzer wiedergutzumachen. Dabei steigerte sie sich Joan Baez zu Ehren in solche [25] Quietschdimensionen, daß alle anderen Gespräche im Raum verstummten. Wieder drehten sich die anderen Gäste nach ihnen um, doch diesmal erfreut über ein so ausgelassenes, lebenslustiges Persönchen. Manchen gefiel außerdem, daß der Spaß offensichtlich auf Freds Kosten ging. Durch seine geschmacklosen Brüllwitze schon ein Ärgernis fürs Ohr, war er ihnen mit seinen vorsintflutlichen Turnschuhen, dem abgerissenen blauen Overall und dem Idiotenhaarschnitt auch ein Dorn im »Eleganz« gewohnten Auge. Schließlich trug heutzutage in Dieburg jeder Müllmann ein rosa- oder türkisfarbenes C&A-Freizeithemd zur Arbeit.
Fred sah in Joan Baez’ längliches, blasses, trotz ihrer Jugend schon von Überstunden und Neonlicht gezeichnetes Gesicht und fragte sich, was gerade sie am Thema Beruf interessierte.
»… In der Schreinerei hab ich gearbeitet«, sagte er dann, »aber wenn ich jetzt Sägespäne rieche, wird mir schlecht. Ist wie mit Kühen und Steaks: ’n Baum ist schön, ’n Tisch auch, alles dazwischen ist Scheiße.«
Joan Baez sah auf Freds klobige Hände am Bierglas und lächelte der Form halber. »… In diesen Zeiten sollte man wohl zu Kompromissen bereit sein.«
»In diesen Zeiten?«
»Arbeitslosigkeit!« sagte sie und guckte dabei, als beende dieses Wort endgültig den lustigen Teil des Abends.
»Arbeitslosigkeit …?«, Fred zuckte die Schultern, »ist mir gleich.«
»So …?«, Joan Baez hob die Augenbrauen, »und wenn du mit Millionen auf der Straße stehst …?«
[26] »Wo?« fragte Fred und wandte sich zum Fenster. Joan Baez und ihre Kollegin wechselten einen Blick.
»Ich seh das so«, sagte er nach einer Pause, in der er auf einen, wenigstens kleinen, Quietscher gewartet hatte, »im Knast gibt’s zwei Sorten von Typen: Die einen schaffen den ganzen Tag, während die andern auf’m Bett liegen und die Decke anglotzen. Der einzige Unterschied ist, die einen kriegen vom Aufenthalt weniger mit, und die anderen haben länger Zeit, sich über ’ne weiche Matratze zu freuen.«
»Und was hat das mit dem normalen Leben zu tun?«
»Na, alle kommen irgendwann raus«, antwortete Fred und zwinkerte der Kollegin aufmunternd zu. Doch die sah zu ihrer Vorgesetzten, und die betrachtete Fred ungerührt. Dann lachte Joan Baez kurz auf und griff nach ihrer Handtasche. »Ich denke, es ist besser, wir gehen jetzt«, und schnippisch fügte sie hinzu: »Wir müssen nämlich morgen früh arbeiten!«
Fred glaubte erst, nicht richtig verstanden zu haben, doch dann mußte er zusehen, wie Joan Baez aufstand, ihr Kleid zurechtzupfte und ihre Strickjacke nahm, und sein Mund öffnete sich verdutzt. Auch die Kollegin war überrascht und deutete zaghaft auf ihr halbvolles Cocktailglas.
Joan Baez winkte ab. »Das spendiert uns unser Magic doch sicher? Einer, der Geld verdient, indem er nach Kanada fährt! Und wenn’s ihm ausgeht, überfällt er eben einfach wieder eine Bank …!«
Das leuchtete der Kollegin ein, und lustig fand sie es außerdem. Nachdem sie noch schnell einen Schluck genommen hatte und während sie sich ihre Zigaretten schnappte, brach ihr Mund auseinander, und ihr Quietschen tönte [27] durch den Saal, machte Fred wie taub im Kopf, und klang erst wieder ab, als die Tür hinter ihnen ins Schloß fiel.
Stille. Alles guckte auf Fred. Er saß in den Sessel gedrückt, die Hände um die Lehnen geklammert, und starrte unverwandt zur Tür. Dann wurden die Gespräche wiederaufgenommen, und bald war der alte Geräuschpegel erreicht.
Fred sah sich vorsichtig um. Langsam wich das taube Gefühl. …Was um Himmels willen war passiert?! Hatten sie nicht eben noch gelacht? Er ließ den Abend an sich vorbeiziehen. Mußte man sich heutzutage vielleicht vor Arbeitslosigkeit fürchten, um mit den Mädchen klarzukommen? Und dabei hatten sie doch abgemacht, ins Dance 2000 zu gehen, tanzen, feiern, Rock ’n’ Roll …
Fred sah auf die Uhr. Jetzt würden auch Annette und Nickel nicht mehr kommen. Das Dance 2000 war gelaufen, alleine konnte er da nicht hin, wie sah das aus! Da mußte man mit Hoppla rein, so wie er’s geplant hatte: Magic Hoffmann, der der Welt trotz vier Jahren Knast mehr Spaß rausleierte als alle anderen zusammen! …Und so war’s ja auch … oder würde es werden, nur heute nicht, jedenfalls nicht exakt.
Er steckte sich eine Zigarette an und sah sich erneut um. Niemand schien ihn zu beachten. Sollte er nach Hause gehen? Sollte das seine erste night in freedom gewesen sein …?!
Er trank sein Glas aus und winkte Gerda. Als sie sich endlich nach ihm umwandte, grinste er und rief: »Lokalrunde!«
Es dämmerte, als Fred auf einer Bank in der Fußgängerzone aufwachte. Er brauchte einen Moment, um zu begreifen, [28] wo er war und daß er sich nicht in seiner Zelle befand, bis er erschrocken hochfuhr.
Dieburg schlief noch. Geschlossene Fensterläden, vergitterte Geschäftsauslagen, das verblassende Licht einer Straßenlaterne. Die ersten Vögel zwitscherten, sonst war es still.
Freds Kleider waren klamm. Er schüttelte sich, ließ die Füße aufs Pflaster plumpsen und rieb sich das Gesicht. Dann entdeckte er die Blutkruste, die sich über seinen rechten Handrücken den Unterarm hinaufzog. Langsam fiel es ihm wieder ein: Er hatte Gerda zum Abschied in die Arme nehmen wollen, aber irgendwas mußte schiefgegangen sein, denn im nächsten Moment hatte ihn jemand gepackt und auf die Straße geschmissen.
Er lehnte sich zur Seite und übergab sich in einen Blumenkübel. Schon immer hatte er einen schwachen Magen gehabt. Wenigstens das Saufen hatte am ersten Abend geklappt. Das klappte immer.
In seiner Tasche waren noch ein Zwanziger und Münzen. Er mußte über sechshundert Mark ausgegeben haben, fast alles, was ihm bei der Entlassung vom Gefängnisarbeitslohn übriggeblieben war.
Er rappelte sich hoch und wankte nach Hause. Die Straßen waren leer. Von weitem hörte er die ersten Autos über die Landstraße Richtung Frankfurt fahren. Ob Annette und Nickel inzwischen da waren?
Doch schon von weitem sah er, daß der Zettel Bin im Clash noch an der Haustür klebte. Damit schien klar: Seine Postkarten waren nicht angekommen. Oder aber …
Er lief schneller und vergaß seinen Kater. An der Tür angelangt, riß er den Zettel ab und knüllte ihn zusammen. [29] Konnte es sein, daß sie von seiner Entlassung wußten und ihn trotzdem nicht abholten? Wollten sie vielleicht erst am Wochenende kommen …?!
Er schloß auf und trat in den Flur. Bleiches Licht erfüllte den niedrigen, schmalen, mit Rosenmuster-Tapeten beklebten Schlauch. An der Garderobe hing noch Oma Ranunkels Wintermantel. Sollte er hier auf Annette und Nikkel warten? Zwischen diesen trostlosen Wänden, ohne Strom und Wasser, und ohne Clash am Abend …?
Er warf die Tür zu. Er hatte keine Zeit mehr zu verlieren, und schon gar nicht in Dieburg! Er würde sich ihre Adressen besorgen, nach Berlin fahren und die beiden abholen! Und wenn sie glaubten, nach vier Jahren käme es ihm auf ein oder zwei Tage nicht an, dann hatten sie sich geirrt!
[30] 4
Auf dem Weg zu Schöllers kaufte Fred im Supermarkt eine Flasche französischen Rotwein für Annettes Mutter.
Er kannte sie seit Sandkastentagen, und hätte er sich eine Mutter aussuchen können, wäre sie erste Wahl gewesen: groß und kräftig, mit prächtigem Busen, kecken grünen Augen und feinem, schmalem Gesicht. Zu Hause lief sie meistens barfuß, nur mit einem Bademantel bekleidet, herum. Nicht immer schloß sie den Gürtel, und es war ein kleines Wunder, daß Fred in früher Jugend keinen bleibenden Schielschaden davongetragen hatte. Zum Ausgehen schminkte sie sich, legte Parfum auf und trug feine, nach dem Empfinden der Nachbarn stets zu knappe Kostüme. Sie mochte die Leute um sich herum, lud zu Gartenfesten und Abendessen ein, und noch der muffigste Beamtenfreund ihres Mannes ließ sich von ihrem Charme und ihrer Lebenslust mitreißen. Daß sie Fred im Gefängnis nie besucht hatte, war für ihn nur eine Maßnahme gewesen, um keinen weiteren Verdacht auf Annette zu lenken.
Es war kurz nach neun, die Sonne stand hinterm Haus, und über Schöllers Vorgarten lag friedlicher Schatten. Nichts hatte sich verändert. Immer noch war der Garten eine Art mediterrane Oase im Vergleich zu seinen feinsäuberlich angelegten Nachbarn mit Stiefmütterchenbeeten und Tannenbäumchen. Bei Schöllers war das Gras nicht gemäht, Sträucher und Blumen standen wild [31] durcheinander, und in braunen Tontöpfen wuchsen Salbei und Rosmarin.
Die Rama-Familie. Fred sah sie vor sich, wie sie fröhlich zusammen kochten und anschließend um den Eßtisch saßen, wie sie über dieselben Sachen lachten, sich für dieselben Themen interessierten und sogar über das, was in den Zeitungen stand, meistens derselben Meinung waren. Freds Vater hatte einmal gesagt, entweder hätten die Eltern einen Dachschaden oder die Kinder keinen Mumm – aber zu Schöllers war ihm sowieso nie Gutes eingefallen.
Fred stieß die Gartenpforte auf, ging zur Haustür und klingelte. Nichts passierte. Er klingelte weiter, bis sich der Vorhang im ersten Stock bewegte und jemand hustete. Dann kamen Schritte die Treppe runter, und Fred zog die Flasche aus der Tüte. Als die Schritte verstummten, krächzte es hinter der Tür, wer da sei. Fred schob die Flasche zurück.
»Fred Hoffmann. Ich wollte Frau Schöller sprechen.«
»Fred …?!«
Die Tür öffnete sich, und Fred stockte der Atem. Es war Frau Schöller – oder das, was von ihr übrig war: abgemagert bis auf einen kleinen spitzen, geschwulstähnlichen Männerbierbauch, das Gesicht ein aufgeschwemmtes Schlachtfeld aus eitrigen Pusteln, zerfurchten Lippen und rot unterlaufenen, glasigen Augen. Wie ein Höhlentier, das das Licht scheut, blieb sie im Halbdunkel des Hausflurs stehen. Freds Nase erreichte fauliger Schweißgeruch.
Er versuchte, sich seinen Schreck nicht anmerken zu lassen. Wie früher, wenn er etwas ausgefressen hatte, grinste er frech und rief: »Na, Frau Schöller?!«, als hoffte er, mit [32] alten Tönen Frau Schöller auch ihr altes Aussehen wiederzugeben.
»Mensch, Fred … Bist du endlich draußen!«
»Seit gestern.«
»Komm rein.« Doch im selben Moment schaute sie beiseite, als fiele ihr etwas ein. Dabei raffte sie ihren Bademantel zusammen und fuhr sich durchs verklebte Haar. Als sie aufsah, war ihr Blick voller Angst. »… Ich meine, wenn du willst. Du siehst ja … Es hat sich einiges geändert …«
Fred zuckte die Schultern. »Na, wo ändert sich denn nix! Oder bekomm ich hier auch keinen Kaffee mehr?«
»Aber natürlich.« Sie zeigte eine Reihe gelber Zähne, und ein schwacher Glanz huschte über ihre Augen.
Fred folgte ihr ins Wohnzimmer. Die Vorhänge waren zugezogen, nur durch die Ritzen fielen vereinzelte Sonnenstrahlen. Es roch nach Schnaps und abgestandenem Rauch. Im Halbdunkel erkannte Fred immer noch dieselbe, auf Herrn Schöllers Mist gewachsene, evangelische Einrichtung: praktische helle Holzmöbel, orange Lampenschirme, waldfarbene Wandteppiche und ein Plakat für Völkerverständigung. Im Regal standen Fotos von Annette und ihren älteren Brüdern. Einer war Geigenbauer, der andere etwas Lobenswertes in Afrika, was, wußte Fred nicht genau. Daneben prangte Herrn Schöllers Kopf aus Gips. Ein befreundeter Künstler hatte ihm die Skulptur geschenkt. Sie ließ ihn wie ein griechischer Philosoph wirken.
Frau Schöller war stehengeblieben und klammerte nervös die Hände ineinander.