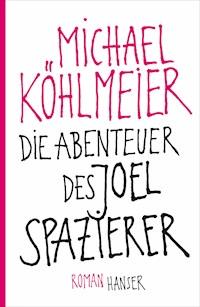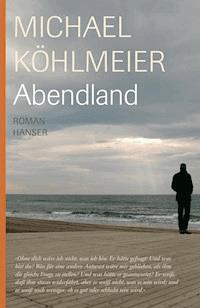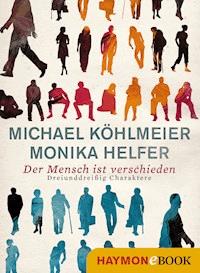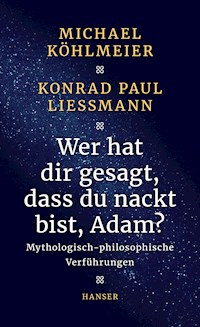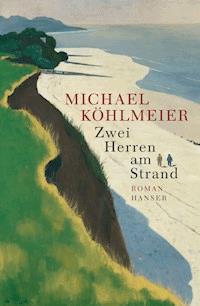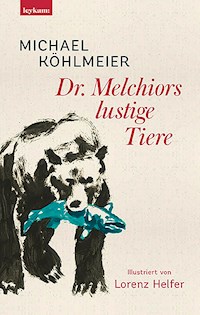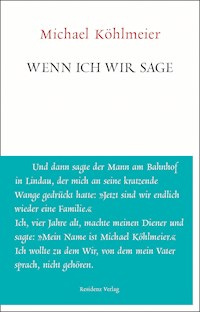Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Im Mai mailt Hanna an ihre Schwägerin in Dublin: Komm, dein Bruder wird verrückt! Zwei Tage später landet Jetti Lenobel in Wien – und Robert ist verschwunden. Doch Jetti glaubt nicht daran, dass der Bruder verrückt geworden ist. Sie kennt ihre sehr ungewöhnliche jüdische Familie. In der ist immer mit allem zu rechnen. Dann kommt die Nachricht des Bruders: „Ich bitte dich, dass Du mit niemandem darüber sprichst!!! Ich will es so. Ich bin in Israel, dem Land der Väter. Aber an die Väter denke ich nicht.“
In den merkwürdigen, verschlungenen Lebensläufen der Geschwister Jetti und Robert, seiner Frau, ihrer Kinder und Freunde, erzählt Köhlmeier packend von dem, was jeder sein Leben lang mit sich trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 834
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Im Mai schreibt Hanna an ihre Schwägerin eine Mail nach Dublin: Komm, dein Bruder wird verrückt! Zwei Tage später landet Jetti in Wien. Robert Lenobel ist verschwunden. Gegen Jettis Rat gibt Hanna eine Vermisstenanzeige auf. Jetzt aber bekommt Jetti eine Nachricht: „Ich bitte dich noch einmal, dass Du mit niemandem darüber sprichst!!! Ich will es so. Ich bin in Israel, dem Land der Väter. Aber an die Väter denke ich nicht.“ Klarer jedoch wird dadurch nichts, und anstatt sich weiter mit Hanna zu streiten fährt Jetti zunächst einmal zurück nach Dublin – zu ihren zwei Männern.
Michael Köhlmeiers packender, zugleich tragischer und komischer Roman ist das Epos einer Familie und das Porträt einer Epoche. In den skurrilen, verschlungenen Lebensläufen der Geschwister Jetti und Robert, seiner Frau ihrer Kinder und Freunde, erzählt Köhlmeier, wie nur er es versteht, von dem, was jeder sein Leben lang mit sich trägt.
Hanser E-Book
MICHAEL KÖHLMEIER
BRUDER UND SCHWESTER LENOBEL
Roman
Carl Hanser Verlag
für die Familie
ERSTER TEIL
ERSTES KAPITEL
Es war einmal ein König, der fing einen Floh und sperrte ihn in eine Flasche und fütterte ihn mit Krumen und Tropfen. Der Floh wuchs und wurde groß wie ein Frosch, und der König steckte ihn in ein Fass. Nun nährte er ihn mit rohem Fleisch, das er von der Tafel abzweigte, und mit Bier. So vergingen die Jahre. Der Floh wuchs weiter, und der König ließ einen Käfig bauen so groß wie ein Haus, dort hielt er ihn, um ihn zu betrachten, und niemand im Reich wusste davon, nicht die Königin und nicht die Königstochter und keiner der Minister, und es war dem König eine Freude, den Floh ganz allein zu besitzen. Schließlich aber schlachtete er den Floh und zog ihm das Fell ab und stopfte es mit Reisig aus und hängte es neben das Tor zur Stadt.
Dann verkündete er: »Wer mir sagen kann, was dieses Fell für eines ist, der kriegt die Prinzessin zur Frau und das halbe Reich dazu, denn ich bin müde.«
Kam einer und drehte das Fell und prüfte es: »Wenn es ein wenig anders röche, würde ich sagen, es ist das Fell eines Büffels, aber ein Büffelfell riecht nicht so, also kann es nicht das Fell eines Büffels sein.«
»Ich will von meinen Untertanen nicht wissen, was für ein Fell es nicht sein kann. Ich will wissen, was für ein Fell es ist!«, sagte der König, und er ließ ihm den Kopf abschlagen. Nun wussten alle anderen, was ihnen blühte.
Und doch kam ein zweiter, und auch er drehte das Fell und wendete es, und auch er roch daran und schnüffelte und wog es in seinen Händen, und er sagte: »Wenn es nur ein bisschen größer und ein bisschen schwerer wäre, dann würde ich wohl sagen, ja, es ist ein Kalbsfell. Und wenn es nur ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter wäre, würde ich wohl sagen, ja, es ist ein Hundsfell.«
»Ich will von meinen Untertanen nicht wissen, was einer sagen würde, sondern was er sagt«, sagte der König und ließ auch diesem den Kopf abschlagen.
Dann kam gar ein dritter, der drehte das Fell und schaute es genau an und roch daran und rieb es zwischen seinen Fingern und wog es in seinen Händen und wendete es und kratzte daran und wischte darüber, und schließlich sagte er: »Ich sag nichts, ich schau nur, ich sag nichts, ich riech nur, ich sag nichts, ich greif nur, ich will nur wissen, wie es sich anfühlt, aber sagen tu ich nichts.«
Ihm erst recht ließ der König den Kopf abschlagen, denn er wollte, dass seine Untertanen sagten, was es für ein Fell ist, und nicht, dass sie sagten, dass sie nichts sagen.
Zuletzt stieg ein Teufelsding aus dem Meer heraus, so dass Schaum und Wogen weit umherwirbelten, das verkleidete sich als ein Mensch, und er drehte das Fell nicht und roch nicht daran und prüfte es nicht zwischen Zeigefinger und Daumen, er kratzte nicht daran und wischte nicht drüber. Er stellte sich hin und holte aus und zeigte auf das Fell und sagte:
»Es ist das Fell eines Flohs.«
Nun war es aber so, dass die Menschenhaut, die sich das Teufelsding übergezogen hatte, an manchen Stellen spannte und an anderen Stellen nicht gut deckte, so dass darunter Stücke vom Teufel und seinem Fleisch zu sehen waren, und das sah aus, als hätte es der Hässlichkeit den Namen gegeben. Und als das Teufelsding ausgeholt hatte, um auf das Fell des Flohs zu zeigen, war die Menschenhaut auf der Seite aufgerissen, und darunter war nun alles Elend zu sehen, das ein Mensch unter der Haut mit sich herumträgt.
Den König packte die Angst, und er befahl seiner Tochter: »Schnell, wasch dir die Hände, dann kann er dir nichts anhaben!«, und sie tat es, und dem Teufel sagte er:
»Die Prinzessin bekommst du nicht, nein, die bekommst du nicht, die bekommst du nicht!«
Da schwoll die Teufelsfratze unter der Menschenhaut, und das Menschengesicht platzte auf, und der Teufel, wie er war, rot und lodernd, rief:
»Ich fluche euch! Ihr werdet hinfort eurer eigenen Haut nicht mehr trauen!«
Er schüttelte den Menschen ganz von sich ab und zertrat das Stöhnen und das Jammern mit seinem Huf. Er zog sich die Haut des Flohs über, denn der Teufel hat keine eigene Haut, und wenn er aus der Hölle ist, muss er sich eine andere nehmen, und lief schreiend davon und tauchte unter ins Meer, woher er gekommen war.
1
Im Mai noch schrieb Hanna an ihre Schwägerin eine Mail. Ungefähr so: Komm, dein Bruder wird verrückt! Zwei Tage später landete Jetti in Wien Schwechat. Inzwischen schien alles schlimmer. Robert war verschwunden. Gegen Jettis Rat gab Hanna eine Vermisstenanzeige auf. Um Druck zu machen, log sie: Seit einer Woche abgängig, Dr. Robert Lenobel, 55. Dass der Vermisste von Beruf Psychiater und Psychoanalytiker war, ließ den Beamten die Dringlichkeit einsehen.
Zu Hause bei ihrer Schwägerin in der Garnisongasse im 9. Wiener Gemeindebezirk, während sie ihre Kleider aus dem Koffer nahm und an den Fensterrahmen hängte, fragte Jetti: »Warum bin ausgerechnet ich hier, Hanna? Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen … wenn Robert nicht bereits abgehauen wäre?«
»Nicht bereitsabgeHAUEN?«, wiederholte Hanna, die auf der Schwelle stand, die Arme verschränkt, und ihr zusah, und rief das letzte halbe Wort in das Zimmer hinein wie von der Bühne herunter. »Du tust so, als hätte er das von Anfang an vorgehabt. Das ist aber nicht wahr, Jetti!« Hoch, eckig, empörte Augen, scharfkantiges, porzellanhelles Gesicht, bereit zu streiten.
»Ich verstehe nicht«, sagte Jetti. »Von welchem Anfang an?«
Und Hanna dagegen: »Sag du mir von welchem AnFANG an, Jetti! Ich weiß nichts von einem Anfang … nicht in diesem Zusammenhang jedenfalls.«
»Ist ja gut«, sagte Jetti; dachte, sie hat doch von einem Anfang gesprochen, nicht ich; streckte aber die Hand nach ihrer Schwägerin aus. Wenn Hanna verzweifelt war oder unglücklich, das hatte sie nicht vergessen, oder zornig oder aus irgendeinem Grund giftig gelaunt, betrieb sie Wortklauberei, als wüchse das Gift wie Unkraut zwischen Subjekt und Prädikat, Konjunktion und Adverb, und man müsste es nur herauszupfen, und Verzweiflung, Unglück, Zorn und Laune lösten sich auf. Das hatte Hanna von ihrem Mann. Robert meinte, wenn er die Wörter haut, haut er die Welt. Nach dieser Pfeife konnte Jetti aber nicht tanzen, selbst wenn sie es um des Friedens willen gewollt hätte; über Worte musste sie nachdenken, länger als andere, zu lang auf jeden Fall, um sich auf Schlagfertigkeiten einzulassen. »Ist gut, Hanna«, versuchte sie zu besänftigen. »Aber sag mir doch, warum hast du mich gerufen? Was kann ich tun? Was hätte ich tun können?«
»Ihn daran hindern«, schluchzte Hanna.
»Ich bin seine Schwester, du seine Frau«, sagte Jetti. Ein Ton geriet ihr, der nun doch streitsüchtig klang, obwohl sie das Gegenteil fühlte – das Gegenteil von streitsüchtig war doch die Bereitschaft zu schlichten, und nur das wollte sie; deswegen war sie gekommen. Sie war darauf gefasst gewesen, einen Streit zwischen Bruder und Schwägerin schlichten zu sollen – diesmal einen, so interpretierte sie die Mail, der, wer weiß, so tief wurzelte, dass die Eheleute sich nicht mehr an die Ursachen der Ursachen erinnerten und jemanden brauchten, der sie hinunterführte – oder so ähnlich, wie sich Robert ausdrücken würde, wenn die Seelen anderer Menschen zur Disposition stünden und nicht seine eigene und die seiner Frau …
»Was, Hanna, kann ich, was du nicht kannst?« Die Frage war sachlich gemeint, pragmatisch.
»Ach, Jetti, hör auf!«, wurde sie angefahren.
Da zog Jetti ihre Hand zurück.
2
Dabei hätte sie es wenigstens ahnen müssen … Hannas erste Worte, als Jetti durch die automatische Schiebetür in die Ankunftshalle getreten war – die beiden hatten einander seit fünf Jahren nicht gesehen: »Man weiß nicht, warst du schöner gewesen mit zwanzig oder mit dreißig oder mit vierzig, oder bist du jetzt mit fast fünfzig am schönsten?« Dann hatte sie Jetti den Koffer aus der Hand genommen und war losmarschiert, einen Meter voran, bohrte den Blick in den genoppten Kunststoff, mit dem der Weg zur Tiefgarage ausgelegt war. Und damit auch ja kein Zweifel aufkomme, dass es sich nicht um ein Kompliment handelte, hängte sie an: »Wenn du mich fragst, am schönsten warst du mit dreißig. Da hätte dich einer erschießen sollen. Oder heiraten.« – Jetti hätte wissen müssen, dass jede Schuld, die sich ihr Bruder nach Meinung seiner Frau auflud, dass jeder Schmerz, den er seiner Frau zufügte, mindestens zu gleichen Teilen ihr, der Schwester, angekreidet würde; Hanna hatte für diese Quelle allen Übels sogar ein Wort erfunden: Lenobeltum.
Was den Schmerz betraf, besser: seine Darbietung, fand Jetti, Hanna übertreibe mächtig, und ungeschickt obendrein. Das beruhigte sie ein wenig; obwohl sie nicht erkennen konnte, worin genau diese Übertreibung bestand – ob sich Hanna sozusagen »ehrlich« hineinsteigerte oder ob sie ihre Sorge willentlich und berechnend aufbauschte, um sich zu rechtfertigen, wofür auch immer, oder ob sie – und das hielt sie für wahrscheinlich – sich selbst feiern wollte, als eine Art Witwe. Sie waren vom Flughafen direkt zur Polizei gefahren. Im Auto sprachen sie wenig miteinander. Den Beamten gegenüber gab sich Hanna hysterisch. Sie gab sich so, sie war es nicht. Ihre Stimme hüpfte ins Falsett, aber die Augen, eine kleine Spanne über dem Mund, der auch in seinen Pausen offen stand, blickten unbeteiligt, als warteten sie gelangweilt auf das Ende dieses Spiels. Auch einer der Beamten, dies meinte Jetti beobachtet zu haben, hatte ihr nicht geglaubt. Wieder im Auto war Hanna sogar ein bisschen fröhlich gewesen. Erleichtert fröhlich. Vielleicht hatte ja sie, Jetti, übertrieben, als sie ohne weitere Fragen stante pede ein sehr teures One-Way-Ticket gekauft hatte. Vielleicht hatte sich ja inzwischen alles aufgeklärt, und Hanna war es einfach peinlich, und sie wusste nicht, wie sie ihr beibringen sollte, dass sie wegen nichts und wieder nichts von Irland hergeflogen war. Aber warum hätte sie dann zur Polizei gehen sollen? Oder Hanna und Robert hatten sich abgesprochen; dass sie beide nicht wussten, wie sie aus der Verlegenheit herauskommen sollten; und wollten sich das Geld für den teuren Flug sparen, denn wenn Jetti tatsächlich wegen nichts und wieder nichts angetanzt wäre, würde es der Anstand gebieten, dass sie wenigstens die Spesen übernehmen … – So zu denken wäre allerdings paranoid; dann schon lieber als naives Schaf dastehen.
Als sie die Wohnung betreten hatten, war alle fröhliche Erleichterung auch schon dahin. Gleich begann Hanna auf- und abzustaksen wie ein eingesperrter Storch. Dann schien sie sich zu besinnen, stand starr, noch ein Fuß vor dem anderen, über der Nasenwurzel eine tiefe Falte, ließ sich von Jetti bestaunen, warf ihr einen vorwurfsvoll grimmigen Blick zu und wechselte in diese arrogant-vulgäre kreuzbeinige Art, wie es Models tun. In dem Blick aus Eis und Hochmut war alles und nichts zu finden, und Jetti konnte sich wieder keinen Begriff von der Frau ihres Bruders machen, betrachtete ihre spitzen Schultern, die sich zu den Ohren hin etwas hoben.
»Was sollen wir unternehmen, was meinst du?«, fragte sie, fasste ihre Schwägerin am Arm und schob sie in die Küche. Sie wollte nicht im Flur stehen, als wäre sie ein unerwünschter Besuch, und sich eine billig einstudierte Szene anschauen. »Trinken wir einen Tee, Hanna, und gehen alles der Reihe nach durch, Schritt für Schritt. Vielleicht setzen wir eine Liste auf, was meinst du?«
Aber Hanna zog in der Küche weiter ihre Achterschleifen, warf immer wieder die Arme von sich und stieß verzweifelte Laute aus, und nun war Jetti sich doch nicht mehr sicher, dass sie bloß spielte; könnte sein, dass bei Hanna sogar die tiefste Sorge gespielt aussieht. Was war die tiefste Sorge? Sie sagte: Dass ihr Bruder sich jemals etwas antue, wüsste sie auszuschließen – als wäre dies Punkt eins auf der Liste. Ihre Stimme aber hatte sich am Satzende wie von selbst zu einem Fragezeichen gebogen, denn in Wahrheit wusste sie nichts mehr auszuschließen, seit Beginn des Gedankens jedenfalls nicht mehr. Dass Zynismus einen Menschen tatsächlich gegen Suizid immunisiere, wie ein Freund ihr irgendwann vorgeschlagen hatte zu glauben, glaubte sie nicht und hatte es nie geglaubt.
Wie ihr denn um Himmels willen so etwas einfalle, stellte Hanna sie prompt zur Rede. »Für einen SelbstMORD ist Robert nicht der Typ, so etwas kommt für ihn nicht in Frage!« Als beschriebe sie eine Sportart. »Aggressive, paranoide Charaktere wie dein Bruder rechnen diese Art zu enden ausschließlich den anderen zu.«
»Wie soll ich das verstehen, Hanna?«
»So. Genau so.«
»So siehst du Robert?«
»So sieht er sich selbst. Ich habe ihn lediglich zitiert.«
Da dachte Jetti zum ersten Mal an ihren Bruder, als wäre er nicht eine Fortsetzung von ihr – oder sie von ihm. Und das machte ihr Angst.
Hanna setzte sich ihrer Schwägerin gegenüber an den Küchentisch und fixierte sie, und als gäbe es für Jetti endgültig etwas zu begreifen, sagte sie: »Ich mache mir um Roberts körperliches Wohl keine Sorgen, schon gar nicht um sein seelisches – um sein geistiges jedoch schon!«
»Liegt das Problem darin«, forschte Jetti weiter, und noch während sie sprach, wusste sie, dass sie wieder etwas Falsches wieder mit einer falschen Betonung sagte, konnte den Satz aber nicht mehr bremsen, »dass du befürchtest, er will dich verlassen?«, und presste die Lippen aufeinander, bevor herauskam: wegen einer anderen. Mittlerweile meinte sie, sich ihren Bruder als einen Menschen denken zu müssen, über den sie, die Erinnerungen an ihre gemeinsame Kindheit und Jugend abgezogen, nicht nur wenig, sondern gar nichts wusste. Schnell ging das. In Hannas Gegenwart schlitterte Jetti – hierhin, dorthin, wollte dieses sagen, sagte aber jenes; wurde hierhin befördert und dorthin, war einmal das narzisstische Vorzeigeobjekt schlechthin und gleich darauf ein unbedarftes, naives Schäfchen, das sich alles zweimal erklären lassen musste. So war es immer gewesen. Gut ausgestiegen war sie bei ihrer Schwägerin – selten.
»Was«, fragte sie und wollte nach Hannas Händen greifen, »was war zwischen dir und Robert? War etwas zwischen dir und Robert? Dass er abgehauen ist …«
3
Hanna stand ohne ein Wort vom Tisch auf und schritt auf ihren langen Beinen (Hausschuhe mit hohen Keilabsätzen aus Kork) durch Küche und Flur in ihr Zimmer und blieb dort bis zum Abend und verließ es erst, um sich ihren Tee zu brühen und Jetti »Gute Nacht« zu sagen, murmelnd, mit gesenktem grauem Lockenkopf. Da strich ihr Jetti über die Wange, und die beiden Frauen umarmten sich. Und lachten wie Schulmädchen und umarmten sich ein zweites Mal, nun verlegen und ein bisschen angeekelt, weil nicht mehr spontan, sondern gehorsam der Rolle aus einer amerikanischen Vorabendserie. Vor über zwanzig Jahren, als Jetti bei ihrem Bruder und ihrer Schwägerin gewohnt hatte, weil sie glaubte, für den kurzen Aufenthalt in Wien rentiere sich eine eigene Wohnung nicht, hatten sie manchmal abends zusammen vor dem Fernseher gesessen, und Hanna war auf einem Teppich, gewirkt aus Zitaten aus tausendundeinem klugen Buch, zwischen den dürftigen Dialogen durch die dürftige Handlung geflogen und hatte ihrer Schwägerin erklärt, was für ein Schwachsinn das Ganze sei, als wäre Jetti es gewesen, die sich diesen Schwachsinn ansehen wollte, derweil es ja genau Hanna war, die sie dazu überredet hatte, indem sie nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, Frau und Schwester müssten außer dem Robert noch etwas Gemeinsames haben, ansonsten wäre kein Friede im Haus, und dieses Gemeinsame sollte am besten ein Laster sein, denn nichts verbinde zwei Frauen auf erfrischendere Weise miteinander als ein Laster, und die »gemeinsame Vorliebe« für miserable amerikanische Vorabendserien sei genau das richtige Laster – wobei sie Jetti nicht zu Wort kommen ließ, die gern eingewendet hätte, sie habe überhaupt keine Vorliebe für miserable amerikanische Vorabendserien. Aber sie hätte ja doch nicht die Kraft aufgebracht dagegenzuhalten. Sie hatte nicht einmal mitbekommen, was auf dem Bildschirm lief. Es war ihr damals nicht gutgegangen. Hanna hatte sie aufheitern wollen, das war alles. Sie hatte es gut gemeint. Sie hatte immer wieder den Arm um sie gelegt oder ihre Hand gehalten oder ihr mit dem Finger über die Wange gestreichelt. Sie dürfe sich von Herzen ausweinen, hatte sie gesagt. Öfter als einmal. Mit Vorliebe in Roberts Gegenwart. Der war in ein bestürztes Hohngelächter ausgebrochen und hatte noch am ersten Abend – wenn sich Jetti recht erinnerte – die Wohnung verlassen. War abgefahren ins Waldviertel. Urlaub brauche er. Was Urlaub! Urlaub wovon? Urlaub vom Unglück? Geflohen war er vor dem Unglück seiner Schwester. Unglück in den eigenen Reihen hielt er nicht aus. Krankheit nicht, Unglück nicht und Tod nicht. Jetti und Hanna waren in der Wohnung zurückgeblieben, allein, ohne Mann und Bruder.
Vielleicht hatte sie Hanna ja aus Dublin nach Wien gerufen, gar nicht, um Robert zu suchen, sondern weil sie Revanche wollte; weil sie sich diesmal bei ihr ausweinen wollte. Das wäre Jetti nicht angenehm gewesen …
»Was hast du gemacht die ganze Zeit über?«, fragte Hanna und setzte sich zu Jetti an den Tisch; fragte im harmlosesten Ton, als wäre Jetti einfach nur so zu Besuch – auf Urlaub.
»Ich habe hier in der Küche gesessen«, antwortete Jetti – in einem ähnlichen Ton.
»Die ganze Zeit bist du hier gesessen? Du lieber Himmel, was bin ich egoistisch!« Und bevor Jetti etwas entgegnen konnte: »Ich habe mit Cora telefoniert …« – Als würde so ein Telefonat zwei Stunden dauern! »Entschuldige, Jetti! Ich kann sie nicht einfach allein lassen, das verstehst du doch, oder? Sie sagt zwar, sie schafft es ohne mich, das hat sie gesagt, du kennst sie ja, wenigstens morgen und vielleicht noch übermorgen schafft sie es allein, da bin ich unbesorgt. Sie wünscht uns alles Gute für unser Unternehmen und lässt dich schön grüßen.«
»Danke«, sagte Jetti. Ihre Luft war raus und damit auch fast aller Unmut.
Cora Bonheim und Hanna führten eine Buchhandlung in der Innenstadt – die einzige jüdische Buchhandlung in Wien, zweimal bereits waren sie mit einem Preis ausgezeichnet worden, Jetti erinnerte sich nicht mehr an die Namen der Preise und auch nicht daran, wer sie gestiftet hatte, es war aber prominent gewesen. Die FAZ hatte sogar einen Artikel über den Buchladen geschrieben, »eine Institution, die an die große Zeit Wiens erinnert« – Robert hatte ihr den Link zugeschickt, »auf Wunsch von Hanna«. Jetti hatte Cora irgendwann getroffen, ja, aber sie erinnerte sich nicht mehr, sie hätte nicht sagen können, wie sie aussah oder wie ihre Stimme klang, oder ob, und wenn, was sie miteinander gesprochen hatten – keine Spur von »du kennst sie ja«.
Hanna legte ihre Unterarme auf Jettis Schultern und schloss die Finger in ihrem Nacken und kam mit ihrer Stirn nahe herunter zu ihrer Stirn. »Wir haben also zwei Tage Zeit, um ihn zu suchen, Jetti. Und dann ist Schabbat, da ist der Laden geschlossen, das sind zusammen sogar drei Tage. Genügt uns das? Drei volle Tage und Nächte. Sag, genügt uns das?«
Beinahe wäre Jetti herausgerutscht, ob es denn erlaubt sei, am Schabbat verlorengegangene Brüder und Gatten zu suchen. Sie nahm sich aber zusammen und sagte: »Aber wo sollen wir ihn suchen, Hanna? Wo? Und wie soll das gehen?«
»Geh du erst einmal in dein Zimmer, ich geh in mein Zimmer.« Hanna tat, als wäre dies die Antwort. »Wir müssen ausgeschlafen sein.«
»Aber es ist doch erst acht Uhr!«
»Wir müssen ausgeschlafen sein«, wiederholte Hanna.
Als »mein Zimmer« bezeichnete Hanna das ehemalige Mädchenzimmer ihrer Tochter Klara. Für Jetti habe sie daneben, im Zimmer von Klaras Bruder Hanno, das Bett gemacht – was nicht stimmte, Leintuch und Überzüge waren nicht frisch, nicht einmal aufgeschlagen, sondern zerknüllt, als wäre gerade erst jemand herausgestiegen; Jetti vermutete, Hanna wälzte sich abwechselnd einmal hier und einmal dort.
Frau und Schwester des Vermissten schliefen also Wand an Wand, wie die Kinder all die Jahre hatten schlafen wollen, als sie noch zu Hause lebten. Die beiden Zimmer waren irgendwann ein großes gewesen mit zwei Türen zum Flur; die Wand, die eingezogen wurde, bestand aus Rigipsplatten, mehr war da nicht. In der Nacht hörte Jetti ihre Schwägerin weinen. Wieder glaubte sie ihr nicht. Hanna spielte Weinen, so nahe an der Wand wie möglich.
4
Dabei redeten sie in den ersten Tagen nur wenig über Robert. Als wäre Jetti tatsächlich nur so auf Besuch hier. Als wäre Robert bei einem Kongress, und kein Mensch brauchte sich Sorgen um ihn zu machen. Kein Gedanke, ihn zu suchen! Wo auch, bitte? In der weiten Welt? Wo fing die an? Hatte Hanna zum Beispiel bei Freunden und Bekannten angerufen? Oder hatte sie mit Roberts Sekretärin gesprochen?
Nach dem ersten Frühstück hatte sich Jetti noch zu einem kleinen Frage-Antwort-Spiel aufgerafft. Sie wollte es durchaus als Verhör führen, um von vornherein klarzustellen, dass sie nicht das Schäfchen war; dass sie auch anders konnte.
»Hanna … sag mir …« Hanna hob den Blick und schaute ihr direkt in die Augen, und schon knickte Jettis Ton ein: »Sag mir … Hanna … du hast geschrieben, Robert wird verrückt … Was hast du damit genau gemeint?«
»Ist verrückt, habe ich geschrieben. Das habe ich geschrieben, Jetti. Ist, nicht wird.«
»Mir ist in Erinnerung, dass du geschrieben hast, er wird …«
»Ist, Jetti, ist!«
»Es spielt ja auch keine Rolle …«
»Ach nein?«
»Verrückt ist ein weiter Begriff, Hanna.«
»Such’s dir aus, Jetti! Merkwürdig. Irr. Wirr. Meschugge. Jeck. Gestört. Gedächtnisausfälle. Unkonzentriertheit. Unwirsches Verhalten ohne Grund. Barsch. Garstig.«
»Robert war immer vergesslich, jedenfalls bei Angelegenheiten, die ihn nicht betreffen.«
»AllerDINGS!«, trumpfte Hanna auf. Das eben sei – und da war das Wort: »Lenobeltum, pures, unverdünntes Lenobeltum.« Auch bei Klara und Hanno könne man dieses »Sippschaftsattribut« leider beobachten. Habe man schon beobachten können, als sie noch Kinder waren …
»Wenig konzentriert ist jeder bisweilen und unwirsch auch«, versuchte es Jetti noch einmal, zwang sich zu einem geradezu vorbildlich besonnenen Tonfall und merkte, dass sie säuselte. »Ich zum Beispiel … meistens bin ich unwirsch … ich meine, wenn ich es bin, ich glaube, oft bin ich es nicht … aber wenn, dann ohne großen Grund … ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen …«
Sie bekam nur einen Blick.
»War er unkonzentrierter als sonst?«
»Nein.«
»Unwirscher als sonst?«
»Nein.«
»Barscher?«
»Was? Was verwendest du für Wörter … Jesus! Nein, er war nicht BARSCHER.«
»Was meinst du dann, Hanna?«
Und Hanna – wieder: »Ach, Jetti, hör auf!«
Als ob Jettis Fragen in Wahrheit der puren Streitlust entsprängen.
Jetti öffnete das Fenster, setzte sich aufs Fensterbrett und zündete sich eine Zigarette an. Sie wusste, Hanna mochte das nicht. »Darf ich dir eine letzte Frage stellen, Hanna? Ist Robert wirklich weg? Ist das wirklich dein Problem? Oder ist es etwas anderes? Ich wäre dir nicht böse, versteh mich richtig, mir wäre nur recht, wenn du es mir sagst. Ich habe sehr viel zu tun in Dublin, weißt du, und es wäre nicht fair, wenn du …«
Weiter kam sie nicht. Hanna nahm die letzten beiden Worte auf und richtete sie gegen Jetti: »WENN DU … mir nicht beistehen willst, dann packe deine Sachen wieder ein, und ich fahr dich zurück zum Flughafen, und ich will dir gern deine Auslagen erstatten!«
Nach diesem Frühstück waren sie einander aus dem Weg gegangen. Und hatten nicht mehr miteinander gesprochen bis zum Abend.
5
Es war still in der Wohnung. Jetti zog sich aus bis auf Slip und T-Shirt. Müde war sie zum Umfallen, und es war noch nicht einmal Mittag. Sie legte sich aufs Bett und schloss die Augen, das Mobiltelefon hing am Ladegerät und lag neben ihrer Hand, den Ton hatte sie abgeschaltet. Sie hätte schrumpfen wollen, bis sie in ihren Koffer passte. Erstaunlich war dieses fremde Innehalten für sie, wie der Zauber aus dem Märchen, als die Pferde im Stall eingeschlafen waren und die Hunde im Hof und die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an der Wand und das Feuer im Herd. Ein Ticken schlich sich in ihren Kopf hinein, das aus den Kanten zwischen Wänden und Fußboden zu dringen schien. Im Halbtraum sah sie eine Kolonne winziger Wesen an den Zimmerkanten entlangmarschieren – waren es Zwerge, die niedliche Vorschlaghämmer geschultert hatten, oder waren es Tierchen, die ihre Beute trugen? Sie hätte sich jetzt gern einen von Jamies brachialen Witzen angehört, der hätte sie wach gemacht. Vielleicht lag er in diesem Augenblick in Dublin auf seiner Frau und stellte sich vor, er läge auf ihr. Es war ja erst Mittag oder früher Nachmittag, Sex fand für Jamie nur tagsüber statt, der Abend gehörte König Alkohol. Das verband Jetti mit der Angetrauten ihres Liebhabers: dass sie beide über Witze lachten, über die sie niemals lachen würden, erzählte sie ein anderer. Wenn Jamie zu einem Witz oder zu einer Anekdote ausholte, donnerte sein Lachen los, schon bevor er ein Wort gesagt hatte, als wäre ihm die Pointe gerade erst verraten worden, und dieses Lachen war so ansteckend, dass es auf den Witz gar nicht mehr ankam. Draußen wehte der Frühling, Laptop und Handy funktionierten, die Ladegeräte hingen am Adapter und der an der Steckdose. Gleich werde ich Jamie anrufen und ihn bitten, mir einen Witz zu erzählen, dachte Jetti. Wenn seine Frau in der Nähe war, begrüßte er sie am Telefon mit »Jesse« – »Hey, Jesse!« – , wie Jesse James, der Outlaw, und redete rabaukenhaft und mit versteckten Anspielungen und Geheimcodes, die seine Frau nicht verstehen konnte, über die sie aber herzlich lache, wie er Jetti erzählte, sie habe sogar angeregt, diesen fidelen Jesse doch einmal zum Dinner einzuladen. Ob sie keine Lust habe, sich als Kerl zu verkleiden, hatte er Jetti gefragt, ganz im Ernst, sie solle sich ein Bärtchen aufkleben und eine Perücke aufsetzen, er werde ihr ein nobles monkey suit besorgen, eines mit einem weiten Jackett, damit sie darunter ihre Titten verstecken könne, er habe seiner Frau vorgeschwärmt, was für ein hübscher Kerl dieser Jesse sei, hübsch durchtrainiert, bei einigermaßen gedimmtem Licht werde sie nichts merken, und sie, Jetti, dürfe getrost alle ordinären Sprüche ablassen, die er ihr beigebracht habe, nur die Stimme müsse sie etwas tiefer halten. Er habe vor seiner Frau schon das halbe Leben von diesem Jesse nachgestellt, langsam müsse er sich etwas einfallen lassen, sie wolle ihn unbedingt kennenlernen, wahrscheinlich habe sie sich in ihn verliebt, am besten, er lasse ihn sterben, Lastauto drüber, fertig.
Jetti starrte unter schweren Augenlidern auf die Decke, auf die ihr Neffe gestarrt hatte durch Kindheit und Pubertät hindurch, bis er endlich aufgestanden und vors Haus getreten war, um seine Heldenreise zu beginnen. Es tat ihr leid, dass sie niemanden hatte, mit dem sie über Jamie und seine Witze und den mysterious superman Jesse reden konnte. Die einen würden es nicht lustig finden, die anderen würden sich darüber mokieren, die dritten beides. Der liebe mollige Hanno keines von beiden. Er würde seiner Tante jeden Spaß gönnen. Hatte er inzwischen herausgekriegt, wo die Welt beginnt? Jetti hätte ihn gern wieder einmal gesehen. Vielleicht hatte sich ja sein Vater ein Vorbild an ihm genommen. Wer könnte es ihm verdenken!
Aus der Küche hörte sie den Wasserhahn rauschen. Sie dachte, Hanna wird sich einen Tee machen wollen, schätzte ab, wie lange das dauern würde und ob sie derweil schnell über den Flur in die Toilette huschen könnte, denn die Blase drückte, und wieder zurückhuschen, ohne bemerkt zu werden. Sie rollte sich aus dem Bett, öffnete die Tür einen Spalt weit und sah gerade noch Hannas Ferse vorbeiflitzen, hörte die Tür zum Bad, und wie Hanna hinter sich abschloss … während das Wasser in der Küche weiterlief. Welchen Topf füllte sie auf, um Himmels willen! Wollte sie Nudeln kochen für zehn Personen? Sie räusperte sich, tat, als ob ihr die Klinke aus der Hand spränge, tapste hinaus in den Flur und hinüber zur Küche, so wohlgelaunt geräuschvoll, wie sich Tapsen in Schlapfen eben spielen lässt, gähnte, streckte sich, knurrte. Lauschte. Sie hörte die Klospülung im Bad, legte sich flink eine »normale« Körperhaltung an und einen »normalen« Gesichtsausdruck, bereit zu lächeln, wie man lächelt, wenn man am helllichten Nachmittag schlaftrunken in der Küche aufeinandertrifft. Lauschte. Zählte. Zehn Sekunden. Dann fiel die Tür zu Hannas Zimmer ins Schloss. Hat sie vergessen, dass sie den Wasserhahn in der Küche aufgedreht hat? Oder überlässt sie das Wasser mir? Das Wasser rann nicht in einen Topf, es verschwand im Abfluss. Einfach nur den Hahn aufgedreht? – Wie sollte das wieder gedeutet werden?
6
Sie hatte sich nicht einmal getraut, nach den Kindern zu fragen. Hätte das nicht das Erste sein sollen? Hätte man die beiden nicht verständigen müssen? Immerhin war ihr Vater von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Für Klara wäre es schwierig gewesen, nach Wien zu kommen. Sie war in Paris und bereitete sich auf ihren Abschluss am Institut d’Études Politiques vor und arbeitete bei einer Behörde der UNESCO. Über Hanno wusste Jetti eben leider nichts Näheres, nur dass er erst ein Physikstudium, dann ein Betriebswirtschaftsstudium, zuletzt eine Lehre als Automechaniker abgebrochen, beziehungsweise unterbrochen hatte. Wo er sich zur Zeit aufhielt, hatte ihr Robert in einem Telefonat irgendwann um Weihnachten herum erzählt, sie hatte es aber vergessen, und wahrscheinlich war er inzwischen schon irgendwo anders; er reise gern, hatte Robert in den Hörer geseufzt, und mache seinen Eltern nur wenig Mitteilung.
Sie schlich zurück in das Zimmer ihres Neffen, legte sich auf sein Bett und schief ein, und als sie erwachte, war es dunkel.
Das Bett roch nach altem Mann, nach Lagerfeuer und ungewaschenem Haar, das fiel ihr erst jetzt auf. Über dem Kopfende war eine Leselampe in den Bettrahmen geklemmt. Sie funktionierte nicht, womöglich war die Glühbirne kaputt. Sie tastete sich durch das Zimmer zur Tür und schaltete das Licht an. In der Deckenlampe steckte eine Sparbirne, die wenig und ein deprimierend düsteres Licht gab und erst allmählich den Raum erhellte, ihm aber nicht die Atmosphäre einer freudlosen Zelle nehmen konnte. Sie schob Hannos Schreibtischstuhl in die Mitte des Raumes, die gepolsterte Lehne roch wie das Bett, stieg darauf und drehte die Birne aus der Fassung. In der Dunkelheit suchte sie die Leselampe und tauschte die Glühbirnen aus. Sie holte aus ihrem Koffer den Flacon Serge Lutens – sie erinnerte sich, dass sie das Fläschchen in die untere Ecke der rechten Kofferhälfte gepackt hatte, eingewickelt in eine Strumpfhose; sie fand es an einer anderen Stelle –, sie verteilte ein paar Tropfen auf Kopfpolster, Laken und Tuchent. Wie hatte es Hanno in diesem Zimmer aushalten können? Bei diesem Licht! Bei diesem Geruch. War es sein Geruch? Wenn man einen Geruch schätzen könnte wie das Alter eines Menschen, dann diesen zwischen siebzig und achtzig oder noch älter. In den Holzrahmen an der Längsseite des Bettes waren mit Kugelschreiber Hieroglyphen eingeritzt. Dass hier der hübsche Hanno zusammen mit seinen hübschen Ideen gehaust haben soll? Ab wann hatte sie sich mehr seiner Schwester zugeneigt? Was war der Grund dafür gewesen? Klara war spröder als ihr Bruder, sie wollte nicht gern angefasst werden, gegen Lob sträubte sie sich, Komplimenten misstraute sie oder bemerkte sie gar nicht. Sie war nicht hübsch, aber anziehend; anziehend war ihre Direktheit, ihr direkter Blick, der gar nichts Provozierendes hatte. Wenn man sie fragte: Hat es dir geschmeckt?, musste man gefasst sein, dass sie sagte: Nein. Und wenn man sie fragte: Worauf freust du dich, Klara?, konnte es sein, dass sie antwortete: Auf nichts. Dabei sah sie einen an, ohne Bitterkeit, ohne Ironie oder Sarkasmus, als hätte sie auf eine Frage geantwortet wie: Regnet es? Manchmal hatte sie Ahnungen. Darüber war Jetti schon erschrocken. Einmal hatte Klara sie in der Nacht zu sich gerufen, da war sie vielleicht vierzehn gewesen, sie war im Nachthemd auf ihrem Bett gesessen und hatte gesagt: »Mama wird krank, sie wird sehr krank«, und eine Woche später hatte sich Hanna eine gefährliche Lungenentzündung eingefangen, und Klara hatte Jetti angefleht, niemandem zu verraten, dass sie die Mama im Bett habe liegen sehen und wie sie nur schlecht Luft bekommen habe, sie traue sich nicht, die Augen zuzumachen, sie habe Angst, sie sehe wieder so etwas. An zwei, drei ähnliche Szenen erinnerte sich Jetti, die allerdings Harmloses betrafen. Es war auch nicht leicht, Klara zu trösten, sie war eine gute Schülerin gewesen, aber es war vorgekommen, dass sie eine Schularbeit verhaute; dann war sie wie zerschmettert und ließ niemanden an sich heran. Hanno dagegen war verschmust, noch als Zwanzigjähriger hatte er sich, wenn seine ›schöne Tante‹ auf Besuch war, vor sie hingekniet und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt, und sie hatte mit den Fingernägeln geknipst, als würde sie Läuse im Urwald seiner Locken zerdrücken. Nach Motoröl hatte er gerochen.
Das Telefonat um Weihnachten war nicht das letzte gewesen, das Jetti mit ihrem Bruder geführt hatte. Vor drei Monaten, im Februar, hatte sie ihn angerufen. Am Abend vor ihrem Geburtstag. Sie wusste, er würde ihren Geburtstag vergessen. Darum rief sie ihn immer am Tag davor an. Und immer war ihm während des Telefonats eingefallen, warum sie anrief, und er hatte ihr im Voraus gratuliert. Diesmal nicht. Diesmal hatte er es versäumt. Sie meinte, sich zu erinnern, dass er einen glücklichen Eindruck auf sie gemacht hatte. Sie meinte, sich sogar zu erinnern, dass er es ausgesprochen, dass er gesagt hatte, er sei glücklich. »Jetti, ich bin glücklich.« Warum hatte sie sich damals nicht gewundert? Jetzt wunderte sie sich. Das Wörtchen »glücklich« war so gar nicht für Roberts Stimmbänder erfunden worden. Es war schon ziemlich spät gewesen, als sie ihn angerufen hatte. Er war in seiner Praxis. Sie hatte ihn gefragt: »Was tust du denn so spät noch in deiner Praxis, Robert?« Er hatte geantwortet: »Ich bin einfach mit mir allein.« Dreimal hintereinander hatte er das gesagt. »Einfach nur mit mir allein. Mit mir allein.« Erst so betont, dann anders, dann wieder anders. Daran erinnerte sie sich. Und nun fiel ihr noch etwas ein. Er hatte gesagt: »Jetti, ich glaube, ich muss Urlaub machen.« Und sie hatte gefragt, ironisch natürlich: »Urlaub, Robert? Du? Um Himmels willen! Bist du erschöpft? Du sitzt ja nur da und hörst irgendwelchen Leuten zu. Kriegst jeden Tag bewiesen, dass es anderen schlechter geht als dir. Wie kann das einen vernünftigen Menschen erschöpfen? Fahr ins Waldviertel! Nach Hawaii traust du dich ja nicht.« Und er hatte gesagt: »Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich höre meinen Patienten ja nicht wirklich zu, ich höre mir nur alles an. Sie suchen vor meinen Ohren, was sie verloren haben. Was denkst du denn, wie anstrengend das ist! Ich muss von mir selbst Urlaub machen!« und hatte schallend gelacht. »Einfach nur da sein und nachdenken, das will ich. Was soll ich im Waldviertel! Das kann ich überall. Weißt du, wie wohl das tut? Da sein und nachdenken.« Eigentlich habe er schon um sechs Uhr nach Hause gehen wollen, da habe er sich noch an seinen Schreibtisch gesetzt und sei sitzen geblieben und habe nichts anderes getan als denken. »Und worüber denkst du nach?«, hatte sie ihn gefragt. Und ihr fiel ein – und ihr Herz schlug nun heftig –, was er geantwortet hatte. »Ich denke nicht über etwas nach, ich denke nicht einmal nach, ich denke einfach, und nicht einmal ich denke, es denkt.« Das hatte er ihr geantwortet. Damals hatte sie sich darüber keine Sorgen gemacht. Jetzt war sie sich gewiss, über so eine Antwort musste man sich Sorgen machen. Wenn einer wie ihr Bruder so etwas sagte, dann musste man sich Sorgen machen. Oder nicht? Seine Patienten, sagte er, suchen, was sie verloren haben. Jetzt ist er selbst verlorengegangen.
Schon war der erste Tag dahin. Jetti legte das Ohr an die Wand und lauschte.
»Hanna?«, sagte sie. Aber so leise, dass sie sich selbst kaum hörte. »Ich bin wieder gut, Hanna, sei auch du wieder gut mit mir.«
7
Sie ernährten sich von Brot mit Marmelade, Brot mit Schinken, Brot mit Käse, von Kakao, Tee und Kaffee. Am Morgen lag Hanna bis um zehn im Bett oder gleich bis über Mittag, sie unterschieden bald nicht mehr zwischen Tag und Nacht, sie ging im Pyjama von einem Zimmer zum anderen, bückte sich mit durchgestreckten Knien zum Eisschrank nieder, nahm irgendetwas Kleines heraus und aß es noch vor der offenen Eisschranktür. Es roch säuerlich in der Wohnung. Jetti schob die Vorhänge beiseite und riss die Fenster auf – besonders heftig, um anzuzeigen, dass sie es nicht hinnehmen werde, wenn Hanna sie gleich wieder schlösse – und sog die Luft ein, und weil sie gerade dabei war, sprühte sie Putzmittel auf die Scheiben und rieb sie ab. Und kehrte durch. Schob den Besen unter die Kästen, pflückte den Lurch aus den Borsten. Sie räumte den Spüler ein und räumte den Spüler aus. Wischte den Tisch ab. Wenn sie in der Vergangenheit zu Besuch gewesen war, hatte es verlässlich Vorwürfe gehagelt: dass sie so lange schlafe, dass sie nicht im Haushalt mithelfe, dass sie vor ihrem pubertierenden Neffen in T-Shirt und Slip herumlaufe und sich die Beine rasiere, dass sie ihre Sachen liegen lasse, wo sie gerade hinfallen, dass sie sich erst gegen Abend ins Bad begebe und dann ja doch nur, um sich für die Nacht aufzudonnern. Höchstens die Hälfte davon hatte zugetroffen.
Als sie schon einmal zusammen in dieser Wohnung gehaust hatten, sie und Hanna, weil Robert vor dem Unglück seiner Schwester davongelaufen war, da war Hanna eines Morgens vor der Tür zum Wohnzimmer gestanden, wo sich Jetti auf dem Sofa vergraben hatte, und hatte angeklopft und gesagt: »Jetti, sind wir wieder gut.« Hanna hatte sich zu ihr gesetzt, hatte ihren Kopf in die Arme genommen und ihr übers Haar gestreichelt. Ein Joghurtbecher war umgekippt in der Nacht und vom Glastisch auf das Parkett gefallen. Jetti hatte sich nicht durchringen können, den Boden zu wischen, sie hatte einfach ihre Bluse drübergelegt. Und Hanna hatte alles so sein lassen. Sie hatte nicht geputzt, sie hatte Jetti nicht gebeten zu putzen, sie hatte die Bluse liegen lassen, wo sie war, und auch Jetti hatte es nicht über sich gebracht, sie aufzuheben. Ein Widerwille war in ihr gewesen, sich zu waschen und frische Sachen anzuziehen. Sie hatte geglaubt, es liege daran, dass sie im Begriff war, von München nach Triest zu übersiedeln und sie hier nicht mehr und dort noch nicht sei. Eines Morgens in München war sie aufgewacht, ihr Herz raste, sie ließ sich in einer Apotheke den Blutdruck messen, der war zu hoch, sie ging zum Arzt, den ganzen Weg steckte ein Weinen in ihrem Hals, so dass ihr der Kehlkopf schmerzte, der Arzt beruhigte sie, alles sei in Ordnung. Sie ging ins Kino und wusste beim Hinausgehen nicht mehr, welchen Film sie gesehen hatte. Sie schaute auf das Plakat, las den Titel, nichts darauf kam ihr auch nur bekannt vor, und als sie weitereilte, als hätte sie ein Ziel, erinnerte sie sich nicht mehr, was auf dem Plakat gestanden hatte. Da war sie nach Wien zu ihrem Bruder gefahren. Weil sie dachte, sie habe ja sonst niemanden auf der Welt. Robert aber wollte ihr nicht zuhören, er sagte, das komme vor, besonders bei zur Egomanie und Grandiosität neigenden Menschen, das sei normal. Hanna aber sagte, man müsse sich um Jetti kümmern. Und das hatte sie getan. Über eine Woche waren die beiden Frauen allein in der Wohnung gewesen. Hanna war mit ihr durch die Stadt spaziert, und als Jetti nach hundert Metern sagte, sie wolle nicht mehr, sie wolle nach Hause, drehte sie mit ihr um, und als sie zu Hause sagte, sie halte es zwischen den Wänden nicht aus, begleitete sie Jetti die nächsten hundert Meter, und als sie es draußen wieder nicht aushielt, legte Hanna ihren Arm um sie, und Schläfe an Schläfe kehrten sie nach Hause zurück. In den Nächten hatten sie nebeneinander im Ehebett geschlafen, und als es Jetti zu eng wurde, sie aber doch nicht allein schlafen wollte, drehte sich Hanna, so dass ihr Kopf bei Jettis Füßen war. Am Ende sagte Hanna: »Jetti, sind wir wieder gut.« Jetti wusste, Hanna sprach nicht für sich, denn zwischen ihnen hatte es nichts gegeben in diesen Tagen, weswegen die eine die andere hätte bitten müssen, wieder gut zu sein. Hanna hatte für die Welt gesprochen, der sie angehörte, aber Jetti nicht mehr. – Solche Nähe war in dem folgenden Vierteljahrhundert zwischen ihnen nicht mehr gewesen. Dazu hätte Jetti erst wieder krank werden müssen.
Vor dem Schlafengehen trafen sie einander dann doch wieder in der Küche. Hanna kochte Milch auf und rührte Kakaopulver hinein und stellte zwei große, dicke Tassen auf den Tisch.
»In Hannos Zimmer tickt es«, sagte Jetti. »Aus den Ecken und den Kanten heraus tickt es.«
»Das sind Mäuse«, sagte Hanna. »Sie tun dir nichts.«
»Ihr müsstet eine Katze haben.« Jetti versuchte zu lachen.
»Das fehlte grad noch«, sagte Hanna.
8
So ging es weiter. Jetti war, als lebte sie allein in der Wohnung – aber es war ihr wert, sich nicht gehen zu lassen.
Und dann, am Abend des dritten Tages, rief Hanna ihren Namen: »Jetti!«, rief sie. »Jetti! Jetti! Wollen wir nachtmahlen?«
»Was für ein schönes Wort«, rief Jetti zurück und trat in die Küche, in dem weißen Kleid ohne Träger (das sie für alle Fälle eingepackt hatte); sie hatte ein ausgiebiges Bad genommen und vor dem Spiegel die nötigen Register gezogen. »Habe ich schon lange nicht mehr gehört, dieses Wort.«
»Ich habe es absichtlich gesagt.«
»Für mich?«
»Ja. Du siehst umwerfend aus, Jetti.«
»Danke, Hanna.«
»Berauschend. Anbetungswürdig!«
»Sag das bitte nicht, Hanna.«
»Nein, Jetti, ich frag nicht, ob du etwas vorhast. Denk bitte nicht, gleich haut sie mir wieder eins drauf. Das tu ich nicht, das verspreche ich dir.«
»Das hab ich doch gar nicht gedacht, Hanna. Du siehst auch gut aus. Du musst nichts dafür tun, ich schon. Zwei Stunden war ich vor dem Spiegel.«
»Das brauchst du doch nicht zu sagen, Jetti. Ich weiß, dass es nicht stimmt, und du weißt es auch.«
»Wer dich einmal gesehen hat, Hanna, der vergisst dich nicht. Das kann ich über mich nicht unbedingt sagen.«
»Man könnte das aber so oder so verstehen.«
»Ich meine es SO, Hanna.«
»Danke, Jetti.«
Wenn eine Zynikerin wie Hanna Lob ausspricht, dann musste man Obacht geben, und vielleicht sollte man sich Sorgen machen und in Deckung gehen – oder auch nicht, denn vielleicht war Hanna ja gar keine Zynikerin, vielleicht war sie nur immer wieder in Versuchung geführt worden, dieser Gedanke war Jetti schon öfter gekommen. Wenn hingegen ein wahrhaftiger Zyniker wie Robert sagt, er sei glücklich, dann musste man sich Sorgen machen, und man durfte nicht in Deckung gehen. Und wenn ein Psychiater und Psychoanalytiker wie Dr. Lenobel, 55, nachts in seinem Büro sitzt und nichts anderes tut als zuzusehen, wie es in ihm denkt, und wenn er ein halbes Jahr später verschwindet, dann können Frau und Schwester nicht sorglos nachtmahlen und sich dabei schöne Worte zustecken – in der Küche, wo er jeden Morgen und jeden Abend gesessen und sein Brot gegessen und seinen Kaffee und seinen Wein getrunken hat. Nein, das geht nicht!
Also nahm Jetti am Abend des Schabbat ihr Verhör wieder auf.
»Was hat er mitgenommen?«
»Was meinst du, Jetti?«
»Was er mitgenommen hat.«
»Du sprichst von Robert?«
»Natürlich spreche ich von Robert!«
»Nichts. Nichts hat er mitgenommen.«
»Er muss doch irgendetwas mitgenommen haben.«
»Wenn ich sage nichts, dann meine ich: nichts.«
»Keinen Koffer mit Wäsche?
»Das wäre ja etwas.«
»Bücher?«
»Ich habe gesagt: nichts.«
»Sein Handy?«
»Das ja. Aber er hebt nicht ab. Er hat es abgedreht.«
»Und Kontobewegungen? Gibt es Kontobewegungen?«
»Was meinst du nun wieder damit, Jetti?«
»Ob er von eurem Konto Geld abgehoben hat.«
»Wir haben kein Konto.«
»Das verstehe ich nicht … Jeder Mensch hat ein Konto … Was meinst du damit, Hanna?«
»Erstens hat nicht jeder Mensch ein Konto. Die Mehrheit der Weltbevölkerung besitzt kein Konto. Wo lebst du eigentlich, Jetti! Im Marzipan? Wir haben kein Konto. Wir. Wir haben kein gemeinsames Konto. Gibt es da etwas zu staunen, Jetti?«
»Gar nicht.«
»Gar nicht?«
»Nein.«
»Ich habe gedacht, du denkst: Sie haben gemeinsame Kinder, aber sie haben kein gemeinsames Konto.«
»Denke ich aber nicht, Hanna.«
»Dann ist es ja gut, Jetti.«
»Gut ist es nicht. Und du könntest auch bitte anders mit mir sprechen. Nichts ist gut, wenn mein Bruder verschwunden ist … Hanna, ich dachte doch nur, wenn er gar nichts mitgenommen hat, wie du sagst … er muss ja von irgendetwas leben. Hast du sein Konto kontrolliert? Ich bin mir sicher, dass die bei der Bank dir seine Auszüge zeigen. Du hast ihn immerhin als vermisst gemeldet, Hanna. Wenn er Geld abhebt, wüsste man, wo er Geld abhebt, und dann wüsste man, wo er ist …«
»Du redest nur von Geld, Jetti. Fällt dir das auf?«
»Ich rede doch nicht von Geld, nein …«
»Egal, was passiert ist, Jetti, du redest von Geld!«
»Aber ich habe doch nur nach Roberts Konto gefragt … das ist doch vernünftig …«
»Geld. Geld. Ich höre nur Geld. Woran liegt das, Jetti? Das muss doch einen Grund haben, dass du nur von Geld redest.«
Aber du kennst doch den Grund, Hanna. Juden reden immer nur von Geld. – Das hatte sie natürlich nicht gesagt. Wäre aber gut gewesen. Damit hätte sie das Maul ihrer Schwägerin für die nächsten paar Stunden gestopft. Und augenblicklich hatte Jetti ein schlechtes Gewissen: weil sie vermutete, dass sie sich Hanna gegenüber genauso mistig verhalten hatte, damals, als es ihr nicht gutgegangen war, wie sich Hanna jetzt ihr gegenüber verhielt; und weiter: weil sie auch mit aller Mühe nicht die ehrliche Sorge in sich aufbrachte, die erwartet werden musste, wenn der Bruder verschollen war; und weiter: weil sie sich nicht ein einziges Mal im Büro in Dublin gemeldet hatte, obwohl ihr Handy fünfzig Anrufe in Abwesenheit anzeigte und sie wusste, dass sie Entscheidungen zu fällen hatte, die ihr niemand abnehmen konnte; und weiter: weil sie noch kein einziges Mal das Grab der Mutter besucht hatte und es auch nicht zu besuchen beabsichtigte; und dann grad auch noch: weil ausgerechnet sie, die so viel Wert darauf legte, dass ihr Bruder ihren Geburtstag nicht vergaß, regelmäßig den Geburtstag ihrer Nichte und den Geburtstag ihres Neffen vergaß und ihnen auch nicht nachträglich Geschenke schickte, wie sie es jedes Mal am Telefon versprach – immerhin war sie als Kvaterin ausgewählt worden und hatte den winzigen Hanno vor seiner Beschneidung aus den Händen des Mohel entgegengenommen, eine Verpflichtung, bitte! »Das ist eine Verpflichtung«, hatte Robert sie ermahnt. »Ich würde sogar sagen, das ist eine große Verpflichtung«, hatte Hanna nachgelegt, als wären die beiden tatsächlich Schulze und Schultze. Bis heute machte sie diese Erinnerung fuchsteufelswild, zumal weder ihrem Bruder noch ihrer Schwägerin die Brit Mila je mehr bedeutet hatte als kuriose Folklore, ein vorübergehender Chic, ein Ritual, das die beiden weniger ernst nahmen als sie, Jetti, die immerhin rundum und immer ein schlechtes Gewissen hatte – mehrere sogar.
»Ach, Jetti, hör auf!«, sagte Hanna und stolzierte ab und davon.
9
In der Nacht erwachte Jetti, sie schaute nicht nach der Uhrzeit, es war dunkel, das genügte ihr. Sie ging ins Wohnzimmer, legte sich auf das Sofa, wickelte sich in eine der Wolldecken, aber sie schlief nicht wieder ein. Sie wollte kein Licht machen, sie holte ihr Handy, das sie seit einiger Zeit über die Nacht in ihrem Koffer versteckte, und aktivierte die Taschenlampenfunktion. Der Lichtkegel war kalt bläulich und zeigte die Dinge in kaum wahrnehmbaren Farbunterschieden. Sie richtete das Licht auf das Bild, das im Wohnzimmer über dem Sofa hing und die ganze Wand einnahm, gute zwei Meter lang und über einen Meter fünfzig hoch. Robert und Hanna hatten dieses Riesending von ihrer Hochzeitsreise mitgebracht, der einzigen gemeinsamen Reise über Europa hinaus. Rings um die USA waren sie gefahren, hatten in New York einen Chrysler Winnebago gemietet, waren über die Neuenglandstaaten nach Norden gefahren, dann nach Westen zu den großen Seen, weiter nach North Dakota und Montana und nach Süden, nach Kalifornien und über New Mexico, Texas, Alabama, Georgia hinauf nach Virginia und zurück nach New York. In Chicago hatten sie das Bild auf der Straße vor einem Antiquitätengeschäft gesehen, und Hanna hatte sich in das kuriose Stück verliebt und den Händler so weit heruntergehandelt, bis schließlich auch Robert einverstanden war, es zu kaufen. Es sollte ein gegenseitiges Hochzeitsgeschenk sein. Der Transport per Schiff nach Europa und dann weiter von Rotterdam in einem LKW nach Wien hatte das Dreifache gekostet. Das Ding war das Sinnbild ihrer Verbindung. Es war eine Reklametafel. Geworben wurde für die Joseph Schlitz Brewing Company in Wisconsin. Der Name stand in schlichter, selbstbewusster Schrift über der Szene, darunter: »The beer that made Milwaukee famous.« Datiert war es auf das Jahr 1933, in diesem Jahr war die Prohibition in den USA aufgehoben worden. In geradezu fotografischem Realismus zeigte es auf milchig grünem Untergrund die Gebäude der Brauerei und die umliegende Landschaft mit Straßen und Wegen und Parkanlagen. Kupferne Braukessel waren durch die Fenster der Betriebshalle zu sehen, davor tummelten sich detailversessen naturalistisch gemalte Männer mit Schiebermützen und verschiedenfarbigen Wämsern unter ihren Jacken, sie rollten Fässer oder schoben Sackkarren und Karetten, auf denen Säcke mit Malz gestapelt waren, manche trugen Handschuhe, andere nicht, in ihren Brusttaschen steckten Zigarettenschachteln, sogar die verschiedenen Marken waren zu erkennen. Pferde standen bereit, vor Wägen gespannt, auf den Böcken saßen die Kutscher und unterhielten sich, einer reichte einem anderen ein brennendes Zündholz hinüber. Aus einer schwarzen Limousine, die eben angekommen war, winkte Mr Schlitz, der Besitzer, den Zylinder hielt er in der Hand, ein Goldzahn blinkte. Arbeiter grüßten lachend zurück, schwenkten ihre Mützen, zeigten den aufgestellten Daumen. Mit dem Brauereigebäude verbunden durch einen überdachten, verglasten Gang war der Verwaltungstrakt. Auf einem der Balkone konnte man Angestellte sehen, Ärmelschoner über den Ellbogen, sie legten eine Pause ein, rauchten Zigarillos und lachten über einen Witz, der Erzähler war von den Zuhörern deutlich zu unterscheiden. Etwas abseits in einem Park, der mit seinen symmetrisch verschlungenen Wegen einem barocken Garten nachempfunden war, spielten weißgekleidete Damen mit weißen Hütchen Crocket, vornehme Herren, Großkunden der Brauerei, schauten ihnen zu. Weit im Hintergrund warteten Bagger und Kräne darauf, das Betriebsareal zu erweitern. Das Bild, so erklärten Robert und Hanna den Bewunderern, sollte nach den Jahren des Alkoholverbots zeigen, was für eine gute Sache ein gutes Bier sei, etwas für fortschrittliche wie konservative Menschen, kultiviert, zivilisiert, positiv. Die Stadt Mainz, woher Joseph Schlitz ursprünglich stammte, hatte irgendwann ein großzügiges Angebot gemacht, der Stadtrat hätte das Bild gern im Stadtmuseum aufgehängt. Robert und Hanna hatten darüber nicht einmal nachgedacht.
Jetti sah sich das Bild zum ersten Mal genau an. Sie war auf das Sofa gestiegen und hielt den Lichtschein nahe an jedes Detail. Sie war immer eifersüchtig auf das Bild gewesen; es war eine so offensichtliche Sensation, und weil es ein gegenseitiges Ehegeschenk war, ein unübersehbares Symbol. Eine Reklametafel wurde zu einer Ikone stilisiert, das durfte man doch ein wenig lächerlich finden, und die dezenteste Art, dies zu tun, war, wenig Aufhebens davon zu machen. Deshalb hatte sie das Bild bisher ignoriert, soweit das möglich war. – Noch etwas fiel ihr auf: Entlang des rechten Randes war das Blech nicht wie an den anderen Rändern nach innen gebogen zu einer Art Rahmen; hier war es abgeschnitten worden, mit einer Blechschere, oder abgeflext. Der Rand war scharfkantig; wenn man darüberstrich, konnte man sich empfindlich verletzen. Der Schnitt war über die ganze Länge verrostet, Farbe war abgeblättert. Über das Bild war viel gesprochen worden, darüber aber nie.
Nun, da sie es sich angesehen hatte, wollte sie nicht mehr unter dem Bild schlafen, sie wollte nicht, dass Mr Schlitz und seine Angestellten, der Prokurist und die Schreiber, die Bierfahrer und die Pferde, sie wollte nicht, dass die Kunden von Mr Schlitz und die Damen der Kunden, die Tauben auf dem Dach und der Hund, der aus einer Bierlache leckte – dass all die Wesen aus Farbe und Rost ihr beim Schlafen zuschauten, das wollte sie nicht. Aber ihr Körper war so schwer, sie musste damit rechnen, dass ihre Beine sie nicht trügen, dass sie einknickten und sie niederfiel und sich verletzte, dann hätte sie gewiss nicht mehr die Kraft, Hanna um Hilfe zu rufen, und Hanna würde vor morgen Mittag nicht aus dem Bett kommen, und so eine lange Nacht im Elend könnte das Leben kosten. Darum kroch sie auf Knien und Händen aus dem Wohnzimmer, kroch über den Flur, und als leuchtete aus ihren Augen der bläuliche Schein ihres Handys, sah sie den Parkettboden nahe unter sich, konnte jede Ritze unterscheiden, jeden Kratzer, jede Schramme, Zeugen, dass hier gelebt worden war. Welche dieser Merkmale stammen von Robert? Welche von mir? Die kleinen runden Dellen habe ich gemacht, mit meinen Stöckelschuhen. Dass der Weg um so viel weiter war, wenn man ihn auf den Knien zurücklegte! Da war sie auch schon am Rand und blickte hinunter … wo das Meer schäumte, auf dem mancherlei schwamm.
10
Als sie Kinder waren, hatten Jetti und ihr Bruder »Zum-Lachen-Bringen« gespielt. Wer zuerst lachte, der hatte verloren. Sie hatten sich einander gegenübergesetzt und sich angesehen. Wer den Blick abwendete, wurde disqualifiziert, wer etwas sagte oder aufstand, wurde ebenfalls disqualifiziert. Immer war Robert Sieger gewesen. Jetti hatte sich bemüht, ein Gesicht aufzusetzen, das aussah, als würde sie gleich mit vollem Lachen herausplatzen. Sie presste die Lippen zusammen, verdrehte die Augen, schielte. Sie dachte, das sei ansteckend. War es auch. Es steckte sie selber an. Und bald platzte sie tatsächlich mit vollem Lachen heraus. Roberts Gesicht aber blieb unverändert starr, leer und ausdruckslos. Sie fragte ihn, wie er das anstelle. Er denke, er sei tot, antwortete er. Sie sagte, das wolle sie ihm nachmachen, und sie schaute ihn an und dachte, sie sei tot, und es funktionierte, sie musste nicht lachen. Erst dachte sie, wie würde es sich anfühlen, wenn ich tot wäre; dann dachte sie, wenn ich tatsächlich tot wäre, würde sich eben nichts mehr anfühlen. Bei den Füßen würde es beginnen, dachte sie. Und es begann bei den Füßen. Sie spürte die Füße nicht mehr. Dann die Unterschenkel. Dann die Knie. Dann die Oberschenkel. Sie dachte, ich darf nicht denken. So dachte sie nicht an die Hände, nicht an die Unterarme, nicht an die Oberarme, nicht an die Schultern und spürte die Hände, die Unterarme, die Oberarme, die Schultern nicht mehr. Wenn ich den Kopf nicht denke, dachte sie, dann bin ich tot. Solange ich aber denke, ich bin tot, dachte sie, bin ich noch nicht tot. So saß sie ihrem Bruder gegenüber und dachte, er denkt das Gleiche wie ich. Sie dachten, sie seien tot, und lachten nicht, eine halbe Stunde oder länger saßen sie so, und wenn Jetti nicht irgendwann gesagt hätte, jetzt wolle sie nicht mehr, ihr sei langweilig, sie erkläre sich freiwillig zur Verliererin für alle Zeiten, dann säßen sie immer noch in der Küche und starrten einander ins Gesicht, denn nie, nie, nie hätte Robert aufgegeben.
Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.
Mit Zynismus konnte Jetti nicht umgehen. Nach Zynismus musste sie Musik hören, um wieder dorthin zurückzukehren, wo der Mensch anfängt. Am besten Schubert. Und immer am besten die Winterreise. Diese Vorliebe teilte sie mit ihrem Bruder. Ohne dass er von dieser Gemeinsamkeit wusste. Sicher war Robert dabei ihr Vorbild gewesen, wie bei so vielem anderen auch: Adorno las sie, als er Adorno las, Robert Burtons Buch über die Anatomie der Melancholie las sie, als er es las, und sie besorgte sich ein Reclam-Heftchen mit Gedichten von Georg Trakl. Er hatte den Schubert viel nötiger als sie, das war ausgemacht. Aber hätte sie ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass auch sie den Franz Schubert von Herzen lieb hatte, dann wären ihm aus dem Gelenk heraus eine Handvoll hässlichster, aber unwiderlegbarer Gründe eingefallen, warum es dumm, abgedroschen, einfältig, überholt und peinlich konventionell sei, Schubert »lieb zu haben«. Und sie hätte sich wahrscheinlich nicht getraut zu antworten: He, ich hab dich doch gesehen, als ich aus der Schule kam, da bist du dagesessen auf dem Sessel in der Küche, die Augen zu, und hast Die Krähe auf deinem Plattenspieler gehört und hast geglaubt, du seist allein in der Wohnung, und vor lauter Liebhaben hast du nicht gemerkt, dass ich in der Tür gestanden bin und zugeschaut habe, wie sich deine Brust gehoben und gesenkt hat.
Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl, bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen?
Ihr Charakter sei geprägt von einer Portion »zünftig Oktoberfesthaftem« – diese hinterhältigste aller hinterhältigen Punzen hatte ausgerechnet er ihr aufs Fell gehämmert. In ihren Zwanzigern hatte sie in München als Lektorin in einem Verlag gearbeitet und war mit einem Elektriker liiert gewesen, von Angesicht kein schöner, von der Statur aber ein wahrhaft prächtiger Mann, der ihr das Bier schmackhaft gemacht und »einen Satz roter Ohren« (Hanna) gekriegt hatte, als sie ihn ihrem Bruder und ihrer Schwägerin vorstellte und Ersterer ihn fragte, ob er der »lustige Knopf« sei, von dem seine Schwester so schwärme, und Letztere ihre Blicke bis in die hintersten Ecken des Mannes schickte und kommentierte, Schönheit brauche offenbar Kontrast, um zu wirken, und sogar wagte, seinen Bizeps zu drücken und zu fragen, ob er trainiere, worauf Robert erklärte, in »Bodybuilder-Kreisen« spreche man nicht von »trainieren«, sondern von »definieren«, und Hanna, als hätten sich Mann und Frau zu einer Doppel-Conference abgesprochen: »Definieren aber anders definiert, als man in den Lektorenkreisen von Magistra Lenobel gewohnt ist zu definieren, was definieren heißt, wenn ich recht verstehe.« Dieses »Gespräch« hatte während des Oktoberfestes stattgefunden, auf teuren, reservierten Plätzen im großen Festzelt, die Maß Bier 8 Mark, Eisbein mit Kraut und Knödel 24 Mark. Jettis Freund hatte sich so sehr auf diesen Abend gefreut, er hatte sie alle eingeladen – »der Elektriker«, wie ihn das feindliche Ehepaar mit bestialischer Sturheit nannte (ebenso, wie Hanna an diesem Abend von Jetti nur als der »Frau Magistra« sprach, obwohl sie ja wusste, dass ihre Schwägerin – nicht anders als sie selbst! – ihr Studium nicht abgeschlossen hatte). Jetti war sprachlos gewesen vor Scham und Zorn. »He, Schwester,« hatte ihr Robert, als Kadenz sozusagen, ins Ohr gebrüllt, in Kauf nehmend, dass die Blasmusik auf der Bühne plötzlich abbräche und alle rundherum ihn hören könnten, »he, ihr beide habt doch gerade so viel gemeinsam wie Salutschüsse und Salatschüssel!« – ein Witz in doppelter, widersprüchlicher Mission: einmal, um sie noch mehr zu kränken, und zugleich, um sie zu trösten, denn wer über Roberts Witze nicht lachte, der war naturgemäß untröstbar und für ein würdiges Menschtum in gesundem Humor sowieso verloren. Hätte sie weinen können, wozu schöne Menschen offenbar nicht imstande sind, hätte sie geweint, buchstäblich bitterlich.
Danach hatte sie sich nicht mehr bei ihrem Bruder gemeldet. Und sie hatte vor, es auch nicht mehr zu tun. Nie mehr. Erst als er sie fünf Monate später zu ihrem Geburtstag anrief und herumstammelte, dass er sie vermisse und dass sie ihn ja kenne, dass manchmal ein Hund in ihm belle und ein Skorpion in ihm steche und so weiter, da war sie in ihrem Herzen wieder mit ihm gut. Die Affäre mit dem »Elektriker« war ja auch schon beendet. Dass es »nur« eine Affäre gewesen war, erfuhr sie, als er – schon im Weggehen und über die Schulter hinweg – sagte, seine Frau habe die ganze Zeit geduldig auf ihn gewartet. Jetti hatte nicht gewusst, dass er verheiratet war.
Nun, es wird nicht weit mehr geh’n
An dem Wanderstabe.
Krähe, lass mich endlich seh’n
Treue bis zum Grabe!
Was hätte Robert geantwortet, wenn er sich damals, als sie aus der Schule nach Hause kam, umgedreht und sie gesehen hätte, wie sie im Türstock stand und ihn beobachtete, den Bruder, den weinenden, der den Franz Schubert lieb hatte? – Ha, hätte er ausgerufen und sich schnell die Tränen abgewischt, natürlich habe ich gemerkt, dass du da stehst, ich wollte dir nur vorführen, wie blöd einer aussieht, wenn er … und so weiter … und noch viel Giftigeres. Auch sich selbst schonte er nicht, sein Zynismus war ihm ein höheres Gut als die Unversehrtheit der eigenen Seele.