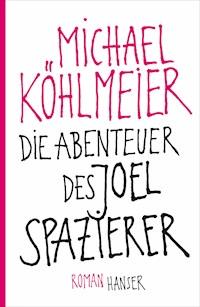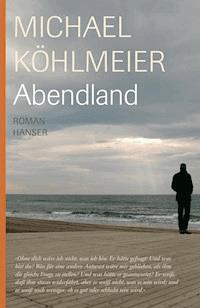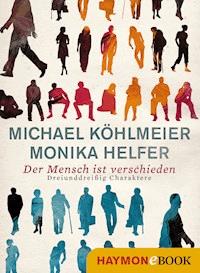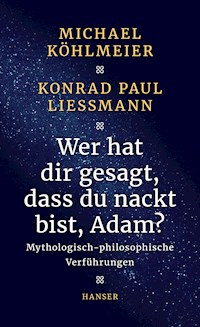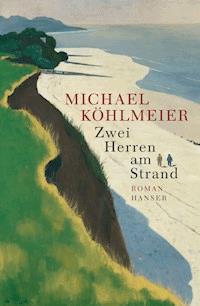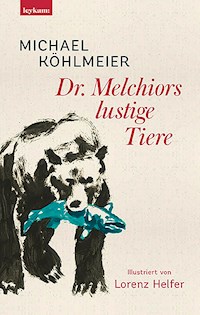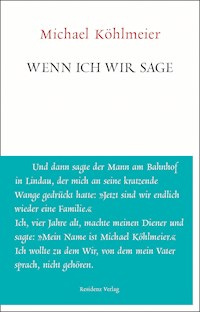Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mitreißende Schwärmereien des „begnadeten Kulturerklärers Michael Köhlmeier“ Iris Radisch, Die Zeit
Eine Verführung zum Lesen, Hören und Offen-in-die-Welt-Schauen: Michael Köhlmeier lädt ein zu einer ganz persönlichen Reise, von Tolstoi über Mozart bis zu Batmans Joker. Zu wem spricht Kunst? Hat Shakespeare das Menschliche erfunden – oder gar den Menschen? Hat Bob Dylan die schönste Ausformung antiker Lyrik geschaffen? Was ist überhaupt das Schöne? Michael Köhlmeier flaniert durch die Welt – und verbindet sein Staunen mit den großen und kleinen Fragen der Gegenwart. Er zelebriert alle Facetten eines intellektuellen Savoir-vivre und entwirft eine kleine Schule des klugen Schwärmens. Dieses Buch ist der ideale Begleiter für alle, die sich begeistern lassen wollen für das Schöne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mitreißende Schwärmereien des »begnadeten Kulturerklärers Michael Köhlmeier« Iris Radisch, Die ZeitEine Verführung zum Lesen, Hören und Offen-in-die-Welt-Schauen: Michael Köhlmeier lädt ein zu einer ganz persönlichen Reise, von Tolstoi über Mozart bis zu Batmans Joker. Zu wem spricht Kunst? Hat Shakespeare das Menschliche erfunden — oder gar den Menschen? Hat Bob Dylan die schönste Ausformung antiker Lyrik geschaffen? Was ist überhaupt das Schöne? Michael Köhlmeier flaniert durch die Welt — und verbindet sein Staunen mit den großen und kleinen Fragen der Gegenwart. Er zelebriert alle Facetten eines intellektuellen Savoir-vivre und entwirft eine kleine Schule des klugen Schwärmens. Dieses Buch ist der ideale Begleiter für alle, die sich begeistern lassen wollen für das Schöne.
Michael Köhlmeier
Das Schöne
59 Begeisterungen
Hanser
für Monika — unser lebenslanges Gespräch
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Michael Köhlmeier
Impressum
Inhalt
Stolz und Pathos
Anna Karenina
Mehr als unendlicher Spaß
Unser Wilhelm Busch
Die Abenteuer des Huckleberry Finn
Wir Turmbaumeister
Odyssee
Über das Tragisch-Komische
Der Zauberberg
Philip Roth: Amerikanisches Idyll
Simply the Blues
Beckett nicht vergessen!
Das doppelte Lottchen
Herz der Finsternis
Über Hamlet nachdenken
Der alte Mann und das Meer
Herman Melville: Billy Budd
Georges Simenon: Die Verlobung des Monsieur Hire
Eudaimonia
Michael Kohlhaas
Über das Böse lachen
Richard Ford: Optimisten
Kulturelle Aneignung
Der Struwwelpeter
Der Augenblick
Hundert Jahre Einsamkeit
Alleinsein
Fjodor Michailowitsch Dostojewski: Erniedrigte und Beleidigte
Täter-Opfer-Umkehr
Und wieder: König Lear
Das Schöne — was ist das?
Agatha Christie: Alibi
Dichtung und Wahrheit
Frankenstein oder Der moderne Prometheus
Alter weißer Mann
Franz Michael Felder: Aus meinem Leben
Die Anwälte
Marlen Haushofer: Die Wand
Kunst ist Als-ob
Wilhelm und Jacob Grimm: Kinder- und Hausmärchen
Ding und Unding
Raymond Roussel: Locus Solus
Zeit und Ziel
Friedrich Dürrenmatt: Das Versprechen
Das Gegenteil aller Wünsche
Mr. Tambourine Man
Blumfeld, ein älterer Junggeselle
Mein Recht
Robinson Crusoe
Keith Richards’ linker Unterarm
»Dem Ingeniör ist nichts zu schwör«
Don Juan
Michail Bulgakow: Der Meister und Margarita
Können wir Krieg?
Johannes Mario Simmel: Das geheime Brot
Matthäus 11,3: »Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?«
Radetzkymarsch
Der Witz von den zwei jüdischen Attentätern
Priamos im Zelt des Achill
Stolz und Pathos
Es ist viele Jahre her, da hörte ich zum ersten Mal Mozarts 40. Symphonie, dirigiert von Karl Böhm — es war eine hoffnungslos zerkratzte Schallplatte. Schon der erste Satz erschien mir wie ein Wunder. Ich galoppierte in die Musik hinein, als säße ich auf einem Pferdchen und hätte nur halb so viel Gewicht. Nach hundertmal Abhören, Auflegen, Abhören, Auflegen war die Platte dahin, und ich kaufte mir eine neue, wieder mit Karl Böhm am Dirigentenpult. Ich lernte das Musikstück bis in jeden Ton hinein kennen, ich konnte alle vier Sätze auswendig — aber ich begriff sie nicht. Diese Musik war das Substrat des Unbegreiflichen, dem wir in aller Kunst begegnen. Und auf einmal war ich von Stolz erfüllt, aber eben nicht von einem heiligen Stolz, der ja, allein des Wortes wegen, auf ein göttliches Wesen hinweisen würde; ich war stolz, derselben Gattung anzugehören, der Mozart angehörte: Ich war stolz, ein Mensch zu sein. Und war doch erst so jung und hatte noch so viel Menschsein vor mir.
Ich diskutiere mit einem guten Freund, er ist Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor. Ich sage, der Mensch muss Literatur, Kunst, Theater, Musik wollen, brauchen tut er dies alles nicht. Er sagt, nein, der Mensch braucht Kultur. Und er begründet es damit, dass wir in unserem Dauerkampf gegen die Natur untergehen würden, längst untergegangen wären, spätestens, nachdem uns Nietzsche den Tod Gottes gemeldet hat, wenn wir, die wir allein im Universum sind, nicht das Fähnchen unserer Identität hochgehalten hätten und immer hochhalten, und das könne einzig dadurch geschehen, dass wir stolz darauf sind, Menschen zu sein. Es gebe, so fährt er fort, weiß Gott genug, was wir anrichten, auf das wir — noch einmal weiß Gott — nicht stolz sein können. Aber wenn uns ein »menschliches Wunder« begegnet — wie eben Mozarts 40. Symphonie —, dann, so mein Freund, erkennen wir unsere Größe, unsere Einmaligkeit und unsere Freiheit. Und deshalb brauchen wir Kultur.
»Wieso Freiheit?«, frage ich.
Er antwortet: »Weil es Freiheit bedeutet, nämlich äußerste Freiheit, wenn uns in solchen Werken der Kunst bewiesen wird, dass wir Menschen keinen Gott, keinen Kaiser, keinen Tribun brauchen, um uns selbst zu erheben, sondern allein uns selbst.«
Das ist Pathos.
Ich habe nichts dagegen. Aber man muss aufpassen. Pathos ist ein Hund. Pathos vereinnahmt ebenso, wie es ausschließt. Und Pathos lügt sehr oft. Oft ist Pathos ein Trick: Es transferiert ein Gefühl von seinem angestammten Adressaten auf ein anderes Feld — Beispiel: Die Liebe zum Vater wird als etwas Gutes, Edles, Schönes empfunden; hänge ich über die Nation den Begriff Vater, mache sie also zum »Vaterland«, dann übertrage ich dieses Gefühl auf ein historisch politisches Gebilde, das im Ganzen betrachtet nur wenig mit meinen Gefühlen zu tun hat, und es ist durchaus ratsam, sich zu fragen, welchen Zwecken diese Übertragung dient.
Ich habe nichts gegen Pathos, wenn es einem wahren Gefühl entspringt — dem Gefühl der Freude über die Großartigkeit des Menschen. Wenn ich Musik höre, wenn ich ein Gemälde betrachte — mir fällt ein, dass ich bei meinem nächsten Wienbesuch unbedingt wieder das Kunsthistorische Museum besuchen muss, um mir die Bilder von Pieter Bruegel anzusehen! —, wenn ich einen Roman lese, der mich in die innerste Herzkammer eines Menschen führt — zum Beispiel Kanada von dem amerikanischen Autor Richard Ford —, oder wenn ich ins Theater gehe, dann kann es sein, dass ich, ohne ihn zu begreifen, ahne, dass unser Leben einen Sinn hat und dass wir es sind, die den Sinn geben, und dies gerade dann, wenn wir ihn nicht begreifen.
Unsere Nachbarn hier auf dem Land erzählten mir — auch das ist schon sehr lange her, sie sind schon lange tot —, sie seien nur einmal in ihrem Leben in Wien gewesen, und da hätten sie sich von ihrer Tochter überreden lassen, im Burgtheater ein Stück von Shakespeare anzusehen, König Lear. Nie seien sie bis dahin im Theater gewesen und seit damals auch nicht mehr. Sie hätten befürchtet, das sei doch nichts für sie; sie seien sich sogar nicht einmal sicher gewesen, ob man sie hineinlässt. Dann aber hätten sie gesehen, dass neben ihnen Männer ohne Krawatte und Frauen in Turnschuhen gesessen seien, und da hätten sie sich gedacht, aha, wenn das geht, wird man uns auch nicht hinauswerfen. Wie ihnen das Stück gefallen habe, fragte ich sie. Es sei wunderbar gewesen, am Anfang hätten sie sich mit der Sprache noch etwas schwergetan, aber dann seien sie hineingekommen. Es sei ihnen zu kurz erschienen, obwohl es dreieinhalb Stunden gedauert habe. Sie hätten später noch oft darüber geredet, erzählten sie, und sie seien nicht immer der gleichen Meinung gewesen. Die Frau zum Beispiel habe mit dem alten König schon auch Mitleid gehabt, aber sie habe ihn auch ausschimpfen mögen; es gehöre sich nicht, die Töchter antreten zu lassen vor Leuten, die nicht Familie sind, und dann von ihnen zu verlangen, sie sollen eine nach der anderen sagen, wie sehr sie den Papa lieben. Der Mann sagte, ja, ja, sie habe schon recht, aber er sehe es doch etwas anders, er sei eben ein Mann, und die Männer, weil sie das ganze Leben außer Haus arbeiten müssen, kriegen zu wenig von der Liebe mit, und dann wollen sie am Ende alles auf einmal, das müsse man doch verstehen, ihm tue der König sehr leid. Es war ein langes Gespräch, das ich mit dem Ehepaar aus unserer Nachbarschaft über König Lear geführt habe. Am Ende fragte ich sie, warum sie denn später nie wieder ins Theater gegangen seien. Sie antworteten einhellig: Sie hätten gefürchtet, der wunderbare Eindruck wäre dadurch kleiner geworden.
Ich erzähle die Geschichte meinem Freund. Er sagt, ich hätte folgendermaßen argumentieren sollen: Größer wäre der Eindruck geworden. Das Gute verdünne sich nicht. Ein Gutes gebe dem anderen. Wer Macbeth gesehen hat, verstehe König Lear besser, wer Othello gesehen hat, könne sich besser in Professor Unrat aus dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann einfühlen; und wenn er sich Gedanken über Jago mache, verstehe er in Zukunft besser, eine Intrige abzuwehren. — Ich will meinem Freund glauben.
Wer Mozarts 40. Symphonie hört, hat ein Instrument gewonnen, um sich bei Shakespeare und bei all den anderen Werken der Literatur besser zurechtzufinden. Kunst hilft Kunst über alle Sparten hinweg. Und warum ist das so? Weil Kunst, Literatur, Musik, Theater nicht zum Menschen im Allgemeinen sprechen, sondern zu jedem einzelnen — und das heißt: zu mir. Es gibt im Spiegel nichts Schöneres, nichts Aufregenderes, nichts Interessanteres zu sehen als mich selbst. Ich entdecke in König Lear, dem alten verzweifelt Liebenden, mich selbst; in der absurden Hölle von Samuel Becketts Endspiel sehe ich meine eigene Leere in all ihrer absurden Buntheit; aus Bruegels Kinderspielen erklingt mein eigenes kindliches Jauchzen; aus Mozarts Musik weht mir Unerhörtes aus meiner Seele entgegen. Das Erhabene, was ist es anderes als Teilhabe an der Größe und Herrlichkeit des Menschen. Das Erhabene sind wir selbst.
So geht Pathos. Und das ist nicht schlecht.
Anna Karenina
»Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.«
In diesem kleinen Satz — dem wohl berühmtesten Anfangssatz der Romanliteratur — ist das Thema der folgenden mehr als tausend Seiten umrissen. Wenn es stimmt, dass die Keimzelle jeder Gesellschaft die Familie ist — gleich wie Familie definiert wird —, dann kündigt dieser Satz ein Gesellschaftspanorama an; und ich sage es gleich, ein umfassenderes hat es bis dahin in der Literatur nicht gegeben. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Harold Bloom stellt Tolstoi neben die Autoren der Bibel, neben Homer und Shakespeare auf den Gipfel des Parnass.
Anna besucht ihren Bruder, um dessen Ehe zu retten. Es gelingt ihr. Sie trifft auf Kitti, die Schwester ihrer Schwägerin, ein liebes, empfindliches Mädchen, das sich in den leichtlebigen Offizier Wronskij verliebt hat und hofft, er mache ihr endlich einen Antrag. In der Eisenbahn treffen Anna und Wronskij aufeinander, eine heimliche, unheimliche Leidenschaft beginnt. Anna ist die Mutter eines achtjährigen Sohnes, sie ist mit Karenin, einem ordnungsmächtigen, fantasielosen Beamten, verheiratet. Als ihre Affäre auffliegt, bittet sie ihren Mann um die Scheidung. Inzwischen ist sie schwanger von Wronskij. Karenin gibt seine Frau schließlich frei; der Sohn aber, so bestimmt er, bleibt bei ihm. Die Trennung von ihrem Kind kann Anna nicht verwinden. Sie gerät in eine Krise.
Als ich den Roman zum ersten Mal las, war ich ganz auf der Seite von Anna. Wronskij konnte ich nicht wirklich gut leiden, er erschien mir zu zögerlich, zu oberflächlich auch. Als er meint Anna zu verlieren, versucht er, sich das Leben zu nehmen. Ich hielt das für schäbige Taktik, ich habe ihm nicht geglaubt — und ich dachte, auch Anna glaubte ihm nicht. Anna war für mich die Heilige. Karenin fand ich einfach nur langweilig, stur und bösartig.
Mit fünfzig las ich den Roman ein zweites Mal, erst vor kurzem ein drittes Mal. Es war, als würde das Buch neu aufgeschlagen. Ich traf in Karenin einen einsamen, mitfühlenden, im Interesse seines Sohnes klar denkenden, klar urteilenden Mann, der weiß, dass er seine Frau verloren hat, der verletzt ist, aber keine Rache empfindet. Beim dritten Lesen war dieser graue, so gar nicht schillernde Mensch mein wahrer Held. In ihrer blinden Leidenschaft und Eifersucht, ihrem Wahn, interessiert sich Anna nicht für ihre kleine Tochter, die ja immerhin die Frucht ihrer Liebe zu Wronskij ist; Karenin aber nimmt sich des Kindes an, gegen alle Vorurteile seiner Zeit tut er das, für die Menschen um ihn herum ist das Mädchen ein Bastard, Karenin liebt es. Über Anna habe ich mich nun geärgert. Als junger Leser hatte ich ihre Leidenschaft, diese Amour fou, als etwas Heiliges bewundert — als ob Verliebtheit alles rechtfertigte.
Anna Karenina wurde als ein Doppelroman bezeichnet, weil zwei große Dramen ineinandergreifen — er ist viel mehr: Ein halbes Dutzend Handlungsstränge mit jeweils einem halben Dutzend Personen sind so kunstvoll verflochten, dass wir glauben dürfen, das Leben, wie es ist, wie es zu dieser Zeit war, aber auch, wie es immer sein wird, vor uns zu sehen.
Mehr als unendlicher Spaß
Vor der »Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft« — müssen wir uns vor der fürchten? Wenn sogar dem Teufel nichts anderes bleibt, als letztendlich dem Guten zu dienen? Ende gut, alles gut. Es gibt immer welche, die das Ende erleben, und mit denen freuen wir uns, auch wenn wir vor ihnen gestorben sind. — Nach dem Vorbild und unter Verwendung einer volkstümlichen Figur aus dem Mittelalter schuf Goethe mit seinem Mephistopheles einen neuen Mythos: den aufgeklärten, eloquenten, eleganten europäischen Zyniker, der das Papiergeld und den glatten, ökonomisch unwiderlegbaren Wirtschaftsliberalismus erfindet, dem die altmodische, unpraktische, unhygienische Hütte von Philemon und Baukis weichen muss. Mephistopheles war im alten Volksbuch vom Doktor Faust noch eine Schreckfigur, mehr gruselig als entsetzlich, eher ein Schausteller auf dem Jahrmarkt als der Fürst der Finsternis. Goethe hat aus ihm den Teufel der Aufklärung geformt. Die aufkommende Industrialisierung und die Festigung der bürgerlichen Märkte benötigten ein neues Bild, einen neuen Mythos des Bösen.
Die Welt muss in den Fugen bleiben — nur darauf kommt es an. Die Fugen der Welt, das sind die Motive und die Kausalitäten. Wenn wir wissen, warum etwas geschieht und in welcher Abfolge und dass die Abfolge logisch zwingend ist, dann scheint halb so wild, was mit uns geschieht. Die Eschatologie der Aufklärung — ja, das gibt es! — lässt uns zudem glauben — auch scheinen Glaube und Aufklärung auf diesem Feld einander nicht zu widersprechen —, dass sich die Welt und der Mensch hin zum Besseren »entwickeln«. Das in Anführungszeichen gesetzte Wort weist darauf hin, dass das Gute schon von Anfang an und in allem enthalten ist, es muss nur ausgewickelt werden, wie ein Bonbon eben. Goethes Mammutwerk ist ein hoher Lobgesang auf die Sinnhaftigkeit der Geschichte und stellt, so gesehen, das poetische Pendant zur Staatsphilosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel dar (und später auch zu Das Kapital von Karl Marx, wie uns der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer in seinem inzwischen klassischen Buch Faust Zweiter Teil. Die Allegorie des 19. Jahrhunderts vorführt).
Aber am Ende des optimistischen, von der Sonne überstrahlten Tages, in dem sich auch eine finstere Figur wie Mephisto recht wohl fühlte, kommt die Nacht; und im Schatten des Mondes verkümmern die Motive und die Kausalitäten, und die Teufel, die sich nun durch die Erde nach oben graben, sind keine eloquenten Zyniker mehr, mit denen man durchaus nicht ungern einen Abend verbringen würde, sondern nur böse. Schon die Romantik hatte eine Ahnung: Um böse zu sein, braucht es nicht mehr als — böse zu sein. Die Zerstörung benötigt keinen Plan. Was aber ist das reine Böse? Vor allem, was ist das moderne reine Böse? Gibt es heute wieder einen neuen Mythos des Bösen? Ist ein neuer Mythos fällig, um uns unsere Zeit begreifbar zu machen? Ohne eine Figur, die ihn trägt, ist ein Mythos nicht denkbar, er verkäme zur Theorie; in einer Figur erst verdichten sich die Ängste, die Vorlieben, die Vorurteile einer Zeit zur Kenntlichkeit. Gibt es heute so eine Figur, einen neuen Repräsentanten des Bösen?
In dem Märchen Herr Korbes tun sich die Tiere mit den Dingen zusammen, um einen Mann erst zu quälen und dann zu töten. Wir wissen nicht, warum sie es tun. Wir wissen nicht, was Tiere und Dinge dazu bewogen hat, eine Allianz gegen diesen Menschen zu bilden. Es benötigt keine großartige Interpretation, um uns davon zu überzeugen, dass mit dem Herrn Korbes wir gemeint sind, wir alle, also auch ich. Wir dürfen uns vielleicht einbilden zu verstehen, was Tiere denken, wenn sie überhaupt denken, und was sie fühlen, wenn sie überhaupt fühlen; was jedoch in den Dingen vor sich geht, in einer Nähnadel, einer Stecknadel, einem Mühlstein, das wissen wir nicht; da sind uns doch die Gedanken Gottes begreifbarer. Wilhelm Grimm hat in der letzten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Geschichte einen Satz hinzugefügt: »Der Herr Korbes muss ein böser Mann gewesen sein.« Damit war die Welt wieder in den Fugen, ein Motiv war gegeben: Nicht, dass man für einen bösen Mann gleich die Todesstrafe fordert, aber man weiß wenigstens, warum er umgebracht wurde.
Als Kind hat mich dieses Märchen sehr beunruhigt; in der Fassung, die mir von meiner Großmutter erzählt wurde, fehlte der letzte Satz. Als ich ihn als Erwachsener während meines Studiums las, kam er zu spät; ich glaubte ihn nicht, er vermochte die angeschlagene Ecke meines Weltvertrauens nicht mehr zu reparieren. Auch wenn mit dem angeklebten Motiv die Menschheit als Ganzes entlastet wurde, der Angriff der Tiere und der Dinge also nur diesem einen, dem angeblich bösen Herrn Korbes, galt, wurde ich den Gedanken nicht mehr los, dass wir, wir alle, bei den Tieren und den Dingen nicht gut angeschrieben sind. Ich hielt es für möglich und halte es immer noch für möglich, dass sogar das Sicherste, über das wir verfügen, nämlich Logik und Kausalität, ebenso Illusionen sind wie so viele andere Als-ob, die uns das Rangieren in der Welt leichter machen und auf die wir als natural born pragmatics nicht verzichten wollen und können. Ich werde nicht müde, auf Hans Vaihingers Philosophie des Als Ob hinzuweisen, ein Buch, das sich wie wenig andere um den Menschen in seiner ontologischen Verunsicherung kümmert.
Dem Teufel des 20. Jahrhunderts war mit fein gesponnener Literatur nicht mehr beizukommen. Der alte Gottseibeiuns hat sich die intellektuellen mephistophelischen Flausen abgeschminkt; er hat neu Anlauf genommen. Das Jahrhundert begann damit, dass die Welt erfuhr, wie König Leopold II. von Belgien im Kongo gewütet hat — die Hälfte der Bevölkerung hat er umgebracht. Dass so etwas überhaupt möglich ist! Dann der Genozid an den Hereros in Deutsch-Südwestafrika — achtzig Prozent des Volkes. Fortsetzung folgte in den Gräueln des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, im Holocaust, im stalinistischen Terror, im ukrainischen Holodomor, in Maos Kulturrevolution und in Pol Pots Steinzeitkommunismus … — Wovon hätte nach diesem 20. Jahrhundert ein neuer Mythos zu erzählen, wenn nicht vom Bösen?
Die Entstehung der Welt, von der alle großen Mythen zu allen Zeiten erzählten, hat sich die Naturwissenschaft zum Thema gemacht, und zwar auf eine Weise, die keinen Widerspruch duldet, weil jeder Widerspruch lächerlich wäre. Das Gleiche trifft auf die Apokalypse zu, den Untergang. Anfang und Ende, die Brennpunkte jedes Mythos, sind also fest vergeben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, Szenarien und Spekulationen darüber erweisen sich als phantastischer denn jeder Mythos — zugleich aber auch als unendlich langweilig. Der langsame Kältetod des ohnehin kalten Universums vermag niemanden in den Bann zu schlagen. Sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann irgendein Tonsetzer daraus eine Oper komponiert. Ragnarök gab dafür mehr her. Auch harte Astrophysiker sah man schon mit hingebungsvollen Augen und Ohren in Wagners Götterdämmerung sitzen.
Das Böse hingegen hat aller Verwissenschaftlichung standgehalten, es ließ sich weder ins Überschaubare psychoanalysieren noch juristisch knebeln, auch konnten all die Erzählungen in Buch, Film, Funk und Fernsehen seine raue Schale nicht abraspeln und den bitteren Kern so weit verdünnen, dass er uns nicht mehr das Innerste verätzt. Der Teufel hat von allen allegorischen Figuren am wenigsten Staub angesetzt. Er hält sich gleichauf mit dem Tod. Aber eine neue Erzählung vom Bösen? Ein neuer, nachaufklärerischer Teufel? Ein neuer Mythos?
»I shot a man in Reno / Just to watch him die.« So sang Johnny Cash 1968 bei seinem legendären Auftritt im Folsom Prison vor tausend Schwerverbrechern. Die Kriminalgeschichte erzählt von vielen Gründen, jemanden zu töten. Nur um jemanden sterben zu sehen, ist vielleicht nicht, erscheint uns aber tautologisch, als Motiv können wir solche Rückbezüglichkeit kaum gelten lassen; er tut es, weil er es tut — darauf läuft die Begründung hinaus, und das ist zu wenig, um uns zu beruhigen. Bei besonders entsetzlichen Bluttaten haben wir einen Ausweg bereit, wir sagen: Der Täter war verrückt. Und wissen wieder nicht genau, was wir damit meinen. Dass ein Mensch normal sein kann, ganz normal, wie du und ich, und dass er trotzdem mordet, und zwar ohne einen Grund mordet, nur um des Mordens willen mordet, das ist allerdings eine neue Erkenntnis, das ist ein psychologischer Schock. Motivlosigkeit hätten die Bösen der Vergangenheit, Leopold II., Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, empört von sich gewiesen, sie mordeten aus Gier, Rassenwahn, Klassenwahn oder schlicht aus Gehorsam. Gerade weil sich die »neue« böse Tat jedem überkommenen Verständnis verweigert, kann sich an ihr ein Mythos entspinnen.
Als hätte sich die Erklärung des Unerklärlichen personalisiert, taucht 1940 zum ersten Mal die Figur des Jokers auf. In einem Comic. Wie sein Vorgänger Mephisto ist der Joker eine Erfindung der trivialen Populärkultur. Er ist der Gegenspieler von Batman, dem in der Verkleidung eines Fledermausmannes über Gotham City wachenden Milliardär Bruce Wayne. Inspiration für den Joker bezog der Zeichner Jerry Robinson (1922—2011) aus Victor Hugos Roman Der lachende Mann von 1869, in dem von einem wahnsinnigen Arzt erzählt wird, der einem jungen, durch und durch liebenswürdigen, durch und durch angepassten »normalen« Mann mit dem Skalpell ein ewiges Lachen ins Gesicht schneidet. Im Comic allerdings hat diese Figur von Anfang an anarchistische Züge, der Joker ist von Anfang an zügellos böse. Das Böse macht dem Joker Spaß; was er tut, tut er um des Spaßes willen. Dies mag ein merkwürdiges Motiv für Zerstörung und Mord sein, ein perverses Motiv, aber immerhin ist es ein Motiv. Der »unendliche Spaß« des Jokers — Infinite Jest (ein Zitat aus Shakespeares Hamlet; dem amerikanischen Autor David Foster Wallace diente es als Titel eines seiner Romane) — drückt sich im ewigen Grinsen der Figur aus und in seinem clownesk geschminkten Gesicht: breiter roter Mund, der bis in die Wangen hineinreicht, weiße Haut, grüne Haare. Das Dauergrinsen könnte diese Figur zu einem Verrückten stempeln, dem alles zuzutrauen ist, der dann aber kein wirklich interessantes Objekt für die Motivforschung wäre, weil er für seine Taten nicht nur kein Motiv hat, sondern keines braucht, jedes Motiv also beliebig wäre.
Der Joker aber ist nicht verrückt, nicht in einem pathologischen Sinn. Er ist wohl eher ein Narr; der Narr, zu Ende gedacht. Zum ersten Mal in der abendländischen Literatur begegnen wir dem Narren in der Ilias des Homer — Tersites, der als der einzige Nicht-Adelige unter den griechischen Offizieren verkehrt, spricht unliebsame Wahrheiten aus, hält nichts von einer Ehre, die einen Helden wie Agamemnon gegen Kritik immunisiert. Shakespeare führt uns zwei völlig verschiedene Narren vor. Einmal in König Lear, hier ist er von Beruf Narr, ob er einen fröhlichen oder einen finsteren Charakter hat, das wissen wir nicht, wir wissen nur, er ist nicht verrückt, und böse ist er auch nicht, jedenfalls nicht mehr als wir. Der andere Narr ist gefährlich und hat mit den gefährlichen Narren unserer Zeit viel gemeinsam; es ist Jago aus Othello. Er ist ein Zerstörer. Er ist böse. Aber aus anderen Gründen und mit anderem Ziel als der Joker. Jago folgt seiner persönlichen Rache. Das tut der Joker nicht. Jago meint, ihm sei Unrecht geschehen, seine Rache ist unverhältnismäßig, er vernichtet Michael, Othello, Desdemona, seine eigene Frau und sich selbst. Der Joker hat gegen niemanden etwas. Der Joker ist gegen alle. Und er zerstört alles.
Aber erst in der Darstellung durch den US-Schauspieler Heath Ledger in dem Film The Dark Knight findet der Joker als Personifikation des Bösen zu sich selbst. Und wird damit eine tatsächlich moderne mythische Figur. Er ist die Kraft, die stets das Böse will und stets das Böse schafft. Weil sich sein Tun in keine Eschatologie einbetten lässt. »Das Chaos ist fair«, sagt er einmal — über diesen Satz ließe sich eine Abhandlung schreiben. Und an einer anderen Stelle: »Ich bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich eines erwische.« Über uns philosophiert er vor Batman: »Ihre Moral, ihr Kodex, ist ein schlechter Witz. Verworfen beim ersten Anzeichen von Ärger. Sie sind nur so gut, wie die Welt ihnen erlaubt, zu sein. Es ist doch so, es kommt hart auf hart, und diese zivilisierten Menschen fressen sich gegenseitig. Ich bin kein Monster, nur der Zeit voraus.«
Das Entsetzen packt uns — sicher auch wegen der perfid bösen Dinge, die er tut; wenn er zum Beispiel den Zaubertrick mit dem Bleistift vorführt: Er stellt einen Bleistift auf den Tisch mit der Spitze nach oben, sagt zu den Gangstern, die um ihn herum sitzen, er könne das Ding verschwinden lassen, packt blitzschnell einen von ihnen am Hinterkopf und haut sein Gesicht auf den Stift, der verschwindet tatsächlich — im Gehirn des Mannes. Entsetzlich, ja, aber ähnliche Szenen haben sich inzwischen bis ins Vorabendfernsehprogramm vorgearbeitet, damit können wir einigermaßen umgehen. Was uns beim Joker, in der Darstellung von Heath Ledger, tiefstes Grauen einjagt, ist, dass er nicht nur ohne ein Motiv mordet und zerstört, sondern auch ohne Spaß, er hat Infinite Jest hinter sich gelassen. Er ist bizarr, aber nicht verrückt, und nicht einmal er selbst weiß, warum er tut, was er tut. Damit ist die Welt aus den Fugen.
Dennoch können wir nicht aufhören zu fragen: Warum? Warum tut er? Und haben vielleicht nur noch eine Antwort parat: Weil er es kann. Diese Antwort ist ungeheuerlich, denn sie verweist auf die Theologie. Keine andere Antwort wäre denkbar, wenn wir nach den Motiven Gottes bei der Erschaffung der Welt fragen. Weil er es kann. Ein anderes Motiv ist vor der Erschaffung der Welt, also des Ganzen, nicht denkbar, alle anderen Motive würden auf die Welt und ihr Einzelnes verweisen.
Somit wird das Böse in dieser neuen, aus der Trivialliteratur entstiegenen Figur zur Kehrseite der Figur unseres Schöpfers. Und er wird zugleich zum Fremden an sich. Denn nichts ist dem Einzelnen fremder als das Ganze; das Einzelne ist nachgerade die Emanzipation vom Ganzen, die Negation des Ganzen. Das Ganze droht jederzeit das Einzelne zu verschlingen. Das Böse an sich, so fürchten wir, würde uns auslöschen. Es ist das Nichts, wir sind das Etwas. Diese Angst ist uralt, in der Verkörperung einer Figur im Clownskostüm, einer Comicfigur aus einem Schundheft, hat sie die moderne Bühne betreten.
Unser Wilhelm Busch
Wenn meine Eltern gut gelaunt waren und ihre gute Laune aus ihrer gegenseitigen Zuneigung entsprang, dann zitierten sie Wilhelm Busch, und meine Schwester und ich wussten, jetzt interessieren sie sich nicht für uns, jetzt sind sie ganz beieinander. Die beiden warfen sich Zitate zu, vor allem aus Plisch und Plum, aber auch aus Balduin Bählamm oder Maler Klecksel, und wir durften denken, sie verbinden mit jedem Vers die Erinnerung an ein gemeinsames Erlebnis, kleine Geheimnisse ihrer Liebe. Plisch und Plum konnten sie auswendig.
Ich habe die alte Ausgabe der Werke von Wilhelm Busch geerbt, die bei uns im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch meiner Mutter lag. Sie ist zerfleddert. Ich lese darin, lese meiner Frau vor, und wir kugeln uns vor Lachen.
Zugereist in diese Gegend,
Noch viel mehr als sehr vermögend,
In der Hand das Perspektiv,
Kam ein Mister namens Pief.
»Warum soll ich nicht beim Gehen« —
Sprach er — »in die Ferne sehen?
Schön ist es auch anderswo,
Und hier bin ich sowieso.«
Berühmt wurde Wilhelm Busch mit der bösen Lausbubenstory Max und Moritz, dieser »Bubengeschichte in sieben Streichen«, geschrieben in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Natürlich haben meine Eltern auch daraus zitiert — besonders oft das »Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe!«. Der Dichter und Zeichner wurde nicht glücklich, konnte sich nicht freuen über den großen Erfolg. Er wollte ein Maler sein, ein ernsthafter Maler. Seine Gemälde, großflächig und in Öl, waren epigonal. Originell waren die schnellen Skizzen, die Karikaturen und die Verse. Damit konnte er seine Schulden bezahlen und einen Lebensstil führen, in dem die Sorgen nicht das Geld meinten.
Wilhelm Busch wird oft als ein Vorläufer der Comics genannt. Das sollte man korrigieren in: Vorläufer der Graphic Novel. Tatsächlich sind einige seiner Geschichten Bilderromane. Ich weiß nicht, was ich in meiner Begeisterung höher halten soll, die Texte oder die Bilder. Niemand kann so lakonisch und präzise reimen wie Wilhelm Busch. — Ein Betrunkener zieht einem Fremden den Hut übers Gesicht; daraus wird eine Strophe, die als Motto über der Philosophie des Existenzialismus stehen könnte:
Ohne Hören, ohne Sehen
Steht der Gute sinnend da;
Und er fragt, wie das geschehen,
und warum ihm das geschah.
… ein Lieblingszitat meines Vaters, wenn ich eine schlechte Note nach Hause brachte.