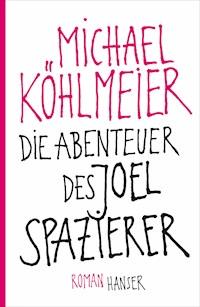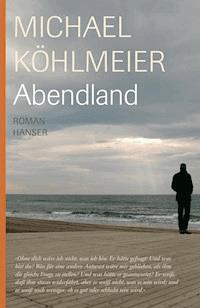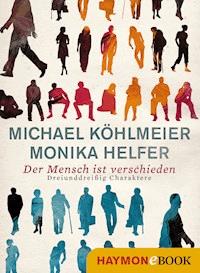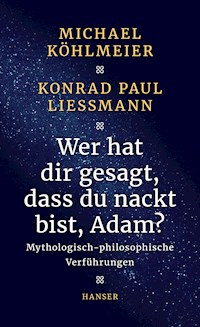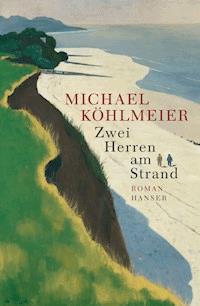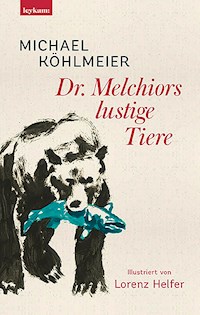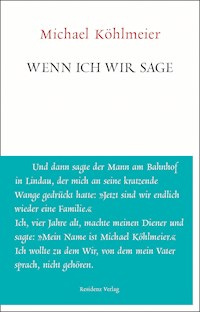Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Michael Köhlmeier – eine rasante Road Novel, ein unvergessliches Duo
Ein Teenager, ein soeben aus dem Gefängnis entlassener Großvater und eine geladene Pistole: Frank ist vierzehn, lebt in Wien, kocht gern und liebt die gemeinsamen Abende mit seiner Mutter. Aber dann gerät sein Leben durcheinander. Der Großvater ist nach achtzehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Frank kennt ihn nur von wenigen Besuchen. Der alte Mann reißt den Jungen an sich, einmal tyrannisch, dann zärtlich. Frank ist fasziniert von ihm. Am Ende stehen sich die beiden auf einer Autobahnraststätte gegenüber wie bei einem Duell. Michael Köhlmeier erzählt von einer Initiation, von Rebellion und Befreiung und der ewigen Faszination des Bösen – von einem Duo, das man nie wieder vergisst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Ein Teenager, ein soeben aus dem Gefängnis entlassener Großvater und eine geladene Pistole: Frank ist vierzehn, lebt in Wien, kocht gern und liebt die gemeinsamen Abende mit seiner Mutter. Aber dann gerät sein Leben durcheinander. Der Großvater ist nach achtzehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Frank kennt ihn nur von wenigen Besuchen. Der alte Mann reißt den Jungen an sich, einmal tyrannisch, dann zärtlich. Frank ist fasziniert von ihm. Am Ende stehen sich die beiden auf einer Autobahnraststätte gegenüber wie bei einem Duell. Michael Köhlmeier erzählt von einer Initiation, von Rebellion und Befreiung und der ewigen Faszination des Bösen — von einem Duo, das man nie wieder vergisst.
Michael Köhlmeier
Frankie
Roman
Hanser
Eins
1
Am Dienstag haben sie Opa entlassen. Er ist jetzt einundsiebzig. Mama wollte, dass ich mitgehe, ihn abholen. Wir sind erst im Zug bis Krems gefahren und dann weiter zu Fuß, aber ich habe es mir nach einer Weile anders überlegt und mich auf die Bank hinter der Fußgängerbrücke gesetzt. Mama hat gesagt: »Was jetzt?« Ich habe gesagt: »Ich warte hier.«
Opa ist achtzehn Jahre gesessen, er ist frühzeitig herausgekommen. Wie viel er im Ganzen gekriegt hat, weiß ich nicht. Mama sagt, es fällt ihr auch nicht mehr ein. Was ich ihr aber nicht glaube.
Nicht dass ich ihn nicht kenne. Ich war ja ein paarmal dabei gewesen, wenn Mama ihn besucht hat. Aber da war ich noch klein. Seit ich selber entscheiden kann, war ich nicht mehr dabei. Ich bin jetzt vierzehn. Noch nicht ganz. Wegen dem knappen Monat, der noch fehlt, glaube ich, kann ich doch sagen, ich bin vierzehn. Das heißt, er ist vier Jahre vor meiner Geburt ins Gefängnis gekommen. Er war also immer da. Ich weiß nicht, was er getan hat. Ich denke, ich werde es herauskriegen. Irgendwann. Jetzt habe ich noch ein bisschen Angst davor. Angst eigentlich nicht, eher ist mir nicht wohl dabei. Ich weiß nur, vorher ist er auch schon gesessen. Aber nicht so lange am Stück. Dafür nicht nur einmal. Immer wieder habe ich Mama gefragt, da war ich noch ziemlich grün und habe mir nichts Richtiges unter der Frage vorstellen können, und wenn sie gesagt hat, er sitzt, dachte ich, er sitzt wirklich, und zwar die ganze Zeit. In einer Küche oder so. Auf einem Stuhl oder auf einer Bank. Irgendwann habe ich nicht mehr gefragt.
Ich wartete fast eine Stunde, und dann habe ich gesehen, wie sie daherkamen. Er einen Koffer unter dem Arm. Nicht am Griff, sondern unter dem Arm, über dem Koffer die Jacke, die Hemdsärmel hochgekrempelt, alles hell. So groß und dünn hatte ich ihn nicht in Erinnerung. Ich habe ihn bisher nur sitzen sehen. Das war jetzt ein unfreiwilliger Witz. Aber ich lass ihn stehen. Mama ist eher klein. Es sah aus, als ob sie schnell geht und er langsam, aber sie gingen beide gleich schnell. Er wirkte überhaupt nicht gebrechlich. Mama hat nämlich befürchtet, das könnte er inzwischen sein.
Ich habe mich nicht gerührt. Er blieb vor mir stehen, legte sein Gewicht auf das rechte Bein, das linke spreizte er ab, stand schief, wie ich noch nie einen schief stehen gesehen habe, als würde er sich gegen den Wind lehnen, dabei hat sich kein Blatt geregt, wie ein langer, dünner Hampelmann, der noch an Fäden hängt, unten aber schon am Boden aufsteht, eben schief. Er hat mich angeschaut und gesagt:
»Du bist Frank, ha! Frankie. Frankie Boy, ha! Little Frankie Boy.«
Spinnt er? Ich habe nicht einmal genickt. Was hat er davon, viermal meinen Namen vor sich hin zu sagen. Wie eine Formel. Dreimal verkleinert, wie ich es nicht will. Hinter der Bank wuchs ein Holunderbaum, der war voll Beeren, die fallen herunter, wenn sie reif sind, und fallen auf die Bank. Genau mitten in den schwarzblauen Beerenmatsch setzte er sich. Mit seinen hellen Hosen. Mama hat die Hände vors Gesicht gerissen, aber nichts gesagt.
Zu ihr sagte er: »Geh du, wir kommen nach!«
Sie sagte, und ich mochte nicht, wie ihre Stimme war: »Soll ich am Bahnhof warten?«
»Das tust du, ja!«, sagte er.
»Dann warte ich am Bahnhof auf euch«, sagte sie, noch schlimmer die Stimme.
»Das hast du schon einmal gesagt!«, sagte er.
Wie sie von uns wegging, kam mir vor, dass sie einen ganz normal schnellen Schritt hatte. Von hinten sah sie wie ein Mädchen aus, so sieht sie immer aus und wird noch in zwanzig Jahren so aussehen. In ihren weißen Stiefeln, die mit Gold verziert sind, aber elegant, kein Pseudo-Cowboy-Kitsch. Sie hat gern Röcke, die beim Gehen schwingen, und sie schlenkert lustig mit den Armen und hält den Kopf hoch. Den Menschen gefällt das. Zu uns umgedreht hat sie sich nicht. Wir saßen da und haben ihr nachgeschaut. Für Opa war die Bank zu niedrig, die Knie ragten ihm nach oben, als ob er auf einem Kinderstuhl sitzen würde, mit den Händen hat er sich rechts und links an der Bank festgehalten. Der Koffer am Boden zwischen den Füßen.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Zum Glück hat er gefragt. Antworten ist immer leichter. Finde ich. Meistens.
»Was bist du für einer?«, fragte er.
Darauf allerdings kann niemand antworten. Denn was soll man darauf antworten? Sogar wenn man erst vierzehn ist, wäre die Liste zu lang.
Darum sagte ich: »Ich weiß nicht, was du meinst, Opa.«
»Ich glaube, ich kann es nicht leiden, wenn du Opa zu mir sagst«, sagte er.
»Weil wir verwandt sind, uns aber nicht kennen?«, fragte ich.
Ich sah ihn an, zum ersten Mal, und er mich auch. Mitten in unsere Gesichter hinein schauten wir, das meine ich. »Ein Schlauer, ha?«, sagte er.
Seines war sehr blass, die Haut an den Wangen glatt, als hätte er sich grad eben erst rasiert. Er roch auch nach Seife. Lange steile spiegelnde Wangen hatte er, wie aus Stein. Auf der Stirn schwitzte er, und neben den Augen war alles voll Falten. Auffällig waren seine blauen Augen. Mama und ich haben braune. Woher er wohl die blauen hat, dachte ich. Vielleicht kriegt man ja blaue, wenn man lange eingesperrt ist. Wegen dem dauernden elektrischen Licht. Die Lider hingen ziemlich tief über den Augen, das kommt vielleicht auch vom dauernden elektrischen Licht. Ich muss zugeben, dieser Blick kam mir gefährlich vor, weil hinterhältig. Also, dass es ein Zeichen eines gefährlichen Mannes ist. Dabei braucht der da so ein Zeichen gar nicht. Wenn einer achtzehn Jahre eingesperrt wird, dann ist er gefährlich, auch wenn nichts an ihm gefährlich aussieht.
»Wie soll ich zu dir sagen?«, fragte ich.
Er gab keine Antwort.
»Wenn ich schon nicht Opa sagen soll.«
Wieder nichts.
»Du hast dich genau auf den Holler gesetzt«, sagte ich nach einer Weile.
Er nickte nur.
Ich wusste ja nicht, warum wir hier sitzen und Mama vorausgehen sollte. Was er von mir will. Er streckte die Beine von sich und lehnte sich zurück. Er genießt jetzt die Freiheit, dachte ich und überlegte, ob ich nun fragen sollte, warum er so lang im Gefängnis gewesen war. Irgendwann würde ich ihn fragen, warum also nicht gleich.
Da sagte er: »Und frag mich nicht, warum ich gesessen habe.«
»Tu ich eh nicht«, sagte ich.
»Und gleich auch nicht, wie es dort war.«
»Tu ich eh nicht«, sagte ich.
»Und was fragst du sonst noch?«
»Gar nichts.«
»Kannst du Schach?«
»Eher nicht.«
»Man kann es, oder man kann es nicht. ›Eher nicht‹ kann man es nicht. Also was!«
»Nicht«, sagte ich.
»Würdest du es irgendwie gut finden, wenn du es könntest?«
»Ich glaube schon«, sagte ich. Aber nur, weil ich nicht wollte, dass er mich für bockig hält, sagte ich das. Ich dachte nämlich: Wer diesem Mann widerspricht, den betrachtet er gleich einmal als seinen Feind.
Er holte aus dem Koffer ein Schachbrett. Das war in der Mitte zusammengeklappt zu einem Kistchen, außen herum ein Einweckgummi. Darin befanden sich die Figuren. Wenn ich so ein Schlauer sei, sagte er, dann werde ich mir in einer Viertelstunde merken, wie die Figuren heißen und wie sie sich auf dem Brett bewegen dürfen und wie viele Felder es gibt und wer wie wen schlägt. Für die erste Lektion genüge das. Er rutschte ein Stück zur Seite, dorthin, wo noch mehr Beeren auf der Bank lagen, und stellte das Schachbrett und die Figuren zwischen uns auf. Derweil Mama beim Bahnhof wartete.
2
So war das gewesen am Dienstag, als wir ihn beim Gefängnis abgeholt hatten. Heute ist Samstag. Heute Morgen haben wir ihn zu seiner neuen Wohnung begleitet. Er hat sich den Wecker gestellt, hat ihn aber nicht gehört, wir mussten ihn wecken. Auch der Kaffeegeruch konnte ihn nicht wach kriegen, mich kriegt der immer wach, sogar durch die geschlossene Tür hindurch, und ich mag das sehr. Wenn ich einmal so alt bin wie er, werde ich mich immer noch an diesen Geruch erinnern, hoffentlich wird er dann nicht anders sein.
Mama hat sich nicht getraut, ihn anzufassen, sie hat nur geflüstert: »Es ist halb sieben, Papa, wach auf, es ist halb sieben!« Sie hat sich nicht einmal getraut, laut zu sprechen.
Ich habe ihn an der Schulter gerüttelt. Und war dabei grob. Wenn man grob sein muss, ist man gern grob. Würde er sich beschweren, könnte ich sagen, es sei zu seinem Besten. Zuerst wusste er nicht, wo er ist. Er sah hilflos und ungefährlich aus. Um neun Uhr warte ein Mann auf ihn bei seiner zukünftigen Wohnung. Der Mann müsse ihm vorher etwas sagen und ihm dann die Schlüssel übergeben. So hatte es beim Abschied aus dem Gefängnis geheißen. Der Beamte im Gefängnis hatte nur mit Mama gesprochen, nicht mit Opa, das hat sie mir später erzählt. Als ob Opa ein Kind wäre und das Gefängnis ein Kindergarten und Mama seine Mutter und nicht seine Tochter.
Zum Frühstück rauchte er nur zwei Zigaretten und trank einen schwarzen Kaffee mit Zucker. Hat kein Wort geredet. Wir hätten mit der U-Bahn fahren und eine Stunde länger schlafen können, jeder vernünftige Mensch hätte das getan, das wollte er nicht. Hat er schon am Abend gesagt. Er wolle zu Fuß gehen. Also hatschten wir eine Stunde, quer durch die ganze Stadt, wieder kein Wort, und kamen gerade noch rechtzeitig an, der Mann hat bereits gewartet, aber erst zehn Minuten, das gehe gerade noch, sagte er, aber in Zukunft werde er das vermerken müssen. Der Mann war viel jünger als Opa und am Hals tätowiert, bis hinter das Ohr hinauf ins Haar, auch jünger als Mama war er und redete mit Opa wie mit einem Lausbub. Außerdem sei es ein Entgegenkommen, dass er ihn am Samstag treffe, eigentlich habe er heute frei. Für Mama und mich hatte er nicht einmal einen Blick, wir waren gar nicht da für ihn.
Die zukünftige Wohnung ist Opa gestellt worden. Vom Staat oder von der Stadt Wien oder von der Caritas. Das weiß ich nicht genau. Oder von jemand anderem. Interessiert mich auch nicht. Ich werde so etwas nie nötig haben. Dass er bei uns wohnt, ich meine, für immer, das geht auf jeden Fall nicht. Das wurde nämlich angefragt, schriftlich, bevor man ihn rausgelassen hat. Wir haben zwei Zimmer und die Küche, in der ein Kanapee steht, eine große, gemütliche Küche. Auf dem Kanapee hat Opa seit dem Dienstag geschlafen, über zehn Stunden jede Nacht übrigens, ich habe in meinem Zimmer zu Mittag gegessen, damit ich ihn nicht störe, kalt, was mir Mama am Abend vorgekocht hat und was ich am Herd nur hätte aufwärmen müssen, das traute ich mich aber nicht, weil er danebengelegen hat. Auf die Dauer geht das nicht. Das hat er selber gesagt. Das hat er schon im Gefängnis zu den Leuten gesagt, die sich um ihn kümmern wollten, wenn er draußen ist. Er könne seiner Tochter nicht Schwierigkeiten machen, hatte er gesagt. Wahrscheinlich haben sie das eingesehen. Mama erzählte mir, das hat sie mir erzählt, als Opa noch im Gefängnis war, dass gewisse Leute mit ihm in den letzten Wochen »Draußensein« übten. Was ich nicht uninteressant finde. Wie übt man das? Und was genau ist »Draußensein«?
Seine Wohnung ist in der Brigittenau, im 20. Bezirk. Nicht schön dort. Aber schöner als im Gefängnis. Wir wohnen im 4. Bezirk, in Wieden, in der Blechturmgasse 12, im Hochparterre, Nummer 8, ich kenne nichts anderes, mir gefällt’s. Und der Name der Gasse gefällt mir auch und ist auch überall gut angekommen, wenn ich mich vorgestellt habe.
Mama ist fix und fertig. Seit wir Opa am Dienstag in Krems abgeholt haben, ist sie fix und fertig. Sie benimmt sich so, wie ich mich Papa gegenüber benommen habe, als er noch bei uns war: ängstlich. Ich hatte immer gedacht, ich mache nichts richtig oder das meiste nicht. Am schlimmsten war, wenn er leer vor sich hin geschaut hat und ich in seinem Gesicht lesen konnte, dass es eh keinen Sinn hat, etwas zu sagen bei dem da. Der da war ich. Und gleich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er dachte, er sei schuld, schließlich hat er mich ja gemacht. Ich habe bei mir gedacht, ich bin für ihn das Letzte, und gerade dann war er besonders lieb zu mir, aber eigentlich nicht zu mir, sondern zu seinem schlechten Gewissen, er hat sich bei seinem eigenen schlechten Gewissen eingeschmeichelt. Und genauso denkt Mama jetzt: Für ihn bin ich das Letzte. Also für Opa. Ich kann sie leider nicht freisprechen, sie ist viel älter als ich. Ich war damals acht, heute, mit meinen vierzehn Jahren, würde ich das nicht mehr denken, auch wenn Papa zurückkäme. Was er natürlich nicht tut. Und warum soll Mama so etwas überhaupt denken? Der Versager ist doch schließlich Opa. Er hat achtzehn Jahre im Gefängnis gesessen, nicht sie. Insgesamt sei er, das hat mir Mama irgendwann vorgerechnet, sechsundzwanzig Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen. Wenn da einer das Letzte ist, dann doch er. Also!
Sie sagt: »Er glaubt, er hat nichts zu verlieren. Solche Leute sind gefährlich!«
An den Abenden seit dem Dienstag waren wir immer zusammen, in der Küche, Mama, Opa und ich. Er hat nicht viel geredet, meistens nur gefragt. Einen Suppenwürfel ließ er in eine von den großen Tassen fallen und goss kochendes Wasser darüber. Oder er machte sich einen Grog. Billiger Rum, den er sich selber beim Gourmet-SPAR an der Wiedner Hauptstraße besorgt hat, und heißes Wasser. In derselben Tasse. Nicht einmal unter den Wasserhahn gehalten hat er sie. Schon war es seine Tasse. Die haben wir ihm mitgegeben in seine neue Wohnung. Mama hat sie in Seidenpapier eingewickelt und in seinen Koffer gelegt.
Mit dem Fragen ist es so eine Sache. Eigentlich müsste ich, wenn ich über ihn schreibe und ihn etwas fragen lasse, kein Fragezeichen setzen, sondern ein Rufzeichen. »Darf ich noch von dem Gulasch haben!« Oder: »Darf ich mir noch ein Bier nehmen!« »Hast du Kandiszucker!« Immer Rufzeichen. Das muss er sich abgewöhnen, denke ich. So kommt er draußen nicht weit. In diese Richtung hätten sie mit ihm üben sollen. Das Radio wollte er anhaben, die ganze Zeit, hat immer einen Sender gesucht, wo geredet wird. Von Musik hält er nicht viel. Nachrichten, aber auch Gesprächssendungen, Diskussionen oder Berichte oder Reportagen, das ist seines. Und Kandiszucker, darauf steht er. Mama, brav, hat gleich welchen eingekauft, ein brauner muss es sein. Wir haben einen Radioapparat in der Küche, einen mit einem CD-Player und zwei Boxen. Den hat er nicht angeschaltet, sondern immer seinen eigenen. Das ist ein uraltes Gerät, ein Kofferradio, hell wie seine verdorbene Hose. Weil er nur sein eigenes Radio einschaltet, tut er so, als ob wir nichts hören. Normal wäre es, wenn einer fragt: Stört es euch, wenn ich jetzt Radio höre? Fragt er nicht. Und fernsehen wollte er nicht. Ich dachte wieder, das ist wegen dem elektrischen Licht, das tut seinen blauen Augen nicht gut. Wir haben nämlich den Fernseher in der Küche stehen. Wo auch sonst? Im Bad vielleicht? Mama und ich schauen am Abend beim Essen immer in den Fernseher, das ist unsere Gemütlichkeit. Dabei unterhalten wir uns. Wir haben schon festgestellt, dass wir uns nicht unterhalten, wenn der Fernseher nicht läuft. Dann sind wir nämlich ebenfalls still. Das ist komisch. Finden wir. Wir haben darüber gelacht und den Fernseher wieder eingeschaltet. Sehr gern sehen wir die Millionenshow am Montag um 20 Uhr 15 mit Armin Assinger im zweiten Österreichischen, wir finden beide, da lernt man einiges, und über den Herrn Assinger müssen wir manchmal schmunzeln, weil er so witzige Sachen sagt und die Kandidaten durcheinanderbringt, manchmal könnte ich mich kugeln, aber er meint es immer gut. Und am Sonntag um 20 Uhr 15 schauen wir den Tatort. Da kann sein, was will, den schauen wir.
Opas Wohnung sieht trostlos aus. »Mehr als trostlos«, sagte Mama, als sie und ich hinterher in der U-Bahn saßen nach Hause. Möbliert von der MA48, das ist die Magistratsabteilung der Stadt, die für den Sperrmüll verantwortlich ist. Ein Zimmer mit einer Kochnische, ein Klo mit einer Dusche und ein Schlafkabinett, grad dass ein Bett und ein Kasten hineinpassen. Und wenn man den dazuzählen möchte, noch ein Vorraum mit einer Garderobe, einem Spiegel und einem Regal für die Schuhe. Fenster im Zimmer und im Kabinett hinaus auf die Straße, besser gesagt, auf die Mauer des Wohnblocks gegenüber, wo ich sicher nicht lieber wohnen würde. Auf dem Bett lag nur eine Wolldecke, kein Überzug, nichts, und nur ein Kopfpolster und zwei Klopapierrollen.
Mama sagte, sie besorge ordentliches Bettzeug, das sei ja kein Zustand.
Er sagte: »Das brauchst du nicht!«
Der Sozialarbeiter, der Opa betreut, sagte, er werde sich kümmern, ein Federbett sei eigentlich vorgesehen und Bettzeug.
Im Zimmer ist eine Sitzbank ums Eck, ein Tisch und ein Stuhl. An der Wand hängt ein Regal, das sind drei Bretter übereinander, leer. Das heißt, ein Buch steht dort. Die Bibel.
»Wie erwartet!«, sagte Opa.
»Ich bring dir etwas Ordentliches zu lesen«, sagte Mama.
»Was ist etwas Ordentliches!«, fragte er. Mit Ausrufzeichen.
»Sag mir, was du gern möchtest, ich besorge es dir, wenn ich kann«, sagte sie.
Er fragte mich: »Weißt du, was sie meint, Frankie: etwas Ordentliches zu lesen?«
»Ein Buch über das Weltall zum Beispiel ist eines«, sagte ich.
Ich besitze nämlich so eines, es ist zwar eines für Jugendliche, aber etwas Falsches steht nicht drin, das kann ich mir nicht vorstellen, das hätte man inzwischen längst aufgedeckt und das Buch eingezogen, und auf dem neuesten Stand ist es auch, ausführlichst über Schwarze Löcher.
»Über das Weltall, das ist gut«, sagte er und nickte und grinste. »Das ist gut, über das Weltall!«
Er finde das auch gut, sagte der Sozialarbeiter.
Ich wartete ab, bis sie beide fertig genickt hatten, dann sagte ich, ich würde Opa gern meines borgen. Da nickte er wieder, wieder lang und still.
Wir ließen ihn zurück, wie er war, erst verabschiedete sich der Sozialarbeiter, dann wir. Auf der Eckbank saß er, die langen Beine unter dem Tisch ausgestreckt, so dass sie auf der anderen Seite herausschauten, Hochwasserhosen. Er hat zwei, eine helle und eine dunkle, die helle hat Mama behalten. Die Schuhe hatte er ausgezogen und im Vorraum nebeneinandergestellt, vorbildlich. In Socken ließen wir ihn zurück.
3
Ich stehe am Herd und rühre und kann nur an ihn denken.
Die Hollerflecken in der hellen Hose gehen nicht heraus. Mama hat die Hose schon dreimal gewaschen. Vorher die Flecken mit Gallseife eingerieben. Das sei nun wirklich nicht nötig gewesen, dass er sich auf den Holler setzt! Außerdem bildet sie sich ein, die Hose riecht immer noch.
»Nach was riecht sie denn?«, frage ich.
»Riechst du nichts?« Sie hält mir das Ding unter die Nase. Ich drehe und wende es von den Stulpen unten bis zum Hintern hinauf.
»Waschmittel«, sage ich.
»Und hinter dem Waschmittel?«
»Wie kann man etwas hinter etwas riechen?«, frage ich.
Er ist jetzt schon seit vier Tagen in seiner Wohnung in der Brigittenau. Wir haben ihn noch nicht besucht. Mama sagt, er will nicht. Das habe ich aber nicht gehört. Und ich habe nicht gesehen, dass sie allein mit ihm geredet hätte. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, sie möchte auf gar keinen Fall allein sein mit ihm. Ich musste in seiner Wohnung dringend aufs Klo, da hat sie gesagt, das kann ich auch später machen. Wann später, bitte? In der U-Bahn? Sie hat mir hinter seinem Rücken ein Zeichen gegeben. Da habe ich eben die Tür offen gelassen.
Einmal in der Woche koche ich. Immer am Mittwoch am Abend. Das ist, von meinem Schulplan her gesehen und auch von dem Plan mit meinen Freunden, der günstigste Tag in der Woche, und auch für Mama ist der Mittwoch günstig. Ich gehe am Morgen vor ihr aus der Wohnung, sie kommt am Abend gegen fünf heim. Manchmal hat sie einen Tag frei, dafür muss sie am Abend zur Vorstellung und kommt erst spät in der Nacht, weil sie hinterher noch in der Kantine zusammensitzen und ein Glas trinken. Sie ist Garderoberin in der Volksoper. Das heißt, dem würde sie widersprechen und sagen, man müsse genau sein, Garderoberin sei sie nämlich noch nicht, werde sie aber bald, vorläufig sei sie offiziell erst in der Schneiderei tätig und Garderoberin nur hie und da, und das auch erst beim Chor. Ich sehe das nicht so eng. Darum sage ich, sie ist Garderoberin. Weil sie es gern hört. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es in der Volksoper eine bessere Schneiderin gibt als sie. Alle meine Sachen hat sie besser gemacht, ich habe nämlich eine Figur, die »von der Stange nicht bedient werden kann« — ihre Worte. Kurze Beine und kurze Arme. Stämmig. Wie ein Hydrant. Das Gegenteil meines Großvaters.
Es war übrigens Mamas Idee, dass ich einmal in der Woche kochen soll. Damit ich kochen lerne und etwas fürs Leben habe. Ich war gleich damit einverstanden, ich sehe es nämlich ähnlich. Meistens, das muss ich zugeben, gibt es bei mir Spaghetti. Gern mache ich auch Risotto. Ich rühre gern und gieße gern Suppe und Weißwein dazu. Gemüse-Risotto ist meine Spezialität. Mama sagt, mein Risotto sei 1 a, sie brauche nicht in die Cantinetta Antinori in der Innenstadt zu gehen, das ist eines der feinsten Lokale in unserer Stadt. Ich fühle mich gebauchpinselt, wie man so sagt. Uns gegenseitig loben, das können Mama und ich.
Wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn vor mir, wie er auf der Eckbank sitzt, nur in Socken. Genauso, wie wir ihn dort zurückgelassen haben. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich in den letzten vier Tagen nicht vom Fleck gerührt hätte. Einen Kaffee vor sich und den Aschenbecher. Und eine Schachtel Tschick. Wovon ernährt er sich? Und das Feuerzeug, das er aus dem Gefängnis mitgebracht hat, das bei seinen Sachen war, die sie ihm dort vor achtzehn Jahren abgenommen und aufbewahrt haben. Achtzehn Jahre hat das Feuerzeug auf ihn gewartet. Ein Benzinfeuerzeug. Er hat es mir ausführlich gezeigt. Ein echtes Zippo. Das sei zu seiner Zeit lässig gewesen. Ich hätte mir seine Zigarettenmarke merken sollen. Dann würde ich ihm bei meinem nächsten Besuch eine oder zwei Schachteln mitbringen. Aus meinem Geld. Hat er eigenes Geld? Wo hat er das verdient? Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass er ein paar Tage nichts isst.
Beim Rühren im Topf denke ich die ganze Zeit an ihn, er geht mir nicht aus dem Sinn, und eigentlich finde ich das ziemlich lästig, ich habe für gewöhnlich andere Gedanken, Spintisierereien, die ich gern mag. Letzte Woche am Mittwoch habe ich nicht gekocht. Als er noch bei uns war. Warum nicht? Ich weiß nicht. Es hat sich so ergeben. Oder nicht. Ich hatte Angst, dass er unzufrieden ist. Und schimpft. Mit Mamas Essen war er einverstanden. Ich glaube, er traut mir nicht zu, dass ich kochen kann. Er wird sich denken, die Mama ist stolz auf mich und isst alles, was ich koche, aber schmecken tut es ihr nicht. Die würde mich auch loben, wenn ich ihr einen Sandkuchen servierte. Und würde ihn glatt aufessen. Ich dachte, wenn er so denkt, dann nimmt er keine Rücksicht und sagt das auch geradeheraus. Nämlich, dass meine Spaghetti wie Hundsdreck sind und auch so aussehen. Das hätte ihm Mama nicht verziehen. Und schon wäre eine Stimmung gewesen. Das wollte ich vermeiden. Ich denke, das ist der Grund, warum ich nicht gekocht habe letzten Mittwoch. Automatisch hat es mich zum Nichtkochen getrieben, sozusagen. Das Gescheiteste tut man manchmal, ohne es sich vorzunehmen, das ist meine Meinung.
Wegen dem Zeichengeben hinter dem Rücken übrigens: Das haben Mama und ich trainiert und perfektioniert, als Papa noch bei uns gewohnt hat, in der alten Wohnung. Da war es nötig gewesen, dass wir uns dauernd absprechen. Man musste auf Zack sein. Ein Beispiel: Wenn er geredet hat, sagen wir, mit mir, und Mama ist hinter ihm gestanden, dann habe ich ein Gesicht gemacht, dem man nicht ablesen konnte, dass es ein Gesicht ist, dem man nichts ablesen können soll. Während Mama ihre Grimassen geschnitten hat. Oder wenn er uns beiden den Rücken zugekehrt hat und hat etwas gesagt, dann war es nicht gut, wenn wir beide still waren, daraus hätte er geschlossen, wir werfen uns Blicke zu oder verziehen den Mund und verdrehen die Augen. Das ist die Schlauheit von Leuten, die meinen, die Hauptsache spiele sich hinter einem ab.
Erst heute kommt Mama drauf, dass Opa ja kein Handy hat. Mir ist der Gedanke auch nicht gekommen. Er kann gar nicht anrufen, dass er etwas braucht. Ich frage Mama, ob er überhaupt weiß, wo wir wohnen. Man nimmt etwas als selbstverständlich an, und dann ist es nicht so. Sie überlegt, ich sehe ihr an, dass sie erschrocken ist über den Gedanken, dann sagt sie, sie hat ihm Briefe ins Gefängnis geschickt, auf jedem war die Adresse gestanden. Wie viele Briefe denn, frage ich. Sie weiß es nicht. Ob mehr als fünf. Das glaubt sie nicht. Und auch schon länger her. Und eigentlich alle von unserer alten Adresse. Und natürlich nie eine Antwort.
»Er hat mir nie geschrieben, in den achtzehn Jahren nicht.«
»Vielleicht hat er die Briefe gar nicht gekriegt«, gebe ich zu bedenken. Ich weiß nicht, war es in einem Film oder habe ich es irgendwo gehört, dass die Aufsichtspersonen, also die Gefängniswärter, wenn ein Gefangener ein Päckchen bekommt mit Marmelade und Keksen und anderen guten Sachen, Tabak und Whisky und so, das selber behalten, weil sie es auch nicht so dick haben.
»Er hat doch sicher auf das Straßenschild geschaut, als wir vom Bahnhof mit dem Taxi hierhergefahren sind«, sage ich. »Oder dass er gehört hat, wie du dem Taxifahrer die Adresse gesagt hast.«
»Das glaube ich nicht«, sagt sie. »Er hat nur vor sich hin geschaut, der hat gar nichts mitgekriegt, und er ist ja erst eingestiegen, als wir längst schon eingestiegen waren, ich habe mir noch gedacht, er will nicht, der war ja gar nicht auf dieser Welt, der ist gar nicht auf dieser Welt.«
Also wissen wir nicht mit Sicherheit, ob er weiß, wo wir wohnen. Er hat kein Handy und keine Adresse von uns. Sitzt auf seiner Eckbank, vor sich seine Tasse und den Aschenbecher und die Beine unter dem Tisch hindurch, in Strümpfen. Morgen, sagt Mama, solle ich gleich nach der Schule in ein Handygeschäft gehen und ein Gerät kaufen, ein einfaches, mit dem er zurechtkommt. Und dann solle ich es ihm bringen. Sie habe morgen den ganzen Tag Dienst und Abendvorstellung dazu, die Elisabeth Simmer, Sopran, habe sich ausdrücklich gewünscht, dass sie morgen ihre Garderoberin sei, ihre spezielle, sie allein. Vielleicht für die ganze Spielzeit. Das wäre ein Traum.
»Warum ich?«, sage ich. »Warum nicht du? Du bist seine Tochter. Das ist mir peinlich.«
»Bitte«, sagt sie, »bitte, tu mir den Gefallen!«
Ich kann schlecht einschlafen und Mama auch. In der Nacht kommt sie in mein Zimmer und fragt, ob ich mich zu ihr hinüberlege. Wenigstens für eine halbe Stunde. Das mach ich eh gern. In ihrem Zimmer steht das Ehebett, das wir aus der alten Wohnung mitgenommen haben, da haben wir gemütlich beide Platz. Ich schlafe bis zum Morgen bei ihr. Ich wache auf, weil ich den Kaffee rieche.
4
Ich habe fünfmal an der Tür zu seiner Wohnung geklingelt, ehe er mir aufgemacht hat. Ich sah ihn durch die Milchglasscheibe neben der Tür, seinen Schatten habe ich gesehen, oder wie soll ich sagen. Hin-und-her-Bewegung. Vor der Scheibe ist ein Eisengitter, verrostet. Und verziert. Unten war offen, das Schloss vom Tor zur Straße ist kaputt, herausgerissen, so ist diese Gegend.