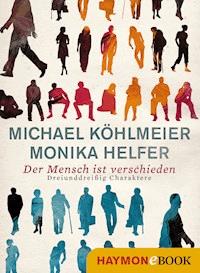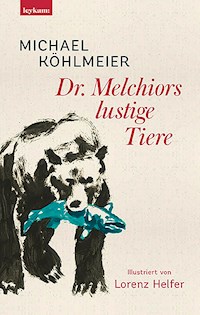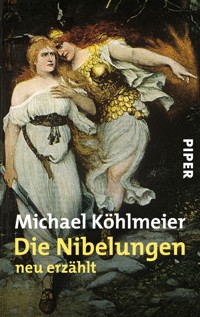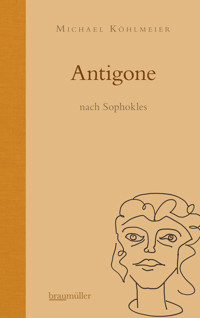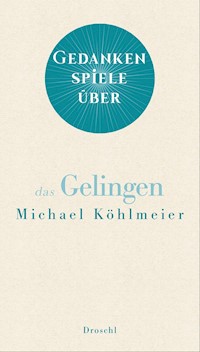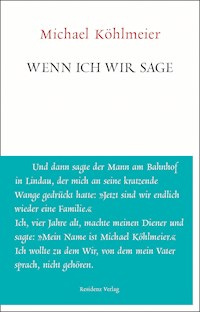
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Unruhe bewahren
- Sprache: Deutsch
Ein kluges Buch über die Sprengkraft eines kleinen Wortes – über das Wir, das ausgrenzt, und das Wir, das uns alle einschließen kann Michael Köhlmeiers Nachdenken über das Wir ist ein Plädoyer für eine offene Gemeinschaft. Das Wir kann wohltun, weil es dem einsamen Ich eine Heimat bietet und eine Ahnung, woher es kommt. In dieses Wir kann integriert werden. Es ist dem Ich nahe, es erzählt Geschichten. Aber das Wir ist auch eine Uniform, die man anlegen kann. Jeder kann diesem Wir zum Feind werden, es macht uns zu Opportunisten, zu Rechthabern. Dieses militärische Wir erzeugt Mythen, um Ideologien zu sanktionieren. Doch wie wird aus dem einen das andere Wir, aus intimster Familiengeschichte eine Begeisterung, für etwas zu töten und zu sterben, das niemand je gesehen hat? Und was lässt sich gegen diese Verwandlung tun? Intensiv befragt der große Erzähler Michael Köhlmeier die Doppelgesichtigkeit des Wir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Köhlmeier
Wenn ich wir sage
Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN«
Unruhe bewahren – Frühlingsvorlesung & Herbstvorlesung.
Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit dem Literaturhaus Graz und DIE PRESSE.
Die Frühlingsvorlesung zum Thema »Wer, wenn nicht wir« fand am 24. und 25. 04. 2019 im Literaturhaus Graz statt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2019 Residenz Verlag GmbH
Wien – Salzburg
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Redaktion: Harald Klauhs, Astrid Kury
Wissenschaftliche Beratung: Thomas Macho, Peter Strasser
Umschlaggestaltung: Kurt Dornig
Lektorat: Jessica Beer
ISBN e-Book: 978 3 7017 4627 9
ISBN Print: 978 3 7017 3484 9
Ich will mich dem Thema in Kreisen nähern. Die Kreise mögen bisweilen arg verbeult aussehen, manchmal, so fürchte ich, brechen sie ab oder scheinen zerbrochen, so dass ein offenes Ende nach Irgendwohin oder Nirgendwohin ausreißt und wir einen neuen Anschluss suchen müssen. Manchmal finde ich einen falschen Anschluss und bin gezwungen, drei Schritte zurückzugehen. Weswegen ich immer wieder abschweife. Auf dem »krummen Holz der Humanität« – wie Isaiah Berlin sich ausdrückte – wachsen viele Äste und Zweige, und welcher sich als Wassertrieb erweisen und welcher Blüten und Früchte hervorbringen wird, das ist im Frühling für den Fachmann vielleicht zu erkennen, nicht aber für den Laien – und ein solcher bin ich im Garten der Philosophie. Meine Unruhe möchte ich mir bewahren und deshalb beim Niederschreiben meiner Gedanken deren chaotische Hervorbringung nicht verleugnen, indem ich sie in ein Schema presse, das ja nur ordentlich aussähe, in Wahrheit aber willkürlich und beliebig austauschbar wäre und einen klaren Geist vortäuschte, der nicht einmal selbst wüsste, wie er sich definieren soll. Von Montaigne hole ich mir dazu die Erlaubnis: »Ich will, dass man meinen natürlichen Gang sehe, so stolpernd er auch ist.«
Eine These werde ich trotzdem an den Anfang stellen, eigentlich mehr eine Vermutung, eine Behauptung, eine Provokation: Freundschaft, Familie und Nation – diese drei formen unseren Begriff vom Wir. Die Freundschaft entspringt einem Akt des Willens; sie ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der dauernde Energiezufuhr benötigt, um in Bewegung zu bleiben, ein Prozess, in dem sich wie in einem Vexierbild Schmerz und Glück rasend schnell abwechseln können und der zu Ende ist, wenn der Stoff ausgeht. Die Familie erscheint ambivalent, einerseits ist sie auf natürliche Weise identisch mit dem Wir, andererseits kann sie jedoch das Wir zerstören und sogar als schöne Idee ruinieren und würde sogar dann weiter auf die Hoheit über diesen Begriff pochen, wenn im Herzen längst kein Wir mehr besteht. Wie aus dem Wir der Freundschaft durch die Liebe ein quasi-familiäres Wir geschaffen werden kann, darüber berichtet uns Michel de Montaigne in seinem Essay Über die Freundschaft, den er in Erinnerung an seinen Freund – und Bruder! – Étienne de la Boétie geschrieben hat. Auch darüber will ich mir Gedanken machen.
Die Nation schließlich erschleicht sich die Emotionen des Wir, sie ist ein reines Produkt von Ideologie und Lüge, bereits ihr Name ist eine Irreführung, sie ist die Hölle des Wir – sie und ihr Patriotismus sind, wie Samuel Johnson, der klügste Mann, seit es Engländer gibt, sagte, die letzte Zuflucht des Halunken. Das Wir der Nation ist das Wir der Komplizen.
Beginnen wir damit, uns Gedanken über die Freundschaft zu machen. Ich greife ins Regal und bitte meinen alten Freund Ralph Waldo Emerson, mir zu helfen:
Ich muss Stolz mit den Errungenschaften meines Freundes empfinden, als wären sie meine eigenen, und ein Besitzgut an seinen Tugenden. Ich fühle das Lob, das ihm gilt, ebenso warm wie der Liebende den Applaus, der seiner Braut gilt. Aber wir überschätzen das Gewissen unseres Freundes. Seine Güte scheint besser als unsere Güte, seine Natur feiner, seine Versuchungen geringer. Alles, was sein ist, sein Name, seine Gestalt, seine Kleidung, seine Bücher und Instrumente, rückt die Vorstellungskraft in ein besseres Licht. Unsere eigenen Gedanken klingen neu und größer aus seinem Munde. (…) Freundschaft, wie die Unsterblichkeit der Seele, ist zu gut für unseren Glauben. Der Liebende, der sein Mädchen betrachtet, weiß halbwegs schon, dass sie nicht wirklich das ist, was er verehrt: und in der goldenen Stunde der Freundschaft werden wir von Schatten des Argwohns und des Unglaubens überrascht. Wir vermuten, dass wir unserem Helden die Tugenden verleihen, in denen er erscheint, und nachher verehren wir die Form, der wir dieses göttliche Innewohnen zugeschrieben haben. Im strengen Sinne achtet die Seele die Menschen nicht so, wie sie sich selbst achtet. In der strengen Wissenschaft unterliegen alle Menschen der gleichen Bedingung einer unendlichen Entfernung.
Dieser Amerikaner kann bisweilen ein unbequem verquerer Denker sein, der mit Schmeichelstimme verspricht, uns beizustehen, wenn wir beim Denken im Vagen steckenbleiben, und uns in seine pantheistische Idylle lockt – zum Beispiel, wenn er weiter schreibt: »Alle natürlichen Dinge machen einen verwandten Eindruck, wenn der Geist ihren Einflüssen gegenüber offen ist …«
Und kaum trauen wir uns aufzuatmen, weil wir meinen, wir sähen klarer, zieht er uns die Haut ab: »Wir dürsten nach Anerkennung, doch wir können dem, der uns anerkennt, nicht vergeben.«
Solche Sätze lassen uns den Mund offenstehen. Da habe ich ihn gerade als meinen Freund bezeichnet, nicht zuletzt, um ein wenig von seinem Glanz auf mich zu lenken – eben damit ich »Anerkennung« erfahre, ich geb’s zu –, schon stellt mich Ralph Waldo Emerson bloß, indem er sich dagegen verwahrt, von mir vereinnahmt zu werden. Und mir bleibt nichts anderes, als nach den Fragen zu suchen, die zu seinen Antworten passen.
Was haben wir dem zu vergeben, der uns lobt? Anerkennung ist doch Lob, oder nicht? Sie ist sogar mehr als Lob, denke ich. Lob meint eine Sache, die ich gut gemacht habe; Anerkennung meint mein Wesen, mich ganz und gar, meine Existenz. Hat unser bisheriges Leben denn nicht das gerade Gegenteil bewiesen? Nämlich, dass wir – im Gegenteil – dem nicht vergeben können, der uns die Anerkennung verweigert. Und ist es nicht vielmehr so, dass Anerkennung noch vor allen anderen Zuwendungen unsere Eitelkeit weckt, die unbedacht bereit ist, dem, der uns anerkennt, alles zu vergeben, ihm sogar zu vergeben, wenn er uns anlügt? Und sollte seine Anerkennung nur gespielt oder geheuchelt sein, wir vergeben ihm. Weil uns vorgespielte Anerkennung lieber ist als gar keine. Er hat sich, halte ich ihm zugute, wenigstens die Mühe gemacht, so zu tun, als würde er mich anerkennen. Seine Lüge war immerhin Höflichkeit. Und der Heuchler – bei ihm vermuten wir, dass er entweder Angst vor uns hat, was uns wieder schmeicheln würde, oder dass er von uns etwas will, was uns noch einmal und sogar noch lustvoller schmeichelt, denn immerhin sieht er in uns jemanden, der etwas zu geben hat, und wer etwas zu geben hat, der stellt etwas dar … So sehr dürsten wir nach Anerkennung, dass wir Höflichkeit und Heuchelei gnädig durchgehen lassen. Er braucht nur dreimal so zu tun, als ob, schon glauben wir ihm, schon nehmen wir ihm sein Spiel ab und erklären es für wahr.
Emerson fährt fort und legt noch eines drauf: »Die Süße der Natur ist Liebe; doch wenn ich einen Freund habe, quälen mich meine Unvollkommenheiten.«
Das ist dunkel. Versuchen wir es trotzdem: Ein Freund hat uns Anerkennung erwiesen, einer, dem wir vertrauen, dessen Lob wir glauben, über dessen Wertschätzung wir uns vorbehaltlos freuen dürfen, weil sie ehrlich gemeint ist, weder vorgespielt noch geheuchelt – und dennoch und immer noch, nein, gerade deswegen sind wir unzufrieden? Mehr noch: Sein Lob hat die Unzufriedenheit in uns erst geweckt. Und nicht mit ihm sind wir unzufrieden, sondern mit uns selbst. Sein schieres Freundsein lässt mich vor mir selbst als unvollkommen erscheinen. »Doch wenn ich einen Freund habe …«, sagt Emerson. Wer hat mir denn gesagt, dass dieser mein Freund ist? Hat er es mir selbst gesagt? Hat er sich mir als Freund angetragen? Hat er gesagt, ich bin dein Freund? Ja? Und durch diese zwei kleinen süßen Worte fühle ich mich bereits unvollkommen? Wäre mir lieber, er hätte gesagt, er sei nicht mein Freund? Dachte ich vorher denn, ich sei vollkommen? Und wäre es tatsächlich eine Qual, unvollkommen zu sein? – Was will mir Emerson da einreden? Was für Antworten haut er vor mich hin, damit ich die Fragen dazu finde?
»Meine Eigenliebe klagt die andere Seite an«, schreibt er weiter, und was nun folgt, ist in der Tat unerhört. »Wenn er (der Freund) hoch genug stünde, mich geringzuschätzen, dann könnte ich ihn lieben und durch meine Zuneigung zu neuen Höhen emporsteigen.«
Der Freund soll sein wie die Sterne am nächtlichen Firmament – sie »erwecken ein bestimmtes Ehrfurchtsgefühl, weil sie, obwohl immer gegenwärtig, dennoch niemals erreichbar sind …«
So einen Freund wollen wir? Einen, der uns geringschätzt? Wäre der nicht eher ein Feind? Können, wollen, sollen wir so jemanden in unser Wir aufnehmen? Der Wunsch, Emersons Worte mit unseren Empfindungen abzugleichen, drängt uns zu einer Definition. Was meine ich, wenn ich Wir sage? Aber was für einen Sinn hätte es, wenn wir uns durch eine Definition frühzeitig den Blick einengen? Also verschieben wir die Definition an den Schluss – oder gar darüber hinaus …
Noch bevor ich meine ersten Gedanken zu ihrem wackeligen Ende bringe, möchte ich kurz abschweifen und von einer Eigenart berichten, die meinen Eltern Sorgen bereitete, so schwere Sorgen, dass sie unseren Pfarrer um Rat baten; das heißt, meine Mutter bat ihn um Rat, mein Vater war dagegen, ließ es aber zu, weil er der hippokratischen Meinung war, wer heile, habe recht, sogar wenn’s ein Pfarrer ist. Meine Eigenart bestand darin, dass ich mit Dingen redete. Nicht mit Puppen oder Teddybären oder anderem menschen- oder tierähnlich Geformtem, sondern mit den rot-grün geflochtenen Schnürsenkeln meiner Schuhe oder mit meinem königsblauen Samtpullover oder mit jedem einzelnen meiner Buntstifte oder mit dem Micky-Maus-Heft, das mir mein Vater aus Wien mitgebracht hatte – nicht mit den Figuren darin sprach ich, mit Donald oder Dagobert oder Tick, Trick und Track oder dem großen, bösen Wolf, sondern mit dem Heft als Heft, das Bildergeschichten beinhaltete. In der Nacht gruppierte ich die Dinge um mein Kopfkissen herum. Hätte ich mir damals schon Gedanken zu unserem Thema gemacht, ich hätte, ohne zu zögern, gesagt: Ja, diese Dinge sind mein Wir. Die semantische Grenze zwischen diese Dinge sind mein Wir und diese Dinge gehören mir war für mich nicht streng gezogen. Die Dinge gehörten zwar mir, aber ich empfand für sie mehr, als einer Sache gegenüber statthaft ist. Diese Empfindung war eindeutig Liebe, und die unterschied sich von der Liebe zu einem Menschen, zum Beispiel zu meiner Mutter, eigentlich nicht. Als ich meinen königsblauen Pullover auf dem Fußballplatz vergaß und er am nächsten Tag nicht mehr da war, trauerte ich um ihn, als wäre er gestorben, und ich machte mir bittere Vorwürfe. Wie wenn einer aus meinem Wir durch meine Schuld gestorben wäre. Meine Mutter war sehr katholisch, wir besuchten ihr zuliebe jeden Sonntag die heilige Messe, und ich beobachtete sehr genau, was der Priester tat. Ich spielte es zu Hause nach. Ich bastelte ein Kreuz, verwendete zwei Eierbecher als Kerzenständer und richtete mir einen Altar her. Ich hielt eine Totenandacht für einen königsblauen Samtpullover.
Meine Großmutter erzählte mir das Märchen vom Herrn Korbes. Da tun sich Tiere mit Dingen zusammen, um einen Menschen zu quälen und zu töten. Das Märchen ist beunruhigend, weil, so habe ich später gelesen, wir nicht wissen, warum Hühnchen und Hähnchen, Katze, Ei, Nähnadel, Stecknadel und Mühlstein das tun. Mich beunruhigte das Märchen, weil ich mir einbildete, ich wüsste es. Ich konnte vielleicht nicht ausdrücken, warum sie handelten, wie sie handelten – fröhlich übrigens, heiter, ein Liedchen singend –, aber ich fühlte mit ihnen und war auf ihrer Seite und geriet in Aufregung, weil ich genau wusste, dass ich damit Unrecht tat. Die Tiere und die Dinge waren mir näher als der Herr Korbes. Hätte mich einer gefragt, wen ich zu meinem Wir