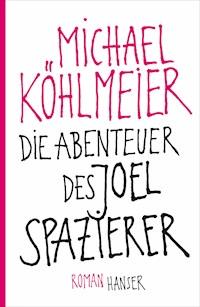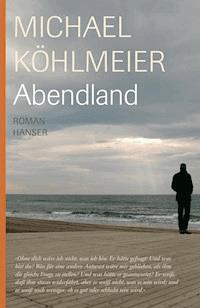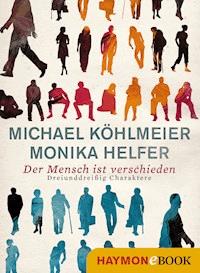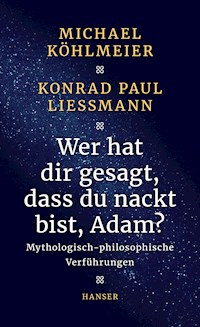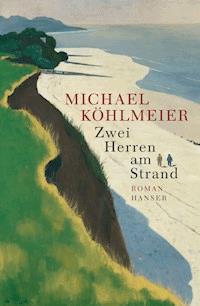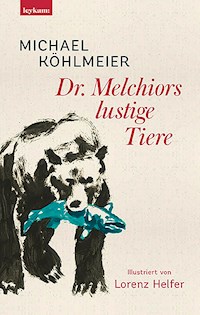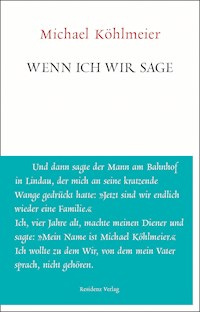Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Lenin auf dem Sonnendeck – eine beinahe wahre Geschichte vom "erstklassigen Erzähler Michael Köhlmeier." Denis Scheck, ARD Druckfrisch
Mit diesem großen Werk schließt Michael Köhlmeier an seinen Bestseller „Zwei Herren am Strand“ an. Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Architektin Anouk Perleman-Jacob einen Schriftsteller ein und bittet ihn darum, ihr Leben als Roman zu erzählen. In Sankt Petersburg geboren, erlebt sie den bolschewistischen Terror. Zusammen mit anderen Intellektuellen wird sie als junges Mädchen mit ihrer Familie auf einem der sogenannten „Philosophenschiffe“ auf Lenins Befehl ins Exil deportiert. Nachdem das Schiff fünf Tage und Nächte lang auf dem Finnischen Meerbusen treibt, wird ein letzter Passagier an Bord gebracht und in die Verbannung geschickt: Es ist Lenin selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mit diesem großen Werk schließt Michael Köhlmeier an seinen Bestseller »Zwei Herren am Strand« an. Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Architektin Anouk Perleman-Jacob einen Schriftsteller ein und bittet ihn darum, ihr Leben als Roman zu erzählen. In Sankt Petersburg geboren, erlebt sie den bolschewistischen Terror. Zusammen mit anderen Intellektuellen wird sie als junges Mädchen mit ihrer Familie auf einem der sogenannten »Philosophenschiffe« auf Lenins Befehl ins Exil deportiert. Nachdem das Schiff fünf Tage und Nächte lang auf dem Finnischen Meerbusen treibt, wird ein letzter Passagier an Bord gebracht und in die Verbannung geschickt: Es ist Lenin selbst.
Michael Köhlmeier
Das Philosophenschiff
Roman | Hanser
In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
Samuel Taylor Coleridge
Erstes Kapitel
Frau Professor Anouk Perleman-Jacob lernte ich an ihrem hundertsten Geburtstag kennen. Der Österreichische Ingenieur- und Architekten-Verein lud zu einem Abendessen ihr zu Ehren ins Palais Eschenbach im 1. Wiener Gemeindebezirk. Das war im Mai 2008.
Meine Einladung verdankte ich ihrem »ausdrücklichen Wunsch«. Ich möge die Geschichte von Dädalus erzählen; die habe sie im Radio gehört und wolle sie noch einmal hören, weil darin Dinge vorkämen, von denen sie nichts gewusst habe und von denen auch sonst niemand etwas wisse — sie habe bei ihren Freunden nachgefragt —, zum Beispiel, dass Dädalus ursprünglich Bildhauer, später Architekt und dann erst Erfinder gewesen sei. Das alles hatte mir der Präsident des Vereins, Herr Dr. Mahler, am Telefon mitgeteilt. Er klang, als wäre ihm die Sache unverständlich und unangenehm, und würde es nach ihm gehen, wäre keine Einladung an mich ausgesprochen worden. Seine Stimme war eintönig wie die eines Butlers, der vorsorglich jeden ihm unbekannten Besuch als verdächtig einstuft und verächtlich behandelt. Ich gab ihm recht — im Stillen —, auch mir war die Sache peinlich, denn gerade diese Geschichte hatte ich frei erfunden, hatte aber in meiner Radiosendung so getan, als wäre sie überlieferter Mythos.
Ich erzählte sie an diesem Abend dann doch nicht. Niemand forderte mich dazu auf. Ich war erleichtert, zugleich auch ärgerlich, ich war immerhin sieben Stunden mit dem Zug gefahren und würde noch einmal sieben Stunden zurückfahren. Ich wollte mich bei Gelegenheit davonschleichen. Vor dem Dessert kam ein junger Mann an meinen Tisch — ich war an den äußersten Rand des Saals platziert worden — und sagte, Frau Professor Perleman-Jacob wünsche, dass ich mich zu ihr setze.
Sie hörte nicht mehr gut und konnte nur noch schlecht sehen. Mit den anderen an ihrem Tisch sprach sie überlaut, mit fester, beinahe jugendlicher Stimme. Da waren neben dem Präsidenten des Vereins die Ministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, der Wiener Bürgermeister, der Leiter der Kulturabteilung der Stadt, der Vizekanzler der Republik und der russische Botschafter, dazu Gatte und Gattinnen, und dann noch eine Amerikanerin, eine — wie sie mir vorgestellt wurde — Freundin und Kollegin der Geehrten, die immer wieder nach ihrer Hand griff und sie drückte. Die Amerikanerin war es auch, die sich bei mir dafür entschuldigte, dass meine Erzählung aus dem Programm gestrichen worden war, eine Stimme wie ein Mann. Die Gefeierte höre inzwischen so schlecht, dass mein Auftritt nicht die gebührende Wirkung erfahren würde.
Frau Perleman-Jacob bat den Vizekanzler, der neben ihr saß, mir seinen Platz zu überlassen. Ich solle ihr »mein Ohr leihen«, damit meinte sie — sie winkte mich mit ihrem Zeigefinger zu sich —, ich solle mich zu ihr beugen. Es war mehr als merkwürdig: Flüsternd in strengem Ton befahl sie mir, amüsiert dreinzuschauen, auf jeden Fall nicht ernst, aber auch nicht allzu interessiert. Am besten, ich tue, als ob sie mir ein Kompliment zuflüstere, etwas Harmloseres gebe es in ihrem Alter nicht. Sie erwarte mich morgen Nachmittag um drei in ihrem Haus in Hietzing. Dann lachte sie spitz auf — ich lachte ebenfalls, als hätte sie mir, der ich halb so alt war wie sie, tatsächlich ein Kompliment gemacht — und raunte mir ihre Adresse zu.
Ich war nur für dieses Abendessen von Vorarlberg nach Wien gefahren. Frau Perleman-Jacob war eine zu bekannte Persönlichkeit, um abzulehnen, eine der bedeutendsten europäischen Architektinnen des 20. Jahrhunderts. Berühmtheit erlangt hatte sie, als sie in den Fünfzigerjahren in Frankfurt, Brüssel und in den Siebzigerjahren auch in Amerika Siedlungen für Arbeiter geplant und gebaut hatte, die — ich zitiere aus der Einladung des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins — »Schönheit und Funktion in unvergleichlicher Weise miteinander verbinden und dabei so kostengünstig waren, dass die Arbeiterfamilien es sich leisten konnten, sie eines Tages zu besitzen, weil Frau Professor Perleman-Jacob zugleich ein System errechnet hatte, das erlaubte, dass Mietzahlungen nach einigen Jahren in Vorauszahlungen auf Eigentum umgewandelt werden konnten«. Ein Freund, auch er Architekt, dem ich von der Einladung erzählte, hatte ausgerufen: »Was, die lebt noch?« Und hatte gleich gefragt: »Was hast du getan, dass sie dich bei ihrem Geburtstag bei sich haben will?« Darauf konnte ich ihm keine Antwort geben, die mir selbst triftig geklungen hätte.
Ich möchte zu Beginn meines Berichts ein paar Daten nennen: Anouk Perleman-Jacob wurde 1908 in Sankt Petersburg in Russland geboren und lebte dort bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr. Ihre Mutter, Maria Perleman, war Ornithologin und arbeitete als Assistentin von Sergei Buturlin, dem über Russland hinaus bekannten Wissenschaftler. Der Vater, Michail Jacob, war bis zur Ausreise der Familie Professor an der Universität Sankt Petersburg, als junger Mann hatte er zu der Gruppe von Architekten gehört, unter deren Leitung die berühmte Große Choral-Synagoge geplant und gebaut worden war. Mutter und Vater genossen in intellektuellen Kreisen der Stadt großes Ansehen, beide sympathisierten lange mit den Bolschewiki. Vor allem, weil sie anprangerten, wie unter dem Zaren die Juden behandelt wurden. Nach dem Tod ihrer Eltern — sie waren im Exil in Berlin 1931 gemeinsam aus dem Leben geschieden — nahm Anouk den Namen sowohl ihres Vaters als auch den Geburtsnamen ihrer Mutter an. Auch um, wie sie sich ausdrückte, ein Zeichen des Protests zu setzen gegen die Tradition, die Kinder immer und allein nach dem Vater zu benennen. — Das war übrigens das Erste, was sie mir erzählte, da hatte ich noch gar nicht ihr gegenüber Platz genommen.
»Mein Ehemann ist vor dreißig Jahren gestorben. Wir waren zwanzig Jahre verheiratet. Es hat ihn nicht gestört, dass ich ohne seinen Namen neben ihm existierte. Ebenso wenig, wie es mich gestört hat, dass er hieß, wie er eben hieß. Wir hatten nicht viel gemeinsam, zu wenig, um einen gemeinsamen Namen zu rechtfertigen.«
Wir saßen im Wohnzimmer einer sachlich eingerichteten Villa — bei einem meiner späteren Besuche führte mich Frau Perleman-Jacob durch das Haus —, wir tranken Bier, und sie rauchte. Sie habe vor drei Jahren wieder damit angefangen und hoffe nun, die Zigaretten brächten sie schneller hin zum Tod.
Und dann teilte sie mir den wenig schmeichelhaften Grund mit, warum sie gerade mich »ausgesucht« habe.
»Ich habe mich über Sie erkundigt. Sie haben einen guten Ruf als Schriftsteller, aber auch einen etwas windigen. Ich weiß, dass Sie Dinge erfinden und dann behaupten, sie seien wahr. Jeder wisse das, hat man mir gesagt, aber immer wieder gelinge es Ihnen, Ihre Leser und Zuhörer hinters Licht zu führen. Deshalb glaube man Ihnen oftmals nicht, wenn Sie die Wahrheit schreiben, und glaube Ihnen, wenn Sie schummeln. Das habe ich mir sagen lassen. Stimmt das?«
Und kam, ohne meine Antwort abzuwarten, zu ihrer Sache: »Sie sollen nicht meine Biografie schreiben, die ist bereits geschrieben worden. Zwei sogar. Eine auf Deutsch, eine auf Russisch. Beide nicht besonders. Das jedenfalls meint Alice Winegard. Ich habe weder die eine noch die andere gelesen. Alice haben Sie kennengelernt, sie saß bei uns am Tisch. Ist Ihnen aufgefallen, dass sie keine Augenbrauen hat? Wie das Looshaus am Michaelerplatz. Sie arbeitet zusammen mit einer Kollegin an der dritten Biografie, die soll aber eine Monografie werden, eine Werkschau. Das heißt, Alice selbst schreibt nicht, sie gibt lediglich Auskunft, sie weiß alles über meine Arbeit. Aber nicht alles über mich. Was niemand weiß, das sollen Sie schreiben, ein Schriftsteller, dem man nicht glaubt, was er schreibt.« — Das aber sei nicht ihr Problem, sondern meines. — »Gesagt werden soll es. Und wenn es keiner glaubt, umso besser. Aber erzählt werden soll es.«
Ich fragte nicht weiter. Ich dachte, wenn ich frage, mildere ich meinen schlechten Ruf. Ich wolle darüber nachdenken.
»Bitte«, sagte sie, »denken Sie nicht zu lange darüber nach. Die Zigaretten wirken bereits.«
Ich telefonierte mit meiner Frau. Monika war empört. Alter schütze offenbar nicht vor unzumutbarem Verhalten. Ob wir wenigstens über Geld gesprochen hätten. Hatten wir nicht.
»Also sag ab! Oder sag erst gar nicht ab. Tu einfach nichts. Komm heim.«
Das nahm ich mir auch vor. Aber am nächsten Tag drückte ich wieder auf den Klingelknopf an der Haustür der Villa in Hietzing. In meiner Tasche hatte ich eine Schachtel Marlboro und mein Handy als Aufnahmegerät.
Zweites Kapitel
»Was ich Ihnen erzählen möchte, geschah im Jahr 1922. Ich war vierzehn Jahre alt und hatte bereits einen Busen. Meine Mutter sorgte sich, dass er sehr groß werden könnte. Weil er schon so früh anfing. Er ist dann ja auch groß geworden. So ganz nebenbei ist das nicht. Denn die Damen zu der Zeit, als ich endlich selbst eine war, bevorzugten einen kleinen Busen oder gar keinen. Am besten gar keinen. Pech gehabt. Sonst war ich noch ein Kind. Sogar mehr ein Kind als die anderen Mädchen in meinem Alter, die noch keinen Busen hatten. Außerdem störte er beim Turnen, und ich war eine gute Turnerin und tat es gern.
Wir lebten damals bereits in unserer neuen Wohnung. Aus der alten waren wir ausquartiert worden. Das war wegen des allgemeinen Elends in Sankt Petersburg. Große Wohnungen wurden in Lazarette umgewandelt. Oder kaputt geschlagen. Oder angezündet. Es war Bürgerkrieg. Und ein Bürgerkrieg ist immer auch ein Krieg der Armen und Ungebildeten, der Dummen und Bösartigen gegen die Intelligenzija. Zur Intelligenzija gehörte, wer nicht schwitzte, nicht stank und seine Arbeit im Sitzen tat. Das traf auf meine Eltern zu. Seit zwei Jahren wohnten wir in der neuen Wohnung. Ich muss sagen, mir gefiel sie besser als die alte. Aus verschiedenen Gründen. Erstens war sie für ein verschmustes Ding, wie ich damals noch eines war, gemütlicher, und leichter zu heizen war sie auch, in der alten hatte ich immer gefroren, sogar im Sommer. Wenn man im Korridor gesprochen hat, hallte es, das mochte ich nicht. Mir war, als redete jemand anders und nicht ich. Hauptsächlich aber gefiel mir die neue Wohnung besser, weil rundherum viel los war, draußen auf den Straßen und Gassen und auch im Haus selbst. Unter uns waren nämlich ein Kino und ein Gasthaus. Ein übles Gasthaus. Wahrscheinlich auch ein übles Kino. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Gasthaus etwas anderes zu trinken gab als Wodka. Zu essen, das weiß ich bestimmt, weil ich doch hie und da nach unten schlich und bettelte, gab es in Essigwasser eingelegte harte Eier und Brot mit Öl oder Schmalz, selten mit Butter, und wenn, dann war sie ranzig. Manchmal Heringe.
Wenn man von der Straße hereinkam, war zuerst ein Vorraum, von wo es geradewegs weiterging in das Gasthaus. Rechts davon war der Eingang zum Kino mit dem winzigen Schlupf, in dem eine Dame saß und die Karten ausgab. Dame, weil sie geschminkt war. Enge, hohe kirschrote Lippen, geformt wie ein Bogen der Reiter des Dschingis Khan. Da qualmte es heraus aus dem Schlupf, als säße sie in einem Backofen. Das war sie mit ihrer Papirossa. Daneben führte die Stiege hinauf zu unserer Wohnung und zu den anderen Wohnungen. Vier oder fünf Stockwerke. Ich sehe das Haus vor mir, als stünde es immer noch, eine Straße weit von hier, und ich wäre erst gestern dort gewesen. Halblinks ging es durch eine Balkentür in den Hof zum Waschhaus. Balkentür sage ich, weil wir so gesagt haben. Sie war tatsächlich aus dicken Balken zusammengenagelt, senkrechte Balken, waagrecht darüber genagelte starke Bohlen. Man brauchte Kraft, um die Tür auf- und zuzuziehen. Sie hätten darauf schießen können, die Kugeln wären stecken geblieben. Besitzen Sie eine Waffe? Hemingway soll gesagt haben, für einen Schriftsteller sei ein Revolver ebenso wichtig wie eine Schreibmaschine. Ich habe später Wohnungstüren aus massivem, dickem Holz geplant und auch eingesetzt. Die waren beliebt. Der Mensch hat gern das Gefühl, sein Haus sei eine Burg, auch seine Wohnung sei eine Burg. Sogar sein Auto sei eine Burg. Wenn man sich als Architekt nach den Empfindungen der Kunden richtet, dann fällt das genauso unter die Kategorie funktionell, wie wenn man der sogenannten Logik des Materials folgt. Misst sich Funktionalität nur an der Sache, was hätte sie dann für einen Sinn? Man dürfte nur Garagen aufstellen. Und wer nur der Logik des Geldes folgt, der sollte besser Portmonees nähen als Häuser bauen.
Im Vorraum roch es nach Folgendem: erstens nach Pisse, Ammoniak. Gleich links neben dem Eingang war nämlich der Abort. Die Tür ausgehängt, die war im Winter verheizt worden. Die Balkentür war verschont worden, sonst hätte man den Winter im Haus gehabt. Für das große Geschäft war einfach ein Loch im Boden, irgendwohin wird es schon abgeronnen sein, über das musste man sich hocken, Kleider über den Hintern ziehen, fertig, das ging. Davor hing eine Wolldecke, die hätten Sie nicht angreifen wollen, nein, das hätten Sie nicht wollen. Für das kleine Geschäft der Männer war rechts eine Blechwand. Zweimal am Tag kam eine Frau und hat einen Kübel heißes Wasser an die Blechwand geschüttet und einen in das Loch im Boden. Das war also Geruch Numero eins. Zweitens roch es nach Tabakrauch und Schnaps und Rotwein, und Männerachselschweiß, diese vier Gerüche fasse ich zusammen in einen, den Gasthaus- und Kinogeruch. Drittens aber, und erst dieser Geruch rundet das Ganze ab, drittens roch es nach dem Wachs, mit dem die Stiege hinauf zu unserer Wohnung eingelassen war, und dieses Wachs, das roch wirklich gut, sehr gut, nach Honig, ein Duft nahezu. Mindestens einmal in der Woche wurde die Stiege gewachst und geplättet, dunkelbraun rötliches Holz, ich denke, alte Buche.
Meine Mutter hatte sich immer ein zweites Kind gewünscht. Mein Vater nicht. Ich hätte auch gern eine Schwester oder einen Bruder gehabt, lieber eine Schwester. Eine jüngere Schwester, die zu mir aufblickt und der ich helfen kann im Leben irgendwann einmal, dass sie vorbeikommt und wir gemeinsam weinen, was bekanntlich guttut. Aber ich gebe ihm recht, meinem Vater. Schon damals habe ich ihm recht gegeben. Das hat ja der Unbarmherzigste unter den Unbarmherzigen eingesehen, dass man in dieser Stadt zu dieser Zeit keine Kinder kriegen soll. Dass man damit warten soll. Es konnte ja nur aufwärtsgehen. Die Revolution ist schließlich gemacht worden, damit es aufwärtsgeht. Es galt als ein Quasinaturgesetz, dass, wenn es aufwärtsgehen soll, es zunächst abwärtsgehen muss, aber eben nur vorübergehend. Um Anlauf zu nehmen, sozusagen. Revolution ist Anlauf. Wenn man schließlich ein bisschen höher oben angekommen sein würde, könnte man sich das Kinderkriegen überlegen. Aber jetzt nicht. Das war der Tenor meines Vaters. Es wurde aber nicht besser, und niemand kam höher an. Es ging nicht aufwärts. Und sogar für ein verschmustes Ding, wie ich eines war, wurde es bald zu eng in unserer neuen Wohnung. Weil Kamenew der Meinung war, es wäre da noch Platz für eine zweite Familie. Oder Sinowjew. Woher sollte ich das wissen. Oder gleich Trotzki. Ich kannte ihre Namen, aber die kannte jeder in der Stadt. Gesehen habe ich nicht einen von ihnen. Und auch nicht gehört. Vor dem Trotzki haben sich alle gefürchtet, noch mehr als vor dem Lenin. Lenin denkt, Trotzki tut. So hat es geheißen. Gelobt hat den Trotzki jeder, aber gefürchtet auch. Weil er sich konzentrieren konnte. Es ist einer kein geistvoller Mann, nur weil er viele Ideen hat, wie auch der kein guter General ist, nur weil er viele Soldaten hat. Es braucht dazu noch Konzentration. Dass Trotzki Jude war wie wir, das hat uns beruhigt. Nicht sehr beruhigt, aber ein wenig doch. Wir dachten, wenn es ernst wird, erkennt er seine Leute. Obwohl: Sinowjew war auch Jude, Apfelbaum soll er in Wahrheit geheißen haben, und der war der Meinung, zehn Prozent der hundert Millionen Russen müssten vernichtet werden, das sind zehn Millionen, Maden, die am Allgemeinwohl fressen, wie er sich ausdrückte. Da wären sicher auch Juden dabei gewesen. Ob er die geschont hätte? Darauf konnte man sich nicht verlassen. Er selber auch nicht, er konnte sich auch auf nichts verlassen. Als ihn Stalins Schergen in die Mangel nahmen, soll er, bevor sie ihm die Seele aus dem Leib prügelten, den Schma Jisrael angestimmt haben. Er hat angeklopft bei seinem alten Gott. Geholfen hat er ihm nicht.
Eine gewisse Zeit, ein paar Monate, wohnte also eine zweite Familie bei uns. Gut erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich, dass überall Wolldecken hingen, zur Abgrenzung, auch ein Mantel mit einem sehr breiten Kragen, zum Fürchten, in der Nacht sah das aus, als hätte sich jemand erhängt. An irgendwelche Konflikte erinnere ich mich nicht. Wir hatten nicht viel miteinander zu tun. Sogar in dieser Enge konnten wir uns aus dem Weg gehen. Sie waren misstrauisch, wir waren es auch. Wenn ich sage, es war eine Familie, dann stimmt das wahrscheinlich gar nicht. Kinder waren nämlich keine dabei. Ich habe mich nach Gleichaltrigen gesehnt. Ich hätte mich gern verliebt. Einmal war ich es gewesen. Aber das war so hurtig und traurig abgelaufen, dass ich es gar nicht richtig mitgekriegt habe. Mein Gott, mit zehn! Ich wusste, ich bin keine Schönheit und werde wohl nie eine werden, aber verliebt hätte ich mich doch gern noch einmal. Ich stellte mir vor, wenn man verliebt ist, schüttet man sich gegenseitig das Herz aus. Und jetzt können Sie sehen, was ich für ein dummes Ding war: Ich wünschte mir tatsächlich Sorgen! Dass, wenn ich verliebt wäre, ich sie ausschütten könnte. Ich kam mir dumm vor, weil ich keine richtigen Sorgen hatte. Das muss man sich einmal vorstellen! Die größte Sorge war, dass ich nicht hübsch bin. Aber genau diese Sorge kann man nicht mitteilen, wenn man verliebt ist. Dann hätte man sich gleich ein Schild an den Hut heften können: In die da auf keinen Fall sich verlieben!
Ich glaube, es waren ein Ehepaar und ein Schwager oder Cousin, keine Familie also. Ich hoffte, sie würden eines Tages Besuch bekommen und ein Bursch wäre dabei, ein bisschen älter als ich am besten und ebenfalls nicht besonders hübsch. Vor dem Einschlafen dachte ich mir aus, er wäre einer mit Sorgen und wir würden uns aneinanderlehnen.
Unsere alte Wohnung dagegen war die Wohnung eines Universitätsprofessors und einer Wissenschaftlerin gewesen, das heißt eine Wohnung angesehener Leute, die über ihr Ansehen hinaus auch noch Geld hatten. Sie lag nicht weit von unserer neuen Wohnung entfernt. Nicht weit vom Newski-Prospekt. Dort, wo sich in Sankt Petersburg alles abspielte zu jener Zeit, die großen Ereignisse. Dort hatten sich immer alle großen Ereignisse abgespielt. Das Haus lag in einer Seitenstraße, die Wohnung aber war in der Beletage. Woran ich mich sehr gut erinnere, ist das Stiegenhaus, in dem würden heute Kongresse abgehalten, so vornehm, so weit, Theateraufführungen, auf den Stufen Pölster für die Zuschauer, Marmor und Messing und Kronleuchter, grüner Marmor, zu sechst nebeneinander konnte man über die Stiege hinaufgehen und musste sich nicht quetschen. Meine Mutter hatte auch verdient, natürlich als Assistentin lange nicht so viel wie der Herr Professor, dafür konnte sie mit einer zünftigen Erbschaft aufwarten. Und angesehen war sie auch. In der Fachwelt auf jeden Fall. Aber auch bei den anderen Fakultäten der Universität. Immerhin hatte sie in ihrer Jugend die Rosenmöwe entdeckt, die in den Polargebieten heimisch ist, über sie hatte sie ihre Dissertation geschrieben. War auf Expedition gewesen in Nordnorwegen. Von der Erbschaft war nach dem Krieg und der Revolution und dem Bürgerkrieg nicht ein Blättchen übrig geblieben. Die Rosenmöwen hätte man eventuell essen können, aber die waren schwer zu erwischen. Das war jetzt ein Witz. Ich nehme an, das haben Sie kapiert.
Ich komme immer wieder mit dem Zählen durcheinander, aber wenn ich mich nicht irre, hatte unsere alte Wohnung acht Zimmer. Acht Zimmer für zweieinhalb Menschen! Da sind aber die Abstellräume und die Kabinette, das Badezimmer und die Küche nicht mitgerechnet, auch nicht das Zimmer für das Dienstmädchen, so eines hatten wir nämlich, ein Zimmer und ein dazu passendes Mädchen. Den Namen habe ich vergessen. Oder nie gewusst. Ich erinnere mich auch nicht, wie sie aussah. Oder wie alt sie war. Kann ja auch eine ältere Frau gewesen sein. Man hätte trotzdem Mädchen gesagt. Und eine Putzfrau dreimal in der Woche hatten wir auch. Ich kann mich nur an ihren Hintern erinnern. Beim Putzen beugt man sich nach vorne, und ich war nicht viel höher als ihr Hintern. Das soll Sie aber nicht dazu verleiten zu glauben, ich sei eingebildet und hoffärtig gewesen, ein arrogantes Bürgertöchterchen. War ich nicht. Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, wie mein Vater ausgesehen hat. Der eigene Vater! Kein Bild! Außer abstrakte Daten. Groß. Dunkel. Leise. Alt. Das ist es aber auch schon. Mehr kommt zu diesem Thema nicht aus meinem Hirn heraus. Was aus seiner Tochter geworden ist, hat er nicht mehr mitgekriegt. Er: Architekt und Professor für Architektur, ich: Architektin und eine berühmte dazu. Ob er stolz auf mich gewesen wäre? Nein, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Reporter stellen solche Fragen. Und dann unsere Bibliothek. Ich denke, sie ist verheizt worden. Interessanterweise erinnere ich mich sehr gut an manche Gespräche, die mein Vater und meine Mutter geführt haben. An manchen Wortlaut genau, meistens völlig unwichtige Dinge. Das Gedächtnis ist ein ineffektives Gerät, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf.
In Sankt Petersburg lebten nach der Revolution und dem Krieg weniger Menschen als zuvor, also Platz wäre genug da gewesen. Ich habe später gelesen, dass nur noch ein Drittel der Einwohner übrig geblieben war. Da bin ich erschrocken. Noch nach so vielen Jahren bin ich erschrocken. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die alle erschossen worden sind. Sind sie nicht, sind sie schon, aber nicht alle, viele sind aus Sankt Petersburg hinaus, die neue Hauptstadt war Moskau. Oder sind verhungert. Trotzdem sollte eine Zweieinhalbmenschenfamilie nicht in so einer großen Wohnung leben dürfen. Auch wenn überall Platz genug war. Ich nehme an, das hat der Sowjet von Petrograd so beschlossen. Also haben wir uns eine neue Wohnung gesucht. Meine Mutter hat den Umzug organisiert. Mein Vater war nicht in der Lage dazu. Obwohl man es falscher kaum ausdrücken kann. Er hat nämlich die ganze Zeit nur gelegen. Auf dem Kanapee. Auf dem Kanapee mit der hohen Lehne links und dem groben Blumenmuster, die Blumen waren mit vernähten Goldfäden umrahmt, manchmal habe ich einen herausgezupft, das war dann auch schon egal. Depression würde man heute sagen. Ein großer, dunkler, leiser, depressiver, alter Vater, der wie später seine Tochter zu viel geraucht hat. Meine Mutter dagegen hatte einen Nacken wie ein Raubtier. Und zwar ein Raubtier knapp vor dem Absprung. So ist sie durch die Wohnung marschiert, durch die große Wohnung, von einem Zimmer ins andere. Jemand, der meine Mutter nicht kannte, hätte sich darüber erschrecken können. Was hat sie vor? Was tut sie gleich? Sie richtete unser Leben neu ein. Einer musste es ja tun. Komm endlich zu Willen, sagte sie zu meinem Vater. So drückte sie sich aus. Komm endlich zu Willen! Auf Deutsch sagte sie es. Das heißt doch: Nicht die Kraft fehlt ihm, der Wille fehlt ihm. Das geht doch! Wenn man keine Kraft hat, kann man nichts machen, da trifft einen keine Schuld. Aber einfach wollen, das kann man doch! Komm endlich zu Willen! Jawohl!
Ich erinnere mich an das Tanzen im Park. Diese Erinnerung macht mich fast so glücklich wie die Erinnerung an den Gestank unter unserer neuen Wohnung. Tanzen im Park! Wenn man nichts hat, hat man wenigstens noch das Freie und die Luft im Freien. Also sind alle ins Freie. Sogar im Winter. Schöner war natürlich der Sommer. Sogar in der bittersten Zeit haben wir Aprikosenlimonade getrunken. Da gab es Holzwägen, dort schenkte man aus. Für die kleinste Münze ein aus Papier gedrehtes Becherchen. Gerade ein Schluck. Hat geschmeckt wie Haarwasser. Köstlich. So fingen die schönen Nachmittage im Freien an. Im Sommergarten und an der Fontanka. Dort unten standen oder saßen Musikanten, Akkordeon oder zwei Geiger oder Balalaikaspieler und Trommler, Tamburinspielerinnen, Sänger. Gerade so weit auseinander spielten sie, dass einer dem anderen nicht dreinspielte. Ich stellte mich gern genau zwischen zwei Musiken. Manchmal war ein kleiner Chor zu hören. Eher selten. Wie soll man zu einem Chor tanzen? Chöre sind zum Weinen da. Mein Vater lag zu Hause, und ich begleitete meine Mutter in den Sommergarten. Alle Menschen waren dünn wie Zweige. Und alle haben aus dem Mund gerochen. An den Hungermundgeruch hatten wir uns alle gewöhnt. Auch an die verschwitzten Haare. Ein Mann hatte verschwitzte Haare zu haben. Das war so. Wer nicht, war ein Faulpelz. Man kann die Zeiten nach den Mundgerüchen unterscheiden. Wir alle hätten lieber gegessen als getanzt. Aber besser nichts essen und tanzen als nichts essen und nicht tanzen. Obwohl der Mensch nach dem Tanzen bekanntlich mehr Hunger hat, als wenn er nicht getanzt hätte. Gegen Hunger hilft, sich nicht bewegen. Drum hat mein Vater nie Hunger gehabt. Meine Mutter war jetzt wirklich nicht das schönste Exemplar unter der Sonne, aber temperamentvoll war sie. Ich habe mitbekommen, dass sie zu den Frauen gehörte, die oft aufgefordert wurden. Ich glaube, keine andere wurde öfter aufgefordert. Obwohl es einige Schöne gab. Alleinstehende Schöne. In normalen Zeiten muss eine Schöne nicht allein zum Tanze gehen. Da stehen zehn vor ihrer Tür und warten darauf, sie auszuführen. Die nicht normalen Zeiten haben eben auch ihre Vorteile. Vornehme Zurückhaltung hat man damals nicht beobachten können. Wie beim Essen, so beim Tanzen. Meine Mutter hat mir alle Vögel erklärt, die auf den Bäumen herumhüpften, und während sie mit der ausgestreckten Hand sehr unpräzise zum Himmel hinaufzeigte, hat sie mit den Augen die Kandidaten geprüft. Ich sage dazu: mit den Augen abgegriffen. Wenn sie sich einen ausgesucht hat, hat sie mich stehenlassen und ist auf ihn zu. Wie ein Jaguar. Ein Nacken wie ein Raubtier, ich sagte es bereits. Ein bisschen einen krummen Rücken. Absprungbereit. Dabei wollte sie nur tanzen. Nichts Erotisches. Und lachen wollte sie auch. Man tanzte, um zu lachen. Aber das ist ja bereits Erotik. Was meinen Sie? Erotik in den Zeiten der Not, das ist ein eigenes Kapitel! Ich tanzte auch. Lieber aber saß ich irgendwo und schrieb in mein Tagebuch. Ein Drehbleistift war mein Schatz. Ich drückte nur sehr zart auf, damit die Mine lange hält. Viel später, als wir in Berlin waren, habe ich zurücklesen wollen und konnte nicht oder nur schwer entziffern, was ich geschrieben hatte. Weil alles so blass war. Gezeichnet habe ich. Zeichnungen nicht von Menschen. Menschen haben mich nicht sonderlich interessiert, als Motiv. Ihre Geschichten interessierten mich. Wie sie leben. Das ist immer noch so. Das war so und ist so. Aber wenn man einen Menschen zeichnet oder fotografiert, was ist er dann? Ein Schriftsteller, wie Sie einer sind, der muss jetzt sagen, bei einem guten Bild kann sich der Betrachter die Geschichte dieses Menschen ausdenken. Ein Bild ist gerade so gut, wie es Geschichten aufrufen kann im Betrachter. Das müssen Sie als Schriftsteller sagen. Sie leben ja von der Einbildungskraft. Ich halte wenig davon. Was haben die Geschichten, die Sie sich ausdenken, mit dem Menschen auf dem Bild zu tun? Rein gar nichts. Mit Ihnen haben sie etwas zu tun, sonst mit niemandem. Wenn ich eine Mauer abzeichne oder ein Haus, dann hat die Mauer oder das Haus keine Geschichte. Die sind, was sie sind. Wenn einer sagt, das Haus da hat eine Geschichte, dann meint er, die Leute, die in dem Haus wohnen oder gewohnt haben, haben oder hatten eine Geschichte. Aber die Leute sind nicht auf dem Bild. Sie sind tot. Das Haus ist, was es ist. Die Mauer ist, was sie ist. Die Brücke ist, was sie ist.