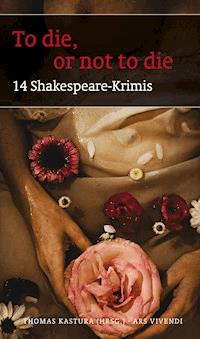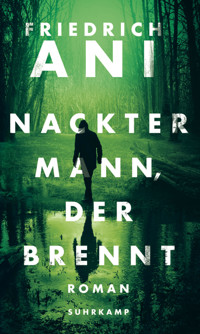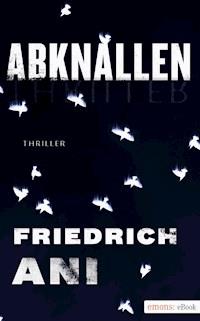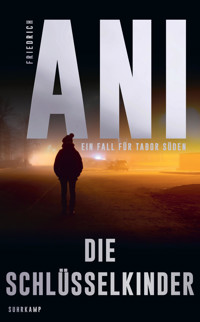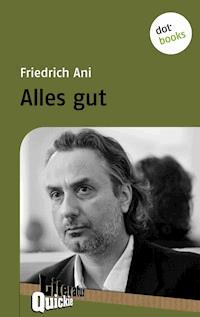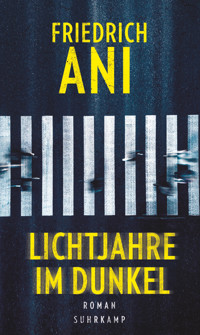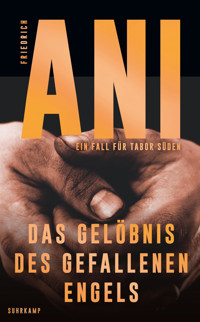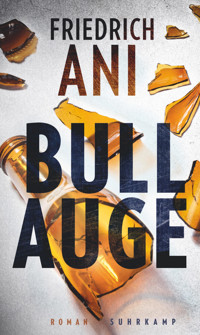
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Polizist Kay Oleander wurde auf einer Demo mit einer Bierflasche im Gesicht getroffen. Dabei hat er sein linkes Auge verloren. Vom Dienst freigestellt, bringt er sich eher mühsam durch den Tag, bis ihn das Schicksal mit Silvia Glaser zusammenführt. Seit einem Fahrradunfall ist auch sie eine Versehrte. Auf unverhoffte Weise finden die beiden Halt aneinander. Und das, obwohl sie im Verdacht steht, für Oleanders Unglück verantwortlich zu sein. Silvia Glaser fand nach dem Unfall, der ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, Zuflucht bei einer rechtspopulistischen Partei. Sie möchte aussteigen, wagt es aber nicht, weil sie Repressalien fürchtet. Als sie von Plänen der Parteispitze zu einem Attentat erfährt, weiht sie Oleander ein. Die beiden beschließen, den Anschlag zu verhindern. Dafür brauchen sie Verbündete, doch die sind für zwei wie sie nicht leicht zu finden …
Friedrich Ani erzählt mitfühlend und lakonisch die Geschichte zweier Versehrter, die allen Widrigkeiten zum Trotz zueinander finden und sich zusammenraufen, um ein Mal etwas richtig zu machen in einem Leben, das sich schon lange falsch anfühlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
Friedrich Ani
Bullauge
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5372.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: mauritius images/Kemedo/Alamy
eISBN 978-3-518-77213-3
www.suhrkamp.de
Motto
In diesem Moment war sein letztes Vorhaben, den Himmel zu heiraten, nachdem er die Verlobung mit dieser übertünchten Natur aufgelöst hatte. Dieses Land, so heißt es, wirft sich am Ende immer in ein Meer.
Franck Bouysse, Rauer Himmel
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Erster Teil
1
Ohne Humor ist alles nichts
2
Das Blöken der Spaziergänger
3
Der Elch vorm Fenster
4
Begossener Pudel im Regen
5
Erschaffung der Menschheit
6
Mangel an Atem
7
»Magda’s mag das nicht«
8
Was am siebzehnten Februar geschah
9
Frau Kalaschnikow Nummer fünf
10
Die Möwe und der Blaue
Zweiter Teil
1
Geschorener Maulwurf
2
Was wenn? Was dann?
3
Eine Stimme, so samten wie heiser
4
Beschwingt im Englischen Garten
5
Eine elektrisierende Nachricht
6
Verfickte Sackgesichter
7
Der Clown auf der Couch
8
Frau im Haus, alles ok
9
Mit Stumpf und Stiel
10
Sind Sie das?
11
Drei Mönche, zwei Leichen
12
Das rote Leuchten
Informationen zum Buch
Bullauge
Erster Teil
1
Ohne Humor ist alles nichts
Er schaute mir ins Gesicht. Das tat er jedes Mal, wenn er seinen Redefluss unterbrach, einen Schluck Kaffee trank und die Augen zusammenkniff. Als bemerke er etwas an mir zum ersten Mal; als irritiere ihn mein stoisches Dasitzen, meine offensichtliche Gelassenheit; als habe er einen völlig anderen Mann erwartet als den, der vor einer Stunde die Tür geöffnet und ihn wie einen guten Freund hereingebeten hatte.
Wir waren Kollegen, kannten uns lange, hatten eine Menge Einsätze gemeinsam absolviert und – im Vertrauen aufeinander und dank unserer Erfahrung auf der Straße – die eine oder andere Gefahrensituation bewältigt; von enger Freundschaft konnte keine Rede sein. Wir respektierten uns; gelegentlich tranken wir mit anderen Kollegen ein Bier in der Kneipe und saßen bei den Weihnachtsfeiern am selben Tisch.
Auf die Idee, ihn in meine Wohnung einzuladen, wäre ich nie gekommen.
Er hatte mich angerufen und sich nach meinem Zustand erkundigt. Schließlich kündigte er einen Kurzbesuch an, immerhin beträfe die Sache uns beide; seit Wochen hätten wir praktisch kein Wort mehr gewechselt, was er, wie er betonte, sehr bedauere.
Klar, hatte ich gesagt, schau vorbei.
Und da war er und schaute. Schaute mir ins Gesicht, ungefähr alle fünf Minuten, aus schmalen Augen, die Lippen aufeinandergepresst, mit einer Mischung – bildete ich mir ein – aus professionellem Beobachtungszwang und ihn selbst überfordernder Verwirrung. Wie einer, der partout nicht glauben will, was er sieht.
Nach allem, was er von den Kollegen in der Zwischenzeit erfahren haben musste, dürfte ihn mein Aussehen nicht im Geringsten überrascht haben – zumal ich mich nicht in den Buckligen von Notre Dame oder in einen Elefantenmenschen verwandelt hatte. Ich hatte mich überhaupt nicht verwandelt. Ich war derselbe wie vor der Attacke, abgesehen von dem ovalen Filzteil auf meiner linken Gesichtshälfte, das ich trug, um mein Wohlbefinden zu steigern und das mich zudem an alte Zeiten auf hoher See in meinem Kinderzimmer erinnerte. Eine innere Freude, die ich mit niemandem teilte.
»Und es war wirklich nichts, gar nichts zu machen?«
Polizeiobermeister Gillis setzte die Kaffeetasse ab und warf einen Blick auf das Stück Keks-Schichtkuchen, das auf seinem Teller übrig war. »Schmeckt wie früher, der Karierte Affe.« Und er fügte hinzu, als belehre er einen wesentlich Jüngeren: »Meine Großmutter hat den Kuchen immer so genannt, kennst du den Ausdruck?«
»Nein«, log ich.
Mehr noch als schon bei unserer Begrüßung missfiel mir zunehmend sein Aussehen: die vollkommen überflüssige Dienstuniform samt Schusswaffe und Handschellen, dazu die Schirmmütze, die er, als ich die Tür öffnete, pflichtbewusst abgenommen und im Wohnzimmer neben sich auf die Couch gelegt hatte. Das blaue Hemd mit der dunkelblauen Krawatte sah frisch gewaschen und gebügelt aus; sein Lederblouson hatte er anbehalten.
Je länger er dasaß, an seinem Kaffee nippte und mit der Kuchengabel trockene Affenteile zu seinem Mund balancierte, desto weniger gelang es mir, seine Anwesenheit als eine halbwegs angenehme Abwechslung in meinem monotonen Alltag wertzuschätzen. Ihn zu fragen, was ihn – außer meinem Gesundheitszustand oder meinem ihn anscheinend überfordernden Aussehen – in Wahrheit beschäftigte, widerstrebte mir.
Plötzlich kam mir mein Kollege Arno Gillis wie ein Eindringling vor. Pure Neugier, dachte ich, habe ihn getrieben, oder – und dieser Gedanke ärgerte mich sofort – er hatte irgendeine dämliche Wette verloren. Womöglich wäre er deswegen gezwungen gewesen, mir trotz meines eindringlichen Wunsches, eine Zeitlang in Ruhe gelassen zu werden, zwischen zwei Dienstzeiten einen Blitzbesuch abzustatten.
Wetten war eine Art Megahobby einiger Kollegen auf der Dienststelle, inklusive der Frauen. Sie wetteten auf alles, fünf, zehn, fünfzig, hundert Euro. Idiotisches Eifern: Um die Anzahl der an einem Tag erwischten illegal in der Stadt lebenden Ausländer; oder um Falschparker oder die Straßenverkehrsordnung missachtende Radler und E-Scooter-Raser; um die am schnellsten aufflatternde Krähe eines Schwarms in einem Baum; um Hundekothaufen in einem Grünstreifen; um die Menge der Hustenanfälle der kettenrauchenden Kollegin Miriam; um die Zahl der Tore eines Fußballspielers im Lauf eines Monats; um den Promillegehalt des nächsten angehaltenen Verkehrsteilnehmers; oder darum, ob eine Kollegin diesmal friedlich das Wochenende mit ihrem Mann überstand oder ein Kollege sich doch zu etwas breitschlagen ließ, was er zuvor rigoros abgelehnt hatte.
Wie viel hast du verloren?, dachte ich und wartete auf die Wiederholung seiner Frage von vorhin.
»Gar nichts?«, setzte er an. »Die Ärzte haben doch operiert, oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Der Chef sagt, du wärst sofort unters Messer gekommen, noch am selben Nachmittag.«
Unser Fünf-Sterne-General, Polizeihauptmeister Wilke, hatte mich einen Tag nach dem Vorfall in der Klinik besucht. Ich war unfähig zu sprechen; nicht, weil ich keine Stimme mehr gehabt hätte; vermutlich stand ich einfach noch unter Schock. Wilke versicherte mir, wir würden den Täter finden und vor Gericht stellen; ich solle mir keine Sorgen um meinen Job machen, alles ließe sich intern regeln; er habe bereits mit dem Präsidium telefoniert. Mich erreichten seine gut gemeinten Worte in einem von Sedativa und Selbstmitleid erzeugten Tunnel. Erst spät in der Nacht liefen mir Tränen über die Wangen, und ich begriff das Wunder nicht: Können tote Augen tatsächlich weinen?
»Zwei Splitter haben die Hornhaut durchbohrt.« Sogar für meine Ohren hörte es sich an, als spräche ich von jemand anderem, einem beliebigen Verkehrsopfer. »Die Iris wurde verletzt, die Linse auch, das wäre möglicherweise operabel gewesen. Aber der Augapfel wurde vom Sehnerv getrennt.«
Gillis schaute mich wieder an. Neues würde er nicht entdecken.
»Also habe ich jetzt ein Auge weniger.«
»Aber …«
»Das heißt, das Auge ist noch da, unter der Klappe, aber halt erloschen, oder wie man das nennt.«
»Aber …«
»Ich hatte Pech«, sagte ich, zurückgelehnt im Sessel, zufrieden im Bewusstsein, dass ich in maximal fünfzehn Minuten die Tür wieder hinter meinem Kollegen schließen würde. »Wer immer die Flasche geworfen hat, er landete einen Volltreffer.«
»Wir hätten dich schützen müssen.«
»Unmöglich in dem Tumult. Die Leute sind plötzlich ausgerastet.«
»Jedenfalls sitzen die beiden Typen in U-Haft. Wenn’s die Staatsanwältin hinkriegt, kommen sie wegen versuchten Mordes vor Gericht und nicht nur wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.«
Auf den Aufnahmen, die ich bisher gesehen hatte, warf einer der beiden Männer eine Bierflasche auf Höhe des Spielwarengeschäfts am Karlsplatz in die Phalanx der Einsatzkräfte.
Eindeutig.
Allerdings ungefähr zweihundert Meter von der Stelle entfernt, an der ich verletzt worden war.
Der zweite Verdächtige hatte anfangs seine Beteiligung bestritten. Dann tauchten die Bilder einer städtischen Überwachungskamera auf; darauf war zu sehen, wie er eine Null-Komma-drei-Liter-Flasche aus dem Anorak zieht und diese über die Köpfe der Demonstranten hinweg in eine Gruppe von Polizisten schleudert. In den Vernehmungen gab er an, er wäre von der U-Bahn am Lenbachplatz ins Stadtzentrum gelaufen. Eine Kamera der Verkehrsbetriebe hatte einen rennenden jungen Mann gefilmt, auf den die Beschreibung des Verdächtigen passte. Kein überzeugender Beweis.
Problem: Sollte der Kerl die Wahrheit gesagt haben, wäre es ziemlich unwahrscheinlich, dass er, aus nördlicher Richtung kommend, sich durch den Pulk der vor dem Karlsplatz dicht gedrängt stehenden Demonstranten seinen Weg gebahnt hätte, um von der anderen Seite die Polizei anzugreifen, also uns. Mich.
Absolut umständlich und unverständlich.
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen hielt ich ihn nicht für den Verbrecher, der mir das linke Auge geraubt hatte.
»Wir haben sie, und sie kriegen ihre Strafe.« Gillis nickte mehrmals, spitzte die Lippen und zog die Stirn in Falten. Ich hielt es nicht für ausgeschlossen, dass er darüber nachdachte, worüber er auf die Schnelle nachdenken könnte. Mit seinem Blick verschonte er mich diesmal.
»Noch Kaffee?«, fragte ich.
»Auf keinen Fall, war sehr gut, alles.« Ruckartig stand er auf, die Hand flach auf der Krawatte. »Dank’ dir für deine Gastfreundschaft. Es war mir wichtig, persönlich vorbeizuschauen. Der Chef sagt, du bist auf jeden Fall bis Ende des Jahres krankgeschrieben. Und dann Innendienst?«
»Mal sehen.«
Wieder, wie erschrocken, schaute er mich aus verengten Pupillen an. Ich rang mir ein Grinsen ab.
»Humor ist wichtig«, sagte er.
»Ohne Humor ist alles nichts«, zitierte ich irgendjemanden.
Ein Lächeln krümmte seinen Mund. Zum wiederholten Mal fragte ich mich nach dem tieferen Grund seines Auftritts.
»Grab dich hier nicht ein, komm uns besuchen«, sagte er an der Tür, nachdem wir zum Gruß unsere Fäuste gegeneinandergeschlagen hatten. »Damit du den speziellen Geruch unserer Amtsstube nicht vergisst.«
»Das mache ich. Riechen kann ich ja noch mit beiden Öffnungen.«
Sein Mund klappte auf; mehr passierte nicht.
»Danke für den Besuch«, sagte ich.
Mit Zeige- und Mittelfinger tippte er an den Schirm seiner Mütze, die er, kaum an der Tür, wieder aufgesetzt hatte.
Von meinem Sessel aus betrachtete ich den leeren Platz auf dem Sofa. Das Geschirr wie vorher auf dem Tisch, Kuchenbrösel auf den Tellern. Mein Stück hatte ich zur Hälfte gegessen. Was war sein Plan gewesen? Bei der Begrüßung hatte er mir hastig die Genesungswünsche der Kollegen übermittelt; anschließend begann seine Suada über aktuelle Ereignisse auf der Dienststelle, alltäglicher Kleinkram, der mich seit dreißig Jahren jeden Morgen erwartete. Wir plauderten. Er fragte mich nach meiner Verletzung, was auch sonst? Ich war jetzt behindert, untauglich für den Außendienst, halbwegs brauchbar für den Innendienst. Das hatte er gewusst, bevor er herkam.
Wahrscheinlich wollte er nur höflich sein. Vielleicht vertrat er das schlechte Gewissen der Kollegen, die sich wegen der Ereignisse Vorwürfe machten.
Kann sein, dass wir für einige Augenblicke unvorsichtig gewesen waren.
Dass wir den Stimmungsumschwung unter den Demonstranten nicht frühzeitig erkannt hatten.
Dass wir uns von den ständig sich wiederholenden Gesängen und stupiden Parolen hatten ablenken lassen. Dass wir die Rädelsführer nicht intensiv genug im Blick gehabt hatten.
Dass mir dieses Geschrei nach Freiheit und angeblich abgeschafften Bürgerrechten und die verbalen Attacken gegen Polizei und Staat an diesem Tag besonders auf die Nerven gefallen waren.
Dass mir klar wurde, wie wenig Interesse ich verspürte, eine Demokratie zu verteidigen, deren Grundwerte diesen Leuten am Arsch vorbeigingen.
Dass ich diese Leute allein deswegen verabscheute, weil sie mir mit ihrem Recht auf öffentliches Zurschaustellen von Dummheit und Egoismus den Samstag ruinierten – samt meiner Lust aufs Joggen, aufs Anschauen klassischer Fußballspiele auf DVD und aufs Köpfen diverser Freude spendender Bottles.
Kann sein, dass ich von mir selber abgelenkt war und mich hochgradig unprofessionell verhalten hatte.
Kann sein, ich trug eine Mitschuld am Geschehen und an seinen Folgen.
Geschützt von der Menge, warf jemand eine Flasche direkt in mein Gesicht. Die Flasche zersprang, Splitter drangen in mein linkes Auge, ich kippte hintüber. Blut überschwemmte mein Gesicht. Im Schock verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Seitenstraße auf dem Boden, blutete immer noch aus einem Auge, und jemand rief: »Um Gottes willen! Um Gottes willen!«
Zu diesem Zeitpunkt – so erfuhr ich in der Klinik – fehlte vom Flaschenwerfer jede Spur. Heute, einen Monat später, saß der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Mir würde Gerechtigkeit widerfahren, hatte Chef Wilke beim Abschied am Krankenbett versprochen.
Sollten die beiden Hauptverdächtigen zu Haftstrafen verurteilt werden, hätte Wilke, zumindest nach seiner Überzeugung, sein Versprechen eingelöst. Für die schnelle und erfolgreiche Ermittlungsarbeit würde ich ihm und seinem Team danken. Bliebe zu hoffen, dass in der Inspektion 22 der eine oder andere Kollege oder eine der Kolleginnen auf Freispruch gewettet hatte.
Kein Grund, zynisch zu werden.
Ich holte eine neue Flasche Plomari aus dem Eisfach. Heute war Freitag. Mir stand ein entspanntes Wochenende bevor, mit Laufen, Fernsehen, Lieferservice und eventuell dem Besuch einer Freundin aus dem Nachtgeschäft.
Ich füllte zwei Finger breit in ein geriffeltes Wasserglas, kehrte ins Wohnzimmer zurück, stellte die Flasche auf den niedrigen Mahagonitisch; ich lehnte mich im Sessel zurück, legte die Beine auf den Tisch und schmatzte wohlig beim ersten Schluck.
Mit einem Auge weniger halbierte sich nicht gleich die ganze Welt, dachte ich launig.
2
Das Blöken der Spaziergänger
Inge Gerling, meine Nachbarin vom selben Stockwerk, pfriemelte den verbogenen Schlüssel ins Schloss ihrer Wohnungstür und hörte bei meinem Anblick sofort damit auf. »Das ist … Das sieht … Dann ist das also wahr, in der Zeitung stand, ein Polizist wär bei der Demo im letzten Monat schwer verletzt worden, und zwar am Aug’ … Am Auge … Sie?«
»Ja, Frau Gerling.«
»Mein herzliches … Das tut mir so leid, Herr … Herr Oleander, wie … wie geht’s Ihnen? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein.«
Ich war auf dem Weg zur Dienststelle, wollte die Samstagsruhe nutzen und mir noch einmal die gespeicherten Aufnahmen der Überwachungskameras ansehen; weniger aus eigenem Antrieb, eher auf Drängen von Lilo, die mir gestern Nacht damit in den Ohren gelegen hatte, ich müsste mehr Druck aufbauen, um die Wahrheit zu erfahren. Für meine Kollegen wie für meine Vorgesetzten sei der Fall doch erledigt, meinte sie, die Täter seien gefasst und kämen vor Gericht, basta. Eines ihrer Lieblingswörter. Du ziehst dich jetzt aus, basta! Sei still und leg dich hin, basta.
Lilo. Sie nannte sich Lucy. In Krisenzeiten spezialisierte sie sich auf Hausbesuche bei Bekannten und Vertrauten; alles erlaubt, wie sonst auch.
Die Fotos werden gelöscht, erklärte sie, und wenn’s je Beweise gab, sind die weg für immer, also krieg deinen Arsch hoch und tu was, basta.
Wahrscheinlich hatte sie Recht. Und Druck aufbauen war nie verkehrt, das wusste ich von meinem Arbeitsleben auf der Straße.
»Was wird aus Ihrem Beruf, Herr Oleander? Müssen Sie umschulen?«
»Auf was, Frau Gerling?«
»Weiß nicht … Sie können doch nicht mehr … Dürfen Sie … Ich bin ganz verwirrt. Ich hab noch nie, entschuldigen Sie, einen … einen einäugigen Polizisten hab ich noch nie gesehen …«
Ihre Brille mit dem goldfarbenen Rahmen war verrutscht und hing schief. Inge Gerling blinzelte mit beiden Augen und streckte ein wenig den Kopf vor, was mir ihren nikotinhaltigen Atem näher brachte.
»Zurzeit bin ich krankgeschrieben«, sagte ich.
Sie nickte vor sich hin, leicht gebeugt in ihrem blassroten, fusseligen Mantel, zu dem sie kniehohe Lederstiefel mit dem Staub vieler Straßen trug. Ihr Gesicht wie immer blass, die Wangen gedunsen, bräunliche Augenringe, kornblumenblaue Pupillen inmitten winziger roter Äderchen. Ihren mit Lebensmitteln gefüllten Jutebeutel, aus dem zwei Lauchstangen und eine Gurke herausragten, hatte sie an die Wand neben der Tür gelehnt; der Schlüssel steckte unverändert halb im Schloss. Anders als mein Kollege Gillis vermied sie es, mich anzustarren; ihr Blick huschte durch den engen Flur im Treppenhaus und schien zwischendurch geheime Punkte auf meiner Lederjacke zu erforschen.
Drei oder vier Mal in den vergangenen Jahren hatten wir im libanesischen Lokal im Erdgeschoss ein paar Gläser gekippt. Ich hatte sie zum Essen eingeladen, sie beließ es bei Vorspeisen und Arak, den wir beide schätzten und ausführlich konsumierten. Schon beim ersten Treffen hatten wir uns geduzt; als ich mich nach anisvollen Küssen an ihrer Wohnungstür verabschiedete, um die neun Schritte zu meiner Tür hinter mich zu bringen, endete unsere frisch begossene Nähe abrupt. Zurückgekehrt zum Sie, gingen wir dennoch weitere Male in die Kneipe und ließen das Küssen einfach sein.
Mit Ende vierzig war sie auf der Suche nach einer festen Partnerschaft und ich nach meiner Scheidung mit meinem Alleinsein im Einklang. Außerdem konnte ich jederzeit Lilo anrufen, basta.
»Es tut mir wahnsinnig leid«, wiederholte meine Nachbarin. »Kann ich was für dich tun?«
Auch ich fand, dass wir uns unter den gegebenen Umständen wieder duzen sollten. »Danke«, sagte ich. »Lass uns mal wieder was essen gehen, wenn du Zeit hast.«
»Ich hab viel Zeit.«
»Bist du nicht mehr im Hotel?«
»Nur noch vier Mal in der Woche. Das Geschäft läuft grad sehr schlecht, weniger Touristen, kaum Tagesgäste, Tagungen finden nur noch selten statt. Große Krise. Die Familie Schubert ist sehr freundlich zu mir, sie bezahlen mich weiter, auch wenn ich nur noch von Montag bis Donnerstag die Rezeption mach.«
»Ich melde mich bei dir.«
Sie wandte sich zur Tür, hielt inne und sah mich noch einmal an. »Sag mir doch, wie’s dir geht. Brauchst du Hilfe, Kay?«
»Mir geht’s gut, ich habe keine Schmerzen, wie gesagt.«
»Bist du in psychologischer Betreuung?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Warum?«
»Du bist jetzt ein anderer Mensch, dein Leben ist auf den Kopf gestellt.«
Ich gab mir einen Ruck, ging zu ihr, legte die Arme um sie und hielt sie fest. Dem Mantel entströmte der Geruch überfütterter Schränke. Sie schniefte. Ich ließ sie los, bevor es schwierig wurde.
»Sorg dich nicht«, sagte ich.
Sie rückte ihre Brille zurecht, hielt den Kopf gesenkt.
»Falls ich nicht zu spät heimkomme, klingele ich bei dir, und wir gehen runter.«
»Heut am Samstag kriegen wir eh keinen Platz.«
»Wir doch immer«, sagte ich.
»Stimmt, du bist ja Polizist.«
Wir verabschiedeten uns wortlos. Auf dem Weg nach unten hörte ich das Klacken des Schlüssels. Beinah hätte ich beim Verlassen des Hauses Inges finalen Fluch verpasst, mit dem sie jedes Mal die endlich geöffnete Tür aufstieß und gegen die Wand knallen ließ.
Die Inspektion lag fünf Gehminuten vom Mittleren Ring entfernt, in einer langen, schmalen Straße, die zwei Ausfallstraßen miteinander verband, unweit eines Krankenhauses und eines Seniorenheims. Ein dreistöckiges Gebäude aus den Sechzigern, mit abblätternder Fassade, deren Grüntöne ins Graue tendierten; den Balkon im ersten Stock zierten Geranien in Rosa und Violett, hin und wieder auch in Weiß oder in zweifarbiger Ausführung – je nachdem, für welche Variation Britta Irgang sich entschied.
Schon als ich auf dieser Dienststelle angefangen hatte, fungierte die alte Dame als eine Art Haushälterin, die sich ums Putzen der Räume – manchmal mit Unterstützung einer Freundin –, die Pflege des kleinen Gartens und die Bepflanzung der Balkonkästen kümmerte, und zwar widerspruchslos. Den Geranien – sie nannte sie ausschließlich Pelargonien – widmete sie den Großteil ihrer Zeit. Das wunderte uns, da sie uns mehrfach erklärt hatte, wie robust und im Grunde »selbstständig« die Blumen den Wetterkapriolen trotzten und sich auf eine Weise, die wir nicht verstehen mussten, sogar selbst reinigten.
Hingebungsvoll kümmerte sie sich um die Stecklinge; ständig zupfte sie an den Blüten und murmelte verschwörerisch klingende Worte vor sich hin. Im Garten hatte sie ein schmales Beet für Schnittlauch und Dill angelegt. Die etwa hundert Quadratmeter Grünfläche bearbeitete sie nach wie vor eigenhändig, mit einem scheppernden Elektromäher, vielleicht einem der Prototypen seiner Generation. Unseren Vorschlag, einen Mähroboter anzuschaffen, hatte sie mit der Bemerkung quittiert, wir sollten das Geld besser in eine neue Toilette investieren; seither war das Thema Neugestaltung der Rasenpflege für sie erledigt. Unsere sanitären Anlagen profitierten nicht davon.
Niemand wusste, wie alt Britta Irgang war, nicht einmal Chef Wilke. Ich schätzte sie auf Ende siebzig, eventuell Anfang achtzig; keine sechzig Kilo; sie trug Wollröcke in den Farben ihrer Pelargonien. In den Arbeitspausen aß sie mitgebrachte Vollkornbrote mit Wurst oder Käse – sie nannte sie Schnitten –, garniert mit Gurken, Tomaten oder gelben Paprikastreifen, gekrönt von Schnittlauch aus unserem Garten; oder sie brachte Müsli mit Früchten oder Haferflocken in Tupperware mit. An manchen Tagen beschloss sie ihre Vesper mit einem Stamperl goldfarbenen Sliwowitz, den sie in einer runden Flasche in ihrer ledernen Umhängetasche bunkerte.
Das Einzige, was wir sicher von ihr wussten, war: Ihrem Mann hatte einmal das Haus gehört, in dem wir untergebracht waren, dem Zwillingsbruder eines ehemaligen Kripobeamten. Vor mehr als vierzig Jahren hatten beide außerdienstlich ein Volksfest besucht, auf dem eine Nagelbombe explodierte. Sechzehn Schwerverletzte, vier Tote, unter ihnen der Attentäter. Der Verdacht, der Anschlag habe dem in der neonazistischen Szene ermittelnden Schwager von Britta Irgang gegolten, wurde nie erhärtet und nie ausgeräumt. Die Suche nach den Hintermännern oder Auftraggebern des angeblichen Einzeltäters versandete.
Über das Thema verlor Frau Irgang kein Wort – wie sie es generell nicht schätzte, in längere Gespräche verstrickt zu werden, womöglich über aktuelle, politische Themen. Mir hatte sie einmal ein Glas Schnaps angeboten, ich hatte abgelehnt, und sie fragte nie wieder.
Dabei hatte es Tage gegeben, an denen hätte ich sofort zugegriffen.
»Freut mich, Sie zu sehen«, rief Britta Irgang vom Balkon, halb versteckt hinter ihren strahlenden Blumenfreunden.
Ich war mit der U-Bahn gefahren und hatte den Weg von der Haltestelle bis zum Haus in der Lorberstraße zu Fuß zurückgelegt; die Sonne milchig, die Luft ein kühles, angenehmes Bad.
»Fangen Sie wieder an?«, fragte Frau Irgang an der Ecke des Balkons, wo keine Kästen hingen.
»Nur ein paar Unterlagen kontrollieren.«
»Hauptsache, Sie sind wieder da.« Sie hob die Hand; ich sah, dass sie gelbe Gummihandschuhe trug.
Ihr Satz löste in mir eine eigenartige Reaktion aus, beinah hätte ich mich bedankt.
Wo, wenn nicht hier, sollte ich sein?
Ich winkte ihr zu und tippte die Codenummer in den Metallkasten neben der Eingangstür. Im Flur, vor der Scheibe aus Sicherheitsglas, wurde mir bewusst, dass ich seit mehr als einem Monat die Ziffern nicht mehr eingegeben hatte; alles wirkte routiniert und einfach, als wäre in der Zwischenzeit nicht das Geringste geschehen.
In dieser einen Minute erschien mir sogar meine halbseitige Blindheit wie eine Selbstverständlichkeit.
Und ich sagte zum Kollegen Kolbek am Empfang:
»Da bin ich wieder.«
Er starrte mich an wie ein Lehrling des Kollegen Gillis.
»Ich bin’s«, sagte ich. »Hauptkommissar Störtebeker meldet sich zum Dienst.«
Kopfschüttelnd wuchtete Kolbek seine hundert Kilo aus dem Drehstuhl. Auf den Erfolg seiner Diäten schlossen manche Kollegen aberwitzige Wetten ab; diese betrafen nicht die Zahl der Kilos, die sich Kolbek runterhungern wollte, sondern die, die er nicht schaffen würde. Jedes Mal startete er seine Fastenzeit mit vollmundigen Versprechungen; auf diese Weise brachte er sich derart in Zugzwang, dass er nach spätestens vier Tagen selbst nicht mehr an einen Erfolg glaubte.
Lang her, da hatte auch ich mich einmal an dem Spiel beteiligt und verloren; ich hatte Kolbek mehr Willen zugetraut.
»Du hast abgenommen«, sagte er, als er mir, anstatt nur den Öffner zu drücken, die Tür zum Dienstraum aufhielt. »Hab nicht mit dir gerechnet. Der Chef sagte, du willst deine Ruhe haben.« Während er die Tür schloss, legte er mir eine Hand auf die Schulter und zog sie mit einer hastigen Bewegung wieder zurück; als habe ihn die vertrauliche Geste überfordert oder als fürchte er, eine unter der Kleidung verborgene Wunde zu reizen: Womöglich waren durch die Attacke auch noch andere Körperteile außer meinem Gesicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Neben Wetten zählten Gerüchte zu den Haupthobbys meiner Kollegen.
»Du bist allein hier«, sagte ich.
»Notbesetzung.« Er trat einen Schritt beiseite, nickte zu den Büros, deren Türen offen standen. »Zwei krank, einer seit gestern in Mutterschaft oder Vaterschaft, Niko, weißt schon. Marion und Arno auf Streife, Eva und Adnan auch, das war’s. Und du?«
Wieder machte er eine Handbewegung in meine Richtung, die in der Luft abbrach. Im Raum hing ein Geruch nach Rasierwasser, altem Papier, ungelüfteten Klamotten und – falls meine Nase sich nicht täuschte – fauligem Wasser.
»Was macht Frau Irgang an einem Samstag bei uns?«
»Schimpfen.« Zurückgeplumpst auf den Stuhl vor der Telefonanlage, umklammerte Kolbek die Lehnen mit beiden Händen. »Sie war zwei Wochen weg, Todesfall im Bekanntenkreis. Sie hat uns Blumen hinterlassen, Schnittblumen, Riesenstrauß, ein Geschenk. Wir haben die Vase ans Fenster gestellt, sah schön aus, edel fast in unserer ranzigen Hütte. Schau, die Vase steht noch da, die Blumen hat sie heut Morgen wutschnaubend weggeschmissen. Sie hat behauptet, wir hätten die Blumen verrotten lassen, hätten das Wasser nie gewechselt. Was nicht stimmt, ich weiß genau, dass wir mindestens einmal frisches Wasser reingeschüttet haben, Marion hat das gemacht. Jedenfalls hat die Irgang uns heut früh um acht zur Sau gemacht, ein Auftritt wie schon lang nicht mehr. Wir haben uns entschuldigt, aber du kennst sie, mit ihr ist nicht zu diskutieren. Hat sie dich gesehen?«
»Sie hat mich begrüßt und war freundlich.«
»Vielleicht hat sie sich inzwischen wieder eingekriegt.«
»Welche Sorte Blumen waren das?«
»Gerbera, Rosen, Hortensien, was halt so wächst, ein bunter Strauß.«
»Und die haben nicht angefangen zu riechen?«
»Haben gut gerochen, man gewöhnt sich dran, irgendwann riechst du das nicht mehr. Frau Irgang meint, wir hätten sie verfaulen lassen, mutwillig. Haben wir sonst nichts zu tun, oder was? Sind wir Floristiker von Beruf?«
»Ich rede mit ihr.«
»Vertane Zeit. Soll ich frischen Kaffee machen? Ist nichts los grad.«
»Ich bleibe nicht lang«, sagte ich, schon auf dem Weg in mein Büro, das ich mit Niko Burg teilte, einem siebenundzwanzigjährigen Polizeimeister, der, wie ich gerade erfahren hatte, in den nächsten Monaten den Schichtdienst in der PI gegen Nachtdienst an der Wiege eintauschte.
»Kann ich dir was helfen?«, rief Kolbek mir hinterher.
»Brauche nur den Computer.«
»Wegen der Demo?«
Ich schloss die Tür hinter mir.
Neben den Aufnahmen von der Bereitschaftspolizei lieferten die Dateien Bilder und Tonmitschnitte des Unterstützungskommandos; dessen Teams begleiteten regelmäßig Demonstrationen. Auf meinem Laptop zu Hause hatte ich einige kurze Filme der Bepo gesehen, die keine Klärung brachten.
Das kurzfristige Chaos unter den Demonstranten – sie nannten sich im Auftrag der Veranstalter »Spaziergänger« – hatte auch unsere Reihen durcheinandergewirbelt. Wir verließen die angestammten Plätze auf dem Bürgersteig und brauchten eine Weile, um eine Eskalation zu verhindern. Deswegen lieferten die Kollegen mit den Helm- und Handkameras minutenlang nur verwackelte Bilder. Zu sehen: Eine Menge Leute brüllten herum und schubsten sich gegenseitig. Vom Wurf der Flasche, die mich getroffen hatte, keine Nanosekunde.
Wie ich am Bildschirm feststellte, lieferten auch die USK-Kollegen keine brauchbaren Hinweise. Immer wieder rückten die beiden Vorsitzenden der »Neuen Volkspartei Deutschland« ins Visier. Sie schritten, scheinbar entspannt und mitunter lachend, vor Leuten einher, die Deutschlandfahnen schwenkten und Schilder umgehängt hatten, mit Parolen wie »Freiheit dem Volk« oder »Meinungsdiktatur, nein danke«. Aus verschiedenen Richtungen flogen Tomaten, Eier, zusammengeknüllte Zeitungen gegen die Schutzschilde der Polizisten, auch zwei oder drei Bierflaschen, die auf dem Boden zerschellten.
Nirgendwo ich.
Offenkundig waren die Kollegen um mich herum für wenige Augenblicke abgelenkt und unkonzentriert. Ein unsichtbarer Demonstrant nutzte die Gelegenheit.
Lächerlich.
Mein rechtes Auge begann zu flimmern. Erschrocken presste ich mir die Hände vors Gesicht. Mein Herz schlug heftig und unregelmäßig. Ich schwitzte. Das T-Shirt unterm Hemd klebte mir auf der Haut, das Hemd am T-Shirt, die Lederjacke schnürte mich ein. Mit hastigen Bewegungen streifte ich sie ab, warf sie in die Ecke. Ich sprang vom Stuhl, schüttelte die Arme aus, schnaufte mit offenem Mund.
Für mein Verhalten, meine Reaktion fehlte mir jede Erklärung. Was war passiert? Was hatte ich gesehen oder gehört, das mich dermaßen aufwühlte und aus der Fassung brachte?
Was?
Nichts.
Nichts Neues. Die Abläufe waren mir vertraut, die meisten Aufnahmen hatte ich schon in meiner Wohnung mehrfach vor- und zurückgespult.
Totales Durcheinander. Das Blöken und Geifern der so genannten Spaziergänger. Das abrupte Innehalten einer Gruppe im Gewühl. Folge: Ringsum entstanden neue Menschentrauben. Sie rempelten einander an, einige in Panik wegen der entstandenen Enge; kein Entkommen, weder zum Gehsteig hin – dort patrouillierten wir Polizisten – noch auf die gegenüberliegende Seite zu den von einem Einsatzkommando bewachten Schienen. In der Mitte der Sonnenstraße fuhren weiterhin Straßenbahnen.
Drei Mal hatte Wilke mir – »mit absolutem Bedauern«, wie er sich ausdrückte – am Telefon erklärt, er habe noch einmal das verfügbare Material gesichtet: kein einziger brauchbarer Hinweis auf den Täter. Es sei »wie verhext, als hätten wir alle in der einen Sekunde die Augen zugemacht«.
All das wusste ich bereits.
Nach knapp zwei Minuten war das Chaos vorbei. Wie geplant setzte der Zug seinen Weg fort und endete am Karlsplatz vor der aufgebauten Tribüne. Dort warteten bereits die beiden NVD-Funktionäre, eskortiert von aufgepumpten Kerlen in schwarzen Windjacken und Stiefeln. Einer von ihnen – das entnahm ich dem im INPOL-System beigefügten Bericht – gehörte der »Schwarzen Front« an, einer inzwischen verbotenen, rechtsradikalen Gruppierung im Umfeld der NVD. Dass solche Gruppen einfach aufhörten zu existieren, bloß weil der Verfassungsschutz ein Auge auf sie warf, bezweifelte ich seit jeher.
Was war los mit mir?
Was hatte mich so erschreckt?
Jemand klopfte an die Milchglasscheibe der Tür. Ich stieß einen Schrei aus.
Stille.
Noch mal behutsames Klopfen. Eine Stimme, gedämpft, zaghaft.
»Kay? Hallo? Alles paletti?«
Im Handspiegel, den wir neben dem Schrank an die Wand genagelt hatten, tauchte mein Gesicht auf – eine vernarbte, bleiche Fratze mit knochigen, stoppeligen Wangen und einer schwarzen Klappe über dem Auge; der Mund verzerrt, Panik im Blick.
»Hallo? Darf ich reinkommen?«
Allmählich wurde mir bewusst, wie ich dastand und mein Spiegelbild fixierte. Ähnlich entgeistert hatten meine Kollegen Gillis und Kolbek mich betrachtet. Jetzt begriff ich den Grund ihrer Irritation.
Meine Fratze.
»Bin gleich fertig, Jockel«, sagte ich zur Tür.
»Ich mach erst mal Kaffee.«
»Nicht wegen mir.«
»Frau Irgang hat’s mir angeschafft.«
Unwillkürlich warf ich einen Blick zum Fenster, das auf den Garten hinaus ging; die alte Dame stand nicht davor. Tief durchatmend machte ich ein paar Schritte und öffnete die Tür zum Empfangsraum. Kolbek hantierte am Filter der Kaffeemaschine.
»Du brauchst Ruhe.« Er schraubte die Kaffeedose auf. Die Sorte hatte uns Frau Irgang empfohlen, nachdem wir jahrelang eine ihrer Überzeugung nach Magengeschwüre auslösende Plörre in uns reingekippt hatten. »Hast du gefunden, was du gesucht hast?« Den Löffel in der Hand, hielt Kolbek inne; er schätzte die Menge ab und gab noch ein Häufchen dazu.
»Da ist nichts zu finden.«
»Hast du die Datei mit den Interviews gelesen?«
»Welche Interviews?«
»Die Kollegen haben Zeugen befragt, kurz nach dem Angriff auf dich. Für den Chef sinnloses Gerede: lauter Leute, die von der Masse aufgewiegelt waren, Polizeistaat und so weiter; die haben die Kollegen teilweise übel beschimpft. Eine alte Frau meinte, die gesamte Regierung gehört eingesperrt, und die Polizei gleich mit; wir sind alle Handlanger der Mächtigen, die uns klein halten und mundtot machen wollen. Wusstest du das?«
»Eine alte Frau? Wie alt?«
»Alt halt.«
Ich ging zurück zum Computer und öffnete die entsprechende Datei.
Die Frau war ein Jahr jünger als unser Chef, einundsechzig. Sie hieß Silvia Glaser und wohnte in der Falkenstraße in der Au. Ihre Personalien hatten die Kollegen im Protokoll vermerkt. Sie und ihr Begleiter wurden angehalten, weil die Frau den Arm mit einer Null-Komma-drei-Liter-Flasche Bier schwenkte und anscheinend im Begriff war, diese in die Reihen der Polizei zu schleudern. Niemals, erklärte sie gegenüber meinen Kollegen, hätte sie so etwas getan; sie sei lediglich ein wenig angetrunken und von der Menge eingeschüchtert. Ihr Begleiter, ein gewisser Holger Kranich, ebenfalls einundsechzig, bestätigte die Aussage.
Aufgegriffen wurden die beiden in der Herzogspitalstraße, keine fünfzig Meter von der Stelle entfernt, wo ich blutend und halb bewusstlos auf dem Asphalt lag. Angeblich wollten sie in einem italienischen Restaurant in der Nähe zu Mittag essen. Die Frau schimpfte vor sich hin; der Mann versuchte, sie zu beruhigen; die Kollegen mussten sie gehen lassen. Auch im Nachhinein fanden sich keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung. Zwar tauchte der Mann auf einer der verwackelten Aufnahmen auf, die kurz vor dem Flaschenwurf entstanden waren, offensichtlich jedoch war die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Nähe.
Auf dem Foto aus der Helmkamera meines Kollegen stützte sich die Frau auf einen bernsteinfarbenen Gehstock und blickte mit gleichgültiger Miene direkt in die Kamera – als wäre es ihr recht, fotografiert zu werden; als habe sie extra für die Aufnahme ihre Zornesrede gegen die Staatsmacht unterbrochen.
Das Bild ging mir nicht aus dem Kopf.
Aus dem Empfangsraum drang starker Kaffeeduft in mein Büro. Ich klappte den Block mit meinen Notizen zu, schaltete den Computer aus und zuckte schon wieder zusammen. Ein Klopfen am Fenster, mehrmals hintereinander.
So schreckhaft war ich seit meiner Jugend nicht mehr gewesen.
Mit Daumen und Zeigefinger deutete Britta Irgang das Kippen einer Tasse vor ihrem Mund an und zeigte dann auf mich. Ich nickte. Ihre Hand steckte immer noch in einem gelben Gummihandschuh.
3
Der Elch vorm Fenster
Ich saß auf einem Fensterplatz in der U-Bahn und glotzte ins vorbeirasende Tunneldunkel. In Gedanken an die von der alten Dame provozierte, angespannte Stimmung in der Dienststelle – sie zahlte Polizeihauptmeister Kolbek das Massaker an den Schnittblumen mit grimmigem Schweigen heim – und an die Aussagen der angetrunkenen Frau mit dem Gehstock verspürte ich plötzlich den Impuls, auf die Uhr zu schauen; hastig schob ich den Ärmel der Lederjacke zurück. Die Frau mir gegenüber zuckte – so wie ich im Büro – vor Schreck mit dem Kopf; das nervige Klacken ihrer Fingernägel auf dem Handydisplay endete schlagartig.
Zwölf Uhr dreißig.
Wieder Samstag. Wieder zwölf Uhr dreißig. Verblüfft sah ich ein zweites Mal auf die Uhr. Exakt halb eins. Dasselbe hatte ich vor fast genau einem Monat getan, am Samstag, vierter September. Dass ich mich daran erinnerte, wunderte mich. Natürlich hatte ich das Datum nicht vergessen – die Koinzidenz der Handbewegung beschäftigte mich.
Um zwölf Uhr dreiunddreißig hatte mein Leben seine Richtung geändert.
Der Satz klang in mir nach, hörte sich an wie das Echo einer Stimme, die nicht meine war.
Wer hatte behauptet, mein Leben hätte seine Richtung geändert? Wilke? An seine Worte im Krankenhaus erinnerte ich mich nur rudimentär, er hatte Versprechungen gemacht, mir viel Glück gewünscht, was sonst? Er hatte Anteilnahme gezeigt und sich für etwas entschuldigt, das ich vergessen hatte.
Änderte mein Leben seine Richtung …
Eine solche Formulierung passte nicht zu Wilke. Oder doch? Wir kannten uns lange, doch so gut auch wieder nicht. Wir kannten uns alle lange, was bedeutete das schon? Was wussten sie alle von mir? Darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Das Übliche, Heirat, Ehe, Scheidung, Hobbys: Fußball und … Fußball.
Die Daumen der Frau mir gegenüber stöckelten in einem Affentempo über den Touchscreen; die von mir ausgelöste Unterbrechung hatte ihr anscheinend eine Menge Zeit gestohlen.
Unvermutet tauchte in meinem Erinnerungsnebel ein Ausspruch meiner Exfrau auf. Nach einem Wochenende auf einer Elektronikmesse, die sie als Fachjournalistin für Computertechnik besuchte, hatte sie erklärt, sie müsse ab sofort eine Woche »Handyfasten« einlegen – sie habe ein Sirren in den Ohren und schlafe schlecht.
An der selbstauferlegten Diät scheiterte sie schneller als mein Kollege Kolbek an seiner.
Welche neue Richtung nahm mein Leben gerade? Abgesehen davon, dass ich ausnahmsweise das ganze Wochenende frei hatte? Sogar den ganzen Monat und den folgenden und den darauffolgenden? In welcher Weise betrafen dienstliche Änderungen meine Person? Mich als Mann, als Mensch. In keiner, sagte ich mir. Allenfalls als Beamter.
Die Frau musterte mich. Hatte ich womöglich laut gesprochen? Ihr Blick wirkte verklärt oder leer, schwer zu sagen in der einen Sekunde, in der ich sie betrachtete. Mich betraf ihre Reaktion nicht im Geringsten; ihre Daumen nahmen erneut Fahrt auf. Ich widmete mich der vertrauten Monotonie vor dem Fenster. An der nächsten Station, Giselastraße, musste ich aussteigen.
Mit meinem Leben war alles in Ordnung.
Die Anderen fingen ständig damit an. Auch die alte Irgang bedachte mich, kaum dass sie an ihrem Kaffee genippt hatte, mit einem besorgten Blick, den sie beibehielt, während sie zwei Schlucke trank und dann die Tasse auf den Unterteller stellte und diesen mit beiden Händen festhielt.
Außer ihr benutzte niemand in der PI