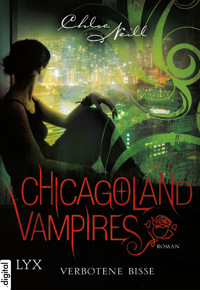9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chicagoland-Vampires-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Studentin Merit wird nachts auf dem Campus von einem Vampir angefallen und schwer verletzt. Kurz darauf taucht ein zweiter Vampir auf, der ihr das Leben rettet, indem er sie selbst in eine Unsterbliche verwandelt. Merit ist zunächst wenig begeistert über ihr neues Dasein als Blutsaugerin. Doch als sie ihren Retter zur Rede stellen will, erfährt sie, dass es sich bei ihm um den mächtigen Ethan Sullivan von Haus Cadogan handelt. Die Vampire erwarten von ihr, dass sie sich als Dank für die Rettung Sullivan unterwirft und in den Dienst seines Hauses tritt. Darauf hat Merit allerdings nicht die geringste Lust. Auch wenn der gut aussehende Ethan ihr Interesse weckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
VORSPANN
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
EPILOG
DANKSAGUNG
IMPRESSUM
Chloe Neill
Frisch gebissen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Marcel Bülles
»Es ist besser, für das, was man ist, gehasst, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden.«
KAPITEL EINS
Die Wandlung
Anfang April
Chicago, Illinois
Zuerst fragte ich mich, ob es mein Karma war, bestraft zu werden. Ich hatte diese schicken Vampire immer belächelt, und der Kosmos hatte sich als Strafe ausgedacht, mich zu einer von ihnen zu machen. Vampirin. Raubtier. Initiantin eines der ältesten der zwölf Vampirhäuser der Vereinigten Staaten.
Und ich war nicht nur einfach eine von ihnen.
Ich war eine der Besten.
Aber ich überspringe da einiges. Lasst mich zuerst erzählen, wie ich zu einer Vampirin wurde. Meine Geschichte beginnt einige Wochen vor meinem achtundzwanzigsten Geburtstag, und zwar in der Nacht, als ich die Wandlung vollzogen hatte. In dieser Nacht erwachte ich auf dem Rücksitz einer Limousine, drei Tage nachdem ich auf dem Gelände der University of Chicago angegriffen worden war.
An die Details des Angriffs erinnerte ich mich nur schwach. Aber meine Erinnerungen reichten aus, um mich wahnsinnig zu freuen, dass ich noch lebte. Um schockiert zu sein, dass ich noch lebte.
WährendichaufdemRücksitzderLimousinelag,hieltichverzweifeltmeineAugengeschlossenundbewegtemichnicht.Ichversuchte,michandenAngriffzuerinnern.IchhatteSchrittegehört,diedertaunasseRasengedämpfthatte,bevormeinAngreifermichpackte.Ichhattegeschrienundummichgetreten,ummichzubefreien,abererwarfmicheinfachzuBoden.
Er war unmenschlich stark – übernatürlich stark –, und er biss mir mit einer rücksichtslosen Gier in den Hals, die mir keinen Zweifel daran ließ, wer er war. Was er war.
Ein Vampir.
Aber obwohl er tief in mein Fleisch und meine Muskeln eindrang, so trank er doch nicht. Er hatte keine Zeit dafür. Ohne Vorwarnung hatte er aufgehört und war von mir heruntergesprungen, um zwischen den Gebäuden am Rande des Innenhofs zu verschwinden.
Da mein Angreifer von mir abgelassen zu haben schien, hob ich meine Hand an den Übergang zwischen Hals und Schulter und spürte eine klebrige Wärme. Die Welt um mich herum wurde dunkel, aber den weinroten Fleck auf meinen Fingern konnte ich noch deutlich erkennen.
Dann bemerkte ich, wie sich neben mir etwas bewegte. Zwei Männer.
Die Männer, vor denen mein Angreifer geflohen war.
Der eine klang nervös. »Er war schnell. Ihr müsst Euch beeilen, Lehnsherr.«
Der andere klang sicher und selbstbewusst »Ich erledige das.«
Er zog mich hoch, bis ich auf den Knien war, und kniete sich hinter mich. Der frische und saubere Duft von Eau de Cologne umgab mich, und sein starker Arm fasste mich sicher um die Hüfte.
Ich versuchte, mich zu bewegen, mich in irgendeiner Form zu wehren, doch ich wurde mit jedem Augenblick schwächer.
»Halt still.«
»Sie ist bezaubernd.«
»Das ist sie«, gab er zu. Er saugte an meiner Halswunde. Ich zuckte zusammen, und er strich mir sanft übers Haar. »Halt still.«
An die folgenden drei Tage konnte ich mich kaum erinnern, schon gar nicht an die genetische Umgestaltung, die mich zu einem Vampir machte. Selbst heute sind meine Erinnerungen äußerst lückenhaft. Dumpfe, tief in mein Ich reichende Schmerzen – Krämpfe, die meinen Körper krümmten. Lähmende Kälte. Dunkelheit. Grüne Augen, die mein Wesen durchdrangen.
In der Limousine tastete ich nach den Narben, die meinen Hals und meine Schulter eigentlich verunzieren sollten. Der Vampir, der mich angegriffen hatte, hatte nicht sauber zugebissen – wie ein hungriges Tier hatte er einfach meine Haut aufgerissen. Doch meine Haut war makellos. Keine Narben. Keine Beulen. Keine Verbände. Ich zog meine Hand zurück und starrte auf die reine, bleiche Haut – und die kurzen Fingernägel, auf denen ein perfektes Kirschrot glänzte.
Das Blut war verschwunden – und mich hatte man einer Maniküre unterzogen.
Ich kämpfte gegen einen Schwindelanfall an und setzte mich auf. Ich trug andere Kleidung. Ich hatte eine Jeans und ein T-Shirt angehabt. Nun trug ich ein schwarzes Cocktailkleid, das knapp unter meinen Knien aufhörte, und fast acht Zentimeter hohe Stöckelschuhe.
Ich war also das siebenundzwanzigjährige Opfer einer Gewalttat, das absurderweise keine Narben davongetragen hatte und nun ein Cocktailkleid trug, das nicht einmal mir gehörte. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass sie mich zu einer von ihnen gemacht hatten.
Die Vampire von Chicagoland.
Alles hatte vor acht Monaten mit einem Brief begonnen, der zuerst in der Sun-Times, dann in der Tribune zu lesen war und anschließend von Zeitungen im gesamten Land abgedruckt wurde. Dieses Vampir-Manifest war ihr Coming-out, die Bekanntgabe ihrer Existenz in unserer Welt. Einige Menschen hielten es für eine Zeitungsente, aber nur bis zur darauf folgenden Pressekonferenz, auf der drei von ihnen ihre Fangzähne entblößten. Unter den Menschen brach Panik aus, und vier Tage lang herrschten Unruhen in der Windy City. Die offensichtliche Angst vor einer Vampir-Apokalypse ließ die Menschen Wasser und Konservendosen horten. Schließlich griffen die Bundesbehörden ein und ordneten eine Untersuchung durch den Kongress an. Die Anhörungen wurden gefilmt und im Fernsehen übertragen; jedes noch so kleine Detail ihrer Existenz wurde unter die Lupe genommen. Und obwohl es die Vampire selbst gewesen waren, die den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hatten, hielten sie sich über diese Details bedeckt. Nur bei drei Dingen konnte die Öffentlichkeit absolut sicher sein: Sie hatten Fangzähne, sie tranken Blut, und sie durchstreiften die Stadt nur nachts.
Nach acht Monaten hatten einige Menschen immer noch Angst. Andere waren von ihnen wie besessen. Ihr Lebensstil faszinierte sie, die Unsterblichkeit, und vor allem die Vampire selbst – besonders Celina Desaulniers, die glamouröse Vampirin der Windy City, die offensichtlich für das Coming-out verantwortlich war. Bei den Anhörungen vor dem Kongress hatte sie ihr Debüt gegeben. Celina war groß, schlank und hatte schwarze Haare. An diesem Tag trug sie ein schwarzes Kostüm, das den Eindruck erweckte, als ob es nur für ihren Körper geschaffen worden war. Abgesehen von ihrer Schönheit war sie auch geschickt und klug, und sie wusste, wie sie die Menschen um den Finger wickeln konnte. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Senior Senator des Staates Idaho hatte sie gefragt, was sie als Nächstes vorhabe, jetzt, wo die Vampire sich geoutet hätten.
Ihre Antwort hatte sie berühmt gemacht, denn sie flötete einfach nur: »Ich werde aus jeder Nacht das Beste machen.«
Der Kongressveteran hatte sie mit Blicken verschlungen, was ihn auf die Titelseite der New York Times brachte.
Meine Reaktion fiel anders aus. Ich hatte lediglich die Augen verdreht und den Fernseher ausgeschaltet.
Ich hatte mich über sie lustig gemacht, über ihre Überheblichkeit.
Und im Gegenzug hatten sie mich zu einer von ihnen gemacht.
Karma war manchmal wirklich scheiße.
Jetzt schickten sie mich nach Hause, aber sie hatten mich verändert. Ungeachtet der Veränderungen, die mein Körper über sich hatte ergehen lassen müssen, hatten sie mich auch noch aufgehübscht, mir das Blut abgewaschen, mich ausgezogen und nach ihrem Vorbild neu verpackt.
Sie brachten mich um. Sie retteten mein Leben. Sie veränderten mich.
Und damit begann mein Misstrauen gegenüber denen, die mich verwandelt hatten.
Mir war immer noch schwindlig, als die Limousine vor dem Brownstone, einem Haus aus braunen Ziegeln, in Wicker Park anhielt, das ich mir mit meiner Mitbewohnerin Mallory teilte. Es war nicht Müdigkeit, die mein Schwindelgefühl verursachte, sondern eine Nebelwand, die sich durch mein Bewusstsein zog, mich lähmte und behinderte. Vielleicht waren Medikamente daran schuld, oder mein Übergang vom Menschen zum Vampir zeigte Nachwirkungen.
Mallory stand auf der Treppe, und ihre schulterlangen eisblauen Haare schimmerten im Licht der nackten Glühbirne über ihrem Kopf. Sie wirkte besorgt, schien mich aber zu erwarten. Sie trug einen Flanellpyjama mit Sockenaffenmuster. Mir wurde klar, dass es spät sein musste.
Die Limousinentür wurde geöffnet, und ich sah zum Haus und in das Gesicht eines Mannes in schwarzer Uniform und mit Mütze, der mich durch die Autotür hindurch anstarrte.
»Madame?« Er streckte mir erwartungsvoll eine Hand hin.
Ich nahm sie und trat auf den Asphalt. Auf den ungewohnten Stilettos wankte ich ein wenig, denn Stöckelschuhe zog ich nur selten an. Ich trug normalerweise Jeans, denn für eine Doktorandin reichte das völlig aus.
Dann hörte ich, wie eine Tür zugeschlagen wurde. Nur Augenblicke später packte mich eine Hand am Ellbogen. Mein Blick glitt einen bleichen, schmalen Arm entlang bis hin zu dem bebrillten Gesicht, zu dem er gehörte. Die Frau, die meinen Arm festhielt, lächelte mich an. Sie musste die Frau sein, die auf dem Vordersitz der Limousine gesessen hatte.
»Hallo, meine Liebe! Wir sind jetzt zu Hause. Ich werde Ihnen hineinhelfen, und dann kümmern wir uns darum, dass Sie sich eingewöhnen.«
Da ich mich nicht besonders gut auf den Füßen halten konnte, fügte ich mich widerspruchslos. Für einen Streit fehlten mir auch die Argumente, und daher nickte ich der Dame zu, die Ende fünfzig sein musste. Sie trug einen kurzen stahlgrauen Bob und ein ordentliches Kostüm, das gut zu ihrer schlanken Figur passte. Ihre Haltung strahlte eine gewohnte Selbstsicherheit aus. Als wir uns auf dem Gehweg näherten, kam uns Mallory vorsichtig eine Stufe entgegen, dann eine zweite.
»Merit?«
Die Frau klopfte mir auf den Rücken. »Es wird ihr bald besser gehen, meine Liebe. Ihr ist nur ein wenig schwindlig. Ich bin Helen. Sie sind sicherlich Mallory?«
Mallory nickte, ohne den Blick von mir abzuwenden.
»EinhübschesHaus,meineLiebe.Wollenwirhineingehen?«
Mallory nickte erneut und ging die Treppe wieder hinauf. Ich wollte ihr folgen, doch die Hand an meinem Arm hielt mich fest. »Sie werden Merit genannt, meine Liebe? Obwohl dies Ihr Nachname ist?«
Ich nickte zustimmend.
Sie schenkte mir ein geduldiges Lächeln. »Die Wiedergeborenen verwenden nur einen einzelnen Namen. Merit wäre also der Ihre, wenn Sie sich so nennen lassen. Lediglich den Meistern der Häuser ist es vorbehalten, ihren Nachnamen zu bewahren. Das ist nur eine der Regeln, an die Sie sich gewöhnen müssen.« Sie beugte sich mit einem verschwörerischen Zwinkern zu mir. »Und es wird als unter unserer Würde angesehen, die Regeln zu verletzen.«
Ihre freundlich gemeinte Zurechtweisung wühlte etwas in mir auf, das sich wie ein Blitz im Dunkeln seinen Weg bahnte. »Einige würden es als unter ihrer Würde ansehen, einen Menschen ohne seine Zustimmung zu verwandeln, Helen.«
Ihre Augen straften das aufgesetzte Lächeln Lügen. »Sie wurden zu einer Vampirin gemacht, um Ihr Leben zu retten, Merit. Ihre Zustimmung war ohne Bedeutung.« Sie warf Mallory einen Blick zu. »Ein Glas Wasser wäre vermutlich eine gute Idee. Ich lasse Sie einen Moment allein.«
Mallory nickte, und Helen, die eine antik wirkende Umhängetasche trug, schob sich an ihr vorbei in das Brownstone. Die letzten Stufen schaffte ich allein, blieb aber stehen, als ich Mallory erreichte. Ihr standen Tränen in den Augen, und ihr perfekt geschwungener Amorbogen konnte nicht von ihrem traurigen Blick ablenken. Sie war eine außergewöhnliche, geradezu klassische Schönheit, und daher hatte sie irgendwann angefangen, sich die Haare leuchtend blau zu färben. Sie begründete dies mit dem Wunsch, sich von den anderen zu unterscheiden. Ungewöhnlich war es auf jeden Fall, aber für eine leitende Angestellte in der Werbebranche kein schlechter Look. Diese Frau definierte sich eben über ihre Kreativität.
»Du bist …« Sie schüttelte den Kopf und fing von vorn an. »Drei Tage sind vergangen. Ich wusste nicht, wo du bist. Als du nicht nach Hause gekommen bist, habe ich deine Eltern angerufen. Dein Dad meinte bloß, er würde sich darum kümmern. Er sagte mir auch, dass ich nicht die Polizei einschalten solle. Er meinte, dass ihn jemand angerufen und gesagt hätte, du seist angegriffen worden. Es ginge dir aber gut, und du seist auf dem Weg der Heilung. Sie haben deinem Vater gesagt, dass sie dich nach Hause bringen, wenn du dazu bereit wärst. Vor ein paar Minuten haben sie mich dann angerufen. Sie sagten, du würdest jetzt nach Hause kommen.« Sie umarmte mich ungestüm. »Ich werde dich dafür zusammenschlagen, dass du nicht angerufen hast.«
Mal wich zurück und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. »Sie sagten – dass sie dich verwandelt hätten.«
Ich nickte und war den Tränen nahe.
»Du bist also jetzt eine Vampirin?«, fragte sie.
»Ich denke schon. Ich bin einfach aufgewacht oder … Ach, ich weiß nicht.«
»Fühlst du dich irgendwie anders?«
»Ich fühle mich … langsam.«
Mallory nickte zustimmend. »Vermutlich eine Nebenwirkung der Wandlung. Es heißt, dass das vorkommen kann. Das legt sich schon wieder.« Mallory musste es wissen. Im Gegensatz zu mir war sie bei allen Vampirinfos auf dem neuesten Stand. Sie brachte ein müdes Lächeln zustande. »He, du bist immer noch Merit, nicht wahr?«
Merkwürdigerweise spürte ich in der Luft, wie ein Kribbeln von meiner besten Freundin und Mitbewohnerin ausging. Ein Kribbeln wie von statischer Elektrizität hervorgerufen. Aber da ich immer noch müde und mir schwindlig war, beachtete ich es nicht weiter.
»Ich bin immer noch ich«, sagte ich.
Und hoffte, dass es der Wahrheit entsprach.
Das Brownstone hatte ihrer Großtante bis zu deren Tod vor vier Jahren gehört. Mallory, die ihre Eltern schon in jungen Jahren bei einem Autounfall verloren hatte, erbte das Haus und alles, was sich in ihm befand: von den kitschigen Teppichen auf den Hartholzfußböden über die antiken Möbel bis hin zu Blumenvasen, die Gegenstand zahlreicher Ölgemälde waren. Es war nicht gerade schick, aber es war ein Zuhause, und es roch wie ein Zuhause – nach Holzpolitur mit Zitronenduft, nach Keksen, einer angestaubten Gemütlichkeit. Es roch genauso wie vor drei Tagen, aber ich bemerkte, dass der Duft kräftiger war. Üppiger.
Vielleicht waren das meine verstärkten Vampir-Sinne?
Als wir das Wohnzimmer betraten, hatte sich Helen am Rand unserer Couch mit Gingham-Muster hingesetzt und die Beine übereinandergeschlagen. Auf dem Couchtisch vor ihr stand ein Wasserglas.
»Kommen Sie herein, meine Damen! Setzen Sie sich!« Sie lächelte und klopfte neben sich auf die Couch. Mallory und ich warfen uns einen kurzen Blick zu und setzten uns. Ich nahm neben Helen Platz. Mallory setzte sich auf das Zweiersofa gegenüber der Couch. Helen reichte mir das Wasserglas.
Ich führte es an meine Lippen, hielt aber vor dem ersten Schluck kurz inne. »Ich kann – auch andere Sachen essen und trinken außer Blut?«
Helen lachte. »Aber natürlich, meine Liebe. Sie können essen, was immer Sie möchten. Aber Sie benötigen Blut aufgrund seines Nährwerts.« Sie beugte sich zu mir und berührte mein nacktes Knie mit ihren Fingerspitzen. »Und ich könnte mir denken, dass Sie es mögen werden!« Sie sagte das, als ob sie uns ein delikates Geheimnis, etwas über ihren direkten Nachbarn mitteilte.
Ich nahm einen Schluck und stellte fest, dass Wasser immer noch nach Wasser schmeckte. Ich stellte das Glas auf dem Tisch ab.
HelenschlugmitdenHändenaufihreKnieundschenkteunsdannerneuteinfreundlichesLächeln.»Nun,wollenwirdieSachedannmalangehen?«SiegriffinihreTasche,diezuihrenFüßenlag,undholteeinledergebundenesBuchhervor,dassodickwieeinWörterbuchwar.DerburgunderroteEinbandwarmiteingeprägtengoldenenBuchstabenbeschriftet – KanonderNordamerikanischenHäuser,Kompendium.»Hierdrinstehtalles,wasSieüberIhrenBeitrittzumHausCadoganwissenmüssen.DasistnichtdervollständigeKanon,dadieReiherechtumfangreichist,aber die Grundlagen werden Ihnen damit vermittelt.«
»Haus Cadogan?«, fragte Mallory. »Ernsthaft?«
Ich blinzelte und schaute erst zu Mallory, dann zu Helen. »Was ist das, Haus Cadogan?«
Helen schaute mich über den Rand ihrer Hornbrille an. »Das ist das Haus, in das Sie aufgenommen werden. Eins der drei Häuser in Chicago – Navarre, Cadogan, Grey. Nur dem Meister eines solchen Hauses obliegt das Recht, neue Vampire zu erschaffen. Sie, Merit, wurden von Cadogans Meister verwandelt, nämlich …«
»Ethan Sullivan«, beendete Mallory den Satz.
Helen nickte anerkennend. »Korrekt.«
Ich runzelte die Stirn.
»Internet«, sagte Mallory. »Wenn du wüsstest …«
»Ethan ist der zweite Herr des Hauses. Er folgte Peter Cadogan in die Dunkelheit, sozusagen.«
Wenn nur die Meister neue Vampire erschaffen durften, dann musste Ethan Sullivan der Vampir in meiner Uni gewesen sein, derjenige, der mich als Zweiter gebissen hatte.
»Dieses Haus …«, fing ich an. »Ich bin nun in was, einer Vampir-Studentenvereinigung?«
Helen schüttelte den Kopf. »Es ist um einiges komplizierter. Alle rechtmäßigen Vampire auf dieser Welt sind mit einem der Häuser verbunden. In den Vereinigten Staaten gibt es im Moment zwölf Häuser; Cadogan ist das viertälteste.« Helen setzte sich noch gerader hin, und so nahm ich an, dass sie stolzes Mitglied des Hauses Cadogan war.
Helen reichte mir den Wälzer, der gute fünf Kilo wiegen musste. Ich legte ihn auf meine Knie, um das beachtliche Gewicht besser zu verteilen.
»Sie müssen natürlich nicht alle Regeln auswendig lernen, aber Sie sollten unbedingt die Einleitung lesen, um einen Überblick über den Inhalt zu bekommen. Und natürlich können Sie bei Fragen jederzeit ausführlicher nachlesen. Lesen Sie auf jeden Fall alles über die Aufnahmezeremonie.«
»Um was geht’s bei dieser Zeremonie?«
»Es geht um Ihre Aufnahme als offizielles Mitglied des Hauses. Sie werden Ethan und den anderen Vampiren Cadogans den Treueschwur leisten. Und wenn wir schon davon reden, etwa zwei Wochen nachdem Sie ihren Eid geleistet haben, erhalten Sie Ihr erstes Geld.«
Ich blinzelte. »Geld?«
Sie schenkte mir wieder einen dieser Blicke, die einen Zentimeter über dem Brillenrand anfingen. »Ihr Gehalt, meine Liebe.«
Mein Lachen klang nicht nur nervös, sondern auch so, als ob mir die Luft wegbliebe. »Ich brauche kein Gehalt. Ich bin Doktorandin. Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich bekomme ein Gehalt.« Ich arbeitete seit drei Jahren an meiner Doktorarbeit und hatte die ersten drei Kapitel über die romantische Literatur des Mittelalters bereits geschrieben.
Helen runzelte die Stirn. »Meine Liebe, Sie können ihre Studien nicht weiterführen. Die Universität akzeptiert Vampire nicht als Studierende, und sie wird sie erst recht nicht anstellen. Paragraph VII gilt noch nicht für uns. Wir haben uns bereits darum gekümmert und Sie exmatrikuliert, um Streit vorzubeugen. Darum müssen Sie sich nicht mehr sorgen und …«
Mein Herzschlag dröhnte in meinen Ohren. »Was meinen Sie damit, Sie haben mich exmatrikuliert?«
Ihr Gesichtsausdruck wurde weicher. »Merit, Sie sind eine Vampirin. Eine Initiantin Cadogans. Ihr früheres Leben gibt es für Sie nicht mehr.«
Ich war schon durch die Tür, bevor sie ihren Satz beendet hatte, und hörte ihre Stimme hinter mir leiser werden, während ich in das Schlafzimmer im ersten Stock rannte, das uns als Arbeitszimmer diente. Ich wackelte kurz mit der Maus, um den Rechner zu aktivieren, rief den Browser auf und loggte mich in den Universitätsserver ein. Das System akzeptierte mein Passwort, und ich entspannte mich.
Dann suchte ich mein Profil auf.
Vor zwei Tagen war mein Status geändert worden. Ich war nun »exmatrikuliert«.
Die Welt um mich herum geriet ins Wanken.
Ich ging zurück ins Wohnzimmer. Meine Stimme zitterte, während ich die aufkommende Panik zu bekämpfen versuchte. Ich starrte Helen an. »Was haben Sie getan? Sie hatten kein Recht, mich zu exmatrikulieren.«
Helen griff erneut in ihre Tasche und zog ein Blatt Papier hervor. Sie blieb nervtötend ruhig. »Weil Ethan Ihre Umstände für … ungewöhnlich hält, werden Sie Ihr Gehalt vom Haus innerhalb der nächsten zehn Werktage erhalten. Wir haben die Einzahlung bereits veranlasst. Die Aufnahmezeremonie ist für Ihren siebten Tag angesetzt worden, also in sechs Tagen. Sie werden dort wie befohlen erscheinen. Im Lauf der Zeremonie wird Ihnen Ethan Ihre Aufgabe im Haus zuteilen.« Sie lächelte mich an. »Vielleicht etwas in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man die guten Beziehungen Ihrer Familie in der Stadt bedenkt.«
»Oh, Mädel. Die Eltern zu erwähnen war eine dumme Idee«, murmelte Mallory.
Und damit hatte sie recht. Da meine Eltern ein von mir wenig geschätztes Thema waren, war dies genau das Falsche im falschen Moment. Aber zumindest verärgerte es mich so sehr, dass ich aus meiner Benommenheit erwachte. »Ich glaube, wir sind dann fertig«, sagte ich. »Es wird Zeit für Sie zu gehen.«
Helen hob eine Augenbraue. »Dies ist nicht Ihr Haus.«
Ganz schön mutig, die frisch gebissene Vampirin zu verärgern. Aber das war für mich jetzt ein Heimspiel, und ich hatte Verbündete.
Ich wandte mich mit einem boshaften Grinsen an Mallory. »Wie wäre es, wenn wir die Gelegenheit nutzen und herausfinden, wie viel von diesem Vampirmythos eigentlich Mythos ist? Müssen Vampire nicht eine Einladung erhalten, wenn sie das Haus eines Fremden betreten?«
»Ich liebe deine Art zu denken«, sagte Mallory, ging zur Tür und öffnete sie. »Helen«, sagte sie, »ich will Sie aus meinem Haus haben.«
Etwas lag in der Luft, eine kühle Brise, die durch die Tür hereinfegte und Mallorys Haare durcheinanderbrachte – und mir zugleich eine Gänsehaut auf meinen Armen verursachte.
»Dies ist unglaublich ungezogen«, sagte Helen, schnappte sich aber dennoch ihre Tasche. »Lesen Sie das Buch, unterschreiben Sie die Formulare! Im Kühlschrank werden Sie Blut finden. Trinken Sie es – einen halben Liter alle zwei Tage! Meiden Sie das Sonnenlicht und Espenpflöcke, und erscheinen Sie, wenn er es Ihnen befiehlt!« Sie ging auf die Tür zu und wurde plötzlich auf die Treppenstufen vor dem Haus gesaugt, als ob jemand an einem Staubsauger den Schalter betätigt hätte.
Ich rannte zur Tür. Helen stand auf der obersten Stufe, und ihre Brille hing schief. Sie starrte uns zerzaust und schockiert an, fing sich aber nach einem Augenblick, nahm wieder Haltung an und richtete Rock und Brille. Sie drehte sich zackig um und schritt die Stufen zur Limousine hinab. »Das war – sehr unverschämt«, rief sie über die Schulter zurück. »Glauben Sie bloß nicht, dass ich dies Ethan verschweigen werde!«
Ich winkte ihr pompös zu – mit leicht gewölbter, nach innen gedrehter Handfläche.
»Sagen Sie ihm das, Helen«, forderte Mallory sie heraus. »Und richten Sie ihm aus, dass er sich verpissen soll, wenn Sie schon dabei sind.«
Helen drehte sich um und starrte mich an. Ihre Augen funkelten silbern. Auf unmenschliche Weise silbern. »Sie sind unwürdig«, warf sie mir an den Kopf.
»Ich war unwillig«, wies ich sie zurecht und schlug die schwere Eichentür mit solcher Kraft zu, dass sie in ihren Scharnieren erbebte. Als die Limousine geräuschvoll auf dem Asphaltschotter davonfuhr, lehnte ich mich mit dem Rücken an die Tür und sah Mallory an.
Sie starrte zornig zurück. »Sie sagten, du wärst mitten in der Nacht allein auf dem Universitätsgelände unterwegs gewesen!« Sie schlug mir auf den Arm, und ihr Gesichtsausdruck ließ keinen Zweifel daran, wie empört sie war. »Was in aller Welt hast du dir dabei gedacht?«
Daran ist ihre Panik schuld, dachte ich, die Angst, die sie durchgemacht hat, bis sie hörte, dass ich nach Hause komme. Meine Kehle war wie zugeschnürt, denn ich wusste, dass sie auf mich gewartet hatte, dass sie Angst um mich gehabt hatte.
»Ich musste arbeiten.«
»Mitten in der Nacht?!«
»Ich sage dir doch, ich musste arbeiten!« Ich schlug die Hände über dem Kopf zusammen und wurde zunehmend wütender. »Gott, Mallory, das ist doch nicht meine Schuld!« Meine Knie gaben langsam nach. Ich schlich die wenigen Schritte zurück zur Couch und setzte mich. Die unterdrückte Angst, Entsetzen und die Verletzung, all das überwältigte mich in diesem Augenblick. Ich vergrub mein Gesicht in meinen Händen, als die ersten Tränen flossen. »Es war nicht meine Schuld, Mallory. Alles – mein Leben, die Uni – alles ist weg, und es war nicht meine Schuld.«
Ich spürte, wie sich das Kissen neben mir senkte und ein Arm um meine Schultern gelegt wurde.
»Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bin nur völlig am Ende. Ich hatte solche Angst, Merit. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist.« Sie hielt mich in den Armen, während ich schluchzte und jeder Atemzug zu einem krampfhaften Schmerz wurde, während ich den Verlust meines Lebens betrauerte und den Verlust meiner Menschlichkeit.
Wir saßen lange auf der Couch, meine beste Freundin und ich. Sie reichte mir unaufhörlich Taschentücher, während ich mir immer und immer wieder die Dinge durch den Kopf gehen ließ, an die ich mich erinnern konnte – den Angriff, die Vampire, die danach erschienen, die Kälte und den Schmerz, die Fahrt in der Limousine, schemenhaft, verschwommen.
Als mein Körper keine Tränen mehr hervorbrachte, strich mir Mallory die Haare aus dem Gesicht. »Alles wird gut, das verspreche ich dir. Ich rufe morgen früh die Universität an. Und wenn du nicht wieder angenommen wirst … dann überlegen wir uns was. In der Zwischenzeit sollten wir deinen Großvater anrufen. Er wird sicherlich erfahren wollen, dass es dir gut geht.«
Ich schüttelte den Kopf, denn zu diesem Gespräch war ich einfach noch nicht bereit. Die Liebe meines Großvaters war immer bedingungslos gewesen, aber ich war auch bis jetzt immer ein Mensch gewesen. Ich war noch nicht bereit, eine mögliche Wechselwirkung auszutesten. »Ich fang erst mal mit Mom und Dad an«, versprach ich ihr. »Dann lass ich’s langsam durchsickern.«
»Schäbig«, warf mir Mallory vor, ließ es aber gelten. »Ich nehme mal an, der Anruf, den ich bekommen habe, war vom Haus, aber ich weiß nicht, ob sie sonst noch jemanden benachrichtigt haben. Der Anruf war ziemlich kurz. ›Merit wurde vor zwei Tagen nachts auf dem Universitätsgelände angegriffen. Um ihr Leben zu retten, haben wir sie zu einer Vampirin gemacht. Sie wird heute nach Hause kommen. Die Wandlung wird vermutlich eine leichte Benommenheit hervorrufen, also seien Sie bitte zu Hause, um ihr während der ersten, kritischen Stunden zur Seite zu stehen. Vielen Dank!‹ Es hörte sich fast wie ein Tonband an, um ganz ehrlich zu sein.«
»Also ist dieser Ethan Sullivan total billig«, stellte ich fest. »Das gehört mit auf die endlos lange Liste an Gründen, warum wir ihn nicht ausstehen können.«
»Dass er dich in eine seelenraubende Kreatur der Dunkelheit verwandelt, steht wohl als erster Punkt auf dieser Liste?«
Ich nickte reumütig. »Das hat sicherlich den ersten Platz verdient.« Ich rutschte unruhig hin und her und warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. »Sie haben mich zu einer von ihnen gemacht. Er hat mich zu einer von ihnen gemacht, dieser Sullivan.«
Mallory schnaubte frustriert. »Ich weiß. Und ich bin so scheiße neidisch.« Mallory war schon immer ein Fan des Paranormalen gewesen; seit dem Tag, an dem ich sie kennengelernt hatte, war sie von allem begeistert gewesen, was mit Fangzähnen ausgestattet oder einfach nur völlig abgedreht war. Sie legte die Handfläche auf ihre Brust. »Ich bin die Okkultistin in der Familie, und dennoch verwandeln sie dich, die beknackte Englischstudentin? Selbst Buffy würde das empörend finden. Immerhin«, sagte sie mit einem kennerischen Blick«, wirst du erstklassiges Forschungsmaterial abgeben.«
Ich lachte prustend. »Forschungsmaterial wofür? Wer zur Hölle bin ich nun eigentlich?«
»Du bist Merit«, sagte sie mit einer Überzeugung in der Stimme, die mein Herz erfreute. »Aber so eine Art Merit 2.0. Und ich muss sagen – von dem Telefonanruf mal abgesehen – an diesem Sullivan ist bestimmt nichts billig. Die Schuhe, die du trägst, sind von Jimmy Choo, und dieses Kleid kannst du auch auf einem Catwalk anziehen.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Er hat dich eingekleidet, als ob du sein privates Model wärst. Und ehrlich gesagt, Merit, du siehst gut aus.«
Gut, dachte ich, ist relativ. Ich schaute auf das Cocktailkleid hinab und strich mit meinen Händen über den glatten schwarzen Stoff. »Ich mochte, wer ich war, Mallory. Mein Leben war nicht perfekt, aber ich war glücklich.«
»Ich weiß, mein Engel. Aber vielleicht wirst du das hier auch mögen.«
Ich hatte meine Zweifel. Ernsthafte Zweifel.
KAPITEL ZWEI
Reiche Menschen sind nicht netter – sie haben einfach nur bessere Autos
Meine Eltern gehörten in Chicago zu den Neureichen.
Mein Großvater Chuck Merit hatte der Stadt vierunddreißig Jahre als Polizist gedient – er drehte seine Runden an der South Side, bis er zum Kriminalamt des Chicago Police Department wechselte. Er war eine Legende bei der Chicagoer Polizei.
Aber obwohl er seiner Familie eine solide, mittelständische Existenz ermöglichte, reichte das Einkommen manchmal nicht aus. Meine Großmutter stammte aus einer reichen Familie, aber sie hatte das Erbe ihres herrischen Vaters, der dem alten Chicagoer Geldadel angehörte, ausgeschlagen. Auch wenn es ihre Entscheidung war, so machte mein Vater es meinem Großvater zum Vorwurf, dass er nicht mit dem Standard aufwuchs, der ihm seiner Meinung nach zugestanden hätte. Geprägt von diesem angeblichen Verrat und verärgert über eine Kindheit in einem Haus mit Polizistengehalt, hatte mein Vater es sich zum Ziel gesetzt, so viel Geld wie möglich anzuhäufen, aber sonst gab es nicht viel in seinem Leben.
Aber Geld verdienen, das konnte er.
Merit Properties, die Immobilienfirma meines Vaters, verwaltete in der gesamten Stadt Wohnungs- und Hochhauskomplexe. Er war außerdem Mitglied des mächtigen Chicagoer Wirtschaftsrats, der sich aus Vertretern der in der Stadt ansässigen Unternehmen zusammensetzte und den gerade erst wiedergewählten Bürgermeister Seth Tate bei Planungsvorhaben und der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt beriet. Mein Vater war sehr stolz auf seine Beziehung zu Tate und ließ das auch oft genug im Gespräch fallen. Meiner Meinung nach warf das eher ein schlechtes Licht auf den Bürgermeister.
Natürlich hatte ich all die Vorteile genossen, die der Name Merit mit sich brachte – ein großes Haus, Sommercamps, Ballettunterricht, nette Klamotten. Aber wenn die finanziellen Vorteile auch beachtlich waren, so waren meine Eltern nicht gerade mitfühlende Menschen und mein Vater schon gar nicht. Joshua Merit wollte der Welt etwas hinterlassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er wollte die perfekte Ehefrau, die perfekten Kinder und den perfekten Platz innerhalb der sozialen und finanziellen Elite Chicagos. Es war keine große Überraschung, dass ich meine Großeltern über alles vergötterte, denn sie wussten noch, was bedingungslose Liebe bedeutete.
Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine neue Existenz als Vampirin besonders schätzen würde. Aber ich war ja schon ein großes Mädchen und sprang daher in mein Auto, nachdem ich mir die Tränen aus dem Gesicht gewaschen hatte – einen alten, kastenförmigen Volvo, den ich mir vom Mund abgespart hatte –, und fuhr zu ihrem Haus in Oak Park.
Als ich ankam, parkte ich den Volvo auf der Zufahrt, die in einem Bogen vor dem Haus verlief. Das Gebäude war eine gewaltige postmoderne Betonschachtel, die überhaupt nicht zu den viel dezenteren Häusern im Prairie-Style in der Nachbarschaft passte. Guter Geschmack ließ sich eben nicht mit Geld kaufen.
Ich ging zur Eingangstür. Sie wurde geöffnet, bevor ich klopfen konnte. Ich sah kurz hoch. Mürrisch dreinblickende graue Augen blickten auf mich aus einer Höhe von fast zwei Metern herab. Ein spindeldürrer weißer Typ stand vor mir. »Ms Merit.«
»Hallo, Peabody!«
»Pennebaker.«
»Das habe ich doch gesagt.« Natürlich kannte ich seinen Namen. Pennebaker, der Butler, war die erste große Errungenschaft meines Vaters gewesen. Was Kindererziehung betraf, hatte Pennebaker eine Mentalität, die sich nur mit »Wer an der Rute spart, verzieht das Kind« umschreiben ließ. Er war immer auf der Seite meines Vaters – er schnüffelte herum, verpetzte mich und ließ im Allgemeinen keine Gelegenheit aus, die saftigen Details meiner ach so rebellischen Kindheit weiterzugeben. Realistisch betrachtet lag ich, was Rebellionen anging, unter dem Durchschnitt, aber ich hatte perfekte Geschwister – meine ältere Schwester Charlotte war mit einem Kardiologen verheiratet und warf regelmäßig Kinder, und mein älterer Bruder Robert wurde darauf getrimmt, eines Tages das Familienunternehmen zu leiten. Da ich nur eine siebenundzwanzigjährige Doktorandin war, wenn auch an einer der besten Universitäten des Landes, war ich eben nur eine Merit zweiter Klasse. Und jetzt suchte ich unser trautes Heim wegen eines echten Knallers auf.
Ich ging hinein und spürte den Luftzug in meinem Rücken, als Pennebaker entschieden die Tür hinter mir schloss und dann vor mich trat.
»Ihre Eltern halten sich im vorderen Salon auf«, stimmte er an. »Sie werden erwartet. Sie waren über alle Maßen um Ihr Wohlergehen besorgt. Sie bekümmern Ihren Vater« – er schaute verächtlich herab – »mit diesen Dingen, in die Sie hineingeraten.«
Das nahm ich ihm übel, entschied mich aber, ihn nicht in seiner Annahme zu korrigieren, in welchem Maße ich meiner Wandlung zugestimmt hatte. Er hätte mir sowieso nicht geglaubt.
Ich ging an ihm vorbei den Flur entlang zum vorderen Salon und öffnete die Schiebetür. Meine Mutter, Meredith Merit, erhob sich von einem der extrem kastenförmigen Sofas im Raum. Selbst um dreiundzwanzig Uhr trug sie noch Stöckelschuhe, ein Leinenkleid und eine Perlenkette. Ihre blonden Haare saßen perfekt, ihre Augen waren blaßgrün.
Mom eilte mir mit ausgestreckten Armen entgegen. »Bist du in Ordnung?« Sie nahm mein Gesicht zwischen ihre Hände, deren Finger sehr lange Nägel hatten, und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. »Bist du in Ordnung?«
Ich lächelte höflich. »Mir geht’s gut.« Aus ihrer Perspektive stimmte das sogar.
Mein Vater saß auf dem gegenüberliegenden Sofa. Er war genauso schlank und groß gewachsen wie ich, hatte dieselben kastanienbraunen Haare und blauen Augen und trug trotz der späten Stunde immer noch einen Anzug. Er blickte über den Rand seiner Lesebrille, eine Angewohnheit, die er sich glatt bei Helen abgeschaut haben könnte. Dieser Blick hinterließ nicht nur bei Menschen Eindruck, sondern auch bei Vampiren. Er schlug die Zeitung zusammen, die er gerade las, und legte sie neben sich auf das Sofa.
»Vampire?« Er schaffte es, das eine Wort sowohl wie eine Frage als auch eine Anklage klingen zu lassen.
»Ich wurde an der Uni angegriffen.«
Meine Mutter keuchte, griff sich mit der Hand ans Herz und warf einen Blick auf meinen Vater. »Joshua! An der Universität! Sie greifen Menschen an!«
Der Blick meines Vaters hatte sich nicht geändert, doch die Überraschung war an seinen Augen abzulesen. »Angegriffen?«
»Ich wurde von einem Vampir angegriffen, aber ein anderer hat mich dann verwandelt.« Ich erinnerte mich an die wenigen Worte, die ich mitbekommen hatte, an die Angst in der Stimme von Ethan Sullivans Begleiter. »Ich glaube, der erste flüchtete, weil er weggejagt wurde, und die zweiten hatten Angst, ich würde sterben.« Nicht ganz die Wahrheit – der Begleiter fürchtete, dass dies geschehen könnte; Sullivan war eindeutig davon überzeugt, dass es geschehen würde – und dass er mein Schicksal ändern könnte.
»Zwei Vampirgruppen? An der Universität von Chicago?«
Ich zuckte mit den Achseln, weil ich mir genau dieselbe Frage gestellt hatte.
Mein Vater schlug die Beine übereinander. »Und wo wir schon davon sprechen: Warum, in Gottes Namen, bist du mitten in der Nacht allein auf dem Universitätsgelände unterwegs?«
Etwas erwachte in mir. Vielleicht ein Funken Zorn, begleitet von einem Gefühl des Selbstmitleids – Emotionen, die ich beim Umgang mit meinem Vater mehr als einmal empfunden hatte. Normalerweise spielte ich aus Angst das Unschuldslamm; wenn ich die Stimme gegen meine Eltern erhob, riskierte ich, dass sie ihren seit Langem gehegten Wunsch nach einer anderen jüngsten Tochter äußerten.
»Ich habe gearbeitet.«
Sein Schnauben war als Antwort mehr als genug.
»Ich habe gearbeitet«, wiederholte ich, und in meiner Stimme lagen siebenundzwanzig Jahre Kampf um Selbstbehauptung. »Ich war auf dem Weg, einige Forschungsartikel abzuholen, und wurde angegriffen. Ich hatte keine Wahl, und es war auch nicht meine Schuld. Er hat mir fast die Kehle aufgeschlitzt.«
Mein Vater betrachtete die makellose Haut meines Halses und schien dies zu bezweifeln – Gott bewahre, eine Merit, eine Merit aus Chicago kann sich nicht allein verteidigen –, wechselte aber das Thema. »Und dieses Haus Cadogan. Sie sind alt, aber nicht so alt wie Navarre.«
Da ich Haus Cadogan bisher noch nicht erwähnt hatte, nahm ich an, dass derjenige, der meine Eltern angerufen hatte, sie auch über meine Verbindung zum Haus aufgeklärt hatte. Und mein Vater hatte sich anscheinend gründlich informiert.
»Ich weiß nicht viel über die Häuser«, gab ich zu und dachte, dass dies wohl mehr Mallorys Interessenfeld war.
Der Gesichtsausdruck meines Vaters ließ keinen Zweifel daran, dass ihn meine Antwort nicht überzeugte. »Ich bin erst heute Abend nach Hause gekommen«, sagte ich, um mich zu verteidigen. »Sie haben mich vor zwei Stunden vor meiner Haustür abgeliefert. Ich war mir nicht sicher, ob ihr es von irgendjemandem erfahren oder gedacht habt, ich sei verletzt oder so was, also bin ich vorbeigekommen.«
»Wir wurden angerufen«, lautete sein trockener Kommentar. »Vom Haus. Deine Mitbewohnerin …«
»Mallory«, unterbrach ich ihn. »Sie heißt Mallory.«
»… hat uns informiert, dass du nicht nach Hause gekommen bist. Dann rief das Haus an und ließ uns wissen, dass du angefallen worden bist. Sie sagten, du würdest dich jetzt erholen. Ich habe deinem Großvater Bescheid gegeben und deinem Bruder und deiner Schwester. Es gab also keinen Grund, die Polizei zu benachrichtigen.« Er hielt kurz inne. »Ich möchte nicht, dass sie da mit hineingezogen werden, Merit.«
Ich fasste mir an den Hals, obwohl meine Narben nicht mehr vorhanden waren. Mein Vater hatte angesichts der Tatsache, dass seine Tochter den Angriff unbeschadet überstanden hatte, offensichtlich kein Interesse daran, das Ganze genauer zu untersuchen. »Für die Polizei ist es wohl auch ein wenig zu spät.«
Mein Vater stand vom Sofa auf und kam zu mir. Meine forensische Meisterleistung schien ihn wenig beeindruckt zu haben. »Ich habe hart dafür gearbeitet, aus dieser Familie etwas zu machen. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie ihr guter Ruf wieder zerstört wird.« Seine Wangen waren hochrot angelaufen. Meine Mutter, die sich neben ihn gestellt hatte, berührte ihn am Arm und sagte leise seinen Namen.
Meine Nackenhaare stellten sich bei dem »wieder« auf, aber ich widerstand dem Verlangen, der Bewertung meines Vaters zu widersprechen, was unsere Familiengeschichte anging. »Es war nicht meine Entscheidung, ein Vampir zu werden.«
»Du warst schon immer völlig abgedreht. Du hast immer von diesem romantischen Blabla geträumt.« Ich verstand dies als Seitenhieb auf meine Dissertation. »Und jetzt das.« Er ließ mich einfach stehen und ging zu einem deckenhohen Fenster, durch das er nach draußen starrte. »Bleib einfach – bleib einfach auf deiner Seite der Stadt! Und versuch keinen Ärger zu machen!«
Ich dachte, damit wäre er fertig, dass sein Vorwurf das letzte Wort gewesen sei, aber dann drehte er sich zu mir um und starrte mich aus schmalen Augen an. »Und wenn du irgendetwas anstellen solltest, was unseren Namen beschmutzt, dann werde ich dich so schnell enterben, dass du deinen Namen nicht mal mehr sagen kannst.«
Das ist mein Vater, sehr geehrte Damen und Herren!
Als ich Wicker Park endlich erreichte, waren meine Augen wieder hoffnungslos verheult und alles Make-up verwischt, denn auf dem Weg nach Osten hatte ich ohne Unterbrechung geweint. Ich weiß nicht, warum mich das Verhalten meines Vaters überraschte; es war völlig im Einklang mit dem einzigen Ziel in seinem Leben: seine gesellschaftliche Stellung zu verbessern. Meine Nahtoderfahrung und die Tatsache, dass ich zu einem Blutsauger geworden war, hatten in seiner kleinen, ordentlichen Welt nicht denselben Wert wie die Gefahr, die dadurch für seine Stellung entstand.
Es war schon spät, als ich den Wagen in die kleine Garage neben dem Haus fuhr – fast ein Uhr nachts. Das Brownstone lag im Dunkeln, alles war ruhig in der Nachbarschaft, und ich ging davon aus, dass Mallory bereits oben in ihrem Zimmer schlief. Im Gegensatz zu mir hatte sie ihren Job noch. Sie arbeitete in einer Werbeagentur auf der Michigan Avenue und war meistens schon um sieben in Downtown. Aber als ich die Vordertür aufschloss, fand ich sie auf der Couch sitzend. Sie starrte ausdruckslos auf den Fernseher.
»Das musst du sehen«, sagte sie, ohne mich anzublicken. Ich schleuderte die Stöckelschuhe in eine Ecke, ging um das Sofa herum zum Fernseher und starrte wie sie. Die Unheil verheißende Schlagzeile am unteren Bildrand lautete: Chicagoland-Vampire streiten Beteiligung an Mord ab.
Ich sah Mallory an. »Mord?«
»Sie haben ein totes Mädchen im Grant Park gefunden. Ihr Name ist Jennifer Porter. Ihr wurde die Kehle herausgerissen. Sie haben sie heute Nacht gefunden, glauben aber, dass sie schon vor einer Woche getötet wurde – drei Tage bevor du angegriffen wurdest.«
»Oh mein Gott!« Ich ließ mich auf das Sofa hinter mir fallen und zog die Knie heran. »Sie glauben, die Vampire sind dafür verantwortlich?«
»Schau es dir an«, sagte Mallory.
Auf dem Bildschirm waren vier Männer und eine Frau zu sehen – Celina Desaulniers –, die hinter einem Holzpodest standen.
Eine Horde Fernseh- und Printjournalisten hockte davor. Alle hielten Mikrofone, Kameras, Aufnahmegeräte oder Notizblöcke in der Hand.
Das Quintett schritt in perfekter Koordination nach vorn.
Der Mann in der Mitte beugte sich über das Mikrofon. Seine langen dunklen Haare umrahmten sein Gesicht.
»Ich heiße Alexander«, sagte er mit vollmundiger Stimme. »Dies sind meine Freunde und Partner. Wie Sie wissen, sind wir Vampire.«
Der Raum wurde von zahllosen Blitzen erhellt, als die Reporter hektisch Bilder der Gruppe machten. Das Blitzlicht schien die Vampire überhaupt nicht zu stören, denn sie standen völlig regungslos da, Seite an Seite.
»Wirsindhier«,sagteAlexander,»umderFamilieunddenFreundenJenniferPortersunseraufrichtigesBeileidauszusprechen.WirwerdendiePolizeiChicagosundandereStrafverfolgungsbehördenmitallenunszurVerfügungstehendenMittelnunterstützen.WirbietenunsereHilfeanundverurteilenVerbrechen,diemenschlichesLebenfordern.EsgibtkeinenGrundfürsolcheGewalt,unddieZivilisiertenunterunsverabscheuensieschonseitLangem.WieSiewissen,habenwirseitLangemexistierendebesondereMethodenentwickelt,umBlutzutrinken – sieverhindern,diejenigenzuOpfernzumachen,dieunserVerlangennichtteilen.MordewerdennurvonunserenFeindenbegangen.UndseienSiesichdessenversichert,meineFreunde,siesindnichtnurIhre,sondernauchunsereFeinde.«
Alexander hielt kurz inne, sprach dann aber mit einer leicht nervöser klingenden Stimme weiter. »Wir haben erfahren, dass am Tatort ein Medaillon eines der Chicagoer Häuser, Cadogan, gefunden wurde.«
»Oh mein Gott«, flüsterte Mallory.
Ich konnte meinen Blick nicht vom Fernseher abwenden.
»Unsere Kameraden des Hauses Cadogan trinken zwar Blut direkt von Menschen«, fuhr Alexander fort, »doch sie gewährleisten, dass die Menschen, die ihr Blut spenden, über alle Eventualitäten informiert sind und ihre Spende absolut freiwillig erfolgt. Und Chicagos andere Vampire trinken unter keinen Umständen Blut direkt von Menschen. Daher gehen wir davon aus, obwohl es sich zu diesem Zeitpunkt nur um eine Hypothese handeln kann, dass das Medaillon nur deshalb am Tatort platziert wurde, um die Bewohner des Hauses Cadogan zu beschuldigen. Alles andere wäre eine unbegründete Annahme.«
Ohne ein weiteres Wort schritt Alexander nach hinten zu seinen Kameraden.
Celina trat vor. Zuerst schwieg sie und ließ ihren Blick über die Reporter vor ihr gleiten. Sie lächelte sanft, und man konnte das Seufzen der Reporter erahnen. Doch ihr unschuldiger Gesichtsausdruck war ein wenig zu unschuldig, um noch glaubwürdig zu sein. Ein wenig zu gezwungen.
»Der Tod Jennifer Porters hat uns alle schwer getroffen«, sagte sie, »und die Beschuldigungen gegen unsere Kollegen haben uns sehr betrübt. Obwohl die Vampire des Hauses Navarre nicht direkt von Menschen trinken, respektieren wir die Entscheidung anderer Häuser, diese Vorgehensweise zu praktizieren. Alle Mittel des Hauses Navarre stehen der Stadt zur Verfügung. Dieses Verbrechen betrifft uns alle, und das Haus Navarre wird nicht ruhen, bis der Mörder gefasst und vor Gericht gebracht ist.«
Celina nickte der Horde Reporter zu, drehte sich zur Seite und ging aus dem Bildschirm heraus. Die anderen Vampire schlossen sich ihr an.
Mallory machte den Ton aus und drehte sich zu mir. »Wo hast du dich da reinziehen lassen, verdammt noch mal?«
»Sie sagen, die Häuser hätten damit nichts zu tun«, merkte ich an.
»Sie sagt, Navarre hätte damit nichts zu tun«, wies mich Mallory zurecht. »Sie scheint durchaus bereit, die anderen Häuser den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen. Und außerdem waren Vampire involviert, als es dich fast erwischt hat. Ein Vampir hat dich angegriffen. Das sind zu viele Fangzähne auf einmal.«
Ich folgte ihrem Gedankengang. »Du denkst, ich bin, nun ja, Nummer zwei? Dass ich das zweite Opfer sein sollte?«
»Du warst das zweite Opfer«, betonte sie. Sie schaltete den Fernseher mit der Fernbedienung aus. »Ich halte es für einen verdammt großen Zufall, dass man dir die Kehle an der Uni aufgeschlitzt hat. Das ist zwar nicht gerade ein Park, aber nah genug dran. Schau mal hin«, sagte sie und deutete mit der Fernbedienung auf den Fernseher.
Ein Bild Jennifer Porters füllte den Bildschirm vollständig aus, vergrößert von ihrem Personalausweis. Dunkelbraune Haare, blaue Augen. Genau wie ich.
Ein Moment des Schweigens entstand zwischen uns.
»Wenn wir schon von schrecklichen Leuten reden«, sagte Mallory schließlich, »wie war eigentlich dein Besuch zu Hause?« Mallory hatte meine Eltern nur einmal getroffen, als ich es nicht mehr länger herauszögern konnte, sie ihnen vorzustellen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt gerade ihre Blaue-Haare-Phase begonnen. Ich muss nicht betonen, dass meine Eltern dies wenig beeindruckte. Kreativität, egal wie ungefährlich sie sein mochte, wurde im Hause Merit nicht toleriert. Nach diesem einmaligen Besuch entschloss ich mich dazu, Mallory meinen Eltern nicht erneut aufzudrängen – einen Augenblick lang hatte sie vorgehabt, meinem Vater einen Kinnhaken zu verpassen.
Ich setzte mich neben sie aufs Sofa. »Nicht so besonders.«
»Tut mir leid.«
IchzucktemitdenAchseln.»IchhattekeinebesondershohenErwartungen.IchhättenurvorhernochwenigerErwartungendaraufsetzensollen.«IchbetrachtetedendickeninLedergebundenenKanonaufdemWohnzimmertisch,griffdanachundlegteihnmirindenSchoß.»IrgendwiehabensiesichschonSorgengemacht,glaubeich,aberimWesentlichenwareseinVortragdarüber,derFamiliekeineSchandezubereiten.«IchhobmeineHändeundwackeltemelodramatischmitdenFingern.»Duweißtschon,dieMeritsausChicago.AlsobdasirgendeineBedeutunghätte.«
Mallory schnaubte leise. »Unglücklicherweise hat es was zu bedeuten. Du musst dir ja nur die Tribune anschauen, um das zu erkennen. Hast du schon deinen Großvater besucht?«
»Noch nicht.«
»Du musst aber.«
»Ich geh ja«, antwortete ich schnell. »Wenn ich dazu in der Lage bin.«
»Schwachsinn«, sagte sie und schnappte sich das kabellose Telefon von seiner Station neben dem Sofa. »Er war dir immer wie der Vater, der Joshua niemals war. Und du weißt, dass er immer wach ist. Ruf ihn an.« Sie reichte mir den Hörer, und ich nahm ihn und starrte auf die blauen Plastikknöpfe.
»Verdammt!«, murmelte ich, tippte aber die Nummer ein. Ich hielt das Telefon an mein Ohr, ballte meine Hand zur Faust, um das Zittern unter Kontrolle zu bekommen, und betete leise, dass wenigstens er Verständnis zeigen würde. Es klingelte dreimal, bis sich der Anrufbeantworter einschaltete.
»Hi, Grandpa«, sagte ich nach dem Piepton. »Ich bin’s, Merit. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt zu Hause bin und dass es mir gut geht. Ich besuche dich, sobald ich kann.« Ich legte auf und gab Mallory den Hörer zurück.
»Erwachsenergeht’skaum.Ichbinsostolzaufdich«,sagtesie,strecktedenArmausundstelltedasTelefoninseineStation.
»He, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann dir immer noch in den Hintern treten, ob untot oder nicht.«
Sie schnaubte verächtlich. Einen Moment lang schwieg sie, und meinte dann vorsichtig: »Vielleicht hat das Ganze ja auch sein Gutes.«
Ich warf ihr einen kurzen Blick zu. »Was soll das heißen?«
»Das soll heißen: Vielleicht hast du jetzt endlich mal wieder Sex.«
»Jesus, Mallory. Darum geht’s ja wohl gar nicht«, sagte ich, musste ihr aber recht geben, was ihre Anspielung auf mein nicht vorhandenes Liebesleben anging. Mallory machte mich für diese Durststrecke verantwortlich. Sie meinte, ich »würde meine Fühler nicht genug ausstrecken«. Was sollte das denn heißen? Ich ging aus. Ich verbrachte eine Menge Zeit in Cafés, ging freitagabends mit meinen Uni-Kollegen vom English Department aus. Mallory und ich waren fast jedes Wochenende auf Konzerten unterwegs, denn in Chicago spielten viele Indie-Bands. Aber ich musste mich auch um den Abschluss meiner Dissertation kümmern. Ich hatte mir eben gedacht, es wäre auch noch später Zeit für Jungs. So wie es im Moment schien, hatte ich ab sofort eine (untote) Ewigkeit Zeit.
Mallory legte ihren Arm um meine Schultern und drückte mich. »Hör mal zu. Du bist jetzt eine Vampirin. Eine Vampirin.« Sie betrachtete mich von Kopf bis Fuß und ließ den Imagewechsel à la Haus Cadogan auf sich wirken. »Sie haben deinen Klamottengeschmack auf jeden Fall verbessert, und bald wirst du diesen Untoten-Gothic-Stil perfekt beherrschen.«
Ich sah sie kritisch an.
»Ernsthaft. Du bist groß, intelligent, hübsch. Du bestehst zu achtzig Prozent nur aus Beinen.« Sie legte den Kopf zur Seite und schaute mich an. »Ich hasse dich ein bisschen dafür.«
»Du hast die besseren Titten«, räumte ich ein. Und wie jedes Mal, wenn wir dieses Brüste-gegen-Beine-Gespräch führten, sahen wir auf unsere Oberweiten. Gafften sie an. Verglichen sie miteinander. Meine Brüste waren in Ordnung, wenn auch ein wenig klein. Ihre waren perfekt.
»Stimmt«, sagte sie schließlich, machte dabei aber eine abweisende Handbewegung. »Aber darum geht’s ja nicht. Der Punkt ist doch, dass du sehr gut aussiehst, und wenn es dich persönlich auch ärgert, du bist die Tochter Joshua Merits. Jeder kennt deinen Namen. Und trotz alldem hattest du wie lange kein Date mehr – ein Jahr?«
Vierzehn Monate, aber wer zählte so was schon?
»Wenn du da draußen dein völlig neues, heißes Vampirding abziehst, dann könnte dir das eine völlig neue Welt eröffnen.«
»Okay, Süße. Ich werde auf jeden Fall deswegen zu Hause anrufen.« Ich hob meine Hand und bog meine Finger so, als hielte ich ein Telefon. »Hi, Dad. Hier spricht deine Tochter, die du nur mit Müh und Not ertragen kannst. Klar, ich weiß, dass du enttäuscht bist, weil ich jetzt zu den wandelnden Untoten gehöre, aber diese blutsaugenden Jungs sind so heiß.« Ich tat so, als ob ich den Anruf beendete. »Nein, danke! Ich werde ganz bestimmt nicht mit einem Vampir ausgehen.«
Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter. »Engel, du bist ein Vampir.«
Ich rieb meine Schläfen, die mir Kopfschmerzen voraussagten. »Ich weiß, und das ist scheiße. Ich will nicht mehr darüber reden.«
Mallory seufzte ungeduldig, sagte aber nichts mehr. Sie ließ sich in die Sofakissen zurücksinken und tippte mit dem Finger auf das Handbuch der Vampire, das noch immer unberührt in meinem Schoß lag. »Und? Wirst du’s lesen?«
»Ich werde mir die grundlegenden Sachen wohl mal anschauen. Und da ich die ganze Nacht Zeit habe …«
»Nun, ich hab nicht die ganze Nacht Zeit.« Sie stand auf und streckte sich. »Ich muss ein wenig Schlaf bekommen. Ich hab ganz früh ein Meeting. Viel Spaß mit deinem Vampirbuch!«
»Gute Nacht, Mallory! Danke, dass du wach geblieben bist.«
»Kein Problem. Ich ruf die Uni morgen an und lass dich wissen, was sie zu einer erneuten Immatrikulation sagen.« Sie verließ das Zimmer, spähte aber noch einmal kurz um die Ecke. Ihre Hand lag auf dem Rahmen der Eichentür. »Nur um es noch mal zusammenzufassen: Du bist sauer, weil man dich zu einem Vampir gemacht hat, und wir hassen diesen komischen Penner Ethan Sullivan. Korrekt?«
Ich blätterte durch die dicken, alt wirkenden Seiten des Kanons, überflog die Danksagung und das Inhaltsverzeichnis. Mein wandernder Blick blieb am Titel des zweiten Kapitels hängen: »Deinem Lehnsherrn zu Diensten sein.«
»Oh ja«, beteuerte ich. »Wir hassen ihn.«
Ich schlief mit dem Buch in meinen Händen auf dem Sofa ein. Die letzten Nachtstunden hatte ich mit der Lektüre des Kanons verbracht, lange nachdem sich Mallory die Treppe hinaufgeschleppt hatte. Ich war die ganze Zeit hellwach, denn meine Wandlung zur Vampirin hatte meinen Schlafrhythmus bereits verändert, aber dafür traf mich bei Sonnenaufgang die Erschöpfung umso mehr. Als der neue Tag anbrach, spürte ich, wie sich die Sonne langsam heranschlich, um den Horizont zu überwinden. Ihr Aufgang führte bei mir zu einer Schläfrigkeit, die wie Blei in meinen Knochen lag. Was hat der Dichter Carl Sandburg noch mal über Nebel gesagt? Dass er sich auf Katzenpfötchen heranschleicht?
So erschien mir diese Erschöpfung. Sie schlich sich heran, leise, aber unwiderstehlich, und überzog mich mit einer schweren Samtdecke.
So langsam, wie ich einschlief, so abrupt wachte ich auf. Ich fand mich in einen uralten, muffigen Quilt eingewickelt, entknotete meine Beine und blickte aus den Stoffmassen hervor. Mallory saß auf dem Zweiersofa und trug Jeans zu einem T-Shirt mit dem Logo der Chicago Cubs. Sie bedachte mich mit einem neugierigen Blick.
»Hattest du vor, aus mir eine Mumie zu machen?«
»In diesem Zimmer gibt es Fenster«, wies sie mich zurecht, »und du warst einfach zu schwer, um dich die Treppe hochzutragen. Wenn ich dich den ganzen Tag der Sonne aussetze, werde ich am Ende des Monats ganz bestimmt keine Miete von dir bekommen.« Sie stand auf, kam zu mir und inspizierte mich. »Keine Verbrennungen?«
Ich warf die Decke von mir und betrachtete meinen Körper. Ich trug immer noch dieses eng anliegende Cocktailkleid, und die Haut, die man erkennen konnte, sah gut aus, vielleicht sogar besser als vor der Wandlung. Und ich fühlte mich verdammt viel besser als in der vorherigen Nacht. Die Schwerfälligkeit war ich endlich los. Jetzt war ich eine gesunde, blutsaugende Vampirin. Yeah!
»Nee«, antwortete ich und ersparte ihr wohlweislich meinen inneren Monolog. »Ich glaube, mir geht’s gut. Danke!«
Mallory tippte mit den Fingernägeln auf ihren Oberschenkel. »Ich denke, wir sollten uns heute Abend ein wenig Zeit nehmen, um uns, na ja, einen Überblick zu verschaffen. Rausfinden, womit wir es zu tun haben, was du brauchst. Wir sollten uns aufschreiben, was für dich wichtig sein könnte.«
IchwarfihreinenskeptischenBlickzu.Mallorywareinfachgroßartig.UmeintypischesBeispielzunennen:IhrenJobalsleitendeAngestelltebeiderWerbeagenturMcGettrick-CombshattesiesofortnachdemCollegeanLandgezogen – umgenauzusein,amTagnachdemsieihrenAbschlussanderNorthwesterngemachthatte.Mallorysagte:»MrMcGettrick,ichwillfürIhreAgenturarbeiten.«AlecMcGettricks – MrVollgas’ – mürrischeAntwortlautete:»SeienSieamMontagmorgenumachtUhrhier!«
Mallory war die Art Mensch mit großartigen Ideen, die sie für Alec und seine Truppe so wertvoll machten. Akribisch und genau zu sein, war hingegen nicht so ihr Ding. Wenn sie also vorschlug, ich solle mir eine Liste machen – nun, dann war das nicht typisch Mallory.
»Ist alles in Ordnung?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Du bist meine beste Freundin. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.« Mallory räusperte sich und starrte ausdruckslos auf die Wand. »Wo wir gerade dabei sind, der Kühlschrank ist jetzt voller Blut, das geliefert wurde, bevor du aufgewacht bist. Auf den Beuteln steht eine 0800er-Nummer, falls du mehr haben willst.« Ihre Mundwinkel zuckten, und es war offensichtlich, dass sie krampfhaft versuchte, nicht zu lachen.
»Warum machst du dich über mein Essen lustig?«
Sie schloss die Augen. »Die Firma, die diesen Vampir-Lieferservice erledigt, heißt ›Lebenssaft‹. Blöder geht’s doch kaum, oder? Ich meine, sie haben eine echt treue Kundschaft, das ist mir klar, aber können die um Gottes willen ihre Markenpolitik mal ernst nehmen? Sie brauchen einen neuen Namen, ein neues Image, neue Verpackungen …« Ihr Blick wurde glasig. Vermutlich tanzten Logos und Maskottchen in ihrem Kopf wild umher, und das zu einem Jingle, den sie sich bestimmt schon überlegt hatte.
»Ist auch egal«, sagte sie schließlich und schüttelte den Kopf, als ob sie ihn freizukriegen versuchte. »Ich bin nicht auf der Arbeit. Was viel wichtiger ist: Ich habe einen Ledervorhang für dein Schlafzimmer gekauft. Der ist riesig, damit er auch das gesamte Fenster abdeckt. Somit solltest du einen sicheren Platz zum Schlafen haben, auch wenn er nicht ganz ins Zimmerkonzept passt.« Sie blickte sich skeptisch im Raum um. »Obwohl ich die Einrichtung des Hauses eigentlich nicht Konzept nennen möchte.«
AlsMalloryeinzog,hattesieamHauskeinerleiVeränderungenvorgenommen.SiehattedieSchlafzimmeraufgeteilt,denKühlschrankgefülltundeinpaarelektrischeGerätegekauft.AlsohattedieInneneinrichtungimmernochvielvonTanteRose.DiehatteihrenNamenalsPflichtverstandenundpraktischjedefreieFlächemitBlumenmusterdeckenoderkleinenTeppichenüberdeckt.SelbstaufderTapeteprangtenkohlkopfgroßeRosen.
»Danke!«
»Nur falls es dich interessiert – du hast wirklich geschlafen.«
Ich grinste sie an. »Du hast es kontrolliert?«
»Ich habe dir einen Finger unter die Nase gehalten. Ich wusste nicht, ob du atmest oder einfach … gestorben bist. In einigen Büchern steht, dass Vampire das machen, du weißt schon, tagsüber.«
Und da Mallory Studentin des Okkulten war, musste sie es natürlich wissen. Wenn sie nicht so hervorragend zu ihrem Job in einer Chicagoer Werbeagentur gepasst hätte, dann hätte sie ihr gesamtes Leben wohl Vampiren und vergleichbaren Kreaturen gewidmet – und die hatten ihr Interesse geweckt, bevor sie wusste, dass es sie wirklich gab. So wie die Dinge lagen, beschäftigte sie sich mit ihrem Lieblingsthema also nach Feierabend. Und jetzt hatte sie endlich mich, in ihrem eigenen Haus, ein blutsaugendes Haustier. Ein Vampirhaustier?
»Es hat sich wie Schlaf angefühlt«, bestätigte ich und stand auf. Ich legte das Buch auf den Boden zwischen uns und bemerkte erneut, was ich immer noch anhatte. »Ich bin schon seit vierundzwanzig Stunden in diesem Kleid. Ich brauche eine entsetzlich lange Dusche und andere Klamotten.«
»Lass dich nicht aufhalten. Und lass mir was von meiner Haarspülung übrig, totes Mädchen.«
Ich lachte prustend und ging zur Treppe. »Ich verstehe nicht, warum ich es mit dir aushalte.«
»Weil du eines Tages auch mal so super cool wie ich sein willst.«
»Bitte! Du bist doch ein totales Fangzahn-Groupie.«
Aus dem Wohnzimmer war Gelächter zu hören. »Wir werden damit echt eine Menge Spaß haben.«
Das bezweifelte ich zwar, aber ich hatte mich lange genug dem Selbstmitleid hingegeben. Ich ignorierte meine Zweifel und tapste nach oben.
Ich vermied es, in den Badezimmerspiegel zu blicken, weil ich Angst vor einem nicht vorhandenen Spiegelbild hatte. Ich blieb so lange unter der Dusche, bis das heiße Wasser aufgebraucht war. Ich genoss die prickelnde Hitze und dachte nach … über meine neue Existenz? Helen hatte einige Grundkenntnisse erwähnt – Holzpflöcke, Sonnenlicht, Blut –, aber die Metaphysik hatte sie gänzlich ausgelassen. Wer war ich? Was war ich? Seelenlos? Tot? Untot?
Ich zwang mich zu einer Antwort auf meine Fragen: Ich wischte mit der Hand über den beschlagenen Spiegel und betete um ein Spiegelbild. In dem kleinen Badezimmer waberte der Dampf, konnte mich aber nicht verdecken. Ich stand sichtbar vor dem Spiegel, noch nass und überwiegend von einem rosafarbenen Handtuch bedeckt. Mein Gesichtsausdruck verriet meine Erleichterung.
IchrunzelteimSpiegelmeineStirnundversuchte,denRestzuenträtseln.Ichwarniebesondersreligiösgewesen.FürmeineElternwardieKircheeineGelegenheit,mitPrada-SlippernunddemneuestenMercedes-Cabrioanzugeben.AberinnerlichwarichimmereinspirituellerMenschgewesen.MeinenElternzumTrotzversuchteichimmerfürdieDinge,diemirgegebenwordenwaren,dankbarzusein.Ichversuchte,fürdieDingedankbarzusein,diemichdaranerinnerten,dassichnureinkleinesRadimGetriebewar:fürdenSeeaneinemtrüben,wolkigenTag;diegöttlicheGnadevonEdwardElgarsViolinenkonzert;diefriedlicheWürdeeinesGemäldesvonMaryCassattimArtInstitute.
Während ich also zitternd, nackt und nass vor dem Badezimmerspiegel stand, richtete ich meinen Blick zum Himmel. »Ich hoffe, wir können damit leben.«
EineAntworterhieltichnicht,aberichhatteauchnichtwirklicheineerwartet.EsspielteauchkeineRolle,obnunmitoderohneAntwort.SoistdasnunmalmitdemGlauben,nehmeichan.
Zwanzig Minuten später war ich wieder unten, sauber und trocken und in meinen Jeans. Ich hatte mich für eine meiner Lieblingshosen entschieden, die an der Hüfte tief saß, und zwei übereinander zu tragende T-Shirts ausgewählt, die weiß und blau waren und zu meinen Augen passten. Außerdem trug ich meine schwarzen Pumas von Mihara. Bei einer Größe von 1,73 Meter brauchte ich keine Stöckelschuhe. Das einzige Accessoire, das bei diesem Ensemble fehlte, war ein schwarzes Gummiband, das ich für Haarnotfälle immer am rechten Handgelenk trug. Heute hatte ich meine dunklen Haare bereits zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, der den gerade geschnittenen Pony in die Stirn fallen ließ.
Ich fand Mallory unten in der Küche, wo sie an der Kücheninsel saß. Vor ihr stand eine Dose Diät-Cola, und sie hielt eine Ausgabe der Cosmopolitan in der Hand.
»Was hast du letzte Nacht aus deiner Vampirbibel gelernt?«, fragte sie, ohne aufzublicken.
Während ich mich darauf vorbereitete, mein Wissen wiederzugeben, schnappte ich mir eine Dose Limonade aus dem Kühlschrank, öffnete sie und setzte mich auf den Stuhl neben Mallory. »Wie Helen sagte, gibt es in den Vereinigten Staaten zwölf Vampirhäuser, drei davon in Chicago. Die Struktur der Häuser gleicht … Nun ja, stell dir das englische Feudalsystem vor. Nur anstelle des Barons gibt es den Meistervampir, der für alle der Chef ist.«
»Ethan«, soufflierte sie.
Ich nickte zustimmend. »Bei Cadogan ist es Ethan. Er ist in seinem Haus der mächtigste Vampir. Die übrigen Vampire sind nichts anderes als seine Lakaien – wir müssen ihm einen Eid leisten, unsere Treue schwören, so was halt. Er hat sogar einen schicken Titel.«
Sie sah mit gerunzelter Stirn hoch.
»Er ist mein ›Lehnsherr‹.«
Mallory versuchte mit wenig Erfolg, ein Kichern zu unterdrücken – das sich irgendwie sehr abgewürgt und kraftlos anhörte –, bevor sie sich wieder ihrem Magazin widmete. »Du musst ›Darth Vader‹ Sullivan deinen ›Lehnsherren‹ nennen?«
Ich grinste. »Nur, wenn ich von ihm eine Antwort erwarte.«
Sie schnaubte. »Was noch?«