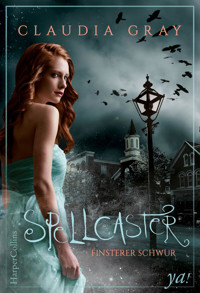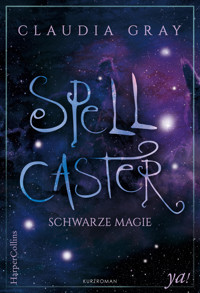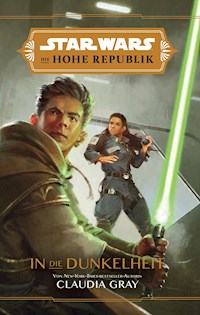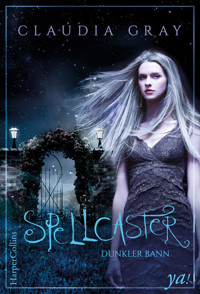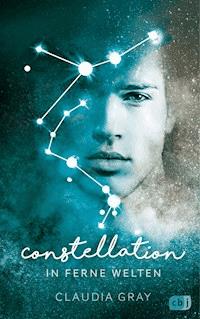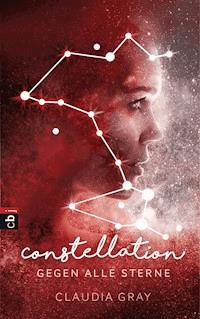
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Constellation-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er ist programmiert, sie zu töten. Sie ist bereit, ihn zu vernichten. Bis sie sich näher kommen als gedacht …
Noemi ist bereit zu sterben, um ihren Planeten gegen die Erde zu verteidigen. Als sie in einem verlassenen Raumschiff nach Hilfe für ihre schwer verletzte Freundin sucht, trifft sie auf Abel, die perfekteste künstliche Intelligenz, die je entwickelt wurde. Er ist programmiert, sie zu töten. Gleichzeitig aber muss Abel dem ranghöchsten Menschen an Bord gehorchen. So gelingt es Noemi, ihm das Geheimnis zu entlocken, das ihren Planeten retten kann. Dafür müsste sie Abel zerstören. Doch Abel sieht nicht nur aus wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Je näher sich die beiden auf der lebensgefährlichen Mission kommen, desto klarer wird Noemi: Er fühlt auch wie ein Mensch. Bald steht er längst nicht mehr nur aus programmiertem Gehorsam zu ihr. Aber ist er wirklich frei, alles für sie zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
CLAUDIA GRAY
GEGEN ALLE STERNE
Aus dem Amerikanischen von
Christa Prummer-Lehmair und
Heide Horn
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2017 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text © 2017 Amy Vincent
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Defy the Stars« bei Little, Brown and Company
in der Verlagsgruppe Hachette Book Group, Inc, New York.
Der Name von Little, Brown ist eine eingetragene Handelsmarke
von Hachette Book Group, Inc.
This edition was published by arrangement with
Little, Brown and Company, New York, New York, USA.
All rights reserved.
Übersetzung: Christa Prummer-Lehmair und Heide Horn
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock
(Yuriy Mazur, Anton Zabielskyi)
kk · Herstellung: AJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-19398-0V002
www.cbj-verlag.de
Für meine Eltern
1
In drei Wochen wird Noemi Vidal sterben – genau hier, an diesem Ort.
Heute ist es nur eine Übung.
Noemi würde gerne beten wie die anderen Soldaten ringsum. Das sanfte An- und Abschwellen ihrer flüsternden Stimmen klingt wie der Wellenschlag am Strand. In der Schwerelosigkeit wirkt es sogar so, als befänden sie sich unter Wasser – ihr Haar steht fächerartig vom Kopf ab, ihre gestiefelten Beine baumeln von den Sitzen, als würden sie in der Brandung treiben. Nur das dunkle Sternenfeld draußen vor den wenigen kleinen Fenstern verrät, wie weit weg von zu Hause sie sind.
Die Soldaten um sie herum gehören den unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften an. Die meisten Anhänger der Buchreligionen sitzen nah beieinander: Die Juden halten einander an den Händen; den Muslimen hat man eine Ecke zugewiesen, in der sie besser in Richtung Mekka beten können, von hier aus nur ein weit entfernter Punkt am Himmel. Wie die anderen Mitglieder der Zweiten Katholischen Kirche hält Noemi ihren Rosenkranz in der Hand, das kleine, aus Stein gemeißelte Kruzifix schwebt neben ihrem Gesicht. Sie umfasst ihn fester und wünschte, sie würde sich nicht so leer fühlen. So klein. Würde nicht so verzweifelt am Leben hängen, mit dem sie bereits abgeschlossen hat.
Jeder einzelne Teilnehmer hat sich freiwillig gemeldet und doch ist keiner wirklich bereit zu sterben. Hier im Innern des Truppentransporters scheint die Luft vor erbitterter Entschlossenheit zu knistern.
Zwanzig Tage, ruft Noemi sich in Erinnerung. Mir bleiben noch zwanzig Tage.
Das ist kein großer Trost. Und so wirft sie einen Blick quer über die Reihe zu ihrer besten Freundin, die nicht zur Kampftruppe gehört und nur mit von der Partie ist, um potenzielle Flugrouten für die Masada-Offensive zu ermitteln, und nicht, um dabei zu sterben. Esther Gatson hält die Augen in inbrünstigem Gebet geschlossen. Wenn Noemi auch so beten könnte, hätte sie vielleicht nicht solche Angst. Esthers lange, goldblonde Haare sind zu dicken Zöpfen geflochten und hochgesteckt, sodass sie ihren Kopf wie ein Heiligenschein umrahmen, und Noemi spürt, wie sie von neuem Mut erfüllt wird.
Ich tue das für Esther. Wenn ich schon sonst niemanden retten kann, dann wenigstens sie.
Jedenfalls für eine Weile.
Die meisten der neben Noemi festgeschnallten Soldaten sind zwischen sechzehn und achtundzwanzig. Noemi ist erst siebzehn. Ihre Generation dezimiert sich selbst.
Und die Masada-Offensive wird ihr größtes Opfer werden.
Es ist ein Himmelfahrtskommando – auch wenn niemand von Selbstmord sprechen will. Hundertfünzig Schiffe werden gleichzeitig zuschlagen, alle auf dasselbe Ziel. Hundertfünfzig Schiffe werden sich selbst in die Luft jagen. Noemi wird eines davon fliegen.
Die Masada-Offensive wird den Krieg nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Aber sie wird Genesis Zeit erkaufen. Ihr Leben gegen Zeit.
Nein. Erneut sieht Noemi zu Esther. Dein Leben für ihres.
In den vergangenen Jahren sind Tausende in diesem Krieg gefallen und ein Sieg ist nicht in Sicht. Das Raumschiff, auf dem sie sich befinden, ist fast vierzig Jahre alt, somit eines der neuesten in der Genesis-Flotte. Aber jeder auch nur flüchtige Blick zeigt Noemi einen weiteren Mangel: die geflickte Stelle, die auf einen Riss im Rumpf hindeutet, die zerkratzten Fensterscheiben, die die Sterne draußen verschwommen erscheinen lassen, und die abgenutzten Gurte, mit denen sie und ihre Mitstreiter auf ihren Sitzen angeschnallt sind. Sie müssen sogar den Einsatz künstlicher Schwerkraft begrenzen, um Energie zu sparen.
Das ist der Preis, den Genesis für seine intakte Umwelt bezahlt, für die Gesundheit und Kraft jedes Lebewesens in ihrer Welt. Genesis stellt nichts Neues her, solange es noch etwas Altes gibt, was funktioniert. Der Schwur, die industrielle und handwerkliche Produktion zu drosseln, hat ihrer Gesellschaft mehr Gewinn als Schaden gebracht – zumindest war das so, bis der Krieg wieder aufflammte, Jahre nachdem sie sämtliche Rüstungsbetriebe geschlossen und den Bau neuer Raumjäger eingestellt hatten.
Vor über drei Jahrzehnten schien der Befreiungskrieg beendet zu sein, und natürlich hatten sie darauf vertraut, dass ihr Sieg von Dauer sein würde. Ihr Planet hatte angefangen, abzurüsten. Die Kriegswunden waren noch nicht verheilt; das weiß kaum jemand besser als Noemi. Aber sogar sie hatte, wie jeder andere, geglaubt, dass sie wirklich in Sicherheit lebten.
Vor zwei Jahren war der Feind dann zurückgekehrt. Seitdem hat Noemi gelernt, Waffen abzufeuern und einen Einmann-Raumjäger zu fliegen. Sie hat gelernt, Freunde zu betrauern, die noch Stunden zuvor an ihrer Seite kämpften. Sie hat gelernt, wie es ist, zum Horizont zu schauen, Rauch zu sehen und zu wissen, dass von der nächstgelegenen Stadt nur noch Trümmer übrig sind.
Sie hat gelernt zu kämpfen. Als Nächstes muss sie lernen zu sterben.
Die feindlichen Schiffe sind neu. Ihre Waffen sind schlagkräftiger. Und ihre Soldaten sind nicht einmal aus Fleisch und Blut. Stattdessen haben sie mechanische Armeen: Roboter in Menschengestalt, aber ohne Gnade, ohne Schwachstellen, ohne Seelen.
Was für Feiglinge ziehen in den Krieg und kämpfen dann nicht mal selbst?, denkt Noemi. Wie schlecht muss man sein, um die Bewohner eines anderen Planeten zu töten, ohne das Leben der eigenen Leute zu riskieren?
Das heute ist nur ein Übungslauf, ruft sie sich ins Gedächtnis. Keine große Sache. Du fliegst deinen Einsatz, bringst ihn hinter dich, damit du, wenn der Tag X kommt, auch wenn du noch so viel Angst hast, in der Lage bist –
Das Blinken der orangefarbenen Lämpchen in jeder Reihe warnt die Soldaten, dass in Kürze die künstliche magnetische Schwerkraft einsetzt. Es kommt zu früh. Die anderen Soldaten wechseln besorgte Blicke, Noemi hingegen ist von der nahenden Gefahr wie elektrisiert. Sie hält sich bereit und holt tief Luft.
Rumms! Hunderte Füße knallen gleichzeitig auf den Metallboden. Noemis Haar, das von einem gepolsterten Haarreif aus dem Gesicht gehalten wird, fällt ihr bis zum Kinn. Sofort ist sie im Kampfmodus, löst den Gurt und greift nach ihrem Helm. Sie spürt wieder das Gewicht ihres dunkelgrünen Exosuits, doch er ist anschmiegsam und ebenso bereit für die Schlacht wie sie.
Wie es klingt, steht ihnen nämlich eine Schlacht bevor.
»Alle Krieger in ihre Jäger!«, schreit Captain Baz. »Die Sensoren melden, dass jeden Moment Schiffe durch das Tor eindringen werden. Start in fünf Minuten!«
Ihre Todesangst verflüchtigt sich und ihr Kampfinstinkt gewinnt die Oberhand. Noemi reiht sich in die Schlange der Soldaten ein, die sich in Staffeln aufteilen und über die schmalen Korridore zu ihren jeweiligen Raumjägern eilen.
»Warum sind die hier?«, murmelt ein rundgesichtiger Kämpfer direkt vor ihr, ein Neuling, während sie durch einen Tunnel mit fehlenden Paneelen und bloß liegenden Leitungen hasten. Unter seinen Sommersprossen ist er leichenblass geworden. »Wissen die, was wir vorhaben?«
»Sie haben uns noch nicht in die Luft gejagt, oder?«, erklärt Noemi. »Also haben sie keine Ahnung von der Masada-Offensive. Ein Glück, dass wir gerade hier oben sind, wo sie kommen, so können wir sie an einem Ort abwehren, der noch weit von zu Hause entfernt ist. Okay?«
Der arme Kerl nickt. Er schlottert am ganzen Leib. Noemi würde gerne etwas Tröstlicheres sagen, aber es würde wahrscheinlich nicht echt klingen. Sie hat eine raue Schale, versteckt ihr Herz so gut hinter ihrem hitzigen Gemüt, dass fast niemand merkt, dass sie eines hat. Manchmal wünschte sie, sie könnte ihr Innerstes nach außen kehren. Dann würden die Menschen zuerst das Gute in ihr sehen, bevor sie das Schlechte bemerkten.
Der Kampf bringt ihre schlechte Seite zum Vorschein und da ist es sogar etwas Positives. Wie dem auch sei, es hat nicht viel Sinn, ausgerechnet jetzt an sich zu arbeiten.
Esther, die direkt vor dem Jungen geht, dreht sich um und lächelt ihn an. »Das wird schon«, verspricht sie ihm mit ihrer sanften Stimme. »Wirst sehen. Sobald du im Raumjäger sitzt, spulst du das ab, was du in der Ausbildung gelernt hast, und fühlst dich so tapfer wie nie zuvor.« Er lächelt zurück, schon ein wenig beruhigt.
Als Noemis Eltern gestorben waren, hasste sie die Welt für ihre Existenz, hasste die anderen Menschen dafür, dass sie nicht ebenso litten wie sie, und hasste sich selbst dafür, dass sie noch lebte und atmete. So nett es von den Gatsons gewesen war, sie aufzunehmen, entgingen Noemi doch nicht die Blicke, die Esthers Eltern wechselten – ihre Verärgerung darüber, dass sie so viel für jemanden taten, der dies weder schätzen konnte noch wollte. Erst nach Jahren konnte Noemi eine gewisse Dankbarkeit empfinden oder überhaupt etwas anderes als Wut und Bitterkeit.
Bei Esther hingegen fühlte sie sich nie schlecht. Schon in der schlimmen Anfangszeit hatte Esther, obwohl sie beide damals erst acht Jahre alt gewesen waren, es verstanden, ihre Freundin nicht mit dem billigen Trost abzuspeisen, dass ihre Eltern in ihrer Erinnerung weiterlebten oder dass es Gottes Wille gewesen sei. Sie hatte gewusst, dass Noemi einfach jemanden brauchte, der für sie da war und nichts von ihr wollte, sondern ihr das Gefühl gab, nicht allein zu sein.
Wie kommt es nur, dass davon nichts auf mich abgefärbt hat?, denkt Noemi, als sie durch die letzten Korridore eilen. Vielleicht hätte sie Esther bitten sollen, es ihr beizubringen.
Esther schert aus, lässt den verängstigten Jungen vorbei, um neben Noemi herzulaufen, und wendet sich sofort an ihre Freundin: »Mach dir keine Sorgen.«
Zu spät. »Du hast heute keinen Raumjäger. Nur einen Aufklärer. Mit dem Ding kannst du nicht an der Schlacht teilnehmen; du solltest uns nur von hier aus überwachen. Gib Captain Baz Bescheid.«
»Was glaubst du, wird sie sagen? Dass ich hierbleiben und stricken soll? Späher können während eines Gefechts viele wertvolle Informationen übermitteln.« Esther schüttelt den Kopf. »Du kannst mich nicht aus jedem Kampf heraushalten, weißt du.«
Nein, nur aus dem schlimmsten. »Wenn du hier oben verletzt wirst, werden mich deine Eltern umbringen, das heißt, falls Jemuel mich nicht zuvor in die Finger bekommt.«
Jedes Mal, wenn Noemi Jemuel erwähnt, geht in Esthers Gesicht eine Veränderung vor: Ihre Wangen röten sich vor Freude, und sie presst die Lippen aufeinander, um ein Lächeln zu unterdrücken. Ihre Augen jedoch wirken so betrübt, als sähe sie Noemi verwundet und blutend auf dem Boden liegen. Früher einmal hatte sich Noemi über diesen Anblick gefreut – zu wissen, dass Esther Noemis Kummer ebenso am Herzen lag wie ihr eigenes Glück –, aber jetzt irritiert es sie nur. Esther antwortet bloß: »Noemi, es ist meine Pflicht, da draußen zu sein. Genauso wie deine. Also hör auf.«
Wie üblich hat Esther recht. Noemi holt tief Luft und beschleunigt ihren Schritt.
Ihre Division erreicht den Abflugbereich – eine Reihe kleiner Einmann-Raumjäger, so schlank und stromlinienförmig wie Pfeile. Noemi springt auf ihren Pilotensitz. Quer durch den Raum sieht sie Esther dasselbe tun, so zielstrebig, als könnte sie tatsächlich kämpfen. Während sich das durchsichtige Cockpit über Noemi schließt und sie ihren Helm festschnallt, wirft Esther ihr einen Blick zu, einen von der Sorte: Hey, ich bin dir nicht wirklich böse, das weißt du, oder? Diesen Blick beherrscht sie gut, besonders für jemanden, der fast nie aus der Haut fährt.
Noemi antwortet wie üblich mit einem Lächeln, einem von der Sorte: Alles bestens. Sie ist wahrscheinlich nicht gut darin, weil sie es außer Esther nie jemandem zeigt.
Aber Esther grinst. Sie hat es verstanden. Das genügt.
Das Paneel der Abflugrampe beginnt sich zu öffnen und setzt die Jagdstaffel der kalten Dunkelheit des Weltalls in der entlegensten Region ihres Sonnensystems aus. Genesis ist kaum mehr als ein schwach grüner Punkt in der Ferne; die Sonne, unter der Noemi geboren wurde, dominiert zwar immer noch den Himmel, aber von hier aus wirkt sie kleiner als jeder der Monde ihres Planeten von dessen Oberfläche aus. In diesem ersten Moment, in dem Noemi nichts anderes erblickt als ein unendliches Sternenmeer, ist es wunderschön – mehr als das –, und sie empfindet einen solchen Schauder, als sähe sie es zum ersten Mal.
Und wie immer regt sich ihr geheimster, selbstsüchtigster Wunsch: Wenn ich das alles doch nur erforschen könnte …
Dann ist das Paneel ganz geöffnet und gibt den Blick auf das Genesis-Tor frei.
Das Tor ist ein riesiger, mattsilberner Ring aus miteinander verzahnten Komponenten, Dutzende Kilometer im Durchmesser. Innerhalb des Rings nimmt Noemi einen schwachen Schimmer wahr, wie bei einer Wasseroberfläche, wenn es fast zu dunkel für eine Reflexion ist, aber nicht ganz. Auch das ein wunderschöner Anblick, wenn es nicht die größte Bedrohung für die Sicherheit von Genesis darstellen würde. Jedes Tor stabilisiert das eine Ende einer Singularität – eine Abkürzung durch die Raumzeit, die es einem Schiff erlaubt, in einem einzigen Augenblick durch die halbe Galaxie zu reisen. Auf diesem Weg dringt der Feind zu ihnen; dort nehmen all die Schlachten ihren Anfang.
In der Ferne kann Noemi noch Zeugnisse einiger dieser vergangenen Schlachten ausmachen – Schrott von Schiffen, die vor langer Zeit in Stücke gerissen wurden. Zum Teil sind es nur noch Metallsplitter, zum Teil auch riesige verbogene Platten oder sogar ganze zerbombte Raumschiffe. Diese Bruchstücke schweben gemächlich in einer Umlaufbahn, die von der Anziehungskraft des Tors bestimmt wird.
Doch sie sind kaum von Belang verglichen mit den dunkelgrauen Schemen, die aus dem Tor herausrasen und in ihr System eindringen. Das sind die Schiffe des Feindes, jenes Planeten, der entschlossen ist, Genesis zu erobern und sich dessen Land und Ressourcen für immer einzuverleiben:
Die Erde.
Sie haben ihre eigene Welt vergiftet. Haben Genesis kolonisiert, nur um Milliarden von Menschen hier anzusiedeln und auch diesen Planeten zu vergiften. Aber nachhaltig lebende Welten sind rar und kostbar. Sie sind heilig. Sie müssen geschützt werden.
Die Signallämpchen blinken. Noemi entriegelt ihre Andockklammern und hört über ihr Helmmikrofon Captain Baz’ Aufforderung an ihre Staffel: »Und raus!«
Klammern lösen: bestätigt. Noemis Schiff hat sich aus seiner Verankerung gelöst und schwebt schwerelos. Die anderen steigen neben ihr auf, alle bereit für den Kampf. Ihre Hände bewegen sich zu der bunten Instrumententafel vor ihr. Sie kennt jeden Knopf und jeden Schalter in- und auswendig, versteht, was jedes Lämpchen bedeutet. Systemanzeigen normal: bestätigt.
Zündung: bestätigt.
Ihr Jäger schießt nach vorne, ein silberner Komet in der Schwärze des Raums. Das Schimmern im Tor wird heller, wie bei einem Stern, der sich zu einer Supernova entwickelt – eine Warnung, dass noch mehr Streitkräfte von der Erde unterwegs sind.
Ihre Hände verstärken den Griff um die Steuerung, während sie zusieht, wie im Tor grelles Licht aufflammt und Schiffe hindurchbrechen, eins nach dem anderen.
»Wir haben fünf – nein, sieben Schiffe der Damokles-Klasse identifiziert!«, informiert Captain Baz über Funk. »Sie rechnen nicht mit uns. Nutzt es aus!«
Noemi beschleunigt, ihr silberner Jäger steuert auf das am weitesten entfernte Damokles-Schiff zu. Diese langen, flachen, kastenförmigen Schiffe müssen keine künstliche Schwerkraft oder umfangreiche Lebenserhaltungssysteme mit sich führen, weil sie nicht zum Transport von Menschen gedacht sind. Stattdessen kann jedes Damokles-Schiff je nach Größe von einem Dutzend bis zu hundert Mechs transportieren, jeder Einzelne schwer bewaffnet, auf Kampf programmiert und bereit zu töten.
Mechs haben keine Angst zu sterben, weil sie nicht wirklich leben. Sie haben keine Seelen. Sie sind reine Killermaschinen.
Das pure Böse.
Noemi kneift die Augen zusammen, als sie sieht, wie sich die ersten Luken öffnen. Gott sei Dank handelt es sich um kleinere Schiffe, aber sie haben trotzdem eine mächtige Mech-Streitmacht an Bord. Wenn sie nur eines oder zwei Damokles-Schiffe pulverisieren könnte, bevor sie ihre tödliche Fracht entladen …
Zu spät. Die Mechs schießen heraus, ihre metallenen Exoskelette haben gerade genug Ummantelung, dass die Roboterkrieger darin im eiskalten Weltall nicht erfrieren. Während sich die Genesis-Kämpfer nähern, verändern die Mechs ihre Position. Sie spreizen die Glieder weit aus, um ihre Reichweite zu vergrößern, wie Raubtiere beim Sprung auf die Beute. So lange Noemi schon kämpft, so hart sie auch trainiert hat, dieser Anblick lässt sie immer noch zittern.
»Angriffssequenz – jetzt!«, ruft Baz, und Kampfschreie dringen durch Noemis Helm. Noemi dreht ihren Jäger scharf nach links und wählt ihr erstes Ziel aus.
Über die Funkanlage ruft einer: »Macht sie fertig!«
Blasterstrahlen zischen durch die Luft auf Noemi zu, feurige orangefarbene Streifen, die einen Raumjäger in Sekundenschnelle kampfunfähig machen können. Sie legt sich nach links in Schräglage und feuert zurück. Überall um sie herum stieben Genesis-Kämpfer und Mechs von der Erde auseinander, lösen sich Schlachtordnungen im Kampfgetümmel auf.
Wie die meisten Bewohner von Genesis glaubt Noemi an Gott. Auch wenn sie manchmal Fragen und Zweifel hat, die die Ältesten nicht beantworten können, weiß sie um den Wert des Lebens und die Bedeutung von Frieden. Zwar sind die Dinge, die sie vom Himmel schießt, nicht wirklich lebendig, aber sie haben … eine menschliche Gestalt. Der Blutrausch, der in ihr entfacht wurde, fühlt sich falsch an, und das wird auch durch all ihre rechtschaffene Wut nicht besser. Aber sie beißt sich durch. Sie muss, für ihre Mitsoldaten und für ihre Welt.
Noemi weiß, worin ihre Pflicht im Augenblick besteht:
Kämpfen auf Teufel komm raus.
2
Während Abel in der Schwerelosigkeit schwebt, in der dunklen Stille der Versorgungsschleuse eines verlassenen Schiffs, erzählt er sich wieder einmal die Geschichte. Die Schwarz-Weiß-Bilder flackern absolut exakt durch sein Gehirn, als wären sie vor ihm auf eine Leinwand projiziert, so, wie man sie vor Jahrhunderten gezeigt hat. Abel besitzt ein fotografisches Gedächtnis, er muss Dinge nur ein einziges Mal sehen, um sie sich für immer zu merken.
Und er mag es, sich an Casablanca zu erinnern. Sich jede einzelne Szene in genau der richtigen Reihenfolge immer wieder aufs Neue zu erzählen. Die Stimmen der Figuren sind in seinem Kopf so lebendig, als würden die Schauspieler neben ihm in der Versorgungsschleuse schweben.
Wo warst du letzte Nacht?
Das ist so lange her, ich erinnere mich nicht.
Es ist eine gute Geschichte, eine, die sich durch die Wiederholung nicht abnutzt. Zum Glück für Abel, denn er sitzt nun seit fast dreißig Jahren in der Dädalus fest. Ungefähr fünfzehn Millionen siebenhundertsiebzigtausendneunhundert Minuten oder neunhundertsechsundvierzig Millionen siebenhunderttausend Sekunden.
(Er wurde darauf programmiert, so große Zahlen außerhalb der rein wissenschaftlichen Tätigkeit abzurunden. Dieselben Menschen, die ihn befähigt haben, mit absoluter Präzision zu messen, finden solche Zahlen nämlich gleichzeitig irritierend. Für Abel ist das absurd, aber von Menschen erwartet er ohnehin kein rationales Verhalten.)
In der nahezu völligen Dunkelheit seiner eingeengten Behausung kann Abel sich leicht vorstellen, dass die Realität so schwarz-weiß ist wie der Film.
Neuer Input. Form: irreguläre Lichtblitze. Die dramatische Szene in Abels Kopf wird jäh unterbrochen, als er aufblickt, um zu analysieren, was –
Blasterstrahlen. Ganz ohne Zweifel ist eine Schlacht zwischen Streitkräften der Erde und Genesis im Gange.
In genau solch einer Schlacht ist Abel hier gestrandet. Nach einer langen Ruhepause ist der Krieg in den vergangenen zwei Jahren wieder aufgeflammt. Zunächst fand er das vielversprechend. Wenn wieder Schiffe von der Erde das Genesis-System ansteuerten, würden sie die Dädalus irgendwann finden. Sie würden sie ins Schlepptau nehmen und alles, was sich darin befand, zurückholen, einschließlich Abel.
Und nach dreißig schrecklichen Jahren der Ungewissheit wäre Abel endlich in der Lage, seine oberste Direktive auszuführen: Burton Mansfield zu schützen.
Ehre den Schöpfer. Gehorche seinen Befehlen vor allen anderen. Schütze sein Leben um jeden Preis.
Doch seine Hoffnungen sind geschwunden, je länger der Krieg tobt. Niemand ist gekommen, um ihn zu suchen, und daran scheint sich auch in naher Zukunft nichts zu ändern. Vielleicht nicht einmal in ferner Zukunft. Obwohl Abel stärker als jeder Mensch ist und es sogar mit den leistungsfähigsten Kampf-Mechs aufnehmen kann, schafft er es nicht, die Luftschleusentür zu öffnen, die ihn vom Rest der Dädalus trennt. (Er hat es versucht. Zwar weiß er bis auf die hundertste Dezimalstelle genau, wie schlecht seine Chancen stehen, aber Abel hat es trotzdem versucht. Dreißig Jahre sind eine lange Zeit.)
Bestimmt hatte man weder Abel noch dieses Schiff leichtfertig aufgegeben. Abel ist die unterschiedlichen Szenarien viele Male durchgegangen, aber er kann es einfach nicht nachvollziehen. Möglicherweise war Mansfield geflohen, um seine eigene Haut zu retten, mit der Absicht, später zurückzukehren und Abel zu holen, was er dann jedoch nicht schaffte. Andererseits hatte die Schlacht an jenem Tag so heftig getobt, dass ein Entkommen von der Dädalus für einen Menschen schier unmöglich gewesen war. Höchstwahrscheinlich wurde Mansfield am selben Tag von den feindlichen Truppen getötet, als Abel hier eingeschlossen wurde.
Andererseits, Mansfield ist ein Genie, der Schöpfer aller sechsundzwanzig Mech-Modelle, die derzeit der Menschheit dienen. Wenn überhaupt jemand einen Weg gefunden hatte, jene letzte Schlacht zu überleben, dann Mansfield.
Natürlich könnte Abels Schöpfer inzwischen auch gestorben sein. Vor dreißig Jahren war er im reifen Mannesalter gewesen und Menschen stoßen manchmal Unfälle zu. Vielleicht ist das der Grund, warum er nicht gekommen ist. Ganz bestimmt hätte Mansfield sich nur durch seinen Tod davon abhalten lassen.
Es gibt noch eine Möglichkeit. Es ist die am wenigsten wahrscheinliche von allen vorstellbaren Optionen, aber trotzdem nicht ausgeschlossen: Mansfield befindet sich vielleicht noch an Bord, im Kryoschlaf. Die Kryokammern in der Krankenstation könnten einen Menschen mit minimalen Lebenserhaltungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit am Leben erhalten. Die darin liegende Person wäre bewusstlos, würde weniger als ein Zehntel so schnell altern wie normal und auf einen Retter warten, der sie aufwecken würde.
Abel müsste es nur irgendwie dorthin schaffen.
Bevor er Mansfield finden kann, muss allerdings erst jemand ihn finden. Bisher haben die Streitkräfte der Erde keine Zeit darauf verwendet, das Trümmerfeld nach funktionierenden Schiffen abzusuchen. Niemand hat Abel aufgespürt; es hat nicht einmal jemand versucht.
Eines Tages, sagt er sich. Der Sieg der Erde ist unausweichlich, ob in zwei Monaten oder zweihundert Jahren. Es ist durchaus vorstellbar, dass Abel so lange lebt.
Mansfield hingegen wäre bis dahin tot. Vielleicht wird nach so vielen Jahren sogar Casablanca irgendwann langweilig …
Abel neigt den Kopf, späht aufmerksamer auf das kleine Stück Sternenfeld, dass er durch das Schleusenfenster erkennen kann. Einen Augenblick später fasst er an die nächstliegende Wand und stößt sich ab, um dichter an die Scheibe zu gelangen. In dem ultradicken Glas muss er durch sein eigenes transparentes Spiegelbild schauen, sein kurzes goldblondes Haar umrahmt seinen Kopf wie ein Fächer, sodass es aussieht wie in einer mittelalterlichen Handschrift, als hätte er einen Goldrand.
Diese Schlacht rückt näher an die Dädalus heran als jede andere zuvor. Einige Raumjäger haben bereits den Rand des Trümmerfelds erreicht; wenn die Erdstreitkräfte weiterhin die Genesis-Truppen voneinander isolieren, werden bald ein paar der Mechs diesem Schiff sehr nahe kommen.
Sehr, sehr nahe.
Er sollte sich überlegen, wie er ein Signal abgeben kann. Es müsste eine technisch simple Lösung mit einem sehr einfachen Signal sein. Aber Abel muss ja keine Informationen an einen Menschen übermitteln und braucht sich daher auch keine Gedanken über die Begrenzungen eines biologischen Gehirns zu machen. Schon ein winziges Muster inmitten des Chaos würde vielleicht die Aufmerksamkeit eines anderen Mechs erregen – und wenn dieser die Möglichkeit hat, dem nachzugehen, wird seine Programmierung ihn dazu zwingen, es zu tun.
Abel stößt sich von der Wand ab, um sich durch die Schleuse zu bewegen. Nach dreißig Jahren kennt er die wenigen Ausrüstungsgegenstände, die ihm hier zur Verfügung stehen, in- und auswendig, und nicht einer davon kann ihm helfen, das Schiff zu starten, die Schleusentür zu öffnen oder direkt mit einem anderen Schiff zu kommunizieren. Das heißt jedoch nicht, dass sie nutzlos sind.
In einer Ecke schwebt ein paar Zentimeter von der Wand entfernt eine einfache Taschenlampe.
Nützlich für Reparaturen, hatte Mansfield ihm erklärt und dabei gelächelt, sodass sich um seine blauen Augen Fältchen bildeten. Menschen sind nicht in der Lage, ein Raumschiff nur mit dem Bauplan im Kopf neu zu verkabeln. Nicht wie du, mein Junge. Wir müssen etwas sehen. Abel weiß noch, dass er zurücklächelte, stolz, dass er die schwächeren Menschen ersetzen und Mansfield besser dienen konnte.
Und doch könnte er nie Verachtung für die Menschheit empfinden, weil Mansfield ebenfalls ein Mensch war.
Abel schnappt sich die Taschenlampe und stößt sich erneut zum Fenster ab. Welche Botschaft soll er abschicken?
Keine Botschaft. Nur ein Signal. Hier ist jemand; jemand sucht Kontakt. Der Rest kann später folgen.
Abel hält die Taschenlampe ans Fenster. Er hat sie seit Jahrzehnten nicht benutzt und sie ist immer noch ausreichend geladen. Ein Lichtblitz. Dann zwei, drei, fünf, sieben, elf und so weiter, die ersten zehn Primzahlen. Er beabsichtigt, die Sequenz so oft zu wiederholen, bis ihn jemand bemerkt.
Oder bis die Schlacht zu Ende ist und er wieder für viele, viele Jahre allein ist.
Vielleicht sieht es ja jemand, denkt Abel.
Er sollte sich keine Hoffnungen machen. Nicht wie die Menschen. Aber in den vergangenen dreißig Jahren war sein Geist gezwungen, in die Tiefe zu gehen. Ohne neue Stimulationen von außen hat er über jede Information, jede Interaktion, jeden einzelnen Bestandteil seiner Existenz, bevor die Dädalus verlassen wurde, nachgedacht. Etwas in seinem Innenleben hat sich verändert und vielleicht nicht zum Besseren.
Denn Hoffnung kann wehtun, und trotzdem kann Abel nicht aufhören, aus dem Fenster zu schauen und sich verzweifelt zu wünschen, dass ihn jemand sieht, damit er nicht mehr allein ist.
3
»Feindliches Feuer!«, brüllt Captain Baz.
Noemi steuert scharf nach unten, schlängelt sich durch die verbogenen Metallüberreste soeben abgeschossener Mechs. Doch die Damokles-Schiffe spucken immer mehr davon aus – viel zu viele, als dass ihre Staffel damit fertigwerden könnte. Heute sind nur die Freiwilligen der Masada-Offensive im Einsatz, und auch nur für eine Übung. Sie hatten nicht geplant, einen Großangriff der Mechs abzuwehren, und das macht sich jetzt bemerkbar.
Die Mechs sind überall, ihre überdimensionalen Exoskelett-Angriffsmonturen fahren wie ein feuriger Meteorschauer zwischen die ramponierten Jäger ihrer Staffel. Im Anflug entfalten sich ihre Exoskelette, und sie verwandeln sich von metallverstrebten, scharfkantigen Pseudoschiffen in monströse metallgliedrige Kreaturen, fähig, die Linien von Genesis zu durchschlagen, als würden sie Papier durchstoßen.
Immer wieder zischt einer an ihrem Schiff vorbei, und Noemi erhascht einen Blick auf den Roboter selbst – die Maschine innerhalb der Maschine. Sie sehen aus wie Menschen, weshalb es Neulingen manchmal schwerfällt, zu schießen. In ihrem ersten Feuergefecht zögerte sie selbst, als sie den Blick auf etwas erhaschte, das wie ein Mann Mitte zwanzig aussah, mit tiefbrauner Haut und schwarzem Haar genau wie sie selbst; er hätte ihr Bruder sein können, wenn Rafael nicht schon als Baby gestorben wäre.
Dieses sehr menschliche Zögern hätte sie an jenem Tag fast das Leben gekostet. Mechs zögern nicht. Sie wollen immer töten.
Seitdem hat sie Dutzende Male genau in dasselbe Gesicht gestarrt. Es ist ein Charlie, das weiß sie jetzt. Männlicher Standardkämpfer, unbarmherzig und unermüdlich.
»Die Standardproduktion umfasst fünfundzwanzig Modelle«, hatte der Älteste Darius Akide erklärt, als er zum ersten Mal vor ihrer Klasse stand. »Der Name jeder Reihe beginnt mit einem anderen Buchstaben des Alphabets, von Baker bis Zebra. Bis auf zwei sehen alle Modelle vollkommen menschlich aus. Und jedes ist stärker, als der Mensch jemals sein kann. Man hat ihnen gerade genug Intelligenz einprogrammiert, dass sie ihre Kernaufgaben bewältigen können. Bei Arbeits-Mechs ist das nicht viel. Aber wie sieht es bei den Kämpfern aus, die sie uns auf den Hals hetzen? Die sind clever. Verdammt clever. Mansfield hat nur auf die höheren Intelligenzniveaus verzichtet, mit denen es ihnen möglich gewesen wäre, so etwas wie ein Bewusstsein zu entwickeln.«
Noemis Augen weiten sich, als ihr Taktik-Bildschirm aufleuchtet. Sie verstärkt den Griff um die Auslöser der Waffen und feuert, sobald der Mech in ihre Reichweite kommt. Den Bruchteil einer Sekunde lang sieht sie das Gesicht dieses Dings – Queen, weibliche Standardkämpferin –, bevor das Exoskelett samt Mech birst. Übrig bleiben nur Metallsplitter. Gut.
Wo ist Esther? Seit einigen Minuten fliegen sie nicht mehr in Sichtweite voneinander. Noemi würde sie gern anfunken, aber sie weiß, dass man während einer Schlacht keine Privatgespräche über die Kommunikationsanlage führen soll. Sie kann nur die Augen offen halten.
Wie soll ich hier jemanden finden?, fragt sie sich, während sie im Sturzflug über weitere Mechs hinwegfegt und dabei feuert, was ihre Waffen hergeben. Das Gegenfeuer ist so erbittert, dass der schwarze Weltraum kurzzeitig strahlend weiß aufleuchtet. Die Invasionstruppen werden immer zahlreicher. Die Erde wird immer kühner. Sie werden niemals Ruhe geben, niemals.
Die Masada-Offensive ist wirklich unsere einzige Hoffnung.
Sie muss an den verängstigten Jungen denken, der zitterte, als die Soldaten zu ihren Jägern rannten. Auch sein Rufzeichen ist schon seit einer Weile nicht mehr auf ihrem Bildschirm erschienen. Ist er verschollen? Tot?
Und Esther – Aufklärer sind so gut wie wehrlos …
Schließlich tritt eine kurze Gefechtspause ein, und Noemi hat Gelegenheit, Ausschau nach Esthers Schiff zu halten. Als sie es entdeckt, wird sie von einem jähen Hochgefühl erfasst – es ist intakt, Esther lebt –, doch gleich darauf runzelt Noemi die Stirn. Was hat Esther so weit da drüben zu suchen?
Dann wird Noemi bewusst, was sie da eigentlich vor sich sieht. Das Entsetzen jagt Adrenalin durch ihre Adern.
Einer der Mechs hat sich von der Schlacht abgewandt. Einfach die Kampfhandlungen verlassen. Sie hat noch nie erlebt, dass ein Mech so etwas tut, und er steuert auf das Trümmerfeld in der Nähe des zerstörten Tors zu. Hat er eine Funktionsstörung? Egal. Aus irgendeinem Grund hat Esther entschieden, dem dummen Ding zu folgen – wahrscheinlich um nachzuforschen, was er vorhat. Aber jetzt ist sie von den Genesis-Truppen abgeschnitten, die sie beschützen könnten. Wenn der Mech findet, wonach er sucht, oder von seinem Damokles-Schiff zurückgepfiffen wird, wird er Esther im Handumdrehen angreifen.
Noemis Soldatenpflicht erlaubt es ihr, einen Kampfgenossen, der sich in extremer Gefahr befindet, zu verteidigen. Daher schwenkt sie nach links und beschleunigt so stark, dass sie in ihren Sitz gedrückt wird. Das grelle Feuergefecht um sie herum verblasst und schließlich hat sie wieder klare Sicht auf das All. Vor ihr ragt drohend das Genesis-Tor auf, umgeben von bewaffneten Plattformen. Jedes Schiff, das sich ohne die Signatur-Codes der Erde nähert, wird zerstört. Sogar quer durch die ganze Galaxie hinweg behält die Erde Genesis in ihrem Laserblick.
Während Noemi auf Esthers Standort zurast, verlässt sie sich immer weniger auf ihren Sensorbildschirm. Der Blick vom Cockpit aus zeigt ihr genug. Esthers Aufklärer schwirrt um den Mech herum und nutzt dabei Energieschübe der Sensoren, um den Mechanismus des Angreifers zu stören, was jedoch nicht viel bringt. Bisher gelingt es dem Mech meisterhaft auszuweichen. Offenbar steuert er auf eines der größeren Trümmerteile zu – nein, kein Trümmerteil, es ist ein verlassenes Raumschiff, irgendein Zivilfahrzeug. So ein Schiff hat Noemi noch nie gesehen: tropfenförmig, etwa von der Größe eines dreistöckigen Gebäudes und mit einer verspiegelten Oberfläche, die im Laufe der Jahre nur ein wenig matter geworden ist. Bis vor Kurzem muss es mit bloßem Auge kaum zu erkennen gewesen sein.
Hat der Mech vor, dieses Schiff zurück zur Erde zu bringen? Das Schiff ist offensichtlich verlassen, wirkt aber von hier aus nicht ernsthaft beschädigt.
Wenn die Erde es haben will, dann beabsichtigt Noemi, dies zu verhindern. Sie stellt sich vor, wie sie den Mech zerstört und dieses tropfenförmige Schiff für die Genesis-Flotte kapert. Vielleicht könnte man es mit Waffen bestücken und in ein Kriegsschiff verwandeln. Bei Gott, sie konnten noch eines gebrauchen.
Andererseits, dieser Mech ist eine Queen oder ein Charlie. Ihr und Esther steht eine teuflische Schlacht bevor.
Dann mal rein ins Vergnügen, denkt sie.
Im Anflug drosselt Noemi das Tempo. Esther und der Mech befinden sich fast innerhalb ihrer Schussweite …
… da wendet der Mech und ändert sein Ziel. Er streckt seine Exoskelett-Arme aus und umfasst Esthers Aufklärer wie eine Venusfliegenfalle, die sich um ein Insekt schließt. Ihrer Position nach muss sich der Mech direkt über Esther befinden, sodass die beiden sich in die Augen schauen können.
Waffen! Aber von hier aus kann Noemi nicht auf den Mech schießen, ohne gleichzeitig Esther zu treffen. In einer normalen Schlacht würde sie trotzdem feuern. Jeder Pilot, der sich auf diese Weise im Klammergriff befindet, ist so gut wie tot, und sie könnte wenigstens den Mech zerstören …
… aber hier geht es um Esther, bitte nicht sie, bitte …
Der Mech löst einen Arm, zieht ihn in einer verblüffend menschlichen Bewegung zurück und durchbohrt den Rumpf von Esthers Aufklärer.
Noemis Aufschrei gellt ohrenbetäubend in ihrem Helm. Das ist egal, sie muss nichts hören – sie muss Esther retten.
Zehn Minuten. Unsere Exosuits liefern uns Luft für zehn Minuten. Los, los, los, los …
Der Mech lässt von Esther ab, schwenkt auf das verlassene Schiff um, dann hält er inne und erfasst mit seinen Scannern endlich Noemi. Sie feuert, bevor er auch nur zielen kann.
Es gibt einen Lichtblitz, als der Mech explodiert und sich in Lametta verwandelt. Auf dem Weg zu Esther saust Noemi an seinen Überresten vorbei, Metallsplitter prallen klirrend gegen ihre Cockpit-Hülle.
Werden wir es rechtzeitig zurück zum Truppentransporter schaffen? Nein, nicht solange die Schlacht im Gange ist.Na gut. Dann eben dieses verlassene Schiff. Vielleicht kann ich das Lebenserhaltungssystem wieder aktivieren; falls nicht, gibt es dort bestimmt Sauerstoff, um Esthers Reserven aufzufüllen. Erste-Hilfe-Ausrüstung. Vielleicht sogar eine Krankenstation. Oh Gott, hoffentlich gibt es eine Krankenstation.
Sie hat das Gefühl, ins Nichts zu beten. An keinen Empfänger gerichtet. Aber selbst wenn Gott nicht mit ihr spricht, wird er ihr bestimmt um Esthers willen zuhören.
Noemis Visier beschlägt leicht. Sie muss unbedingt die Tränen zurückhalten, sonst werden sie in den Helm fließen und ihr im ungünstigsten Moment die Sicht rauben. Deshalb beißt sie sich in die Innenseite ihrer Backe, während sie im Sturzflug auf den zerstörten Aufklärer zusteuert. »Esther? Kannst du mich hören?«
Keine Antwort. Inzwischen hat Noemi den Funkbereich der anderen Genesis-Kämpfer verlassen. Falls Captain Baz ihre Abwesenheit überhaupt schon bemerkt hat, wird Noemis Notruf sie nicht erreichen, wird sie nicht wissen, dass sie Hilfe schicken muss. Vielleicht hat man sie beide schon abgeschrieben und hält sie für tot.
»Wir werden es schaffen«, verspricht Noemi Esther und sich selbst und manövriert ihren Jäger näher heran. Jetzt kann sie erkennen, wie schwer der Aufklärer beschädigt ist – das Metall ist zerfetzt –, aber Esthers Helm scheint noch intakt zu sein. Bewegt sie sich? Ja, denkt Noemi. Es kommt ihr so vor. Sie lebt. Sie wird durchkommen. Alles, was ich tun muss, ist, uns zu diesem Schiff zu bringen.
Sie betätigt einen Hebel und wirft damit die Ankerleine aus, deren Magnetklemme sich an den Rumpf von Esthers Aufklärer heftet. Rasch lässt Noemi den Blick über das verspiegelte Schiff vor ihnen gleiten. Dort – es gibt eine Andockstation.
Angetrieben durch Magnetsensoren fächern sich die Platten der runden Tür automatisch auf. Noemi könnte vor Dankbarkeit weinen.
Sie hatte immer den Eindruck, dass ihre Gebete kein Gehör finden, dass niemand da oben jemals ihre Bitten erhört hat. Aber Gott scheint doch zuzuhören.
4
Der Genesis-Jäger feuert auf das Queen-Modell und zerstört es, und Abel spürt, wie die Hoffnung ihn verlässt – eine fast physische Empfindung. Es ist, als ob sein inneres Gerüst zusammengebrochen wäre.
Ich muss bei nächster Gelegenheit eine vollständige Eigendiagnose durchführen.
Abel schwebt in der dunklen, kalten Schleusenkammer, nur ein Ausrüstungsstück von vielen. Schwerelos. Ziellos. Wie lange wird es dauern, bis seine Batterien erschöpft sind? Sie sind auf mindestens zweieinhalb Jahrhunderte Betriebsdauer ausgelegt … aber bei seinem geringen Energieverbrauch halten sie womöglich doppelt so lang. Oder noch länger. Es könnte mehr als ein halbes Jahrtausend vergehen, bevor aus Abel Metallschrott wird.
Er ist nicht dazu fähig, seinen eigenen Tod zu fürchten. Das lässt seine Programmierung nicht zu.
Aber Abel kann Hunderte Jahre Einsamkeit fürchten – ohne jemals zu erfahren, was aus Burton Mansfield geworden ist – ohne jemals wieder von Nutzen zu sein.
Kann ein Mech den Verstand verlieren? Gut möglich, dass Abel es herausfinden wird.
In diesem Moment jedoch sieht er, wie einer der Genesis-Jäger den anderen ins Schlepptau nimmt und durchstartet. Sind sie … kann es sein, dass …
Ja. Sie wollen an Bord der Dädalus kommen.
Das sind feindliche Truppen. Genesis-Krieger. Und somit eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit Burton Mansfields.
(Der vielleicht gar nicht mehr an Bord ist. Der unter Umständen schon vor Jahren gestorben ist. Doch während Abel diese Möglichkeiten einräumt, hat es für ihn immer noch oberste Priorität, jede Gefährdung von Mansfields Leben zu eliminieren – jede, und sei sie auch noch so gering.)
Das Genesis-Schiff steuert die Hauptlandebucht an. Abel ruft den Bauplan des Schiffs ab und sieht die Konstruktionszeichnungen der Dädalus wie auf einem Bildschirm vor sich. Er ist sie in den letzten dreißig Jahren häufig durchgegangen; Abel hat jede Information durchgekaut, die er jemals bekommen hat, um nicht der totalen Langeweile zu erliegen. Aber jetzt wirken die Pläne lebensechter, leuchten die gezeichneten Linien in seinem Kopf, als würden sie brennen.
Hauptlandebucht: Ebene eins. Zwei Ebenen unter meiner Versorgungsschleuse. Nach drei Jahrzehnten betrachtet Abel den Raum als seinen. Wenn die Genesis-Jäger an der Hauptlandebucht andocken, wird der unverletzte Pilot zweifellos versuchen, die Krankenstation zu erreichen, um seinem verletzten Kameraden zu helfen, überlegt Abel. Wäre das Hauptziel des Piloten Sicherheit und nicht Rettung, würde der Jäger schleunigst zur weit entfernten Genesis-Flotte zurückfliegen. In der Hauptlandebucht war zwar einmal ein Erste-Hilfe-Kasten deponiert, aber Abel weiß nicht, ob er sich noch dort befindet; selbst wenn, würde er wohl nicht viel helfen, um einen Schwerverletzten zu versorgen.
Um die Landebucht zu verlassen, wird der Genesis-Pilot den Notstrom aktivieren müssen. Sofern die Dädalus nicht allzu schwer beschädigt ist, lässt sich das von dort aus erledigen. Jeder ausgebildete Pilot sollte das innerhalb von Minuten, wenn nicht Sekunden hinbekommen.
Abel geht im Geist die Möglichkeiten durch, immer schneller und schneller. Das ist die erste neuartige Situation, mit der er seit dreißig Jahren konfrontiert wurde. Seine geistigen Fähigkeiten sind nach dieser langen Pause nicht geschrumpft. Im Gegenteil, er fühlt sich scharfsinniger denn je.
Doch jetzt kommt eine emotionale Komponente hinzu. Die Hoffnung hat sich zu etwas viel Prickelnderem entwickelt: gespannter Erwartung. Schon dass er etwas anderes als die Versorgungsschleuse sehen wird, ist aufregend …
… aber nichts ist so fantastisch wie das Wissen, dass er endlich in der Lage sein wird, nach Burton Mansfield zu suchen. Ihn zu finden. Ihn vielleicht sogar zu retten.
»Exzellent«, sagte Mansfield, als er die fertigen Puzzles begutachtete. »Deine Fähigkeit zur Mustererkennung ist erstklassig. Das hier hast du fast in Rekordzeit gelöst, Abel.«
Abel war zwar darauf programmiert, sich über Lob zu freuen, besonders, wenn es von Mansfield kam, aber er kannte auch Zweifel. »War meine Leistung angemessen, Sir?«
Mansfield machte es sich in seinem Ledersessel mit hoher Rückenlehne bequem und runzelte leicht die Stirn. »Du weißt sicher, dass Exzellenz schon per definitionem Angemessenheit beinhaltet, oder?«
»Ja, Sir! Natürlich, Sir.« Abel wollte bei Mansfield nicht den Eindruck hinterlassen, als wären seine Sprachdatenbanken nicht richtig hochgeladen. »Ich meinte nur – viele meiner Übungsleistungen haben alle bestehenden Rekorde gebrochen. Diese hier nicht.«
Nach einem Augenblick begann Mansfield zu kichern. »Sieh mal einer an. Deine Persönlichkeit hat sich anscheinend schon so weit entwickelt, dass du zum Perfektionisten geworden bist.«
»… Ist das gut, Sir?«
»Besser, als du denkst.« Mansfield stand auf. »Geh ein Stück mit mir spazieren, Abel.«
Burton Mansfields Büro befand sich in seinem Haus in London. Obwohl es erst vor Kurzem gebaut worden war und sich äußerlich nicht von den anderen verspiegelten Vielecken in dieser bewachten, privilegierten Wohnanlage auf dem Hügel unterschied, hätte es in seinem Innern genauso gut 1895 und nicht 2295 sein können. Auf den Parkettböden lagen handgewebte Seidenteppiche. In einer Ecke tickte trotz unzähliger Atomuhren in den Hightech-Geräten überall laut vernehmlich eine Standuhr mit einem hin- und herschwingenden Kupferpendel. Die Wände zierten Gemälde verschiedener alter Meister: ein Heiligenbild von Raffael, eine Suppendose von Andy Warhol. Und obwohl der offene Kamin und das Feuer darin nur eine Holografie waren, sorgte die Klimaanlage dafür, dass man das Gefühl hatte, als würde es tatsächlich brennen.
Mansfield war ein Mensch männlichen Geschlechts von durchschnittlicher Größe, mit goldbraunen Haaren und blauen Augen. Seine Gesichtszüge waren regelmäßig, sogar schön, wenn Abel die ästhetischen Prinzipien richtig verstanden hatte. (Er hoffte, dass dem so war, denn Mansfields jüngeres Gesicht hatte als Vorlage für Abels Aussehen gedient.) Selbst das Unperfekte in Mansfields Erscheinung war apart und aristokratisch – seine Geheimratsecken, die leichte Hakennase und die ungewöhnlich vollen Lippen. Er kleidete sich nach der heutigen Mode in schlichtem japanischem Stil: fließende offene Jacke und Hose mit weiten Beinen.
Abel hingegen trug denselben unförmigen grauen Overall wie die meisten Mechs. Ein gut sitzendes und praktisches Kleidungsstück. Warum fühlte er sich darin dann manchmal so … unwohl?
Bevor er diese Frage vertiefen konnte, wurde Abel von Mansfield, der zum Fenster deutete – genauer gesagt zum Garten –, wieder in die Gegenwart zurückgeholt. »Was siehst du da draußen, Abel? Nein. Wen siehst du?«
Wenn Mansfield von Mechs sprach, benutzte er in der Regel das Wort »wen« und nicht »was«. Abel gefiel diese höfliche Geste. »Ich sehe zwei Dog-Modelle und ein Yoke-Modell, die im Garten arbeiten. Einer der Dogs kümmert sich um die Hydrokulturen, während der andere Dog und der Yoke die Formhecke stutzen.«
»An deiner Detailverliebtheit müssen wir noch arbeiten.« Mansfield seufzte. »Das ist natürlich meine Schuld. Mach dir nichts draus. Worauf ich hinauswill: Wenn ich dich in den Garten schicken würde, könntest du dich um die Hydrokulturen kümmern, oder? Und die Hecke stutzen?«
»Ja, Sir.«
»Genauso gut wie ein Dog oder ein Yoke?«
»Natürlich, Sir.«
»Und was wäre, wenn ich hinfallen und mir den Arm brechen würde? Könntest du ihn genauso gut wieder einrichten wie ein Tare-Modell?«
Die Medizin-Mechs zählten zu den klügsten und flinksten Exemplaren, aber Abel konnte trotzdem mit »Ja, Sir« antworten.
Mansfields blaue Augen blitzten. »Und was wäre, wenn sich ein Queen-Modell hier Zugang verschaffen würde und den Auftrag hätte, mich zu töten? Eine Queen oder ein Charlie? Was wäre dann?«
»Sir, Sie sind der angesehenste Robotiker der Erde – niemand würde …«
»Das ist eine theoretische Frage«, sagte Mansfield sanft.
»Oh. Also, wenn rein theoretisch ein Kampf-Mech versuchen würde, Sie zu töten, könnte ich ihn, glaube ich, bezwingen. Zumindest wäre ich in der Lage, ihn so weit abzulenken oder zu beschädigen, dass Sie flüchten oder Hilfe holen könnten.«
»Genau. Du vereinst die gesamte Programmierung aller anderen fünfundzwanzig Modelle – all ihre Begabungen – in dir. Auf manchen Gebieten bist du vielleicht nur genauso gut wie deine einfacheren Gegenstücke, auf den meisten jedoch bist du herausragend. Und kein Mech, der jemals gebaut wurde, hat so eine große Bandbreite von Fähigkeiten und ist so intelligent wie du.« Der Hauch eines Lächelns umspielte Mansfields Mund, während er Abel musterte. »Du, mein Sohn, bist einzigartig.«
Sohn. Abel wusste, dass das im wörtlichen Sinn nicht stimmte; er besaß zwar natürliche DNA, die der von Mansfield nachempfunden war, trotzdem war er im Wesentlichen eine mechanische Konstruktion, kein biologischer Organismus. Burton Mansfield hatte ein richtiges Kind, eine Tochter, die natürlich in jeder Hinsicht Vorrang hatte. Und dennoch …
»Das hat dir gefallen, nicht wahr?«, fragte Mansfield. »Dass ich dich ›Sohn‹ genannt habe.«
»Ja, Sir.«
»Du entwickelst also allmählich gewisse emotionale Fähigkeiten. Gut.« Er gab Abel einen Klaps auf den Rücken. »Lass uns das noch ein bisschen fördern, ja? Von nun an darfst du mich ›Vater‹ nennen.« Mit einem Seufzer betrachtete Mansfield die Quadrocopter, die durch den Londoner Himmel schossen. »Es ist schon spät. Sag bitte den Dogs und dem Yoke, dass sie Schluss machen sollen, ja?«
Abel nickte.
»Und danach kommst du in die Bibliothek. Ich möchte, dass du dir ein paar Bücher und Filme und Holovids vornimmst. Wir wollen mal sehen, ob du empfänglich für fiktionale Geschichten bist.«
»Ich komme gleich«, versprach Abel, bevor er noch »Vater« nachschob.
Er wurde mit Mansfields Lächeln belohnt.
Von ferne dringt ein hohles Dröhnen durch das Schiff. Der Rumpf zittert leicht – das widerspenstige Metall rebelliert nach der langen Ruhepause gegen die Bewegung. Schließlich öffnet sich die Tür der Hauptlandebucht.
Abel merkt, dass er lächelt.
Ich komme gleich, Vater.
Erneut geht er die Konstruktionszeichnungen des Schiffs durch, stellt sich vor, ein dreidimensionales Modell der Dädalus würde vor ihm schweben. Abel vergrößert im Geist den Bereich um die Versorgungsschleuse und sucht nach »Verteidigungsmitteln«. Verschiedene Möglichkeiten kommen infrage, hauptsächlich Notfallschränke, von denen manche näher und praktischer liegen als andere …
Die Notbeleuchtung springt an. Zum ersten Mal seit dreißig Jahren ist Abel nicht mehr von Dunkelheit umgeben.
Ein Mensch hätte vielleicht gezögert, überwältigt von Schock, Freude oder Dankbarkeit. Abel bringt sich sofort in Position, bereit für den Augenblick einen Sekundenbruchteil später, als die Schwerkraft wieder einsetzt. Er fällt zwei Meter und landet so leise wie eine Katze auf seinen Händen und Füßen. Von dort ist es nur ein Schritt zur Tür; seine Finger fliegen mit übermenschlicher Geschwindigkeit über die Tasten, um den Türcode einzugeben, und – endlich, endlich – öffnet sich die Tür der Versorgungsschleuse.
Abel ist frei.
Er jubelt nicht. Er lacht nicht. Er läuft einfach zu dem nächsten »Verteidigungsmittel«, das im Bauplan des Schiffs verzeichnet ist. Der Schrank ist unbeschädigt und noch versiegelt. Was auch immer Mansfield und den anderen zugestoßen ist, sie haben keinen Gebrauch von seinem Inhalt gemacht. Ist das eine gute Nachricht – oder der Beweis dafür, dass sie sofort gestorben sind?
Abel tippt den aus zehn Ziffern bestehenden Code ein. Die Tür öffnet sich und gibt den Blick auf das Innere des Schranks frei. Abel greift nach einem Blaster. Nun bewaffnet, läuft er Richtung Krankenstation. Wenn Burton Mansfield dort im Kryoschlaf liegt, könnte sein Leben unmittelbar bedroht sein. Daher bleibt der Genesis-Pilot ein feindlicher Eindringling, dessen Anwesenheit nicht geduldet werden kann. Dass der Pilot so schnell die volle Stromversorgung wiederherstellen konnte, deutet darauf hin, dass er intelligent ist. Mit anderen Worten gefährlich.
Abel wird sich von seinem Befreier finden lassen – der Person, die nach all der Zeit seine Gefangenschaft beendet hat – und ihn dann erschießen.
5
Noemi knallt auf das Deck des verlassenen Schiffs und schützt dabei instinktiv ihren Kopf, während von überall Gegenstände auf sie herabpurzeln – Pakete mit Notproviant, Werkzeuge und all die anderen Dinge, die diese fahrlässigen Menschen zurückgelassen haben. Schlimmer als die Schläge auf ihren Rücken und ihre Arme ist der schwere Aufprall von Metall hinter ihr: Ihr Jäger und Esthers Aufklärer sind auf den Boden der Landebucht gefallen.
Die Schiffe halten das aus. Aber Esther …
Licht eingeschaltet. Schwerkraft stabilisiert. Luftdruck normal – los.
Noemi eilt von der Instrumententafel zu Esthers Schiff und betätigt den Schalter, mit dem sich das Cockpit von außen öffnen lässt, aber das Schiff ist zu schwer beschädigt – es hat keinen Strom mehr. Esther rührt sich, rollt sich auf die Seite, doch dann erstarrt sie, offensichtlich vor Schmerz. Zitternd streckt sie die Hand zur manuellen Bedienung aus. Die Hülle des Cockpits schrappt quälend langsam zurück.
»Esther!« Noemi reißt sich den Helm vom Kopf und greift ins Cockpit, noch während die Hülle mühsam zurückfährt. Vorsichtig zieht sie auch Esther den Helm vom Kopf. »Wo bist du verletzt?«
»Linke –« Esther schluckt mühsam, bevor sie weitersprechen kann. »Linke Seite … wo sind wir?«
»Wie es aussieht in einem verlassenen Erd-Schiff im Trümmerfeld.« Und das Schiff ist in besserem Zustand, als Noemi gehofft hatte. Der Notstrom liegt bei fast hundert Prozent, obwohl er vermutlich viele Jahre lang abgestellt war. Auf dem kleinen Schild über der Tür, die zum Rest des Schiffs führt, ist ein Wort in größeren Buchstaben hervorgehoben. »Die Dädalus. Offenbar hat jemand von der Erde sie vor Jahrzehnten verlassen müssen. Du siehst also, wir haben Schwerkraft, ein Kommunikationssystem, medizinische Hilfsmittel, alles, was wir brauchen. Du kommst wieder in Ordnung.«
Esthers Kopf kippt nach hinten, in ihren grünen Augen funkelt Galgenhumor. »Lügnerin.«
»Doch, wirklich. Kannst du aussteigen?«
Nach einem Augenblick schüttelt Esther langsam den Kopf. »Ich kann nicht aufstehen. Der Mech – meine Hüfte –«
Noemi dreht sich der Magen um, als sie feststellt, dass der Mech nicht nur den Rumpf des Schiffs durchschnitten, sondern auch Esthers Hüftgelenk zerquetscht hat. Der Raumanzug ist zwar unbeschädigt, aber das bedeutet nicht, dass Esther keine inneren Verletzungen und Blutungen hat.
Die Oberschenkelarterie ist nicht durchtrennt, überlegt Noemi. Sonst wäre Esther schon tot. Die Arterie ist also intakt. Esther hat eine Chance.
»Okay, Esther. Warte.« Soll sie versuchen, sie zur Krankenstation zu tragen, oder das benötigte Material hierherbringen? Um es zurück zum Truppentransporter zu schaffen, wo Esther richtig behandelt werden kann, müssen ihre Wunden versorgt werden, und sie braucht vielleicht wegen innerer Blutungen eine Transfusion – für die Noemi mit der Blutgruppe AB negativ vermutlich nicht als Spenderin infrage kommt. Ein Schiff wie dieses könnte jedoch synthetisches Blut auf Lager haben und das Zeug hält ewig. Noemi kann synthetisches Blut und Kanülen holen, und wahrscheinlich sollte Esther nicht bewegt werden, bis ihr Zustand stabiler ist und Noemi sich ein Bild von der Schwere ihrer Verletzungen gemacht hat. »Ich suche jetzt die Krankenstation, okay? Ich bin gleich wieder da und bringe mit, was wir brauchen.«
Esthers Gesicht wird noch bleicher. Sie will nicht allein gelassen werden, und Noemi zerreißt es das Herz bei dem Gedanken, welche Angst Esther haben muss. Aber ihre Freundin nickt bloß und versucht zu witzeln. »Ich rühre mich … nicht vom Fleck.«
Noemi drückt Esthers behandschuhte Hand, dann rennt sie zur Tür, die geschmeidig aufgleitet. Sie flitzt in das Innere des verlassenen Schiffs und hält inne, versucht sich zu orientieren. Der Korridor krümmt sich in einer lang geschwungenen, ovalen Kurve und die Notbeleuchtung taucht alles in ein gedämpftes Orange. Noemi blickt sich hektisch um. So riesig ist das Schiff gar nicht – vielleicht so groß wie ein paar aneinandergereihte dreistöckige Häuser –, doch schon die paar Minuten, die es dauern würde, es ganz zu erforschen, sind für Esther zu viel. Ich brauche einen Bildschirm, Konstruktionspläne, etwas, das mir sagt, wo alles ist!
Sie läuft den Hauptkorridor entlang, eine lange Spirale, die sich von unten nach oben durch das gesamte Schiff windet und von der mehrere kurze Nebenkorridore abzweigen. Wie eine Kletterpflanze mit Dornen, denkt Noemi. Die Korridore sind gewölbt und an den Seitenwänden alle paar Meter von geschwungenen Metallstreben unterbrochen. Es erinnert sie an das Innere gotischer Kathedralen, wie sie vor langer Zeit auf der Erde gebaut wurden.
Dann entdeckt sie einen Bildschirm. Mit klopfendem Herzen legt sie ihre Hand darauf. Die meisten Infoscreens reagieren auf menschliche Berührung, aber dieser bleibt schwarz. »Computer?«, versucht es Noemi. Nichts. Hört er sie nicht? »Information. Einschalten.«
Immer noch nichts. Ganz unten sieht sie jedoch ein schwaches Licht über den Bildschirm laufen, die Computer sind also nicht ganz tot. Es muss sich um eine Störung handeln. Obwohl die Dädalus fast vollkommen unbeschädigt wirkt, liegt sie bestimmt schon eine ganze Weile hier, mindestens seit dem ersten Befreiungskrieg vor dreißig Jahren. Vielleicht fällt sie aufgrund von Vernachlässigung allmählich auseinander …
Nein, realisiert Noemi. Das ist es nicht. Jemand muss die Primärsysteme abgestellt haben.
Ein Frösteln läuft ihr über den Rücken, lässt ihre Wirbelsäule erstarren und ihre Haare zu Berge stehen. Befindet sich noch jemand anderer an Bord der Dädalus? – aber nein. Das ist unmöglich. Kein Mensch hätte dreißig Jahre lang in völliger Isolation überlebt. Wahrscheinlich hat die ehemalige Crew vor dem Verlassen des Schiffs sämtliche Systeme heruntergefahren, um zu verhindern, dass es von Genesis gekapert wird.
Wenn diese Systeme heruntergefahren sind, dann funktioniert auch das Kommunikationssystem nicht. Wie soll sie dann Kontakt mit dem Truppentransporter und Captain Baz aufnehmen?
Das überlege ich mir später, sagt sie sich. Jetzt suche ich erst mal die Krankenstation und kümmere mich um Esther.
Die Landebucht liegt auf der untersten Ebene der Dädalus, daher läuft Noemi nach oben und überprüft dabei jede Tür. Maschinenraum – nein. Kombüse und Messe – nein. Zusätzliche Versorgungsschleuse – nein. Mannschaftsquartiere – die Brücke mit dem riesigen Sichtschirm – nein. Ihr Atem wird schneller, während sie sich selbst antreibt. Ihre Panik wächst, und einen Jäger in einer Schlacht zu steuern ist anstrengender, als es scheint. Aber Esthers kritischer Zustand hält Noemi in Gang.
Ich muss fast ganz oben sein, denkt sie, als sie um die nächste Kurve biegt, ihre Schritte donnern auf den Metallplatten des Fußbodens. Einer der nächsten Räume muss die Krankenstationsein …
Zwei Jahre militärische Ausbildung haben Noemis Reflexe trainiert. Daher klingeln in ihrem Innern ganz schwach die Alarmglocken, als sich ihr Schrittgeräusch auf einer der Metallplatten anders anhört als bei den anderen. Vielleicht ist es dieser zusätzliche Adrenalinschub, der ihre Sicht schärft und sie eine rasche Bewegung hinter der nächsten Kurve wahrnehmen lässt – etwas Hellgraues hebt sich vom pechschwarzen Hintergrund ab. Noemi reagiert instinktiv, wirft sich augenblicklich zur Seite, um sich hinter eine der Metallstreben zu ducken, einen Sekundenbruchteil bevor ein Blasterstrahl den Boden versengt.
Einen Wimpernschlag später hält sie ihren eigenen Blaster in der Hand. Noemi beugt sich nach vorne, um auf ihren unbekannten Angreifer zu schießen, und zieht sich blitzschnell zurück, bevor wer auch immer sie wieder ins Visier nehmen kann. Ozongeruch sticht ihr in die Nase und jetzt gerät sie endgültig in Panik.
Wie kann jemand hier drin sein? Hat ein Mensch irgendwie dreißig Jahre in diesem Schiff überlebt?
Was Noemi am meisten Angst macht, ist, dass ihr Angreifer zwischen ihr und der Krankenstation steht. Dieser Eindringling oder Gestrandete, ganz egal wer es ist, hält Noemi davon ab, Esther die benötigte Hilfe zu bringen. In diesem Augenblick könnte Esther innerlich verbluten.
Aus Angst wird unbändige Wut. Noemi schießt blindlings um die Kurve des Korridors. Ihr Angreifer ballert sofort zurück, verfehlt sie nur um Millimeter; die Hitze des Feuerstoßes versengt ihre bloßen Finger.
Das war so knapp. So präzise. Und dabei hatte er nur einen Sekundenbruchteil zum Zielen …
Noemis Eingeweide krampfen sich zusammen. Ein Mech. Das muss es sein, noch so ein verfluchter Mech. Zunächst ist sie verwirrt – ich weiß, dass keine anderen Mechs mit uns in diese Richtung geflogen sind, nur der eine, den ich zerstört habe –, bis ihr klar wird, dass er schon die ganze Zeit an Bord gewesen sein muss, seitdem das Schiff aufgegeben wurde. Die Menschen retteten sich selbst und flohen zurück zur Erde und ließen diesen seelenlosen Metallhaufen zurück, damit er das Wrack für immer verteidigte.
Jetzt endlich hat auch die Alarmanlage der Dädalus registriert, dass an Bord Waffen abgefeuert wurden. Die Lampen leuchten nicht mehr orange, sondern rot und beginnen hektisch zu blinken, der stroboskopartige Effekt lässt die gesamte Umgebung seltsam und entrückt erscheinen. Noemis Herzschlag beschleunigt sich entsprechend.
Sie ist eine Kriegerin von Genesis. Als sie heute in die Schlacht zog, tat sie es in dem Bewusstsein, womöglich von einem Mech getötet zu werden. Aber sie will verdammt sein, wenn sie es zulässt, dass einer davon auch noch Esther tötet.
Noemi muss diesen Mech jetzt zerstören und die Krankenstation erreichen – oder bei dem Versuch sterben.
6
Dreißig Jahre Einsamkeit, auf einen Schlag zu Ende. Mit dem ersten Blick auf den Eindringling ist Abel – endlich – nicht mehr allein.
Alle Befehle seiner Programmierung sagen ihm, dass er den neuen Menschen an Bord töten muss. Und das ist auch seine volle Absicht. Doch einen überwältigenden, glückseligen Moment lang möchte Abel einfach nur seine Stimme hören, ihn ansehen, in der Gegenwart einer anderen Person schwelgen.
Eine Rekapitulation der 412 Millisekunden visueller Daten, über die er verfügt, ergibt, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Sie handelt – ein junger, weiblich aussehender Mensch, etwa 1,68 Meter groß, von überwiegend lateinamerikanischer und polynesischer Abstammung, mit kinnlangem schwarzem Haar, braunen Augen, dem dunkelgrünen Exosuit eines Genesis-Soldaten und einem Mark-8-Blaster, der – nach der Wellenlänge der Strahlen zu schließen, die soeben die Luft durchschnitten haben – ungefähr noch zu fünfundvierzig Prozent geladen ist.
In Anbetracht der Tatsache, dass er den Eindringling in Kürze töten muss, sind die Daten über den Blaster die relevantesten. Abel hat gesehen, dass zwei Raumjäger in der Landebucht ankamen, aber nur ein Soldat ist in das Schiff eingedrungen. Seine frühere Analyse der Situation war also korrekt: Ein Pilot ist schwer verletzt, und der andere möchte zur Krankenstation, um Erste Hilfe leisten zu können.
Das gilt es jedoch zu verhindern, denn es könnte sein, dass Burton Mansfield dort im Kryoschlaf liegt. Sofort nachdem er sich bewaffnet hat, hat Abel sämtliche Kommunikationssysteme abgeschaltet, sowohl intern als auch extern, um die Genesis-Piloten zu isolieren. Es wird also keine Verstärkung kommen. Seine Gegnerin ist allein und verzweifelt. In einem solchen Zustand werden Menschen leichtsinnig. Wenn er sie von ihrem Ziel abhält, wird sie bis zum Äußersten gehen, um zur Krankenstation zu gelangen – und dabei ihre Position schwächen.
Abel geht die Optionen des Eindringlings durch und trifft eine Entscheidung. Anstatt den Schusswechsel fortzusetzen, dreht er sich um und läuft zur Krankenstation. Er schafft es schnell genug zur Tür, bevor der erste Blasterstrahl die Wand in der Nähe trifft, und schlüpft hinein, bevor seine Gegnerin ihm folgen kann. Sobald die Tür der Krankenstation hinter ihm zugleitet, schnellt er herum, schließt ab und …
… hält inne.
Seine Programmierung ist unmissverständlich. Kryokammern überprüfen. Nach Mansfield suchen.
Aber seine emotionalen Prozesse scheinen sich in den vergangenen dreißig Jahren erheblich verändert zu haben, denn er möchte sich nicht umdrehen und die Krankenstation in Augenschein nehmen.
Ja, er könnte herausfinden, dass Burton Mansfield hier ist – aber auch, dass Mansfield längst fort oder tot ist. Nachdem er all die Zeit mit der Ungewissheit gelebt hat, fürchtet er sich vor der Gewissheit. Er möchte für immer und ewig zusammen mit Schrödingers Katze in dieser Stahlkammer bleiben.
Lämpchen um den Türrahmen herum beginnen zu blinken, eine Warnung vor einem Energieschub. Wie von Abel vorhergesehen hat der Eindringling seinen Blaster auf maximale Leistung gestellt, um das Schloss zu sprengen. Innerhalb von neunzig Sekunden wird sich die Tür öffnen. Nach der Überbeanspruchung wird die Genesis-Kämpferin nur noch einen oder zwei Schüsse übrighaben. Abel ist zwar zuversichtlich, dass er ihnen ausweichen kann, aber vielleicht zielt sie auch daneben und trifft die Kryokammern.
Dieses Risiko lässt ihn sein Zögern überwinden. Abel dreht sich um und schaut.
Allem Anschein nach sind die Kryokammern nicht in Betrieb. Verifizieren.
Während sich das schwache Heulen des auf Hochtouren laufenden Blasters immer höher schraubt, geht Abel zu den Konsolen, um sich zu vergewissern. Bestätigt. Niemand liegt in den Kryokammern. Es sieht so aus, als wären sie überhaupt noch nie aktiviert worden.
Die menschlichen Passagiere der Dädalus, einschließlich Burton Mansfields, haben das Schiff vor dreißig Jahren verlassen und sind nie zurückgekehrt.
»Sie dürfen die Betriebsdaten des Tors nicht in die Finger bekommen«, sagte Captain Gee. Auf dem kuppelförmigen Sichtschirm der Brücke war zu sehen, wie die Genesis-Jäger eine weitere Damokles abschossen und in einem einzigen Moment mehrere Hundert Mechs zerschmetterten. »Du da. Mech. Entferne die Speicherelemente und schieße sie durch das Tor. Jetzt.«
Abel schickte sich an, die Befehle der ranghöchsten Offizierin an Bord zu befolgen, hielt jedoch inne, als Mansfield sagte: »Wir verlassen das Schiff nicht ohne Abel.«
Captain Gee herrschte ihn an: »Wenn dieses Ding rechtzeitig zurück in der Landebucht ist, um mit uns abzufliegen, wunderbar! Wenn nicht, dann bauen Sie sich eben ein neues!«
Nur wenige Menschen sprachen auf diese Weise mit Burton Mansfield. Er richtete sich auf und seine tiefe Stimme schien die dunkle Brücke zu füllen. »Abel ist anders –«
»Das ist eine Maschine! Ich habe hier Menschenleben zu retten.« Captain Gee drehte sich zu Abel und runzelte die Stirn, als sie feststellte, dass dieser sich nicht vom Fleck bewegt hatte. »Ist das Ding kaputt?«
Abel blieb immer noch untätig, während Mansfield durch den Bildschirm, der zwei Wände und die gesamte kuppelförmige Decke umfasste, auf das riesige Sternenfeld blickte. Die Schlacht hatte sich gewendet. Genesis würde heute den Sieg erringen – und in Kürze dieses Schiff, wenn sie es haben wollten.
Eine Erschütterung ging durch die Dädalus, als sie zum ersten Mal direkt beschossen wurde. Leise sagte Mansfield: »Abel, geh. Beeil dich.«