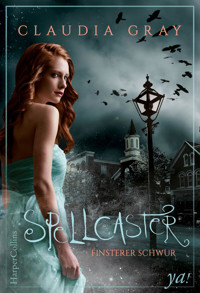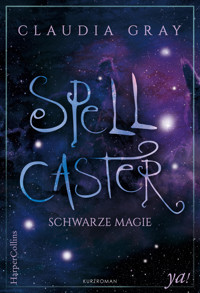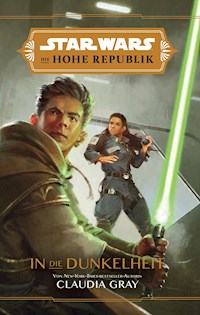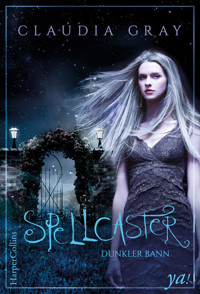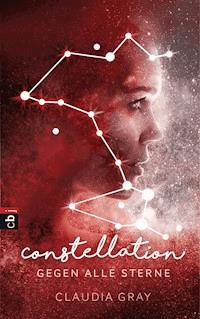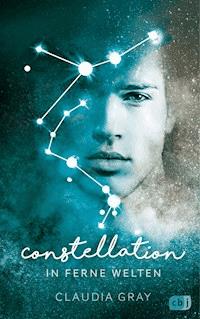
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Constellation-Reihe
- Sprache: Deutsch
Einst wollten sie sich töten. Jetzt wollen sie füreinander sterben.
Noemi ist ohne Abel auf ihren Planeten zurückgekehrt. Er, der so viel mehr ist als nur eine künstliche Intelligenz, soll ein freies Leben führen. Am anderen Ende des Weltraums wagt Abel kaum zu träumen, Noemi wiederzusehen. Doch das geschieht schneller als vermutet. Abels Schöpfer Burton Mansfield hat ihn aufgespürt und schickt ihm eine Botschaft: Noemi befindet sich in seiner Gewalt, und Abel hat vierundzwanzig Stunden, nach London zu kommen, sonst stirbt Noemi. Um seine große Liebe zu retten, folgt Abel dem Ruf seines skrupellosen Schöpfers. Doch dessen Tochter hat einen noch perfideren Plan …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
CLAUDIA GRAY
IN FERNE WELTEN
Aus dem Amerikanischen von
Christa Prummer-Lehmair und
Heide Horn
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage 2018
© 2018 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München,
Neumarkter Straße 18, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text © 2018 Amy Vincent
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Defy the Worlds« bei Little, Brown und Company
in der Verlagsgruppe Hachette Book Group, Inc, New York.
Der Name von Little, Brown ist eine eingetragene Handelsmarke
von Hachette Book Group, Inc.
This edition was published by arrangement with
Little, Brown and Company, New York, New York, USA.
All rights reserved.
Aus dem Amerikanischen von Christa Prummer-Lehmair und Heide Horn
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München,
unter Verwendung von Motiven von
© Shutterstock (ArtOfPhotos, Yuriy Mazur, ririro)
kk · Herstellung: AJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-19395-9V001
www.cbj-verlag.de
1
Hocherhobenen Hauptes, den Helm unter den Arm geklemmt, geht Noemi Vidal zwischen den beiden langen Reihen Sternenjägern im Hangar hindurch. Sie winkt ihren Kameraden nicht zu, wie sie es früher getan hat – bis vor sechs Monaten.
Nun würde niemand ihren Gruß erwidern.
Kinn hoch, Schultern gerade, ermahnt sie sich und sucht Trost in dem vertrauten Geruch nach Schmieröl und Ozon, im Zischen der Schweißbrenner und im Poltern von Stiefeln auf Beton. Wenn du willst, dass sie dich wieder als Kameradin akzeptieren, dann benimm dich wie eine. Du kneifst nicht vor den Geschützen der Mechs, also wirst du auch jetzt nicht kneifen.
Doch die Kampf-Mechs der Erde zielen nur auf den Körper. Dafür hat Noemi die Schutzschilde ihres Sternenjägers. Die Ablehnung ihrer Staffelmitglieder zielt aufs Herz und dafür wurde noch kein Schutz erfunden.
»Vidal!« Captain Baz eilt mit ausgreifenden Schritten durch den Hangar, einen Datenleser in der Hand. Sie trägt ihre Uniform mit dem dunkel gemusterten Kopftuch und lächelt, das erste Lächeln, das Noemi an diesem Tag sieht. »Wir schicken Sie heute auf Nahbereichs-Patrouille.«
»Ja, Ma’am. Captain, könnte ich vielleicht …«
Baz kommt auf Noemi zu. »Ja, Lieutenant?«
»Ich wollte fragen …« Noemi holt tief Luft. »Sie haben mich schon seit Monaten nicht mehr für die Tor-Patrouille eingeteilt. Ich würde sehr gern bald mal wieder eine Schicht dort übernehmen.«
»Tor-Patrouillen zählen zu den gefährlichsten Einsätzen«, sagt Baz sachlich, während sie ihren Datenleser überfliegt. Jeder auf Genesis weiß, dass das Tor die Verbindung zur Erde und zu den anderen Kolonie-Welten im Planetenring darstellt. Es stabilisiert den Eingang zu einem Wurmloch und ermöglicht blitzschnelle Reisen durch die Galaxie. Aber es macht auch den Krieg möglich, der Genesis verwüstet. »Die meisten Piloten wären froh, wenn sie nicht so weit wegmüssten.«
»Ich bin bereit, mich der Gefahr auszusetzen.« Mehr als bereit – inzwischen sehnt sich Noemi fast schon verzweifelt danach. Genesis zu beschützen verleiht ihrem Leben Sinn. Seit Monaten, seit ihrer Rückkehr, wurde ihr nicht mehr gestattet, wirklich etwas für die Verteidigung ihrer Welt zu tun.
Baz braucht einige Sekunden, bevor sie antwortet. »Hören Sie, der Tag wird kommen, okay? Wir müssen es langsam angehen.«
Captain Baz ist auf ihrer Seite und das tut Noemi gut. Aber es bedeutet nicht, dass ihre Vorgesetzte recht hat. Mit gesenkter Stimme sagt Noemi: »Die anderen werden mir erst wieder vertrauen, wenn ich die volle Leistung bringe.«
Baz überlegt. »Vielleicht.« Nachdem sie noch kurz das Für und Wider abgewogen hat, nickt sie. »Versuchen wir’s.« Laut ruft sie: »Ganaraj, O’Farrell, Sie nehmen heute Vidal mit! Rauf mit euch, Leute – die Gamma-Schicht kommt gleich nach Hause.«
Die beiden anderen Piloten starren vom anderen Ende des Hangars zu Noemi herüber, doch sie geht geradewegs zu ihrem Sternenjäger.
Es gibt nur einen Weg für sie, sich Respekt zu verschaffen: Schritt für Schritt, Flug um Flug.
Hab Geduld, ermahnt sie sich. Bald werden sie dich wieder so mögen wie früher.
Das dürfte nicht allzu schwer sein. Schließlich mochten sie sie noch nie besonders.
Zehn Prozent der Zeit sind Tor-Patrouillen die schlimmsten, angsteinflößendsten Einsätze überhaupt. In unregelmäßigen, nicht vorhersehbaren Abständen schickt die Erde Damokles-Schiffe voller Kampf-Mechs – Queen- und Charlie-Modelle, die darauf programmiert sind, zu töten. In den letzten fünf Jahren haben sie Genesis’ antiquierte Verteidigungsflotte stark dezimiert; mit jeder verlorenen Schlacht rückt der Tag näher, an dem Kampf-Mechs auf Genesis landen, einen Bodenkrieg entfachen und Noemis Planeten erobern werden, damit die Erde ihn ausbeuten kann. Bei einem Gefecht muss so schnell wie möglich Alarm ausgelöst werden. Die patrouillierenden Sternenjäger sollen Damokles-Schiffe sofort angreifen, ohne auf Verstärkung zu warten. Die meisten Piloten überleben das nicht.
Die anderen neunzig Prozent der Zeit jedoch sind Tor-Patrouillen todlangweilig.
Auf dem Pilotensitz ihres Sternenjägers zieht Noemi ihre Kreise um den äußeren Bereich des Tors; Arun Ganaraj und Deirdre O’Farrell gehen näher ran. Auch Noemi ist nahe genug, um dieses monströse Ding am Himmel zu beobachten; ein gewaltiger silberner Ring, dessen illuminierte Segmente im Dunkel des Weltalls leuchten. Trümmerteile aus dem Krieg kreisen in seinem Orbit, von winzigen Metallsplittern bis hin zu Brocken, größer als ihr Sternenjäger.
Zwischen all diesen Trümmern blieb ein ganzes Schiff dreißig Jahre lang verborgen, bis Noemi es entdeckte. In seinem Innern fand sie –
»Seht ihr das?« Ganarajs Stimme ertönt aus dem Lautsprecher, gerade als Noemis Sichtschirm das Tor detaillierter zeigt. Der schwache Schimmer im Zentrum des Rings wirkt unheilvoll trüb – wie ein Teich, der sich gerade mit einer Eisschicht überzieht.
»Ja, ich seh’s«, erwidert Noemi.
»Vielleicht ist es auch gar nichts.« Ganaraj klingt, als versuchte er sich selbst zu überzeugen. »Es muss nicht immer bedeuten, dass was durchkommt.«
»Meistens ist gar nichts«, stimmt Noemi ihm zu, während sie das Bild näher heranzoomt und ihre Geschütze gefechtsklar macht. Teile alter Wracks und Schrapnelle aus vergangenen Schlachten erschaffen oft die Illusion eintretender Objekte. Doch selbst der kleinste Hinweis auf einen Eindringling reicht aus, um Noemi in Alarmbereitschaft zu versetzen.
»Oder es könnte ein Haufen Mechs sein, die Hackfleisch aus uns machen wollen.« O’Farrell klingt fröhlich, so fröhlich, dass ihr Sarkasmus unverkennbar ist. »Aber du möchtest sicher ein Kaffeekränzchen mit ihnen abhalten und sie dann wieder heimschicken, Vidal, oder?«
»Hör auf damit, O’Farrell«, zischt Noemi.
»Na ja, so bist du doch, oder? Du hast Mechs ja sooo lieb, dass du Genesis lieber Krieg und Tod aussetzt, als so einen verdammten Metallhaufen in die Luft zu jagen –«
Ganaraj schaltet sich ein. »Könnten wir uns bitte alle wieder auf das Tor konzentrieren?«
»Das tu ich die ganze Zeit«, entgegnet Noemi. Allerdings brennen ihre Wangen und das Blut pocht ihr zornig in den Schläfen. Sie kann damit umgehen, wenn sie auf ihr herumhacken, aber nicht, wenn sie abfällig über Abel reden.
Als sie vor sechs Monaten dieses Schiff entdeckte, entdeckte sie auch einen Mech darin: das Modell Eins A von Mansfield Cybernetics, das Herzensprojekt des einzigartigen Burton Mansfield und den höchstentwickelten Mech, der jemals geschaffen wurde.
Das Modell Eins A nennt sich selbst lieber Abel.
Zuerst sah Noemi nichts anderes in ihm als alle anderen Genesisbewohner: eine seelenlose Maschine in Menschengestalt. Als einen Feind, der ihr noch von Nutzen sein konnte, bevor sie ihn vernichtete. Er sollte das Werkzeug sein, mit dem sie das Genesis-Tor in die Luft jagen wollte – wodurch Genesis für immer von der Erde abgeschottet und der Krieg im Bruchteil einer Sekunde gewonnen gewesen wäre.
Das Tor in die Luft zu jagen, hätte jedoch bedeutet, mit ihm auch Abel zu vernichten, und am Ende ihrer Reise durch die Kolonie-Welten des Planetenrings wusste Noemi, dass Abel viel mehr war als eine Maschine. Sie hätte ihn genauso wenig für die Zerstörung des Tors töten können, wie sie ein Kind auf dem Altar hätte opfern können.
Gott hat das schon einmal gefordert, flüstern ihr die Lektionen aus dem Katechismusunterricht ins Ohr. Es fällt ihr inzwischen leichter, diese Stimme zu ignorieren. Womöglich zu leicht …
Auf der Konsole ihres Sternenjägers blinken rote Lämpchen. Noemis Hände verkrampfen sich, als sie das Signal erkennt. »Da kommt was durch.«
Inzwischen melden ihnen ihre Sensoren alle dasselbe. »Bestätigt«, sagt Ganaraj, seine Stimme verrät Angst. »Aber es ist kein Damokles.«
»Ein Aufklärer«, mutmaßt O’Farrell. »Um Informationen zu sammeln, bevor die Queens und Charlies anrücken.«
»Seit wann setzen Mechs Aufklärer ein?« Noemi zoomt das eindringende Schiff noch näher heran.
Nein. Kein Schiff. Etwas anderes.
Das Metallobjekt besitzt ein kleines kugelförmiges Zentrum, von dem in alle Richtungen meterlange feine Spitzen ausgehen. »Es sieht aus wie ein Stern«, flüstert Noemi bei sich. So hatte sie sich Sterne als Kind vorgestellt, hübsch und schimmernd, nicht riesig und voller zerstörerischer Kraft. Das hübsche Äußere macht das Ding noch verdächtiger.
»Ist das eine Bombe?«, fragt Ganaraj.
Noemi weiß, dass das nicht der Fall ist. Sie kann nicht sagen, warum, aber sie weiß es. So was nennt man wohl Intuition.
O’Farrell liefert konkretere Informationen: »Scans auf Sprengstoff negativ.«
Wieder schimmert das Tor und ein weiterer Stern bricht durch. Dann noch einer. Während Noemi zusieht, werden es immer mehr und mehr, bis die Sensoren eine endgültige Anzahl von einhundertzwanzig melden. Sie rasen als leuchtende und zugleich furchterregende Sternenkonstellation Richtung Genesis.
»Informieren wir die Kommandozentrale und bleiben wir an ihnen dran«, befiehlt Ganaraj. Er wurde neun Wochen früher als Noemi zum Lieutenant befördert. »Sobald wir grünes Licht haben, werden wir diese Dinger pulverisieren.«
Noemi würde sie lieber sofort pulverisieren und darauf hoffen, dass es dann nachträglich genehmigt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Captain Baz und die anderen hohen Tiere irgendetwas von der Erde so nah an ihren Heimatplaneten herankommen lassen – ob es nun Sprengstoff an Bord hat oder nicht –, ist kleiner als null. Aber Ganaraj hat das Kommando, und Noemi bewegt sich auf dünnem Eis, also beißt sie die Zähne zusammen und heftet sich so lange wie möglich dicht an die Sterne …
… was nicht lange dauert, da sie ausschwärmen, sich immer weiter voneinander entfernen. Als die Sterne durch das Tor drangen, hätte Noemis drei Mann starke Patrouille sie mit einer schnellen Salve Blasterfeuer eliminieren können. Doch mit jeder verstreichenden Sekunde wird das Zielen schwieriger und zeitraubender. Die Sterne flitzen durchs Sonnensystem, winzige Magnettriebwerke lassen sie in der Dunkelheit hell leuchten. Sie sind so schnell, dass sie Genesis in fünfzehn Minuten erreichen werden. Noemi durchleuchtet die »Sterne« ununterbrochen und weiß, dass die anderen dasselbe tun. Die Ergebnisse auf ihrem Schirm liefern keinen Hinweis darauf, was diese Dinger sind oder was sie bedeuten könnten.
Vielleicht bringen sie ein Friedensangebot, denkt sie. Das ist nicht ernst gemeint. Niemals würde die Erde ein solches Angebot machen, nicht jetzt. Die Lage in der gesamten Galaxie ist schlimmer denn je. Die Erde wird nicht mehr lange bewohnbar sein und die anderen Kolonien können nur noch ein paar Millionen Menschen mehr aufnehmen; damit bleiben Milliarden, die einen Ort zum Leben suchen, Milliarden, die Noemis Welt genauso zerstören würden, wie sie ihre eigene zerstört haben. Der Befreiungskrieg begann, weil die Menschen von Genesis vor dreißig Jahren erkannten, dass sie eine moralische, geradezu heilige Pflicht hatten, ihren Planeten zu schützen.
Obwohl ihre Technologie veraltet war, hielten sie jahrzehntelang durch, und es gab sogar eine Phase relativer Ruhe. Doch in den letzten Jahren hat die Erde ihre Angriffe wiederaufgenommen, und zwar mit überraschender Härte. Genesis ist das einzige gewinnversprechende Ziel weit und breit.
»Ganaraj«, sagt Noemi. »Sie entfernen sich zu weit voneinander. Wenn wir nicht –«
»Die Vorschriften –« Ganaraj unterbricht sich. »Freigabe erteilt. Holt die Dinger runter.«
Viereinhalb Minuten. Es hat viereinhalb Minuten gedauert, um diese Entscheidung zu treffen. Aber so läuft das auf Genesis, alle Entscheidungen müssen die ganze Kommandokette vom Ältestenrat bis hinunter zu den Offizieren der mittleren Ebene durchlaufen – immer schön vorsichtig sein, immer zögerlich, immer erst reagieren, statt selbst die Initiative zu ergreifen …
Noemi reißt sich zusammen. Ihr Leben lang hat sie den Rat verehrt, seinem Urteil vertraut und ist seiner Führung gefolgt, selbst als das bedeutete, sich freiwillig für die Masada-Offensive zu melden, ein Himmelfahrtskommando. Dann kam es zu ihrer Reise durch den Planetenring und zur Erde, einer Reise, die sie den Befreiungskrieg mit anderen Augen sehen ließ … und ihr den Fatalismus des Ältestenrats bewusst machte. Selbst nachdem sie mit ihrem Bericht klargestellt hatte, dass die Erde aufgrund einer sich verändernden politischen Weltlage verwundbar geworden war, hatte der Rat die Masada-Offensive nicht abgesagt. Nur »verschoben«, auf ein unbekanntes Datum in der Zukunft. Und auch nach all diesen Monaten haben die Ältesten immer noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen, um aus den von Noemi gelieferten Informationen Nutzen zu ziehen.
Zumindest kann sie jetzt handeln. Noemi nimmt den ersten Stern ins Visier und drückt ab. Das Ding zerstiebt in einer bläulichen Staubwolke und einem Lichtblitz, der rasch vom kalten Weltraum geschluckt wird – selten hat eine Explosion sie mit solcher Befriedigung erfüllt.
Wenn sie sie nur schneller in die Luft jagen könnte! Die Sterne bilden nun ein breites Netz, machen sich eindeutig daran, den ganzen Planeten zu umzingeln, dessen grün-blaue Oberfläche inzwischen größer durch ihr Cockpitfenster zu sehen ist; friedlich harrt er dieses merkwürdigen Angriffs. Ihr fällt auf, dass die Sterne individuelle Ziele ansteuern, und zwar überall auf Noemis Welt. Ihr sträuben sich die Haare. »Ganaraj, wir brauchen so schnell wie möglich Verstärkung.«
Ein weiterer Stern flammt hell auf, als er von einem Blasterstrahl getroffen wird, und zerfällt – O’Farrell hat ihn erwischt und schreit: »Wir können diese Dinger allein ausschalten!«
Noemi schüttelt den Kopf, als würde O’Farrell sie sehen. »Kann sein, aber wir dürfen kein Risiko eingehen.«
»Ich habe eine Lagebeurteilung vom Boden erbeten«, sagt Ganaraj. »Abwarten!«
Abwarten? Diese Sterne stehen kurz vor dem Eintritt in die Atmosphäre und er will sich immer noch rückversichern? Noemi unterdrückt ihren Frust und konzentriert sich wieder aufs Feuern, nimmt jeden Stern, den sie entdeckt, ins Visier.
Doch sie kann sie nicht mehr alle im Blick behalten. Die drei Kampfjäger entfernen sich nun voneinander, um jeweils eine andere Gruppe von Sternen unschädlich zu machen, die auf die drei großen Kontinente von Genesis zusteuern. Einen Stern nach dem anderen sprengt Noemi in Stücke, aber sie haben sich zu stark verteilt, sind zu weit entfernt. Im selben Augenblick, in dem Noemi ihren zwanzigsten Treffer landet, sieht sie einen Stern beim Eintritt in die Atmosphäre aufleuchten. Dann erglüht ein zweiter weit entfernt am Horizont. Und noch einer, und noch einer …
Konzentriere dich nicht auf das, was du nicht tun kannst, ermahnt sie sich. Sondern auf das, was du tun kannst.
Am Ende melden die Instrumente, dass siebenundvierzig Sterne auf der Oberfläche von Genesis aufgeschlagen sind. Jeder einzelne davon trifft auf bewohntes Gebiet, meist in oder in der Nähe von größeren Städten oder Verkehrsknotenpunkten; nicht einer fällt ins Meer, obwohl Genesis zu sechzig Prozent mit Wasser bedeckt ist. Das legt nahe, dass ihnen Ziele einprogrammiert wurden. Doch die Sterne explodieren nicht beim Aufprall, sie treffen keine Regierungsgebäude oder entfalten irgendeine andere zerstörerische Wirkung. Einer landet auf den Schienen einer Schwebebahn und beschädigt sie leicht, ein anderer reißt ein tiefes Loch in einen öffentlichen Park. Aber schlimmer sind die Schäden nicht und auch die gemeldeten Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich – Schnitte von herumfliegenden Trümmerteilen, ein kleinerer Verkehrsunfall, als ein aus dem Konzept gebrachter Fahrer nicht auf die Ampel achtete, und eine Person, die vor Angst in Ohnmacht fiel und sich dabei den Kopf anschlug.
Niemand ist ernstlich verletzt – nur Noemis Ruf hat Schaden genommen.
»Ganaraj hat berichtet, dass Sie dagegen waren, das Einverständnis der Kommandozentrale einzuholen«, sagt Captain Baz. Sie sitzt in ihrem Büro, Noemi steht in Habachtstellung vor dem Schreibtisch. »Mit anderen Worten, Sie wollten, dass er das Standardprotokoll missachtet.«
»Captain, auf unseren Patrouillen ist es uns gestattet, nach eigenem Ermessen zu handeln. Von der Erde entsandte Objekte abzuschießen, liegt sehr wohl innerhalb dieses Ermessensspielraums.«
»Unter Umständen«, sagt Baz trocken. »In diesem Fall gilt das wohl. Aber es ist nicht ausdrücklich erlaubt. Vidal, das Problem ist nicht, dass sie diese Dinger abschießen wollten. Sondern dass Sie Ihren befehlshabenden Offizier davon abhalten wollten, seinen befehlshabenden Offizier zu kontaktieren, was nahelegen könnte, dass Sie ihn zu regelwidrigem Verhalten anstiften wollten.«
»Regelwidriges Verhalten?« Noemi kann sich gerade noch beherrschen, nicht patzig zu werden. »Entschuldigung, Captain – ich wollte sagen, diese Sterne abzuschießen, stellt wohl kaum ›regelwidriges Verhalten‹ dar …«
Baz nickt müde. »Es sind Ganarajs Worte, nicht meine. Und wenn Sie das Gefühl haben, das sei eine unfaire Interpretation Ihrer Handlungen, dann stimme ich Ihnen zu.« Sie lehnt sich im Stuhl zurück und löst ihr Kopftuch, wie sie es manchmal tut, wenn sie sich nur in Gesellschaft von Frauen befindet. »Sie mussten in den letzten Monaten in dieser Hinsicht einiges einstecken. Die anderen machen es Ihnen nicht leicht. Es ist hart, und trotz des Drucks halten Sie sich wacker. Das erfordert Mut. Glauben Sie bloß nicht, dass ich das nicht gemerkt habe.«
Noemi schluckt den Kloß im Hals hinunter. »Das bedeutet mir viel, Ma’am.«
Wieder seufzt Baz. »Ganaraj wird nicht gerade erfreut sein, dass wir Sie nicht gemeldet haben. Vielleicht wäre es ganz gut … wenn Sie mal eine Auszeit vom Fliegen nehmen. Wir finden eine Aufgabe am Boden für Sie. Vorzugsweise etwas, was Sie allein erledigen können, sodass Sie niemandem auf den Schlips treten.«
»Ja, Captain.« Diese Lösung wird Noemis Meinung nach ihre Probleme nur verschärfen. »Aber ich muss einen Weg finden, um wieder Teil der Staffel zu werden. Mehr als zuvor, wenn möglich. Ich denke, das wäre besser.«
Immer war sie eine Außenseiterin. Manchmal hat sie das Gefühl, dass sie schon ihr halbes Leben einsam ist, seit ihre Eltern starben. Esther war die einzige Freundin, die sie jemals verstanden hat, und nun liegt Esther begraben im Herzen eines Sterns am anderen Ende der Galaxie.
Baz scheint das anders zu sehen. »Sie waren stets unabhängig, Lieutenant Vidal. Das ist nichts Schlechtes. Lernen Sie, es anzunehmen. Nicht jeder muss überall beliebt sein.«
Am liebsten hätte Noemi laut gelacht. Für so jemanden hätte sie bestimmt niemand gehalten.
Seit Esthers Tod hat es nur eine Person gegeben, der sie etwas bedeutet hat. Jemanden, der sogar besser verstand als Esther, was in ihrem Innern vorging.
Jemanden, den keiner auf Genesis überhaupt als Person bezeichnen würde.
Die Stimme ihrer Vorgesetzten wird sanfter, nachdenklicher. »Ich weiß, dass einige Mitglieder der Zweiten Katholischen Kirche meditieren. Tun Sie das auch?«
»Ich habe es versucht. Aber ich bin nicht besonders gut darin.«
»Das ist das Geheimnis der Meditation – niemand ist gut darin.« Ein Lächeln huscht über Baz’ Gesicht. »Es ist wichtig, dass Sie Ihre Mitte finden, Vidal. Sie müssen wieder ins Gleichgewicht kommen. Wenn Ihnen das gelingt, werden es die Menschen in Ihrer Umgebung sicherlich spüren.«
»Mag sein«, erwidert Noemi höflich. Sie gibt dem Ganzen eine Erfolgsquote von ungefähr null Prozent.
Entweder bemerkt Baz Noemis Skepsis nicht oder es kümmert sie nicht. »Wenn Sie das nächste Mal meditieren, möchte ich, dass Sie sich zwei Fragen stellen. Wogegen kämpfen Sie, Noemi Vidal? Und wofür kämpfen Sie?«
Diese Fragen berühren Noemi stärker, als sie erwartet hätte. Verwirrt starrt sie auf den Boden und nickt.
»Sie können gehen«, sagt Captain Baz. Zumindest verfolgt sie das Thema Meditation nicht weiter. »Bemühen Sie sich, beim Rausgehen niemandem auf die Füße zu treten.«
»Ja, Captain. Aber – ich wollte Sie noch nach den Sternen fragen. Haben die Wissenschaftler schon herausgefunden, was das ist? Wofür sie gedacht waren?«
Baz zuckt die Schultern. »Bislang hat niemand eine Ahnung. Es hat sich nichts Naheliegendes ergeben. Und auch nichts weniger Naheliegendes. Vielleicht war es gar nichts Offizielles und auch nichts Ernstes. Vielleicht hat es ein Erdbewohner mit mehr Geld als Verstand zu seinem neuen Hobby gemacht, uns zu schikanieren.«
»Vielleicht«, sagt Noemi. Eigentlich kann sie sich das nicht vorstellen. Diese Flugkörper von der Erde sollten ihnen schaden, davon ist sie überzeugt.
Falls diese Attacke nichts bewirkt hat, bedeutet es nur, dass neue kommen werden. Und dann wird Noemi keine Chance haben, sie abzuschießen.
2
Eine halbe Galaxie entfernt, auf einer üppig grünen Ferieninsel vor der chinesischen Küste, betätigt sich Abel als Partycrasher.
»Danke«, sagt er zu dem George-Modell, das ihm seine Identitätsmarke zurückgibt, die Abel persönlich mit falschen Daten gefüttert hat. George-Mechs besitzen gerade genügend Intelligenz, um eher eintönige Verwaltungsaufgaben zu erledigen, und dieser George hat nur die Routinechecks durchgeführt, genau wie von Abel einkalkuliert. Man müsste ihn schon eingehender überprüfen, um irgendwelche Ungereimtheiten zu entdecken. Selbst einem Menschen würde wahrscheinlich nicht auffallen, dass dieser Partygast nicht wirklich Kevin Lambert heißt, nicht seit seiner Geburt in Großbritannien lebt und kein potenzieller Investor von Mansfield Cybernetics ist.
Die Party findet in einer riesigen, ovalen, durchsichtigen Blase statt, die knapp über dem Meer schwebt und an die sich einige schummrige Nebenräume und Korridore schmiegen wie eine Metallfassung um einen Edelstein. Bislang hat Abel zweihundertsiebzehn Partygäste ermittelt; er wird die endgültige Zahl festlegen, wenn er auch die Leute in den Toiletten und in den Gängen berücksichtigt hat. Auf drei Partygäste kommt mindestens ein Service-Mech, Dogs und Yokes reichen Tabletts mit Essen herum, ein paar spärlich bekleidete Fox- und Peter-Modelle sind zweifellos für Vergnügungen nach der Party gedacht, und in einer Ecke musizieren drei Oboe-Mechs, aber nur so laut, dass sich die Gäste noch unterhalten können.
Abels Informationen über die derzeit populäre Musik sind nach den dreißig Jahren seiner Gefangenschaft äußerst lückenhaft. Er muss immer noch Versäumtes aufholen. Nach fast einem Jahrhundert langsamerer, sanfterer, neoklassischer Musik erfreuen sich schnelle Rhythmen erneut großer Beliebtheit. Dieser Song mit einhundertvierzig Beats pro Minute soll gewiss den menschlichen Herzschlag in einem Zustand der Erregung widerspiegeln und dadurch die Zuhörer sowohl auf bewusster als auch unbewusster Ebene stimulieren …
Doch dann unterbricht er seine Analyse und fragt sich schlicht: Gefällt dir das?
Ja. Es gefällt ihm.
Lächelnd mischt sich Abel unter die versammelten Gäste. Er ist umgeben von den Reichen und Schönen, überall sieht man schlanke Körper in prächtig gemusterten Kimonos, in maßgeschneiderten Jacken und Hosen, die die körperlichen Vorzüge ihrer Träger unterstreichen, und in seidenen Kleidern, die jede Rundung – oder deren Fehlen – betonen.
Nur 3,16 Meter unter dem durchsichtigen Boden wogt das dunkle Wasser, bilden sich unter den Füßen der Gäste Wellen, die sich an der Küste in der Ferne brechen. Bänder aus sanftem Licht wandern rhythmisch an den Wänden herab, als würde die Beleuchtung direkt bis hinunter ins Meer fließen.
Der in Abels schwarzem Seidenjackett verborgene Datenleser vibriert einmal. Statt ihn herauszuziehen, tippt Abel auf seine Brusttasche und schränkt seine Hörweite ein. Sofort wird das Gemurmel der Menge leiser.
»Wie geht’s dort unten?«, fragt Harriet Dixon, die als Pilotin auf Abels Schiff, der Persephone, arbeitet. Normalerweise versprüht sie quirligen Optimismus, doch sie wird nervös, wenn sie merkt, dass Abel ihr etwas verschweigt. »Hast du das ›große Glitzerding‹ schon verscherbelt?«
Er schnappt sich ein Glas Champagner vom Tablett einer in der Nähe stehenden Yoke, um seine Rolle als Partygast zu perfektionieren. »Noch nicht.«
Das stimmt nicht. Er hat den Diamanten, den sie auf einem Meteor in der Nähe des Saturn zutage gefördert haben, sofort nach der Landung auf der Erde verkauft. Was ihn wirklich hierherführt, betrifft Harriet und ihren Lebensgefährten Zayan Thakur nicht. Sie einzuweihen, würde sie nur in Gefahr bringen. Abel hat in letzter Zeit begonnen, sich mit den moralischen Aspekten von Lügen eingehender auseinanderzusetzen.
»Solange du ihn nicht in einem Casino verspielst«, meint Harriet. »Dieser Stein wird uns so viel bringen, dass wir locker ein paar Monate über die Runden kommen! Zumindest wenn du es richtig anstellst.«
»Keine Sorge«, beruhigt sie Abel. Tatsächlich würde der Preis, den er erzielt hat, die Betriebskosten eines gesamten Jahrs decken. Abel wird Harriet und Zayan mit jeweils einem Drittel am Erlös beteiligen, aber er hat beschlossen, größere Einnahmen von nun an in kleinen, regelmäßigen Raten auszuzahlen. Als er seine neuen Crew-Mitglieder vor sechs Monaten kennenlernte, waren sie nahe am Verhungern. Die normale psychologische Reaktion auf solch einen Mangel ist der Impuls, jedes eingenommene Geld sofort wieder auszugeben, manchmal sogar für puren Luxus zu verschwenden. Das betrifft nicht nur Harriet und Zayan; die meisten Vagabunden sind so daran gewöhnt, nur das Nötigste zum Leben zu haben, dass sie mit plötzlichem Wohlstand oft gar nicht umgehen können. Abel dagegen können Luxusgegenstände nicht in Versuchung führen.
Seine einzige Versuchung lauert am anderen Ende des Erd-Systems und wird von Sicherheitssatelliten bewacht – das Genesis-Tor.
Der Weg, der zu Noemi zurückführen und vermutlich seinen Tod bedeuten würde.
Manchmal denkt er, diese Reise wäre den Preis wert.
»Ich verspreche, dass ich ihn nicht verspielen werde«, bekräftigt Abel. »In zwei Stunden müsste ich wieder auf der Persephone sein.«
»Das will ich dir auch geraten haben.« Zayan ruft es von seiner Ops-Station herüber. »Oder wir stellen die gesamte Erde auf den Kopf, um dich zu finden.«
»Und die Stationen der Sicherheitskräfte.« Harriet hat mitbekommen, dass Abel falsche Identitäten benutzt und Queen- und Charlie-Modellen tunlichst aus dem Weg geht. Obwohl sie hochintelligent ist, hat sie verständlicherweise den genauen Grund dafür noch nicht erraten. Zweifellos nimmt sie an, dass er in einem der Planetensysteme mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. »Du hast mehr Glück als alle Vagabunden, die ich kenne. Aber jeden verlässt irgendwann das Glück, Abel.«
Abel hat kein »Glück«. Er kennt sich nur besser mit Wahrscheinlichkeiten aus als jede biologische Lebensform. Doch der Effekt ist fast derselbe. »Du brauchst nicht in den Sicherheitsstationen zu suchen. Versprochen.« Als ein George-Modell in das akustische Zentrum des Raums tritt, fügt Abel noch hinzu: »Ich melde mich, sobald ich hier fertig bin. Captain Ende.«
Kaum hat er den Datenleser ausgeschaltet, als die Musik mitten im Lied aufhört. Die menschlichen Partygäste verstummen genauso plötzlich wie die Mech-Band.
Ein Spot richtet sich auf den George, der verkündet: »Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für das Programm des heutigen Abends. Mansfield Cybernetics möchte Ihnen Ihre Gastgeberin vorstellen, die renommierte Wissenschaftlerin und Philosophin Dr. Gillian Mansfield Shearer.«
Applaus brandet auf, als eine Frau Anfang vierzig ins Scheinwerferlicht tritt. Ein Stück entfernt hört Abel jemanden flüstern: »Unglaublich, dass sie heute Abend hier ist. Ich hätte gedacht, sie würde eine Vertretung schicken …«
»Das hier ist wichtig«, sagt der Begleiter der Person. Abel interessiert sich nicht für diese Leute. Er konzentriert sich einzig auf Gillian Shearer. Das gleißende Licht lässt ihr rotes Haar schimmern. Mit ihren 154,12 Zentimetern ist sie kleiner als die durchschnittliche menschliche Frau, aber an ihrer Haltung und ihrer intensiven Ausstrahlung lässt sich ablesen, dass sie Macht besitzt. Ihr schlichtes schwarzes Kleid wirkt in einem Raum voller prächtiger Abendroben und Anzüge aus Seide fehl am Platz – als hätte sich der Teilnehmer an einer Beerdigung hierher verirrt. Das Kleid hängt ein wenig unförmig an ihr herunter; entweder hat sie in kurzer Zeit viel an Gewicht verloren, oder sie gehört einfach zu den Menschen, die Mode für Zeitverschwendung halten.
Dr. Shearer besitzt eine markante Nase und einen spitzen Haaransatz. Diese Merkmale hat sie mit Abel gemeinsam, denn sie haben sie von derselben DNA geerbt.
Abel ist Burton Mansfields Schöpfung, Gillian Shearer seine Tochter.
Abel schiebt sich hinter einen hochgewachsenen Partygast. Wahrscheinlich können Gillians menschliche Augen gegen das grelle Scheinwerferlicht die genauen Gesichtszüge der Umstehenden nicht erkennen, doch Abel möchte kein Risiko eingehen. Womöglich bemerkt sie seine starke Ähnlichkeit mit einem jüngeren Mansfield oder erinnert sich vielleicht sogar an ihn selbst.
Abel jedenfalls erinnert sich an sie.
»Ich wünschte, ich könnte noch einmal mit Mommy reden. Mommy wusste immer, was man machen muss, damit es nicht mehr wehtut.« Gillian sieht zu ihm auf, in ihren blauen Augen stehen Tränen, als er vorsichtig den Hautersatz auf ihre blutigen Knöchel klebt; sie meint, dass er das besser kann als die Tare, ihr Medizin-Mech. Zu diesem Zeitpunkt ist Gillian acht Jahre, einen Monat und vier Tage alt. »Daddy sagt, dass ich eines Tages wieder mit Mommy sprechen kann, aber warum geht das nicht jetzt?«
Robin Mansfield ist einige Monate, bevor Abel das Bewusstsein erlangt hat, gestorben. Er hat eigentlich gedacht, dass Burton Mansfield nicht an ein höheres Wesen glaubt, aber vielleicht kann die Vorstellung von einem Himmel ja ein Kind trösten. »Bis dahin dauert es noch sehr lange.«
»Es soll jetzt sein! Daddy hat es nicht richtig hingekriegt.« Gillians finsterer Blick wirkt zu grimmig für ihr kleines Gesichtchen. »Stattdessen hat er dich gemacht, damit du dich um mich kümmerst.«
»Und noch für andere Zwecke«, sagt Abel, während er den Hautersatz mit den Fingerspitzen glatt streicht, stolz, der Tare vorgezogen worden zu sein. »Aber natürlich werde ich mich auch um dich kümmern.«
Vielleicht sollte er liebevoll an sie zurückdenken. Doch alles, was ihn an Burton Mansfield erinnert, ist für Abel vergiftet, womöglich für immer – inklusive seiner Tochter.
»Verehrte Gäste«, beginnt Gillian. Dass ihre Stimme im Erwachsenenalter tiefer und volltönender geworden ist, war zu erwarten, dennoch ist es für Abel gewöhnungsbedürftig. »Seit zwei Generationen ist Mansfield Cybernetics einzigartig in seiner Fähigkeit, die künstlichen Intelligenzen, die das Fundament unserer Gesellschaft bilden, zu schaffen, zu verbessern und zu perfektionieren. Inzwischen kann man sich kaum mehr vorstellen, wie wir ohne sie zurechtkämen: ohne die Bakers und Items, die komplexe, aber eher eintönige Aufgaben übernehmen, ohne die Dogs und Yokes, die die körperliche Arbeit verrichten, ohne die Mikes und Tares, die uns versorgen, wenn wir krank sind, ohne die Nans und Uncles, die sich um unsere Kinder und unsere Senioren kümmern, und ohne die Queens und Charlies, die überall in der Galaxie für unseren Schutz sorgen.«
Kurz erfüllt höflicher Applaus den Raum. Einen Meter von Abel entfernt steht eine Yoke mit einem Tablett Champagnergläser in der Hand, ein nützlicher Gegenstand in Menschengestalt. Abel kann es Gillian nicht verübeln, dass sie in einer Yoke nicht mehr sieht als das; das Ich-Bewusstsein, das er kennt – seine Seele, wie Noemi es ausgedrückt hat – besitzt außer ihm kein anderer Mech. Aber wenn er in die Augen der Yoke blickt, wünscht er sich, er könnte darin ebenfalls eine Seele entdecken.
Gillian deutet auf einen Bildschirm, der aufleuchtet, als der Scheinwerfer erlischt. Verschiedene Mech-Modelle erscheinen in wechselnder Reihenfolge – Queens mit ihrer Löwenmähne, perfekt zum Kampf ausgelegt; schlichte Dogs für die körperliche Arbeit; silbern glänzende, nicht menschlich aussehende X-Rays, auf die Gesichter projiziert werden können. »Wir entwickeln jedes der fünfundzwanzig produzierten Mech-Modelle ständig weiter. In den Grundzügen sind diese Modelle jedoch seit Jahrzehnten unverändert geblieben – in erster Linie, weil sie ihre Dienste stets kompetent und zuverlässig verrichten. Doch mein Vater und ich haben an diesen Modellen noch aus einem anderen Grund festgehalten: Wir wollten keine drastische Neuerung auf den Markt bringen, bis wir eine wirklich bahnbrechende Innovation vorweisen konnten.« Auf dem Bildschirm werden die Tanks, in denen die Mechs in menschlicher Gestalt heranreifen, von roten Blasen abgelöst. Kraftfelder? Ein Polymer? Anhand der visuellen Daten allein kann Abel es nicht bestimmen. Im Innern der Blasen sind jedenfalls schattenhaft fötale Formen zu erkennen. Gillians Miene bleibt ernst, aber sie reckt das Kinn, sodass ihr Gesicht in den purpurroten Schein dieser Zukunftsvision getaucht ist. »Nun endlich sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass uns ein Durchbruch gelungen ist.«
Wieder ertönt Applaus, diesmal noch begeisterter als zuvor, als die Blasen die Form von zwei Embryonen mit hell leuchtenden Mech-Komponenten in der Region des Kopfs annehmen. Die Embryonen werden rasch zu Föten, dann zu Kleinkindern und schließlich zu ausgewachsenen Mechs – aber diese sind kein Charlie und keine Queen, sondern tragen Gesichtszüge, die die Kinder der beiden haben würden, wenn sie sich fortpflanzen könnten.
Nun können sie es anscheinend.
»Organische Technologie«, verkündet Gillian. »Das extrem strapazierfähige innere Gerüst besteht nicht aus Metall, sondern aus organischen Verbindungen, die so manipuliert wurden, dass sie ein weitaus stabileres Material als Knochen bilden können. Die geistigen Fähigkeiten werden eine individuellere Programmierung erlauben, wobei die wichtige Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine erhalten bleibt. Ein Selbstreparatur-Mechanismus geht über die Fähigkeit, kleine Verletzungen zu heilen, hinaus und macht die nächste Mech-Generation nahezu unsterblich. Wir nennen sie Inheritors: Mechs, die das Beste aus der Vergangenheit mit den Visionen für eine bessere Zukunft vereinen. Das hoffen wir unserer Galaxie anbieten zu können – und zwar nicht erst in Jahrzehnten, sondern bereits in den nächsten zwei, drei Jahren.«
Während es im Saal wieder hell wird, hebt aufgeregtes Gemurmel an. Abel versteht, warum. Diese Menschen erwarten nicht nur bessere, nützlichere Mechs, sondern auch Investitionsmöglichkeiten, die sie noch reicher machen, als sie sowieso schon sind. (Er hat beobachtet, dass die menschliche Gier fast immer weit über die menschlichen Bedürfnisse hinausgeht.)
Sein erster Gedanke ist ein völlig anderer: Bald werde ich buchstäblich zum alten Eisen gehören.
In vielerlei Hinsicht. Mit einer Ausnahme: Die neuen Mechs werden mental begrenzt sein; sie werden kein Bewusstsein entwickeln. Doch zu wissen, dass irgendein Mech irgendwo auf irgendeine Weise höher entwickelt sein wird als er – das ist ein ganz neues Gefühl und es gefällt Abel nicht.
Er hat Gerüchte darüber aufgeschnappt, hauptsächlich Wissenschaftsklatsch vom Planeten Cray, vor allem von Virginia Redbird. Die Neugier auf eine mögliche neue kybernetische Produktlinie hat ihn hierhergelockt. Aber er hatte gehofft, die neuen Mechs seien mehr wie er. Eher Menschen als Maschinen.
Dann wäre er nicht länger allein.
»Organische Mechs«, fährt Gillian fort, »werden sich fortpflanzen können, wodurch die Herstellungskosten sinken.« Mit erhobener Augenbraue fügt sie trocken hinzu: »Keine Angst, die Reproduktion wird nur auf Nachfrage stattfinden, es wird also keine unliebsamen Überraschungen geben. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir die Schwangerschaftsdauer unter neun Monate drücken können – da werden menschliche Mütter vermutlich vor Neid erblassen.«
Während die Zuhörer dies lachend quittieren, wägt Abel die möglichen Folgen ab. Der Gedanke an einen schwangeren Mech, der etwas in sich trägt, was eher ein Werkzeug ist als ein Kind – etwas, was zur Sklaverei verdammt ist –, empört ihn zutiefst. Menschen würden eine solche Reaktion dem Urinstinkt zuschreiben. Abel weiß nur, dass er den Gedanken unerträglich findet.
Auch Gillian wirkt beunruhigt, sie hält den Blick gesenkt, aber ihre Stimme klingt unverändert, als sie mit der Beschreibung ihrer Neuschöpfungen fortfährt. »Sie sind billiger in der Herstellung und daher preisgünstiger. Sie behalten alle Vorteile der Mech-Arbeitskraft bei, während gleichzeitig die Nachteile beseitigt werden. Heute Abend werde ich hoffentlich mit jedem von Ihnen persönlich über unsere Forschungen sprechen können und auch darüber, welches Potenzial dies für unser Unternehmen birgt, für Ihre Beteiligung an unserem nächsten großen Projekt und für die Verbesserung unserer gesamten Gesellschaft – alles durch die Schaffung des höchstentwickelten Mechs, den es je gegeben hat.«
Abel ist zwar der Meinung, dass dieser Titel immer noch allein ihm gebührt, aber dies zu erwähnen würde zweifellos ihre bisher so reibungslose Präsentation durcheinanderbringen.
»Die Vision meines Vaters hat schon einmal diese Galaxie verändert.« Das Blau von Gillians Augen ist so stechend wie das einer Gasflamme. »Sein Vermächtnis lässt noch Größeres möglich erscheinen. Mansfield Cybernetics möchte nicht nur in der Mech-Technologie eine Führungsrolle einnehmen, sondern auch durch eine revolutionäre Zukunftsvision, die verspricht, die menschlichen Fähigkeiten auszuweiten. Mit Ihrer Hilfe können wir den nächsten Wandel in der Galaxie einläuten … gemeinsam.«
Der lauteste Beifall dieses Abends bricht los, als sie vom Podium herabsteigt und den Oboe-Mechs zunickt, die ihr Lied an exakt der Stelle wiederaufnehmen, an der sie aufgehört haben. Keiner dieser Mechs zeigt auch nur die geringste Reaktion ob dieser Offenbarungen. Man hat ihnen dazu nicht die nötige Intelligenz einprogrammiert.
Abel jedoch wird Gillians Rede noch lange beschäftigen. Sie hat nicht seine Hoffnungen erfüllt, einen anderen Mech wie ihn zu finden, ist aber trotzdem bedeutsam …
Seine visuellen Sensoren haben eine Bedrohung ausgemacht: Gillian Shearer, die ihn direkt anstarrt.
Ihr Blick verweilt nur 0,338 Sekunden auf ihm, nicht lang genug, um ihn sofort zu enttarnen, doch mehr als lang genug, um einen nicht akzeptablen Risikograd darzustellen. Ohne einen Blick zurück macht sich Abel aus dem Staub.
Er schlängelt sich durch die Menschenmenge, bewegt sich gegen die Masse derer, die nach vorne drängen, näher zu Gillian, um mehr über die Zukunftsvision zu hören, die sie ihnen anbietet. Die Gehgeschwindigkeit muss genau austariert werden, er muss den Nutzen der Eile gegen die Kosten, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, abwägen.
Seine Berechnungen müssen allerdings falsch gewesen sein, denn durch das Stimmengewirr macht er Gillians Stimme aus. »Dieser Mann da – der Blonde –, er kommt mir bekannt vor, kannst du –«
Abel schlüpft in einen der düsteren Seitenkorridore, die zu Toiletten und Cateringräumen führen, findet eine freie Toilette und sperrt die Tür hinter sich ab. Dann kniet er sich hin und durchschlägt mit einem Fausthieb den durchsichtigen Boden.
Die Gischt und das Dröhnen der Wellen dringen in den Raum, als Abel ein Segment von ungefähr vierzig mal vierzig Zentimetern herausreißt und ins Meer springt.
Die Kälte des Wassers ist fast ein Schock. Mit kraftvollen Bewegungen schwimmt Abel zwischen blauschwarzen Algen und Schwärmen winziger, silbrig glänzender Aale hindurch, kämpft gegen die Strömung an und ist dankbar für seinen unfehlbaren Orientierungssinn und die Fähigkeit, den Atem länger anhalten zu können als jeder Mensch.
Sie werden den Schaden im Fußboden in frühestens drei und spätestens zehn Minuten entdecken. Falls mich Gillian erkannt hat, wird sie bereits die Sicherheits-Mechs an Land verständigt haben. Falls sie nur einen Verdacht hinsichtlich meiner Identität hegt oder sich aufgrund des unterlegenen menschlichen Gedächtnisses unsicher ist, wird sie erst nach der Entdeckung des Schadens Alarm auslösen. Im letzteren Fall hat er eine Chance, es zum Hangar der Persephone zu schaffen. Im ersteren Fall …
Mit diesem negativen Ausgang wird er sich erst befassen, wenn es so weit ist.
Kaum berührt Abels Fuß die Sandbank vor der Küste, hört er auf zu schwimmen und läuft los. Als er an den Strand stürmt, schreckt er die Gäste einer nächtlichen Party auf, die beim Anblick dieses wilden, plötzlich aus den Wellen auftauchenden Manns lachend zur Seite springen. Sand klebt an seinen Schuhen und den tropfnassen Kleidern, aber das hält ihn nicht auf.
Nachdem er den Strand hinter sich gelassen hat, braucht er sich nicht mehr an das menschliche Lauftempo zu halten. Innerhalb von 1,3 Sekunden hat er den Turbo eingelegt und hält direkt auf den Hangar zu. Währenddessen tippt er auf den Datenleser. »Harriet, Zayan, hört ihr mich?«
»Abel!« Zayan antwortet sofort. »Noch ein paar Minuten, und wir hätten uns ernsthaft Sorgen gemacht.«
»Sorgen kannst du dir jetzt machen«, sagt Abel. »Und starte sofort die Triebwerke. Mach das Schiff so schnell wie möglich startklar.«
Harriet ruft: »Wir haben dir doch gesagt, du sollst nicht …«
»Du kannst mit mir schimpfen, wenn das Schiff zum Abflug bereit ist.« Während er unter einer Hochbahn hindurch in einen kleinen, ungepflegten Park rennt, überschlägt er rasch die Zeit, die ihm bis zu einer möglichen Gefangennahme bleibt. Mit jeder Minute wird der Himmel dunkler. Die Nacht bricht herein. »Wenn ich nicht in zehn Minuten beim Schiff bin, fliegt ihr ohne mich. Dann gehört die Persephone euch.«
»Oh Gott, Abel, was hast du bloß getan?« Harriet klingt inzwischen eher entsetzt als wütend.
»Im Grunde nichts, aber die Sicherheitskräfte werden mir nicht glauben. Macht schon!«
Als er 6,1 Minuten später den Hangar erreicht, sind seine Haare und Kleider von der schieren Geschwindigkeit seines Laufs fast getrocknet. Abel wird nicht langsamer, während er auf den Eingang zu ihrer Landebucht zusteuert, nur einmal stoppt er kurz, als er ein Brecheisen sieht, das unbeaufsichtigt bei einem alten Vagabunden-Schrottkahn herumliegt. Es kostet ihn nur 1,3 Sekunden, es sich zu schnappen, immerhin könnte es ja sein, dass ihm jemand auflauert …
An der Tür zur Landebucht angekommen klammert er sich an den Rahmen, schwingt sich herum und zieht der auf ihn wartenden Queen das Brecheisen über den Schädel. Natürlich hatte sie sich an der Stelle auf der anderen Seite der Wand versteckt, die ihre Programmierung als die strategisch sinnvollste ausgemacht hat. Sie sackt zu Boden, nur noch ein regloses Stück Maschine, und Abel wirft das Brecheisen an seinen Platz zurück, bevor er die letzten Meter zur Persephone zurücklegt. Ihr silbernes, tropfenförmiges Äußeres schimmert in der düsteren Landebucht. Als sich die Tür vor ihm auffächert, ist er endlich wieder zu Hause.
»Ein sofortiger Abflug ist anzuraten«, ruft er, im Vertrauen darauf, dass das Kommunikationssystem eingeschaltet ist. Und tatsächlich zünden die Magnettriebwerke augenblicklich und das Schiff hebt ab. Welchen Funkspruch Gillian auch gesandt haben mag, er hat keinen planetenweiten Alarm ausgelöst, oder zumindest hatte sie nicht speziell die Persephone im Visier, denn er spürt, dass das Schiff die Schwerkraft des Planeten ohne Widerstand überwindet.
Als er auf die Brücke spaziert, ruft ihm Harriet über die Schulter zu: »Bist du völlig verrückt geworden?«
»Ich bin nicht verrückter als sonst«, entgegnet Abel.
Dafür erntet er einen finsteren Blick von ihr. »Das klingt weniger tröstlich, als du vielleicht meinst.«
Im Geist hört Abel Noemis Stimme. Du hast wirklich überhaupt kein Talent, einen zu beruhigen.
»Sieht nicht so aus, als würden wir Gesellschaft kriegen«, verkündet Zayan. »Unser Weg zum Erd-Tor Richtung Stronghold ist frei.« Gillian hat Abel wohl doch nicht richtig erkannt – sie sah in ihm nur einen Eindringling, jemanden, den man im nächsten Raumhafen überprüfen lassen, jedoch nicht unbedingt aufspüren und festsetzen sollte.
Aber es hätte leicht schiefgehen können. Um Haaresbreite hätte sie ihn erwischt. Abel hat zugelassen, dass seine Neugier sein Urteilsvermögen trübte; dadurch hat er nicht nur sich selbst, sondern auch seine Crew in Gefahr gebracht. Das ist inakzeptabel. In Zukunft muss er vorsichtiger sein.
»He, du bist ja ganz nass! Wollte dich jemand ertränken?«, will Harriet wissen.
»Dazu bin ich ein viel zu guter Schwimmer.« Abel erwartet nicht, dass diese Bemerkung ihre Laune hebt, und tatsächlich wird ihr Blick noch finsterer. »Immerhin bin ich wieder da, Harriet. Reicht das nicht?«
»Doch, natürlich.« Sie dreht sich zu ihm um, ihre langen Zöpfe fallen ihr dabei über die Schulter. Sie und Zayan tragen die übliche Vagabundenkluft, weite Hemden und leuchtend bunt gemusterte Hosen. Auf der in Schwarz und Silber gehaltenen Brücke der Persephone erinnert das junge Paar an exotische Schmetterlinge. »Wir machen uns nur Sorgen. Das ist alles.«
Zayan lacht. »Genau, wir würden niemals einen anderen Boss finden, der so gut zahlt wie du.«
Plötzlich fällt Abel auf, dass ihm ein mögliches Szenario entgangen ist – eine unerklärliche Schwachstelle in seinen Überlegungen. »Ihr hättet ohne mich fliegen können. Meine letzte Audioübertragung hätte euch gestattet, die Persephone ganz offiziell zu übernehmen.«
»Das würden wir dir niemals antun«, protestiert Zayan. »Komm schon, Abel. Weißt du das denn nicht?«
Harriet sieht ihn wieder an, aber dieses Mal ist ihr Blick nicht wütend, sondern eher bekümmert. »Hast du denn wirklich noch nie Freunde gehabt, dass du so etwas von uns denkst? Außer Noemi, meine ich.«
»Nein, habe ich nicht.« Eigentlich möchte Abel diese Unterhaltung nicht weiterführen. »Ich sollte mich umziehen.«
Abel spürt die Blicke seiner Crew-Mitglieder, als er von der Brücke eilt, doch sie versuchen nicht, ihn aufzuhalten.
Harriet und Zayan wissen nicht, warum ihr Captain keine Angst vor dem Ertrinken hat. Warum er regelmäßig falsche Identitäten benutzt und sich so weit wie möglich von Sicherheits-Mechs fernhält. Ihre Loyalität verbietet ihnen, zu fragen. Sie sind, wie Harriet gerade gesagt hat, nicht nur Angestellte, sondern Freunde.
Würden sie anders handeln, wenn sie wüssten, dass Abel kein Mensch ist? Dass er nicht nur ein Mech, sondern das Herzensprojekt des hochverehrten Burton Mansfield ist?
Wenn sie wüssten, dass Mansfield Abel zurückhaben will, weil Abels kybernetischer Körper der einzige ist, der ein menschliches Bewusstsein aufnehmen kann – Mansfields Bewusstsein, was den alten Mann vor seinem nahen Tod bewahren würde –, würden sie Abel dann ausliefern, um Mansfields Leben zu retten?
Manchmal beunruhigen Abel diese Fragen, aber er möchte die Antworten darauf gar nicht wissen.
Soweit er weiß, hat nur eine Person jemals das Leben eines Mechs als genauso wertvoll eingeschätzt wie das Leben eines Menschen. Diese Person befindet sich auf der anderen Seite des Genesis-Tors – weit entfernt von ihm, und zwar für immer.
Was würde Noemi Vidal zu den organischen Mechs sagen? Abel ist sicher, dass sie ähnlich fasziniert wäre wie er.
Seine Stimmung sinkt, als er sich die Zukunft dieser Technologie vorstellt: Mechs werden immer menschenähnlicher werden. Sicherlich wird eines Tags in einem von ihnen ein Bewusstsein erwachen – aber Mansfield lernt aus seinen Fehlern. Der nächste Mech mit einer Seele wird durch Programmierung so stark gebunden sein, dass Abels oberste Direktive dagegen wie ein bloßer Vorschlag wirken wird.
Wir werden keine Individuen mehr sein, denkt Abel, und zählt sich bereits zu diesen noch nicht geschaffenen Brüdern und Schwestern. Wir werden nicht mehr frei sein.
Wir werden Sklaven sein.
3
Als Noemi ohne handfeste Beweise für ihre Reise durch die Galaxie nach Genesis zurückkehrte, hätte sie im Gefängnis landen und sogar unehrenhaft aus der Armee entlassen werden können. Jeder diensttaugliche Jugendliche auf dem Planeten geht zum Militär; ihr Status als diskreditierte Ex-Soldatin hätte sie zu einer Außenseiterin gemacht – mehr noch als ohnehin schon. Einzig und allein eine Person hat sie vor diesem Schicksal bewahrt: Darius Akide, Mitglied des Ältestenrats und einst brillanter Student von Burton Mansfield.
Nun treffen sie sich alle paar Wochen. Noemi fällt auf, als sie die Treppe zur Halle der Ältesten hinaufsteigt, ein junges Mädchen in seiner smaragdgrünen Uniform zwischen lauter grauhaarigen, majestätischen Gestalten in herrschaftlich weißen Roben. Diese Treffen hat Akide angeregt, da er weiß, wie allein Noemi sonst ist. Indem er sie hierherbestellt, sendet er ein unmissverständliches Signal an die Öffentlichkeit aus, dass der Ältestenrat an ihre Version der Ereignisse glaubt. Er ist ihr wichtigster Verteidiger. Noemi ist dankbar oder weiß zumindest, dass sie es sein sollte.
Doch seit sie ein Mitglied des Ältestenrats kennt, sind ihr auch die Schwächen des Rats bewusst geworden – und wie diese Schwächen Genesis gefährden.
»Vermutlich ist es nicht überraschend, dass Sie eine solche Technologie wie diese mysteriösen sternenförmigen Raumsonden noch nie gesehen haben.« Akide sitzt an seinem Schreibtisch aus grob behauenem Stein, das grau melierte Haar am Hinterkopf zu einem Knoten geschlungen. Wie die meisten Räume in der Halle der Ältesten wird dieser tagsüber nur vom Sonnenlicht erhellt, das durch die ovalen, in die Wand gemeißelten Fenster flutet. »Haben Sie vielleicht in den Nachrichtenquellen irgendetwas mitbekommen oder in einer Unterhaltung etwas aufgeschnappt? Wir wissen immer noch nicht, welchem Zweck diese Sterne eigentlich dienen. Jeder noch so kleine Hinweis könnte für unsere Nachforschungen hilfreich sein.«
»Ich wünschte, ich könnte helfen.« Noemi versucht, ruhig zu bleiben. Akide ist noch am ehesten derjenige, den sie dieser Tage als Freund bezeichnen würde, doch manchmal scheint er zu erwarten, dass sie seit ihrer abenteuerlichen Reise alles über die anderen Welten des Planetenrings weiß. »Aber an so etwas kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.«
Akide seufzt. Mehr zu sich selbst murmelt er: »Waren es Sonden? Waffen, die versagt haben? Sollten sie uns nur Angst einjagen? Als wüssten wir nicht, welch große Bedrohung die Erde darstellt. Als wüssten wir nicht, wie gering unsere Chancen sind.«
»Reden Sie doch nicht so.« Plötzlich wird Noemi bewusst, wie sie gerade mit einem Ältesten gesprochen hat, und ihre Wangen färben sich flammend rot. »Entschuldigen Sie. Ich meine – wir haben schließlich Grund zur Hoffnung. Zum Beispiel gibt es überall im Planetenring potenzielle Verbündete.«
Er tätschelt ihren Arm, eine Geste, die väterlich gemeint ist, aber Noemi empfindet sie als gönnerhaft. Vielleicht würde sie anders darauf reagieren, wenn sie sich besser an ihren verstorbenen Vater erinnern könnte, doch da ist nur ein verschwommenes Bild von einem Lächeln und Umarmungen, und noch weniger ist ihr präsent, was es heißt, umsorgt, wertgeschätzt, wirklich wahrgenommen zu werden.
»Lieutenant Vidal«, sagt Akide. »Sie sind auf einem Planeten im Kriegszustand aufgewachsen. Sie wussten schon von klein auf, dass ein Sieg unwahrscheinlich ist und dass Sie Ihr Leben voraussichtlich im Kampf verlieren werden. Sie haben sich nie vor Ihren Pflichten gedrückt, auch nicht vor dem größten Opfer, aber vermutlich wollten Sie sich nie eingestehen, dass wir letzten Endes wohl unterliegen werden. Ich weiß, wie schwer es ist, damit seinen Frieden zu machen – doch Sie müssen es versuchen, zu Ihrem eigenen Besten. Sonst wäre der Schmerz …« Er senkt den Kopf. »Er wäre dann nicht auszuhalten.«
Immer geht es um Opfermut. Immer geht es um Pflicht. Um Resignation. Für einen Planeten im Krieg, denkt Noemi manchmal, hat Genesis zu wenig Ahnung vom Kämpfen.
An diesem Abend beschließt sie, den Tempel aller Glaubensrichtungen zu besuchen. Er ist eines der größten Bauwerke auf Genesis, und sicherlich das größte Heiligtum – eine riesige Kuppel aus grauem Granit mit blauen Einsprengseln ruht auf wuchtigen Säulen, so dick wie jahrhundertealte Bäume. Kleinere Räume, die von dem zentralen Bau abgehen, sind für die Gottesdienste der jeweiligen Religionen vorgesehen, ob dort nun gesungen, getanzt, gebetet oder ein Schlangenkult betrieben wird. Doch Noemi ist wegen etwas hier, das von fast allen Glaubensrichtungen praktiziert wird: Meditation.
Sie macht es sich auf einem der großen Kissen bequem. Es ist alt, hie und da geflickt, und der Stoff ist so abgerieben, dass er sich weich anfühlt. Licht fällt durch die hohen Spitzbogenfenster herein und wirft seine Strahlen in den weitläufigen Tempel. Als Noemi tief einatmet, riecht sie Räucherstäbchen.
An diesem Ort kann vielleicht sogar ihr geschwätziger Geist Ruhe finden.
Noemi schließt die Augen und erinnert sich an die zwei Fragen, die Captain Baz ihr gestellt hat:
Wogegen kämpfen Sie, Noemi Vidal? Und wofür kämpfen Sie?
Ehrlich gesagt erwartet sie nicht, dass bei dem Ganzen viel herauskommt. Es ist ein Anfang, mehr nicht. Denn eigentlich kennt sie die Antworten. Sie kämpft gegen die Erde, gegen ihre Mechs. Und sie kämpft für Genesis.
Doch plötzlich wird ihr bewusst, dass das nicht die Antwort ist – oder zumindest nicht die ganze Antwort. Sie kämpft auch um das Vertrauen ihrer Kameraden. Sie kämpft darum, dass Akide ihr zuhört, dass ihr Planet sich entschlossener zur Wehr setzt.
Und es ist ein Kampf, ohne Esther weiterzuleben. Ohne Abel.
Es ist ein Kampf, allein weiterzumachen.
Sie wusste schon als Kind, dass die meisten Leute sie nicht besonders mochten, und das hatte sie auch gar nicht erwartet. Ihre einzige richtige Freundin war Esther Gatson gewesen, ihre Pflegeschwester, die gar keine andere Wahl gehabt hatte, als Noemi in ihr Haus und in ihr Herz zu lassen – und Esthers Tod ist nun eine der Sünden, die ihr von den anderen angelastet werden.
Davor hatte Noemi zumindest gehofft, dass sie nicht für immer einsam sein würde. Dass sie irgendwie eines Tages herausfinden würde, wie man Nähe zu anderen Menschen herstellt oder sie zumindest nicht abschreckt – dass sie herausfinden würde, wo ihr Problem lag, damit sie es lösen konnte. Und als sie draußen in der Galaxie unterwegs war und Harriet und Zayan auf Kismet kennenlernte, Virginia auf Cray oder Ephraim auf Stronghold, schien sie es tatsächlich herausgefunden zu haben. Wenn man irgendwo neu anfängt, ist es einfacher, Freundschaften zu schließen.
Doch hier ist kein Neuanfang möglich. Die Lektionen, die sie in Sachen Freundschaft gelernt hat, lassen sich hier nicht anwenden. Sie ist noch isolierter als zuvor, und nun versucht sie zu akzeptieren, dass es wohl auf Dauer so bleiben wird.
Entspann dich, sagte Esther immer. Gib den Leuten Zeit, dich kennenzulernen! Sei nicht so nervös und geh nicht immer gleich in die Defensive. Wenn du keine Angst vor Zurückweisung hast, wird man dich auch nicht mehr so leicht zurückweisen.
Esther hatte recht gehabt. Noemi weiß, dass Menschen die Einsamen meiden. Aber wenn die Voraussetzung für das Schließen von Freundschaften darin besteht, nicht einsam zu sein, ist das ein Widerspruch in sich. Das ist ja so, denkt sie verbittert, als würde man einem Verhungernden sagen, er könne so viel Essen haben, wie er wolle, wenn er nur aufhöre, hungrig zu sein.
Es gab in ihrem Leben nur wenige Phasen, in denen sie das Gefühl hatte, das Hungern könnte vorbei sein. Obwohl, eigentlich gab es nur eine Zeit, in der sie nicht völlig allein war – nur eine Zeit, in der jemand sie verstand und sich um sie sorgte – sie sogar liebte, wie er sagte …
Noemi reißt sich von der Erinnerung los. An Abel zu denken, tut weh, aus tausend verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil sie weiß, dass sie ihn nie wiedersehen wird.
Abels Leben zu verschonen war der einzige Augenblick göttlicher Gnade, der Noemi jemals zuteilwurde, der eine Moment, in dem ihr Glaube zu einer lebendigen Kraft in ihr wurde. Eigentlich hatte sie gedacht, dass solch ein Moment tiefer Verbundenheit mit Gott all ihre Fragen beantworten würde. Dass ihr dann alles klar werden würde. Aber es hat sich herausgestellt, dass es so nicht funktioniert. Sie fühlt sich immer noch wie ein kleines Staubkorn in diesem riesigen Kosmos, ist sich unsicher, was richtig und gut ist.
Versuch es noch mal, fordert sie sich auf und schließt die Augen. Benutze das Mantra, das Baz dir gegeben hat.
Es hilft nichts. Meditation bringt ihr keinen Frieden, sondern erinnert sie nur daran, wie allein sie ist – und wie sehr sie fürchtet, dass diese Einsamkeit für immer anhalten wird.
»Möchtest du heute Morgen Toast?« Mrs Gatson fragt es im Ton einer Kellnerin, die im Restaurant einen Gast bedient. Und zwar einen neuen, keinen Stammgast. Dabei lebt Noemi seit neun Jahren bei den Gatsons.
Nach Esthers Tod haben die Gatsons bei einem Künstler in der Nachbarschaft ein Porträt von Esther in Auftrag gegeben. Das Bild hängt an der Wand, eine Kreidezeichnung, die Esthers goldblondes Haar und ihre blauen Augen treffend wiedergibt. Doch das Schweigen, das ihr Tod hinterlassen hat, dehnt sich jeden Morgen aufs Neue im Haus aus, bis Noemi glaubt, keine Luft mehr zu bekommen. Hier wird sie sich niemals wirklich zu Hause fühlen.
Das Haus ist in dem auf Genesis üblichen Stil gebaut – die Schlafräume liegen unter der Erde, die Wohnräume oberirdisch, mit großen »Fenstern« aus durchsichtigen Solarpaneelen. In Blumenkästen, die die Wand des großen gemeinschaftlichen Wohnraums säumen, wächst Gemüse, und Kräuter sprießen aus langen, schmalen Balken, die vom Boden bis zu Decke reichen und den Raum in Bereiche zum Kochen und Essen, zum gemeinsamen Wohnen und zum Arbeiten unterteilen. Unterhaltung findet man außerhalb des Heims, es sei denn, die Familie liebt Musik; Vids, Bücher und Ähnliches sind in Bibliotheken erhältlich und Schwimmbäder und Fitnessklubs befinden sich in den öffentlichen Sporthallen. Noemi konnte es sich nicht anders vorstellen, bis sie ihre Reise durch die Galaxie machte, zu den Welten im Planetenring, wo sie Virginia Redbirds Labor/Unterschlupf/Opiumhöhle auf Cray sah, Kismets luxuriöse Resorts mit ihrem lavendelfarbenen Meer und dem fliederfarbenen Himmel kennenlernte und den überwältigenden Wirbel an Aktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten erlebte, in den sich die sterbende Erde stürzt, um sich von ihrem nahen Ende abzulenken.
Einmal, als sie und Abel sich auf einem Asteroiden in der regenbogenfarbenen Wolke eines Sternennebels versteckten, sahen sie sich einen alten »Schwarz-Weiß-Film« aus dem zwanzigsten Jahrhundert an, in dem ein ehemaliges Liebespaar ganz unerwartet in Casablanca wieder aufeinandertrifft.
Wenn ich Abel nur noch ein einziges Mal wiedersehen könnte, denkt sie. Ohne die Last zweier Welten auf unseren Schultern. Wenn wir nur einfach … sein könnten.
»Noemi?« Mrs Gatsons Lächeln wirkt eingefroren, ihre Mundwinkel erinnern an eine exakt gefaltete Serviette. Die dunklen Ringe unter den Augen deuten auf eine schlaflose Nacht hin und ihre Stimme ist heiser. Ob sie krank wird? Vielleicht hat sie um Esther geweint; für die Gatsons ist Trauer etwas Privates. Sie teilen ihren Kummer nicht mit Noemi und haben auch keinerlei Anstalten gemacht, sie in ihrem Kummer zu trösten. »Möchtest du Toast?«
»Ja, Ma’am. Es tut mir leid. Ich bin heute Morgen mit den Gedanken woanders.«
Mrs Gatson wirkt entspannter, als sie etwas zu tun hat und Noemi nicht mehr direkt ansehen muss. »Hoffentlich keine Probleme auf der Basis?«
Ihre Pflegeeltern wissen sehr gut, dass Noemi seit ihrer Rückkehr mit nichts als Problemen zu kämpfen hat. Aber das ist kein angenehmes Thema für eine Unterhaltung. Die Gatsons möchten nur über angenehme Dinge sprechen. Als Esther noch lebte – ein wunderbarer, durch und durch guter Mensch – drehten sich die Unterhaltungen um sie, und die Anspannung war geringer. Jetzt fühlt sich jedes Gespräch an wie eine Prüfung, die Noemi bestehen muss.
»Alles in Ordnung«, antwortet Noemi.
Als Mr Gatson hereinkommt, erschrickt sie. Er sieht furchtbar aus, blass und verschwitzt wankt er auf zitternden Beinen umher. »Mary, ich – ich kriege diese Erkältung einfach nicht los.«
Mrs Gatson geht nicht zu ihm hinüber, sondern deutet auf einen Stuhl. »Ich bringe dir einen Saft«, erwidert sie mit bebender Stimme.
»Nein, lassen Sie mich das machen.« Rasch gießt Noemi ein paar Gläser Saft ein, während sich Mrs Gatson neben ihren Mann setzt. »Sieht so aus, als würden Sie beide etwas ausbrüten.«
»Du könntest dich anstecken«, warnt Mr Gatson. »Bleib auf Abstand und wasch dir die Hände, hörst du?«
»Ja, Sir.« Mit einem Lächeln reicht ihm Noemi das Glas. Sie sorgen sich um sie, auf ihre eigene, etwas distanzierte Art. Sie würden nicht wollen, dass ihr etwas zustößt.
Doch für Noemi werden die beiden immer Mr und Mrs Gatson bleiben, sie würde sie nie mit Onkel und Tante oder irgendwelchen Kosenamen ansprechen, die zeigen, dass sie sich jetzt schon genauso lange um Noemi kümmern wie früher ihre verstorbenen Eltern. Ihre Gesichter werden nie strahlen, wenn sie nach Hause kommt. Sie werden sie nie beim Abschied umarmen.
Mr Gatson reibt sich die Stirn. »Haben wir irgendwo Ingwertee?«
»Ich glaube, der ist aus, aber ich könnte einkaufen gehen«, bietet Noemi an. Bis ihr Captain Baz eine neue Aufgabe zuteilt, gibt es ja nichts Wichtiges zu tun.
»Das wäre schön«, sagt Mrs Gatson. Näher wird sie einem Danke nicht kommen. Unausgesprochen gehen die Gatsons davon aus, dass ihre Pflegetochter ihnen Höflichkeit und Hilfe schuldet – so verdient sie sich ihren Unterhalt.
Auf dem Weg zum Markt in ihrem Viertel fällt Noemi auf, dass heute weniger Fußgänger als sonst und kaum Radfahrer unterwegs sind. Es spielen auch weniger Kinder draußen. Nichts davon ist für sich genommen besonders auffällig, aber die Stille um sie herum gibt ihr das Gefühl, vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein.
Auf dem Markt angekommen steuert sie den Teestand an, nur um dann festzustellen, dass sowohl Ingwer- als auch Kamillen- und Pfefferminztee ausverkauft sind – jene Teesorten, die ihre erste Wahl wären, wenn jemand krank ist. Als sie nach einem Päckchen Holunderblütentee greift, kommt ein Kunde neben ihr ins Taumeln und lässt sich dann schwer auf den Boden sacken – wie es Leute tun, wenn sie Angst haben, sonst in Ohnmacht zu fallen.
»Es tut mir leid«, sagt der Mann und hebt die Hand, als wollte er die Frau vom Verkaufsstand fortwinken, die an seine Seite eilt. »Ich habe heute Morgen Fieber bekommen. Hätte es nicht riskieren sollen, rauszugehen. Ich muss mich nur ein paar Minuten ausruhen …«
Den Rest hört Noemi nicht mehr, denn auf einmal rauscht ihr das Blut laut in den Ohren. Ihr stockt der Atem, als sie auf die ausgestreckte Hand des Manns starrt – und auf die verräterischen weißen Linien, die seine Haut überziehen.
»Unmöglich«, flüstert sie, aber dann denkt sie an die Sterne, die auf Genesis einschlugen, die Sterne, von denen niemand wusste, welchen Schaden sie anrichten sollten. Nun weiß sie Bescheid.
Sie stürmt durch den Markt, schlängelt sich zwischen Ständen und Wagen hindurch, bis sie die öffentliche Kommunikationsstation findet. Mit zitternden Fingern tippt sie den Code für Darius Akides Amtsräume ein. »Hallo, hier ist Lieutenant Noemi Vidal für den Ältesten Akide.«
Ein Bild erscheint auf dem Schirm – es ist nicht Akides üblicher Assistent, sondern eine Vertretung. Stirnrunzelnd betrachtet er diese junge Frau, die irgendwie an den Code für das Allerheiligste gekommen ist. »Der Älteste Akide hat viele Verpflichtungen –«
»Sagen Sie ihm, dass ich es bin und dass es sich um einen absoluten Notfall handelt.« Noemi holt tief Luft. »Die Erde setzt biologische Waffen ein. Sie hat die Bevölkerung von Genesis mit der Spinnweben-Krankheit infiziert.«
Der Ältestenrat zweifelt ihre Nachricht nicht an, sondern tritt augenblicklich in Aktion. Noemi hätte sich über dieses Vertrauen gefreut, wenn es wenigstens irgendetwas Gutes bewirkt hätte.