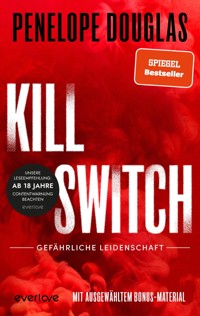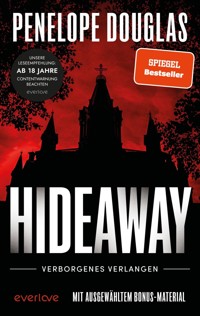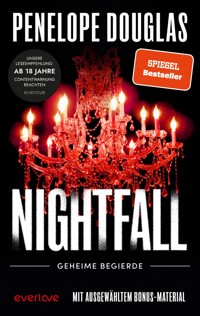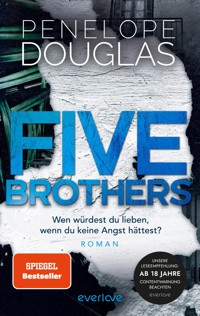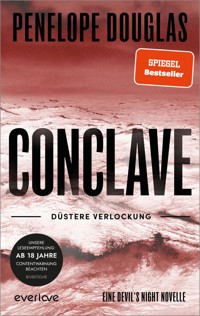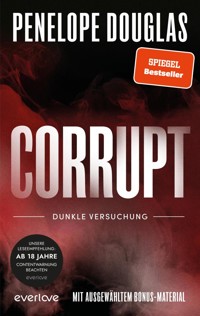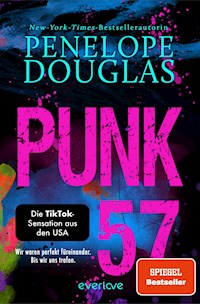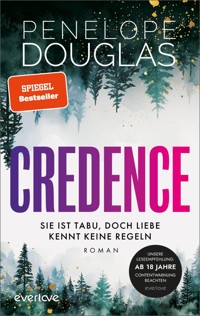
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist leicht, Regeln zu brechen, wenn niemand zusieht … Tiernan ist ein Leben in Luxus gewohnt. Doch nach dem Tod ihrer Eltern findet sie sich in der abgelegenen Wildnis Colorados wieder – in der Obhut von Jake, dem Stiefbruder ihres Vaters, der mit seinen beiden Söhnen in den Bergen lebt. Tiernan muss sich in dieser rauen Umgebung behaupten, während sie mit Verlust, Einsamkeit und ihrem Platz in der Welt ringt. Doch dann kommt der Winter, und Tiernan erkennt, was Familie wirklich bedeutet und dass nur die Regeln zählen, die sie zu brechen wagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Credence – Sie ist tabu, doch Liebe kennt keine Regeln« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Nadine Lipp und Isabelle Toppe
© Penelope Douglas 2020
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Credence«, Penelope Douglas LLC, Las Vegas, 2020
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Antje Steinhäuser
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Contentwarnung
Vorbemerkung der Autorin
PLAYLIST
1 – Tiernan
2 – Tiernan
3 – Tiernan
4 – Tiernan
5 – Jake
6 – Tiernan
7 – Tiernan
8 – Tiernan
9 – Noah
10 – Tiernan
11 – Tiernan
12 – Tiernan
13 – Tiernan
14 – Noah
15 – Tiernan
16 – Tiernan
17 – Jake
18 – Jake
19 – Tiernan
20 – Tiernan
21 – Tiernan
22 – Noah
23 – Tiernan
24 – Tiernan
25 – Tiernan
26
27 – Tiernan
28 – Tiernan
29 – Tiernan
30 – Tiernan
31 – Tiernan
32 – Tiernan
Zwei Monate später
33 – Tiernan
34 – Tiernan
35 – Tiernan
36 – Tiernan
Epilog – Kaleb
Fünf Jahre später
Credence
Bonusszene
Kaleb
Danksagung
Contentwarnung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Den Leserinnen und Lesern,die den Gipfel in ihr Herz geschlossen haben.
Contentwarnung
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Um euch das bestmögliche Leseerlebnis zu ermöglichen, findet ihr deshalb am Buchende[1] eine Contentwarnung.
Euer everlove-Team
Vorbemerkung der Autorin
Ich bedanke mich bei euch allen fürs Lesen!
Eine der besten Rezensionen, die ich je erhalten habe, bezog sich auf dieses Buch. Sie war insgesamt großartig, aber am besten gefiel mir, dass die Leserin meinte, sie wüsste nicht, in welche Sparte sie das Buch einordnen sollte. Für mich ist das ein großes Kompliment, denn ich wollte mit meinen Romanen nie in eine Schublade passen. Ich wollte immer die Freiheit haben, einer Laune zu folgen, die Freiheit, mich verändern zu können, jederzeit etwas Neues und anderes erschaffen zu können.
Ich habe gehofft, dass die Leser:innen darauf vertrauen, dass ich nichts Erwartbares schreibe, dass es keine Garantie dafür gibt, worauf sie sich mit jeder neuen Geschichte einlassen. Ich wollte sie auf verschiedene Reisen mitnehmen, weil ich selbst an verschiedene Orte reisen wollte.
Das hängt wahrscheinlich auch mit meiner freien Lektorin zusammen. Als ich mit dem Schreiben anfing, sagte sie, ich solle die negativen Besprechungen genauso annehmen wie die positiven. Was ich fürchten sollte, sei die Gleichgültigkeit der Leser:innen, denn das würde bedeuten, dass das Buch es nicht wert sei, sich daran zu erinnern. Bei Bully – Geliebter Quälgeist, Corrupt – Dunkle Verschwörung, Punk 57, Birthday Girl und Credence habe ich nicht herumgesessen und nach verrückten Ideen gesucht. Haha. Ich habe einfach meine Gedanken schweifen lassen und an Dinge gedacht, die meine Fantasie beflügelt haben, und dann habe ich mich gefragt, ob ich das so aufschreiben könnte, dass man es versteht. Bislang war die Herausforderung bei Credence am größten.
Ich wusste, dass sich einige nicht mit den Figuren identifizieren würden – oder zumindest noch nicht. Ich wusste, dass einige nicht das sehen würden, was ich hoffte, dass sie in den Van der Bergs sehen.
In Jake, der entdeckt, dass das Leben nicht vorbei ist.
In Noah, der verzweifelt nach dem Mut sucht, wegzugehen und seinen eigenen Weg zu finden.
In Kaleb und seiner Angst, sein Herz in die Hände einer anderen Person zu legen.
Und in Tiernan, die lernt, was manche von uns erst nach Jahren lernen: Dass das Leben wert ist, in vollen Zügen gelebt zu werden.
Aber mehr als alles andere hat mich überrascht, dass so viele Leser:innen das Haus oberhalb von Chapel Peak so sehr in ihr Herz geschlossen haben und dass diese Geschichte nach so vielen Jahren noch so viel Zuspruch erfährt. Das Schreiben und die Veröffentlichung dieses Buches ist eine der besten Erfahrungen, die ich je in Romance-Land gemacht habe, und ich danke euch, dass ihr es gelesen und rezensiert habt. Wie alles, was ich schreibe, beginnt auch diese Geschichte an einem Ort, an den ich zum Zeitpunkt des Schreibens gehen möchte, und es werden Dinge gesagt, die ich sagen möchte. Es ist eine schöne Bestätigung, zu sehen, wer mir folgt und bereit ist für das, was als Nächstes kommt. Ich liebe diese Welt, und ich hoffe, dass die Geschichten aller Figuren dieses Romans eines Tages wahr werden, denn ich könnte jederzeit wieder zum Gipfel zurückkehren.
Pen
PLAYLIST
»Blue Blood« von Laurel
»Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored« von Ariana Grande
»Dancing Barefoot« von U2
»Devil in a Bottle« von Genitorturers
»Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)« von Joan Jett
»Fire It Up« von Thousand Foot Krutch
»Gives You Hell« von The All-American Rejects
»I Found« von Amber Run
»Kryptonite« von 3 Doors Down
»Look Back at It« von A Boogie Wit da Hoodie
»Nobody Rides for Free« von Ratt
»The Hand That Feeds« von Nine Inch Nails
»Way Down We Go« von Kaleo
»Wow.« von Post Malone
1 – Tiernan
Merkwürdig. Die Reifenschaukel im Garten ist das Einzige, was darauf hindeutet, dass hier auch mal ein Kind gelebt hat. Im Haus hängen keinerlei Kinderzeichnungen, weder am Kühlschrank noch an den Wänden. In den Regalen stehen keine Kinder- oder Jugendbücher, an der Eingangstür sind keine Schuhe einer dritten, jüngeren Person, am Pool liegt kein spaßiges Wasserspielzeug.
Es ist das Haus eines Paares. Nicht das einer Familie.
Ich schaue aus dem Fenster und beobachte, wie die Reifenschaukel, die an der Eiche hängt, hin und her schwingt. Abwesend reibe ich mein rotes Haarband zwischen den Fingern, die glatte Oberfläche fühlt sich gut an.
Er hatte immer Zeit, sie auf der Schaukel anzuschieben. Er hatte Zeit für sie.
Und sie für ihn.
Hinter mir ertönen Pieptöne und weißes Rauschen aus Walkie-Talkies. Auf der Treppe sind Schritte zu hören und über mir schlagen Türen zu. Die Polizei und die Sanitäter sind noch oben beschäftigt, aber sie werden sicher bald mit mir reden wollen.
Ich schlucke, aber ich blinzle nicht.
Als er sie vor zehn Jahren angebracht hat, dachte ich, die Schaukel sei für mich. Ich durfte damit spielen, aber meine Mutter war diejenige, die sie wirklich geliebt hat. Spätnachts beobachtete ich aus meinem Fenster, wie mein Vater sie anschubste. Ihr Spiel und ihr Lachen wirkten so magisch, dass ich gerne Teil davon sein wollte. Aber ich wusste, dass der Zauber verfliegen würde, sobald sie mich sehen würden.
Also blieb ich an meinem Fenster stehen und beobachtete sie nur.
So, wie ich es jetzt auch tue.
Ich beiße mir seitlich auf die Unterlippe und beobachte, wie ein grünes Blatt an der Schaukel vorbeifliegt und in dem Reifen landet, in dem meine Mutter so oft gesessen hat. Das Bild ihres weißen Nachthemds und ihrer blonden Haare, die durch die Nacht flattern, ist noch so lebendig. Gestern war das letzte Mal, dass ich sie so gesehen habe.
Hinter mir räuspert sich jemand, und ich blinzle schließlich und senke den Blick.
»Haben sie etwas zu dir gesagt?«, fragt Mirai mit tränenerstickter Stimme.
Ich drehe mich nicht um, aber nach einer Weile schüttle ich langsam den Kopf.
»Wann hast du das letzte Mal mit ihnen gesprochen?«
Das kann ich nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher.
Ich spüre, dass sie näher kommt. Als das Klirren der ersten Krankenwagentrage zu hören ist, die ruckelnd und krachend die Treppe hinunter und aus dem Haus getragen wird, bleibt sie stehen.
Während die Sanitäter die Haustür öffnen, recke ich mein Kinn vor und versuche, mich innerlich gegen den fernen Tumult draußen zu wappnen. Es wird Anrufe und Fragen geben, Hupen werden ertönen, wenn sich mehr Leute vor den Toren versammeln, und die Medienleute werden zweifellos gleich sehen können, dass zwei Leichen herausgefahren werden.
Wann habe ich das letzte Mal mit meinen Eltern gesprochen?
»Die Polizei hat im Badezimmer deiner Eltern Medikamente gefunden, Tiernan«, sagt Mirai mit ihrer sanften Stimme. »Auf der Packung stand der Name deines Vaters, also haben sie den Arzt angerufen und erfahren, dass er Krebs hatte.«
Ich bewege mich nicht.
»Sie haben mir nie davon erzählt«, sagt sie. »Wusstest du, dass dein Vater krank war?«
Ich schüttle wieder den Kopf, beobachte immer noch den schwankenden Reifen.
Ich höre, wie sie schluckt. »Anscheinend hat er verschiedene Behandlungen ausprobiert, aber es war ein besonders aggressiver Krebs«, sagt sie. »Der … Arzt hat gesagt, er hätte das Jahr nicht überlebt, Schatz.«
Draußen kommt ein Windstoß auf, der die Schaukel kräftig ins Wirbeln bringt, und ich beobachte, wie das Seil den Reifen dreht.
»Es sieht so aus … als ob sie …« Mirai bricht ab, unfähig, den Satz zu Ende zu bringen.
Ich weiß, wonach es aussieht. Ich wusste es, als ich sie heute Morgen gefunden habe. Toulouse, der Scottish Terrier meiner Mutter, hat an der Tür gekratzt und darum gebettelt, in ihr Schlafzimmer gehen zu können, also habe ich die Tür geöffnet. Es war schon seltsam genug, dass sie noch gar nicht aufgestanden waren, aber nun gut. Ich ließ den Hund hinein, und kurz bevor ich die Tür wieder schließen wollte, sah ich sie.
Auf dem Bett. In den Armen des jeweils anderen. Vollständig angezogen.
Er trug seinen Lieblingsanzug von Givenchy und sie das Kleid von Oscar de la Renta, das sie 2013 bei den Filmfestspielen in Cannes getragen hatte.
Er hatte Krebs.
Er lag im Sterben.
Sie wussten es, und meine Mutter hatte beschlossen, ihn nicht ohne sie gehen zu lassen. Sie hatte beschlossen, dass es ohne ihn nichts anderes auf dieser Welt für sie gab.
Nichts anderes.
Ich spüre ein Stechen hinter den Augen, es verschwindet aber gleich wieder.
»Die Polizei hat keinen Abschiedsbrief gefunden«, sagt Mirai. »Hast du …«
Ich drehe den Kopf in ihre Richtung, schaue ihr in die Augen, und sie verstummt sofort. Was für eine dumme Frage.
Ich presse die Zähne aufeinander und schlucke die Nadeln in meinem Hals hinunter. In all den Jahren mit Kindermädchen, Internaten und Ferienlagern, in denen sich andere Menschen als meine Eltern um mich gekümmert und mich erzogen haben, wurde ich ihnen gegenüber immer gleichgültiger. Aber es scheint noch Stellen in mir zu geben, wo ich verletzlich bin.
Sie haben mir keinen Brief hinterlassen. Selbst zu diesem Zeitpunkt gab es nichts, was sie mir sagen wollten.
Ich blinzle die Tränen weg, drehe mich um und starre wieder auf die Schaukel, die sich im Wind hin und her dreht.
Ich höre Mirai hinter mir leise schniefen und schluchzen, denn sie versteht. Sie weiß, was ich fühle, weil sie von Anfang an hier war.
Kurz danach sehe ich sie draußen vor dem Fenster, sie geht an mir vorbei, und ich habe nicht einmal bemerkt, dass sie den Raum verlassen hat.
Sie hat eine Schere in der Hand und stürmt direkt auf die Schaukel zu. Als sie die Schere ans Seil hebt, balle ich meine Fäuste zusammen und beobachte, wie sie am Seil säbelt, bis der Reifen nur noch an einzelnen Fasern hängt und schließlich zu Boden fällt.
Jetzt läuft mir eine Träne über die Wange, und zum ersten Mal, seit ich in diesem Sommer zu Hause bin, fühle ich so etwas wie Liebe.
Stunden später ist die Sonne untergegangen, das Haus wieder ruhig und ich allein. Fast. Die Reporter lungern noch immer vor den Toren herum.
Mirai wollte, dass ich mit zu ihr nach Hause komme. Sie wohnt in einem kleinen Ein-Zimmer-Apartment, obwohl sie sicherlich genug verdient, um sich etwas Größeres leisten zu können. Aber da sie Tag und Nacht bei uns war und mit meiner Mutter überall hinreiste, wäre es sinnvoller gewesen, gar keine Wohnung zu haben, geschweige denn eine größere. Ich lehnte höflich ab.
Sie hat Toulouse mitgenommen, denn dieser Hund versteht sich mit mir so gut wie mit einer scheuen Katze, und hat angekündigt, gleich morgen früh wiederzukommen.
Ich hätte netter zu ihr sein sollen. Als sie angeboten hat, bei mir zu bleiben, wollte ich einfach nur, dass alle verschwinden. Der Lärm und die Aufmerksamkeit haben mich nervös gemacht, und ich will nicht all die Anrufe mitbekommen, die Mirai heute Abend tätigen muss. Das würde mich nur daran erinnern, dass da draußen und in den sozialen Medien gerade die Hölle los ist.
Sie behaupten Sachen über meine Eltern.
Und sicher spekulieren sie über mich.
Und haben Mitleid. Und reden darüber, wann ich meinen Eltern in den Tod folgen werde, entweder durch eine Überdosis oder durch Selbstmord. Alle haben eine Meinung und denken, alles zu wissen. Ich habe ja früher schon gedacht, ich lebe in einem Goldfischglas, aber jetzt …
Ich gehe zurück zum Herd und atme aus. Meine Eltern haben mich mit dieser Scheiße allein gelassen.
Dampf steigt aus dem Topf auf, und ich schalte die Herdplatte aus und schütte die Ramensuppe in eine Schale. Ich reibe meine trockenen Lippen aneinander und starre die gelbe Brühe an, während mein Magen knurrt. Ich habe den ganzen Tag über nichts gegessen oder getrunken, bin mir aber gar nicht sicher, ob ich wirklich Lust auf diese Suppe habe. Ich habe sie gekocht, weil ich schon immer den Prozess des Kochens mochte. Das Rezept, die Prozedur … Ich weiß einfach, was ich tun muss, und es hat etwas Meditatives.
Ich lege die Hände um die Schüssel und genieße die Hitze, die von der Keramik in meine Arme aufsteigt. Dann durchfährt mich ein Schauer, und ich hätte mich beinahe verschluckt, aber mir wird klar, dass das mehr Energie kosten würde, als ich habe.
Sie sind tot, und ich habe nicht geweint. Ich mache mir eher Sorgen um den morgigen Tag und darum, wie ich mit allem fertigwerden soll.
Ich weiß nicht, was ich tun soll, und die Vorstellung, in den kommenden Wochen Small Talk mit Studiobetreibern oder alten Freunden meiner Eltern zu führen, während ich meine Mutter und meinen Vater beerdige und alles in den Griff zu bekommen versuche, was ich geerbt habe, lässt mir die Galle hochkommen. Ich fühle mich krank. Ich kann das nicht.
Ich kann das nicht.
Sie wussten, dass ich mit solchen Situationen nicht umgehen kann. Ich kann nicht lächeln oder Gefühle vortäuschen, die ich nicht habe.
Ich krame Stäbchen aus der Schublade, stecke sie in die Schale und gehe die Treppe hinauf. Oben angekommen, mache ich vor ihrem Schlafzimmer keine Pause, sondern gehe gleich nach links, in mein eigenes Zimmer.
Während ich die Suppe zu meinem Schreibtisch trage, bleibe ich stehen, denn der Geruch der Ramen lässt meinen Magen knurren. Ich stelle die Schale ab, gehe zur Wand und lasse mich auf den Boden hinunterrutschen. Das kühle Hartholz beruhigt meine Nerven, und ich will mich am liebsten hinlegen und mein Gesicht darauf betten.
Ist es seltsam, dass ich heute Nacht im Haus geblieben bin, obwohl sie heute Morgen nebenan gestorben sind? Der Gerichtsmediziner hat den Todeszeitpunkt auf etwa zwei Uhr morgens geschätzt. Ich bin erst um sechs Uhr aufgewacht.
Meine Gedanken rasen, gefangen zwischen dem Wunsch, das Geschehene loszulassen und dem Wunsch, zu verarbeiten, wie alles passiert ist. Mirai kommt jeden Tag her. Wenn ich sie nicht gefunden hätte, hätte sie es getan. Warum haben sie nicht gewartet? Nächste Woche wäre ich wieder im Internat gewesen. Haben sie überhaupt daran gedacht, dass ich auch im Haus war?
Ich lehne den Kopf an die Wand, lege die Arme über die angewinkelten Knie und schließe die brennenden Augen.
Sie haben mir keinen Brief hinterlassen.
Sie haben sich angezogen, haben den Hund rausgelassen und haben Mirai erst für spät am Morgen einbestellt.
Sie haben mir keinen Brief geschrieben.
Ihre geschlossene Schlafzimmertür liegt genau gegenüber. Ich öffne die Augen, starre durch mein Zimmer, durch meine offene Tür, den langen Flur hinunter und zu ihrem Zimmer am anderen Ende des Flurs.
Das Haus klingt wie immer.
Nichts hat sich verändert.
Doch dann ertönt von irgendwoher ein leises Summen, und ich blinzle zu dem schwachen Geräusch, das mich so erschreckt, dass es mich in die Realität zurückholt. Was ist das?
Ich dachte, ich hätte mein Handy ausgeschaltet.
Die Journalisten wissen, dass sie sich mit Interviewanfragen an die Assistenten meiner Eltern wenden müssen, aber das hält die Gierigen – und das sind die meisten – nicht davon ab, meine persönliche Handynummer ausfindig zu machen.
Ich greife nach meinem Handy auf dem Schreibtisch, aber als ich es ausschalten will, sehe ich, dass es ausgeschaltet ist.
Das Summen geht weiter, und als mir klar wird, was es ist, macht mein Herz einen Sprung.
Mein privates Handy. Das, das in meiner Schublade liegt.
Die Nummer hatten nur meine Eltern und Mirai. Es war eine Nummer, unter der sie mich in dringenden Fällen erreichen konnten, da sie wussten, dass ich mein anderes Handy oft ausschaltete.
Sie haben diese Nummer aber nie angerufen, weshalb ich das Handy gar nicht mehr bei mir trug.
Ich stelle mich auf die Knie, greife in die Schreibtischschublade und ziehe das Ladegerät aus dem alten iPhone, lasse mich wieder auf den Boden fallen und schaue auf das Display.
Eine Nummer aus Colorado. Ich kenne niemanden in Colorado.
Und außerdem ruft mich niemand auf diesem Handy an. Vielleicht hat ein Journalist die Nummer irgendwie ausfindig gemacht? Aber sie ist nicht auf meinen Namen registriert, also kann das nicht sein.
Ich gehe ran. »Hallo?«
»Tiernan?«
Die Stimme des Mannes am anderen Ende ist tief, aber sie klingt leicht überrascht, so, als hätte er nicht erwartet, dass ich rangehe.
Oder er ist aufgeregt.
»Hier ist Jake Van der Berg«, sagt er.
Jake Van der Berg …
»Dein Onkel Jake Van der Berg.«
Und dann erinnere ich mich. »Der Bruder meines Vaters …?«
»Ja, genau genommen, Stiefbruder«, korrigiert er mich.
Das hatte ich völlig vergessen. Der Name Jake Van der Berg ist in diesem Haus nur selten gefallen. Ich bin nicht mit Verwandten aufgewachsen, also hatte ich die Tatsache, dass ich einen Onkel hatte, völlig verdrängt.
Meine Mutter ist bei Pflegeeltern aufgewachsen, kannte ihren Vater nicht und hatte keine Geschwister. Mein Vater hatte nur einen ihm entfremdeten jüngeren Stiefbruder, den ich nie kennengelernt habe. Ich habe nie Tanten, Onkel oder Cousins kennengelernt, und die Eltern meines Vaters waren tot, also hatte ich auch keine Großeltern.
Es gibt nur einen Grund, warum Jake Van der Berg mich nach siebzehn Jahren anruft.
»Ähm«, murmele ich und suche nach Worten. »Die Assistentin meiner Mutter wird sich um die Beerdigung kümmern. Ich kenne die Details nicht. Aber ich kann dir ihre Nummer geben.«
»Ich werde nicht zur Beerdigung kommen.«
Ich schweige kurz. Seine Stimme klingt gereizt.
Und er hat mir auch nicht sein herzliches Beileid ausgesprochen, was ungewöhnlich ist. Nicht, dass ich das nötig hätte, aber warum ruft er dann an? Denkt er, dass mein Vater ihn in seinem Testament erwähnt?
Ehrlich gesagt, könnte das sogar sein. Ich habe absolut keine Ahnung.
Aber bevor ich ihn fragen kann, was er will, räuspert er sich: »Der Anwalt deines Vaters hat mich vorhin angerufen, Tiernan. Da ich dein einziger lebender Verwandter bin und du noch minderjährig bist, haben dich deine Eltern offenbar in meine Obhut gegeben.«
In seine Obhut?
Offenbar. Das scheint auch für ihn neu zu sein.
Ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert.
Er fährt fort: »Aber in ein paar Monaten wirst du achtzehn. Ich werde dich zu nichts zwingen, also mach dir keine Sorgen.«
Okay. Ich zögere kurz und weiß nicht, ob ich erleichtert bin oder nicht. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass ich noch nicht volljährig bin und was das bedeuten könnte, jetzt, wo meine Eltern nicht mehr da sind. Aber er versicherte mir, dass es nichts bedeuten würde. Mein Leben würde sich nicht ändern.
Gut.
»Ich bin mir sicher, dass du dich, so, wie du aufgewachsen bist, viel besser in der Welt auskennst als wir, und dass du sehr gut auf dich selbst aufpassen kannst.«
»Wir?«, murmele ich.
»Meine Söhne und ich«, sagt er. »Noah und Kaleb. Sie sind nicht sehr viel älter als du. Nur ein paar Jahre.«
Ich habe also Cousins. Oder … Stiefcousins.
Wie auch immer. Spielt keine Rolle. Ich spiele mit dem hellblauen Faden an meiner Schlafshorts.
»Ich wollte dich das nur wissen lassen«, sagt er schließlich. »Wenn du frei sein willst, werde ich dir nicht im Weg stehen. Ich habe kein Interesse daran, dir alles noch schwerer zu machen, indem ich dich aus deinem Leben herausreiße.«
Ich starre auf den Faden, klemme ihn zwischen meine Nägel und ziehe fest. Okay, in Ordnung.
»Also dann … danke für den Anruf.«
Als ich das Handy vom Ohr runternehme, höre ich wieder seine Stimme. »Willst du denn herkommen?«
Ich halte das Handy wieder an mein Ohr.
»Ich wollte nicht so klingen, als wärst du nicht willkommen«, sagt er. »Das bist du. Ich dachte nur …«
Er verstummt, ich warte.
»Wir führen hier ein ziemlich abgeschiedenes Leben, Tiernan«, erklärt er dann und lacht kurz auf. »Für eine junge Frau ist das kein Vergnügen, vor allem nicht, wenn du mich gar nicht kennst.« Sein Ton wird ernst. »Dein Vater und ich, wir haben uns einfach nie verstanden.«
Ich sitze da und sage nichts. Ich weiß, es wäre höflich, mit ihm zu reden. Oder vielleicht erwartet er, dass ich Fragen stelle. Wie etwa, was zwischen ihm und meinem Vater passiert ist. Ob er meine Mutter gekannt hat.
Aber ich will nicht reden. Es ist mir egal.
»Hat er dir erzählt, dass wir in Colorado leben?«, fragt Jake leise. »In der Nähe von Telluride, aber oben in den Bergen.«
Ich atme ein und aus und wickle den Faden um meinen Finger.
»Bei schönem Wetter ist es nicht weit bis in die Stadt, aber im Winter sind wir monatelang eingeschneit«, fährt er fort. »Das ist etwas ganz anders als das Leben, das du kennst.«
Ich hebe den Blick und lasse ihn langsam durch das karge Zimmer schweifen, in dem ich so selten geschlafen habe. Regale voller Bücher, die ich nie zu Ende gelesen habe. Ein Schreibtisch voller hübscher Tagebücher, die ich gerne gekauft, aber in die ich kaum geschrieben habe. Ich habe darüber nachgedacht, das Zimmer in den Ferien neu zu gestalten, aber wie bei allem anderen auch, konnte ich mich nicht für eine Tapete entscheiden. Ich habe keine Fantasie.
Ja, mein Leben …
Das Gewicht der Tür meiner Eltern ragt vor mir auf.
Eingeschneit, hat er gesagt. Monatelang.
»Kein Kabelfernsehen. Kein Lärm. Manchmal kein WLAN«, sagt er. »Nur die Geräusche des Windes und des niederprasselnden Regens und des Donners.«
Mein Herz schmerzt ein wenig, und ich weiß nicht, ob es an seinen Worten oder an seiner Stimme liegt. Nur die Geräusche des Windes, des niederprasselnden Regens und des Donners.
Eigentlich klingt das großartig. Alles, was er erzählt, klingt gut. Niemand kann einem auf die Nerven gehen.
»Meine Jungs sind an die Abgeschiedenheit gewöhnt«, sagt er. »Aber du …«
Ich nehme den Faden wieder auf und wickle ihn um meinen Finger. Aber ich …?
»Ich bin hierhergekommen, als ich nicht viel älter war als du«, sinniert er, und ich kann das Lächeln in seiner Stimme hören. »Ich hatte weiche Hände und den Kopf voller Scheiße, und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich habe kaum gelebt.«
Ich spüre feine Nadelstiche im Hals und schließe die Augen.
»Aber der Schweiß und die Sonne haben mich gerettet.« Er seufzt. »Harte Arbeit bedeutet auch Trost, und es ist immer viel zu tun. Alles, was wir hier haben, haben wir uns selbst aufgebaut. Es ist ein gutes Leben.«
Vielleicht brauche ich genau das. Ausreißen, wie er es in meinem Alter getan hat. Etwas anderes ausprobieren, denn ich fühle mich nur noch müde.
»Hattest du ein gutes Leben?«, fragt er beinahe flüsternd.
Ich halte meine Augen geschlossen, aber ich fühle mich, als läge ein Lastwagen auf meiner Brust. Ich hatte ein tolles Leben. Ich habe einen Schrank voller Designerklamotten und -taschen, wie es sich für die Tochter eines berühmten Stars gehört. Ich bin in zwei Dutzend Länder gereist und kann mir alles kaufen, was ich will. Mein Haus ist riesig. Mein Kühlschrank ist gut bestückt. Wie viele Leute würden gerne mit mir tauschen? Wie glücklich ich doch sein müsste.
»Willst du herkommen, Tiernan?«, fragt er noch einmal.
2 – Tiernan
Ich nehme die kabellosen Kopfhörer ab und lege sie um den Hals, während ich mich umschaue. Die Gepäckausgabe hat nur zwei Karussells. Sehr sparsam.
Ist er hier? Ich drehe mich um und versuche, jemanden zu erkennen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, aber er wird mich wahrscheinlich eh als Erster erkennen. Das Internet ist mittlerweile voller Fotos unserer Familie.
Ich folge der Menge, gehe zum zweiten Förderband und warte darauf, dass das Gepäck kommt. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel eingepackt, zumal ich sicher nicht lange bleiben werde, aber ehrlich gesagt, habe ich nicht nachgedacht. Er hat mir ein Flugticket per Mail geschickt und geschrieben, ich könne es benutzen oder nicht, und ich habe einfach meine Koffer geschnappt und eingepackt. Ich war so erleichtert, etwas zu tun zu haben.
Ich überprüfe mein Handy, um sicherzugehen, dass er mich nicht angerufen hat, um mir zu sagen, wo wir uns treffen, und sehe stattdessen eine Textnachricht von Mirai.
Ich wollte dich nur vorwarnen … Der Gerichtsmediziner wird die Todesursache bis Ende der Woche bestätigen. Das wird dann in den Nachrichten kommen. Falls du reden willst, ich bin da. Immer.
Ich atme tief ein, vergesse aber auszuatmen, während ich mein Handy in meine Gesäßtasche stecke. Die Todesursache. Wir wissen, wie sie gestorben sind. All die religiösen Spinner auf Twitter verurteilen meine Eltern derzeit als Sünder, weil sie sich das Leben genommen haben. Aber ich lese das alles nicht. Die Probleme, die ich mit Hannes und Amelia de Haas hatte, sind das eine, aber ich will über sie keinen Mist von Fremden hören, die sie nicht kannten.
Ich sollte mein Handy ausschalten. Ich sollte …
Ich runzle die Stirn. Ich sollte nach Hause gehen.
Ich kenne diesen Typen nicht, und ich mag schon die Leute nicht, die ich kenne.
Aber gestern Abend klang nichts verlockender, als wegzukommen.
Ein Karussell beginnt sich zu drehen, was mich aus meinen Gedanken reißt, und ich beobachte, wie die Koffer auftauchen. Einer meiner schwarzen Koffer bewegt sich auf mich zu, und ich greife danach, aber plötzlich taucht eine andere Hand auf und hebt ihn für mich hoch. Ich schaue hoch und stehe einem Mann gegenüber.
Na ja, nicht direkt gegenüber. Er starrt auf mich herab, und ich öffne den Mund, um etwas zu sagen, aber mir fällt nichts ein … Sein Gesichtsausdruck ist wie versteinert, und er blinzelt nicht, während wir so dastehen und uns fixieren.
Ist er das?
Ich weiß, dass der Stiefbruder meines Vaters holländischer Abstammung ist, genau wie mein Vater, und dieser Typ hat auf jeden Fall ein athletisches Aussehen, ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurz geschnittenes dunkelblondes Haar und blaue Augen. Die leichte Heiterkeit in seinen Augen lassen das strenge Kinn und die einschüchternde Präsenz freundlicher wirken.
»Bist du Jake?«, frage ich.
»Hi.«
Hi? Er starrt mich weiterhin an, und einen Moment lang kann ich mich auch nicht losreißen. Ich wusste, dass er und mein Vater nicht blutsverwandt sind, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, sie würden sich ähneln.
Aber ich lag völlig falsch, und ich hatte auch nicht bedacht, dass es einen beträchtlichen Altersunterschied zwischen ihnen gibt. Jake muss mindestens zehn Jahre jünger sein als Hannes. Ende dreißig, vielleicht Anfang vierzig?
Vielleicht sind sie deshalb nicht miteinander ausgekommen. Sie sind auch an zwei völlig unterschiedlichen Orten aufgewachsen, also hatten sie nicht viel gemeinsam.
Wir stehen einen Moment lang da, und ich habe das Gefühl, dass dies der Punkt ist, an dem sich die meisten Menschen umarmen würden oder so, aber ich trete einen Schritt zurück – und von ihm weg –, nur für den Fall.
Er setzt aber auch gar nicht zu einer Umarmung an. Stattdessen blinzeln seine Augen zur Seite, und er macht eine Geste mit der Hand. »Die auch?«
Seine Stimme ist tief, aber sanft, als hätte er ein wenig Angst vor mir, aber vor nichts anderem sonst. Mein Herzschlag beschleunigt sich.
Was hat er mich gefragt?
Oh, das Gepäck.
Ich schaue über meine Schulter und sehe, dass mein anderer schwarzer Koffer auch auf dem Band ist.
Ich nicke einmal und warte darauf, dass er sich nähert.
»Wie hast du mich erkannt?«, frage ich, weil ich mich erinnere, dass er einfach meinen Koffer geschnappt hat, ohne sich zu versichern, dass ich es auch wirklich bin.
Aber er lächelt nur vor sich hin.
Ich schließe für einen Moment die Augen, und mir fallen die Artikel im Internet wieder ein. »Richtig«, murmele ich.
»Entschuldige«, sagt er und greift hinter mich, um meinen zweiten Koffer vom Band zu holen. Ich stolpere einen Schritt zurück, als sein Körper gegen meinen stößt.
Er hebt den Koffer hoch und fügt hinzu: »Außerdem bist du die Einzige hier, die Louis-Vuitton-Koffer hat, also …«
Ich werfe ihm einen taxierenden Blick zu und stelle fest, dass seine Jeans an den Knien schmutzig ist und er ein graues Billig-T-Shirt trägt. »Du kennst Louis Vuitton?«, frage ich.
»Mehr als mir lieb ist«, antwortet er und sieht mich dann an. »Ich bin auch so aufgewachsen.«
Er spricht das so aus, als ob Marken und Luxus jederlei Substanz ausschließen würden. Die Menschen mögen unterschiedliche Realitäten leben, aber die Wahrheit ist immer die gleiche.
Ich räuspere mich und greife nach einem der Koffer. »Ich kann einen nehmen.«
»Schon gut.« Er schüttelt den Kopf. »Ich mach das.«
Ich trage meinen Rucksack und greife nach dem Griff des Handgepäcks, während er die beiden Rollkoffer nimmt.
Ich bin bereit loszugehen, aber er sieht mich an. In seinem Blick liegen Schüchternheit, aber auch Erstaunen.
»Was ist?«, frage ich.
»Entschuldige«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Du siehst einfach aus wie deine Mutter.«
Ich senke den Blick. Das höre ich nicht zum ersten Mal, und es ist als Kompliment gemeint. Meine Mutter war wunderschön. Charismatisch und mit einem perfekten Körper.
Aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei. Es ist, als ob jeder zuerst sie sieht.
Graue Augen, blondes Haar, wobei meins von Natur aus sandfarben ist, während ihres gefärbt war, um goldener zu wirken.
Meine dunkleren Augenbrauen sind allerdings meine eigenen. Und darauf bin ich ein wenig stolz. Ich mag es, wie sie meine Augen betonen.
Er atmet tief ein. »Kommt noch was?«, fragt er und ich nehme an, dass er von meinem Gepäck spricht.
Ich schüttle den Kopf.
»Okay, dann wollen wir mal los.«
Er geht in Richtung Ausgang, und ich folge ihm durch die eher spärlichen Menschenmassen hindurch.
Sobald wir in die Sonne treten, atme ich die dicke Spätherbstluft ein, rieche den Asphalt und die Bäume, die den Parkplatz säumen. Die Brise kitzelt die Haut an meinen Armen, und obwohl der Himmel wolkenlos und alles grün ist, bin ich versucht, meine um die Taille geschnürte Jacke anzuziehen. Wir überqueren den Gehweg und brauchen kaum nach Autos Ausschau zu halten. An einem Sonntagnachmittag ist der Verkehr vor dem Country Club meiner Eltern schlimmer als hier. Das gefällt mir. Kein Hupen oder Tieftöner, die den Asphalt vibrieren lassen.
Jake hält hinter einem schwarzen Truck an, aber anstatt die Heckklappe zu öffnen, schiebt er meinen Koffer einfach über die Seite auf die Ladefläche.
Ich hebe mein Handgepäck hoch, um ihm zu helfen, aber er packt auch dieses mit einem Schwung, und ich sehe, wie sich seine straffen Armmuskeln bewegen und in der Sonne glänzen.
»Ich hätte mit weniger Gepäck reisen sollen«, sage ich laut vor mich hin.
Er dreht sich um. »Es ist ja nicht nur eine Reise.«
Ja, vielleicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich dachte, es wäre das Beste, genug mitzunehmen, falls ich mich entscheide zu bleiben.
Wir steigen in den Truck, und ich schnalle mich an, als er den Motor startet. Reflexartig greife ich nach den Kopfhörern, die mir um den Hals hängen. Aber ich halte inne. Es wäre unhöflich, ihn auszublenden, nachdem ich ihn gerade erst kennengelernt habe. Meine Eltern hatten nie etwas dagegen, aber sie haben mich gebeten, sie nicht in Gesellschaft anderer Menschen aufzusetzen.
Ich lasse die Kopfhörer los und starre stattdessen auf das Radio. Bitte lass Musik laufen.
Und sobald der Motor startet, leuchtet das Radio auf und spielt laut »Kryptonite«, und für eine Sekunde bin ich erleichtert. Small Talk ist furchtbar.
Er fährt los, und ich lege die Hände in den Schoß, drehe den Kopf und schaue aus dem Fenster.
»Also, ich habe mich erkundigt«, sagt er über die Radiomusik hinweg. »Wir haben eine Online-Highschool, die dich aufnehmen könnte.«
Ich schaue ihn an.
»Wir haben hier viele Kinder, die auf den Ranches gebraucht werden, deshalb ist es üblich, dass sie auch mal zu Hause unterrichtet werden oder den Unterricht online absolvieren«, führt er aus.
Oh.
Ich entspanne mich ein wenig. Einen Moment lang dachte ich, er erwartet, dass ich zur Schule gehe. Ich hatte mich auf das Leben an einem neuen Ort eingestellt, aber nicht darauf, mich an neue Lehrkräfte und Mitschüler gewöhnen zu müssen. Die, mit denen ich in den letzten drei Jahren zusammen war, kannte ich kaum.
Er hätte sich die Mühe aber nicht machen müssen. Ich habe mich schon darum gekümmert.
»Ich kann in Brynmor bleiben«, sage ich und wende meinen Blick wieder aus dem Fenster. »Meine Schule in Connecticut hat kein Problem mit meiner Abwesenheit. Meine Lehrkräfte haben mir bereits die Lehrpläne gemailt, und ich werde alles online erledigen können.«
Der Highway führt nun nur noch an vereinzelten Häusern vorbei, ein paar Ranches im Stil der Achtzigerjahre mit rostigen Kettenzäunen und Bungalows, alle umarmt von den dunklen Nadeln der hohen Tannen, die ihre Gärten umgeben.
»Gut«, sagt Jake. »Das ist gut. Sag ihnen aber, dass es sein kann, dass du zeitweise keine Internetverbindung haben könnest, da unser WLAN nur schlecht funktioniert und bei Gewitter meistens komplett ausfällt. Vielleicht sollten sie dir deine Aufgaben gebündelt im Voraus schicken, damit du in der Zeit ohne Internet nicht in Verzug gerätst.«
Ich schaue zu ihm, sehe, wie er seinen Blick von der Straße abwendet, um mir in die Augen zu sehen. Ich nicke.
»Aber wer weiß …«, sinniert er. »Vielleicht rennst du nach einer Woche bei uns auch einfach in die Berge.«
Weil …?
Er schüttelt den Kopf und scherzt: »Es gibt keine Einkaufszentren oder Karamell-Macchiatos in der Nähe.«
Ich schaue wieder aus dem Fenster und murmele: »Ich trinke keine Karamell-Macchiatos.«
Es ist vernünftig, dass er davon ausgeht, dass ich mich bei ihnen vielleicht nicht wohlfühlen oder mein altes Leben vermissen werde, aber mir zu unterstellen, dass ich eine Primadonna bin, die ohne Starbucks nicht leben kann, ist ziemlich dämlich. Ich schätze, wir können dem Fernsehen dafür danken, dass der Rest der Welt denkt, Kalifornierinnen seien Püppchen in engen Oberteilen – aber mit all den Dürren, Waldbränden, Erdbeben, Schlammlawinen und einem Fünftel aller Serienmorde der Nation sind wir auch hart im Nehmen.
Zum Glück fahren wir eine Weile, ohne dass er weiterspricht. Vor uns taucht die Stadt auf, und ich erkenne geschnitzte Holzstatuen und eine Hauptstraße mit quadratischen, durchgehend aneinander gebauten Gebäuden. Auf den Bürgersteigen stehen Menschen und unterhalten sich; an den Laternenpfählen hängen Topfblumen und verleihen dem Ort ein gemütliches, gepflegtes Flair. Teenager sitzen auf den Heckklappen ihrer Autos, die sie am Straßenrand geparkt haben, und ich sehe mir die Geschäfte an – alles kleine Läden und keine Ketten.
Ich schaue nach oben und lese das große Banner, kurz bevor wir darunter durchfahren.
CHAPEL PEAK SOMMERFEST!
26.–29. AUGUST
Chapel Peak …
»Das ist gar nicht Telluride«, sage ich und schaue ihn an.
»Ich habe ja gesagt, wir wohnen außerhalb von Telluride«, antwortet er. »Seeehr weit außerhalb von Telluride.«
Sehr gut. Telluride sehr beliebt bei Skiurlaubern, es hat viele Geschäfte und Restaurants mit gehobener Küche. Das hier wird anders sein. Ich will anders sein.
Ich sehe die Geschäfte an mir vorbeiziehen. Grind House Café. Porters Postamt. Die fröhliche Eisdiele. Das …
Ich drehe den Kopf, um die niedliche rot-weiß gestreifte Markise zu betrachten, als wir an einem kleinen Laden vorbeikommen, und muss fast lächeln. »Ein Süßwarenladen …«
Ich habe Süßwarenläden geliebt. Ich war seit Jahren in keinem mehr.
Rebel’s Pebbles, steht auf dem Schild und klingt sehr nach Wildem Westen.
»Hast du einen Führerschein?«, fragt Jake.
Ich drehe den Kopf wieder zu ihm und nicke.
»Gut.« Er hält inne, und ich spüre, dass er mich anschaut. »Du kannst alle unsere Fahrzeuge benutzen, ich muss nur wissen, wohin du fährst, okay?«
Alle unsere Fahrzeuge. Meint er seine und die seiner Söhne? Wo sind die eigentlich?
Nicht, dass ich erwartet hätte, dass sie auch am Flughafen sind, aber es macht mich irgendwie nervös, dass sie sich vielleicht nicht über meine Ankunft freuen könnten, wenn sie nicht gekommen sind, um mich zu begrüßen. Das ist noch etwas, was ich nicht bedacht hatte. Sie hatten eine gemütliche, testosterongeschwängerte Männerhöhle, und jetzt kommt ein Mädchen hinzu, und sie glauben, dass sie sich ihre schmutzigen Witze nun vor ihr verkneifen müssen.
Aber es ist ja ein Donnerstag. Vielleicht sind sie einfach nur bei der Arbeit.
Da fällt mir ein …
»Was machst du?«, frage ich ihn.
Er blickt zu mir herüber. »Meine Söhne und ich bauen Motorräder um«, antwortet er, »auch Quads und Dünenbuggys.«
»Habt ihr einen Laden?«
»Hm?«
Ich räuspere mich. »Du hast hier einen Laden?«, wiederhole ich lauter.
»Nein. Wir nehmen Bestellungen entgegen, bauen die Fahrzeuge in unserer Werkstatt zu Hause und verschicken dann das fertige Produkt«, erklärt er, und ich kann nicht anders, als ihn wieder anzuschauen. Er sitzt auf dem Fahrersitz und hält das Lenkrad fest, wobei sich die Muskeln in seinen sonnengebräunten Unterarmen anspannen.
Er ist so anders als mein Vater, der es gehasst hat, draußen zu sein und immer ein langärmeliges Hemd anhatte, es sei denn, er ging schlafen.
Jake sieht mir in die Augen. »Es kommen bald viele Aufträge rein«, sagt er. »Das hält uns den ganzen Winter über auf Trab, und im Frühling, pünktlich zum Saisonstart, schicken wir die Bikes los.«
Sie arbeiten also von zu Hause aus. Alle drei.
Sie werden immer zugegen sein.
Ich reibe abwesend meine Handflächen aneinander, während ich vor mich hinstarre, und höre, wie sich mein Puls in meinen Ohren beschleunigt.
Schon im Internat in Brynmor hatten meine Eltern dafür gesorgt, dass ich ein Einzelzimmer hatte. Ich bin lieber allein.
Aber ich habe mich nicht völlig abgeschottet. Ich habe gerne mit meinen Lehrerinnen und Lehrern diskutiert, und ich liebe es, die Welt zu entdecken und etwas zu unternehmen, aber ich brauche Raum zum Atmen. Ein ruhiges Plätzchen für mich allein, um mich zu entspannen, und Männer sind laut. Vor allem junge Männer. Wir werden ständig aufeinander rumhängen, wenn sie von zu Hause arbeiten.
Ich schließe für einen Moment die Augen und bereue plötzlich meinen Entschluss. Warum habe ich das getan?
Meine Klassenkameradinnen haben mich gehasst. Sie haben mich für einen Snob gehalten, weil ich immer so still war.
Aber das stimmt nicht. Ich brauche nur Zeit, das ist alles.
Leider haben die wenigstens Menschen genug Geduld, um mir eine Chance zu geben. Die beiden Jungs werden mich für unhöflich halten, genau wie die Mädchen in der Schule. Warum sollte ich mich absichtlich in eine Situation begeben, in der ich gezwungen bin, neue Leute kennenzulernen?
Ich beiße die Zähne aufeinander und schlucke, als ich aus dem Augenwinkel sehe, dass Jake mich anstarrt. Wie lange macht er das schon?
Ich zwinge mich sofort, mich zu entspannen und langsamer zu atmen, aber bevor ich mein Gesicht in meinem Handy vergraben kann, um meine Beinahe-Panikattacke zu vertuschen, macht er eine Linkswendung und fährt in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind.
Na toll. Er bringt mich zurück zum Flughafen. Ich habe ihm jetzt schon Angst gemacht.
Aber als er die Hauptstraße zurückfährt und ich den Gurt vor der Brust festhalte, um mich zu beruhigen, beobachte ich, wie er zwei Ampeln überfährt und dann das Lenkrad nach links zieht, um in eine Parklücke am Straßenrand zu fahren.
Mein Körper fällt nach vorne, als er anhält, und bevor ich darüber nachdenken kann, was los ist, stellt er den Motor ab und steigt aus.
Huch …
»Komm schon«, sagt er und schaut mich an, bevor er die Tür zuwirft.
Ich schaue aus der Windschutzscheibe und sehe das Schild Rebel’s Pebbles in viktorianischem Stil – Gold auf schwarzem Hintergrund.
Er ist zum Süßwarenladen zurückgefahren.
Mit meiner kleinen umgehängten Reisetasche klettere ich aus dem Truck und folge ihm auf den Bürgersteig. Er öffnet die Ladentür, ein leises Klingeln ertönt, und er bittet mich hinein, indem er mir die Tür aufhält.
Der berauschende Duft von Schokolade und Karamell schlägt uns entgegen, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich habe seit der Handvoll Blaubeeren, die ich heute Morgen vor dem Flug in mich hineingestopft habe, nichts mehr gegessen.
»Hey, Spencer!«, ruft Jake.
Ich höre das Klappern einer Pfanne aus dem hinteren Teil des Raums, und etwas, das wie eine Ofentür klingt, fällt zu.
»Jake Van der Bong!« Ein Mann schaut hinter einer Glaswand hervor, wischt sich die Hände ab und kommt auf uns zu. »Wie geht’s dir, Mann?«
Van der Bong? Ich werfe einen Blick auf Jake.
Er grinst mich an. »Ignorier ihn«, sagt er. »Ich habe nie geraucht. Ich meine, ich rauche nicht mehr. Das ist alter Scheiß.« Er lächelt den anderen Typen an. »Das alte Ich, das böse Ich.«
Sie lachen beide und schütteln sich die Hände, und ich schaue mir den Mann an, der der Ladenbesitzer sein muss. Er sieht ungefähr so alt aus wie Jake, ist aber ein paar Zentimeter kleiner. Er trägt ein rot-blaues Flanellhemd und hat schütteres braunes Haar.
»Spence, das ist meine Nichte Tiernan«, stellt Jake mich vor.
Spencer sieht mich an, wischt sich die Hand noch einmal an seiner Schürze ab und hält sie mir dann hin. »Nichte, was?« Sein Blick ist neugierig. »Tiernan. Das ist ein schöner Name. Wie geht’s dir?«
Ich nicke einmal und nehme seine Hand.
»Sie soll sich zusammensuchen, was sie haben will«, sagt Jake.
»Nein, schon gut.« Ich schüttle den Kopf.
Aber Jake zieht eine Augenbraue hoch und warnt mich: »Wenn du dir nicht selbst eine Tüte füllst, füllt er sie für dich, und dann kriegst du nur Lakritze und Pfefferminzstangen.«
Ich rümpfe reflexartig die Nase, und Spencer prustet. Ich hasse Lakritze.
Jake schnappt sich eine Plastiktüte und fängt an, sie mit Toffee zu füllen, während mein Stolz mich wie angewurzelt dastehen lässt. Das fällt mir immer am schwersten – ich mag es nicht, das zu tun, was andere Menschen von mir erwarten.
Aber dann rieche ich den Zucker und das Salz, und der warme Schokoladenduft, der aus dem Ofen kommt, umhüllt mich und steigt mir zu Kopf. Ich würde gerne davon probieren.
»Worauf wartest du, de Haas?«, höre ich meinen Onkel rufen.
Ich blinzle.
Er verschließt das Toffeeglas und geht zu den Gummiwürmern, während er mir einen Blick zuwirft. Mich bei meinem Nachnamen zu nennen, sollte sich eigentlich spielerisch anfühlen. Bei ihm wirkt es aber irgendwie schroff.
Ich atme aus und gehe zu den Tüten, um mir eine zu nehmen. »Ich bezahle«, informiere ich ihn.
Er sieht mich nicht an. »Wie du willst.«
Ich öffne die Tüte, gehe instinktiv an den Pralinen vorbei, wende mich den weniger kalorienreichen Fruchtgummibonbons zu und packe ein paar Pfirsichringe, Wassermelonenstücke und blaue Haie ein. Ich werfe noch ein paar Jelly Beans und Sour Patch Kids hinein, in dem Wissen, dass ich nichts davon essen werde.
Abwesend lasse ich mich zum nächsten Behälter treiben, steche die Schaufel hinein und ziehe einen kleinen roten Haufen heraus.
Weingummi ist voller Maissirup, Lebensmittelfarbstoffen und Zusatzstoffen, hat meine Mutter einmal gesagt. Ich schaue auf die Fruchtgummis hinunter und erinnere mich, dass ich früher das Gefühl zwischen meinen Zähnen geliebt habe, aber ich habe bestimmt seit vier, fünf Jahren keine mehr gegessen. Damals habe ich damit angefangen, auf alles verzichten zu wollen, nur um ihr zu gefallen. Wenn ich so essen würde wie sie, mich so schminken würde wie sie, Prada- und Chanel-Handtaschen kaufen würde wie sie und jede noch so ausgefallene Kreation von Versace tragen würde, würde sie …
Aber ich schüttle den Kopf und führe den Gedanken nicht zu Ende. Ich packe zwei große Schaufeln in meine Tüte. Jake taucht neben mir auf und greift mit der Hand ins Glas. »Die mag ich auch am liebsten«, sagt er und steckt sich zwei in den Mund.
»Hey, Drecksack!«, schreit Spencer.
Aber Jake lacht nur. Ich schaue wieder nach unten, klappe den Glasdeckel zu und schließe meine Tüte.
»Die Tüte kostet sieben fünfundneunzig, egal was drin ist, also mach sie voll«, sagt Jake und geht um mich herum und an den Süßigkeitengläser entlang.
Sieben fünfundneunzig. Fast so teuer wie die Flaschen mit Swiss Water, in denen meine Mutter gebadet hat. Wie konnte er nur so anders werden als sie?
Ich gehe die beiden Gänge entlang, vorbei an der Schokoladenabteilung, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, weil ich weiß, wie gut alles schmeckt.
»Fertig?« Jake geht an mir vorbei.
Ich folge ihm zur Kasse und werfe meine Tasche auf den Tresen, weil ich befürchte, dass er mir zuvorkommen und für mich bezahlen will.
Ich zücke sofort mein Portemonnaie, und Spencer scheint zu verstehen, denn er stellt mir, ohne zu zögern, die Rechnung aus.
Ich bezahle und trete dann einen Schritt zurück, um Platz für Jake zu machen.
Er kassiert Jake ab, schaut aber zu mir. »Bleibst du länger … auf dem Gipfel?« Seine Frage klingt zögerlich.
Der Gipfel?
Jake antwortet für mich. »Ja, vielleicht bis zum nächsten Sommer.«
Spencers Blick fällt sofort auf Jake, und ein besorgter Ausdruck huscht über sein Gesicht.
»Keine Sorge.« Jake lacht und händigt ihm Bargeld aus. »Wir werden sie vor den großen, bösen Elementen beschützen.«
»Konntest du Kaleb jemals kontrollieren?«, schießt Spencer zurück und nimmt den Geldschein ruckartig aus Jakes Hand.
Kaleb. Einer seiner Söhne. Ich sehe Jake an, aber er sieht mir nur in die Augen und schüttelt den Kopf.
Jake nimmt sein Wechselgeld und seine Süßigkeiten, und wir gehen.
»Danke«, sage ich zu Spencer.
Er nickt nur und sieht uns nach, und ich fühle mich noch verunsicherter als beim Reinkommen.
Wir steigen wieder in den Wagen, und mein Onkel fährt wieder in die Richtung, in die wir ursprünglich gefahren sind.
Die Blütenblätter der pinken Petunien in den Hängetöpfen flattern im Wind vor der blauen Himmelkulisse, und junge Männer in ärmellosen T-Shirts schleppen Säcke von der Laderampe des Futtermittelgeschäfts in ihren Pick-up. Ich wette, hier kennt jeder jeden beim Namen.
»Es ist nicht Telluride«, sagt Jake, »aber es ist die größte Stadt, die ich je wiedersehen möchte.«
Ich stimme zu. Zumindest für eine Weile wird das für mich auch so sein.
Wir fahren an den letzten Läden vorbei, überqueren ein paar Bahngleise und schlängeln uns eine gepflasterte Straße hinauf, die von dichten Tannen flankiert ist und langsam ansteigt.
Die Straße wird enger, und ich schaue durch die Windschutzscheibe und sehe, wie die Bäume immer höher werden und immer mehr vom Licht des späten Nachmittags abschneiden, während wir immer höher fahren und die Stadt hinter uns lassen. Ein paar Schotter- und Feldwege zweigen von der Hauptspur ab, und ich versuche, in die dunklen Pfade hineinzulugen, kann aber nichts erkennen. Führen sie zu anderen Grundstücken? Zu Häusern?
Wir fahren eine Weile bergauf, der Motor surrt, während Jake den Truck um die Kurven windet und nichts mehr von der Stadt unter uns zu sehen ist. Sonnenstrahlen schimmern durch die Äste, und ich blinzle dagegen an. Dann spüre ich, wie der Truck von der gepflasterten Straße auf einen Feldweg abbiegt, die Unebenheiten der Straße lassen mich in meinem Sitz schwanken.
Ich halte mich mit einer Hand am Armaturenbrett fest und beobachte die von Tannen gesäumte Straße vor mir. Es geht noch weitere zwanzig Minuten bergauf.
»Die Strecke ist ganz schön gefährlich«, sagt er, als der Himmel immer dunkler wird, »wenn du also in die Stadt willst, sorge dafür, dass ich oder einer meiner Söhne dich begleiten, okay?«
Ich nicke.
»Ich will nicht, dass du nach Einbruch der Dunkelheit allein auf dieser Straße unterwegs bist«, fügt er hinzu.
Ja, ich auch nicht. Er hat nicht gescherzt, als er davon gesprochen hat, dass sie »abgeschieden« wohnen. Man muss mit allem, was man braucht, gut vorsorgen, denn es ist nicht mal eben ein kurzer Weg zum Laden, wenn Milch, Zucker oder Hustensaft fehlen.
Er biegt rechts ab und fährt eine steile Schotterstraße hinauf, die Steine knirschen unter den Reifen, als ich wieder Strukturen erkenne. Die Lichter leuchten durch die Bäume und sind gut zu sehen, da es gerade erst dunkel wird.
»Die ganze Straße, die wir gerade gefahren sind, ist im Winter von Schnee zugedeckt«, erklärt er, und ich sehe, wie er zu mir herüberschaut, »und da das Gelände teilweise sehr steil und vereist ist, ist es monatelang unmöglich, in die Stadt zu kommen, weil die Straßen gesperrt sind. Bevor es anfängt zu schneien, bringen wir dich noch einmal zum Süßwarenladen, damit du dich eindeckst.«
Ich ignoriere den Scherz und schaue aus dem Fenster, um die Gebäude, auf die wir zufahren, in der Abenddämmerung zu erkennen, aber da überall Bäume stehen, kann ich nicht viel erkennen. Da ist etwas, das wie ein Stall aussieht und im Dickicht verborgen ein paar Schuppen und andere kleine Gebäude, und dann …
Der Truck fährt endlich auf ebenen Boden und kommt direkt vor einem Haus mit riesigen Fenstern, durch die ein paar Lichter scheinen, zum Stehen. Ich lasse meine Augen nach links, rechts, oben und unten schweifen, um das riesige Gebäude zu betrachten, und obwohl ich in der Dunkelheit keine Details ausmachen kann, erkenne ich, dass es groß ist und drei Stockwerke sowie eine obere und eine untere ausladende Terrasse hat.
Ein Anflug von Erleichterung durchfährt mich. Als er von »Hütte« gesprochen hat, habe ich mir die Bleibe eines Preppers vorgestellt, der nur das Allernötigste zum Überleben hat. Aber mich hat vor allem die Einsamkeit und die Entfernung zu L. A. angezogen, als ich entschieden habe, herzukommen. Erst bei der Ankunft habe ich angefangen, mir Gedanken über meine überstürzte Entscheidung zu machen und darüber, worauf ich mich eigentlich eingelassen habe. Auf Internet konnte ich verzichten, aber ich hoffte zumindest auf einen Sanitärbereich im Haus.
Und – ich betrachte weiterhin das Haus von meinem Sitz aus, während Jake aus dem Truck steigt – ich glaube, ich habe Glück.
Ich zögere noch einen Moment, bevor ich die Tür öffne und langsam aus dem Truck steige. Vielleicht habe ich überreagiert. Vielleicht gab es keinen Grund, nervös zu sein. Es ist ruhig, wie ich es mir erhofft habe, und ich atme die gute Luft ein und der frische Geruch nach Wasser und Steinen lässt mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ich liebe diesen Geruch. Er erinnert mich an die Wanderung zum Vernal Fall im Yosemite, die ich vor Jahren mit dem Sommercamp unternommen habe.
Jake trägt meine Koffer, und obwohl es ein wenig kühl ist, lasse ich den Pullover um die Taille gebunden und folge ihm die Holzstufen hinauf. Auf der Vorderseite des Hauses besteht das Erdgeschoss fast ausschließlich aus Fenstern, sodass ich reinsehen kann. Es sieht aus wie ein großer Raum mit hohen Decken, und obwohl alles in einer Farbe gehalten ist – braunes Holz, braunes Leder, braunes Geweih und braune Teppiche –, kann ich auch einige Steinelemente erkennen.
»Hallo!«, ruft Jake, als er das Haus betritt und meine Koffer abstellt. »Noah!«
Ich folge ihm und schließe sanft die Tür hinter mir.
Zwei Hunde stürmen herbei, ein brauner Labrador und ein weiterer, dürrer, mit grau-schwarzem Haar und glasigen schwarzen Augen. Jake beugt sich vor und streichelt beide, während er sich im Haus umschaut.
»Ist jemand da?«, ruft er wieder.
Ich schaue nach oben und sehe, dass es auf verschiedenen Höhen Dachsparren gibt. Nach links fällt die Decke ab und auch dort, wo sich die Küche befindet. Hier unten gibt es nicht viele Wände, denn Wohnzimmer, Esszimmer, Fernsehzimmer und Küche gehen ineinander über und lassen nicht viel Privatsphäre.
Es ist aber sehr geräumig.
»Ja, ich bin hier!«, ruft eine Männerstimme.
Ein junger Typ kommt aus der Küche, fuchtelt mit zwei Bierflaschen herum, schüttelt den Kopf in Jakes Richtung und sagt: »So eine Scheiße, die verdammte Shawnee ist wieder abgehauen!«
Er schlendert auf uns zu und sieht aus, als wolle er Jake eines der Biere reichen, aber dann sieht er mich an und hält inne.
Sein dunkelblondes Haar ist unter einem Baseballcap nach hinten gestylt, und er sieht nicht viel älter aus als ich. Er muss etwa zwanzig oder einundzwanzig sein. Aber sein Körper … Seine starken Arme sind unter dem grünen T-Shirt dunkel gebräunt, und er hat einen breiten Rücken. Seine kristallklaren blauen Augen leuchten, und sein Mund verzieht sich zu einem halben Lächeln.
»Das ist Noah«, stellt Jake uns vor. »Mein Jüngster.«
Ich brauche einen Moment, aber dann hebe ich meine Hand, um seine zu schütteln. Doch statt sie zu nehmen, legt er nur eine der Flaschen hinein und sagt: »Am besten, du gewöhnst dich dran. Wir trinken hier sehr viel.«
Das Dunstwasser auf der Flasche benetzt meine Handfläche, und ich werfe Jake einen Blick zu. Er nimmt sie mir ab und schaut zu seinem Sohn. »Dein Bruder?«
»Immer noch weg«, antwortet Noah, aber er lässt mich nicht aus den Augen.
»Okay.«
Weg? Ich beginne mich zu fragen, wo er ist, schüttle den Gedanken aber ab und wische mir die nasse Hand an der Jeans ab, während ich immer noch seine Blicke auf mir spüre. Warum starrt er mich an?
Ich schaue ihm wieder in die Augen, und er schenkt mir ein echtes Lächeln. Sollte ich etwas sagen? Oder sollte er etwas sagen? Das ist eine ziemlich seltsame Situation. Wir sind praktisch Cousins. Sollte ich ihn umarmen oder so? Ist es unhöflich, falls ich es nicht tue?
Wie auch immer.
»Wie lange hast du nach dem Pferd gesucht, bevor du aufgegeben hast?«, fragt ihn Jake, und ein Seufzer, den er nicht herauslassen will, dämpft seine Stimme.
Noah lächelt strahlend und zuckt mit den Schultern. »Falls wir sie nicht finden, wird sie nie wieder weglaufen. Meine Logik.«
Jake zieht eine Augenbraue hoch, während er zu mir hinunterblickt und erklärt: »Wir haben eine junge Stute, die immer wieder aus ihrem Stall ausbüxt.« Und dann sieht er seinen Sohn wieder an, als wäre das ein leidiges Thema. »Pferde sind teuer, also muss sie gefunden werden.«
Der Junge hält sein Bier hoch und weicht zurück. »Ich bin nur zum Tanken reingekommen.« Und dann sieht er mir in die Augen und geht in den hinteren Teil des Hauses. »Wenn du duschst, lass mir etwas heißes Wasser übrig«, ruft er mir noch zu.
Ich beobachte ihn, wie er an dem großen steinernen Kamin vorbeigeht, einen langen Flur entlang, und schließlich höre ich, wie irgendwo eine Fliegengittertür zuschlägt. Wird er das Pferd noch heute Nacht finden?
»Es ist jetzt schon dunkel, ich zeige dir das Grundstück morgen früh«, sagt Jake und geht nach rechts, »aber hier ist schon mal die Küche.«
Er geht um die große Kochinsel herum, aber ich bleibe zurück.
»Natürlich kannst du dich an allem bedienen«, erklärt er und schaut mir in die Augen. »Wir werden in den nächsten Monaten viel in die Stadt fahren, bevor das Wetter umschlägt, sodass wir die Vorratskammer mit allen Lebensmitteln füllen können, die du magst. Wir werden auch einige Konserven einmachen.« Er schließt die Kühlschranktür, von der ich annehme, dass sein Sohn sie offen gelassen hat, und erklärt mir: »Wir versuchen, so viele Lebensmittel wie möglich selbst anzubauen, zu jagen und zu töten.«
Das erklärt, warum ich den Eindruck hatte, eine Scheune und ein Gewächshaus auf dem Grundstück ausgemacht zu haben. Wenn man so lange eingeschneit ist, ist es klug, sich so wenig wie möglich auf Lebensmittelgeschäfte und die Stadt zu verlassen.
Er gibt mir ein Zeichen, und ich folge ihm, als er eine Tür an der Seite der Küche öffnet.
»Wenn du die Waschmaschine und den Trockner brauchst, die sind hier draußen in der Werkstatt«, sagt er und schaltet ein Licht ein. Er steigt die wenigen Stufen hinunter, und ich sehe einen weiteren Truck in der riesigen Garagen-Werkstatt parken, diesmal in Rot.
Jake hebt einen Wäschekorb vom Zementboden hoch und stellt ihn auf den Trockner, und als ich einen Schritt nach vorne mache, fällt mir etwas ins Auge, und ich bleibe oben an der Treppe stehen. Auf der rechten Seite ist ein Rehbock an seinen Hinterbeinen aufgehängt; um den Abfluss, über dem er hängt, hat sich eine kleine Blutlache gebildet. Sein Geweih schwebt etwa dreißig Zentimeter über dem Boden und wackelt leicht.
Was zum T…? Ich bleibe mit offenem Mund stehen und starre das tote Tier an.
Plötzlich steht Jake neben mir auf der Treppe. »Wie ich schon gesagt habe … anbauen, jagen und töten.« Er klingt amüsiert über das, was er in meinem Gesicht liest. »Du bist doch nicht etwa Vegetarierin, oder?«
Bevor ich antworten kann, ist er schon weggegangen, und ich folge ihm ins Haus und schließe die Tür. Ich bin keine Vegetarierin, aber ich habe mein Steak bisher immer nur als ein Stück Fleisch gesehen und dabei nie das ganze Tier vor Augen gehabt.
Ich schlucke ein paarmal, um meinen trockenen Mund zu befeuchten.
»Wohnzimmer, Bad, Fernsehzimmer«, sagt er, während ich ihm folge. »Wir haben kein Kabelfernsehen, aber wir haben viele Filme auf DVD, und solange das Internet funktioniert, kann man auch streamen.«
Ich folge ihm durch das große Zimmer und sehe rustikale Ledersofas, einen Couchtisch und Stühle. Der Kamin wäre groß genug, um darin Platz zu nehmen, und der Schornstein zieht sich nach oben bis in die Dachsparren. Überall sind Holz und Leder. Es riecht wie im Baumarkt, garniert von einem Hauch verbranntem Speck.
»Willst du das WLAN-Passwort?«, fragt Jake.
Die Erinnerung daran, dass ich mit der Außenwelt in Verbindung bleiben kann, lässt mich für einen Moment innehalten.
Falls ich aber ablehne, wird er sich fragen, warum. »Klar«, antworte ich.
»Es lautet Cobra Kai.«
Ich werfe ihm einen Blick zu. Süß.
Ich durchsuche die verfügbaren Netzwerke und finde nur Cobra Kai.
»Das Passwort?«
Er schweigt kurz, dann sagt er: »Wenn ein Mann sich dir entgegenstellt, ist er der Feind. Ein Feind verdient …«
Ich halte inne, bevor ich den Kopf schüttle und »nomercy«, keine Gnade, eintippe. Die Verbindung wird innerhalb von Sekunden hergestellt.
Jake kommt zu mir und blickt auf mein Display. Als er sieht, dass ich das Passwort richtig eingegeben habe, nickt er beeindruckt. »Du kannst bleiben.«
Er steht dicht bei mir, und ich atme tief ein und gehe dann einen Schritt zur Seite, um mich weiter im Raum umzusehen. Aber er bleibt wie angewurzelt stehen und beobachtet mich und scheint sich etwas zu fragen, er spricht es aber nicht aus. Wahrscheinlich fragt er sich genau wie ich, was zum Teufel ich hier mache, und was er eine Woche oder ein Jahr lang mit mir anfangen soll, bis ich wieder gehe.
»Hast du Hunger?«, fragt er.
»Ich bin müde.«
Er nickt, als ob er sich gerade wieder daran erinnert, dass meine Eltern vor zwei Tagen gestorben sind und ich heute über vier Bundesstaaten geflogen bin. »Natürlich.«
Aber das ist es gar nicht, ich will jetzt nur allein sein.
Er nimmt meine Koffer, und ich folge ihm die Treppe hinauf. Oben angekommen bleibe ich kurz stehen, drehe mich im Kreis und nehme sieben oder acht Türen auf dieser Etage wahr.
»Mein Zimmer.« Jake zeigt direkt vor uns auf eine dunkelbraune Holztür und dann in schneller Folge um den Treppenabsatz herum, während wir an anderen Räumen vorbeikommen. »Badezimmer, Noahs Zimmer, und hier ist dein Zimmer.«
Er stellt mein Gepäck vor einer Tür in der Ecke des Flurs ab, das schwache Licht des schmiedeeisernen Kronleuchters über uns macht es kaum möglich, Genaueres zu erkennen, aber das ist mir im Moment egal.