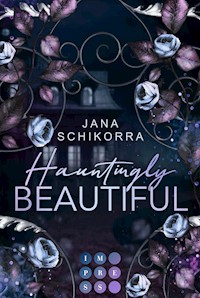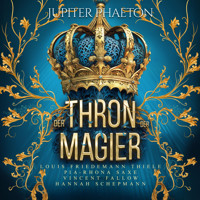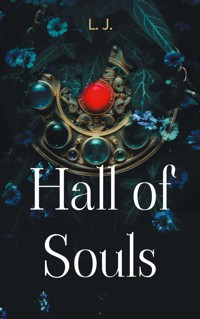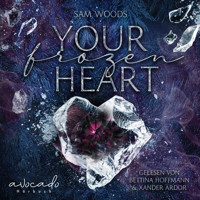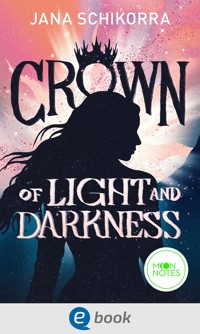
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Kampf um die Sonnenkrone beginnt In Lavandria fristen die Menschen ein Dasein in ewiger Dunkelheit – so auch die 20-jährige Astoria. Nur einmal im Jahr öffnen sich die Pforten zum Sonnenreich der Sidhe, einem magischen Elfenvolk. Wer mutig genug ist, kann in diesen raren Stunden um die Sonnenkrone des jungen Königs Ronas kämpfen, denn ein Sieg würde den Menschen das Licht zurückbringen. Doch als Astoria und Ronas sich in einem erbitterten Duell gegenüberstehen, zögert der sonst so skrupellose König, sie zu töten … Die mitreißende Romantasy für New Adult Fans ab 16 Jahren erzählt von der spannenden Suche nach der Sonnenkrone, die über das Schicksal zweier Reiche entscheidet – und die die junge Astoria und den skrupellosen König Ronas unerwartet einander näher bringt. Ein Muss für alle Romantasy-Fans, die Geschichten voller Magie, Emotionen und spannender Wendungen lieben. Crown of Light and Darkness: Magisch-empowernde Fantasy vom Feinsten - High Fantasy trifft auf Romantasy: Eine packende Geschichte voller Licht, Schatten und Liebe für junge Leser*innen ab 16 Jahren. - Eine mutige Heldin: Die junge Astoria will den skrupellosen König Ronas besiegen und den Menschen das Licht zurückbringen. - Mitreißend und dramatisch: Eine magische Romantasy voller unerwarteter Wendungen. - Voll angesagt: Romantasy für Fans von Lexi Ryan und Holly Black. - Genial ausgestattet in der Erstauflage: Softcover mit Klappen, trendig illustriertem Buchschnitt und coolem Lesezeichen zum Abtrennen."Crown of Light and Darkness" erzählt eine atemberaubende Geschichte über den Kampf gegen die Dunkelheit und den skrupellosen Elfenkönig. Ein spannender New-adult-Roma ab 16 Jahren, der seine Leser*innen in eine fantastische Welt entführt und bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch
In Lavandria fristen die Menschen ein Dasein in ewiger Dunkelheit – so auch die zwanzigjährige Astoria. Nur einmal im Jahr öffnen sich die Pforten zum Sonnenreich der Sidhe, einem magischen Elfenvolk. Wer mutig genug ist, kann in diesen raren Stunden um die Sonnenkrone des jungen Königs Ronas kämpfen, denn ein Sieg würde den Menschen das Licht zurückbringen.
Doch als Astoria und Ronas sich in einem erbitterten Duell gegenüberstehen, zögert der sonst so skrupellose König, sie zu töten …
Für alle, die den Duft von Büchern,
frisch ausgepusteten Kerzen und gemahlenem Kaffee lieben.
Es sind die kleinen Dinge.
Immer.
1
Früher einmal hatte ich Stille gemocht.
Die Sanftheit, mit der sie es einem gestattete, sich selbst den absonderlichsten Illusionen hinzugeben. Und den Frieden, den sie einem kämpferischen Herzen brachte.
Heute aber konnte ich Stille nur noch schwer ertragen. Ich wollte sie füllen. Mit Worten, mit Lauten und mit Taten. Manchmal auch bloß mit dem leisen Summen einer Melodie. Denn Frieden war etwas, das ich mir nicht länger zugestand. Und doch saß ich heute schweigend auf den Stufen vor meiner Hütte und atmete weiße Wölkchen in die Winterluft.
Die Siedlung, die ich mein Zuhause nannte, lag kalt und von einem silbrigen Schimmer umgeben vor mir. Kein Feuerschein tanzte mehr über die steinernen Wände der Häuser, keine Laternen erhellten mehr den kleinen Marktplatz inmitten all der windschiefen Bauten.
Alles schlief – und ich war wach.
Endlich stand er unmittelbar bevor, der Tag, auf den ich jahrelang hingearbeitet hatte.
Ich warf einen Blick gen Himmel.
Noch ein paar Stunden bis zum Aufbruch.
Unser Volk hatte sich angewöhnt, die Zeit am Standort des Mondes abzulesen. Denn in diesem Teil Lavandrias – dem Reich der Sterblichen – währte die Nacht ewig.
»Na? Schlachtest du in Gedanken ein paar Sidhe ab, Astoria?«
Ich zuckte zusammen. Blinzelnd drehte ich den Kopf in Jovians Richtung, der ein paar Schritte abseits des Weges auf seinem Gehstock lehnte und mich beobachtete. Ich hatte ihn weder gehört noch gesehen, was eindeutig dafür sprach, dass ich bald schlafen gehen sollte.
»Nur den, den es braucht, um das hier zu beenden«, murmelte ich.
»Wenn es jemand schafft, dann du.«
Ich starrte den Mann an, der mich die Grundlagen des Schwertkampfes gelehrt und der sich bei einem Jagdausflug schwer genug verletzt hatte, um für den Rest seines Lebens am Stock zu gehen. Und auf eine absolut verachtenswerte Weise war ich dankbar für diesen Unfall. Denn nun war ich das stärkste Glied in der Kette unserer Dorfgemeinschaft.
Und ich würde dieser Gemeinschaft – und allen anderen Dörfern unter dem Mond – zurückholen, was die Sidhe mit der magischen Spaltung des Reiches für sich beansprucht hatten: die Sonne.
»Danke.« Komplimente bedeuteten mir nichts. Normalerweise. Im Angesicht dessen, was mich morgen erwartete, allerdings doch ein wenig.
»Es ehrt mich, dass du mich nicht davonscheuchst wie den Rest deiner Gratulanten.«
»Gratulanten, ja?« Ich lachte freudlos. »Du meinst die Leute, die bis vor ein paar Tagen noch davon ausgegangen sind, dass du dieses Jahr für unsere Siedlung antrittst? Die mir hinter meinem Rücken unterstellen, ich hätte dir das Bein gebrochen, damit ich morgen meine fünf Minuten Ruhm bekomme?«
Seit offiziell entschieden war, dass ich an Jovians Stelle in den Kampf ziehen würde, hatte kaum jemand mit seinem Frust hinter dem Berg gehalten. Niemand außer mir und Jovian selbst schien zu glauben, ich könnte ihn würdig vertreten.
Doch das machte mir nichts aus. Denn mehr als genau diese zwei Personen brauchte es für mich nicht. Und das wusste Jovian genauso gut wie ich.
»Exakt die meine ich. Und es werden mehr sein als nur ein paar Minuten Ruhm, Astoria.« Er legte den Kopf schräg und deutete ein Lächeln an. Dann humpelte er ohne ein weiteres Wort davon.
Wenn es jemand schafft, dann du.
Sollte ich es tatsächlich schaffen, musste ich nicht mehr frösteln. Keiner von uns. Ein ganzes Jahr lang nicht mehr.
Ich hatte die Dorfältesten einmal sagen hören, dass ein Leben ohne Licht und Wärme normalerweise überhaupt nicht möglich sei. Dass es keine Pflanzen mehr geben dürfte, keine Tiere. Und auch keine Menschen.
Nicht einmal der Mond dürfte in Abwesenheit der Sonne leuchten, doch er tat es trotzdem. Vermutlich, weil sie ihm hinter der unsichtbaren Ländergrenze dennoch ausreichend nah war. Die Sidhe, das jenseits dieser Grenze lebende Volk der Hochelfen, sorgten außerdem mit ihrer Magie dafür, dass wir trotz andauernder Dunkelheit und Kälte existieren konnten. Flora und Fauna gediehen einzig dank ihrer Zauber und gerade in einem solchen Maße, dass unser Überleben gesichert war.
Die Sidhe taten das nicht aus Nächstenliebe, sondern weil sie uns brauchten. Zu ihrer Unterhaltung. Um sich zu profilieren und Macht auszuüben. Sich an ihre Stellung zu erinnern.
Vor allem an diesem einen Tag im Jahr, für den ich, wie es schien, nun endlich bereit war.
Plötzlich verspürte ich das dringende Bedürfnis, mich wieder in die beruhigende Gesellschaft meiner Waffen zu begeben, und so trat ich schließlich durch die morsche Holztür hinter mir.
Da keine einzige Wolke am Himmel stand, schien der Mond so hell ins Innere meiner Hütte, dass ich auch ohne Kerzenlicht auskam. Etwas, über das ich mich für gewöhnlich gefreut hätte, denn meine Wachsvorräte waren, wie alles andere in meinem Besitz, knapp geworden. Ich hatte so viel Zeit mit Kampfübungen zugebracht, dass ich die Siedlung ewig nicht mehr verlassen hatte. Nicht einmal, um auf den umliegenden Märkten meine Vorräte aufzufüllen.
Ab morgen musst du dich um derlei Dinge sowieso nicht mehr sorgen.Entweder weil du tot bist, oder weil du siegen wirst.
Schnell schob ich den Gedanken beiseite und ging über die knarzenden, teilweise losen Dielen zu meiner Feuerstelle hinüber. Ich legte ein Holzscheit nach und ließ meinen Blick umherschweifen, um mir alles noch einmal ganz genau einzuprägen, bevor ich es zurücklassen würde: die Pritsche, das selbst gezimmerte Regal, den kleinen Tisch mit dem dazugehörigen Stuhl. Den rostigen Nachttopf und den alten Badezuber; beides hinter einem mottenzerfressenen Vorhang verborgen.
Meine wenigen Habseligkeiten – im Wesentlichen bestehend aus Kleidung – bewahrte ich aus Platzgründen in Strohsäcken hinter meiner Pritsche auf. Nur meine Waffen befanden sich direkt unter meiner Matratze: zwei kleine Messer und ein Schwert. Wunderschöne, tödliche Familienerbstücke und zusammen mit einem großen, goldgerahmten Standspiegel zweifellos das Wertvollste, was ich besaß.
Zögerlich trat ich an ebendiesen Spiegel heran und fuhr mit den Fingerspitzen über die lackierte Umrandung. Aus irgendeinem Grund hatte ausgerechnet der Anblick dieses alten Schatzes, den mein Vater mir einmal von einer Reise mitgebracht hatte, mich all die Zeit über dazu ermutigt, meinen Weg weiterzugehen. Nicht stehen zu bleiben, egal, wie beschwerlich sich die Schritte auch anfühlen mochten.
Vielleicht, weil sein Glas damals nicht mit mir zerbrochen war. Er strahlte etwas Unverwüstliches aus, obwohl es doch so einfach wäre, ihn zu zerstören.
Ich schluckte und wandte mich ab, um die Leere in meinen Augen nicht sehen zu müssen.
Eine Leere von jener Art, die selbst die ewige Dunkelheit nicht verschleiern konnte.
2
Das Schlagen von Türen und aufgeregtes Stimmengewirr rissen mich am nächsten Morgen aus meinem leichten Schlaf.
Ich musste mich nie darum sorgen, Ludiem, den Tag der Sonne, zu verschlafen, denn das halbe Dorf war bereits Stunden vor dem Aufbruch zur Ländergrenze auf den Beinen. Unsere Siedlung lag nur einen kurzen Marsch von jenem Ort entfernt, an dem die Pforte zum Reich der Sidhe wie jedes Jahr erscheinen würde. Ein Vorteil von unschätzbarem Wert, wo doch viele eine tagelange Reise auf sich nehmen mussten, um den Übergang zu erreichen.
Gähnend schälte ich mich aus meiner Decke, streifte meine Kleidung ab und erwärmte mein gestern geschöpftes Wasser über der Feuerstelle. Eilig wusch ich mich und holte dann meine alte, abgewetzte Lederkluft aus einem der Strohsäcke. Gemeinsam mit den Stiefeln und dem Waffengürtel, den ich aus den Resten einer kaputten Hose gefertigt hatte, kam mein Aufzug einer echten Kampfausrüstung zumindest auf den ersten Blick sehr nah – und verschaffte mir beim Tragen ein ganz neues Körpergefühl. Eines, das die ausgebeulten Tuniken und Umhänge, die ich normalerweise trug, mir niemals vermittelten.
Nachdem ich mir aus meinen wenigen verbliebenen Lebensmitteln hastig noch einen Proviantbeutel gepackt hatte, trat ich wie bei jedem Ludiem in den letzten Jahren an meinen Spiegel heran. Vorsichtig kratzte ich an einer ohnehin schon splitternden Stelle des Lacks, bis sich das Gold unter meinen Fingernägeln sammelte.
Glücksbringer. Andenken. Hoffnung.
Alles zugleich.
»Los geht’s«, murmelte ich. Nichtssagende Worte, so viel leichter auszusprechen als ein »Lebewohl«. Denn am Ende war es genau das: ein Abschied. Was auch immer heute geschah, ob ich zurückkam oder nicht, dieselbe Astoria wie jetzt würde ich nie wieder sein.
Ein letztes Mal sog ich den Anblick meines Zuhauses in mich auf, ehe ich die Tür hinter mir schloss und mich dem regen Treiben vor meiner Behausung stellte.
Jung und Alt, allesamt mit flackernden Laternen ausstaffiert, wuselten durcheinander. Obwohl unsere Siedlung nur dreizehn Hütten umfasste, in denen je maximal fünf Personen wohnten, kam es mir heute vor, als hätte sich die Anzahl der Einwohner über Nacht verdreifacht. Wahrscheinlich der Durchreisenden wegen, die sich bereits haufenweise auf den Wegen tummelten.
Ich atmete tief durch, versuchte mich an den damit einhergehenden Lautstärkepegel zu gewöhnen – und an die Stimmung, die so viel gelöster war als üblich. Es wurde aus voller Kehle gelacht, gescherzt und sogar gesungen.
So war es immer an Ludiem, dem letzten Tag eines dunklen Jahres, an dem es uns gestattet war, unter der Sonne zu wandeln. Zwölf Stunden durften wir uns in der königlichen Hügelstadt Clivia bewegen – und nur dort. Den Rest des Landes hatte kein Mensch je mit eigenen Augen gesehen.
Für die meisten von uns spielte das jedoch keine Rolle, denn sie nutzten die begrenzte Zeit in Wärme und Helligkeit, um die Märkte der Sidhe zu besuchen und ihre kostbaren Waren zu erstehen. Bunte Kleidung aus schillernden Stoffen, exzentrisches Geschirr, geschmacksintensive, nach Sommer duftende Früchte. Und wer nicht durch die Gassen der Hügelstadt schlenderte, schwelgte den ganzen Tag über im Luxus der üppigen Gärten oder badete in den zahlreichen Springbrunnen der Hochelfen.
Verzweifelte Versuche, das eigene Herz mit ausreichend Farbe zu füllen, auf dass es die heimische Finsternis zumindest einen Hauch heller wirken ließ.
Aus eigener Erfahrung wusste ich, dass dieses sorgsam gesammelte Glück nicht von großer Dauer war. Stattdessen trieben die Erinnerungen ihren bittersüßen Stachel nur noch tiefer in die Sehnsucht nach dem Tag.
Einer von vielen Gründen, aus denen heraus ich vor einigen Jahren beschlossen hatte, die Stunden im Reich der Sidhe künftig dafür zu nutzen, die jährlich stattfindenden Kämpfe in der Arena des Sonnenkönigs genauestens zu beobachten. Jede Bewegung der Elfenwesen zu studieren, die gegen meinesgleichen antraten und ihr Blut aus purem Vergnügen vergossen.
Bei dem Gedanken an all die Menschen, die ich bereits hatte sterben sehen, zog sich mein Magen zusammen. Das Bild, wie sich manche von ihnen mit ausgestreckten Händen in Richtung jener Loge beugten, von der aus der König das Spiel um seine Krone stets verfolgte, hatte sich eingebrannt. Hinzu kam, dass der Herrscher der Sidhe nur verborgen hinter Umhang und Kapuze agierte, als fürchtete er, sein Antlitz könnte unter dem direkten Blick der Sterblichen verschmutzen.
Ganz automatisch tastete ich nach meinen Waffen, deren beruhigendes Gewicht an meiner Hüfte ruhte.
Ich war bereit.
Nach endlosen Übungskämpfen mit meinen inzwischen zwanzig Jahren endlich gut genug, um mich den Auswahlkämpfen in der Arena zu stellen. Denn neben Rache war es vor allem der Siegerpreis, der mich und so viele andere meiner Art als Rekruten in die Arena lockte: Gewann ein Sterblicher die Krone, stand es ihm zu, die durch uralte Sidhe-Magie an das Herrschaftssymbol gebundene Sonne mit auf die andere Seite der Pforte zu nehmen und so lange über sie zu verfügen, bis sie ihm wiederum in einem Kampf abgenommen wurde. Fast einhundert Jahre war es her, dass ein Sterblicher den an Ludiem stattfindenden Wettkampf zuletzt für sich entschieden hatte. Heute wollte ich es ihm gleichtun.
Mein Ziel fest vor Augen, reihte ich mich in den Strom derer ein, die die Siedlung in Richtung Grenze verließen. Dabei blieb ich erstaunlich unsichtbar inmitten all dieser Gesichter, die mir so fremd und zugleich so vertraut vorkamen. Es war sonderbar: Ich war hier aufgewachsen, kannte die meisten Menschen von Geburt an. Und doch trübte die von mir selbst erschaffene Distanz meinen Blick auf sie, ließ sie verblassen wie Berge im Nebel. Etwas, das nun, da ich meine Tür über Jahre hinweg verschlossen gehalten hatte, auf Gegenseitigkeit beruhte. Denn seit es passiert war – das, worüber ich mir eisern verbot nachzudenken –, hatte ich in meinem Herzen keinen Platz mehr für Freundschaften. Nicht einmal für Jovian, der einem Freund doch am nächsten gekommen war.
Am Ende aber brauchte ich nichts als meine Waffen. Sie stellten keine Fragen. Waren einfach da, kalt und verlässlich in meinen Händen, wann immer die Hitze des Zorns mich zu überwältigen drohte.
Ich schluckte. Entschlossen lenkte ich meinen Blick von der Vergangenheit zurück in Richtung Gegenwart und ließ ihn dort umherschweifen. Die felsige Landschaft jenseits der Hütten war karg und wie stets mit einer feinen Frostschicht überzogen. Es gab nur wenige Gewächse, die unter diesen Bedingungen gedeihen konnten. Knorriges Gemüse, das nicht einmal dann richtig warm wurde, wenn man es kochte, und hie und da ein paar mickrige Pflanzen, die mehr tot als lebendig aussahen. Bei den Tieren bot sich ein ähnliches Bild.
Glücklicherweise musste ich mich heute nicht lange mit dieser Kargheit auseinandersetzen, sondern konnte mich an der Pforte erfreuen, die nun in Sicht kam.
Ihre goldenen, spitz zulaufenden Streben ragten meilenweit in den Himmel empor. Sechs auf jeder Seite, jeweils von außen nach innen an Höhe gewinnend. Wie gewohnt haftete dem Anblick auch heute etwas Unwirkliches an. Es war, als betrachtete ich das Fragment eines Traumes. Eine Illusion, die in sich zusammenfallen würde, sobald ich näher trat.
Aber das tat sie nicht. Nicht, wo die Sidhe dieses Portal in ihrem Teil des Landes doch extra hatten gestaltlich werden lassen, damit meinesgleichen es passieren konnte.
Und genau das geschah bereits. Die Menschen strömten in Massen hindurch; Lichtkegel für Lichtkegel verschwand hüpfend im dahinterliegenden Nichts.
Als kleines Mädchen hatte mich dieser Anblick stets verängstigt. Ich hatte dann die Hand meines Vaters genommen und sie fest zusammengedrückt, ihn angefleht, einfach hierzubleiben, weil ich fürchtete, wir würden uns in der gähnenden Leere zwischen den Reichen verirren.
Ich spürte, wie die Erinnerung mir die Kehle eng werden ließ, und blinzelte sie entschlossen fort. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das leise Vibrieren der Macht unter den Sohlen meiner Stiefel und roch den Duft der süßen Versprechungen, der flüsternd aus der geöffneten Pforte drang. Die Lippen fest aufeinandergepresst, trat ich ein ins Land der Sidhe.
3
Die Leere zwischen den Reichen hatte sich nie zuvor so vertraut angefühlt. Sie war weder Dunkel noch Licht, weder Nacht noch Tag, sondern irgendetwas Undefinierbares, Hohles dazwischen. Bereitwillig drang sie durch jede meiner Poren und kroch wispernd durch mein Blut. Kurz war ich versucht, einfach zu verharren in diesem Nichts, das mir einmal solche Angst eingejagt hatte. Dortzubleiben, bis die Pforte sich wieder schloss, und als Gefangene im friedlich-trüben Weiß dieses Ortes zu sterben. Doch ich zwang meine Füße zum Weitergehen.
Als der Schleier sich nach einer gefühlten Ewigkeit, die eigentlich nur wenige Augenblicke währte, hob, schossen mir die Tränen in die Augen. Das grelle Licht, das mich auf dieser anderen Seite des Portals in Empfang nahm, stach und pikte überall dort, wo meine Haut nicht von Kleidung bedeckt wurde.
Blinzelnd stolperte ich weiter vorwärts, um den anderen Neuankömmlingen den Weg frei zu machen. Die ersten Minuten unter der Sonne waren immer eine Qual. Man hatte das Gefühl, bei lebendigem Leibe zu verbrennen, ehe der Körper sich an Licht und Wärme gewöhnt hatte. Vor allem, wenn man wie ich in einem ledernen Kampfanzug steckte.
Konzentriert atmete ich ein paarmal tief ein und aus, um angesichts der heißen, nach Blüten duftenden Luft nicht zu hyperventilieren. Ein gängiges Problem, das gerade für die Kleinsten von uns im ersten Moment schwer zu handhaben war. Entsprechend wunderte es mich nicht, als im Hintergrund Kindergeschrei erklang, gefolgt von beruhigenden Worten mitfühlender Eltern.
»Es ist gleich vorbei. Ruhig, ganz ruhig. Es tut nur kurz weh, danach ist es schön. Komm, wir gehen in die Stadt und kaufen Süßigkeiten.«
Das Weinen wurde leiser. Nicht mehr lange, und es würde von staunenden, quietschenden Lauten abgelöst werden. Auch ich konnte meine Umgebung endlich wahrnehmen, doch entlockte sie mir, ihrer überwältigenden Schönheit zum Trotz, längst keine Freudenschreie mehr. Im Gegenteil: Sie machte mich traurig. Die prachtvollen Blumen und Hecken, die die gewundenen Straßen in Richtung der Stadt säumten, die glitzernden Dachschindeln der imposanten Bauten, die über der sich um den Hügel ziehenden Mauer hervorlugten, die üppig wogenden Baumkronen und die weitläufigen Grünanlagen, auf denen bunte Pfauen entlangstolzierten … all das schmerzte mich in seiner Vollkommenheit.
Mein Blick wanderte zur Kuppe des Hügels empor, auf der sowohl der Palast des Sidhe-Herrschers als auch seine Arena aufragten. Nicht mehr lange, und die Auswahlzeremonie würde beginnen. Ich hatte beobachtet, dass diejenigen Freiwilligen, die etwas später als der Rest kamen, bevorzugt in den Kampf geschickt wurden. Vermutlich, weil man ihnen für ihre Unpünktlichkeit eine Lektion erteilen wollte. Etwas, das mir hoffentlich zum Vorteil gereichen würde.
Um zur Arena zu gelangen, die sich auf der Rückseite des Hügels befand, würde ich die Hauptstraße nehmen müssen, die sich mitten durch das Herz der Stadt schlängelte. Selbst jetzt, obwohl größtenteils noch von der Mauer verborgen, löste dieses Zentrum ein Gefühl von Widerwillen in mir aus.
Ich verabscheute die Sidhe für ihren Wohlstand und ihre Lebensfreude, die sie lieber für sich einbehielten, als sie zu teilen. Nicht einmal das Glück, dass das Tageslicht schenkte, gestanden sie uns zu.
Ich wusste, dass es vor langer, langer Zeit einmal ein einheitliches Lavandria gegeben hatte, in dem gleichermaßen Platz für Menschen und Sidhe gewesen war. Doch irgendwann hatten Hass, Gier und Neid das Land in zwei Reiche gespalten – und außerdem in Sonne und Mond.
Wenn die Sidhe nur wollten, könnten sie diese Spaltung mit ihren Fähigkeiten gewiss rückgängig machen, aber das taten sie nicht. Sie hassten uns. Für unsere Gewöhnlichkeit, unsere bedeutungslos kurze Lebensspanne, für einfach alles.
Und ich hasste sie.
Jeder Schritt auf magischem Grund verstieß für mich gegen alles, was mir heilig war. Ich wollte hier nicht sein, wollte nicht erleben, wie mein Volk sich von der falschen Gönnerhaftigkeit dieser Wesen blenden ließ. Und doch hatte ich keine andere Wahl, als meine Abscheu zu überwinden. Noch ein einziges, allerletztes Mal.
Mit aufeinandergepressten Kiefern zwang ich mich erneut dazu, weiterzugehen, und schritt auf Clivia zu, erbärmlich schwitzend unter meiner Kluft. Dann war der Moment gekommen, und ich erreichte endlich über eine Brücke den Eingang, der der Pforte auf der Ländergrenze nachempfunden war. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden Durchgängen bestand in ihrer Größe: Dieses hier ragte nicht meilenweit in den Himmel empor, sondern endete unter einem Bogen im Mauerwerk.
In einer Geste vorgegaukelter Gastfreundlichkeit stand es den ganzen Tag über offen. Wer am Ende von Ludiem jedoch nicht draußen war, weil er sich im Rausch des Vergnügens und der Opulenz verloren hatte, musste bleiben – und sterben, oder sogar Schlimmeres erleiden. In den Erzählungen der Dorfältesten war stets von Folter und Versklavung die Rede. Schicksale, die so grauenvoll waren, dass sie besser in Vergessenheit gerieten. Dennoch gab es immer wieder Sterbliche, die sich in ihrer verzweifelten Sehnsucht nach dem Tage absichtlich in den Gassen der Stadt versteckten.
So viele verschwendete Menschenleben … Böse funkelte ich das Tor an, als ich es passierte, und suchte mit den Fingerspitzen erneut die beruhigende Kälte meiner Klingen.
Clivias Farben- und Geräuschvielfalt erschlug mich förmlich. Bunte Hausfassaden und bemalte Laternen, überquellende Blumenkübel … Klänge sanfter Musik und das Klappern von Hufen auf edlem Pflasterstein.
Nur ein paar wenige Sidhe waren zu Fuß unterwegs, der Rest bewegte sich in Kutschen fort. Ihre überwältigende Schönheit – die sonnengebräunte Haut, ihre edlen Gesichtszüge und die seidigen Haare – erinnerte auf geradezu hämische Weise an die Gewöhnlichkeit meines Volkes. Genau wie die durch entsprechende Frisuren bewusst zur Schau gestellten spitzen Ohren und die langen Eckzähne, die bei jedem hochmütigen Lächeln aufblitzten.
Verbissen bahnte ich mir meinen Weg durch die vollen Gassen. Immer weiter bergauf, begleitet von meinem vor Anstrengung hämmernden Pulsschlag.
Der königliche Palast ragte über mir auf und warf mächtige Schatten, in deren schmeichelnder Kühle ich einen Moment lang verharrte. Selbst der von hier aus erkennbare, verhältnismäßig kleine Ausschnitt des sonnengelben, mit Zinnen und Erkern gespickten Schlosses genügte, um mich erahnen zu lassen, wie pompös der Sidhe-Herrscher und sein Hof wirklich hausten.
Schaudernd wandte ich mich ab und betrat die linke Abzweigung des Weges. Ein Gefühl von Trauer und Furcht nagte an mir, als ich nach wenigen Gehminuten endlich jenen Ort erblickte, an dem ich einst alles verloren hatte.
Jetzt gab es kein Zurück mehr.
4
Die Fassade der Arena, die auf der Rückseite des Hügels lag, war mit Kalkstein verkleidet. Kalkstein, der die Farbe von Knochen hatte, was angesichts der Geschehnisse im Inneren dieses Bauwerks reichlich makaber war. Sechs elliptisch angelegte Arkadenreihen boten Platz für etliche Zuschauer magischer Abstammung, während die daruntergelegenen, in die Erde eingelassenen Stufenränge sterbliches Publikum beherbergten. Ich hatte schon oft dort gesessen – und gelitten. Heute aber steuerte ich erstmals auf den Tunnel zu, durch den die auserwählten Rekruten später einlaufen würden.
Und auch wenn ich meine wachsende Anspannung zu unterdrücken versuchte, spürte ich meinen rasenden Puls doch immer deutlicher an meinem Hals, als ich näher kam und einen Sidhe bemerkte. In einem weißen Umhang stand er neben dem Tunneleingang und studierte eine Rolle Pergament, die er in den langen blassen Fingern hielt. Sein gebräuntes Gesicht war mit kraterartigen Narben versehen, die Haare farblos. Und trotzdem, obwohl ihm die Makellosigkeit jener Sidhe auf den Straßen Clivias fehlte, war auch er eine imposante Erscheinung.
»Hast du dich verlaufen, Mädchen?«, fragte er, ohne den Blick zu heben. Während er sprach, entblößten seine vollen Lippen ein Paar besonders langer und spitzer Reißzähne.
»Ich melde mich freiwillig für den Kampf um die Sonnenkrone«, verkündete ich das, was gemeinhin einem Selbstmord gleichkam. Gleichzeitig fragte ich mich, wie viele aus den übrigen vierundzwanzig Dörfern es mir heute wohl bereits gleichgetan hatten. Bis auf eine Ausnahme – das Jahr, das ich am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen wollte – hatte es stets genügend Rekruten gegeben, die aus freien Stücken am Wettkampf teilnehmen wollten. In der Regel selbstverständlich solche, die besonders viel Talent, Stärke oder eine Kombination aus beidem aufwiesen, um die Chancen auf einen Sieg für die sterbliche Seite zu erhöhen. Doch nicht immer hatten die von den jeweiligen Dörfern gestellten Kandidaten ausgereicht – sei es, weil sie sich beim Üben wie Jovian verletzt oder in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht hatten.
Es galt, dass das Volk der Menschen mindestens zehn Kämpfer stellen musste. War diese Bedingung nicht erfüllt, durften die Sidhe Personen aus dem Publikum auswählen. Dabei fiel ihre Wahl der Dramatik halber bevorzugt auf Familien oder Paare – so wie damals, als meine Mutter und mein Vater ernannt worden waren. In der Zeit danach hatte es den Sidhe nicht mehr an Freiwilligen gemangelt. Als hätte die Zwangsauswahl an das Ehrgefühl aller Sterblichen appelliert und sie daran erinnert, dass der Tod unter und für die Sonne es wert war.
Wäre nicht von den Sidhe verfügt worden, dass wir uns nur innerhalb unserer eigenen Gemeinschaften vorbereiten und keine Allianzen zwischen den Dörfern schmieden durften, hätte uns dieser Motivationsschub sicher zu einer mächtigen Armee heranwachsen lassen.
»Ach ja?« Der Sidhe vor mir sah nun doch auf und musterte mich abschätzig. »So ein zartes Ding wie du?«, fragte er glucksend.
»Ja, so ein zartes Ding wie ich«, entgegnete ich möglichst ruhig. Auf Provokationen wie diese war ich vorbereitet. Sollte er sich doch von meinem Äußeren täuschen lassen – ich würde ihm zeigen, dass ich kämpfen konnte wie ein Mann. Ihm und allen anderen seiner Art.
»Nun gut. Name und Siedlung?«
»Astoria Laghiurda aus Velgrim.«
Der Sidhe ließ den Kiel einer Feder über das Pergament kratzen. Dann sah er mich noch einmal intensiv und lange an, ehe er endlich einen Schritt zur Seite machte.
»Bitte sehr, Astoria Laghiurda aus Velgrim. Auf dass deine Todessehnsucht erhört werde.« Mit einer spöttischen Armbewegung bedeutete er mir einzutreten.
Erhobenen Hauptes rauschte ich an ihm vorbei. Meine Emotionen zu kontrollieren, hatte jahrelang zu meinem selbst auferlegten Übungsprogramm gehört.
Als ich den steinernen Tunnel betrat, schlugen mir sofort Kampfgeräusche entgegen. Die Qualifikationsphase hatte bereits begonnen.
Schnell überwand ich die letzten Schritte und erreichte schließlich die lichtdurchflutete Arena, in der knapp dreißig Sterbliche vor den Augen königlich abbestellter Sidhe gegeneinander kämpften.
Kurz staunte ich über diese hohe Anzahl an Freiwilligen, die bedeutete, dass ein paar Dörfer mehr als einen würdigen Kandidaten hergeschickt hatten.
Allerdings nur so lange, bis sämtliche Köpfe der royalen Gardisten in meine Richtung ruckten. Im Gegensatz zu jenen anmutigen wie schönen Wesen ihrer Art, die durch die Stadt flanierten und sich in Droschken durch die Gassen fahren ließen, besaßen sie ein grobschlächtiges Äußeres. Ihre Züge waren gezeichnet von Gewalt; Narben zogen sich über ihre Wangen oder wanden sich wie wulstige rosafarbene Tätowierungen um ihre Arme.
Hinzu kamen etliche schwarze Male, die den Sidhe in verschlungenen Linien und Schnörkeln bis zu den breiten Hälsen reichten. Einem der Gardisten fehlte ein Ohr, dem anderen eine Fingerkuppe, und wieder ein anderer hatte nur noch ein Auge.
Jedes Jahr kämpfte ein anderer von ihnen beim Kronenkampf gegen die menschlichen Rekruten. Dabei galt, dass keine Magie benutzt werden durfte. Es war ein simples Kräftemessen zwischen den Arten, sofern man es unter Berücksichtigung der anatomischen Unterschiede überhaupt als simpel bezeichnen konnte.
Ganz gleich, wie sehr ein Mensch sich anstrengte, nie und nimmer würde er so muskulös werden wie ein Sidhe. Auch ihr Reaktionsvermögen war von Natur aus ausgeprägter als unseres. Gerecht war ein Kronenkampf also vermutlich noch nie gewesen, doch immerhin verzichteten die Sidhe auf den Einsatz ihrer Zauberkräfte. Mehr Entgegenkommen konnten wir nicht erwarten. Nicht von ihnen.
»Eine Nachzüglerin«, begrüßte der einohrige Gardist mich schnarrend. Hinkend kam er auf mich zu, verschränkte die Oberarme vor der massigen Brust und musterte mich mit einem widerlichen Grinsen auf den rissigen Lippen. Auch der Rest seiner Gesichtshaut war an vielen Stellen aufgesprungen. Er hatte eine vernarbte, breite Nase, dunkle Augen und ebenso dunkles Haar. Alles an ihm wirkte bedrohlich.
Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, wer oder was die Gardisten des Königs derart zugerichtet hatte.
Vermutlich gingen sie einander schlicht selbst an die Gurgel, um ihrer perversen Neigung zur Gewalt zu frönen.
»So was Hübsches. Was für eine Verschwendung.« Der Gardist lachte rasselnd.
Zart. Hübsch.
Mit meinen silbernen Haaren, den in dazu beinahe ähnlicher Farbe schimmernden Augen und meinen blassen Sommersprossen mochte diese Beschreibung vielleicht sogar zutreffen.
Dennoch sah ich darin gewiss kein Kompliment.
Sidhe ließen sich von Äußerlichkeiten blenden.
Ich hatte während vorangegangener Sonnentage ausreichend Beobachtungen angestellt und Gespräche verfolgt, um mir dessen absolut sicher sein zu können.
Sie waren Liebhaber der Ästhetik, Verfechter ihrer eigenen verqueren Ideale. Eine schöne Hülle war mehr wert als das, was sich in ihrem Inneren befand. Selbst die Krieger des Königs lebten nach dieser Philosophie.
Ich zog mein Schwert. Sonnenstrahlen brachen sich in seinem stählernen Silber. Es bedurfte keiner weiteren Worte, um dem Gardisten mitzuteilen, warum ich hier war – und dass ich meine Anwesenheit keinesfalls für eine Verschwendung hielt.
Der Sidhe grunzte.
»Du da!«, rief er einem hochgewachsenen Mann zu, der gerade als Sieger aus einem Zweikampf hervorgegangen war.
Sofort drehte der Angesprochene sich zu uns um, als wäre »Du da« der Name, auf den er hier und heute hörte. Ein blutender Schnitt zog sich über seine Wange.
»Herkommen«, befahl der Sidhe. »Du hast eine neue Gegnerin.«
Unterwürfig kam der Mann zu uns. Er verzog keine Miene, als er mich sah. Lachte nicht darüber, dass er gegen eine junge Frau kämpfen sollte, die zwei Köpfe kleiner war als er und kaum einen Bruchteil seiner Muskelmasse besaß, die unter dem gepanzerten Oberköper nur zu erahnen war.
Ich selbst verfügte weder über Kettenhemd noch über Schild, hatte jedoch die Erfahrung gemacht, dass ich mich ohne dieses zusätzliche Gewicht an meinem Körper viel flinker bewegte.
»Los«, knurrte der Sidhe und trat beiseite.
In stummem Einverständnis und Respekt voreinander nickten der Mann und ich einander zu. Wir waren keine Feinde, wollten beide dasselbe: unserem Land die Farben zurückbringen.
Rasch löste ich meinen Proviantbeutel vom Gürtel und warf ihn in meinem Eifer vielleicht ein wenig zu schwungvoll über die Schulter. Ich nahm einen festen Stand ein und positionierte mein Schwert eng an meinem Körper. Schon holte mein Rivale zum Schlag aus, den ich gekonnt parierte. Dann ging ich zum Gegenangriff über, den er seinerseits abblockte.
Wir tänzelten umeinander herum, jede Bewegung wohlüberlegt, jeder Schrittwechsel ein prickelndes Risiko.
Das Silber unserer Waffen küsste sich kreischend, ließ Funken in den goldenen Tag stieben.
Mein Widersacher war schnell, aber ich war schneller.
Als er seine Fußstellung erneut wechseln wollte, um meinem Präventivschlag auszuweichen, brachte ich ihn mit einem heftigen Stoß zu Fall. Klirrend schlug sein Schwert neben ihm auf dem Boden auf, und er gab ein hörbares Stöhnen von sich, als der Aufprall ihm die Luft aus der Lunge quetschte.
Irgendwo pfiff jemand anerkennend durch die Finger.
Nach Luft japsend, wischte ich mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Meine Muskeln schmerzten, und die Sonne brannte in meinem Gesicht. Alles in mir schrie danach, mir die Lederkluft vom Leib zu reißen und meinen Körper mit Wasser zu übergießen, doch ich rang das Bedürfnis tapfer nieder.
Ich rechnete fest damit, einen weiteren Kampf austragen zu müssen. Der einohrige Sidhe aber verkündete überraschend, dass die Auswahlzeremonie jeden Moment beginnen würde.
Durstig sammelte ich meinen Proviantbeutel wieder ein, der den enthusiastischen Schulterwurf glücklicherweise unbeschadet überstanden hatte. Gierig nahm ich ein paar Schlucke aus meiner Flasche – viel war nicht mehr übrig – und sah mich um. Es gab ein paar Verletzte, die meisten der Freiwilligen aber waren schlicht erschöpft und, ähnlich wie ich, vollkommen ausgetrocknet.
Am Eingang des Tunnels entdeckte ich den grauhaarigen Sidhe, der meinen Namen notiert hatte. Sämtliche Legionäre strebten in seine Richtung, um sich in den Tunnel zurückzuziehen und sich zu besprechen. Gespannt hielt ich den Atem an, als die Sidhe nach einer schieren Ewigkeit wieder hereinkamen. Einer von ihnen, der Einäugige, trat vor. Kein Laut war mehr zu vernehmen; jeder wartete nur auf das, was der Gardist zu sagen hatte. Doch es waren nicht die Namen der Auserwählten, die er verkündete.
»Verneigt euch vor König Ronas Tiberion, dem siebten Sonnenkönig von Lavandria.«
5
Ein Raunen ging durch die Menge der Rekruten, die sich sogleich teilte und ehrfürchtig auf die Knie ging.
Ich wiederum ließ mein Schwert, das ich wieder aufgehoben hatte, sinken, das Handgelenk kaum merklich zitternd. Seit wann wohnte der König selbst dem Auswahlverfahren bei?
»Runter mit dir«, zischte der einäugige Sidhe mich an. Seine vermutlich als Folge einer Verletzung gespaltene Zunge schnellte zwischen seinen schwarzen Lippen hervor und machte mir unmissverständlich klar, dass er bereit war, jede Art von Ungehorsam sofort mit einem Biss seines schlangenähnlichen Kiefers zu bestrafen.
Widerwillig tat ich, was er verlangte, und richtete meinen Blick wie alle anderen Rekruten fest auf den Tunnel, der in die Arena führte.
Zuerst traten zwei von Kopf bis Fuß in goldglänzende Rüstung gekleidete Gardisten ein. Der rechte von ihnen trug eine Stange, an der das Wappen des Königs präsentiert wurde: eine gekrönte Sonne hinter zwei gekreuzten Schwertern, gelb auf hellblauem Grund.
Die Männer waren von so breiter Statur, dass ich den hinter ihnen schreitenden König erst sah, als sie ihn in ihre Mitte nahmen. Auch heute trug er seinen schimmernden Umhang, der wie fließende Seide um seine hochgewachsene Gestalt floss.
Wann immer ich in seinem Reich gewesen war, in seiner Arena, hatte er in einer Loge auf einem goldenen Thron gesessen. Unbewegt und in ebendieses Gewand gekleidet; ein gesichtsloses Monster, an dessen Händen das Blut so vieler Unschuldiger klebte.
Ich spürte, wie Wut und Hass mir die Eingeweide verknoteten. Je näher König Ronas kam, desto stärker wurde der Abscheu in mir. Seine Feigheit widerte mich an. Er hielt es nicht einmal für nötig, uns, die doch in seinen Augen ohnehin todgeweiht waren, sein Antlitz zu offenbaren. Damit übertraf er sogar die Arroganz seiner Vorfahren, die, so erzählte man sich, auf derlei Versteckspielchen verzichtet hatten.
Unweit von mir kamen er und sein Geleit zum Stehen.
Langsam wandte der König seinen Kopf in Richtung der Gardisten, die sich in Reih und Glied aufgestellt hatten. Das zumindest ließen die zarten Wellen vermuten, die der Stoff zwischen seinem Kopf und der rechten Schulter plötzlich warf. »Zeigt mir, welche Auswahl ihr getroffen habt«, forderte er mit heuchlerisch weicher dunkler Stimme, die mich zusammenzucken ließ.
Niemals hatte ich Ronas sprechen hören, geschweige denn, ihn aus so geringer Distanz gesehen.
Was wäre, wenn ich ihm mein Schwert hier und jetzt durch sein grausames Herz jagen würde?, schoss es mir durch den Kopf. Doch ich wusste leider, dass damit nichts gewonnen wäre. Dass ich bloß hingerichtet und ein neuer König erwählt würde und dass die Sonne weiterhin im Besitz der Sidhe bliebe.
Dennoch juckte es mich geradezu in den Fingern, Rache an diesem Geschöpf zu üben, das mir meine Eltern genommen hatte.
Beide waren zwar nicht durch seine Hand, aber unter seinen Augen gestorben.
Während ich auf der Tribüne gestanden hatte, flankiert von seinen Männern, schreiend vor bodenloser Verzweiflung, hatte er einfach nur dagesessen. Hatte zugelassen, dass die Sidhe-Zuschauer lachten, dass sie die toten Körper meiner Eltern mit Bechern bewarfen und dabei johlten und grölten. Meine Mutter und mein Vater, die an diesem Tag so verzweifelt versucht hatten, ihrer Tochter die Sonne zurückzuholen.
Ein Beben ging durch meine Schultern.
»Unsere Auswahl, jawohl, Hoheit.« Der Einohrige verbeugte sich kriecherisch. Dann beorderte er den grauhaarigen Aufseher und einen weiteren Sidhe herbei, der während der Testkämpfe am Rand der Arena gestanden und sich Notizen gemacht hatte.
Ein Gefühl kribbelnder Nervosität brandete gegen meine Rippen, als beide ihre Pergamentblätter hervorholten. Gleich würde ich erfahren, ob sich meine jahrelangen Vorbereitungen ausgezahlt hatten.
»Steht auf, ihr Narren«, herrschte der Einohrige uns an.
Am liebsten wäre ich in meiner Position geblieben, einfach nur, um den Gardisten ein wenig zu provozieren. Doch vor dem König im Staub zu knien, war mir ebenso wenig recht. Also erhob ich mich.
»Die, deren Namen genannt werden, sollen vortreten«, sagte der geisterhafte Sidhe mit den Kraternarben, nun beide Papiere in den Händen haltend.
»Darian Gaalhri. Savir Zomgenis. Anduin Lagostra. Firion Thembra. Haldor Iphgenius.«
Mit aufeinandergepressten Lippen beobachtete ich, wie einer nach dem anderen einen Schritt nach vorn machte. Männer unterschiedlichen Alters, in deren Mienen sich Stolz und Furcht spiegelten. Mein Mut sank mit jedem Namen, doch ich gemahnte mich zur Ruhe.
»Marcela Barbessa. Laurin Onulagh. Ossian Treebah. Argon Fyselis. Xaniel Rogharda.«
Eine furchtbare Leere tat sich in mir auf.
Da waren sie, ihre zehn Freiwilligen. Sie hatten sie gefunden – und ich war nicht unter ihnen.
»Eure Gegner, Majestät.«
Ich erstarrte. Seine Gegner? Das klang, als würde der König höchstpersönlich am Kampf um seine Krone teilnehmen.
Plötzlich begriff ich. Wenn er tatsächlich selbst zur Waffe greifen würde … Dann lag es nahe, dass seine Männer die Schwächsten unter uns wählten. Immerhin hatte meines Wissens noch nie ein König im Ring gestanden. Was auch immer Ronas dazu trieb, dies zu ändern – ob Selbstherrlichkeit, Langeweile oder das schlichte Bedürfnis nach Anerkennung –, ich würde ein weiteres Jahr warten müssen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in ewiger Nacht.
Ich schmeckte den bitteren Geschmack der Enttäuschung auf meiner Zunge. Hätte ich auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt, dass die Regeln sich zugunsten des Sidhe-Oberhauptes ändern würden, hätte ich absichtlich verloren.
»Was ist mit dieser jungen Dame hier?«
Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass der König über mich sprach. Er hatte sich mir zugewandt, die Hände an dem Stoff an seinem Kopf. Unfähig, auch nur zu blinzeln, starrte ich ihn an.
Zuerst offenbarte Ronas sein Gesicht, dann löste er kaum sichtbare Kordeln seines Gewands um Hals und Brust und ließ den wallenden Stoff, der seine Identität geschützt hatte, fallen.
Mir stockte der Atem.
Ich hatte nie einen schöneren Mann gesehen.
Sofort wallte ob dieser Erkenntnis Ekel in mir auf. Ich wollte das nicht denken, nicht über jemanden wie ihn, und doch war es die Wahrheit.
Sein goldblondes Haar reichte ihm in seichten Wellen bis zum Kinn, und seine Augen waren von einem geradezu türkisfarbenen Blau, gegen das selbst der strahlende Himmel über dem Königreich blass und farblos erschien. Seine Haut war gebräunt, die Nase wohlgeformt, die Lippen sinnlich. Den Zügen des jungen Königs haftete etwas unbestreitbar Edles an, das sich vor allem in seinen hohen Wangenknochen und den ausgeprägten Konturen seines Kiefers niederschlug. Unter seiner eng anliegenden weißen Lederkluft zeichneten sich seine Muskeln deutlich ab. Auf den Spitzen seiner Ohren, die kaum sichtbar aus seinem dichten Haar hervorlugten, trug er goldene Aufsätze.
Das Beeindruckendste an seiner Erscheinung aber war zweifellos die Krone auf seinem schönen Kopf, die er während der Arena-Kämpfe einfach über dem Stoff trug. Schon von Weitem hatte sie an jedem Ludiem eine ungeheure Faszination auf mich ausgeübt, doch hier entfaltete sie eine beinahe hypnotische Wirkung. Ihre Zacken waren wie Sonnenstrahlen geformt. Fächerartig angeordnet und mit vier kleinen und einem in ihrer Mitte sitzenden, großen goldenen Himmelskörper gespickt, leuchteten sie heller als der Tag selbst.
Weil sie der Tag waren. Nicht symbolisch, sondern wahrhaftig.
Denn ohne sie wäre auch der von den Sidhe bewohnte Teil Lavandrias der Finsternis geweiht. Wenn ich mich recht erinnerte, war die Sonne einst vom Himmel in die Steine der Krone gebannt worden – oder sogar geschmiedet.
Was dort von oben auf uns hinunterschien, war im Grunde genommen nicht mehr als eine Attrappe. Auf magische Weise von der Krone auf das strahlende Blau projiziert.
»Die junge Dame, Euer Gnaden? Was soll mit ihr sein?« Der Einohrige klang alarmiert.
»Du weißt genau, was ich meine, Cyrian.«
Während in mir eine winzige Knospe der Hoffnung gedieh, hob der König die dunklen, im starken Kontrast zu seinem hellen Haar stehenden Brauen. Ein seltsames Flackern zuckte durch das Blau seiner Augen, als er mich musterte.
Erkannte er mich wieder?
Nein. Nein, er hatte stets viel zu weit weg von mir gesessen. Selbst an jenem Tag, an dem ich als zwölfjähriges Mädchen um meine Eltern geschrien hatte, war ich für ihn nur ein winziger Punkt in der Menge der Zuschauer gewesen.
Noch immer verstörten mich seine Schönheit und seine Jugend, die sich doch so schwer in Einklang mit der blutigen Tradition bringen ließ, die er und sein Volk hier Jahr für Jahr pflegten. Ronas, obwohl bereits so lange an der Macht, wirkte kaum älter als ich selbst mit meinen zwanzig Jahren. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Die Sidhe alterten nur langsam.
»Nicht bei Eurem ersten Kampf, Hoheit.« Der Gardist sprach gedämpft, so als schämte er sich für seine Worte.
Sein erster Kampf. Es stimmte also. Er war töricht genug, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen.
Was Ronas wohl anders sah, denn er stieß ein bedrohliches Knurren aus.
Jäh begann die Luft um ihn herum, sich zu kräuseln. Ein kaum wahrnehmbares Sirren drang an meine Ohren und hauchte einen leichten Schwindel in meine Schläfen.
Magie. Ganz eindeutig.
Eine Demonstration jener Macht, die in jedem Sidhe schlummerte. Und als König besaß Ronas ganz gewiss mehr davon als alle anderen seiner Art.
»Sie soll mitmachen«, sagte er in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Heute werden es elf Teilnehmer sein.«
Eine wilde Freude, warm wie Fell und Daunen, breitete sich in meinem Brustkorb aus. Ich durfte kämpfen. Erhielt die einmalige Gelegenheit, meine Familie zu rächen – und dem Oberhaupt der Sidhe höchstpersönlich den Garaus zu machen.
»Wie lautet dein Name?«, fragte König Ronas mich leise.
Ich hielt seinem durchdringenden Blick tapfer stand, obwohl aus dem Schwindel, durch die Magie bedingt, in meinem Kopf allmählich ein drückender Schmerz wurde.
»Astoria Laghiurda.«
»Astoria Laghiurda«, wiederholte er langsam, als wollte er sich jeden einzelnen Buchstaben auf der Zunge zergehen lassen.
Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Recht so. Sollte er ihn sich nur gut einprägen, den Namen seiner Mörderin.
6
Das Warten war das Schlimmste.
Nachdem der König ohne ein weiteres Wort wieder aus der Arena stolziert war – selbstverständlich auch dieses Mal begleitet von seiner Flaggen schwenkenden Eskorte –, wurden wir ebenfalls hinausgeführt.
Die übrigen Freiwilligen schwärmten bereits in Richtung Tribüne aus, während die Gardisten uns in ein großes Zelt lotsten, das bei meiner Ankunft noch nicht da gewesen war.
Dort ließen sie uns mit der Anweisung zurück, erst auf ihre Aufforderung hin wieder nach draußen zu treten. Ihre massigen Schatten zeichneten sich hinter dem Stoff ab und verrieten, dass sie sich rund um das Zelt herum postiert hatten, in dem es schnell furchtbar stickig wurde. Zwar gab es ein paar Wasserflaschen, jedoch nicht ausreichend für jeden von uns, deren Proviantbeutel allesamt von den Gardisten beschlagnahmt worden waren. Also mussten wir teilen und darauf vertrauen, dass niemand mehr trank, als ihm zustand. Wieder ein kleiner, fast unscheinbarer Akt der Grausamkeit, der Geist und Körper mürbe machte, bevor der Kampf überhaupt begonnen hatte.
Genau wie das Fehlen von Sitzgelegenheiten – wobei ich im Gegensatz zu meinen größeren und schwereren Mitstreitern durchaus auch imstande war, es mir auf dem Boden einigermaßen bequem zu machen.
Keiner von uns sprach ein Wort; jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Vielleicht war es vermessen, doch ich rechnete mir nach wie vor die größten Erfolgsaussichten aus.
Wenn die Sidhe mich nur zuerst antreten ließen …
Vielleicht könnte ich die anderen dann vor ihrem Schicksal bewahren. Doch die Festlegung der Reihenfolge, in der wir antraten, würde sicher erst kurz vor Beginn des Spektakels erfolgen.
Als von Clivias Glockenturm her endlich der Gong ertönte, der den baldigen Beginn der Kämpfe ankündigte, zerfiel meine vorgebliche Ruhe zu Staub. Mein Herz schlug in einem wilden Galopp gegen meine Rippen – und brach beim Klang der Zuschauerstimmen, die der Wind bald darauf über den Hügel trug, beinahe aus diesem knöchernen Gefängnis aus.
Gebannt fixierte ich den Zelteingang. Die Schatten der Gardisten verschmolzen mit weiteren grazileren Schemen. Dann strömte eine Gruppe weiblicher Sidhe, alle in hauchdünne, durchscheinende Seidenkleider gehüllt, in das Zelt. Eine der Sidhe-Frauen, zerbrechlich-schön wie ein Schmetterling, trat neben mich. Sachte griff sie nach meiner Hand und drehte sie um. Mit schnellen Pinselstrichen malte sie mir, wie es laut Überlieferungen seit jeher Brauch war, eine Zahl in die Innenfläche – jene Nummer, die mir verriet, an welcher Stelle ich antreten durfte.
Ich blickte auf das Ergebnis: eine Sechs. Wenn es also niemandem vor mir gelang, sich die Krone zu erkämpfen, würden fünf Leute sterben müssen. Fünf Leben, ausgelöscht an einem einzigen Tag, in einer einzigen Stunde. Und sechs weitere würden folgen, wenn ich scheiterte.
Geopfert für Licht und Hoffnung.
Den Wettkampf nur mit den Ohren zu verfolgen, anstatt ihn mit allen Sinnen zu erleben, war die reinste Folter.
Wann immer das Publikum vor Begeisterung johlte, malte ich mir entweder aus, wie der König seinen letzten Atemzug tat, oder, was in meiner Vorstellung leider dominierte, wie einer der Unseren tödlich verletzt wurde. Selten einmal drangen aufgeregte Laute oder entsetztes Raunen ins Zelt herüber – stets von so kurzer Dauer, dass die Hoffnung ausblieb.
Der Tod verrichtete seine Ernte gewissenhaft. In immer kürzer werdenden Abständen riefen die Gardisten uns aus, nannten uns nur noch bei Zahlen und nicht bei Namen.
Obwohl keiner meiner fünf Vorgänger aus der Arena zurückgekehrt war, war ich beinahe überrascht, als ein Sidhe, dieses Mal einer mit stark vernarbter Gesichtshälfte, mich aufforderte, ihm zu folgen. Ein Teil von mir begriff erst jetzt, dass ich tatsächlich hier war; als Teilnehmerin dieses so wichtigen wie blutigen Wettstreits, der über unser aller Schicksal entscheiden konnte. Wenn ich gewann und den König besiegte – durch mein Schwert in seiner Brust oder seine laut ausgerufene Kapitulation –, würde sich alles ändern. Zumindest ein Jahr lang, in dem ich alles daransetzen würde, die Krone auch beim folgenden Ludiem zu verteidigen. Und wenn ich verlor … würde alles weitergehen wie bisher.
Mein Hals wurde so trocken, dass ich ein Hüsteln unterdrückte. Ich hätte den letzten Tropfen Wasser, der meine Kehle hinuntergeronnen war, genießen müssen. Auf dem Weg hierher an einer Blüte riechen, mich auf eine grüne Wiese legen, Vögel beobachten. Nur für den Fall, dass ich es nie wieder würde tun können.
»Los, rein mit dir.« Der Sidhe machte Anstalten, mich zu schubsen, doch ich war flinker als er.
So behänd, wie es unter meiner zunehmenden Anspannung möglich war, sprang ich nach vorn, in den kühlen Schatten des Durchgangs hinein, und lauschte dem Echo meines Atems, das mir sogar lauter vorkam als das ausgelassene Jauchzen der Menge.
Ich zog mein Schwert aus der Scheide, diesen mir so treu ergebenen Freund, und betrat die Arena.
Licht umfloss mich, trieb mir die Hitze in die Wangen und ließ meine Glieder unter der Lederkluft schwer und träge werden. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, mich aufmerksam umzuschauen.
In den niederen Rängen saßen wie jeher Sterbliche, die oberen Reihen waren ausnahmslos von Sidhe in bunten und edlen Roben besetzt. Auch ohne eine Aufteilung in gesonderte Bereiche wäre ganz genau ersichtlich gewesen, wer welchem Volk angehörte. Obwohl die anwesenden Menschen ebenfalls farbenfroh gekleidet waren, wirkten sie blass. Ihre Gesichter waren bleich wie Monde, die nackten Arme und Beine wie aus Wachs gegossen. Neben den Sidhe, diesen vor Anmut und Schönheit strotzenden Wesen, sahen sie entsetzlich krank aus.
Ich schluckte, wandte mich von den Zuschauern ab und konzentrierte mich auf meine nächsten Schritte. Es war wichtig, alles andere auszublenden; die Geräusche, die Farben und die vielen Augenpaare, die auf mich gerichtet waren. Ich musste meinen Körper spüren, jeden einzelnen Muskel bewusst wahrnehmen, musste ganz und gar bei mir sein.
Zu Hause, im Übungskampf mit Jovian, war ich eine Meisterin darin gewesen. Doch hier, umgeben von so viel schwelender Magie und den Spuren des Scheiterns meiner Mitstreiter, fiel es mir schwer. Ihr Blut war zu großen Teilen bereits im Sand versickert. Zurückgeblieben war eine braune Kruste, die am Ende des Tages mit einem Kübel Wasser fortgespült werden würde.
Entschlossen biss ich die Zähne zusammen. Ich durfte nicht zulassen, dass auch das Rot meiner Adern sich auf diesen verfluchten Grund ergoss. Nein, das alles musste hier und heute ein für alle Mal ein Ende finden.
Ich umklammerte den Griff meines Schwertes fester und löste meinen Blick von dem besudelten Boden zu meinen Füßen.
»Da bist du ja«, begrüßte der König mich, als hätte er mich zum Tee eingeladen und freute sich nun auf ein gemütliches Pläuschchen. Blut und Schmutz bedeckten seine ehemals leuchtend helle Lederkluft und die goldene, lange Klinge seines mit Edelsteinen besetzten Schwertes. Auch sein Haar hatte sich strähnenweise rostrot verfärbt. Nur sein Gesicht war blütenrein und das Lächeln darauf so strahlend wie die Krone, die er auf dem Kopf trug.
Ich antwortete nicht. Wenn er und sein Volk mir auch alles nehmen würden, meine Worte gehörten mir allein.
»Bereit?«, fragte er mich und nahm seine Ausgangsposition ein. Ich korrigierte meine Fußstellung minimal, hielt meine Waffe dicht an meinem Oberkörper und nickte knapp.
Von den Kämpfen, denen ich bisher beigewohnt und die ich vorhin vom Zelt aus mit angehört hatte, wusste ich, dass es ein Startsignal gab. Das Blasen eines Rufhorns; ein weicher, tragender Klang. Auch jetzt ertönte er, kaum, dass ich dem König zugenickt hatte.
Und genauso schnell hechtete ich nach vorn und verteilte den ersten Schlag. Silber rasselte scheppernd gegen Gold, als Ronas seine Waffe vor dem Oberkörper emporriss, um meine Attacke abzuwehren. Die Kraft, mit der er sich gegen sein Schwert stemmte, war beeindruckend und hätte mich sicher zu Fall gebracht, wenn ich keine geübte Kämpferin gewesen wäre. So aber manövrierte ich mich durch einen geschickten Stellungswechsel meiner Füße außer Gefahr und setzte sofort zu einem weiteren Angriff an.
Ronas mochte mir durch Größe und Muskelmasse überlegen sein, doch auch meine Statur brachte ihre Vorteile: Sie machte mich leicht und beweglich.
Flink wie der Wind wirbelte ich unablässig um den König herum, gönnte ihm keine Atempause. Parierte und schlug, wich aus und versetzte ihm von Neuem einen Hieb.
Wie schon zuvor bei der Auswahlzeremonie war das Schwert zu einem Teil von mir geworden; es war mein Fleisch und Blut, unmittelbar verbunden mit Herz und Hirn.
Wann immer ich durch meine sich aus dem Zopf gelösten Haarsträhnen einen Blick auf Ronas erhaschen konnte, erkannte ich, dass er geradezu erheitert aussah, obwohl er vor Anstrengung keuchte.
Oder vor Wonne, schoss es mir durch den Kopf. Der Gedanke fachte meine Wut nur noch weiter an. Wie unsäglich arrogant er doch war. Niemals würde er in Betracht ziehen, dass es einem Menschen gelang, sich seine Krone zu erkämpfen. Nicht einmal dann, wenn dieser Mensch ihn durch eine unvorhergesehene Bewegung ins Straucheln brachte – so wie jetzt.
Ich zögerte nicht und versetzte ihm einen gezielten Stich in die Halsbeuge. Der König überraschte mich seinerseits, indem er pfeilschnell reagierte und seinen Körper schlangengleich zur Seite bog. Ich spürte, wie meine Klinge über seine Haut schrammte, wie sie unter dem scharfen Stahl aufriss, doch der Schnitt, aus dem sogleich tiefrotes Blut quoll, war nur oberflächlich. Trotzdem drangen empörtes Gebrüll und erstickte Schreckenslaute aus den Rängen der Zuschauer. Als begriffen sie erst jetzt, dass ihr Herrscher nicht unverwundbar war.
Soweit ich über die Fähigkeiten der Sidhe im Bilde war, würde er eine oberflächliche Verletzung wie diese sofort heilen können, wenn er seine Magie einsetzte. Doch damit würde er gegen den Kodex verstoßen, der dem Wettkampf zugrunde lag. Nicht einmal er konnte so ehrlos sein.
Oder …?
Im Bruchteil einer Sekunde registrierte ich das Flimmern seiner Macht, das von seinen Schultern aufstieg. In meiner Panik, dass er Magie gegen mich einsetzen würde, attackierte ich den König ein weiteres Mal – und begriff mit Schrecken, dass ich einen Fehler begangen hatte. Abgelenkt von der Zurschaustellung seiner Kräfte, hatte ich mich zu schwungvoll in seine Richtung geworfen. Ronas konterte sofort, indem er mir geschickt auswich, meinen kurzen Moment des Gleichgewichtsverlusts ausnutzte und mir seinen Ellbogen in den Rücken rammte.
Hätte ich mich ohne sein Zutun vielleicht noch fangen können, war es nun zu spät: Ich fiel.
Um nicht mit dem Gesicht im Staub zu landen, drehte ich mich in der Luft und schlug stattdessen hart auf dem Rücken auf. Der Schmerz kroch mir unbarmherzig durch Wirbelsäule und Lunge und sorgte dafür, dass sich mein eiserner Griff um mein Schwert lockerte. Tränen vernebelten mir die Sicht. Hilflos blinzelnd, geblendet vom gleißenden Licht des Himmels, versuchte ich, mich aufzurappeln.
Doch die Silhouette des Königs schob sich bereits vor die Sonne und stieß mit dem Fuß meine Waffe beiseite.
Nein, nein, nein.
Es durfte nicht vorbei sein, nicht wegen eines so ärgerlichen Fehlers. Ich hatte mir geschworen zu siegen, hatte es meinen Eltern versprochen … Fahrig tastete ich an meinem Gürtel nach meinen Messern und stellte entsetzt fest, dass die Klingen verbogen waren. Der Schock höhlte mir den Magen aus. Er hatte es tatsächlich getan, hatte seine Kräfte eingesetzt, um meine Waffen unschädlich zu machen. Hasserfüllt sah ich ihn an.
Der amüsierte Ausdruck auf dem Gesicht des Sidhe-Herrschers war verschwunden. Etwas anderes hatte seinen Platz eingenommen; etwas, das ich nicht deuten konnte.
War es Bedauern? Hemmung? Enttäuschung?
Quälend langsam hob Ronas sein Schwert – und bewegte lautlos die Lippen, als spräche er zu sich selbst ein Gebet.
Ich unternahm einen letzten Versuch, an meine Waffe zu kommen, und warf mich mit aller Kraft zur Seite. Doch der König stieg mir mit einem seiner klobigen Stiefel auf den Arm.
»Nicht«, knurrte er, »mach’s mir nicht so schwer.«
Eine Bitte, die ich gewiss nicht beherzigen würde.
Ich wehrte mich aus Leibeskräften, riss und zog an meinem eingequetschten Arm, bis ich glaubte, er müsse jeden Moment aus dem Gelenk springen. Der König aber gab nicht nach.
Im Gegenteil. Er verlagerte sein Gewicht, drückte mich tiefer und tiefer in den blutgetränkten Sand.
»Astoria. Nicht.«
Der Schmerz explodierte in meinem Arm. Ich biss mir so fest auf die Unterlippe, dass ich Blut schmeckte, um die Schreie in meiner Kehle einzusperren.
Nein, so würde ich nicht sterben.
Nicht weinend, brüllend und flehend.
Wieder sah ich König Ronas direkt in die Augen.
Bohrte meinen Blick in seinen, um einen Teil seiner Seele mit mir zu reißen, wenn er mir das Schwert in die Brust jagte.
Abermals sagte er meinen Namen. Und noch etwas anderes.
»Bitte, du musst –«
Weiter kam er nicht. Was auch immer er mir mitteilen wollte, verlor sich in Dunkelheit.
Einer Dunkelheit, die ihren Ursprung nicht in meinem Bewusstsein nahm.
7
König Ronas Tiberion war umgeben von wallenden Schatten.
Er schnappte wie ein Ertrinkender nach Luft, während die Finsternis an ihm emporkroch und ihn langsam von mir wegdrängte.
Plötzlich verschwand auch das drückende Gewicht von meinem Arm, und ich robbte, noch immer benommen vor Schmerz und Todesangst, zurück, fort von dem, was sich des Königs bemächtigte.
Denn was dort geschah, ob es als Teil des Spektakels inszeniert worden war oder nicht, ich musste es für meine Zwecke nutzen, wenn ich überleben wollte. Suchend sah ich mich nach meinem Schwert um, doch die Dunkelheit griff weiter um sich und legte sich nun wie ein schwarzer Schleier vor meine Augen. Also tastete ich blind nach meiner Waffe.
Ein ums andere Mal fasste ich ins Leere, bevor meine Finger endlich auf das vertraute Heft meines Schwertes stießen.
Mein Herz überschlug sich vor lauter wildem Glück, während ich zupackte, mich mit aller Kraft auf die Beine stemmte und keuchend versuchte, den König ausfindig zu machen.