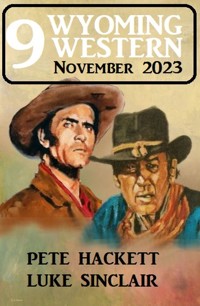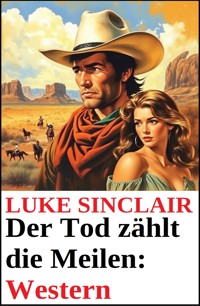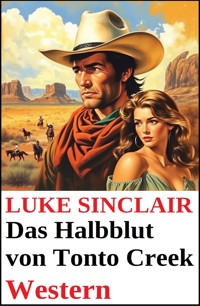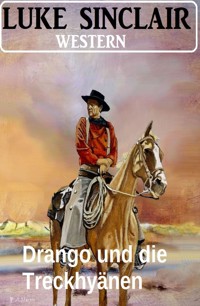Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Weißen nannten ihn Dakota. Sein richtiger Name war unbekannt, weil er bei den Oglalas aufgewachsen war. Und die Weißen fürchteten ihn mehr als einen Roten. Er war ein Mann zwischen zwei Welten. Als die weißen Siedler und Landnehmer seine Welt zerstörten, dachte Dakota nur noch an Rache. Er war wie ein misstrauisches Wild, das jede Falle witterte. Von den Rothäuten gemieden und von den Weißen gehasst, zog Dakota seinen Trail. Er war wie ein Wolf, einsam und gnadenlos. Er war der Mann, der den Kampf bis zur letzten Kugel führte, der keine Rücksicht kannte auf andere und auf sich selbst. So wurde er zum erbarmungslosen Jäger...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dakota, der weiße Wolf: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Dakota, der weiße Wolf: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Dakota, der weiße Wolf: Western
von Luke Sinclair
„ Gehasst von Weißen und Roten“
Die Weißen nannten ihn Dakota. Sein richtiger Name war unbekannt, weil er bei den Oglalas aufgewachsen war. Und die Weißen fürchteten ihn mehr als einen Roten. Er war ein Mann zwischen zwei Welten. Als die weißen Siedler und Landnehmer seine Welt zerstörten, dachte Dakota nur noch an Rache. Er war wie ein misstrauisches Wild, das jede Falle witterte. Von den Rothäuten gemieden und von den Weißen gehasst, zog Dakota seinen Trail. Er war wie ein Wolf, einsam und gnadenlos. Er war der Mann, der den Kampf bis zur letzten Kugel führte, der keine Rücksicht kannte auf andere und auf sich selbst. So wurde er zum erbarmungslosen Jäger...
*
Dort, wo Dakota gerade her kam, sagten die Leute, dass nur ein toter Indianer ein guter Indianer sei. Und sie allein bestimmten auch, was gut und was böse war. Wenn sie es für richtig hielten, dann war selbst das Töten gut, so wie sie es hier getan hatten.
Der Wind trieb den Rauch flach und eilig über die zerstörte Erde, durch das Tal und über den Fluss. Menschen, die hier gelebt hatten, waren von anderen Menschen getötet oder verjagt worden, so wie es schon seit undenklichen Zeiten auf dieser Welt geschah.
Dakota war nicht nur sein Name, wie die weißen Männer in den Forts der Grenze ihn nannten, manche überheblich und manche mit einer gewissen ängstlichen Scheu. Dakota, das war auch sein Leben, der Inbegriff seines Daseins, die Welt, in die es ihn mit Macht zurückzog, auch wenn es eine untergehende Welt war.
Der Wind wurde mit einem Mal eisig kalt, obwohl der nahende Herbst die Blätter des Bergahorns an den Hängen erst leicht zu färben begonnen hatte.
Die Geschichte dieser Welt tröstete ihn verdammt wenig, als er mit langsamen Schritten auf die noch schwelenden Reste der verbrannten Tipis zuging, auf die Pferdekadaver und die grausam verstümmelten Leichen von Männern, Frauen und Kindern. Das hier betraf ihn und sein Schicksal, und niemand konnte das Leid und den Schmerz aus seiner Brust fortnehmen, die er dabei empfand. Und auch nicht den Hass! Er hatte den größten Teil seines Lebens bei diesen Menschen verbracht, und er konnte sich nicht erinnern, dass jemals so sinnlose Grausamkeiten von ihnen verübt worden waren, wie das, was nun mit ihnen geschehen war.
Dakota blieb stehen und schaute fassungslos um sich. Das hier war das Dorf von Black Cloud gewesen. Es hatte sich um diese Jahreszeit immer hier befunden, wenn sie mit den Büffeln nach Süden zogen. Das war so seit uralten Zeiten. Doch in diesem Jahr sollte die alte Tradition zu Ende sein. Das Dorf von Black Cloud gab es nicht mehr!
Das Gefühl einer tiefen Schuld bohrte sich in Dakotas Brust wie die Lanze eines Feindes. Er hätte hier sein müssen, mit ihnen kämpfen sollen und sterben. Stattdessen hatte ihn die Unrast fort trieben zu den Menschen, die von seiner Hautfarbe und von seinem Blut waren.
Aber sie waren nicht von seiner Art, und deshalb kehrte er jetzt zurück. Er war doch ein Indianer. Er dachte und lebte wie sie, und wollte nie im Leben etwas anderes sein, auch wenn sie hundertmal behaupteten, seine Haut sei weiß!
Er fand Black Cloud unter den Toten. Sie hatten ihn skalpiert und seinen Körper dann achtlos liegen gelassen wie eine zerstörte Puppe. Eine wilde, jähzornige Wut packte ihn und brach aus ihm heraus wie der Sturm, wenn sich ein Unwetter über den Bergen entlud. Wenn sie noch in der Nähe waren, dann sollten sie hören, dass noch jemand da war. Dakota, der Weiße Wolf, war zurückgekehrt, um Rache zu nehmen. Er stemmte seine Füße gegen den Boden und ballte die Fäuste, dass sich die Nägel in seine Haut gruben. Sein wilder, tierhafter Schrei gellte durch das Tal und brach sich in vielfältigem Echo an den Berghängen jenseits des Flusses.
Die schmerzende Stille kehrte zurück, und er fragte sich, wo Reh-Frau sei, seine Zieh-Mutter, die Squaw von Black Cloud. Oder Silbernes Wasser, mit der er als Kind oft gespielt hatte, oder Blume-Im-Tal, die die Frau von Galloping Horse war. Auch an das runde, immer freundliche Gesicht von Morgenwind konnte er sich erinnern. Sie alle hatte er nicht gefunden. Waren sie mitgeschleppt worden? Diese Sorge stieg in ihm hoch und würgte ihn in der Kehle. Er kannte die Art solcher Männer, die hiergewesen waren, sie machten keine Gefangenen.
Systematisch suchte er die Umgebung ab und zog seine Kreise immer weiter um das zerstörte Dorf herum, bis er gefunden hatte, wonach er suchte. Die Spuren von Überlebenden, die sich in panischer Eile in die Wälder jenseits des Flusses gerettet haben mussten, denn keiner der Weißen war ihnen gefolgt. Und sie waren auch noch nicht zurückgekommen, um die Toten zu bestatten, damit ihre Seelen nach Wanagi Yata gehen konnten. Bestimmt aber waren sie noch in der Nähe.
Dakota kehrte rasch zu seinem Pferd zurück, das geduldig auf ihn gewartet hatte. Die Sonne stand noch hoch am Himmel. Er konnte sie finden, bevor die Nacht anbrach. Eine ungeduldige Hoffnung glomm in ihm auf, wie das Licht in einer kalten, windigen Nacht. Vielleicht war Reh-Frau bei ihnen und alle die anderen, die er nicht gefunden hatte?
Die Spur war leicht zu verfolgen, da niemand bei all der Angst Zeit gehabt hatte, sie zu verwischen. Es dauerte nicht lange, bis Dakota die Überlebenden des grausigen Massakers gefunden hatte.
Nachdem sich die zahllosen Einzelfährten, Zeugen einer kopflosen Flucht, zu einer einzigen vereinigt hatten, wusste Dakota, wohin man sich gewandt hatte. Fünf Meilen vom Dorf entfernt gab es in einem Felshang zwei kleine, nebeneinander liegende Höhlen, in denen sie sicher Zuflucht suchen würden.
Aber sie hatten es nicht einmal bis dorthin geschafft. In einem Waldstück hatten sie völlig erschöpft im dichten Unterholz Schutz vor den Blicken etwaiger Verfolger gesucht.
Silbernes Wasser war die erste, der er begegnete. Sie gehörte zu den Jüngeren, die noch am kräftigsten waren, und sie schien es übernommen zu haben, nach Verfolgern Ausschau zu halten, was im Ernstfall wohl kaum etwas genützt haben dürfte. Aber zum Glück hatten sich die Mörder nicht die Mühe gemacht, nach ein paar versprengten Rothäuten zu suchen.
Sie stand plötzlich vor ihm, als Dakota sein Pferd durch das dichte Gestrüpp zwängen wollte, und er musste das Tier hart zurückreißen. Ihre großen, runden Augen starrten ihn an. Das Grauen stand noch in ihren Zügen und verhinderte ein Lächeln, als sie ihn erkannte.
„ Du bist es tatsächlich, Weißer Wolf“, sagte sie, noch immer etwas außer Atem. „Fast hätte ich dich für einen der Vehos gehalten.“ Sie benützte das Sioux-Wort für Spinnen, wie die Weißen von den Indianern oft genannt werden, weil diese die Spinnen für überlegene Wesen mit besonderen Fähigkeiten hielten.
„ Bist du endlich zu deinem Volk zurückgekehrt?“ Es klang seltsam in seinen Ohren, aber zumindest Silbernes Wasser akzeptierte ihn noch als einen der Ihren.
Er nickte. „Ich habe mein Leben wiedergefunden. Aber wo sind die anderen? Ist Reh-Frau bei ihnen?“
„ Sie hat den Weißen Wolf nicht vergessen. Doch steig lieber ab, die Bäume stehen hier sehr dicht.“
Reh-Frau war bei den anderen. Sie war sehr erschöpft, und das Leid der letzten Stunden hatte ihr Gesicht gezeichnet. Ihr Blick war dumpf und voller Schmerz.
„ Meine Augen freuen sich, den Weißen Wolf wiederzusehen, aber er hätte klüger gehandelt, wenn er bei den Vehos geblieben wäre. Es ist besser, zu den Siegern zu gehören, als zu den Unterlegenen.“
Ein Kloß würgte in Dakotas Hals, und die Erregung ließ seine Stimme vibrieren, als er erwiderte: „Wir werden es sein, die am Ende siegen.“ Er legte der alten Frau zärtlich die Hand auf die magere Schulter. „Wir werden die Langmesser verjagen aus He sapa, unseren heiligen Jagdgründen.“
Ihre alten, wissenden Augen resignierten, und ihre Stimme war ohne Hoffnung.
„ Es sind schon zu viele gestorben, die das wollten, viel zu viele. Und es waren keine Akicitas, keine Soldaten, die uns überfielen. Ihr Häuptling war der Mann, den die Weißaugen Reverend Preston nennen. Ein Mann, mit einer starken und grausamen Medizin.“
Preston...? Dakota hatte von diesem ehemaligen Wanderprediger und seiner privaten Miliztruppe gehört, die nach dem ersten Massaker am Südrand der Black Hills gebildet worden war.
„ War er es, der Black Cloud getötet hat?“, fragte Dakota mit bebenden Lippen.
Reh-Frau versuchte, ihn zu beschwichtigen. „Dein Vater war ein großer Krieger, sein Leben lang. Er ist gestorben, wie er es gewollt hat, und er ist besser gestorben, als diejenigen, die verhungern, die am Feuerwasser oder den Krankheiten der Weißaugen zugrunde gehen.“
„ Ich werde diesen Veho töten!“ sagte Dakota hart. „Nicht nur wegen Black Cloud allein, sondern wegen allem, was er uns angetan hat.“
„ Du bist allein“, hielt ihm Reh-Frau entgegen. „Und du bist noch zu jung, um den ehrenvollen Tod des Kriegers zu suchen, Weißer Wolf.“
„ Ich bin ein Oglala“, erwiderte er nur stolz. Entschlossen drehte er sich zu seinem Pferd um. Silbernes Wasser hatte in der Nähe gestanden und ihre Unterhaltung mit angehört. Aber sie war nur ein Mädchen, ihr kam es nicht zu, sich in eine Unterhaltung zwischen einem Krieger und seiner alten Mutter einzumischen. Obwohl ihr die Worte auf der Zunge brannten, bange und beschwörende Worte, behielt sie dieselben für sich.
Dakota zögerte, als er sie ansah, und er spürte plötzlich ein seltsam beklemmendes Gefühl in seiner Brust, als er ihre flehenden Augen auf sich gerichtet sah. Wir sind nur Squaws, Kinder und Alte, schienen diese Augen zu sagen. Wer versorgt uns mit Fleisch, wenn sie dich auch noch töten?
Dakota deutete mit dem Kopf nach Norden und sagte leise: „Geht in die Höhlen und wartet dort auf mich. Und wenn ich nicht zurückkommen sollte, versucht, das Dorf von Tokeya Sha, dem Roten Fuchs, zu erreichen.“
Silbernes Wasser nickte nur und sagte kein Wort. Dakota schwang sich auf den Rauchgrauen und ritt rasch davon. Erst viel später sollte ihm klar werden, dass er ihren Blick ganz falsch gedeutet hatte.
Das beklemmende Gefühl war noch immer da, und erst jetzt fiel ihm auf, dass sich Silbernes Wasser seit der kindlichen Spielgefährtin längst vergangener Tage sehr verändert hatte. Früher war ihm das nie aufgefallen. Erst die lange Trennung und der Abstand, den er von ihr und allen anderen bekommen hatte, ließen ihm das klarwerden.
Aber Hass und Wut brannten in seinem Herzen und ließen keinen Platz für etwas anderes.
*
In der Nähe des Flusses, den die Weißen den Cherry Creek nannten, holte Dakota die Freiwilligentruppe von Reverend Preston ein. Sie hatten es nicht eilig, und sie fühlten sich viel zu sicher, als das sie sich die Mühe gemacht hätten, ihre Fährte zu verwischen. Und tatsächlich drohte ihnen auch keine Gefahr von einem einzigen weißen Sioux, der ihnen bis hierher gefolgt war. Kein Mensch, der seine Sinne beisammen hatte, würde es wagen, allein einen Trupp von mehr als zwanzig gut bewaffneten Reitern anzugreifen. Aber Hass und Schmerz sind schlechte Ratgeber.
Dakota beobachtete den Trupp von einem bewaldeten Hügel aus. Das Land ging hier mehr und mehr in offene Prärie über, und es würde immer schwieriger werden, an die Männer heranzukommen. Der Zorn hatte ihn hinter den Mördern seiner Brüder hergetrieben, aber jetzt, da er sie eingeholt hatte, fehlte ihm die klare Vorstellung davon, wie er die Sache weiter anpacken sollte. So folgte er den Reitern seitlich wie ein einsamer Wolf, der auf eine Gelegenheit lauerte, in eine Herde einbrechen zu können.
Einmal kam ihm der Gedanke, einfach umzukehren, aber dann dachte er an Black Cloud und an den stummen Schmerz in den Augen von Reh-Frau, an die Leckerbissen, die sie ihm immer als Kind zubereitet hatte, zu einer Zeit, als ihr Stamm noch keine Nahrungssorgen hatte und der Büffel noch zahlreich durch das Land zog. Er dachte an die ruhige, gütige Art, mit der Black Cloud ihn durch die Jahre seiner Kindheit gelenkt hatte, bevor die Weißen immer zahlreicher und das Wild immer seltener wurden. Er hätte keine Eltern auf dieser Welt haben können, die ihn mehr geliebt hatten, als diese beiden Menschen. Und jetzt hatten diese Weißen den alten Mann getötet, so wie sie Tiere töteten, die ihnen nutzlos erschienen oder im Wege waren.
Er hielt sein Pferd hinter einer Buschgruppe an. Die Weißen waren nur noch zwanzig Meter von ihm entfernt, aber es waren zu viele für einen einzelnen Krieger. Er konnte sich nur von ihnen töten lassen und versuchen, so viele wie möglich dabei mit nach Wanagi Yata, dem Sammelplatz aller Seelen, zu nehmen.
Aber während er noch zögerte, geschah einer dieser winzigen Zufälle, die so oft den Ablauf der Dinge bestimmen. Der Rauchgraue unter ihm warf schnaubend den Kopf hoch. Jetzt gab es nur noch zwei Dinge, die Dakota tun konnte: Entweder fliehen oder kämpfen. Und da er ein Repetiergewehr in den Händen - und jenen wilden Hass im Herzen hatte, entschied er sich spontan für das Letztere.
Mit harten Fersenstößen trieb er das Pferd hinter den Büschen hervor und flog der Gruppe der völlig verwirrten Weißen entgegen.
„ Watankaaaaa...!“ Der Wind riss ihm den schrillen Schrei von den Lippen, mit dem er sich eigentlich gar nicht mehr anzufeuern brauchte. Mit dem rechten Oberarm presste er den Schaft seines Gewehres fest an den Körper. Die linke Hand hielt die Zügel. Sein Schuss riss einen der Reiter aus dem Sattel, als er noch drei oder vier Pferdelängen von ihnen entfernt war. Es entstand ein unbeschreibliches Durcheinander, als er mit seinem Tier mitten in den Pulk der fremden Reiter hineinstieß. Er schrie aus Leibeskräften und schlug den stählernen Lauf nach rechts und links mit gnadenloser Härte.
Einer der Weißen versuchte, seinen Revolver auf ihn abzufeuern, aber er kam nicht mehr dazu. Es gab ein hässliches Geräusch, als Dakotas Gewehrlauf seinen Schädel traf. Einen anderen traf die Mündung auf der Brust. Der Mann rollte mit einem Schrei über die Kruppe seines Pferdes. Dann war Dakota durch den Reitertrupp hindurch gestoßen.
Sie waren inzwischen alle aus den Sätteln, weil sie annahmen, von einer ganzen Horde Sioux angegriffen zu werden. Als sie dann begriffen, dass nur ein einzelner Krieger so wahnwitzig gewesen war, konnten sie sich nur noch darauf beschränken, ihm ein paar wütende aber völlig nutzlose Kugeln nachzuschicken. Denn Dakota verschwand bereits wieder hinter halbhohem Strauchwerk und tauchte dann hinter einer Bodenwelle wieder kurz auf.
„ Ayee!“, schrie er, schwang sein Gewehr und war weg.
Reverend Preston biss sich vor Wut auf die Lippen. Er war ein großer, hagerer Mann, der schon zahlreiche Kämpfe hinter sich hatte. Aber so etwas war ihm noch nicht passiert, seit er den ersten Indianer getötet hatte.
„ Wir können ihn noch erwischen“, knurrte einer seiner Männer. Aber Preston schüttelte widerwillig den Kopf.
„ Das ist bestimmt ein Hinterhalt“, knurrte er. „Keine Rothaut wäre so verrückt, uns allein anzugreifen, wenn sie damit nicht etwas Bestimmtes bezweckte. Aber, wir werden das feststellen und uns um ihn kümmern, nur nicht so hastig, wie der Hundesohn das möchte.“
Sie waren alle hinter ihren Pferden in Deckung gegangen und lauerten mit bereitgehaltenen Waffen. Aber nichts regte sich rings um sie.
So vergingen einige Minuten, bis sich die verkrampfte Spannung löste und Preston sagte: „Kümmert euch um die Verwundeten, es scheint niemand mehr da zu sein.“
Es waren wild aussehende, schmutzige Männer, und keiner von ihnen wusste, ob Preston wirklich einmal Wanderprediger gewesen war, wie allgemein behauptet wurde. Er selbst sprach nie über seine Vergangenheit. Manche glaubten zu wissen, dass sich die Bezeichnung Reverend irgendein Zyniker ausgedacht hatte. Daran konnte auch die Bibel nichts ändern, die Preston mit sich führte, und in der er manchmal las, wenn er nicht gerade Indianer umbrachte.
„ Es hat Baily und John erwischt“, sagte jemand. „Baily hat er den Schädel eingeschlagen, und John hat eine Kugel in der Brust. Er macht auch nicht mehr lange.“
Preston fixierte den Sprecher kurz mit seinen stechenden Augen.
„ Bist du vielleicht ein Doc, dass du das so genau weißt?“ Seine Lippen pressten sich nach diesen Worten zu einem dünnen, geraden Strich zusammen, der so aussah, als hätte man ihn mit einem scharfen Messer geschnitten, und der grausame Zug in seinem Gesicht verstärkte sich noch.
John war einer von seinen vier Söhnen. Eli, Jeremiah und Jakob standen betreten um ihn herum. Sie waren es, die töteten und weiter töten wollten. Nie war ihnen ernsthaft der Gedanke gekommen, dass einer von ihnen durch diese dummen Wilden sterben könnte. Diese neue Erkenntnis machte sie unsicher.
„ Warum hast du diesen Hund entkommen lassen?“, fragte Jeremiah vorwurfsvoll mit fast weinerlicher Stimme.
John lag auf dem Rücken. Er hustete röchelnd, und roter Schaum trat aus seinem Mund. Preston ließ keinen Blick von ihm, als er sagte: „Er ist noch nicht entkommen. Wir holen ihn uns. Er wird sterben und alle, die bei ihm sind.“
„ Wie willst du ihn denn noch einholen?“ begehrte Jeremiah auf. „Wir werden später gar nicht mehr wissen, wer es war.“
„ Dann werden wir eben zwanzig, vierzig oder hundert verdammte Sioux umbringen. Und wenn wir den ganzen Stamm auslöschen müssen, um Gewissheit zu haben, dass der Mörder eures Bruders darunter ist.“
Die anderen Männer schauten zuerst Preston an und wechselten dann besorgte Blicke. Jeder von ihnen wusste, was es hieß, von einem Verrückten befehligt zu werden, der sich einbildete, einen ganzen Indianerstamm allein ausrotten zu müssen. Sie hofften nur, dass sein Sinn für Realitäten wieder klarer wurde, wenn John erst einmal unter der Erde war.
„ Jack“, sagte Preston mit fast leiser Stimme.
Bloody Jack Owen trat näher an ihn heran. Er war der beste Fährtenleser unter ihnen und hatte schon als Scout unter General Crook gedient. Er war schließlich aus dem Armeedienst entlassen worden, weil er mehrfach anstatt zu kundschaften, eigenmächtige Privatkriege geführt hatte. Man hatte ihm den Beinamen Bloody Jack gegeben, weil er mehr Indianer als alle anderen umgebracht hatte, und weil er der einzige unter ihnen war, der seine Opfer skalpierte.
„ Du reitest voraus und bleibst auf der Fährte dieses verdammten Roten. Wir anderen müssen so lange hier bleiben, bis sie unter der Erde sind. Schließlich sind wir Christenmenschen und keine barbarischen Wilden.“
Bloody Jack Owen nickte nur und spuckte seinen Kautabak in das welke Gras. Aufgaben dieser Art waren nach seinem Geschmack, und er war überzeugt, dass er Preston den Skalp dieses verrückten Sioux vorzeigen konnte, bis die anderen ihn wieder einholten.
*
Dakota erreichte die Höhlen nicht ganz mit leeren Händen. Unterwegs war es ihm gelungen, eine Antilope zu erlegen, was in diesen Tagen schon als ein Glücksfall angesehen werden musste. Wild dieser Größenordnung war zur Seltenheit geworden, seitdem die Weißen den Vertrag gebrochen hatten und in immer größeren Scharen nach He Sapa, in das heilige Jagdgebiet der Black Hills strömten, weil man dort Gold gefunden hatte. Sie schossen alles ab, was sich bewegte, und bald würde es wohl nicht einmal mehr ein Kaninchen in den Jagdgründen geben, die seit Jahrhunderten ganze Sioux- und Crowstämme ernährt hatten. Wieder einmal würden die Indianer weiter nach Westen ziehen - und ihr Land, das ihnen erst kurz zuvor vertraglich garantiert worden war, den Weißen überlassen müssen, die mit für indianische Denkweise völlig unverständlicher Gier alles an sich rissen.
Die Antilope löste eine gedämpfte Freude aus und hob etwas die düstere Stimmung. In den letzten beiden Tagen hatte man von Beeren, Wurzeln und ein paar Eichhörnchen gelebt.
Dakota erschrak jedoch, als er Reh-Frau sah. Sie war noch magerer geworden und hatte sich zum Zeichen der Trauer ihre langen Haare abgeschnitten, so wie es die Sitte verlangte. Dakota legte seinen Arm um ihre Schultern und drückte sie zärtlich an sich. Ein unsäglicher Schmerz durchfuhr ihn in diesem Moment.
„ Vertrödle deine Zeit nicht mit einer alten Frau“, sagte sie abwehrend, um ihre eigene Rührung nicht vor ihm zeigen zu müssen. „Hast du Silbernes Wasser schon begrüßt? Sie hat jede Stunde nach dir Ausschau gehalten.“
Silbernes Wasser senkte verlegen den Kopf, als sie die Worte von Reh-Frau vernahm. Dakota ging zu ihr und sagte: „Woynonihan. Es freut mich, dass du mich nicht vergessen hast, Silbernes Wasser.“
Sie schaute zu ihm hoch, und es war so viel Freude in ihren Augen, dass ihm davon ganz warm ums Herz wurde. Und er hatte plötzlich den Wunsch, sie zu beschützen und große Heldentaten für sie zu vollbringen, um ihre Bewunderung zu erringen. Silbernes Wasser deutete auf die Antilope. „Der Weiße Wolf ist ein guter Jäger. Es gelingt den Kriegern nur noch selten, so viel Fleisch mit nach Hause zu bringen. Reh-Frau kann stolz auf ihren Sohn sein.“
„ Ich habe das Wild nicht nur für Reh-Frau erlegt, sondern auch für dich und die anderen. Es ist nicht viel, aber ich war nicht nur auf der Jagd. Wie viele von deiner Familie sind noch am Leben?“
Ein Schatten verdunkelte ihr Gesicht, als er sie wieder an das grausige Massaker erinnerte.
„