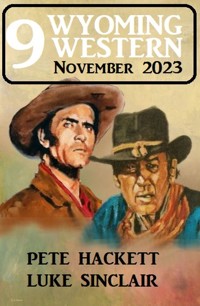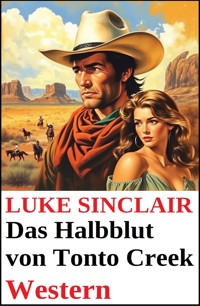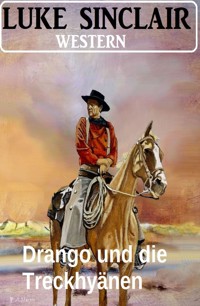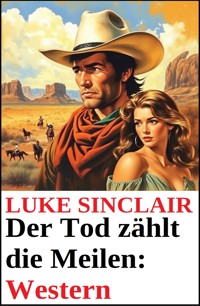
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Handvoll Männer und Frauen kämpfen sich mit einer Kutsche durch die Wyoming-Prärie. Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind jäh über sie hereingebrochen. Das rettende Ziel heißt Cheyenne, aber sie wissen nicht, ob sie die Stadt noch lebend erreichen werden. Weiße Banditen und skalplüsterne Sioux jagen sie erbarmungslos. Und dann kommt auch noch der frühe Wintereinbruch mit den Schrecken eines verheerenden Blizzards und gefährlichen, ausgehungerten Wolfsrudeln. Der Tod ist zum ständigen Begleiter dieser Verzweifelten geworden. Eine Spur von Blut und Tränen markiert die bitteren Meilen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Tod zählt die Meilen: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Der Tod zählt die Meilen: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Der Tod zählt die Meilen: Western
von Luke Sinclair
„ Tollkühne Hetzjagd durchs Land der Cheyennes“
Eine Handvoll Männer und Frauen kämpfen sich mit einer Kutsche durch die Wyoming-Prärie. Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind jäh über sie hereingebrochen. Das rettende Ziel heißt Cheyenne, aber sie wissen nicht, ob sie die Stadt noch lebend erreichen werden. Weiße Banditen und skalplüsterne Sioux jagen sie erbarmungslos. Und dann kommt auch noch der frühe Wintereinbruch mit den Schrecken eines verheerenden Blizzards und gefährlichen, ausgehungerten Wolfsrudeln. Der Tod ist zum ständigen Begleiter dieser Verzweifelten geworden. Eine Spur von Blut und Tränen markiert die bitteren Meilen...
*
Der scharfe Wind wehte an Jim McKenzies Gestalt hoch und blies ihm nadelspitze Eiskristalle in das Gesicht. Aus zusammengekniffenen Augen blickte er dem reiterlosen Pferd nach, das im Grau des treibenden Schnees verschwand wie ein Spuk. Er senkte den Lauf der Winchester, klemmte das Schloss wieder unter den Arm, damit es nicht vereiste, und hauchte in seine steif gewordenen Hände. Dann zog er die dicken Fellhandschuhe wieder an und trieb sein eigenes Tier aus der Deckung der Felsen.
Die Spur war deutlich zu erkennen, und es war keine Frage, dass er ihr folgen würde. Ein gesatteltes Pferd weitab jeder menschlichen Siedlung bedeutete, dass auch ein Reiter dazugehörte, der ohne sein Tier keine Chance mehr haben dürfte.
Nach etwa einer Stunde endete die Fährte an einer verborgenen Stelle zwischen Felsblöcken und Büschen. Es hatte aufgehört zu schneien, aber die schwere Wolkendecke ließ mit weiterem Schnee rechnen.
Jim McKenzie glitt steifbeinig aus dem Sattel, und seine prüfenden Blicke streiften über den zertrampelten Schnee. Das Pferd war hier eine Zeitlang angebunden gewesen, aber von einem Reiter fehlte jede Spur. Ein nachdenklicher Ausdruck kam in Jim McKenzies Augen, aber in seinem kältestarren Gesicht zuckte kein Muskel.
Gestern Mittag hatte der Schneefall eingesetzt. Zeitiger im Jahr, als es sonst üblich war, aber nicht überraschend. Man hatte ihn schon lange in der Luft spüren können.
Der Reiter musste sein Tier bereits gestern verlassen haben. Offenbar war ihm etwas zugestoßen, denn kein vernünftiger Mensch ließ sein Pferd irgendwo in der Wildnis stehen, ohne zurückzukehren. Aber was hatte er hier, so nahe bei McKenzies Zuhause, gewollt?
Der Wind heulte über das Land. Jim McKenzie zog den Kragen seiner Jacke aus grauem Wolfsfell höher.
Er lebte seit Jahren in diesen Bergen und kannte die Eigenarten dieses Landes wie kaum ein anderer, aber er wusste das Rätsel dieser Spuren nicht zu deuten, noch nicht. Er kehrte zu der Stelle zurück, wo das Pferd angebunden gewesen war. Es hatte sich offenbar gewaltsam und unter großer Anstrengung losgerissen. Als er es vorhin gesehen hatte, war es ihm gehetzt und nervös vorgekommen.
Wölfe?
Er schaute aus engen Augenschlitzen über das schweigende Land. Seine Blockhütte befand sich nur wenige Meilen von hier entfernt. Wenn dieser Mann die Gegend kannte, musste er das wissen und hätte sein Pferd nicht hier zurückzulassen brauchen. Was mochte aus ihm geworden sein?
Jim McKenzie stieg wieder in den Sattel. Es gab keine Spur, der er hätte folgen können. Langsam zog er seinen Grauschimmel herum und ritt fort.
Ein Stück weiter fand er die halb zugewehten Spuren von Wölfen. Sie waren nur wenige Stunden alt. Deshalb hatte das Pferd sich losgerissen und war geflohen.
Es war kurz vor dem Mittag, als Jim McKenzie seine Behausung erreichte. Er hielt kurz an, und seine Blicke glitten über das massive Blockhaus und den kleinen Schuppen an der Seite. Der Schnee hatte alles zugedeckt.
Zwei Tage war Jim McKenzie unterwegs gewesen. Jetzt war er wieder zu Hause. Er saß ab und brachte das Pferd in den Schuppen. Dann ging er zum Haus hinüber. Die Schneedecke war leuchtend weiß und unberührt.
Die Tür knarrte, als er sie öffnete, und der Wind blies eine Wolke losen Schnees hinein. Jim McKenzie trat ein, zog die Tür hinter sich zu und sah sich um. Alles schien so zu sein, wie er es verlassen hatte. Neben dem Kamin befand sich noch ein kleiner Stapel Holz. McKenzie ging hin, bückte sich, legte ein wenig zerknülltes Papier auf den Rost und einige dünne Holzscheite darüber. Dann schlug er mit Stein und Eisen Funken auf das dürre Zündkraut und schob es, als es nach mehrmaligen Versuchen endlich zu glimmen anfing, unter das Papier. Er blies es an, bis die ersten kleinen Flammen empor züngelten. Dabei fiel sein Blick auf den großen eisernen Topf, der auf dem Boden lag. Jemand musste ihn von seinem Platz gestoßen haben, und er selbst war es nicht gewesen, das wusste er genau. Er lebte allein hier, und alles hatte seinen bestimmten Platz, so dass er es selbst im Stockdunklen finden konnte.
Es war jemand hier gewesen.
Oder noch hier!
Aber er hatte draußen keine Spuren gesehen. Wenn sein Besucher also noch hier war, dann musste er bereits vor dem Schnee gekommen sein und das Haus nicht ein einziges Mal verlassen haben.
Er dachte an das reiterlose Pferd und an den Mann, der dazugehören musste. Seine Hand näherte sich langsam dem Revolver, während er angestrengt lauschte. Plötzlich war ein unterdrücktes Lachen hinter ihm und ließ ihn augenblicklich erstarren.
„Du bist ein Narr, McKenzie. Meinst du, dass jemand, der sich hier versteckt hat, wartet, bis du deinen Revolver in der Hand hast?“
Schon beim ersten Wort wusste Jim McKenzie, wer hinter ihm stand, und ein eiskalter Schauer kroch über seinen Körper. Er wusste, dass der Tod in diesem Moment näher war, als jemals zuvor. Jim McKenzie achtete darauf, dass seine Hand den Revolver nicht berührte, und dachte fieberhaft nach. Doch es gab keinen Ausweg. Er wusste, dass eine Waffe auf seinen Rücken gerichtet war.
Langsam drehte Jim McKenzie sich nach rechts um, damit der andere seinen Revolver während der ganzen Drehung im Auge behalten konnte.
„Wie ich sehe, kennst du die Spielr¬geln noch.“
Jim McKenzie blickte in die kalten, starren Augen, und sein Hals war wie ausgedörrt.
„Hallo, Lavaca“, nickte er. Seine Stimme klang nicht so ruhig, wie sie sollte, denn jeden Moment konnte ein Feuerstrahl aus der Waffe in Ken Lavacas Hand schießen.
„Du hast mich lange warten lassen, McKenzie. Ich konnte kein Feuer anzünden und nicht einmal vor das Haus gehen, bei dem verdammten Schnee. Doch jetzt hat es sich schließlich gelohnt.“
Lavaca war älter geworden, seit Jim McKenzie ihn das letzte Mal gesehen hatte, und das Haar an seinen Schläfen schimmerte grau. Doch er war noch genauso eiskalt wie früher. Fast schien es Jim, als hätte sich die Härte in Lavacas Augen noch verstärkt.
„Weshalb hast du nicht gleich geschossen?“, fragte McKenzie.
„Eine kluge Frage.“ Lavaca zeigte sein maskenhaftes Lächeln. „Aber ich kann es jederzeit tun, ohne dass du eine Chance hast, McKenzie. Kein Grund also für irgendwelche Spekulationen.“
McKenzie wusste, dass er nichts zu verlieren hatte, wenn er es doch versuchte.
„Wie hast du mich gefunden?“, fragte er, um Zeit zu gewinnen.
„Habe mich in Deadwood ein bisschen umgehört. Es ist nicht schwer, einen Mann zu finden, der sesshaft geworden ist.“
Jim musterte Lavacas Gestalt und sagte: „Findest du nicht, dass du ein bisschen zu alt für diesen Job bist?“
Lavaca lächelte noch immer wie ein Chinese.
„Ich bin nicht mehr so schnell wie früher, wenn du das meinst. Als wir uns damals trafen, befand ich mich in meiner besten Zeit.“ Er machte eine Pause.
„Na ja, alles geht einmal vorbei. Aber du siehst, dass ich auch so noch zum Zuge komme. Man muss halt mehr mit dem Verstand arbeiten und darf sich nicht mehr auf seine Schnelligkeit allein verlassen.“
Jim McKenzie hatte endlich seine Ruhe zurückgewonnen und sagte: „Jetzt machst du trotzdem einen Fehler. Du redest zu viel, nur weil du den Augenblick genießen willst, auf den du so viele Jahre gewartet hast.“
Lavaca spannte den Hahn seines Revolvers.
„Warum sollen zwei alte Freunde nicht ein wenig plaudern, bevor sie sich für immer trennen? Ich...“
In diesem Augenblick zog Jim McKenzie seine Waffe und warf sich zur Seite. Die Detonation des Schusses schien den kleinen Raum bersten zu lassen. Ehe McKenzie den Boden berührte, fühlte er einen glühenden Schmerz in der Schulter, und ein harter Schlag riss ihn in der Luft herum. Er rollte über den Boden, stieß einen Stuhl um und schoss, während er den Luftzug von Lavacas zweiter Kugel am Gesicht spürte. Er wusste nicht, ob er den Mann hinter der grauen Pulverwolke getroffen hatte, und robbte über den Boden. Der nächste Schuss zeigte ihm an, dass Lavaca noch lebte. Jim McKenzie kroch weiter. Wilde Schmerzen fraßen sich in seine Schulter, und er bemerkte mit Schrecken, wie sich der Raum mit dunklen Nebeln füllte. Er musste hier heraus, sonst war es das Ende!
Alle Vorsicht vergessend, sprang er auf, riss die Tür auf und stolperte hinaus. Eine Kugel fetzte durch seine Jacke, und er warf sich seitlich in den Schnee und drückte sein Gesicht hinein. Die Kälte auf der Haut hielt ihn bei Sinnen. Ein unbändiger Wille zum Leben trieb ihn wieder hoch. Dort, wo er gelegen hatte, hatte sich der Schnee rot gefärbt. Lavaca erschien in der Tür, aber McKenzie trieb ihn mit einem Schuss wieder hinein. Da waren noch die Fenster! Jim McKenzie schleppte sich zur Hausecke, als er schon von dort aus beschossen wurde. Die Kugeln bohrten hinter ihm dünne Löcher in die Schneedecke. Er brachte sich hinter der Ecke in Sicherheit und lud mit zitternden Fingern seinen Revolver nach. Sein linker Arm hing schlaff herunter. Er hockte sich wieder hin und musste die Waffe zwischen die Knie klemmen.
Dann blickte er zum Schuppen, in dem sein Pferd stand. Er konnte dort nicht hin, ohne von Lavaca gesehen und getroffen zu werden. Und das war gut so. Dieser Kampf musste hier und jetzt entschieden werden, denn das nächste Mal würde Lavaca nicht den gleichen Fehler begehen, sondern ohne Anruf schießen.
„He, McKenzie! Du wirst da draußen verbluten, wenn dir niemand hilft. Du kommst auch nicht an deinen Klepper heran, und ich brauche nur zu warten, bis du verreckt bist!“ Den Worten folgte ein raues Lachen.
„Du kannst ja herauskommen und mich verbinden, wenn du den Mut dazu hast!“, rief Jim McKenzie zurück.
„Für wie dumm hältst du mich, McKenzie? Zugegeben, ich habe einen Fehler gemacht, aber mit dem nächsten bist du dran!“
Jim McKenzie schleppte sich zum Schuppen hinüber und kauerte sich so an die Wand, dass er an der Vorderfront des Hauses entlang sehen konnte. Er holte sein Taschentuch hervor und drückte es unter der Jacke auf die heftig blutende Wunde. Wenn Lavaca eines der Fenster auf der Rückfront als Ausstieg benützte, konnte er es nicht hören, aber er musste ihn sehen, wenn er um die Hütte herum kam.
Da hockte er und wartete. Lavaca würde das Haus nicht verlassen, und er selbst konnte sein Pferd nicht erreichen. Sie waren auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert. Jim McKenzie war verwundet und der Kälte ausgesetzt, aber Lavaca musste damit rechnen, dass Jim an einem der rückwärtigen Fenster erschien.
„He, McKenzie!“, rief Lavaca.
Jim antwortete nicht, denn der andere wollte nur herausfinden, wo er sich befand. Sein Schweigen musste Lavaca nervös machen. Jim wartete und lauschte. Aber der Mann im Haus war kein Anfänger. Er dachte nicht daran, nervös zu werden, denn er wusste, dass er länger ausharren konnte als Jim.
So verstrich fast eine Stunde, ohne dass einer der beiden etwas unternahm. McKenzie hatte die Blutung, da er sich nicht bewegte, mit dem Tuch einigermaßen eindämmen können, aber die Kälte drang in seinen Körper und machte die Glieder steif.
Er erhob sich. Er musste sich bewegen und versuchen, den Kampf irgendwie zu beenden, sonst würden Lavacas Prophezeiungen eintreffen. Er ging zum Haus hinüber und blieb einen Moment an der Ecke stehen. Dann zog er den Sechsschüsser und stieg auf die kleine Veranda, denn er nahm an, dass Lavaca auf die hinteren Fenster achtgeben würde.
Er wollte gerade durch das Fenster neben der Tür sehen, als er von der Rückseite des Hauses ein Geräusch vernahm.
Zwei schnelle Schritte brachten ihn zur Tür, und er stieß sie auf, aber sein Revolver war auf das leere Fenster gerichtet. Die plötzliche Erkenntnis, dass Lavaca ihn getäuscht hatte, jagte einen eisigen Schreck durch seinen Körper. Und im selben Moment, als er Lavaca hinter dem Tisch kauern sah, krachte dessen Waffe. Feuer und Rauch sprangen Jim McKenzie entgegen. Er schoss zurück und spürte gleichzeitig den harten Einschlag der Kugel, der ihm das rechte Bein wegriss. Er taumelte zurück, das Bein knickte unter ihm ein, und er fiel auf die Bretter der kleinen Veranda. Die Schmerzen ließen ihn aufstöhnen, aber er rollte sich über die Kante und fiel in den Schnee. Einen Augenblick lag er still und keuchte mit zusammengebissenen Zähnen. Er wusste, dass jetzt alles aus war, falls sein eigener Schuss nicht getroffen hatte.
Die folgende Sekunde beendete seine Ungewissheit, denn Lavaca schickte ein paar Kugeln durch die offene Tür. Doch die Verspätung, mit der diese Schüsse fielen, ließen ihn vermuten, dass auch Lavaca verwundet war.
Jim McKenzie kroch auf dem rechten Ellenbogen, eng an den Boden gepresst, ein Stück weiter, wobei er sich mit dem gesunden Bein anschob. Anstrengung und Schmerzen brachten ihn zum Schwitzen. Dann hörte er Ken Lavaca herauskommen. Den Schritten nach zu urteilen, schien er Mühe zu haben, sich auf den Beinen zu halten.
Lavaca jagte einige Kugeln durch die Bohlen der Veranda, in der Annahme, Jim McKenzie stecke darunter.
„Komm hervor, du Hund!“, keuchte er.
McKenzie wartete, bis Lavaca drei weitere Schüsse abgefeuert hatte, dann richtete er den Oberkörper etwas auf. Kopf und Revolver schob er gleichzeitig über den Rand. Lavaca sah ihn sofort und hob seine Waffe, aber McKenzie drückte bereits ab, einmal, zweimal, dreimal...
Alle Kugeln trafen und warfen Lavaca gegen die Hauswand. Dann rutschte er langsam an der Wand herunter und fiel mit dumpfem Schlag auf die Bretter.
Jim McKenzie sank zurück und lag einen Moment schweratmend auf dem Rücken. Er konnte es kaum glauben, noch am Leben zu sein, aber die Schmerzen zeigten ihm, dass es Wirklichkeit war. Ächzend richtete er sich auf. Die Schulterwunde blutete wieder stark, und auch sein rechtes Hosenbein war mit Blut getränkt. Er konnte sich nur mühsam über den Boden ziehen. Er war hilflos wie ein Kind und wusste nicht, wie er es fertigbringen sollte, am Leben zu bleiben.
Neben Lavaca hielt er inne. Der Mann war tot. Jim McKenzie kroch weiter in die Hütte und blickte sich um. Die Kräfte drohten ihn zu verlassen, aber er musste durchhalten und versuchen, die Blutungen einzudämmen, sonst würde er den nächsten Tag nicht mehr erleben.
Er zerrte ein altes Hemd aus einer Truhe, riss es in Streifen und verband sich damit notdürftig. Die Wunde am Bein war ein Durchschuss, handbreit über dem Knie.
Er kroch zum Kamin und brachte das Feuer in Gang. Dann schloss er die Tür und schleppte sich auf sein Lager. Erschöpft lag er da und lauschte mit geschlossenen Augen dem Knacken der dicken Holzscheite. Durch alle seine Schmerzen drang mit quälender Pein das Bewusstsein völliger Hilflosigkeit.
*
Der Lärm in Deadwoods Straßen wurde seit Tagen durch die Schneedecke etwas gedämpft. Sonst hatte der plötzliche Wintereinbruch keine Veränderung mit sich gebracht. Die Arbeit auf den Claims ging vorläufig weiter, aber man wusste, dass zunehmende Kälte und weiterer Schneefall den Betrieb bald zum Erliegen bringen würden.
Im Hinterzimmer des Saloons „Last Chance“ fand die allwöchentliche Besprechung zwischen der Besitzerin, Elsa Mercury, und ihrem Geschäftsführer, Lacy Baddot, statt.
Die beiden unterbrachen ihre Unterhaltung, als die Tür geöffnet wurde und jemand eintrat. Der Mann brachte einen Hauch von Kälte mit in den Raum. Er schloss die Tür hinter sich und lehnte sich dagegen. Feine Eiskristalle glitzerten an seiner Kleidung und dem dunklen Stoppelbart. Der lange Mantel bauschte sich etwas über dem Revolver. Seine Haltung war lässig, aber es lag etwas Lauerndes in ihr.
Die Frau in dem grünen Samtkleid erschauerte leicht.
„Was gibt es, Brad? Du weißt, dass ich um diese Stunde nicht gern gestört werde.“
Brad O’Leary nickte.
„Ich dachte, dass es wichtig genug sei.“
„Was?“
„Lavacas Gaul ist aufgetaucht. Blue hat ihn gerade in die Stadt gebracht - ohne Reiter. Er ist halb verhungert und ziemlich am Ende. Muss lange unterwegs gewesen sein.“
Elsa Mercury sagte einen Moment gar nichts, aber man sah, dass es hinter ihrer Stirn arbeitete. Dann schaute sie den Mann an der Tür an.
„Es hat wohl keinen Sinn, nach ihm zu suchen?“
Brad O’Leary schüttelte den Kopf. „Bei diesem Wetter in den Bergen? Ganz gleich, was mit ihm passiert ist, er hat keine Chance. Er hatte von Anfang an keine.“
„Was willst du damit andeuten?“
„Er ist nur wegen McKenzie hier aufgetaucht. Hatte wohl irgend so ’ne alte Rechnung mit ihm offen.“
„Nun, jetzt ist sie jedenfalls beglichen“, meldete sich Lacy Baddot. Er war ein großer Mann, trug einen dunklen Anzug mit einer gemusterten Weste und einer schweren, goldenen Uhrkette.
„Für mich nicht, Lacy.“ Elsa Mercurys Worte waren nicht laut gesprochen, aber es lag eine gewisse Schärfe in ihnen. Baddot beugte sich vor und stützte die Hände auf den schweren Schreibtisch.
„Es war seine Angelegenheit“, sagte er eindringlich. Der matte Schein der Rochester-Lampe warf einen weichen Schimmer auf das unbewegliche Gesicht der Frau.
„Du weißt, wie viel er mir bedeutet hat, Lacy. Ich wollte ihn zu meinem Partner machen. Und nun...“
„Du kanntest ihn erst kurze Zeit, und ich habe dich von Anfang an vor ihm gewarnt.“
„Ja, das hast du.“
„Er war ein Narr, denn nur ein Narr reitet in die Wildnis und legt sich dort mit Jim McKenzie an.“
Lacy Baddot richtete sich gerade auf. „Außerdem war er kein Mann für unsere Art von Geschäften.“
„Es ist mir gleich, wie ihr darüber denkt“, beharrte Elsa Mercury eigensinnig. „Aber ich will McKenzies Tod, und ich bin bereit, jede Summe dafür zu zahlen.“
Brad O’Leary hielt den Kopf schief. Die feinen Eiskristalle an seiner Kleidung hatten sich in glitzernde Wassertröpfchen verwandelt. Er hielt dem fragenden Blick der Frau stand und lächelte schwach.