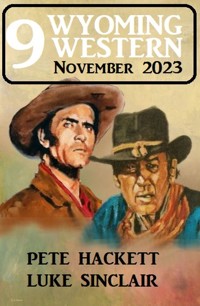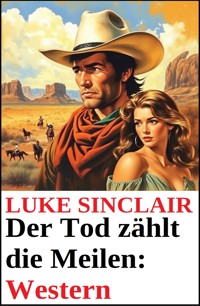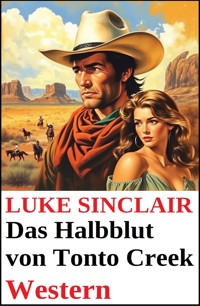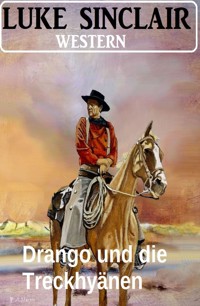Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es war die schlimme Zeit des Hasses zwischen Weißen und Roten. Es waren die bitteren Jahre der unerbittlichen Indianerkriege, in denen von beiden Seiten die entsetzlichsten Gräueltaten begangen wurden. Viele unschuldige Menschen wurden Opfer des sinnlosen Mordens, so auch Elk Woman, die Indianer-Squaw des Mountain Man Jake Stone. Als er vor ihrer verstümmelten Leiche stand, schwor er gnadenlose Rache. Und sein rauer Trail trieb ihn nicht nur zwischen seine Feinde, sondern auch in die mörderische Hölle eines tobenden, alles vernichtenden Blizzards ... (299XE)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luke Sinclair
Die Verfluchten der Blizzard-Hölle: Wichita Western Roman 139
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Die Verfluchten der Blizzard-Hölle: Wichita Western Roman 139
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die Verfluchten der Blizzard-Hölle: Wichita Western Roman 139
Luke Sinclair
Es war die schlimme Zeit des Hasses zwischen Weißen und Roten. Es waren die bitteren Jahre der unerbittlichen Indianerkriege, in denen von beiden Seiten die entsetzlichsten Gräueltaten begangen wurden. Viele unschuldige Menschen wurden Opfer des sinnlosen Mordens, so auch Elk Woman, die Indianer-Squaw des Mountain Man Jake Stone. Als er vor ihrer verstümmelten Leiche stand, schwor er gnadenlose Rache. Und sein rauer Trail trieb ihn nicht nur zwischen seine Feinde, sondern auch in die mörderische Hölle eines tobenden, alles vernichtenden Blizzards ...
*
Als Jakob Stone den Schuss hörte, beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl. In diesem Gebiet jagte sonst niemand außer ihm. Die Blackfeet kamen nicht selten bis hierher, und es gab nur sehr wenige Weiße, die mit ihnen zusammenkommen konnten, ohne ihren Skalp zu verlieren. Aber die Blackfeet jagten nicht mit Gewehren. Die wenigen Flinten, die einige von ihnen besaßen, benützten sie nur zum Kampf. Doch gegen wen, zum Teufel, sollten sie hier kämpfen? Sie wussten, dass es sein Gebiet war, und kein anderer Weißer hatte sich seit Jahren hier blicken lassen.
Trotzdem dieser Schuss!
Jakob Stone hatte den Kopf gehoben und gelauscht, aber es blieb ruhig. Hatte jemand unbeabsichtigt einen Schuss ausgelöst oder nur zum Spaß geschossen? So etwas passierte höchstens einem Greenhorn, und so einer würde nie lebend bis hierher kommen. Und, verdammt noch mal, wer außer ihm und den Blackfeet hatte hier etwas zu suchen? Jake hasste diese verdammten Gegenden, wo man alle paar Tage einem anderen Menschen begegnet, und er war froh, dass es hier in seinen Bergen nicht so war.
Er verließ das seichte Wasser des Flusses und stieg die mit Schilfgras bewachsene Uferböschung hinauf, wo seine alte Mountain-Büchse an einem Baum lehnte. Er nahm das Gewehr in die Hand und spähte unschlüssig zu den Berghängen hinauf, von denen der Knall des Schusses gekommen war.
Er war noch nicht damit fertig, seine Fallen abzugehen, aber wenn in einer so menschenleeren Gegend wie dieser ein Schuss fiel, konnte man nicht einfach weitermachen und so tun, als ob nichts geschehen sei. Man musste stets wissen, was um einen herum vorging, es sei denn, man hatte die Absicht, bald irgendwo unter der Erde zu liegen.
Er würde mehr als zwei Stunden brauchen bis dort hinauf, aber es half nichts, er musste es tun.
So warf er sich die frischen Biberfelle über die Schulter, die er bis jetzt erbeutet hatte, nahm sein Gewehr in die Rechte und marschierte los.
Obwohl die Nächte schon empfindlich kalt waren und sich morgens das erste zaghafte Eis an den Flussufern zeigte, schien ihm jetzt am Tage die Sonne warm auf den Rücken, und er hatte seinen dicken Mantel bis jetzt noch nicht gebraucht. So trug er nur seine leichtere Hirschlederkleidung, in der er gut vorankam.
Er wusste, wie gut man hier unten von dort oben aus zu erkennen war, und wählte für seinen Weg Stellen, an denen Bäume standen, auch wenn es weiter war. Es war ohnehin niemals gut, auf das Geräusch eines Schusses direkt loszugehen. Deshalb schlug er nicht diese Richtung ein, sondern versuchte, den Eindruck zu erwecken, als kehrte er zu seiner Hütte zurück.
Erst als er den Wald erreichte, änderte er seinen Weg und stieg die dicht bewachsenen Hänge empor.
Es dauerte etwas mehr als zwei Stunden, bis er jene Stelle erreicht hatte, wo nach seiner Meinung der Schuss gefallen war. Die Sonne war bereits ein beträchtliches Stück weiter nach Westen gewandert.
Jakob Stone blieb stehen und schaute um sich. Es war nichts zu sehen. Der Wind zischte leise in den Bäumen über ihm. Nichts deutete auf die Anwesenheit von Menschen hin.
War es vielleicht doch woanders gewesen?
Er bewegte sich vorsichtig am Rande einer kleinen Schlucht entlang. Ein paar bunte Blätter des Bergahorn segelten vor der leichten Brise in die Tiefe. Sonst gab es keine Bewegung. Jakob suchte mit den Augen den jenseitigen Rand ab, wo zahlreiche Felsklippen das dunkle Grün des Waldes unterbrachen. Dort drüben konnte sich eine ganze Kriegsschar Blackfeet verstecken, ohne dass er sie bemerkte. Zwar hatten sie ihm noch nie etwas getan, und die Tatsache, dass er mit einer Blackfeet-Squaw zusammenlebte, war eine ganz gute Rückversicherung. Aber Indianer waren immer unberechenbar, und niemand konnte voraussehen, was in ihren Köpfen vorging. Wie bei allen Menschen, so gab es auch bei ihnen Quertreiber, die sich nicht an übliche Normen hielten. Deshalb hatte Jakob Stone beim Umgang mit ihnen Vorsicht zum Leitfaden seines Handelns gemacht. Ein Bruder Leichtfuß konnte in dieser Wildnis nicht lange überleben.
Besonders einen gab es unter den Blackfeet, vor dem sich der Trapper in acht nehmen musste. Wenn Big Knife ihn irgendwo hier draußen unvorbereitet erwischte, würde Jakob keinen Schuss Pulver für sein Leben geben.
Big Knife hatte lange um Elk Woman geworben, aber das Mädchen hatte sich schließlich für den weißen Jäger entschieden, der einen Winter lang bei ihnen gelebt hatte, und war mit ihm gegangen. Seit dieser Zeit hasste Big Knife ihn mehr als einen Crow.
Jakob Stone hatte immer befürchtet, dass Big Knife einmal bei ihm auftauchen würde, um sich Elk Women einfach zu holen. Aber bis jetzt hatte er es nicht getan. Doch das sollte nicht heißen, dass die Gefahr vorüber war. Jake wusste, wie lange Indianer ihren Hass mit sich herumtragen konnten.
Er blieb plötzlich stehen, als er einen Fußabdruck an einer sandigen Stelle am Boden entdeckte. Es war der Abdruck eines Mokassins, nur ein einziger, dann war die Spur wieder auf dem steinigen Grund verschwunden.
Also doch Blackfeet!
Der Trapper hob den Kopf und suchte mit seinen Blicken jeden Strauch, jeden Baum und Felsen in seiner Umgebung ab. Wenn es sich um Blackfeet handelte, konnte man nicht wachsam genug sein, egal ob Freund oder Feind.
Vielleicht hielt Big Knife seine Stunde doch jetzt für gekommen, und der Schuss hatte nur dazu gedient, ihn hierher zu locken? Er verwarf diesen Gedanken wieder, denn auch Big Knife wusste, dass ein Schuss das Wild warnte.
Der Trapper überzeugte sich noch einmal, dass sein Gewehr schussbereit war und das Zündhütchen sicher auf dem Piston saß. Dann schlich er im Schutz der Büsche weiter am Rand der Schlucht entlang. Von Zeit zu Zeit schickte er einen forschenden Blick zur anderen Seite hinüber. Aber sein Hauptaugenmerk richtete sich auf seine nähere Umgebung, denn von jenseits der Schlucht konnte man nicht so schnell an ihn heran.
Dann sah er den Blackfoot, oder wenigstens dessen Beine, die in fransenbesetzten Leggins und geschwärzten Mokassins steckten und hinter einem Felsblock hervorschauten. Der Krieger lag am Boden und musste entweder tot oder verwundet sein.
Er musste allein gewesen sein, sonst hätte er nach so langer Zeit nicht mehr dort gelegen. Aber es war durchaus denkbar, dass noch weitere in der Gegend waren und genauso wie er den Schuss gehört hatten.
Aber wer, zum Teufel, hatte da geschossen?
Vorsichtig ging Jakob Stone, die Büchse im Anschlag, um den Felsblock herum. Er stellte mit einem raschen Blick an der seltsam verkrümmten Lage des Indianers fest, dass dieser tatsächlich tot war, und musterte schon wieder wachsam seine Umgebung. Aber er blieb allein.
Langsam trat er an den Toten heran und drehte ihn auf den Rücken. Er kannte ihn. Es war Painted Face, unverkennbar, mit dem dunklen Muttermal auf der Wange. Die Kugel musste ihn mitten im Sprung erwischt haben, als er hinter jenem Felsblock Deckung gesucht hatte. Sie war ihm von der Seite unter dem linken Arm in die Brust gedrungen und musste ihn auf der Stelle getötet haben.
Painted Face war ein verschlossener junger Mann gewesen, der zum Wolfs-Clan von Big Knife gehörte.
Jakob Stone suchte die nähere Umgebung ab, fand jedoch außer der Fährte des Toten keine andere. So kam er zu dem Schluss, dass der Schütze sich auf der anderen Seite der Schlucht befunden haben musste.
Wer konnte es gewesen sein? Diese Frage beunruhigte den Trapper, aber er fand keine Antwort.
Er hatte kein Pferd bei sich und der Indianer offenbar auch nicht, oder er hatte es irgendwo versteckt, weil er jagen wollte. So konnte Jake ihn nicht mitnehmen und beschloss, zunächst nach Hause zurückzukehren und ihn später zu holen, wenn ihn nicht bis dahin schon seine Stammesgenossen gefunden hatten. Und wenn er mit seinem Pferd und dem Muli zurückkam, konnte er auf der anderen Seite der Schlucht nach Spuren suchen.
Der Trapper beeilte sich. Der Gedanke, dass sich in diesen Bergen jemand herumtrieb, der wahllos tötete, erfüllte ihn mit Sorge.
In der Nähe seiner Behausung fand er Pferdelosung, die erst einige Stunden alt war. Misstrauisch suchte Jake den Boden ab und fand Spuren von beschlagenen Hufen. Es waren drei Pferde gewesen, von denen eines deutlich abgelaufene Hufeisen getragen hatte.
Weiße!
Jakob Stone richtete sich auf und schaute dorthin, wo sich hinter einem Waldgürtel seine Hütte befand. Sehen konnte er sie noch nicht, aber die Unruhe in ihm wuchs, wurde beinahe unerträglich.
Vermutlich handelte es sich um die Mörder von Painted Face, und Elk Woman war allein zu Hause!
Mit schnellen Schritten strebte der Trapper dem Waldgürtel zu. Erst als sich vor ihm die Bäume lichteten, blieb er wieder stehen und spähte aus zusammengekniffenen Augen zu der Hütte hinüber, die sich an eine graue, verwitterte Felswand anlehnte. Die Tür stand offen, und kein Rauch stieg aus dem Kamin. Pferde waren nirgends zu entdecken.
Trotzdem, und trotz der nagenden Ungewissheit, blieb der Trapper vorsichtig und überquerte nicht die freie Fläche bis zu seiner Behausung. Falls die Fremden Elk Woman etwas angetan hatten, würde es niemandem nützen, wenn sie ihn auch noch erwischten. In Gefahrenmomenten wie diesem hier nüchtern zu bleiben und sich nicht irgendwelchen Emotionen hinzugeben, war eines der wichtigsten Dinge, die man lernen musste, denn die Wildnis verzeiht keine Fehler.
Rasch, aber ohne aufzufallen, huschte er im Schutz der Bäume entlang und schlug einen Bogen um seine Hütte, bis er auf die Fährte der Reiter stieß, die von seiner Heimstatt wegführte.
Er zählte drei Pferde, und es sah so aus, als hätten die Reiter es eilig gehabt.
Seine beiden Biberfelle hatte er am Waldsaum fallen gelassen. Jetzt nahm er die Büchse in beide Hände und zog den Hahn in die Feuerraste. Geduckt rannte er auf die Blockhütte zu.
In der offenen Tür blieb er stehen, und der Lauf seines Gewehres sank langsam und still herab.
Elk Woman lag mit seltsam verrenkten Gliedmaßen auf dem Boden hinter dem groben, aus rohen Stangen zusammengebauten Tisch. Sie hatten ihr das Kleid mit Messerschnitten zerfetzt. Sie hatten sie entehrt und sie dann mit Messerstichen umgebracht. Diese Kerle mussten wie reißende Bestien über sie hergefallen sein, wie wilde, blutrünstige Tiere, die ohne jeden Sinn mordeten. Jake war solchen Menschen schon wiederholt begegnet, und meistens waren sie weiß gewesen.
Er legte das Gewehr auf den Boden, hob mit zitternden Fingern die Fetzen ihres blutigen Kleides hoch und starrte auf den skalpierten Schädel von Elk Woman hinab.
Nicht einmal das hatten sie ausgelassen. Sie gehörten offenbar zu jener Sorte, die sich mit Indianerskalps brüsteten, auch wenn sie Frauen gehörten.
Das im Tode erstarrte Gesicht und die weit aufgerissenen Augen spiegelten noch das Entsetzen wider, mit dem sie gestorben war.
Jake musste sich eingestehen, dass Elk Woman ihm nicht alles bedeutet hatte. Er hatte sich zwar mit ihr verständigen, aber nie richtig unterhalten können. Dennoch hatte sie eine gewisse Wärme in sein Leben gebracht. Sie war ihm eine gute, ruhige Frau gewesen, aber er hatte sie nicht beschützen können.
Langsam erhob er sich und spürte den heißen Schmerz, der sich unter seinen dumpfen Groll mischte. Der Schrei, mit dem seine aufgestauten Gefühle plötzlich explodierten, brandete zur offenen Tür hinaus und wurde von der dunklen Front des Waldes zurückgeworfen. Dabei schleuderte er den schweren Tisch mit einer einzigen ungestümen Bewegung krachend gegen die Wand. Er zerschlug einen Schemel am Boden und versetzte einem Topf einen wuchtigen Tritt, der ihn nach draußen beförderte. Wild blickten seine Augen aus dem bärtigen, von zottigem Haar umrahmten Gesicht heraus. Schweratmend lehnte er sich gegen den Pfosten der offenen Tür und schaute in den sterbenden Tag hinaus. Die Sonne versank in einem See aus Blut jenseits der dunklen, bizarren Gipfel.
Ebenso schnell wie seine Gefühle empor geschäumt waren, wurde er auch wieder ruhig. Er hob seine Mountain-Büchse auf, ließ den Hahn behutsam auf das Zündhütchen zurückgleiten und lehnte sie gegen die Wand. Dann machte er Feuer, denn von draußen strömte kalte Luft herein. Im flackernden Flammenschein wusch er den Körper von Elk Woman, legte ihn danach auf sein Lager und bedeckte ihn mit einem Bärenfell. Dabei sprach er mit ihr, so wie er es getan hatte, als sie noch am Leben gewesen war.
Die Mörder waren nach ihrer Tat eilig fortgeritten und hatten sich nicht die Zeit genommen, nach Fellen und anderen Habseligkeiten des Trappers zu suchen. So hatten sie auch nicht den Stall gefunden, der seitlich hinter der Blockhütte in eine Aushöhlung des Felsens hinein gebaut worden war.
Jakob Stone aß an diesem Abend nichts mehr. Noch ehe das Feuer ausgegangen war, nahm er seine Decke und ging in den Stall. Er war ein abergläubischer Mensch und wollte bei lebenden Wesen schlafen. Die Nähe des Todes war ihm unbehaglich.
Aber ehe er sich schlafen legte, wollte er noch die beiden Felle holen, die er am Waldsaum hatte fallen lassen. Das Licht würde gerade noch ausreichen, um sie finden zu können. Ihm war kalt, und er beeilte sich. Der Atem stand als kleine, dampfende Wolke vor seinem Gesicht. Eine einzelne Krähe gaukelte über den verlöschenden Himmel. Ihr krächzender Ruf verhallte in der dämmrigen Weite. Von Nordosten schoben sich dunkle Wolken heran. Vielleicht brachten sie den ersten Schnee.
Zehn Schritte vor dem Wald stockte plötzlich Jakes Fuß, und er blieb stehen.
Die Krähe, die gerade auf die Wipfel der Bäume herunterging, um sich einen Schlafplatz zu suchen, war hastig wieder aufgeflattert und zog davon, als wäre sie durch etwas erschreckt worden. Er selbst konnte es nicht gewesen sein, denn der Vogel hätte ihn zweifellos schon viel früher bemerkt.
Vielleicht hatte der Geruch der frischen Felle einen Wolf angelockt? Aber Wölfe waren scheu und um diese Jahreszeit noch nicht so ausgehungert, dass sie den Geruch des Menschen einfach nicht beachteten.
Zu dumm, dass er sein Gewehr in der Hütte zurückgelassen hatte, ein beinahe unverzeihlicher Fehler. So hatte er jetzt als einzige Waffen eine alte Kentucky-Pistole und sein Messer bei sich.
Während er noch dastand, durch das Verhalten der Krähe misstrauisch gemacht, und fieberhaft überlegte, brachen sie urplötzlich aus dem Wald heraus. Jake zählte vier, fünf, sechs Blackfeet, die auf ihn zustürzten. Aber vielleicht waren noch mehr zwischen den Bäumen. Auf alle Fälle waren es genug für ihn, und sie waren sich ihrer Sache sehr sicher, denn sie schossen nicht auf ihn, sondern versuchten, ihn im Zweikampf zu töten. Und wenn sie ihm den Weg zurück verlegten, war er tatsächlich verloren.
Jake riss die Kentucky-Pistole aus dem Gürtel und schoss dem vordersten der Angreifer in die Brust. Aber das hielt die anderen nicht auf. Noch ehe der Schuss verhallt war, machte Jake kehrt und rannte zurück. Dicht hinter sich hörte er die Schreie der Blackfeet und lief um sein Leben.
In all den Jahren, die er hier gehaust hatte, war ihm nie zu Bewusstsein gekommen, wie weit seine Hütte von dem verdammten Wald entfernt war. Jetzt erst wurde es ihm mit keuchender Lunge gewahr. Mit langen Sätzen rannte er wie ein aufgescheuchtes Wild über den steinigen, mit welkem Gras spärlich bedeckten Boden.
Er war ziemlich sicher, dass es ihm gelingen würde, vor ihnen seine Hütte zu erreichen. Im Laufen hatte er es stets mit den schnellsten der Blackfeet aufgenommen, aber kein Mann konnte so schnell laufen wie ein Tomahawk oder gar eine Kugel flog.
Der Trapper hörte an ihren Rufen, dass sie zurückblieben. Sie mochten erkannt haben, dass sie ihn auf diese Weise nicht erwischen konnten, doch bis zu seiner Hütte musste er noch fast fünfzig Yards zurücklegen. Genug Zeit also, um zielen und treffen zu können.
Er lief mit wilden Sprüngen im Zickzack hin und her. Ein Tomahawk flog mit leisem Fauchen an ihm vorbei und landete knirschend einige Schritte vor ihm.
Noch dreißig Yards bis zur Hütte - noch zwanzig. Etwas fetzte durch sein ledernes Hemd und riss ihm die Haut an den Rippen auf, der scharfe Knall einer Büchse holte ihn ein.
Jake Stone fluchte und presste im Laufen die Hand auf die brennende Stelle an seiner Seite. Hoffentlich haben sie nur das eine Gewehr, dachte er dabei.
Dann prallte er gegen die schwere Tür und stolperte in seine Behausung hinein. Fürs erste war er ihnen entwischt. Er warf die Tür zu und hängte den Querriegel in die Halterung. Dann griff er nach seiner Mountain Rifle und stellte sich an das Fenster, stieß den hölzernen Laden auf.