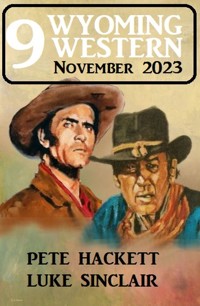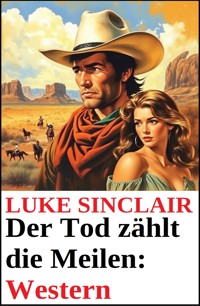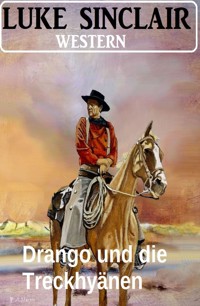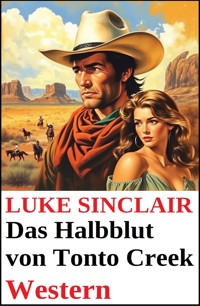
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Sonne war gerade über den Apache Mountains weit hinter der staubigen Ebene aufgegangen. Der Reiter mit dem dunklen Halbblutgesicht trieb seinen Falben ohne Zögern durch das ausgetrocknete Flussbett hindurch. Vor ihm tauchten flache Gebäude auf, Corrals und ein Brunnen. Er lenkte sein Pferd über den Hof der Ranch und hielt ein paar Pferdelängen vor dem Haus an. Ein Mädchen kam heraus, blinzelte in die tiefstehende Sonne und beschattete mit der Hand die Augen. Dann erkannte sie den Reiter und sagte: „Du, Tonto? Dad ist nicht hier, aber es ist trotzdem nicht gut, dass du hierher kommst.“ Noch während sie sprach, erschien ein junger Bursche in der Tür. Er trug ein Henrygewehr in den Händen, und der Blick, mit dem er den Reiter musterte, war feindselig. „Was willst du hier, Tonto? Mein Vater hat dir doch mehr als einmal gesagt, dass du hier nicht willkommen bist. Wir haben nichts übrig für Apachen. Dad sagt immer, ein halber Apache ist noch weniger wert als ein richtiger.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Halbblut von Tonto Creek: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Das Halbblut von Tonto Creek: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2025 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Das Halbblut von Tonto Creek: Western
von LUKE SINCLAIR
Die Sonne war gerade über den Apache Mountains weit hinter der staubigen Ebene aufgegangen.
Der Reiter mit dem dunklen Halbblutgesicht trieb seinen Falben ohne Zögern durch das ausgetrocknete Flussbett hindurch.
Vor ihm tauchten flache Gebäude auf, Corrals und ein Brunnen. Er lenkte sein Pferd über den Hof der Ranch und hielt ein paar Pferdelängen vor dem Haus an.
Ein Mädchen kam heraus, blinzelte in die tiefstehende Sonne und beschattete mit der Hand die Augen. Dann erkannte sie den Reiter und sagte:
„Du, Tonto? Dad ist nicht hier, aber es ist trotzdem nicht gut, dass du hierher kommst.“
Noch während sie sprach, erschien ein junger Bursche in der Tür. Er trug ein Henrygewehr in den Händen, und der Blick, mit dem er den Reiter musterte, war feindselig.
„Was willst du hier, Tonto? Mein Vater hat dir doch mehr als einmal gesagt, dass du hier nicht willkommen bist. Wir haben nichts übrig für Apachen. Dad sagt immer, ein halber Apache ist noch weniger wert als ein richtiger.“
Das schwache Glitzern seiner Augen schien das einzige Leben in dem dunklen Gesicht des Reiters zu sein. Als ob er den jungen Mann gar nicht bemerken würde, wandte er sich an das Mädchen und sagte:
„Ich bin nicht hergekommen, um Ihnen einen guten Morgen zu wünschen, denn ich weiß, heute wird es kein guter Morgen und kein guter Tag sein.“
Das Mädchen versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht ganz.
„Ich muss mich für meinen Bruder entschuldigen“, sagte sie. „Er hat die Regeln der Gastfreundschaft vergessen, die unser Vater uns gelehrt hat. Steig ab, und tränke dein Pferd.“
Der junge Mann hob das Gewehr.
„Ich rate dir, auf dem Gaul sitzenzubleiben, Tonto. Die Gastfreundschaft, von der meine Schwester sprach, gilt nicht für verdammte Rothäute.“
Die Augen des Reiters zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen. Seine Stimme klang eisig, als er erwiderte:
„Wenn ich hier absteigen wollte, Cliff, dann würde mich Ihr Schießprügel nicht daran hindern. Ich bin nur gekommen, um Sie zu warnen, und das tue ich nicht für Sie. Ich habe da hinten Spuren von Apachen gesehen.“
Er wies mit der ausgestreckten Hand in die Richtung, aus der er gekommen war. „Aus der Art, wie die Apachen sich bewegt haben, ist zu schließen, dass sie etwas im Schilde führen. Es waren etwa fünfzehn oder sechzehn Krieger. Aber wenn Sie hier auf der Hut sind, haben Sie eine Chance, sich zu behaupten. Holen Sie Ihre Leute zusammen. Bleiben Sie im Hause, und halten Sie die Augen offen.“
Cliff Carline grinste ihn hämisch an.
„Wir brauchen keinen Rat von einem Halbindianer. Und jetzt verschwinde endlich, ehe ich abdrücke!“ Der Junge spannte mit dem Daumen den Hammer seines Gewehres.
„Er will uns doch nur helfen, Cliff“, sagte Patricia eindringlich, doch ihr Bruder ließ keinen Blick von dem Reiter.
„Geh ins Haus, Schwester! Bestimmt hat er uns ein Märchen erzählt, nur um einen Grund zu haben, hierher zu kommen. Du weißt, dass er schon immer scharf auf dich war. Und wenn er könnte, wie er wollte, dann...“
„Du tust ihm unrecht, Cliff!“
In Tonto brodelte der Zorn, aber er tippte so lässig, wie es ihm möglich war, an den Hut.
„Vielleicht habe ich ein andermal Gelegenheit, Ihnen zu danken, Miss, wenn dieser Verrückte nicht mit einem Gewehr herumfuchtelt.“
Patricia schaute blinzelnd zu ihm hoch.
„Damit wir uns richtig verstehen, Tonto, lediglich aus Höflichkeit und Dankbarkeit für die Warnung bin ich für dich eingetreten. Sonst haben wir uns nichts zu sagen. Meine Mutter ist bei einem Apachenüberfall ums Leben gekommen. Du bist auch zur Hälfte Apache, das vergesse ich nicht.“
„Danke für die freundlichen Worte“, sagte Tonto sarkastisch und ließ den Falben antraben, ohne dem Mann mit dem Gewehr noch einen Blick zu schenken.
Er hatte diesen Leuten nie etwas getan. Dennoch schlug ihm ihr Hass entgegen, wann immer er ihnen begegnete. Nur weil seine Mutter eine Apachin vom Tonto Creek war, dafür hassten ihn die Carlines, und Rhett Carline war ein einflussreicher Mann in diesem Land.
Tonto schlug die Richtung nach Eagle Flat ein. Noch immer wühlte der Zorn in ihm.
Sein richtiger Name war Joseph Girvin, aber er hatte diesen Namen schon fast vergessen. Seit er sich zurückerinnern konnte, nannten ihn die Leute Tonto.
Girvin war der Name seines Pflegevaters, der ihn nach einem Massaker, bei dem auch seine Mutter gestorben war, aufgelesen und großgezogen hatte. Aber die Weißen hatten ihn immer nur Tonto genannt, und er hatte sich längst daran gewöhnt. Was bedeutete schon ein Name?
Auf einem Hügel drehte er sich um und sah, dass die Geschwister ins Haus gegangen waren. Einen Augenblick lang musterte er unschlüssig das Land, den rötlich schimmernden Sand, die dunklen Tupfen von Tumbleweeds, Mesquite und Salbei.
Mochte sie alle der Teufel holen! Scharf zog er sein Pferd herum und ritt weiter, ohne sich ein einziges Mal umzublicken.
*
Patricia Carline schaute unruhig über das dürre Land. Die Tumbleweeds lagen reglos in der Morgensonne. Kein Lufthauch bewegte diese federleichten Reisigbälle, die sonst fast immer in Bewegung waren.
„Cliff“, sagte sie nach einer Weile. „Wir sollten seine Warnung nicht einfach übergehen. Er kennt die Apachen wie sonst niemand.“
„Natürlich“, erwiderte Cliff Carline gehässig. Er legte endlich das Gewehr auf den Tisch und schaute zu seiner Schwester hinüber. „Der Kerl lügt, wenn er den Mund aufmacht.“
„Es ist so still heute“, sagte Patricia leise. „So unheimlich still. Genauso wie damals, bevor Ma starb. Kein Vogel ist zu hören. Es ist so, als ob das ganze Land den Atem anhält.“
Cliff legte ihr den Arm um die schmalen Schultern.
„Lass dich von diesem Halbblut nicht ins Bockshorn jagen. Vergiss ihn endlich.“ Aber er sah, dass er seine Schwester nicht beruhigen konnte. „Na schön, ich werde Lester und Dusty herüberholen, wenn dich das beruhigt.“
„Und Ingram?“
„Der ist über Nacht draußen geblieben. Er sollte im Süden einen Weidezaun reparieren. Die anderen sind mit Pa nach Eagle Flat geritten.“
„Ja, ich weiß.“
Cliff Carline ging hinaus. Das Land war wie erstarrt. Genauso war es damals gewesen, als seine Mutter und sein älterer Bruder gestorben waren. Das lag inzwischen mehr als fünf Jahre zurück, aber er konnte sich noch genau daran erinnern, an das eigenartige Gefühl, das einen nicht losließ, und das man nicht beschreiben konnte.
Einbildung. Er schüttelte diesen Gedanken von sich ab und ging weiter. Aber er konnte nicht verhindern, dass sie immer wiederkamen.
Die Nervosität sprang auch auf Dusty und Lester über, als sie im Haus waren. Sie hatten die Tür geschlossen und starrten durch die Fenster hinaus auf das Land, das vor ihnen lag wie ein Tier, das unter dem hypnotischen Blick einer Schlange vor Angst und Entsetzen gelähmt schien.
„Wenn er doch jetzt nur hier wäre“, sagte Patricia in die Stille.
Cliffs Kopf ruckte herum.
„Sei still!“ herrschte er seine Schwester nervös an. „Dieser Kerl hat uns doch nur zum Narren gehalten.“
„Ich weiß nicht“, sagte Dusty ein wenig unbehaglich. „Mir kommt es auch nicht ganz geheuer vor. Am Morgen steigen sonst immer die Lerchen hoch. Aber heute hört man nicht mal eine armselige Grille.“
„Na schön“, knurrte Cliff. „Vielleicht schleichen wirklich ein paar von ihnen da draußen herum und versuchen, Pferde zu stehlen. Deswegen braucht ihr euch nicht gleich in die Hosen zu machen. Wenn sie es versuchen, werden wir sie zum Teufel jagen.“
„Wenn es Serato ist, wäre ich mir da nicht so sicher“, beharrte Dusty. „Der ist ein Teufel.“
Irgendwo begann ein Koyote zu heulen. Lester und Dusty sahen sich an.
„Ich habe noch nie um diese Zeit einen Koyoten gehört“, sagte Patricia, ohne den Kopf zu wenden.
„Das war auch keiner“, bestätigte Dusty. „Machen wir lieber die Fenster dicht.“
Sie legten die schweren hölzernen Läden vor und verriegelten die Tür mit Querbalken. Dann griffen sie zu ihren Waffen und starrten durch die schmalen Schlitze nach draußen.
Dusty repetierte plötzlich sein Gewehr.
„Da vorn hat sich ein Tumbleweed bewegt, aber es ist noch genauso windstill wie vorhin.“
„Nicht schießen, solange ihr nichts erkennen könnt“, sagte Cliff. Er wischte sich die Handflächen an der Hose ab und nahm dann sein Gewehr wieder auf.
Plötzlich knallte draußen ein Gewehr. Im gleichen Augenblick fuhr Cliff mit einem erschrockenen Fluch zurück. Holzsplitter spritzten in sein Gesicht, und die Kugel zerschlug einen Tonkrug auf dem Regal an der gegenüberliegenden Wand. Unmittelbar nach diesem Schuss setzte draußen ein wildes Feuer ein. Gestalten sprangen plötzlich hoch, als hätte die Erde sie ausgespien, und rannten geduckt auf das Haus zu.
„Verdammte Höllenbrut!“, knurrte Cliff und wischte sich übers Gesicht. Dusty und Lester schossen bereits. Pulverrauch füllte schnell den Raum und machte das Atmen zur Qual. Kugeln prallten gegen den Adobelehm der Mauern oder hämmerten in die dicken Fensterläden.
Cliff starrte über das Visier seiner Waffe hinweg auf die huschenden Gestalten. Man musste verdammt schnell zielen und schießen können, wenn man einen treffen wollte. Die angreifenden Krieger sprangen hoch, um nach zwei oder drei Schritten bereits wieder hinter einer kaum vorhandenen Deckung zu verschwinden. Wie Eidechsen pressten sie sich flach auf den Boden und verschmolzen mit ihm zu einer nicht zu unterscheidenden Einheit. Nur die emporschnellenden Pulverwölkchen verrieten ihre Positionen.
Cliff Carline schoss in rascher Folge. Die Messinghülsen flogen nach jedem Repetiervorgang an seinem geröteten Gesicht vorbei. Kugeln pfiffen durch die heiße Luft und ließen kleine Staubfontänen aus dem rötlichen Sand hervorspritzen.
Lester traf einen Apachen, der sich humpelnd in Sicherheit bringen wollte. Aber er stolperte, blieb an einem Dornbusch hängen und wurde noch einmal von einer Kugel getroffen, noch ehe er Zeit fand, sich loszureißen.
Lester stieß einen triumphierenden Ruf aus.
Eine Kugel flog durch Dustys Schießscharte und riss ihm das Ohr auf.
„Halt’s Maul!“, fuhr er Lester an. „Schieß lieber!“ Er wischte sich mit der Hand das Blut vom Hals und riss wieder sein Gewehr an die Schulter.
Weiter hinten stieg schwacher Rauch aus einer Bodenwelle auf.
„Was haben die Burschen vor?“ Cliff wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Es entstand eine kleine Feuerpause.
„Vielleicht wollen sie uns ausräuchern“, erklärte Dusty kleinlaut.
„Das Haus ist aus Adobe gebaut“, beruhigte Cliff ihn.
„Aber das Dach nicht.“
Sie schwiegen eine Weile, dann sagte Patricia: „Wir dürfen sie auf keinen Fall heranlassen.“
Cliff schrie plötzlich laut: „Passt auf, dort links!“
Lester riss sein Gewehr hoch. Bin Apache sprang mit einer brennenden Fackel aus einer Bodenrinne hoch. Noch fünfzehn Yards trennten ihn vom Haus. Als er ausholte, um seine Fackel auf das Dach des Hauses zu werfen, traf ihn Lesters Kugel.
Der Indianer fiel nach hinten auf einen Tumbleweed, der sofort Feuer fing. Der Verwundete versuchte, wegzukriechen, aber die schnell auflodernden Flammen erfassten bereits seine Gestalt. Rauch quoll empor, und der Krieger wälzte sich in stummer Qual im Sand. Dann verlor er das Bewusstsein und lag still.
Mehrere Krieger versuchten unterdessen, das Haus zu erreichen, aber das heftige Feuer der Verteidiger trieb sie fast augenblicklich in die Deckung zurück.
„Schätze, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen“, bemerkte Lester zufrieden. Er stand auf und schaute durch den Raum. Eine Kugel pfiff durch die Schießscharte und traf ihn in die Seite. Er verlor den Halt und landete krachend neben dem Tisch. Blut rann aus seinem linken Mundwinkel. Patricia schrie auf und presste die Hand vor den Mund. Dusty und Cliff fuhren herum.
„So helft ihm doch!“, rief Patricia.
Die beiden Männer kamen langsam näher, und Cliff lehnte sein Gewehr gegen die Tischkante.
Die Schmerzen spiegelten sich in den Augen des Sterbenden wider, aber er gab keinen Laut von sich. Seine Blicke glitten zwischen Cliff und Dusty hin und her.
„Geht auf eure — Plätze zurück“, sagte er matt, „sonst werden sie kommen.“
„Geh, pass auf, ob du etwas sehen kannst“, sagte Cliff mit einer Kopfbewegung, ohne den Blick von Lesters Gesicht zu nehmen.
Dusty ging auf seinen Platz zurück.
„Es ist nichts zu sehen“, sagte er. „Vielleicht haben sie aufgegeben.“
*
Eine Stunde später war Lester tot. Patricia hockte neben dem Toten und sagte kein Wort. Dusty starrte noch immer nach draußen, wo inzwischen flimmernde Hitze über dem Land lag.
„Was meinst du, ob wir mal nachschauen sollten?“, fragte er.
Cliff hob den Kopf und strich sich das Haar aus der Stirn.
„Ich glaube, sie sind weg“, sagte er. „Nachdem sie uns nicht beigekommen sind, haben sie eingesehen, dass sie nichts mehr ausrichten können.“
Es verstrich eine weitere halbe Stunde. „Es ist die gleiche verdammte Stille wie vor dem Angriff“, knurrte Dusty.
Cliff erhob sich.
„Ich werde nachsehen, ich halte dieses Warten nicht mehr aus.“
„Tu es nicht, Cliff, sie werden dich erschießen“, flehte Patricia. Aber ihr Bruder hörte nicht auf sie. Er nahm den Sicherungsbalken von der Tür und öffnete sie vorsichtig. Einen Moment lang schaute er hinaus, ohne etwas Verdächtiges erkennen zu können. Dann repetierte er sein Gewehr und ging mit der Waffe im Anschlag hinaus.
Die Luft war heiß und drückend, und nichts regte sich. Misstrauisch beobachtete er die Mesquitebüsche in einiger Entfernung und ging langsam auf sie zu.
„Ihr anderen bleibt im Haus!“, rief er über die Schulter, ohne sich umzudrehen.