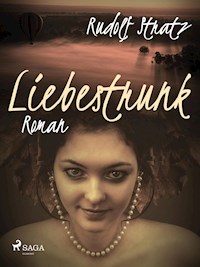Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In "Das deutsche Wunder" von Rudolf Stratz taucht der Leser in die Welt des aufstrebenden Deutschland des 19. Jahrhunderts ein, in dem wissenschaftlicher Fortschritt und industrielle Revolution Hand in Hand gehen. Stratz präsentiert eine detaillierte Analyse der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die das Land prägten, und zeichnet ein faszinierendes Porträt einer Nation im Wandel. Sein Schreibstil ist prägnant und informativ, jedoch auch mit einer gewissen Umsicht und Wärme gegenüber den historischen Persönlichkeiten seiner Erzählungen versehen. Das Buch hebt sich als bedeutende Darstellung des deutschen Aufstiegs im 19. Jahrhundert in der literarischen Landschaft hervor und ist eine fesselnde Lektüre für Geschichtsinteressierte und Liebhaber der industriellen Revolution gleichermaßen. Rudolf Stratz selbst war ein angesehener Historiker und Schriftsteller, der durch seine profunde Kenntnis der deutschen Geschichte und seine Leidenschaft für das Thema dieses Buchs inspiriert wurde. Seine akademische Expertise und sein feines Gespür für Erzählungen ermöglichten es ihm, ein Werk zu schaffen, das sowohl informativ als auch unterhaltsam ist. "Das deutsche Wunder" ist ein Muss für jeden Leser, der sich für die Geschichte Deutschlands, die industrielle Revolution oder historische Erzählungen im Allgemeinen interessiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das deutsche Wunder
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Darf der Dichter die Gegenwart schildern? Das, was erst anderthalb oder zwei Jahre hinter uns liegt und noch bis in die Zeit des großen Kriegs hineinreicht?
Oder soll man dem Ruf der Kunstrichter trauen: Nein! Die Zeit ist noch zu nah. Zu groß. Ihr habt zu schweigen.
Geschwiegen haben wir Alle bisher von selbst! Vom Tage des Kriegsausbruchs ab hat wohl Jeder die Feder aus der Hand gelegt. Manche Schriftsteller kämpften im Felde. Anderen war es vergönnt, als Johanniter, Krankenpfleger, Automobilisten, Kriegsberichterstatter, überhaupt eben als zeitweilig zur Front zugelassen, in West und Ost das ungeheure Schauspiel des ungeheuersten Kriegs aller Völker und Zeiten in sich aufzunehmen. Zu den Letzteren gehörte auch ich.
Und daheim sah Jeder von uns das zweite, nicht minder riesige Bild: die zweite deutsche Front, die Front der Frauen und der Gelehrten, der Arbeiter und der Sparer.
Und draußen sehen wir den Feind: die schamloseste Lüge der Weltgeschichte, die England, den schamlosesten Verrat der Weltgeschichte, der Italien, die schamloseste Mordbrennerei, die Rußland, die satanische Wut, die Frankreich heißt. Wir sehen den Deutschen vogelfrei fast auf dem ganzen Erdball, wir hörten von dem Massenhungertod, der an dem größten Kulturvolk der Welt das Schlächterwerk des Senegalnegers vollenden sollte. Uns würgte der Ekel an der Menschheit, von dem nur der Gedanke an Deutschland uns in heiligem Grimm befreite.
Und von alledem sollen wir schweigen?
»Oh nein!« sagt der kritische Germanist. »Nur laßt Euch Zeit! Distanz! Distanz! In fünf Jahren – oder in zehn – oder in dreißig – je nachdem – da wird der Abstand von den Dingen und Leidenschaften groß genug sein, um ein gereiftes Kunstwerk zu schaffen!«
Ja, zum Donnerwetter, ist denn Abgeklärtheit allein der Zweck der Kunst? Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe nichts? Das, was wir jetzt Alle mit allen Fibern unserer Seele im Brausen der Völkerdämmerung und Weltenwende in uns erleben, was draußen mit tausend feurigen Jungen auf den Schlachtfeldern redet und daheim von tausend Kirchturmglocken läutet? Das, woran Jeder denkt, wofür Jeder atmet, wovon Jeder spricht: Nur der Dichter nicht?
Aber nehmen wir an: der Kunstrichter hätte Recht: Was sollen wir nun in dieser Zwischenzeit bis zum richtigen literarischen Abstand tun?
»Inzwischen? Mein Gott – sehr einfach: Wählt Eure Stoffe aus der Zeit vor dem Krieg wie bisher!«
Die Zeit vor dem Krieg? Wann war das eigentlich? Man reibt sich die Augen: Es kommt Einem wie ein Jahrhundert vor. Es ist eigentlich gleich, wie lange es her war. Es ist ja Alles so anders geworden. So neu. So gewaltig. Die Menschen jenseits des deutschen Jungbrunnens vom 4. August – das sind nicht mehr wir! Wir sind weit über sie hinaus ...
Mit anderen Worten: Wer die Zeit bis vor dem Jahr 1914 beschreibt, der schreibt einen historischen Roman. Historische Romane sind nicht Jedermanns Sache, zumal jetzt, wo vor Aller Augen die Historie selber mit Donnerschritt über die Erde geht.
Also kommen wir wieder auf die Gegenwart zurück! In scheuer und zögernder Ehrfurcht steht der Schriftsteller vor dem jedes Menschenmaß des Auges und Geistes übersteigenden Rundbild des flammenden Erdballs und sagt sich, wenn er versuchen will, ein Stück auf's Bild zu bannen, von vornherein:
»Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis!«
Ja gewiß: Unzulänglich, Stückwerk wird Alles sein, was der, der Zeit und Krieg sehend miterlebte, jetzt schon gestalten kann. Er kann nichts tun, als eben aus sich heraus sein Bestes zu geben. Er muß versuchen, aus seinem Wesen, seiner Weltanschauung, seinen Eindrücken den Beobachtungswinkel zu gewinnen, wo sich ihm, durch einen Strahl von oben, die Welt draußen so deutlich widerspiegelt wie die feindliche Stellung im Scheren-Fernrohr. Die feindliche Stellung – das ist es, von der ich ausgehen möchte. Ich meine damit nicht den Krieg selbst. Von ihm und seinen Einzelheiten darf jetzt aus naheliegenden Gründen noch nicht viel gesagt werden. Und ist es späterhin militärisch möglich, so bleibt es ein selbstverständliches Vorrecht derer, die ihn kämpfend miterlebten. So liegt über meinem hier folgenden Werk der Krieg mehr als Stimmung denn als Geschehnis.
Aber ein Anderes glaubte ich, jetzt schon schildern zu dürfen. Gerade jetzt. Das, was vor uns Allen noch, inmitten aller Siege, als ein unheimliches Rätsel steht: Wie kam es, daß auf einmal gegen uns der Haß eines Irrenhauses über die ganze Erde aufflackerte? Wie kam es, daß hysterische Lüge die Druckerschwärze der fünf Weltteile in schwarzen Eiter verwandelte? Daß russische Große ihre Ehrenwörter gegen uns wie Zahnstocher zerknickten? Daß ein Bandit nackt, mit dem Dolch in der Faust, hervortrat und sich mit pathologischem Grinsen als der Verbündete jenseits der Alpen vorstellte? Daß Japanese und Bur einträchtig wie ein paar Schlächterhunde Deutschland an die Gurgel sprangen? Daß die schwarze, weiße, braune und gelbe Menschheit sich vor unsern Augen wie berauscht in einem Kotmeer von Eidbruch, Verrat, Niedertracht und Blutdurst wälzte?
Zu unsern Feinden will ich den Leser führen, ihre Pläne belauschen, ihren Zusammenkünften beiwohnen, bei denen überall wie Bankos Geist der Schatten Eduards VII. unter den Verschwörern sitzt. Aus seinem Geist, aus der Geistesverfassung – oder Geistesverwirrung – unserer Gegner allein läßt sich der Ursprung und rächende Verlauf des Weltkriegs erklären. Den wir nicht wollten. In dem wir siegen. Den unsere Feinde bereuen werden. Dessen sich – uns und unsere Bundesgenossen ausgenommen – die Menschheit noch nach Jahrhunderten schämen wird.
Unsere Feinde! Ich glaube, sie, nach dem Lauf meines Lebens, besser zu kennen als Andere. Ich kenne Rußland vom Eismeer bis zur Krim. Ich kenne Frankreich aus mannigfachen Beziehungen. Ich kenne ebenso England. Ich habe mit immer wachsender Sorge in dem letzten Jahrzehnt in London und Paris, in Belgrad und Moskau, in Brüssel und Rom, in Kairo und Cettinje die Unterwelt gegen unser arbeit- und festfrohes Deutschland emporsteigen sehen.
Ein garstig Lied – pfui – ein politisch Lied!
Ja, schön im alten Sinn friedlicher Gesittung ist die Welt augenblicklich nicht. Daran sind wir Deutsche nicht schuld. Und doch ist sie schön, hinreißend schön, denn sie ist groß!
Groß wie noch nie! Und Größe tat uns in Deutschland not. Größe! Größe! Wir haben seit Jahren nach Größe gelechzt, ohne es zu wissen. Nicht nach Größe des Kriegs, aber nach Größe der Menschen und Dinge, in unserem innerpolitischen Kleinkampf, in unserer liebevoll alles Kranke und Schwache hätschelnden Kunst, in unserem uns selbst schon unbehaglichen Interesse für alle gleichgiltigen Entartungserscheinungen des Auslands. Deutschland braucht zu seiner Gesundheit Helden. Sie sind das Eisen in seinem Blut. Nun hat es Helden! Hat, über sie alle hinaus, einen einzigen Helden: sich selbst! Das erste und hehrste und älteste Vorrecht des Dichters ist es, den Helden zu besingen. So sei es mir vergönnt, so gut ich es eben vermag, von Deutschland zu sagen und wie es, als ein Wunder vor sich selbst und mehr noch vor seinen Feinden im Kampf gegen die Menschheit der Menschheit Würde wahrte.
I.
»Gott will den Krieg!« sagte der russische Generalmajor Schiraj mit seiner tiefen Stimme.
Sein Nachbar verstand ihn nicht. Es war zu viel Dröhnen um ihn. Alle Glocken von Moskau läuteten, während der Zar an diesem Apriltag des Jahres 1914 die Uspénskykathedrale auf dem Kreml verließ. Es hallte neben ihm von der Archangelsky- und Blagoweschtschenskykathedrale, hoch vom Turm Iwan Weliki und aus dem heiligen Synod, von der Kasanschen und Basileus-Kathedrale unten, von der Erlöser-Kirche drüben, vom Wunderkloster bis zu den Zinnen des Jungfernklosters fern vor der ungeheuren Stadt. Es war ein Sturmläuten wider einen unsichtbaren Feind über den hundert goldenen Kuppeln, den Tausenden von grünen Dächern. Und im Sturm flogen dicht darüber am niederen Himmel die grauen Schneewolken, von Osten her über die moosfarbenen Turmhauben der Kremlmauern aus Tatarenzeit, selbst dahinjagenden, zusammengeballten Reitergeschwadern ähnlich, in ihrem endlosen Zug von Asien nach Europa.
Nikolaus der Zweite hatte dem Gnadenbild der Muttergottes von Wladimir seine Ehrfurcht bezeugt. Nun verblaßte hinter ihm der byzantinische Goldglanz des Ikonostas, die weißbärtige Patriarchengestalt des Metropoliten von Moskau, verhallten die Donnerbässe der Mönche: » Gospodi pomilui! Herr, erbarme Dich!« Er durchschritt den schmalen Platz zwischen der Kathedrale und der Löwentreppe des Kreml. Ein unscheinbarer blonder Schatten in dunkelgrüner, russischer Generalsuniform, sah er noch kleiner aus zwischen den schwarzbärtigen Riesengestalten der Tscherkessen seines Leibgardeconvois, die in ihren hohen Fellmützen alles überragend rechts und links von ihm und seinem Trosse gingen. Vor ihm schritt, für alle Mordversuche der Untertanen verantwortlich, der stellvertretende Generalgouverneur von Moskau, dicht hinter dem Selbstherrscher, sonderbar inmitten der Exzellenzen und Hohen Exzellenzen, ein einfacher, dunkelbärtiger Matrose in reiferen Jahren, der Batka, der Gefährte des siechen kleinen Thronfolgers, den er wie eine bleiche, in den langen Waffenrock der Gardekosacken gesteckte Wachspuppe auf den Armen trug. Dem winzigen Hetman aller Kosacken folgten in einer Reihe nebeneinander seine vier Schwestern, alle in Weiß, mit weißen Pelzen um die Schultern, dann, voll Orden und Bänder, in hohen Stiefeln und weiten Hosen, in Lammfellmützen und grünen Röcken, die Großfürsten und Generale, in Klapphut, Degen und goldgestickter Gala, breite goldene Borten an den weißen Beinkleidern die hohen Tschinowniks in Zivilrang. Die ganze Kremlstadt auf dem Hügel inmitten Moskaus war, solange der Zar sich hier auf der Durchreise nach der Krim aufhielt, streng von Menschheit und Außenwelt abgeschlossen. Aber aus der Uspénsky-Kathedrale strömten immer noch zu Hunderten die Uniformen, zerstreuten sich, belebten die toten Straßen und Plätze von der Stelle, wo der Großfürst Sergius in die Luft gesprengt wurde, bis zum Denkmal des ermordeten Zar-Befreiers. Im Innern der Kirche sangen immer noch die langhaarigen Mönche in dumpfen Bässen ihr Kyrie Eleison, immer noch läuteten nah und fern die Glocken, immer noch stöhnte der Steppenwind um die heiligen altslawischen Stätten und stoben vom Himmel die stürmenden Hunnenwolken gen Westen.
»Gott will den Krieg! Sonst hätte er nicht den Wunsch danach in unsere Brust gelegt!«
Der Generalmajor Schiraj wiederholte es mit einer starken und entschlossenen Stimme. Er war vom Äußeren des wahren Großrussen, schwergebaut, mit breiten Backenknochen, geblähten Nasenflügeln, dichtem, blondem Bart.
Sein Begleiter, der Hofmeister Morskoi, blieb stehen und schaute nach der langen gelben Fensterfront des Kreml-Palais zurück, auf dessen Zinnen die schwarz-gelb-weißen Zarenflaggen scheinbar hilflos im Sturme hin- und herflatterten.
»Gott mag wollen! Aber ob der Gossudar will ...«
»Er wird!«
»Oder er wird nicht! Wer kann das bei ihm wissen!«
Eine Gestalt tauchte im Geist vor Beiden auf, die sie vorhin gesehen. Ein baumlanger, ältlicher General, mit seinem, von Leidenschaften verwüsteten aristokratischen Geierkopf weit den kümmerlichen Neffen überragend.
»Wenn Nicolai Nicolajewitsch ...«
»Ist er schon Zar?«
»Pst! Pst! Still!«
Der General schaute besorgt umher. Mauern und Pflaster hatten hier Ohren, plauderten wieder, was man von den Geheimnissen von Gatschina und Livadia wußte ... Der Höfling drehte sich eine neue Zigarette.
»Der Krieg ist eine Kleinigkeit, Pawel Antonowitsch! Das Schwere ist vor ihm: der eine Federzug des Zaren!«
»Er muß!«
»... Wenn Alle um ihn einig wären! Aber diese Verdächtigen im Lande ... ist da nicht Witte? Ist da nicht Rasputin?«
Die grobknochigen Züge des Generals verfinsterten sich bei dem Namen des wundertätigen russischen Popen und Günstlings der vornehmen Petersburger Damenwelt, der beim Zaren aus- und einging. Er sagte ruhig:
»Und doch ist der Stein im Rollen! Ich komme aus Bochara. Überall in Zentral-Asien zieht man unsere Truppen auf Kriegsfuß zusammen. Im Kaukasus rüstet man. Auf allen Bahnhöfen zwischen Wolga und Ural trifft man Vorbereitungen. Aus dem östlichen Sibirien sind unsere Truppen schon auf dem Marsch ...«
»Von der Krim aus wird der Herrscher Paraden abhalten. In Odessa. In Nicolajeff. In Cherson. Alle diese Divisionen kommen auf Kriegsstärke und bleiben es! Aber gehen wir, Pawel Antonowitsch!«
Sie schritten die weite Kremlterrasse entlang. Unten rauchten schmutziggraue Wasserflächen der Moskwa zwischen den morschen Resten der Eisdecke. Bäche von Tauwasser durchfurchten den fußdicken gefrorenen Straßenschlamm. Es triefte von den Dächern. Der kurze Kampf zwischen russischem Sommer und Winter hatte begonnen, und der General sagte:
»Die Zeit ist gekommen. Wir haben sie seit Jahren genutzt. Unsere Kriegsausrüstung ist unermeßlich – war noch nie da. Nichts wurde diesmal verabsäumt. Nun – was ist?«
Der Staatsrat und Kammerherr Morskoi neben ihm hatte den rechten Handschuh abgestreift. Kurzatmig und wohlbeleibt, eilte er doch, so rasch es die Pfützen gestatteten, quer über den Zarenplatz auf das Kleine Palais zu, wo ihm vom Fußsteig her ein hellblonder schlanker Mann in den Dreißigern lässig lächelnd mit der Rechten herüberwinkte. Es war eine fast gönnerhafte Gebärde. Dabei trug der drüben nicht einmal irgend eine Uniform des russischen Tschin, sondern eine schwarze Krimmermütze, einen nach europäischer Art geschnittenen, schwarzen Krimmer-Paletot, Pariser Bügelfaltenbeinkleider über den Lackgaloschen. Auch sein Gesicht war westlicher geschnitten als das des Andern: schmal, nervös, lebhaft, mit großen, grauen Augen. Der blonde Schnurrbart war auf englische Weise gestutzt. Darunter das ironische und liebenswürdige Lächeln eines Weltmanns. Der General Schiraj frug:
»Was ist das für ein Vogel da drüben?«
»Ein Vogel? Erbarmen Sie sich! Das ist doch Schjelting!«
»Schjelting?«
»Nun ja doch! Nicolai Wassiljewitsch Schjelting!«
»Nun weiß ich nicht mehr als vorher!« sagte der General ruhig.
»Gott schütze Sie, Pawel Antonowitsch! Man merkt, daß Sie acht Jahre in Transkaspien waren! Kommt zurück und hat nichts von Schjelting gehört!«
»Ein Russe?«
»Ein Russe durch und durch! Nehmen Sie sich in Acht: Sie stehen vor einem der gefährlichsten Männer Rußlands!«
Nicolai von Schjelting nickte den Herankommenden lächelnd über die Schulter zu. Er verabschiedete sich eben von einem baumlangen Flügeladjutanten aus dem Militärstaat des Zaren. Dieser Petersburger, auf dessen Antlitz der Asiatendünkel in breiten Lettern geschrieben stand, verbeugte sich beim Händeschütteln vor ihm tief. Dann wandte sich Schjelting zu den Andern und frug, sobald er den Namen des Generals erfahren:
»Nun – und die Afghanen? Sie stehen doch in Kuschk?«
»Ich befehligte dort! Aber vor zwei Jahren ...«
»... kamen Sie als Älterer Gehilfe nach Bochara! Verzeihen Sie! Ich vergaß ...«
»Aber woher wissen Sie überhaupt ...«
»Schjelting weiß Alles!« sagte der Hofmeister Morskoi.
»Man verfolgt wenigstens die Taten unserer Helden draußen!« versetzte Nicolai Schjelting. Es klang beinahe bescheiden. Der General lächelte geschmeichelt. Er frug: »Nun, und Sie nahmen nicht an dem Gottesdienst in der Kathedrale teil?« Und Schjelting zog, wie um Entschuldigung bittend, die Schultern hoch:
»Ich fühlte mich heute früh nicht wohl. Die ganze Nacht war ich wach. Morskoi da weiß es: ich kann seit Jahren nicht schlafen! Gott hat mich damit gestraft. Wenn andere Menschen schnarchen, liege ich mit offenen Augen, bis die Hähne krähen ...«
»Sollten da nicht die Ärzte ...?«
»Keiner kann mir helfen! Genug davon! Wie? Ob ich in Moskau bleibe? Nein: ich reiste zufällig durch ...«
›Zufällig, weil der Zar hier ist‹ ... dachte sich der General.
»... und fahre heute Abend wieder ins Ausland! Nach Belgien. Zu meiner Frau. Ich verabschiedete mich eben von einigen Freunden im Palais.«
Dies mächtige Palais da hinten, in dem, solange der purpurtragende Schatten und sein siecher Sohn darin weilten, die unsichtbaren Fäden aus Belgrad und Paris, aus Cettinje und London, aus Kopenhagen und Tokio zusammenliefen, in dem spitze, diamantengeschmückte Damenfinger die Schicksalsnetze der Völker knüpften und aufdröselten – dies Palais, das mit seinem Ränkegewirr der Vorzimmer, seinem Hauch von Blut und Mord um die Kremlmauern an ein orientalisches Serail erinnerte ... Die drei Männer schritten nebeneinander dem nächsten Ausgang, der Heiligen Pforte zu. Alle Drei entblößten vorher ihre Häupter, und in dem schneidenden Sturmwind, der ihnen in der düsteren Wölbung entgegenpfiff, raunte Morskoi dem General zu:
»Wissen Sie, was Schjelting ist? ... Er ist einer der Vertrauten des Großfürsten!«
»Nicolai Nicolajewitschs?«
»Nicolai Nicolajewitschs selber! Und ein Günstling der Montenegrinerinnen!«
Nie wären vornehme Russen ihrer Art sonst so lange zu Fuß gegangen. Aber in diesen Tagen war der Kreml für Fuhrwerk gesperrt. Erst unten auf dem Roten Platz, nahe der Kathedrale Iwans des Gräßlichen, hielten in langen Reihen die Wagen der Würdenträger. Nicolai Schjelting stieg in den seinen. Die Zigarette zwischen den Lippen, meinte er dabei in jener raschen und lächelnden Art, mit der er jeden Bekannten als Vertrauten zu behandeln schien:
»In den Adelsklub? Erbarmen Sie sich! Dort ist heute das ganze Gouvernement! Ich bekomme keinen Bissen in den Mund! Jeder redet mich an! Ich speise in Ruhe bei mir, im Petrowski Dwor! Auf Wiedersehen dort!«
Fast ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er davon. Die Aufforderung, mit ihm gemeinsam das Gabelfrühstück einzunehmen, dünkte ihm offenbar Auszeichnung genug. In der hinterher rasselnden Droschke schrie der General Schiraj seinem Begleiter zu:
»Belieben Sie ... Schjelting? Ist er Edelmann?«
»Vom Adel des Twer'schen Gouvernements. Er hat dort Güter.«
»Ich kannte die Familie bisher nicht!«
»Es sind nur Wenige! Sie sind ursprünglich – glaube ich – schwedischer Herkunft. Aber seit Peter dem Großen schon slawisch und orthodox.«
»Er scheint klug zu sein!«
»Gott gab ihn uns. Hätten wir nur mehr! In dieser Zeit! Wir stehen vor dem Kampf, der für ein Jahrhundert über Europa entscheidet.«
Der Generalmajor riß die schwarze Lammfellmütze vom Kopf. Rings auf der Straße bekreuzigte sich das Volk und kniete nieder. Das Bild der wundertätigen Iberischen Muttergottes zog in seiner vierspännigen, von barhäuptigem Kutscher und Spitzenreiter gelenkten Glaskarosse vorbei. Der Hofmeister sagte:
»Kennen Sie Krupensky? Den millionenreichen Holzhändler, der sich den Wolkenkratzer in der Twerskaja gebaut hat? Er gibt der Kirche zu verdienen. Jeden Tag läßt er sich das Bild an sein Krankenbett kommen!«
»Und geht es ihm schon besser?«
»Vorgestern lag er noch zwischen Tod und Leben. Auf alle Fälle hat er sich außerdem einen berühmten deutschen Arzt für schweres Geld eigens aus Wiesbaden hierher verschrieben!«
»Nun ... lassen wir ihn! Was ist dieser Schjelting denn eigentlich?«
»Nichts!«
»Nichts?«
»Das eben ist seine Stärke! Er hat keine Rangstufe. Keinen Titel. Keine Orden. Keine Vorgesetzten. Ist Niemandem verantwortlich. Niemandem Rechenschaft schuldig.«
»Was erstrebt er dann?«
»Wer kann es wissen? Vorläufig steht er im Dunkel. Hält sich bereit. Er kann ja warten. Ist unabhängig ... Sehr reich ...«
»Sind seine Güter so groß?«
»Wie denn? Klein und verwahrlost. Aber seine Frau ist eine Belgierin. Die Tochter des Hauses Lambert in Brüssel. Es ist da ein großes Eisenwerk, das ihrem Vater gehört. Und dessen Schwiegervater wieder ist der General de Rigolet in Paris. Uralt und lange außer Dienst. Aber sein Name gilt noch viel in der französischen Armee!« »Ich las erst neulich sein ›Manuel sur la tactique de l'artillerie‹ wieder,« sagte der General Schiraj. Sie fuhren durch die breite Twerskaja dahin. Kurze Zeit hindurch klang das Räderrasseln gedämpft. Stroh lag auf dem Pflaster. Hier, in seinem zehn Stockwerke hohen amerikanischen Geschäftspalast lag der ehemalige Bauer und fünfzigfache Millionär Krupensky auf den Tod. Gleich darauf hielt die Droschke vor dem Petrowski Dwor, dem altrussischen Gasthof zum Peter dem Großen, in dem nichts an den Europäischen Westen erinnerte, in dem man kein Wort außer Slawisch verstand und schlitzäugige Tataren in weißen Kitteln bedienten. Hier war man unter sich. Nur russische Militärs, Beamte, Edelleute vom Lande, russische Damen in grellen Kleidern und Parfumwolken, russische Offiziersburschen und Diener in kaukasischer Tracht im Flur. Außerdem aber waren da heute noch auf der Treppe Menschen aller Stände und Schichten Moskaus. Langbärtige Bauern in umgedrehten Schafpelzen, Handwerker im Gürtelrock, ein Gymnasiast in Uniform mit seinen Eltern, ein wirrmähniger Pope mit seiner kranken Frau, zwei blasse junge Cursistinnen, ein hustender Viertelsmeister in schmutzigem Dienstmantel. Leidende Gesichter, emporgerichtete Augen, die eine Tür im ersten Stockwerk suchten, vor der ein Kommissionär des Gasthofs Wache hielt. Unten wandte sich Morskoi brüsk an einen Geschäftsführer:
»Habt Ihr hier ein Nachtasyl eingerichtet – he? Was will das Volk?«
»Zu dem deutschen Arzt, Euer Hochwohlgeboren! Gospodin Krupensky hat unsere Paradezimmer für ihn gemietet, um ihn immer in der Nähe zu haben. Seit in den Zeitungen stand, daß der deutsche Arzt da ist, kommen die Kranken den ganzen Tag. Schon in aller Frühe um zehn Uhr halten die ersten Equipagen vor dem Peterhof!« »Equipagen – gut! Aber jage dieses Volk weg!«
»Wie darf ich denn, Euer Hochwohlgeboren? Der Deutsche will es so! Jeden Mittag hält er eine Sprechstunde für Arme!«
»Ein Narr! Kuriert Muschiks und Popen umsonst! Als ob es nicht genug davon gäbe!« sagte der General lachend und trat mit seinem Begleiter in die schwere byzantinische Pracht des Speisesaals. Ein huschender weißgekleideter Tatarenschwarm bediente da in einer Ecke Nicolai Schjelting und einen anderen Herrn. Die Beiden waren in ein tiefernstes Geraune verloren. Das glühend-heiße Weizenbrot erkaltete vor ihnen unbeachtet neben der wasserhellen Wodkaflasche und dem eisgekühlten Kaviarwännchen.
»Professor Korsakoff!« sagte der Hofmeister. »Unser großer Panslawist!«
Der Moskauer Hochschullehrer trug heute auch die schwarze am Kragen gestickte Uniform seiner Rangklasse. Er hatte ein slawisch-längliches Gesicht mit dünnem Kinnbart. Zwei fanatische blaue Augen flammten hinter der Goldbrille des schmächtigen Mannes. Seine Fingerspitzen waren gelb vom Zigarettenrauchen, die Nägel schwarz. Man sah es, als er nach russischem Brauch mit seiner eigenen Gabel in die Vorschmackbissen auf den Frühstücksplatten fuhr.
»Korsakoff kommt eben von seiner Rundreise durch Serbien!« erklärte Nicolai Schjelting nach der Begrüßung. »Alles steht dort gut!«
»Ihr sagt das immer! Aber nichts geschieht!«
»Es wird geschehen!«
»Was?«
Korsakoff, der Fanatiker, antwortete nicht. Auch Schjeltings Mienen waren undurchdringlich. Seltsame Dinge scheinen die Beiden zu wissen! dachte sich der General und forschte weiter. »Und wann?«
Jetzt hob der Professor den gelbsträhnigen Kopf.
»Was hilft das Reden! Gott liebt die Tat! Ehe das Korn von den Feldern ist, heben wir die Welt aus den Angeln!«
Ein Schweigen. Am Nebentisch nahmen Gäste Platz. Ein Herr und eine Dame. Nicolai Schjelting gähnte nervös.
»Vergeben Sie! Mein altes Übel – die Schlaflosigkeit ... die wache Nacht rächt sich! Kein Mittel hilft.«
»Nun, und jetzt eben ist doch hier über uns der deutsche Arzt ...«
Plötzlich richtete sich Nicolai von Schjelting auf. Der Anfall von Müdigkeit war vorbei.
»Der Deutsche! ... Das eben ist's: wo ist der Deutsche bei uns nicht? Da: belieben Sie zu hören: der Alte am Tisch neben uns spricht Deutsch! Wie kommt er hierher in diese Gostinitza? ... Wir dulden es! Wir dulden Alles! Unser Rubelkurs wird in Berlin gemacht. Unsere Hauptstadt trägt einen deutschen Namen ...«
»Selbst unser Herrscherhaus kam aus Deutschland!« sagte herantretend ein alter Herr mit hoher rechter Schulter, der mit seinem weißen Henriquatre wie ein stutzerhafter kleiner Marquis aussah. Schjelting reichte ihm im Sitzen flüchtig die Hand und sprach in einem weichen, reinen Französisch:
»Sie wissen, Knjäs: man nimmt Sie nicht ernst!«
Der Fürst Bulagin setzte sich und zwinkerte mit der trockenen Skepsis eines alten Parisers. Auch sein Französisch war wundervoll, so wie man es sonst nur noch am Louvre von den Schauspielern der Comédie Française hört.
»Eben ist der Colonel abgereist. Mit dem ersten Zug!«
Der ›Colonel‹ hieß in diesem vertrauten Kreis der Zar, weil er es bei seiner Thronbesteigung bis zum Obersten gebracht hatte. Die Stunde seiner Abfahrt war stets geheim. Ebenso, in welchem der drei einander folgenden Hofzüge er wirklich saß. Nun rollte er durch die Steppen nach Süden. Ganze Armeekorps säumten hunderte von Kilometern weit reihenweise die Geleise, zeigten ihrem Kriegsherrn den Rücken, wachten schußbereit, daß kein Untertan sich nahte. Der Fürst Bulagin hatte noch eine zweite Neuigkeit.
»Krupensky ist außer Lebensgefahr. Er hat vorhin schon dem Stadthauptmann eine halbe Million Rubel für das Findelhaus geschickt, um seine breite, russische Natur zu zeigen! Der Deutsche, der alte Teufelskerl, hat ihn wahrhaftig gerettet!«
Bei dem Wort ›Krupensky‹ hob der stille Herr am Nebentisch den schlichten, graubärtigen Kopf und lächelte. Vor ihm und seiner Tochter standen erwartungsvoll drei Tataren – Großvater, Vater und Enkel. Aber die Speisekarte war nur russisch. Für die Deutschen unverständlich.
»Was macht man nur, Inge?«
»Wie gestern! Ich tipp' auf irgend was! Wir lassen uns überraschen!«
Der Tatar begriff die Zeichensprache des jungen Mädchens, murmelte: »Ich höre!« und verschwand. Nebenan kehrten die Russen, der Sicherheit halber, zu ihrer Muttersprache zurück. Der Champagner begann ihre Gesichter zu röten. Korsakoff entzündete sich nervös Papyrossen zwischen den einzelnen Gängen und warf sie halb ausgeraucht hinter sich auf den Boden. Nicolai Schjelting sprach rasch, in einer lebhaften und einschmeichelnden Art, gewohnt, daß man ihm zuhörte.
»Zum Beispiel Morskoi führt den Titel ›Gofmester!‹ Warum Hofmeister? Ist die russische Sprache zu arm für einen Diener des Zaren? Müssen wir immer die Lehrlinge dieses kleinen Deutschlands sein – wir, die Herren zweier Weltteile, die Überwinder Napoleons, die Erben von Byzanz? Wie, Bulagin? Wir seien eher die Schuldknechte Frankreichs? Das ist wieder das falsche Denken des Westens. Im Gegenteil: Borgen macht stark! Wer ist stärker: wer Etwas hat oder wer Etwas will? Wir haben das französische Geld. Also müssen die Franzosen tun, was wir wollen!«
Die Russen um ihn lachten und tranken. Schjelting fuhr fort und sah dabei unwillkürlich das junge Mädchen am Nebentisch an.
»Es handelt sich um die Absetzung Europas. Europa ist ein überkommener Irrtum. Europa ist geographisch nichts als eine Halbinsel Asiens. Asien sind wir. Nach Europa kommen wir von dort des Abends müde heim, wie ein Mann nach seiner Tagesarbeit. Da wollen wir unsere Ruhe. Aber giebt es Ruhe mit Deutschland? ...«
»Nein! Da Deutschland seit 1870 ständig nach allen Seiten Krieg führt ..,« sagte der Knjäs Bulagin trocken. Schjelting überhörte es.
»Europa, in dem dies kleine Deutschland sich bläht, ist nur ein Zwischenfall. Asien ist die Wiege der Welt. Alle großen Religionen sind in ihm und an seinen Grenzen entstanden, alle Völkerstürme kamen von dort. Wir halten die Schlüssel Asiens. Uns ist es beschieden, den Westen auf sein winziges Maß zurecht zu rücken.«
»Der Westen ist faul!« sagte der General Schiraj.
»Er ist faul! Aber stört uns ein bischen Hautgout? Polen stank auch schon, als wir es tranchierten.«
»Haben wir es verdaut? Und die Finnen? Die Deutschen? Die Hebräer? Die Letten? Die Esthen? Die Tataren? Die Kaukasier? Sie liegen uns wie Steine im Magen.«
»Sie lieben den Widerspruch, Fürst Bulagin! Man kennt Sie! Da sehen Sie eben einen russischen Kaukasier!«
Nach wahrhaft russischem Brauch wurde das Schaschlik vom Koch selbst in Tscherkessentracht mit umgehängtem Säbel und aufgenähten Patronentaschen dem Gast in den Saal gebracht. Die beiden Deutschen musterten erstaunt den kriegerischen Kerl, der ihnen die Stäbe mit aufgespießten gerösteten Hammelstückchen vorlegte. Das junge Mädchen lachte vergnügt.
»Ein tolles Land!« sagte sie.
Nicolai Schjelting hatte sich wieder nach ihr umgewandt. Sie hatte freie und offene Züge und klare Augen. Schon an der reinen, frischen Hautfarbe erkannte man die Ausländerin. Die Russinnen hatten die Puderquaste immer zur Hand. Auch der verächtliche und lässige Gesichtsausdruck slawischer Schönheiten fehlte ihrer lachenden Unbefangenheit. Sie trug einen schwarz und weißgestreiften Reiserock und eine ebensolche Jacke. Auch noch die preußischen Farben, dachte Schjelting. Sie beachtete ihn nicht. Das ärgerte ihn. Er wußte nicht, warum ...
»Inge ... ob der Mann ein Trinkgeld nimmt?«
»Na, Vater ... ich möcht' mal den Menschen in Rußland sehen, der keins nimmt!«
Der bewaffnete Koch verbeugte sich tief und verschwand mit seinem Rubel. Schjelting sah immer noch gereizt hinüber und sagte sich: Eigentlich hat sie recht! Wir nehmen ja Alle! Der Geschäftsführer war an den Nebentisch getreten und begrüßte den alten Herrn. Dabei klang das russische Wort ›Exzellenz‹ wiederholt von seinen Lippen. Morskoi winkte ihn heran und frug halblaut:
»Wieso Exzellenz?«
»Der deutsche Arzt ist Exzellenz, Euer Hochwohlgeboren. Ich schickte selbst seinen Paß zur Polizei.«
»Wie heißt er?«
»Geheimrat Tillesen!«
»Sie sehen schlecht aus, Schjelting!« sagte der spöttische Fürst Bulagin. »Wenn die hohen Damen Sie nach dem Weltkrieg zum Minister machen, brauchen Sie Ihre Nerven! Lassen Sie sich rasch noch von dem Deutschen da nebenan kurieren, ehe Sie ihn und alle anderen Deutschen umbringen!«
»Ja, wahrlich, unsere Ärzte taugen nichts!« versetzte der General in seinem tiefen Baß.
»Und da ist wieder unser Kleinmut!« Ein plötzliches hochfahrendes Lächeln legte sich wie eine asiatische Tünche über Nicolai Schjeltings unruhige Züge. »Wieder der Deutsche in Ihnen, Pawel Antonowitsch! Die Deutschen verhexen die Welt. Sie erfüllen unsere Köpfe mit einem Nebel, und sie selber üben inzwischen Parademarsch. Gott will da endlich Klarheit. Wer groß ist, soll Großes tun. Wer klein ist, sich bescheiden. Was ist größer als unser heiliges Rußland? Was war je größer, seit es Menschen giebt, als dies Reich von der chinesischen Mauer bis nahe an Berlin? Fünf Meere umspülen unsere Küsten. Walfische blasen an der einen, Orangenbäume blühen an der andern. Einhundertundsiebzig Millionen Menschen gehorchen dem Weißen Zaren. Nußland und Unermeßlichkeit ist Eins. Der Muschik ist der Erderoberer. ›Mir‹ heißt Dorfgemeinde und Welt.«
Außen, an einem der ebenerdigen Fenster des asiatischen Luxushotels bewegten sich zwei bloße Armstumpfe. Dazwischen ein nasenloses Gesicht. Das Wimmern der Bettler drang durch die Glasscheiben. Der Gelehrte aus Wiesbaden sah prüfend auf dies Häuflein Aussatz und Ekel da draußen, mit der Ruhe des deutschen Forschers, für den der Kolibri nicht schön ist und die Kröte nicht häßlich, die Mücke nicht klein und die Milchstraße nicht groß, sondern alle Dinge nur ein Weg zur Erkenntnis. Auch das junge Mädchen zeigte keinen Widerwillen. Sie schien an derlei gewöhnt, eine Gehilfin ihres Vaters. Sie sagte nur halb mitleidig: »Gott ... ja: Rußland ...« Ihre Teilnahme machte Schjelting wütend.
»Schaffe dies Gesindel fort!« herrschte er den nächsten Tataren an. Dann zu den Anderen: »Belieben Sie einmal einen Blick auf die Landkarte zu werfen: Wie groß ist denn dieses Preußen? Ein halb Dutzend von unsern Gouvernements! Ein paar Ellen Küste, die ihm die Engländer sperren. Nicht genug Brot ohne uns. Frankreich, dies furchtbare Frankreich vor dem Tor. Ein solches Dreigespann von Großmächten ...« Er verfiel plötzlich, mit einer blasierten Handbewegung in Französisch: »Quinze jours, mon prince! Je vous assure: pas plus!«
»Und die Kultur, die da zu Grunde geht?«
»Kultur? Das ist wieder eine Suggestion des Westens! Werden Sie von Kant satt? Schlafen Sie besser nach Bismarcks Reden? Was heißt Kultur? Kann man sie essen? Kann man sie trinken? Schützt sie gegen Winterkälte? Gegen Alter und Tod? Glücklich ist, wer nicht lesen und schreiben kann – keine anderen Bedürfnisse kennt, als die er zu stillen vermag! Unser Muschik!«
»Nun – da ist er ja!«
Draußen auf der Straße fuhr ein Leiterwagen vorbei. Ein Dutzend Bauern lagen kreuz und quer wie die Mehlsäcke darauf, mit offenem Mund, verglasten Augen, einer mit dunklem Blut im Bart.
»Unglaublich, diese Masse Betrunkener hierzulande, Vater, nicht?«
»Ja, Inge!«
Schjelting sagte sich ärgerlich: Die Polizei brauchte die Kerle auch nicht grade vor den Augen der Deutschen zu sammeln und auf die Wache zu führen. Dann verloren sich seine Gedanken: Eigentlich ist dies Mädchen drüben hübsch ... Es fiel ihm auf, wie er jetzt von der Seite ihr schönes Profil mit dem dunkelblonden Haar sah. Er kam zu sich und wandte sich jäh zu den Andern:
»Mag auch bei uns manches faul sein! Gut! Umsomehr brauchen wir den Krieg. Zur Ableitung. Die Bombe, die über die Weichsel fliegt, platzt nicht in Petersburg!«
Korsakoffs Augen glühten wie zwei blaue Kohlen. Er hob den gelblichen Zeigefinger:
»So ist es! Und mehr: denkt nicht nur an uns, sondern an unsere slawischen Brüder. Der Balkan ruft mit tausend Stimmen. Er ruft uns bei Tag und Nacht ...«
»Zum Spaziergang zur Adria!« sprach der General Schiraj und reckte sich in den breiten Schultern. Der Kellner schob die vierte Champagnerflasche in den Eiskühler. Die zweite Likörflasche auf dem Nachtisch war schon halbgeleert, jeder mit Ausnahme Schjeltings hatte schon seine zehn, zwölf Schnäpse im Leibe. Auf der Straße entstand ein wirres Geschrei ... Hufschläge ... ein paar Kosacken jagten vorbei. Sie schleiften einen barhäuptigen, jungen Menschen in grüner Studentenuniform neben sich durch den Straßenschmutz, schlugen auf ihn ein, die rechte Seite seines herabhängenden Kopfes war scharlachrot. Auf der langen Blutspur hinter ihm liefen andere Hochschüler und junge Frauen und schrien und drohten mit geballten Fäusten und leidenschaftlich verzerrten Gesichtern den Kosacken.
»Übelgesinnte, Euer Hochwohlgeboren!« meldete der Tatar, den Champagner in die Kelche füllend. »Sie versuchten, das Volk beim Durchzug der ›Unglücklichen‹ aufzuwiegeln!«
Die Russen rauchten ruhig. Derlei gehörte zu Moskau und Petersburg wie Schnee und Wind. Nur Schjelting vernahm nebenan ein helles, diesmal von wirklichem Grauen erfülltes:
»Furchtbar ...« Dabei stand sie mit dem Geheimrat Tillesen auf. Nun sah er, daß sie groß und schlank gewachsen war, wohl einen halben Kopf länger als der unscheinbare, stille Gelehrte neben ihr. Eben wollten sie zahlen – da nahte es da draußen, was Nicolai Schjelting schon die ganze letzte Zeit unruhig von ihren Augen weggewünscht hatte: die ›Unglücklichen‹ kamen, auf dem Weg nach Sibirien. Ein langer, langer Zug. Kerkerbleiche Gesichter. Kettengeklirr unter den Sträflingskleidern. Alt und Jung. Neben den Männern auch Frauen. Stumpfe Soldaten in schmutzigen Mänteln und Mützen, rechts und links. Viele der Begegnenden bekreuzigten und verbeugten sich, wateten auf die Straße und steckten den Gefangenen Almosen zu. Dumpf klang ihr: » z'bogóm! z'bogóm! Mit Gott!« Wie eine graue Luftspiegelung unter dem grauen Himmel zog der Zug der Verbannten vorbei, verschwand auf seinem weiten Weg bis zu den Bergwerken und Einöden Asiens.
»Schade, daß das die unerlösten Brüder auf dem Balkan nicht auch sehen!« sagte der unverbesserliche Bulagin.
»Genug, Fürst! Sie sind kein echter Russe!«
»Nun – ich bin aus Ruriks Stamm!«
»Dann vorwärts, Knjäs!« Korsakoff stand auf und stürzte ein Glas Sekt hinunter. »Rußland vom Stillen Ozean bis zur Adria!«
»Also wollt Ihr wirklich den Weltkrieg?«
Nicolai von Schjelting sah um sich. Die beiden Deutschen waren verschwunden. Er sagte lächelnd:
»Vor hundert Jahren haben wir Moskau angezündet. Warum sollen wir nicht auch einmal die Welt anzünden? Unser Mütterchen Moskau ist schöner wieder auferstanden. Auch die Welt wird schöner auferstehen!«
»Und die Millionen von Menschenleben?«
»Einmal würden sie doch sterben!«
»Und die Milliarden von Geld?« »Gehören sie uns? Wir haben ja nur Schulden!«
»Die Zerstörung von Hab und Gut!«
»... beim Feind, Fürst Bulagin!«
»Denken Sie an das Testament der Alten Katharina!« schrie Korsakoff. Auch der General sprang empor.
»Noch steht das Kreuz nicht auf der Hagia Sophia!«
»Aber der Weg nach Stambul führt über Wien!« rief Morskoi.
»Nein. Über Berlin!«
Schjelting sagte es. Er war allein ruhig sitzen geblieben und reichte so den Anderen die Hand zum Abschied. Der General Schiraj dachte sich dabei: Nun, mein Lieber, dumm bist Du freilich nicht! Aber Dich reitet der Ehrgeiz und Dein Pferdchen wiederum heißt Rußland! Und der Hofmeister meinte, halb im Scherz, halb im Ernst: »Vergessen Sie uns, Ihre Freunde, nicht, wenn Sie nach dem Sieg Minister sind!«
»Leben Sie wohl!«
»Grüßen Sie Paris!«
Allein geblieben, saß Nicolai Schjelting noch eine Weile da und rauchte. Dabei fuhr er ein paarmal mit der Hand über die geschlossenen Augen. Es war eine unwillkürliche Gebärde der Ermüdung. Nun kam der Rückschlag nach der schlechten Nacht. Er dachte sich: Heute und morgen und übermorgen wirst Du auf der Eisenbahn wieder nicht schlafen, bist bei der Ankunft in Paris bei wichtigen Geschäften und Geheimnissen matt und abgespannt. Bei den Boulevards fiel ihm Bulagin ein. Der alte Bajazzo hatte recht: auf dem Weg über Leichen brauchte man seine Nerven ... Er schrieb zerstreut eine Depesche an seine Frau: A Mme Ghislaine de Schjelting, née Lambert à Bruxelles, Boulevard du Régent 311, meldete, daß er sich noch ein paar Tage an der Seine aufhalten und dort auch ihren Großvater, den alten General de Rigolet, treffen würde, ehe er nach Belgien käme, und unterschrieb mit dem gewohnten kühlen und flüchtigen: ›Toujours à vous. Nicolai.‹
Es war der Ton zwischen ihnen. Dann gähnte er und stand auf. Die Stühle am Nebentisch waren leer. Da hatte dieser alte Deutsche gesessen. Eine Exzellenz. Also sicher einer der ersten Ärzte seines Landes. Und für so etwas waren diese Deutschen doch schließlich gut ...
Die Treppe war jetzt frei von den Patienten, die vor ein paar Stunden da wie die Bittsteller Reihen gebildet hatten. Jetzt traf man den Alten allein. Das war wie ein Wink des Schicksals. Vielleicht wollte er später, nach dem Krieg, keine Russen mehr behandeln. Man mußte die Zeit nutzen. Nahm sich ein Rezept mit. Möglicherweise half es doch. Schjelting klopfte kurz entschlossen und öffnete fast zugleich. Im Vorzimmer saß nicht, wie er erwartet, ein Diener, sondern das junge Mädchen von vorhin. Sie legte den Federhalter neben den angefangenen Brief und hob die Hand.
»Pst!«
»Was denn?«
»Leise! Mein Vater schläft nebenan!«
Schjelting blieb ärgerlich stehen. Sie musterte ihn mit einer halb fragenden Wendung des Halses.
»Was wünschen Sie, bitte?«
»Ich möchte den Doktor konsultieren!«
»Sie meinen Seine Exzellenz, Herrn Geheimrat Tillesen?«
»Nun ja – die Exzellenz! Ich werde in einer Stunde wiederkommen!«
»Es tut mir leid! Heute ist es zu spät!«
»Wie denn: zu spät? Ein Arzt ist für die Kranken da!«
»In der Sprechstunde. Die ist von zehn bis zwölf.«
Überall im Zimmer standen Geschenke reicher russischer Patienten. Bunte Tula-Arbeiten, silberne Becher, kaukasischer Zierrat. »Und Schlag Eins mache ich auch mit der Poliklinik Schluß. Mein Vater wird nächstens Sechzig. Er braucht seine Ruhe!«
Nicolai Schjelting liebte keinen Widerstand. Im Gegenteil: ›dann grade‹! Er sagte in seinem reinen, tadellosen Deutsch, in dem nur die harte Aussprache den Russen verriet:
»Nun – man wird mit mir eine Ausnahme machen!«
»Warum gerade mit Ihnen?«
»Weil ich in ein paar Stunden ins Ausland reise!«
»Dann müssen Sie das eben auf morgen verschieben!«
»Wie kann ich das? Äußerst wichtige Dinge rufen mich!«
Er dachte sich: ›Dinge gegen Euch Deutsche! Dabei stehe ich hier vor dieser Deutschen und bitte. Was ist das mit mir?‹
»So kommen Sie nach Wiesbaden! Dort steht mein Vater jedem Patienten zur Verfügung.«
»So lange zu warten ist nicht meine Sache!«
»Dann vermag ich Ihnen zu meinem Bedauern nicht zu helfen.«
»Mit mir steht es aber schlimm! Belieben Sie zu begreifen: ich kann nicht schlafen! Also bitte, melden Sie mich!«
»Mir ist es im Augenblick wichtiger, daß mein Vater schläft, als daß Sie schlafen. Das können Sie mir als Tochter wirklich nicht übel nehmen!«
Durch ihre Worte klang immer dieselbe freundliche Entschiedenheit, die ihn so ärgerte. Er entnahm seiner Brieftasche fünf Regenbogenscheine und legte sie auf den Tisch.
»Hier sind fünfhundert Rubel! Ist das genug?«
Nun stand das junge Mädchen auf. Er sah wieder, wie groß und schlank sie war. Beinah so groß wie er. Eine feine Röte des Unmuts überflog eine Sekunde ihre hübschen Züge. Aber sie blieb ganz gelassen:
»Also nicht wahr: Sie stecken das da wieder ein? Das hat doch gar keinen Zweck! Das müssen Sie sich doch selber sagen!«
»Also tausend Rubel!«
»Herr Krupensky hat hunderttausend Mark auf der Bank hinterlegt, damit mein Vater überhaupt nur hierherkam. Was denken Sie denn von uns?«
Nicolai Schjelting schwieg und schob die Scheine in die Hosentasche. Nun kamen ihm, dem Mann von westlicher Bildung, doch wieder die Maße zu Bewußtsein, in denen ein deutscher Fürst der Wissenschaft lebte. Aber er war wütend auf das junge Mädchen, das zwischen ihm und der Nebentür stand. Er ging, in der plötzlichen herrischen Aufwallung eines vornehmen Russen einfach auf diese Türe zu, um sie zu öffnen. Aber sofort trat sie davor und ihr ›Bitte!‹ klang trotz aller Höflichkeit so ernst und bestimmt, daß er wieder stehen blieb und die Achseln zuckte. Eigentlich war es für ihn, Nicolai von Schjelting, unter seiner Würde, hier zu streiten. Aber er konnte sich doch nicht enthalten zu sagen:
»Gut! Man hätte es wissen können! Wer mit Deutschen zu tun hat, stößt überall auf dieselbe Kleinlichkeit. Überall auf der Welt machen sich die Deutschen verhaßt. Sie werden's noch einmal büßen!«
Er frug sich selber dabei: ›Was sind das für Geschichten? Was schlage ich mich hier mit einer beliebigen Deutschen herum? Ein Mann, wie ich?‹ Es machte auf sie auch gar keinen Eindruck. Sie lachte nur hell und sah dabei reizend aus in ihrer blonden Jugend.
»So? Nun, wir fürchten uns nicht! Adieu!«
Als er mit der hochmütigen Andeutung einer Verbeugung das Zimmer verlassen hatte, setzte sich Inge Tillesen wieder an den Tisch und schrieb weiter:
»... Ich wurde eben unterbrochen. Ein Stück Halbasien kam herein. Die Unkultur auf zwei Beinen, das heißt äußerlich natürlich höchst elegant und also um so unverschämter. Ich mache eben das Fenster auf. Er hat so einen merkwürdigen Geruch von Zigaretten, Kölnisch Wasser und ganz seinem Juchten hinterlassen.
So! Also, lieber Freund, hier merkt man nicht das Geringste von Truppenbewegungen. Überall Ruhe. Tiefster Friede. Aber sonst ein Land, von dem man noch nach Jahren im Traum Alpdrücken kriegen kann. Es bestärkt Einen zum Glück in seiner Anschauung. Es ist die Verläugnung jeder Freiheit, und Sie wissen, wie sehr ich für die Freiheit jedes Menschen bin! Der Mensch ist, nach meiner Meinung, in erster Linie für sich selber auf der Welt!
Das ist ja der alte, ewige Streit zwischen uns, seit ich aus Amerika zurück bin. Ich hab' so gar keine Hoffnung mehr, daß wir da je zusammenkommen können! Sie schreiben: Im Wort ›Pflicht‹ steckt das Wort ›Ich‹ darin. Ich schreibe wieder: Für mich fangen Freiheit und Frau mit denselben Buchstaben an. Natürlich giebt es Pflichten. Aber selbstgewählte. Keine überkommenen. Keinen Zwang. Da draußen reiten eben wieder die Kosacken.
Aber solchen Unterschied in der Weltanschauung kann man sich die Finger wund schreiben und bleibt doch auf demselben Standpunkt: Sie auf Ihrem: ›Ich dien‹! und ich auf meinem: ›Ich bin ich!‹ Wir müssen uns jetzt einmal endgiltig aussprechen, wenn Sie nach Ostern auf Urlaub zu Ihren Eltern nach Wiesbaden kommen. Ich bestehe darauf. Es geht so nicht weiter. Mit uns Beiden nicht. Für heut Schluß. Ich habe keine Zeit mehr. Sie sehen, ich lade mir freiwillig Verantwortung genug auf. Ich muß jetzt meinen Vater mobil machen, daß er nach seinem russischen Krösus sieht. Wir haben ihn glücklich durchgebracht! Also bald auf Wiedersehen in Wiesbaden.
Ihre
Inge Tillesen.«
Sie schrieb die Adresse: ›Herrn Hauptmann Paul Isebrink, Berlin, Alt-Moabit 330‹ und hielt das Schreiben in der Hand, während sie ihren Vater zu dem nahen, über Hütten und Holzpalästen sich auftürmenden Wolkenkratzer des Kaufmanns Erster Gilde Krupensky begleitete. Die breite Twerskaja war noch zu Ehren der Anwesenheit des Zaren in der von der Polizei vorgeschriebenen Zahl und Art der Fahnen beflaggt, ebenso wie die Iljinka und Morossejka, die Warwarka und die anderen Verkehrsadern, die Nicolaus II. auf dem Weg zum Nowgoroder Bahnhof möglicherweise wählen konnte. Dazwischen waren große, ganz schmucklose Straßenzüge. Der Befehl an die Dworniks zum Aushängen der Landesfarben war wie immer strichweise gleich einem Hagelschlag gegangen. Wieder läuteten nah und fern die Glocken der unzähligen Kirchen und Klöster einen der unzähligen Feiertage ein. Beter knieten an den Straßenecken, das bärtige Gesicht nach irgend einem unsichtbaren Heiligtum gewendet, eine krankhafte byzantinische Frömmigkeit fieberte in der sturmerfüllten kalten Frühlingsluft. Der Geheimrat Tillesen sah gedankenvoll auf diese Kosacken und Popen, Tschinowniks und Muschiks.
»Wann waren wir eigentlich zuletzt unterwegs, Inge?«
»Vorigen Herbst, Vater. In Madrid!«
»War das nicht schon im Sommer?«
»Da waren wir doch in Stockholm! ... Halt ... halt ... da ist doch schon das Haus! Nun wärst Du doch richtig wieder in Deinen Gedanken ruhig weitermarschiert ohne mich!«
Der Gelehrte blieb auf dem strohbelegten Bürgersteig stehen. Ringsum war alles fremdartig, die Gesichter, die unverständlichen Ladenaufschriften, die unlesbaren Straßennamen an den Ecken.
»Schließlich werd' ich doch einmal ohne Dich gehen müssen, Inge!«
»Wieso?«
»Deine beiden Schwestern sind längst schon verheiratet. Nun bist Du daran!«
»Oh, ich hab' Zeit!«
»Du wirst doch fünfundzwanzig!«
»Sogar sechsundzwanzig! Das Alter Deiner Töchter merkst Du Dir nie!«
»Nun eben!«
Sie lachte. »Warum schaust Du mich denn so kummervoll an?«
»Das kommt davon, wenn man Witwer ist, Inge! Ich hätte Dich nicht so lange nach Amerika lassen sollen. Die zwei Jahre in Boston waren für Dich viel zu viel!«
»Ich finde, sie haben mir sehr gut getan!«
»Du bist innerlich viel zu unabhängig geworden! ... Amerika ist nicht Deutschland ... Nun ... ich muß jetzt da hinauf ...«
»Ich bringe unterdessen Deine Bestecke in Ordnung und schreib' für Dich Briefe. Auf Wiedersehen!«
»Barinja! Barinja!« schrieen aufmunternd am Straßenrand die struppigen, dick wattierten Droschkenkutscher. Sie begriffen nicht, daß eine vornehme Dame zu Fuß ging, straff und flott, mit hochgehobenem blondem Kopf, viel rascher als die schwerfällig stapfenden Russinnen.
»Herrin! Belieben Sie!«
Inge Tillesen lachte zu dem Gebrüll der Kerle und schritt elastisch die kurze Strecke bis zu dem Hof Peters des Großen zurück. Im Vorraum des Hotels lag ein kleiner Berg von Koffern, Kissen, Reisematratzen, Decken. Nicolai von Schjelting stand dahinter, in Pelz und Mütze, die Zigarette zwischen den Lippen, und jagte ungeduldig die silberbetreßten Schweizer, die weißkitteligen Tataren und rothemdigen Hausknechte hin und her. Erst schien es, als hielte er es für unnötig zu grüßen. Dann tat er es plötzlich doch, mit einem zerstreuten Lächeln, und ärgerte sich über ihre kühle Kopfneigung und dachte sich, während sie die Treppe hinaufstieg: Nun – was geht sie mich an?
Draußen hielt schon der Lichátsch, der Luxuskutscher. Im zweiten Gefährt folgte der Kammerdiener mit dem Gepäck. Mit sausenden Rädern ging es durch spritzenden Eisschlamm hinaus zum Smolensker Bahnhof. Das eigene breite Abteil war schon bereitet, der Samowar brodelte in der Gang-Nische, der Wagenwärter verbeugte sich tief. Der Zug rollte hinaus in die bleichen Schneefelder, die weiß überfrorenen Sümpfe, die silberstämmigen, niederen, endlosen Birkenwälder. Da war das Schlachtfeld von Borodino. Man war damals mit dem ganzen Westen fertig geworden – wie jetzt nicht mit dem einen Nachbar? Nicolai Schjelting liebte, als ein Mann von umfassender Bildung, die geschichtlichen Belege seiner Weltanschauung, verdankte ihrer lebhaft vorgetragenen Beweiskraft einen Teil des Einflusses, den er auf Andere, und namentlich auf die politisierenden Petersburger Damen ausübte. Er saß und rauchte, um die nervöse Ungeduld der langsamen Fahrt zu beschwichtigen. Es dämmerte über den weiten Steppen. Der Oberkonduktor klopfte ehrerbietig und überwachte persönlich das Anzünden der Stearinkerzen. Nun war es draußen dunkle Nacht. Aber von Schlaf keine Rede. Schjelting fuhr sich mit der Hand über die Augen. Er dachte sich grimmig: ›Die Pest über diesen alten Deutschen! Einem Krupensky hilft er, einem halben Vieh vom Ural, das noch den Zucker abbeißt und den Tee aus der Untertasse schlürft. Mir nicht! Die Tochter verhindert es. Sie hat ihm überhaupt nicht gesagt, daß ich da war!‹
In der langen Weile der schlaflosen Nacht sann er darüber nach, was ihre Augen eigentlich für eine Farbe hatten. Komisch: sonst sah er sie leibhaftig vor sich. Aber das wußte er nicht. Er warf die Zigarette weg und frug sich: Was Teufel hast Du daran zu denken? Das eintönige Rollen der Räder lullte doch ein. Aber bald fuhr er wieder aus unruhigem Halbschlummer auf. Man hielt mitten in der Nacht auf irgend einer Station. Es war ein Laufen auf den hohen Holzplanken des Bahnsteigs. Auf dem Nebengeleise hielt ein endloser Zug, der hier den Schnellzug nach Warschau an sich vorbeiließ. In hundert matterleuchteten Wagen drängten sich Tausende von schlafenden Soldaten in feldbraunen Mänteln. Stumpfe, breitknochige Gesichter. Typen des fernen Ostens. Nicolai Schjelting lächelte befriedigt, während er im Weiterrollen den Militärzug hinter sich ließ. Der fuhr nur des Nachts. Die Bahngebäude lagen überall eine Stunde von den Städten entfernt. Die Deutschen brauchten nicht Alles zu wissen, was im Heiligen Rußland vorging. Hier und überall, wo das Eis brach und der Schnee schmolz, rüsteten sich die Regimenter des Zaren zu den großen ›Manövern‹ im Westen. Bald war man aus den weitesten Weiten unterwegs, von den Grenzen des Hindukusch und den Steppen der Mongolei, vom Fuß des Elbrus und dem Nördlichen Eismeer, eine Völkerwanderung in Waffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen.
Über Nicolai Schjelting kam wieder der asiatische Rausch. Unruhig drehte er sich eine neue Zigarette. Seine Augen flackerten. Er unter Wenigen kannte die unwahrscheinliche Zahl von Millionen, die man aufbot. Wer konnte dem Sturm widerstehen? Der Sturm blies dies morsche Europa in Fetzen, trug die, die ihn entfesselt hatten, auf seinen Schwingen empor zu den Sternen.
Ein neuer Tag. Wieder der Abend. Unendlich war dies Rußland. Die zweite Nacht ohne Schlaf, dank diesem Deutschen und seiner Tochter Inge. Ingeborg. Ein recht deutscher Name. Was sie blos für Augen hatte? ... Ein Auffahren: endlich Warschau. Im Mondschein der breite lehmfarbene Schwall der Weichsel. Noch einige Stunden ...
Helle, scharfe Rufe, wie auf dem Exerzierplatz, im Morgendämmern, ein kurzes, sicheres Zugreifen der Gepäckträger, straff aufgerichtete Beamte, ein Hauch von Befehlen und Gehorchen in der Luft: die deutsche Grenze. Der Hauptbahnhof von Thorn. Noch jenseits der hochtürmigen alten Stadt auf dem linken Stromufer.
Zwei Säbel klirrten draußen vorbei. Frische lachende preußische Leutnantsstimmen:
»Na – wo kommen denn Sie in aller Gottesfrühe her?«
»Nachtübungen auf dem Artillerieschießplatz. Und Sie?«
»Ronde! Vom Fort Ulrich von Jungingen!«
Ulrich von Jungingen, der Heermeister in der Schlacht bei Tannenberg. Nicolai von Schjelting ging es durch den Kopf: Damals wurden die Deutschen von den Polen bis zur Vernichtung geschlagen.
Er nahm in dem deutschen Abteil Platz und dachte sich im Weiterfahren: Auch die Polen waren Slawen, wie wir. Vielleicht kommt auch für uns einmal die Schlacht von Tannenberg ...
II.
Man hätte glauben können, es sei der Zar, der an diesem heißen Frühlingstag, zu Ende April, vom jungen Grün der Avenue Gabriel her, umdonnert vom Jubelsturm eines schwarzen Menschenmeers über den Concordienplatz seinen Einzug in Paris hielt. Aber es war nicht der schattenhafte Selbstherrscher aller Reußen, sondern der zweite Herr der Erde, sein gekrönter Vetter von Großbritannien, ihm zum Verwechseln ähnlich, mit unbedeutenden Zügen über kurzem, blondem Vollbart, leerem Lächeln, wie jener ein Fleisch gewordener Widerspruch zur Macht über die halbe Menschheit.
»Vive l'Angleterre!«
Es rollte wie Donner über die weite Fläche. Von den Jahrtausenden ihres Luxor-Obelisks sahen Ra und Thot, Anubis und Nephtat auf das Schneeflockengewimmel wehender Tücher und weißer Menschengesichter. Die Sonne funkelte im Silberspiel auf den Helmen und Kürassen der Gepanzerten, die in langem Zug der vierspännigen Karosse des Kaisers von Indien vorausritten. Er dankte verlegen freundlich rechts und links den Huldigungen. Madame Poincaré saß neben ihm.
»Vive Poincaré!«
Im nächsten Wagen folgte der Präsident der Republik mit der Königin von England. Sein kantiger Lothringer Kopf strahlte von befriedigter Eitelkeit. Wie er sich da selbstgefällig in seiner Volkstümlichkeit sonnte, verkörperte sich in ihm die Republik der Rechtsanwälte und Kammerredner, das fünfzigjährige Reich der Phrase. Doppelreihen von roten Käppis und Hosen und blauen Schwalbenschwänzen schieden seinen Triumphzug von dem dahinter jubelnden Volk. ›Die große Stumme‹, die Armee, hielt Wacht.
»Vive la Russie! Vive l' Angleterre!«
Vergessen Krim und Beresina! Wo war jetzt Abukir und Trafalgar, Waterloo und Faschoda! Aus allen Fenstern blähten sich nebeneinander Union Jack und Tricolore, flatterten von den Dächern, grüßten mit tausend Wimpeln über das Häusermeer an der Seine. Ein Fieberrausch von Festfarben, Frühlingshitze, Zukunftshoffnung über Paris. Das aufgeregte Summen und Wirren eines hitzigen, stechlustigen millionenfachen Bienenschwarms. Drüben, auf der Vendôme-Säule, schaute hoch vom blauen Himmel der kleine Erderoberer in Cäsarentracht hernieder auf sein wimmelndes Reich.
Der Chef des Militärstaates des Präsidenten lenkte sein Roß auf die Konkordienbrücke und führte den Zug hinüber nach dem rechten Seine-Ufer. Auf dem Platz dahinter lösten sich die Spaliere. Die Menge wogte um die glitzernden Springbrunnenstrahlen. Seitwärts, nahe der englischen Botschaft, marschierte ein Regiment, von der Parade kommend, vorbei. Ah – diese braven 102ten von der Linie! Die Hüte hoben sich vor der Fahne, die Frauen winkten gerührt und warfen ihr Kußhände zu, der Taktstock zuckte über den Köpfen: in wildem schmetterndem Jubel setzte es ein, riß die Herzen mit sich fort, der Traum der Weltherrschaft rauschte aus dem Schreien der Hörner, dem Wirbeln der Trommeln, dem Gellen der Trompeten, dem Donner des Paukenschlags: »Allons, enfants de la patrie!« Hunderte von Stimmen sangen es mit:
»Auf, Kinder Frankreichs, zu den Waffen! Der Tag des Ruhms ist wieder da!«
»Noch nicht da! Aber nah!« sagte der General de Rigolet de Mezeyrac. Er war ein starker Siebziger und schon lange nicht mehr im Dienst. Die weiße Frühlingsweste wölbte sich, vom roten Bändchen der Ehrenlegion im Knopfloch seines Schoßrocks überflimmert, über seinem kleinen, gallisch-rundlichen Leib. Aber auch in seinen Augen glühte über dem schneeweißen Henriquatre der Massenrausch der Marseillaise.
»Hoffentlich nahe, mein General!«
Er und der Oberstleutnant Grégoire standen an der Ecke des Platzes vor einer Insel der Trauer inmitten des allgemeinen Festjubels. Kränze mit schwarzen Schleifen türmten sich da vor einem Sockel, Herren in Zylinder bückten sich stumm mit umflorten Blumen, Damen knüpften sich mit theatralischer Pose das Veilchensträußchen von der Brust, führten es an die Lippen und legten es schmerzlich nieder.
Auch der General de Rigolet de Mezeyrac schwenkte seinen Hut und begrüßte mit einer großen Geste das Standbild der Stadt Straßburg, dessen Elsässerhaube dunkel, beinahe unheimlich, die Franzosen unten überschattete.
»Wo frühstücken Sie, mein General?«
»Im Cercle National! Ich erwarte dort den Mann meiner Enkelin, Nicolai Schjelting!«
»Oh ... der Vielgenannte!«
»Er muß heute früh in Paris angekommen sein.«
»Mit den letzten Nachrichten unserer bewunderungswürdigen russischen Freunde! Ich beglückwünsche Sie, mein General!«
»Leider mußte er einige Zeit unterwegs in Berlin Rast machen. Er fühlte sich nicht wohl!«
»Wir werden ihn dies Berlin vergessen lassen! Er kommt grade noch zu unseren Festen zurecht!«
»Er fährt, glaube ich, heute noch nach Brüssel zu seiner Frau und ihren Eltern. Dieser gute Nicolai ist kein Mann der Feste und der Öffentlichkeit. Er wirkt im Stillen!«
»...bis wir ihn eines Tages hier als Nachfolger Iswolskys begrüßen!« sagte der Oberstleutnant Grégoire. Er war als Mitglied des mächtigen zweiten Büros der administrativen Sektion des französischen Generalstabs in manche Geheimnisse eingeweiht. Der General lächelte. Er hörte es gern. Es war keine leere Schmeichelei. Es lag im Bereich der Möglichkeit... an jenem Tag, da keine Trauerkränze mehr zu den Füßen der Stadt Straßburg lagen...
Sie gingen die Rue Royale hinauf, an den gepuderten Dirnen und den übernächtigen Kellnerfratzen der Bar Maxim vorbei. An der Madeleine-Kirche zog der General den Hut vor ein paar Priestern oben auf den Stufen. Er war ein Mann der alten Schule und versäumte nie seine Messe. Nicht nur die Altersgrenze, sondern auch die Freimaurer in der Armee hatten ihm das Genick gebrochen. Er sprach das barsch und offen aus, oft mitten in dem großen Offizierskasino der Armee und Marine, in dem er jetzt nach dem Mann seiner Enkelin frug.
Nein! Monsieur de Schjelting war noch nicht dagewesen.
Das große Gebäude an der Ecke der Rue de la Paix war heute voll Trubel und Leben. Viel mehr Uniformen unter dem Zivil als sonst. Darunter auch fremdartige von England. Ein scharlachroter, baumlanger Coldstream-Gardist mit einem Turm von einer Bärenmütze, neben dem ein schwarzverschnürter, französischer Hauptmann winzig aussah, ein milchbärtiger Lord von einem der schottischen Hochland-Regimenter mit gewürfeltem Rock und nackten Knieen. Der alte Rigolet schmunzelte:
»Arme Burschen! Sie lieben sich und können es sich nicht sagen!«
Ein indischer Fürst in rotem Turban stand, von den Briten mitgebracht, vor dem Araberscheich eines Spahi-Regiments mit dem Orden der Ehrenlegion auf dem weißen Burnus. Der Afrikaner verstand nur französisch, der Asiate nur englisch. Die beiden bräunlichen Männer lächelten sich unsicher inmitten ihrer Zwingherren an. Ringsum ein Stimmengeschwirr der Offiziere.
»Was war im Salon ausgestellt? Eine Büste Wilhelms II.?«
»Ah! Hört Ihr's?«
»Erledigt! Die Direktion wich der Entrüstung und hat sie entfernt!«
»Bravo!«
»Befreit uns lieber von diesem Jaurès!« sprach düster der schwarzbärtige Kapitän Antonelli, ein Korse.
»Auch seine Zeit wird kommen!«
»Wie ist das eigentlich mit dem Pulver, Leblanc?«
»Es ist richtig! Wir haben große Bestellungen in Italien und Schweden gemacht. Aber natürlich nur zum Vergleich mit unserm Nitroglycerin!« sagte der Schiffsleutnant Leblanc lächelnd. Herr von Rigolet redete daneben auf einen hageren straffen General vom ›commandement supérieur de la défense‹ ein, der das breite rote Band der Ehrenlegion quer über der Uniform trug.
»Ah – mein Alter – mich wirst du nicht los! Frankreich – das ist die Freiheit! Ich folge Euch als Schlachtenbummler!«
»Wohin, mein General?«
»An die belgische Grenze! Übermorgen geht der ganze Generalstab dorthin. Vierzehn Tage kriegsmäßige Übungen! Fünfundzwanzig Generale, zweihundertfünfzig Offiziere! Eine blaue und rote Partei!«
Der englische Riese in Rot und der schottische Lord konnten gut französisch. Bei der Erwähnung Belgiens zeigten sie verständnisvoll ihre breiten, weißen Zähne. Man lächelte sich an. Gesprochen wurde nichts. Man wußte ja Bescheid. War längst im Reinen. An einem der Fenster drängte sich eine Gruppe Offiziere und schaute hinaus auf Staub, Sonnenglut und Schmutz des fahnenumhangenen Opernplatzes, zwischen dessen Automobilgewühl sich von beiden Seiten der Boulevards her immer neue Menschenmassen ergossen. Der blonde Leutnant Schouman, der wie ein deutscher Lehrer aussah, drehte sich plötzlich um und gab dem Oberstleutnant Grégoire ein aufgeregtes Zeichen, heranzutreten.
»Da ist er!«
»Wer?«
Zugleich fuhr der Major Michelin auf, wie ein Jäger beim Anblick des Wilds.
»Er geht quer über den Platz!«
»Kommt er hier herüber?«
»Ja!«
»Ah – das ist dreist!«
»Wer denn nur?« Grégoire schob ungestüm die gespannt lauernden jüngeren Offiziere vom Zweiten Büro des Nachrichtendienstes beiseite. Er war etwas kurzsichtig.
»Wer? Isebrink!«
»Isebrink! Erkennen Sie ihn nicht, mein Oberstleutnant?«
»Sapristi! Ja – das ist Isebrink!«
Draußen auf der flaggenbunten Rue de la Paix wimmelten im Sonnenschein die Pariser und ihre Gäste: Engländer, die zu vielen Tausenden mit dem König über den Kanal herübergespritzt waren, Yankees in Scharen. Nur durch seine straffe Haltung unterschied sich da einer von den Hängeschultern der Angelsachsen. Er schlenderte langsam die Diamantenstraße herab, mitten im Menschenstrom, und schaute harmlos neugierig nach rechts und links.
»Zeigen Sie ihn mir doch, Schouman!«
»Herrgott – ... da drüben! In dem grauen Frühlingsanzug!«
»Mit dem dunkelblonden Schnurrbart und dem sonnenverbrannten Gesicht?«
»... und dem Strohhut im Genick! Er hat doch wahrhaftig die Stirne und sieht zu uns her und lächelt!«
»Er darf gar nicht nach Paris! Wilhelm hat es seinen Offizieren verboten!«
»Das ist Spionage!«
»Leider nicht!« sagte der Oberstleutnant Grégoire vom Nachrichtendienst. »Es wurde uns von der Deutschen Botschaft amtlich mitgeteilt, daß der Hauptmann Isebrink auf vierundzwanzig Stunden zum Besuch eines Freundes Paris betreten würde!«
»Dann überwacht ihn wenigstens, parbleu!«
»Unbesorgt! Er hat schon sein Ehrengeleit, wo er geht und steht! Drei Schatten mindestens. Der Camelot da neben ihm ist einer von unsern Agenten, der Blusenmann hier auf unserer Straßenseite auch. Der alte würdige Herr im Zylinder zehn Schritte hinter ihm kontrolliert den Sicherheitsdienst!«
Paul Isebrink war draußen auf dem breiten Bürgersteig stehen geblieben, wartete, bis der Greis herangekommen war, und lüftete vor ihm den Hut. Eine Sekunde streifte dabei sein Blick die bunten Uniformen an den Fenstern des ihm wohlbekannten Cercle National.
»Jetzt läßt er sich auch noch von unserem Spitzel Feuer geben!«
»Verfluchter Kerl! Er macht sich über uns lustig!«
»Ah – v'là un type!«
»Ist er so gefährlich?« frug der Schotte.
»Gefährlich? Mein Gott – er ist im Großen Generalstab in Berlin!«
»Und bis vor ein paar Jahren war er Hauptmann in einer kleinen Grenzgarnison in den Vogesen!«
»Ah – wir kennen ihn wohl!«
»Wir verfolgen jeden seiner Schritte!« sagte der Oberstleutnant vom Zweiten Büro. »Er kam gestern aus Luxemburg. Er wohnt im Grandhotel drüben. Er hat dort vorhin im Eisenbahnbüro eine Karte für den Brüsseler Nachmittagsschnellzug genommen! Wir wissen Alles ...«
Der lange rote Brite grinste.
»Im Königlichen Jachtgeschwader in Cowes haben wir auch manche Sportcharaktere, die nirgends lieber als zwischen Emden und Brunsbüttel kreuzen!«
Um ihn lachten die jungen Offiziere zu dem kleinen blonden Leutnant.
»Schouman macht auch nächstens wieder eine Geschäftsreise über den Rhein!«
»Antonelli hat jetzt noch Schwielen an den Händen. Kein Spaß vier Wochen lang als italienischer Erdarbeiter zu schippen!«
Der Korse schwieg. Es war die Wagelust des Wilderers, das Pirschen an verbotener Grenze, bei den Offizieren, den Heeren in dem endlosen Frieden.
»Nun – da hat der General ihn ja gefunden!« sagte der Oberstleutnant Grégoire und blickte nach der Tür. Durch die kam Herr von Rigolet. Er hielt einen schlanken, aristokratisch aussehenden Mann in den Dreißigern mit unruhig belebten, schnurrbärtigen Zügen und klugen grauen Augen freundschaftlich unter dem Arm gefaßt.
»Eh – dieser Nicolai! Läßt den alten Großpapa warten! Macht nichts, mein Bester! Man weiß, daß Du immer Wichtiges vorhast. Du warst, höre ich, schon bei unsern hiesigen Großfürsten?«
»Ich brachte ihnen Briefe aus Petersburg!« sagte Nicolai Schjelting. »Ich war des Abends mit ihnen zusammen und – natürlich – zwei Mesdames telles et telles. Sobald ich konnte, fuhr ich heim und schlief eigentlich bis jetzt.«
Für die Liederlichkeit der vornehmen Russen in Paris hatte er, der Mann des Ehrgeizes, nichts übrig. Das war nur Zeitverschwendung.
»Du kennst mich. Ich muß den Schlaf nehmen, wann ich ihn einmal finde!« sagte er zu dem Großvater seiner Frau und wurde plötzlich erregt. »Neulich bot sich mir in Moskau eine Gelegenheit. Da war ein berühmter deutscher Arzt! Er hätte mir vielleicht geholfen!«
»Warum ließest Du ihn Dir nicht kommen?«
»Ich ging zu ihm. Stand da. Man ließ mich nicht vor.«
»Dich nicht vor? ... Du scherzest!«
»Es war da irgend eine kleine Deutsche. Die wollte es nicht! Was willst Du machen? Überall in der Welt stößt man ja auf die deutsche Barriere. Wir Alle leiden darunter. Nicht ich allein!«