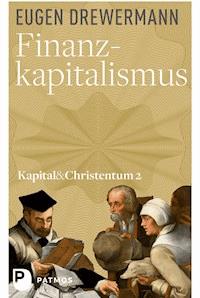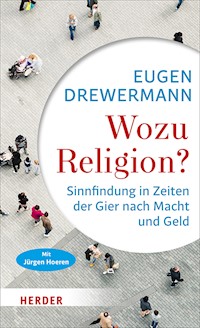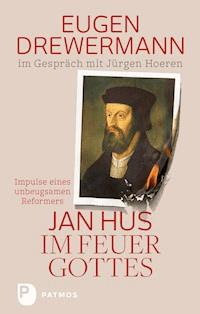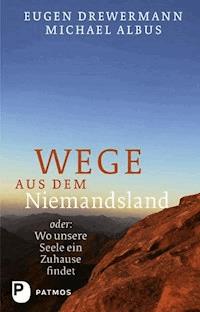Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wir kennen ihn alle, den sympathischen "Kleinen Prinzen" von Antoine de Saint-Exupéry. Es der ewige Traum verlorener Kindheit, der den "Kleinen Prinzen" so trostreich und lebensklug macht. Folgen wir mit Spannung Drewermanns einfühlsam erzählter Deutung bis hin zur Aufschlüsselung des Bildes der geheimnisvollen Rose.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugen Drewermann
Das Eigentliche ist unsichtbar
Der Kleine Prinz tiefenpsychologisch gedeutet
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlag: unter Verwenden eines Motivs aus dem „Kleinen Prinzen“
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-80533-2
ISBN (Buch) 978-3-451-33728-4
Inhalt
Vorwort
Die Botschaft
1. Das königliche Kind – Eine quasi religiöse Wiederentdeckung
2. Die Erwachsenen – Portraits der Einsamkeit
3. Die Weisheit der Wüste und die Suchwanderung der Liebe
4. Von Liebe und Tod oder Das Fenster zu den Sternen
Fragen und Analysen
1. Das Geheimnis der Rose
2. Das Geheimnis des Ikarus
3. Zwischen der »Stadt in der Wüste« und dem »himmlischen Jerusalem«
Anmerkungen
Verzeichnis der zitierten Literatur
Vorwort
Das Märchen vom »Kleinen Prinzen«
Unzähligen ist die schönste Dichtung ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRYS, sein Märchen vom »Kleinen Prinzen«, bis heute zur Schlüsselerzählung ihres Lebens geworden. Der »Kleine Prinz« bot ihnen Zuflucht in Stunden der Einsamkeit, Trost in Augenblicken der Enttäuschung und Hoffnung in Momenten der Verlassenheit; er war ihr unentbehrlicher Begleiter auf den oft langen Wegen des Suchens und der Sehnsucht, und seine verhaltene Traurigkeit war wie der Ort einer verständnisvollen Wärme inmitten einer Welt, die immer kälter wird.
Ist es der ewige Traum verlorener Kindheit, der den »Kleinen Prinzen« so trostreich und sympathisch macht? Gewiss, jedoch nicht nur. Hinzu kommt die kunstvoll ironische Befreiung von der wahnsinnigen Zwangswelt der »großen Leute« – ein erstes Atemholen und Innehalten in der Wüstenei des Menschlichen. Vor allem aber vermag der »Kleine Prinz« ein Stück weit das Vertrauen in die unbedingte Treue der Liebe wiederherzustellen; er verheißt und verkörpert eine Welt des Bemühens und der Verantwortung um- und füreinander, und er zeigt eine Verbundenheit der Liebe, die selbst im Tod nicht zu besiegen ist – ein hohes Lied der Freundschaft und der Kameradschaft in Bildern von bezaubernder Einfachheit und Schönheit.
Was Wunder, dass EXUPÉRYS »Kleiner Prinz« zur Traum- und Idealgestalt der Menschlichkeit herangewachsen ist? Sein Rückblick in das Reich kindlicher Unschuld, sein Ausblick zumal zu den Sternen, die in den Nächten wie Glocken erklingen, um uns zu erzählen von dem unsichtbaren Planeten einer sonderbaren Rose, schenken uns eine Weite des Herzens und eine Tiefe des Träumens zurück, die man in der Ödnis unserer Tage fast schon verloren glaubte. Unwillkürlich, mit einem fast mütterlichen Mitgefühl, wünscht man dem »Kleinen Prinzen«, er möge wohlbehütet glücklich sein in seiner kleinen Sternenwelt, und man vergisst beinahe, dass er im Werk EXUPÉRYS für diese Welt auf ungewisse Zeit »gestorben« ist; man wünscht EXUPÉRY, er selbst hätte der Gestalt des »Kleinen Prinzen« in seinem eigenen Leben Wirklichkeit verleihen können, und allzugern folgt man der großen Zahl der Biographen, die versichern, dass ihr Freund und Kamerad Antoine im Konterfei des »Kleinen Prinzen« sein eigenes Portrait der Nachwelt hinterlassen habe.
In der Tat ist es unerlässlich, den deutlich autobiographischen Zügen des »Kleinen Prinzen« tiefenpsychologisch nachzugehen. Man geht dabei Gefahr, den Mythos »EXUPÉRY« zu zerstören, denn es geht nicht an, die Widersprüche, die das Leben und Dichten EXUPÉRYS durchziehen, aus seiner Person, wie um ihn zu schützen, herauszunehmen und allein den Unbilden der Zeitumstände zuzurechnen; aber man erhält bei objektiver Betrachtung die Chance, dem Menschen EXUPÉRY gerade im »Kleinen Prinzen« tiefer und unverstellter zu begegnen als in allen anderen seiner wunderbaren Schriften.
Es gibt im Werk EXUPÉRYS viele Züge, an denen man ihn verstehen muss, statt ihm zu glauben, und wenn es Leser geben sollte, die von dem hier entworfenen, in der Literatur bisher niemals so gesehenen Bild EXUPÉRYS sich mit dem Gefühl einer enttäuschten Liebe oder einer gekränkten Sympathie abwenden möchten, so sei doch gleich vorweg versichert: man kann einen Dichter, so groß wie EXUPÉRY, niemals in seinen Anliegen und Aussagen wirklich verstehen, ohne die Ahnung oder, besser, ohne den Glauben und die Zuversicht in eine Dimension der Wirklichkeit mitzubringen, die sich als noch liebenswerter, noch hoffnungsvoller, noch tröstlicher, noch menschlicher darbietet, als etwa selbst EXUPÉRY sie aus der Höhe seiner Weltbetrachtung sehen mochte. EXUPÉRYS Dichtung hat die Größe und den Wert eines prophetischen Aufrufs – aber gerade die größten unter den Propheten wurden am Ende in ihrer Botschaft widerlegt, indem man ihnen folgte: stets, wenn der Sturmwind ihres Munds sich legte, sprach Gott in der sanften Stimme eines »verschwebenden Schweigens« (1 Kön 19, 12), das nicht die Anstrengung, sondern die Güte wollte. Der »Kleine Prinz« wird auf diese Erde nur zurückkehren, wenn wir die Widersprüche aufzeigen und überwinden helfen, an denen er zugrunde ging. Der »Kleine Prinz« soll leben dürfen, hier auf dieser Erde – das ist zentral das Ziel des vorliegenden theologischen und tiefenpsychologischen Essays, das in Wort und Bild die verdichteten Symbole der berühmten Märchenerzählung EXUPÉRYS in Richtung auf das eigene Leben weiterträumen möchte.
Vom Sinn einer Auslegung des »Kleinen Prinzen«
Jeder, der versucht, den »Kleinen Prinzen« auszulegen, steht in der Versuchung, ein »Affenbrotbaum« zu werden. Die »Boababs« sind so: sie zerstören durch ihre Aufgeblasenheit und Übergröße jeden geheimen Planeten des Glücks, sie zerwurzeln die Kinderwelt und zerwühlen die Traumwelt, ja sie zerwurmen mit dem Polypenwerk ihrer unersättlichen Gedankenbahnen jeden heilen Boden, aus dem die Schönheit einer Rose sich erheben könnte. Bringt nicht jede Deutung, eine tiefenpsychologische zumal, die Sprache der Dichtung um? Sie bringt sie um ihre Unmittelbarkeit und ersetzt sie durch Reflexion; sie bringt sie um ihre Wärme und Gefühlstiefe und ersetzt sie durch begriffliche Höhenflüge von Hypothesen und Abstraktionen; sie bringt sie um die verdichtete Einheit einer symbolischen Gesamtschau und löst sie auf in Analyse und Zergliederung. »Denn wenn du die Menschen verstehen willst, darfst du nicht auf ihre Reden hören.«1
Warum überhaupt also eine psychoanalytische Interpretation des »Kleinen Prinzen«? Warum die Bilder nicht einfach in ihrer einfachen Bedeutung belassen?
Weil, so muss man sagen, jede wirkliche Dichtung eine komplexe Wirklichkeit in einem vielschichtigen Symbol verdichtet und man die Sprache der Dichtung nur in einer eigentümlichen Mischung aus einfühlender Betrachtung und nachdenkender Analyse wirklich versteht.
Es ist wahr: man kann jedes traumnahe dichterische oder religiöse Bild in seiner Einbildungskraft und Verbindlichkeit zerstören, indem man es in seine Bestandteile zerlegt und so eine intellektuelle Distanz schafft, die jedes unmittelbare Gefühl ersterben lässt. Aber auch das Umgekehrte ist wahr: man kann eine dichterische Erzählung, einen Traum ihrer Wirklichkeit und Wirksamkeit berauben, indem man so handelt, wie es für gewöhnlich des Morgens beim Aufwachen geschieht: man belächelt beklommen oder belustigt die Traumbotschaften der Nacht und stellt erleichtert fest, dass alles nur ein Traum gewesen sei2; oder man gibt spielerisch-erzählend die Traumbilder seinen Freunden zum besten, ohne sich selber darin wiederzuerkennen und die diagnostische Schärfe des Geschehens zu würdigen. Schließlich kann man die eigenen Träume auch dazu benutzen, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Gerade die Welt der Dichtung kann jederzeit die Funktion einer Droge für Intellektuelle übernehmen, und jede Lektüre wirklicher Dichtung, die nicht zu einer Selbstbetrachtung des Lesers gerät, missrät in ihrer eigentlichen Intention.
Also ist es unumgänglich, Dichtung auszulegen, und man wird nicht schon deshalb ein »Affenbrotbaum« vermeintlicher Selbstüberlegenheit, nur weil man überlegt, welches Stück Wirklichkeit sich in einem Stück Dichtung konzentriert. Freilich weicht eine Deutung von Dichtung in Richtung der in ihrer verdichteten Lebenswirklichkeit auf charakteristische Weise von einer literaturwissenschaftlichen Interpretation ab: wo es dieser um die Analyse der sprachlichen Mittel zu tun ist, in denen das Leben zur Dichtung umgestaltet wurde, geht es in unserem Falle um den Versuch, die Wirklichkeit selber zu beschreiben, die sich in einem literarischen (oder darstellenden) Kunstwerk verdichtet ausspricht; nicht um den künstlerischen Wert der Dichtung, sondern um ihren psychischen und existentiellen Wahrheitsgehalt geht es uns. Wenn ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY selbst von der Analyse sagte: »Die Logik steht mit den Dingen auf einer Stufe und nicht mit dem Knoten, der sie verknüpft«3, so ist es unerlässlich zu sehen, inwieweit man selber die Verbindlichkeit des »Knotens«, der verdichtenden Vision, der dichterischen Sinnstiftung jenseits der »Logik« anzuerkennen vermag. Alle Dichtung EXUPÉRYS hat etwas Visionäres; sie versteht sich selbst als eine Art Mission der Menschlichkeit. Um so wichtiger ist es deshalb, zu untersuchen, welche Erfahrungen und Erkenntnisse, welche Motive und Zielsetzungen, welche persönlichen und zeitbedingten Eindrücke und Erlebnisse, welche humanen Evidenzen das Werk des französischen Dichters geprägt haben. Gewiss: »Der Schöpfer entzieht sich stets seiner Schöpfung. Und die Spur, die er zurücklässt, ist reine Logik«4; aber, wenn eine Schöpfung wirken will, so ist zu fragen nach dem Menschenbild, das in ihr lebt, und mithin nach dem Menschen, der sich darin abgebildet findet. Nicht ein unausrottbarer Hang zu (psycho-)logischer Zergliederung, sondern ein Streben nach existentieller Bewahrheitung macht die Deutung eines Kunstwerks nötig.
Es gibt noch einen anderen Grund. Millionen Menschen haben den »Kleinen Prinzen« gelesen, Millionen werden ihn lesen. Wenn in einigen Jahrhunderten die riesigen Bibliotheken unseres noch Bücher schreibenden Zeitalters auf einige wenige kennzeichnende Momentaufnahmen zusammengeschmolzen sein werden, so wie die Dichtung DANTES uns Heutigen bereits für »das« Mittelalter oder SHAKESPEARES Dichtung für »das« Zeitalter Elisabeths stehen mag, wird man aus unserem blutigen, von verzehrenden Konflikten geschüttelten 20. Jahrhundert vielleicht nur zwei Dichtungen für wesentlich und kennzeichnend halten: FRANZ KAFKAS »Schloss« und EXUPÉRYS »Kleinen Prinzen«.
Über KAFKAS »Schloss« kann es keinen Zweifel geben: dieser Roman bietet auf unheimliche Weise den Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen Krise des Menschseins. Nirgendwo sonst ist die Sinnlosigkeit und Entfremdung, die innere Zerrissenheit und Einsamkeit, die Ausgeliefertheit und Verlorenheit unserer Existenzweise beschwörender geschildert worden5. Vergangene Zeiten mochten ihr Konterfei in Mythen und Märchen, Sagen und Legenden malen; – KAFKAS Roman ist ein Antimärchen, eine grausame Vision der Aussichtslosigkeit und Unentrinnbarkeit inmitten einer kalten, bürokratisch verwalteten, unbegreifbaren und unangreifbaren Welt, in der selbst die Metaphern der Hoffnung, die Märchenbilder von Stadt und Schloss, von Königreich und Auftrag, in Symbole des Unheils umgewertet sind. An sich scheint von daher niemand als Gegenzeuge der Verzweiflung berufener zu sein als der Autor des Gegen-»Schlosses«, der »Stadt in der Wüste«, der »Citadelle«6, und nicht zufällig liest man, wenn schon nicht diesen großen fragmentarischen Nachlass EXUPÉRYS, so doch seinen zeitgleich entstandenen »Kleinen Prinzen« wie ein Brevier der Hoffnung, wie ein Vademecum der Liebe. Wenn irgend der Beweis zu erbringen ist, dass selbst das verworrene 20. Jahrhundert Märchen von überzeitlicher Geltung hervorzubringen vermag, so scheint »Der Kleine Prinz« diesen Beweis zu liefern.
Dieses Büchlein zu untersuchen und seine psychische Welt zu erforschen, bedeutet daher nicht mehr und nicht weniger, als die Frage zu stellen, inwieweit es eine glaubwürdige Hoffnung des Menschlichen in unserer auf vielfache Weise unmenschlichen Zeit gibt oder doch geben kann. Spürbar leben wir inmitten einer sich endlos ausbreitenden Wüste, aber ob sie einen Brunnen birgt und wo er liegt – das ist die Frage. Wir werden also mit EXUPÉRY gemeinsam den Sternen- und Zisternenweg gehen müssen und sehen, wieviel Licht in der Nacht und wieviel Wasser in der Wüste wir finden; wir müssen versuchen, seine Botschaft zu verstehen, und wir werden zu prüfen haben, inwieweit sie trägt.
Die Botschaft
1. Das königliche Kind – Eine quasi religiöse Wiederentdeckung
Es ist erstaunlich: immer, wenn Dichter Wesentliches zu sagen haben, schöpfen sie aus dem Quell der religiösen Bilderwelt; so EXUPÉRYS Gestalt des »Kleinen Prinzen«.
Allerorten erzählen die Völker von Königskindern, die von verborgenen Teilen der Welt zu den Menschen kommen und alles mit anderen Augen zu sehen vermögen. Schon dieses archetypische Motiv besitzt eine religiöse Qualität. Weit näher noch an die religiöse Sprache aber schließt EXUPÉRY sich an, wenn er von einem Königssohn erzählt, der von einem fernen Stern unter uns erschienen sei; nur kurze Zeit, versichert EXUPÉRY, verweilte dieser Königssohn in unserer Welt, übers Jahr schon wartete auf ihn der Tod, und er musste heimkehren zum Licht der Sterne; und dennoch war seine Ankunft nicht umsonst, denn wir dürfen seither warten auf seine Wiederkehr, und es scheinen die Sterne uns anders im Dunkel der Nächte. Die Welt hat sich nicht geändert, seit der »Kleine Prinz« sie betrat; aber es ist möglich, sie mit seinen Augen zu sehen, und vieles, was uns jetzt ernst dünkt, erscheint dann lächerlich, vieles Lächerliche ernst, manches Große wirkt dann niedrig, manches Unscheinbare groß, und vieles lässt sich wiederentdecken an verleugneter Menschlichkeit – darunter am meisten das Träumen, das Warten und das Lieben.
Was anderes verbindet die Religion mit der Gestalt des »göttlichen Kindes«, als dass unser Herz zurückfinden dürfte zu seinem Ursprung und unser Leben begänne noch einmal wie neugeboren in dem Umkreis einer Welt, in der die Tiere reden und die Blumen sprechen und die Sterne singen, wie im »Kleinen Prinzen«?
Es ist im Neuen Testament nicht wirklich ausgesprochen, was Jesus meinte, als er zu seinen Jüngern sagte: »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nie die Macht Gottes in eurem Leben begreifen« (Mt 18, 3). Aber selbst wenn man sich hütet, in das Kindsein bestimmte romantisch-verklärende Inhalte hineinzuprojizieren7, so wird man doch sagen müssen, dass ein »Kind« in religiösem Sinn über zwei Haltungen verfügt, die es ihm erlauben, sein wahres Wesen niemals zu verleugnen: die Haltung des Vertrauens und der Treue.
Religiös betrachtet, ist das »Kind« die Chiffre für ein Leben, das von einem unbeirrbaren Vertrauen in die Güte des Weltenhintergrunds getragen wird und deshalb der Angstsicherungen nicht bedarf, die das Leben der »Erwachsenen« von Grund auf formen und deformieren.
Solange ein Mensch Angst hat, wird er sich fürchten, »klein« zu sein; die Angst wird ihn vorwärtspeitschen, größer und immer »erwachsener« zu werden, bis er seinem eigenen Maß vollends entwächst und in wörtlichem Sinne »böse« wird8: aufgeblasen und unwirklich hinter der Als-ob-Fassade9 nicht endender Scheinfertigkeiten und Scheinfähigkeiten. »Ihr könnt mit all euren angsterfüllten Anstrengungen das Maß eures Lebens doch nicht auch nur um eine einzige Elle vergrößern«, meint Jesus begütigend und beschwörend in der »Bergpredigt« (Mt 6, 27); aber es ist in der Angst nicht möglich, diese Wahrheit zu leben. Ein »Kind« ist ein Mensch, der gelernt hat, der Scheinwelt der ausgewachsenen Ängste der »Großen«, der Großtuer und Großsprecher, der chronisch geängstigten Angstverbreiter zu entsagen und in gewissem Sinne das Leben noch einmal von vorn zu beginnen: mit dem unverbrüchlichen Mut zur Wahrheit – auf ihr allein ruht der Segen Gottes für den, der sie annimmt (Mt 5, 3) – und zudem mit einer nicht endenden Sehnsucht nach einer Welt, die sanftmütiger, barmherziger, friedfertiger und insgesamt gerechter ist (Mt 5, 5–9). Ein solches »Kind« wird sich von der Macht, der Ruhmsucht, der Karriere und dem Geld der »großen« Leute nicht blenden lassen, weil es weiß, dass alles, was menschlich wahr ist und dem Frieden dient, nur den »Kleinen« einsichtig und zugänglich sein kann (Mt 11, 25). Dieses Gefühl des Vertrauens ermöglicht eine grenzenlose Offenheit. Die in der Welt der »Erwachsenen« so wichtigen moralischen Unterschiede zwischen gut und Böse etwa gelten nicht für jemanden, der um die scheinbare Allmacht der Angst und der Einsamkeit weiß und der zuinnerst fühlt, dass er nur gut zu sein vermag in dem Geschenk und in dem Glück der Liebe. So hört man Jesus im Neuen Testament sagen, dass Gott die Sonne aufgehen und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte (Mt 6, 45) – er, der Unendliche, muss sich gleich tief herabbeugen zu allen Menschen, zu den Hohen wie den Niedrigen, und ein jeder lebt allein aus seiner Gnade.
Ein solches »Kind« wie Jesus etwa konnte an einem Morgen auf dem Tempelplatz in Jerusalem das Wunder wirken, dass eine Gruppe von Menschen, die in einem Fall von Ehebruch mit Steinen in der Hand schon zu der gesetzlich verordneten Lynchjustiz an einem 12-jährigen Mädchen bereit standen, einen Moment lang den Dünkel der Gerechtigkeit aufgaben, mit dem Verurteilten innehielten und in das eigene Herz zu schauen wagten10. Im gleichen Sinne beschrieb FEDOR M. DOSTOJEWSKI in der Gestalt des Fürsten Myschkin ein solches wunderbares Kind, das fernab von den Verurteilungen und den Vorurteilen der anderen in einem Dorf in der Schweiz sich der geschändeten, verfemten und sterbenskranken Marie annahm und alle Kinder des Ortes, die ursprünglich, wie die Erwachsenen, das Mädchen verspotteten und sogar nach ihm mit Steinen warfen, eine unmittelbare Güte und ein grenzenloses Verstehen lehrte11. Die Liebe solcher »Kinder« ist universell – sie schließt nichts aus, was der Hilfe bedarf, gleich ob Mensch oder Tier, Hoch oder Niedrig.
Für die »Erwachsenen« sind die sozialen Unterschiede überaus wichtig, und es kommt ihnen mehr als alles sonst darauf an, was für ein Haus jemand gebaut hat, was für ein Auto er fährt und ob er weiß, welch ein Besteck man verwendet, um Fisch oder Hummer zu essen. Einem solchen »Kind«, wie Jesus es war, kam es nicht darauf an, ob seine Jünger sich die Hände vor oder nach dem Essen wuschen, aber was im Herzen eines Menschen vor sich ging, welche Gedanken und Gefühle er in sich trug, das entschied in seinen Augen darüber, was für ein Mensch er war (Mk 7, 1–13). Ganz ähnlich schilderte GEORGES BERNANOS in der Person des »Landpfarrers« ein solches »Kind«, das der vornehmen Frau von Chantal, die um den Tod ihres Sohnes untröstlich trauerte und verzweifelt mit Gott haderte, ihr Kind zurückgab durch das Gefühl einer tieferen Geborgenheit in Gott12.
Religiös ist ein »Kind«, wer im Vertrauen auf Gott die Menschenfurcht besiegt hat und daher Raum besitzt für solche einfachen Wahrheiten des Herzens. Wem immer man in seinem Leben Gott als seinem Vater glauben kann, der ist religiös gesehen ein »Kind« Gottes; ihm vermag man zu begegnen wie einer Schwester oder wie einem Bruder in einer absichtslosen Güte, die weder in Besitz nimmt noch versklavt. Und wenn man solch ein »Kind« als »Prinz« oder »Prinzessin« anreden möchte, dann, weil man in seiner Nähe sich selber eingeladen fühlt, als Gast in einem unsichtbaren Königreiche an der Tafel eines ewigen Königs Platz zu nehmen, indem man sich selbst an seine eigene Herkunft aus dem Licht des Himmels auf das lebhafteste wieder zu erinnern vermag. »Mit dem Himmelreich verhält es sich wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeitsfeier vorbereitete«, sagte im Neuen Testament Jesus von der Auszeichnung und Berufung unseres Daseins (Mt 22, 2).
Gemessen daran, greift der »Kleine Prinz« EXUPÉRYS wohl unzweifelhaft entscheidende Motive der religiösen Vorstellungswelt auf – es gäbe seine Gestalt durchaus nicht und er wäre gar nicht vorstellbar ohne den symbolischen und geistigen Hintergrund des Christentums; und doch lebt der »Kleine Prinz« nur wie ein flüchtiger Schatten des einst mächtigen religiösen Lichtes, und die Traurigkeit und Melancholie, die Sphäre der Sonnenuntergänge und der Einsamkeit, die ihn umgibt, ist wie ein Nachruf für etwas, das leben müsste und doch nur als Schemen gegenwärtig ist. Denn so romantisch verträumt der »Kleine Prinz« auch wirken mag, so verdichtet in ihm auch die großen religiösen Wahrheiten anklingen und so menschlich sympathisch man seine Kritik an der Welt der Erwachsenen mit ihrem Aberglauben an Zahlen und Äußerlichkeiten auch finden wird – im Grunde ist selbst diese großartige Dichtung vom »Kleinen Prinzen«, dieses schönste Märchen des 20. Jahrhunderts, wie ein unfreiwilliger Beweis, dass die Zeit wie unerreichbar fern erscheint, in der das Träumen noch geholfen hat und Märchen sich erfüllen konnten.
Denn während sonst die großen Träume der Völker erzählen, wie Erwachsene an sich selbst das Wunder der Wiedergeburt, symbolisiert in einem ihrer Kinder, zu erfahren vermögen, oder wie Kinder ihre Eigenart bewahren können, auch wenn sie unter zumeist lebensbedrohlichen Gefahren erwachsen werden, beschreibt der »Kleine Prinz« eine Begegnung ohne Verschmelzung, eine Erinnerung ohne Synthese, eine Vision ohne Aussicht.
Es handelt sich um eine Geschichte, die mit der Schilderung einsetzt, was Erwachsene in einem Kind alles zerstören können, noch ehe sein Leben wirklich begonnen hat; und diese Dichtung, die dem Wort nach einem Erwachsenen gewidmet ist, richtet sich doch an das Kind, das dieser Erwachsene einst war. Wohl beschwört sie alle Kinder dieser Erde, dem Prunk der Erwachsenen nicht Glauben zu schenken und die Einfalt ihres Herzens zu bewahren. Aber sie zeigt nicht, welch eine Chance ein »Erwachsener« haben könnte, sein Unwesen zu wandeln und zu sich selbst, zu seiner ursprunghaften Kindlichkeit zurückzufinden; und noch weniger verrät sie darüber, wie der »Kleine Prinz« sein geheimes Königreich auf dieser Erde antreten könnte. Im Gegenteil, am Ende kehrt der »Kleine Prinz« auf seinen winzigen Planeten zurück aus Treue zu seiner »Rose«, während der abgestürzte Flieger sein »erwachsenes« Leben wieder aufnimmt, sehnsüchtiger, ohne Zweifel, als zuvor und trauriger denn je, aber gleichwohl außerstande, die Gestalt des »Kleinen Prinzen« in sein eigenes Dasein aufzunehmen.
Gewiss, auch das Christentum berichtet davon, dass das »göttliche Kind«13 auf dieser Welt von Anfang an verfolgt, vertrieben und schließlich getötet wurde, auch das Christentum spricht von dem Warten auf die Wiederkehr des göttlichen Gesandten, dessen Gestalt wir bereits kennen und dessen Botschaft wir vernommen haben. Aber religiös ist das »göttliche Kind« eine Chiffre für den Typus eines von Grund auf erneuerten und erlösten Daseins; der »Kleine Prinz« hingegen verkörpert idealtypisch die sehnsuchtsvollen Inhalte eines nie gelebten Lebens; er ist die bloße Gegenchiffre zu der unmenschlichen Welt der »Erwachsenen«. Während die Religion von einem Traum erzählt, der Wirklichkeit geworden ist und daher jederzeit wieder wirklich werden kann und sollte, erzählt EXUPÉRYS Geschichte von einem Traum, der niemals wirklich war und dessen Verwirklichung nicht abzusehen ist. Das »göttliche Kind« der Religion verkörpert ein Leben, das den Tod überwunden hat; der »Kleine Prinz« verkörpert eine Kindlichkeit, die nie zum Leben zugelassen wurde; nicht das auferstandene – das von Grund auf erstickte Leben lebt in ihm; er verkörpert, was im Menschen angelegt war und wozu er berufen wäre, fiele nicht von außen her nur allzufrüh der Frost über die ersten Frühlingsblüten.
Eine biographische Notiz aus »Wind, Sand und Sterne«, in der EXUPÉRY zum ersten Mal das Bild von den »kleinen Prinzen im Märchen« gebraucht, verdeutlicht mehr als jeder Kommentar, in welchem Sinn diese Chiffre gemeint ist. Es handelt sich um die Schlussszene, in der EXUPÉRY im Eisenbahnabteil sich seine Gedanken über die Mitreisenden macht14.
»Ich setzte mich einem Paar gegenüber. Zwischen Mann und Frau hatte sich das Kind ein Nestchen gebaut, so gut es ging, und schlief. Einmal wendete es sich doch im Schlaf, und sein Gesichtchen erschien mir im Licht der Nachtbeleuchtung. Welch liebliches Gesicht! Diesem Paar war eine goldene Frucht geboren; aus den schwerfälligen Lumpen war eine Vollendung von Anmut und Lieblichkeit entsprungen. Ich beugte mich über die glatte Stirn, die fein geschwungenen Lippen und sah: das ist ein Musikerkopf – das ist Mozart als Kind, eine herrliche Verheißung an das Leben! So sind nur die kleinen Prinzen im Märchen. Was könnte aus diesem Kind, wenn es behütet, umhegt, gefördert würde, alles werden! – Wenn in einem Garten durch Artwechsel eine neue Rose entsteht, fasst alle Gärtner größte Aufregung. Man verwahrt die Rose, man pflegt sie, man tut alles für sie. Aber für die Menschen gibt es keinen Gärtner. Das Kind Mozart wird wie alle anderen vom Hammer zerbeult. Vielleicht empfängt es einst seine höchsten Wonnen von einer entarteten Musik in der stickigen Luft eines Nachtcafés. Mozart ist zum Tode verurteilt. – Ich kehrte in mein Abteil zurück, und meine Gedanken gingen mit: ›Diese Leute leiden gar nicht unter ihrem Los. Nicht Nächstenliebe bewegt mich hier. Ich will mich nicht über eine nie verheilende Wunde erbarmen; denn die Menschen, die sie am Leibe tragen, fühlen sie nicht. Aber das Menschliche ist hier beleidigt, nicht der einzelne Mensch. An Mitleid glaube ich nicht, aber ich sehe die Menschen an wie ein Gärtner. Darum quält mich nicht die tiefe Armut, in der man sich schließlich ebensogut zurechtfindet wie in der Faulheit. Generationen von Morgenländern leben in Schmutz und fühlen sich wohl dabei.‹ Mich quält etwas, was die Volksküchen nicht beseitigen können. Nicht Beulen und Falten und alle Hässlichkeit; mich bedrückt, dass in jedem dieser Menschen etwas von einem ermordeten Mozart steckt. – Nur der Geist, wenn er den Lehm behaucht, kann den Menschen erschaffen.«
Der »Kleine Prinz« als »ermordeter Mozart«, als wehmütige Erinnerung und klagende Hoffnung an ein Leben, das zu Großem berufen wäre, wenn man es nur ließe, aber das man im Keim verstumpft und verdummt hat, indem man an die Stelle jeder geistigen Sensibilität und Wachheit den Terror der Betäubung durch die organisierte Vernichtung der Gefühle gesetzt hat: an die Stelle von künstlerischer Produktivität, der Wirklichkeit von Traum und Phantasie, den Rummel der Unterhaltung und die Verflachung des Massenkonsums; an die Stelle der Musik, des Hörens auf den Gesang der Sphären und der Dinge, das elektronische Gestampfe; an die Stelle der Dichtung, der Poesie, der Zärtlichkeit und Liebe, die Wortkaskaden des Zynismus und die Gefühlskälte logischer und linguistischer Zergliederungen; an die Stelle der Malerei, des Erschauens der verborgenen Wesensgestalt von Dingen der Welt, die marktschreierische Prostitution und Deformation der Schönheit; an die Stelle des Gebets, der schweigenden Erfahrung des Heiligen, die Veräußerlichung aller Worte, die systematische Zerstörung der Seele – also, dass es den Musiker, den Dichter, den Maler, den Priester als Grundgestalten der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit und des menschlichen Ausdrucksvermögens nicht mehr gibt – wegrationalisiert, wegoperiert, wegpraktiziert sie alle. Nein, EXUPÉRYS »Kleiner Prinz«, selbst er, zeigt nicht, wie wir als »Erwachsene« leben könnten, er beklagt, dass wir »erwachsen« geworden sind. Der Sündenfall ist geschehen, und es ist nicht abzusehen, wie wir ins Paradies zurückkehren könnten. Es ist im Gegenteil schon viel gewonnen, wenn wir zumindest einer gewissen Wehmut wieder fähig würden und wiederzuentdecken begännen, was tief in uns verborgen liegt und sich zum Leben melden möchte. Als Seelenbild des in uns noch vor dem Leben Getöteten ist der »Kleine Prinz« zu verstehen, als Erinnerungschiffre des Verlorenen, als ewiges Portrait des Ungelebten und doch unbedingt zu Lebenden.
Wer aber sind dann Mozarts Mörder? Wer diese philisterhaften Seelentöter und Erwürger der Menschlichkeit? Die Antwort kann nur lauten: es sind die Menschen, die wir selber zumeist für »erwachsen« halten, die Menschen, die sich eingerichtet haben in der Normalität ihrer Gefühlskälte, ihrer Zynismen und ihrer Hoffnungslosigkeiten, die wir bewundern, weil sie es fertigbringen, auf nichts mehr zu hoffen und auf nichts mehr zu warten, die mitten im Leben gestorben sind, weil sie buchstäblich »fertig« sind und alles fertigmachen, was nicht, wie sie »erwachsen« ist.
2. Die Erwachsenen – Portraits der Einsamkeit
Nähert man sich, auf den Spuren des »Kleinen Prinzen«, buchstäblich wie von einem fremden Stern mit den unverfälschten Augen eines »Kindes« der Welt, die uns bis zum Überdruss vertraut ist und alltäglich, so enthüllt sie sich als ein Panoptikum der Eitelkeit, der Nichtigkeit und der kompletten Unfähigkeit, irgend etwas zu lieben außer sich selbst, als ein Kaleidoskop verschrobener Egozentriker, die jeder für sich einen eigenen Planeten bewohnen, um Lichtjahre entfernt von allen Menschen wie von aller Menschlichkeit, Wesen, die sich für »ernsthafte Leute« halten, nur weil sie alles in Zahlen verwandeln, während sie doch selber nur »Schwämme« sind, die alles aufsaugen, ohne es innerlich zu verwandeln, einfach nur, um sich damit vor den anderen »schwer« und »dick« zu machen15.
So erlebt man auf der Planetenreise des »Kleinen Prinzen« als erstes das traurige Schauspiel des einsamen, vergreisten »Königs«, der alle Menschen nur als seine Untertanen zu betrachten vermag und der, was immer auch geschieht, mit seinem Befehl zu bestimmen wähnt. Der Raum seiner Welt, ganz bedeckt vom Hermelin seines Mantels, ist winzig klein, aber nicht einmal diese seine Welt hat er ernstlich kennenzulernen versucht. Er, der vermeintlich uneingeschränkte Monarch, dessen Wille über alles ringsum zu gebieten scheint, hat von der wirklichen Welt nicht die geringste Vorstellung16. Sein Umgang mit den Menschen beschränkt sich allein auf die Frage, wozu er sie im Rahmen seiner fiktiven Machtinteressen gebrauchen und einsetzen kann, und es zeigt sich dabei sogleich, dass die »Prinzipien« seiner praktischen Vernunft vollkommen abstrakt und menschenfremd sind. Immerhin hat dieser »König« gelernt, dass Autorität sich auf Vernunft stützen müsse und dass er von daher nur befehlen könne, was im Gang der Natur selbst vorgesehen sei; insofern möchte man ihn für ungleich gütiger und weiser halten als die meisten der vorschnell senil gewordenen, in Macht erstarrten »großen Leute« dieser Welt; ja man möchte, wann irgend man zu einem von ihnen als »Untertan« geladen wird, geradewegs den »Kleinen Prinzen« mitnehmen und ihnen daraus, diesen »König« zitierend, vorlesen: »Wenn ich einem General geböte, nach Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte« – so wäre es nicht die Schuld des Generals17.
Man kann Banausen und Pragmatiker nicht in Poeten und Himmelsstürmer verwandeln wollen – dieser Weisheit des Königs ist nur zuzustimmen; gleichwohl geschieht dieses Befehlen wider die Natur auf Erden immer wieder, stets unter dem Pomp und der Feierlichkeit einer erhaben-langweiligen Etikette, im Gewande gottgleicher Weisungen und mit dem Anspruch unterwürfigen Gehorsams. Aber noch weit grausamer, als dass man »Generälen« befiehlt, den »Dienst« von »Schmetterlingen« zu verrichten, mutet es immer wieder an, wenn man Menschen mit der Sensibilität, der Zärtlichkeit und Schönheit von »Schmetterlingen« dazu zwingt, sich selbst und andere in Reihe und Glied antreten zu lassen; und gerade dies versucht der »König« mit dem »Kleinen Prinzen«.
Wohl gibt er vor, begriffen zu haben, man könne nur befehlen, wenn man selber fähig sei zum Gehorsam; aber er verzichtet durchaus nicht auf seine eingebildete Allmacht und überlässt die Dinge deshalb noch keinesfalls ihrem eigenen Gang. Im Gegenteil besteht er auf dem wesensfremden Befehl, den »Kleinen Prinzen« zum »Richter« einzusetzen, nur um die alte Ratte auf seinem Planeten zum Tode zu verurteilen. Selbst also, wo dieser »König« »Weisheit« kündet, redet er absichtsvolle und einsichtslose Phrasen daher, die nur seinen eigenen Nimbus vergrößern und seine objektive Ohnmacht kaschieren sollen. In Wahrheit ist er, der so verständig und milde tut, ein grausamer Despot, der es liebt, andere in Schrecken zu versetzen, damit sie ihr Leben lang abhängig werden von seiner »Gnade«.