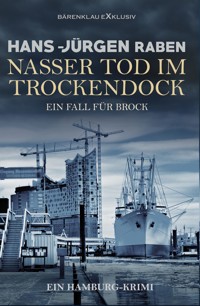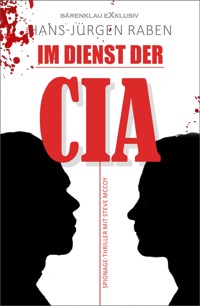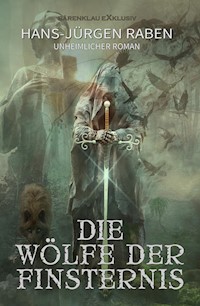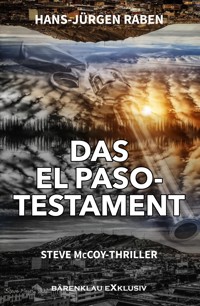
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei einem Raubüberfall Ende des 19. Jahrhunderts wird ein alter Mann auf der Zugfahrt nach El Paso angeschossen und ausgeraubt.
Nahezu einhundert Jahre später stößt bei Recherchearbeiten für seine Abschlussarbeit der junge Student Edmund Starr auf diesen Fall. In der Folge erfährt er vom El Paso-Testament. Ist es ein Fluch oder Vermächtnis?
Einige Jahre vergehen, bis in El Paso ein Richter ermordet wird, bei dem man munkelt, dass der künftige Präsident ihn an den Obersten Gerichtshof berufen möchte. Steve McCoy, der mittlerweile beim Heimatschutz arbeitet, wird mit diesem Fall betraut, da man befürchtet, dass dieses Verbrechen negativen Einfluss auf die Präsidentschaftskandidatur haben könnte. Steve erkennt, dass viel mehr hinter diesem Mord stecken muss.
Begriffe wie Drogen, Kartell und organisiertes Verbrechen fallen und es dauert nicht lange, da geschieht ein weiterer Mord, der nicht der Letzte sein soll …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans-Jürgen Raben
Das El Paso-Testament
Ein Steve McCoy-Thriller
Bärenklau Exklusiv
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Der Autor Hans-Jürgen Raben
Weitere Werke des Autors
Das Buch
Bei einem Raubüberfall Ende des 19. Jahrhunderts wird ein alter Mann auf der Zugfahrt nach El Paso angeschossen und ausgeraubt.
Nahezu einhundert Jahre später stößt bei Recherchearbeiten für seine Abschlussarbeit der junge Student Edmund Starr auf diesen Fall. In der Folge erfährt er vom El Paso-Testament. Ist es ein Fluch oder Vermächtnis?
Einige Jahre vergehen, bis in El Paso ein Richter ermordet wird, bei dem man munkelt, dass der künftige Präsident ihn an den Obersten Gerichtshof berufen möchte. Steve McCoy, der mittlerweile beim Heimatschutz arbeitet, wird mit diesem Fall betraut, da man befürchtet, dass dieses Verbrechen negativen Einfluss auf die Präsidentschaftskandidatur haben könnte. Steve erkennt, dass viel mehr hinter diesem Mord stecken muss. Begriffe wie Drogen, Kartell und organisiertes Verbrechen fallen und es dauert nicht lange, da geschieht ein weiterer Mord, der nicht der Letzte sein soll …
***
… ich suche die Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln …
(Buch Exodus, Kapitel 20)
***
Prolog
Der alte Mann sah aus dem Fenster seiner Wohnung auf das quirlige Treiben auf der Straße hinunter. Pferdekutschen, Lastkarren, Straßenverkäufer, dazwischen spielende Kinder und Frauen mit schweren Einkaufstaschen. Der Lärm drang bis zu ihm herauf. Schließlich war es bis zu seiner Wohnung auch nicht besonders hoch. Mehr als ein Stockwerk hatte er bisher nicht über die kleinen Schalterräume seiner Bank bauen können. Nein, dies war keine wirklich gute Gegend, und die Kunden seiner Bank waren nicht die reichen und mächtigen Familien der Stadt, wie er es sich erträumt hatte, sondern Gastwirte, Handwerker oder Ladeninhaber, die ihm ihr Erspartes anvertrauten.
Wehmütig hob er den Blick, bis er drei Blocks entfernt an der Hauptstraße das prächtige mehrstöckige Eckgebäude erkannte. Mit seiner Säulenfront und den verzierten Fensterrahmen, dem sorgfältig gedeckten Dach und der Fassade mit den vorspringenden Pfeilern wirkte es wie ein kleiner Palast. Eigentlich sollte er ihm gehören! Ebenso das Grundstück, auf dem das Gebäude stand. Sie hatten ihm alles weggenommen, und nur über ihn gelacht, wenn er mit ihnen sprach.
Zorn wallte in ihm auf, als er daran dachte, wie man ihn betrogen hatte. Und bisher hatte er nichts dagegen tun können. Sein einziger Sohn leitete inzwischen die Bank, doch der hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie man das Geschäft führte, und er hatte hochfliegende Pläne. Das immerhin musste er ihm zugutehalten, auch wenn er nicht alle Entscheidungen seines Sprösslings guthieß. Doch es war sein einziges Kind, und seine Frau war schon vor einigen Jahren gestorben.
Der Alte besaß jetzt kaum noch Einfluss in der Bank. Er saß zwar immer noch in seinem alten Büro, das klein und ungemütlich war, und sein Sohn hatte die goldenen Lettern mit dem Schriftzug »Präsident« an der Tür nicht entfernt – es war jedoch nur ein hohler Titel. Die Angestellten ignorierten ihn weitgehend, und das schmerzte. Vielleicht wurde es Zeit, dass er sich völlig aus dem Geschäft zurückzog.
Die Zeiten hatten sich geändert. Er erinnerte sich oft an die Postkutschen der Vergangenheit, die bald von den ersten Autos abgelöst worden waren, auch wenn die nur wie Kutschen aussahen. Es war alles ruhiger und weniger hektisch gelaufen.
Seufzend wandte sich der alte Mann vom Fenster ab und ging zu seinem Schreibtisch. Die Möbel waren inzwischen mit ihm alt geworden, doch das störte ihn nicht. Er hatte sich an sie gewöhnt, und auch an ihm war das Alter nicht spurlos vorüber gegangen.
Der Sessel knarrte bedenklich, als er sich niederließ und nach der Schatulle griff, die auf der Tischplatte stand. Sie war aus Mahagoni gefertigt und mit Elfenbeinintarsien verziert – eine schöne Handarbeit aus dem viktorianischen England. Er öffnete den Deckel und betrachtete eine Zeit lang den Inhalt. Anschließend nahm er ein Blatt Papier aus einer Schublade und tauchte eine Schreibfeder in ein Tintenfass.
Mit einem leichten Lächeln betrachtete er die Feder. Es gab schließlich sehr viel modernere Schreibgeräte, doch er hing an den alten Gewohnheiten. Er wusste sehr wohl, dass sein Sohn ihn manchmal für einen alten Narren hielt, der sich zu sehr an die Vergangenheit klammerte, aber das war ihm gleichgültig.
In Wahrheit war nur eine Erinnerung unauslöschlich in sein Gedächtnis gebrannt. Eine Eisenbahnfahrt vor langer Zeit, die sein Schicksal verändert hatte.
Er dachte einen kurzen Augenblick nach, bevor zu schreiben begann:
An meinen Sohn und dessen Nachkommen!
Wir ihr wisst, ist mir in der Vergangenheit schreckliches Leid widerfahren. Einige Männer haben meine Zukunft vernichtet und alle meine Träume zerstört. Sie und ihre Familien dürfen nicht mit ihren Verbrechen davonkommen, und ich bestimme mit diesem letzten Willen, dass meine Nachkommen nicht aufhören sollen, sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Dies sind die Namen jener Männer und das, was sie getan haben …
1. Kapitel
In der Nähe von El Paso, Texas, Vereinigte Staaten, April 1898
Das gleichmäßige Rattern und Schwanken der Eisenbahn hatte Jeremiah Stern in eine gewisse Schläfrigkeit versetzt, die jäh zu Ende war, als die Tür am hinteren Ende des Waggons krachend aufgerissen wurde und gegen die Wand schlug. Zwei Gestalten erschienen in der Öffnung, von denen die erste einen riesigen alten, aber äußerst gepflegten Revolver in der Hand hielt.
Desperados! dachte Jeremiah Stern. Sie wollen den Zug ausrauben wie in den früheren gesetzlosen Jahren. So etwas war seit ewigen Zeiten nicht mehr passiert, und dabei sind wir nur wenige Meilen von El Paso entfernt.
Wieso geschah es jetzt? Wieso ihm? Er war in seinem Leben noch nie mit Verbrechern in Kontakt gekommen, und ausgerechnet heute sollte es ihm passieren?
Er nahm die lederne und sehr schwere Arzttasche, die er während der ganzen Fahrt von Los Angeles nach El Paso keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte, vom Nebensitz, legte sie auf seine Oberschenkel und presste sie fest gegen seine Brust. Seine runde Nickelbrille rutschte ihm vor Aufregung fast von der Nase.
Es war ihm unerklärlich, woher die Typen während der Fahrt überhaupt gekommen waren. Es gab nur diesen einen Personenwagen. Doch dann fiel ihm ein, dass dahinter ein Viehwaggon angehängt war, in dem auch Pferde transportiert wurden. Anschließend folgten noch zwei oder drei Güterwagen. Er hatte auf dem Bahnsteig nicht genau darauf geachtet, als der kurze Zug langsam zum Stehen kam. Nur den Postwagen gleich hinter dem Kohletender hatte er registriert.
Wahrscheinlich waren die beiden Halunken bei ihren Pferden geblieben und hatten auf die richtige Gelegenheit für ihren Überfall gewartet.
»Sitzen bleiben und alle Hände nach oben!«, brüllte der Typ in der Tür und blickte wild um sich.
Die erschrockenen Fahrgäste drehten die Köpfe zu den beiden Männern, die jetzt in den Gang stürmten. Auch der zweite, der jüngere Mann hielt einen Revolver in der Hand, deutlich kleiner als der Colt des ersten Banditen. Sie ließen die Waffen kreisen, um die Fahrgäste einzuschüchtern.
Es waren außer ihm genau zehn, wie Jeremiah Stern mehrmals gezählt hatte, wenn es ihm zu langweilig geworden war, aus dem Fenster auf die eintönige Landschaft zu blicken. Das Interessanteste waren hin und wieder die Steppenläufer aus Gras gewesen, die ein leichter Wind über die Ebene trieb.
Da war eine ziemlich dicke Frau mit einem halbwüchsigen Kind, das die anderen Personen im Waggon ständig belästigte, ein Paar, das Händchen hielt und sich verliebt ansah sowie vier Männer unterschiedlichen Alters, die in ihren Zeitungen lasen oder sich leise unterhielten. Sie sahen nach Farmern oder Viehzüchtern aus, die viel Zeit unter freiem Himmel verbrachten. Alle waren den Anweisungen des Banditen gefolgt und streckten ihre Arme gehorsam in die Höhe.
Schließlich war da noch eine junge, gut gekleidete Frau mit einer älteren Schwarzen, die offensichtlich ihr Dienstmädchen war. Die junge und recht hübsche Frau war am wenigsten beeindruckt von dem Tumult und hatte ihre Hände nur bis knapp in Schulterhöhe gehoben.
»Wenn sich alle vernünftig verhalten, passiert keinem was!«, brüllte der ältere Bandit. Seine Kleidung schien ziemlich abgerissen, und der breitkrempige Hut hatte auch schon bessere Tage gesehen. Seine Hose wurde durch eine Art Kälberstrick zusammengehalten, und seine Stiefel waren abgetreten. Jedoch der Revolvergurt war neueren Datums und nur wenige Patronen steckten in den dafür vorgesehenen Schlaufen.
Jeremiah Stern verzog schmerzlich das Gesicht. Diese Beobachtungen halfen ihm leider nicht weiter.
Während die beiden Zugräuber sich mit dem Ehepaar und der Dame mit dem Kind beschäftigten, öffnete er vorsichtig seine Tasche. Die dicke Matrone zeterte, als der jüngere Mann ihr die golden glänzende Halskette mit einem heftigen Ruck abriss. Sein Kumpan hielt mit seinem Revolver die übrigen Fahrgäste in Schach.
Das eingeschüchterte Ehepaar leistete keinen Widerstand. Die beiden zogen sogar ihre Ringe vom Finger.
Jeremiah Stern hatte inzwischen seine Tasche einen kleinen Spalt geöffnet und ließ jetzt seine rechte Hand hineingleiten. Seine Finger tasteten umher, bis sie auf hartes Metall stießen. Ganz langsam zog er seine Hand wieder heraus, während der Revolver auf die andere Seite des Mittelganges zielte. Zwei goldene Münzen erschienen zwischen Daumen und Zeigefinger. Rasch ließ er sie in eine der Taschen seines Anzuges gleiten.
Die Zugräuber widmeten sich jetzt den vier Männern, die wortlos ihre Wertsachen aushändigten. Jeremiah sah ein paar Dollarscheine, einige Münzen und zwei billige Taschenuhren den Besitzer wechseln.
Viel ist es ja bisher nicht, was die Desperados in die Finger kriegen, dachte er. Jetzt war nur noch die Lady mit dem Dienstmädchen zwischen ihm und den Räubern.
Jeremiah nutzte den Moment, als die Banditen ihren Blick auf die beiden Frauen richteten und griff erneut in seine Tasche. Diesmal konnte er eine ganze Handvoll Münzen herausziehen. Vorsichtig jedes Klimpern vermeidend schob er sie in seine Anzugtasche und atmete erleichtert aus, obwohl es nicht viel war, was er aus der Tasche geborgen hatte.
Die junge Frau blickte angewidert auf die abgerissenen Gestalten, die sich jetzt vor ihr aufbauten.
Einen Versuch konnte er noch riskieren. Die Münzen durften dabei jedoch nicht gegeneinander klappern. Er hielt die Luft an, bis sie sicher in einer Anzugtasche verstaut waren. Die Banditen hatten die Kleidung ihrer Opfer bisher nicht kontrolliert, und er hoffte, dass es bei ihm genauso sein würde. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen auf der anderen Seite des Ganges zu.
»Was haben Sie uns denn anzubieten, schöne Frau?«, fragte der ältere grinsend und streckte die Hand aus.
Sie zog einen schmalen Goldreif vom Finger und warf ihn auf den Boden. »Hier! Nehmen Sie!«
Der Bandit verpasste ihr eine Ohrfeige, sodass ihr Kopf gegen die Rückenlehne schlug. »Das wird dich lehren, nicht so unhöflich zu sein«, zischte er. »Jetzt mach’ deine Tasche auf und lass’ mich sehen, was drin ist.«
Sie ließ ihm ihre kleine Reisetasche auf den Fuß fallen, das Gesicht dunkelrot vor Zorn. »Mein Mann wird dich hängen lassen!«
Er lachte auf. »Mal sehen, ob meine Kugel ihn eher erwischt.«
Der jüngere Räuber zupfte ihn am Ärmel. »Wir sollten abhauen«, raunte er.
Der andere drehte sich zu Jeremiah Stern um. »Der da fehlt noch. Sieh’ mal, was für einen feinen Anzug er trägt und was für eine interessante Tasche er da bei sich hat. Wollen wir doch mal sehen, was drin ist.«
Jeremiah Stern schloss die Augen. Die Münzen, die er aus seiner Arzttasche geborgen hatte, schienen plötzlich eine Tonne zu wiegen. Er fühlte sich nach unten gezogen und spürte, wie die Angst in ihm hochkroch.
*
»Ist der Kerl etwa eingeschlafen?« Jeff Holbrooke blickte seinen Kumpel Bill fragend an. »Wäre ja kein Wunder bei dem gleichmäßigen Geratter des Zuges.«
»Sollte mich wundern«, entgegnete Bill in seinem breiten texanischen Slang. »Vielleicht denkt er auch, wir sehen ihn nicht.«
Bill Anderson drehte sich wieder um, damit er die Insassen des Waggons im Auge behalten konnte und schwenkte drohend seine Waffe hin und her.
Jeff stupste den vor ihm sitzenden Mann mit dem Revolverlauf auf die Stirn und musterte ihn genauer. Eine Nickelbrille auf der Nase, gekleidet in einen teuer aussehenden Anzug ohne Risse oder Flicken, glänzende Stiefel ohne Sporen, ein Stetson über akkurat geschnittenen Haaren – kein Revolvergürtel. Er dachte einen Moment über diese Tatsache nach, wobei ihm dämmerte, dass es vielleicht besser gewesen wäre, die Fahrgäste als Erstes nach Waffen zu durchsuchen. Zum Glück war nichts passiert. Doch beim nächsten Mal sollten sie gründlicher vorgehen.
Sein Vater hatte ihm schließlich beigebracht, keinem Menschen zu vertrauen und immer mit dem Rücken zur Wand zu sitzen. Da er die meiste Zeit in einem Saloon bei billigem Fusel verbrachte und dabei mit anderen stumpfsinnigen Kerlen Poker spielte, war es wohl auch besser, niemandem im Rücken zu haben, der ihn dabei beobachtete, wie er beim Spielen betrog.
Na ja, der Alte war nun schon lange tot, und das Einzige, das er von seinem Vater geerbt hatte, war der Army Colt, den er an seinem unseligen Todestag nicht bei sich getragen hatte.
Jeff Holbrooke richtete den alten Revolver jetzt auf den Anzugträger, der seine komische Ledertasche krampfhaft umklammert hielt und seine Augen immer noch geschlossen hatte.
Er stieß ihm spielerisch die linke Faust gegen die Schulter. »Mach´ die Tasche auf!«
»Damit kommen Sie nicht durch!«, presste Jeremiah Stern zwischen den Zähnen heraus, nachdem er die Augen geöffnet hatte. »Wie wollen Sie denn jetzt fliehen?«
»Das ist doch nicht deine Sache!« Jeff drehte sich wieder zu seinem Kumpan um. »Er weiß offenbar nicht, dass der nächste Waggon in diesem Zug für die Pferde bestimmt ist. Der Kerl glaubt, dass wir zu blöd sind, einen Fluchtplan zu haben«, höhnte er.
Erneut stieß er den Mann mit der Arzttasche mit dem Revolver an, diesmal etwas heftiger. »Nun zeig’ uns schon, was du so krampfhaft festhältst.«
Jeff dachte erneut an seinen Vater, der sein unrühmliches Ende bei einem Pokerspiel gefunden hatte, als ihn ein Mitspieler dabei erwischte, wie er ein zusätzliches Ass aus dem Ärmel zog.
Sie waren seinerzeit nach Tombstone in Arizona gezogen, wo man vor etwa zwanzig Jahren eine Silberlagerstätte gefunden hatte. Der Ort wurde rasch zur Boomtown und zog eine Menge zwielichtiges Gesindel an. Recht und Gesetz blieben auf der Strecke, und Schießereien waren an der Tagesordnung. Von Wyatt Earp und Doc Holliday redeten die Leute heute noch.
Nachdem sein Vater aus dem Sezessionskrieg zurückgekommen war, hatte er nichts außer einer halb zerfetzten Uniform und seinem Colt besessen. Jeff wusste nicht, wo er seine Frau – seine Mutter – kennen gelernt hatte. Jedenfalls hatten sie versucht, sich eine Existenz als Farmer aufzubauen. Nach Jeffs Geburt war es jedoch immer weiter abwärts gegangen. Das wenige Geld, das sie verdienten, gab sein Vater für Whiskey aus. Er begann, im Suff seine Frau zu verprügeln – bis sie eines Tages nicht mehr da war. Jeff hatte kaum eine Erinnerung an sie, eine stille, verhärmte Frau in schwarzen Kleidern.
In Tombstone hatte sein Vater nie eine Unze Silber gesehen. Eines Tages reinigte er seinen alten Colt und überfiel damit eine kleine Bank. Auch dabei hatte er jedoch kein Glück, denn die Bank besaß einen Wachmann, und der schoss wesentlich schneller und genauer als sein Vater, der mit einem Streifschuss das Weite suchen und eine Zeit lang untertauchen musste. Ihre Farm gehörte inzwischen einer Bank.
Als Jeff älter war, schlug er sich einige Zeit mit Gelegenheitsarbeiten durch, bis er beschloss, sein Glück in Texas zu versuchen. Er fand eine Anstellung bei einem der großen Viehbarone und kümmerte sich um eine Herde Longhornrinder. Seine junge Frau, die er in einem Saloon kennengelernt hatte, blieb mit ihrem gemeinsamen Sohn weiter in einem winzigen Zimmer über dem Saloon. Er hatte ihr versprochen zurückzukommen und sie und das Kind zu holen, wenn er genügend Geld verdient hätte, um eine eigene Farm zu kaufen.
Doch schon im äußersten Westen des Staates Texas war er hängen geblieben, wo er einige Typen traf, die Jesse James nacheifern und ihr Einkommen mit Eisenbahnüberfällen aufbessern wollten. Nach dem ersten geglückten Überfall hatten sie sich wieder getrennt, und nur Bill war bei ihm geblieben. Er war etwas unterbelichtet, aber ein guter Schütze. Auch Bill hatte jung geheiratet und besaß zwei kleine Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Allerdings waren sie mit ihrer Mutter zu seiner Schwiegermutter nach San Francisco gezogen, da sie das rastlose Leben, das Bill führte, nicht länger ertrugen.
»Was hast du gesagt?« Eine Stimme hatte Jeff aus seinen Erinnerungen gerissen.
»Er macht seine Tasche nicht auf«, wiederholte Bill.
Jeff starrte auf den Mann im Anzug herunter, der ihn mit ängstlichen Augen ansah. »Ich habe nichts wertvolles bei mir«, flüsterte er.
»Das werden wir gleich sehen!«
Jeff richtete seinen Revolver auf den Mann und schoss. Die Explosion dröhnte durch den Waggon. Die Fahrgäste schrien durcheinander und warfen sich unter den Sitzbänken in Deckung. Jeremiah Stern starrte fassungslos auf seinen linken Oberarm. Dort hatte die Kugel einen Fetzen aus seinem Anzug gerissen. Darunter rann Blut aus einer Fleischwunde.
Jeff riss ihm die Tasche aus den Händen, stellte sie auf die Sitzbank und klappte sie auf. Er blickte hinein und zog einen dicken Umschlag heraus, den er Bill reichte.
»Sieh’ mal nach, was das ist.« Seine Fertigkeiten im Lesen und Schreiben waren nicht sehr hoch entwickelt. Bill war immerhin ein paar Jahre länger zur Schule gegangen.
Dann starrte er wieder in die Tasche, und auf seinem Gesicht zeichnete sich ungläubiges Staunen ab.
»Heute ist unser Glückstag!«, murmelte er.
2. Kapitel
Washington D. C., Vereinigte Staaten, April 2004
»Was Sie da suchen, haben wir nicht auf Mikrofilm.«
Die Bibliothekarin blickte ihn durch ihre altmodische Hornbrille, die ihr etwas zu tief auf der spitzen Nase saß, streng an. »Wir können auch nicht alles digitalisieren. Das verstehen Sie doch, oder? Wir haben hier in der Smithsonian Institution Millionen von Artefakten und Schriftstücken archiviert. Nicht alles ist ausreichend katalogisiert.«
Edmund Starr sah sie bittend an. »Ich studiere amerikanische Geschichte. Meine Abschlussarbeit beschäftigt sich speziell mit den gesellschaftlichen Veränderungen während der Eroberung des Westens, und dafür benötige ich die originalen Presseartikel aus jener Zeit.«
Der Blick der Bibliothekarin wurde etwas weicher. »Haben Sie irgendein Dokument, das diese Tatsache beweist?«
»Ja, natürlich!« Der junge Student griff in seine Collegemappe und zog ein Blatt Papier heraus. »Das ist ein Brief meines Professors, der für meine Arbeit um Unterstützung bittet.«
Sie nahm ihm das Schreiben aus der Hand und studierte es gründlich. Dann nickte sie. »Professor Macaulay von der George Washington University. Den kenne ich. Das ändert die Situation.«
Sie legte den Brief aus der Hand und begann, auf der Tastatur ihres Computers zu tippen. »Welche Zeitungen interessieren Sie denn besonders?«
Edmund versuchte, auf ihren Monitor zu schielen. »Wichtig wären die Zeitungen aus Texas in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.«
Sie nickte und tippte erneut.
»Zeitungen aus El Paso wären ganz besonders interessant«, ergänzte er hoffnungsvoll.
»Da komme ich nämlich her«, fügte er nach einer Pause hinzu.