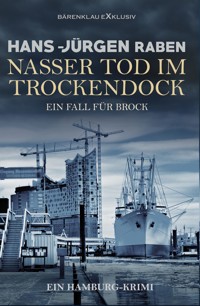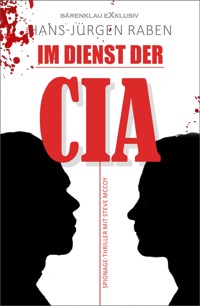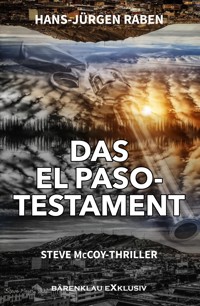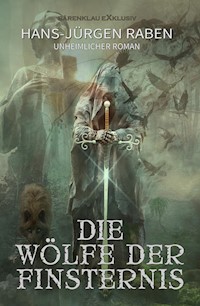Wundersame Weihnacht – Die geheimnisvolle Begegnung: Geschichten und Märchen zur Weihnachtszeit E-Book
Raben Hans-Jürgen
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn sich das Jahr dem Ende nähert, es draußen zeitig dunkel wird, dann wissen alle – Weihnachten steht vor der Tür – und damit die Zeit der Märchen und Geschichten rund um das Weihnachtsfest, das Fest, das Kinderaugen zum Leuchten bringt, und selbst Erwachsene sich ein kleines Stück Kindheit zurückwünschen.
Dieser Band ist für die ganze Familie gedacht und soll helfen, das Tempo aus dem Alltag zu nehmen und somit die Vorweihnachtszeit zu verschönern …
In diesem Band sind zahlreiche Geschichten und Märchen zur Weihnachtszeit nationaler und internationaler Autoren enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wundersame
Weihnacht
Die geheimnisvolle Begegnung
Geschichten und Märchen zur Weihnachtszeit
Herausgegeben von Kerstin Peschel
Mit Geschichten und Märchen unter anderem von Hans-Jürgen Raben, Jonas Kirby, Lion Obra, Angelika Beck, Britta Banowski, Rainer Popp, Mara Laue, Roland Heller, Ursula Gerber, Elisabeth Richter, Ines Schweighöfer, Wolfgang Bittner, Kevin Gratzl, Selma Langerlöf, Paula Dehmel, Luise Büchner …
Impressum
Copyright © by Author/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Bärenklau Exklusiv nach Motiven, 2024
Korrektorat: Katharina Schmidt, Sandra Vierbein, Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
www.baerenklauexklusiv.de / [email protected]
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Weihnachtszwerg
Der Geisterhund
Weihnachten in der Speisekammer
Engel von Frau Bartel
Als der Weihnachtsmann dem Nikolaus begegnete
Weihnachten 1653 im Hause Leupolth
Ein Weltreich in einem Cognac-Schwenker
Der Weihnachtsbesucher
Oma Bonningks besondere Weihnacht
Peter und die Liebenden
Sie hatten nicht mehr damit gerechnet
Ein Weihnachtsgast
Der Heilige Abend, an dem wir nicht zur Kirche gingen
Das schwindende Licht
Die Heimkehr
Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt
Das Wispern der Bücher
Ein Imageproblem
Zitate und Sprüche zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel
Backrezepte für die Weihnachtsbäckerei
Folgende Weihnahtbände sind ebenfalls erhältlich:
Das Buch
Wenn sich das Jahr dem Ende nähert, es draußen zeitig dunkel wird, dann wissen alle – Weihnachten steht vor der Tür – und damit die Zeit der Märchen und Geschichten rund um das Weihnachtsfest, das Fest, das Kinderaugen zum Leuchten bringt, und selbst Erwachsene sich ein kleines Stück Kindheit zurückwünschen.
Dieser Band ist für die ganze Familie gedacht und soll helfen, das Tempo aus dem Alltag zu nehmen und somit die Vorweihnachtszeit zu verschönern …
***
In diesem Buch sind folgende Geschichten und Märchen enthalten:
› Der Weihnachtszwerg – von Ursula Gerber
› Der Geisterhund – von Mara Laue
› Weihnachten in der Speisekammer – von Paula Dehmel
› Engel von Frau Bartel – von Elisabeth Richter
› Als der Weihnachtsmann dem Nikolaus begegnete – von Angelika Beck
› Weihnachten 1653 im Hause Leupolth – von Tomos Forrest
› Ein Weltreich in einem Cognac-Schwenker – von Lion Obra
› Der Weihnachtsbesucher– von Jonas Kirby
› Oma Bonningks besondere Weihnacht – von Ines Schweighöfer
› Peter und die Liebenden– von Britta Banowski
› Sie hatten nicht mehr damit gerechnet – von Roland Heller
› Ein Weihnachtsgast – von Selma Langerlöf
› Der Heilige Abend, an dem wir nicht zur Kirche gingen – von Wolfgang Bittner
› Das schwindende Licht – von Kevin Gratzel
› Die Heimkehr – von Rainer Popp
› Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt – von Luise Büchner
› Das Wispern der Bücher– von Hans-Jürgen Raben
› Ein Imageproblem – von Mara Laue
Bonus:
Backrezepte für die Weihnachtsbäckerei
***
Wundersame Weihnacht
– Die geheimnisvolle Begegnung –
Der Weihnachtszwerg
Ursula Gerber
Schon wieder geht es mit Riesenschritten auf Weihnachten zu.
»O herrje!« Frau Pulver vom Altersheim Sunneschyn seufzt.
Die Jahre vergehen immer schneller, die Insassen werden immer älter – sie mit eingeschlossen – und es wird immer schwieriger, für die vielen Leute eine heimelige Weihnachtsfeier auf die Beine zu stellen.
Sie blickt zum Fenster hinaus in den Schnee, wo die weißen Flocken lautlos vom Himmel segeln. Für die meisten ihrer Schützlinge ist zum Glück gesorgt, die können nach Hause zu ihren Kindern oder anderen Verwandten gehen. Beim Großteil derjenigen, die im Sunneschyn zurückbleiben, kommt wenigstens tagsüber jemand von der Familie zu Besuch, um ihnen zu zeigen, dass sie noch nicht ganz vergessen worden sind. Manch ein Angehöriger ist auch schon länger geblieben und hat dann zusammen mit seinem alten Vater oder der Mutter an der Altersheim-Weihnachtsfeier teilgenommen.
Aber für über ein Dutzend Frauen und Männer sind die Weihnachtstage eine traurige Zeit. Die meisten von ihnen sind schon so alt, dass sie keine Angehörigen oder Freunde mehr haben. Von den anderen hätte der eine oder die andere schon noch irgendwo Verwandtschaft, nur leider niemanden mehr, der zu Besuch zu ihnen kommt. Sie sind einfach aus dem Leben und dem Gedächtnis gestrichen worden, als wenn sie schon verstorben wären oder es sie nie gegeben hätte.
Eine wirklich traurige Geschichte!
»Ach!« Mutter Pulver, wie sie von den Altersheiminsassen liebevoll genannt wird, stößt erneut einen tiefen Seufzer aus. Wenn man den armen Seelen doch wenigstens diese schwere Zeit irgendwie leichter machen könnte!, geht es ihr, wie schon so oft, wieder traurig durch den Sinn.
Aber von ihren Angestellten verlangen, dass sie sich mehr um die alten Leute kümmern oder gar an Heilig Abend oder Weihnachten für diese Fremden noch hierbleiben sollen, kann sie natürlich nicht. So wird halt dann außer denjenigen, die an diesen Tagen ohnehin Dienst tun müssen, auch in diesem Jahr – ausgenommen sie selbst – vom Personal sonst niemand zusätzliches mehr anwesend sein.
Mutter Pulvers Gedanken kreisen wie immer um dasselbe Problem: Die Kasse ist knapp und das Geld schon während des Jahres für seltene Anlässe wie Ausflüge, Konzerte oder auch mal einen Kino- oder Zoobesuch draufgegangen.
Damit muss sie sich jeweils trösten, dass ja eigentlich sogar mehr für die alten Leute getan oder mit ihnen unternommen wird, als vorgeschrieben ist. Aber zufrieden mit der Situation ist sie deswegen trotzdem nicht. Letztendlich gehört doch für eine solch spezielle Feier halt eben mehr dazu, als ein farbig geschmückter Baum, Kekse und ein paar Weihnachtslieder.
Dieses Jahr hat Mutter Pulver außergewöhnlich viel zu tun gehabt. Und ausgerechnet jetzt noch, zwei Wochen vor dem ersten Advent, muss sie einen dringen Fall aufnehmen, was ihr diesmal ziemlich sauer aufstößt.
Es handelt sich um einen alten, verhutzelten Mann mit einem wettergegerbten, runzligen Gesicht, kaum einen Meter fünfzig groß, aber trotz – oder vielleicht gerade wegen – seinem Kleinwuchs ist er ein richtiger Giftzwerg.
Die Polizei hat den Obdachlosen im Städtchen aufgelesen und dann nach einem kurzen Gesundheits-Check im Spital bei ihr abgeliefert.
Er ist mager wie ein Windhund, sieht beinahe verhungert aus. Seine Kleider stehen vor Dreck und weisen kaum einen Flecken auf, an dem nicht ein farbiges Stück Stoff mit Bostitch-Heftklammern angenietet worden ist.
Eigentlich ging Mutter Pulver davon aus, dass der Mann der Polizei und ihr für ihre Mühe dankbar sein würde, stattdessen macht er einen Aufstand, als wenn’s um Töten ginge. Noch bevor die Beamten überhaupt wieder weggefahren sind und erst recht, als sie ihn ins Altersheim hineinführt, lamentiert er schimpfend wie ein Rohrspatz.
»Aber, Herr Kaspar, nun haben Sie sich doch nicht so«, versucht sie ihn zu beruhigen. »Es ist doch jetzt sicher kalt draußen, und Sie werden hier ein warmes Plätzchen haben …«
»Ach, dummes Zeug!«, empört er sich entrüstet. »Ich weiß nicht, was ich hier verloren habe! Das ist idiotischer Blödsinn, dass mich die zwei Beamten hierher geschleift haben! Und das noch gegen meinen Willen. Ich protestiere! Ich kann noch ganz gut auf mich selbst aufpassen!«, keift er zetermordio.
»Davon spricht doch auch gar niemand, Herr Kaspar. Aber jetzt kommen Sie erst mal herein. Ich bin sicher, Sie könnten eine warme Suppe oder so etwas vertragen, meinen Sie nicht auch?«
Aber Frau Pulver nützt alle Freundlichkeit nichts, um den aufgebrachten Giftzwerg zu beschwichtigen.
»Ich habe keinen Hunger! Am Ende ist noch etwas drin, das mir nicht guttut, und dann lasst ihr mich daran sterben!«
Dieser Vorwurf bringt nun selbst die gutherzige Mutter Pulver auf die Palme. »Natürlich nicht! So ein blödes Geschwätz, Herr Kaspar!«, gibt sie verstimmt zurück. »Und jetzt, papperlapapp, schicken Sie sich da rein und kommen Sie, bevor ich mich vergesse und härtere Methoden anwende!«
Darauf, dass die Heimleiterin plötzlich laut wird, ist er nicht gefasst. Zwar hat sie es mit ihrer Drohung nicht wirklich ernst gemeint, aber dem kleinen Mann ist sie gehörig falsch eingefahren. Aufgebracht starrt er sie an. Mit verkniffener Miene richtet er sich zu voller Größe auf, bevor er sich weiter beschwert: »Ich habe es ja gewusst, dass es nicht gut herauskommt! Aber diese blöden Esel von der Polizei wollten des partout nicht begreifen, und Sie allem Anschein nach auch nicht! Hier bleibe ich auf gar keinen Fall!«
»Aber doch wenigstens übers Wochenende«, beginnt Mutter Pulver wieder freundlich und fährt schnell fort, bevor er den Mund öffnen und von Neuem reklamieren kann: »Wenn Sie danach wieder gehen wollen, dann soll es halt meinetwegen so sein. Aber wenigstens sollten Sie sich hier ein bisschen aufwärmen und etwas Anständiges essen, meinen Sie nicht auch, Herr Kaspar?«
Nach langem Zureden willigt der griesgrämige Trotzkopf schließlich doch noch ein und lässt sich von ihr hineinführen.
Während die Auszubildende Fanny neue Kleider für ihn besorgt, begleitet ihn Mutter Pulver zu einem kleinen Zimmer im Westflügel des Altersheims. Es ist das einzige, das noch frei ist.
Als sie die Türe öffnet, sagt sie zu ihrem neuen Gast: »Das ist jetzt für die nächsten drei Tage ein bisschen Ihr Zuhause. Hier haben Sie ein sauberes, weiches Bett, Dusche und sogar eine Badewanne. Und wenn Sie wollen, können Sie hier auch fernsehen. Es gibt zwar auf dem Korridor ein Fernsehzimmer, wo Sie nicht so allein wären …«
»Ich brauche niemanden!«, bellt der Alte jedoch grimmig zurück.
»Dann halt nicht, meinetwegen.« Frau Pulver zuckt resigniert mit den Schultern. Sie schlägt das Bettzeug für ihn auf, als es draußen klopft.
»Herein«, sagt sie.
Fast schüchtern öffnet Fanny die Türe und tritt ein. »Ich bringe Ihnen ein frisches Hemd und Hosen, Herr Kaspar«, plappert sie freundlich und legt die Kleider für ihn aufs Bett.
»Ich brauche nichts!«, fährt er heftig aufbegehrend zu ihr herum.
Fanny widerspricht: »Aber natürlich. Sie können doch nicht in diesen kaputten und schmutzigen Kleidern hierbleiben …«
Balthasar Kaspar wirft ihr mit zusammengezogenen Augenbrauen einen störrischen Blick zu. »Ich sagte doch, ich wolle nicht!«
»Jetzt geben Sie aber mal Ruhe, Herr Kaspar!«, donnert nun Mutter Pulver auf einmal böse. »Noch ein Wort, und ich werfe Sie höchstpersönlich zum Tempel hinaus!«, schimpft sie. Entnervt macht sie auf dem Absatz kehrt und nimmt Fanny mit sich hinaus.
Die beiden Frauen werfen sich einen viel sagenden Blick zu.
»Ich erwarte Sie in einer Viertelstunde vorne zum Abendessen!«, erklärt sie mit schroffem Ton gerade noch knapp, bevor sie die Zimmertüre hinter sich zuzieht.
Draußen auf dem Korridor lässt Fanny ihren Gefühlen kopfschüttelnd freien Lauf: »Das ist aber ein unflätiger Giftzwerg!«
Mutter Pulver nickt zustimmend. Sie hat sich bereits wieder beruhigt und es ist ihr ein bisschen peinlich, dass sie so ausgerastet ist. Begütigend legt sie dem Mädchen die Hand auf die Schulter. »Lass es gut sein, Fanny. Wir wissen ja nicht, was er alles durchgemacht hat, dass er so geworden ist«, nimmt sie den zänkischen Griesgram daraufhin wieder in Schutz, bevor sie sich zum Gehen wendet.
Ja, schon, denkt Fanny im Stillen für sich und folgt ihr. Aber ein klein wenig freundlicher könnte er ja trotzdem sein, oder nicht?
Als Kaspar Balthasar nach einer halben Stunde noch immer nicht vorne beim Eingang aufgetaucht ist, wird Mutter Pulver nun doch unruhig. Sie schickt zwei Altenpfleger nach dem neuen Gast, um nachzusehen, was los ist.
Sämi Reber klopft, erhält aber keine Antwort.
Nach dem vierten Mal zuckt Kollege Andi Luginbühl resigniert mit den Schultern und macht Anstalten, den Rückzug anzutreten.
Da wird es Sämi einfach zu bunt und er öffnet die Türe selbst.
Drinnen im Zimmer sitzt der kleine Mann im Polstersessel, ohne sich zu rühren.
»Entschuldigen Sie, Herr Kaspar, aber … geht es Ihnen nicht gut?«, erkundigt sich Sämi besorgt, weil dieser ein Loch in den Tisch starrt und noch nicht einmal den Kopf nach ihnen umdreht.
»Sackerment!«, explodiert der Giftnickel daraufhin förmlich: »Was habt Ihr hier verloren, Ihr freches Pack? Raus! Ich will meine Ruhe! Raus, sonst schreie ich!«
»So beruhigen Sie sich doch, Herr Kaspar. Wir wollten Ihnen nichts Böses. Frau Pulver lässt Sie zum Essen rufen. Sie haben halt auf unser Klopfen nicht reagiert«, entschuldigt sich Luginbühl ungemütlich.
»Ich habe keinen Hunger!«, faucht der Alte barsch zurück.
»Und anders anziehen sollten Sie sich auch«, meint Reber unbeeindruckt. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen.«
Natürlich ist das für den Dreikäsehoch absolut kein Thema.
»Frau Pulver hat verlangt, dass Sie gewaschen und anders angezogen bei Tisch erscheinen, Herr Kaspar. Also, machen Sie keinen Aufstand, sonst müssen wir nachhelfen«, droht Sämi Reber, der sich von dem Knirps nichts sagen lässt.
Als die beiden Altenpfleger mit eindeutiger Absicht auf ihn zutreten, fängt Balthasar Kaspar zetermordio an zu schreien: »Geht weg, verschwindet! Fasst mich nicht an! Lasst mich in Ruhe, Pfoten weg! Ich will nicht! – Potz Blitz nochmal, ich sagte doch, ich will nicht …!«
Er kommt gar nicht mehr aus dem Zanken und Wettern heraus, weil sie ihn kurz entschlossen einfach packen, ins Badezimmer verfrachten, ausziehen und unter die Dusche stellen.
Das Gebalge, das der Alte veranstaltet, führt dazu, dass am Schluss alle drei tropfnass wie begossene Pudel dastehen, das Männchen nun zwar sauber, aber dafür fuchsteufelswild. Unter Zwang streifen ihm die beiden auch die neuen Kleider über.
Danach klopft ihm Sämi Reber zufrieden auf die Schulter: »War das denn jetzt so schlimm, Herr Kaspar? Kommen Sie, wir wollen Frieden schließen und essen gehen«, versucht er es wieder auf die freundliche Tour.
Aber so leicht vergibt ihnen dieser nicht, was sie ihm soeben sträflich angetan haben. Mit erhobener Faust geht er aufs Neue wütend auf sie los, um sie hinauszutreiben: »Ich sagte doch schon, ich habe keinen Hunger! Lasst mich jetzt endlich in Frieden, ihr Barbaren! Haut ab! Eine Saubande seid ihr! Ich werde mich bei eurem Chef beschweren!«, spuckt er wieder Gift und Galle.
Luginbühl grinst vielsagend zu seinem Kollegen hinüber.
»Sie meinen, bei der Chefin«, nickt Reber ruhig. »Gerade die hat uns hierhergeschickt. Aber gehen Sie nur. Mutter Pulver wartet ohnehin im Essraum auf Sie. Dann können Sie gleich bei Ihr den Kropf leeren. Aber jetzt kommen Sie, ich habe einen Mordshunger. Du nicht auch, Sämi?«
Die zwei Altenpfleger lassen den Giftzwerg einfach stehen und gehen hinaus.
Missmutig blickt ihnen Balthasar Kaspar aus der Türe hinterher. Aber dann packt ihn doch die Neugier. Und Hunger verspürt er eigentlich auch. Ich kann es mir ja wenigstens mal ansehen, denkt er schließlich bei sich.
Um sich in dem fremden Haus nicht zu verlaufen, marschiert er den beiden – wohlgemerkt mit einem riesigen Abstand – eilig hinterher.
Es riecht schon von Weitem richtig gut. Balthasar läuft nun doch das Wasser im Mund zusammen. Sein Magen knurrt und erinnert ihn daran, dass er schon lange nichts Gescheites mehr zwischen die Zähne bekommen hat.
Im Eingang zum großen Essensaal, in dem annähernd ein Dutzend verschieden lange Tische stehen, hält er fast ein wenig erschrocken inne. So viele Leute sind ihm in dieser fremden Umgebung nicht ganz geheuer.
»Kommen Sie nur herein, Herr Kaspar«, begrüßt ihn Mutter Pulver, die durch die Tische hindurch auf ihn zugeeilt kommt, als hätte sie nur auf ihn gewartet. Sie lächelt ihm zufrieden zu. »Wir finden für Sie schon noch ein Plätzchen. Kommen Sie.«
Ohne ein Wort darüber zu verlieren, weil er sauber und frisch angezogen ist, geht sie ihm zielstrebig durch den Raum voran und deutet auf einen kleinen, im hinteren Teil etwas separat stehenden Tisch.
»Ist es Ihnen hier recht? Was möchten Sie essen? Es gibt Pastetchen mit Erbsen und Karotten. Sie können die Soße aber auch mit Teigwaren oder Reis haben«, klärt sie ihn auf.
Kaspar setzt sich hin und kratzt sich unter dem ungepflegten Bart das Kinn. Nach langem hin und her überlegen gibt er danach endlich seinen Menüwunsch kund.
Nach dem Essen begleitet ihn Fanny zurück zu seinem Zimmer, damit er sich den Weg noch einmal einprägen kann.
Immer wieder dreht sie den Kopf nach ihm um und linst verstohlen hinunter auf seinen Bart.
Man hätte meinen können, er habe dort noch einen Vorrat angelegt, um später weiterzuessen; zwischen den dicht verworrenen Haaren hängen noch Gemüsestückchen und Soße.
»Was gaffst du mich so an?«, geifert Kaspar aufgebracht, als er nach einer Weile ihren Blick bemerkt.
Fanny schließt auf, öffnet und hält ihm die Türe auf. Während er an ihr vorbeistolziert, schüttelt sie entschieden den Kopf und folgt ihm in seine Zimmer hinein. »Das geht so nicht, Herr Kaspar!«, sagt sie. »Essensreste gehören in den Kühlschrank, und ein Dogibag ist Ihr Bart auch nicht. Da hängt ja noch das halbe Abendessen drin. Kommen Sie, setzen Sie sich hin, ich will sehen, ob ich die Erbsen und Karotten wieder rausbringe.«
Kaspar schielt über seine große Nase hinunter auf seinen Bart und muss sich eingestehen, dass dieser wirklich nicht gerade appetitlich aussieht.
»Was geht dich das an?«, giftelt er trotzdem, bevor er friedlicher ein: »Dann halt, meinetwegen!«, hinzufügt.
Fanny ist fast überrumpelt, dass er nicht weiter aufmuckt, sondern sich auf einen Stuhl setzt und sie freiwillig in seinem Gestrüpp walten lässt.
Aber das ist einfacher gesagt als getan.
»Das geht so nicht, Herr Kaspar!«, jammert sie bald darauf. »Ich bringe das Zeug so nicht raus! Wollen wir ihn waschen, oder darf ich ein Stück vom Bart abschneiden?«, fragt sie.
Balthasar verdreht die Augen. Wasser? Igitt! Nach seinen letzten Erfahrungen ist ihm Wasser jetzt erst recht ein Gräuel. »Dann hol halt die Schere hervor, wenn’s denn sein muss. Aber nicht alles, verstanden? Pass auf!«
Fanny nickt. »Ich tue mein Möglichstes«, verspricht sie.
Aber der Bart ist so dicht ineinander verwoben, dass sie die Spitze der Schere kaum hineinstoßen kann, um mit dem Schneiden beginnen zu können. Sie drückt und zerrt und verzweifelt fast. Als sie sich zum dritten Mal in die Finger sticht, verliert sie die Nerven. Kurzerhand setzt sie an der Seite an und schneidet den hässlichen Bart direkt am Ansatz ab.
Als Fanny den schmutzigen Filzklumpen in der Hand hält, in dem sich schon Leben zu regen scheint, wird sie vor Grausen von einem heftigen Schauder erfasst. Es gelingt ihr gerade noch, einen Schrei zu unterdrücken und lässt das Bartstück wie eine heiße Kartoffel fallen.
Als aber das Malheur dadurch sichtbar wird, rastet Kaspar natürlich wieder aus: »Du dumme Gans, was hast du getan?! Das wäre jetzt gewiss doch nicht nötig gewesen! Mein schöner Bart!«
Mit wild fuchtelnden Armen keift er entnervt herum, sodass Fanny hastig den Kopf zurückziehen muss. Aber sie fasst sich schnell und lächelt ihn an: »Jetzt haben Sie sich doch nicht wieder so, Herr Kaspar. Nun sehen Sie sogar mit diesem schönen, kurzen Bart ganz attraktiv aus. Da werden Sie sicher einigen von unseren Frauen gefallen.«
»Dummes Geschwätz! Mein schöner Bart!«, lamentiert er mit Zornesröte, aber sie lässt sich nicht beirren.
»Unsinn, Herr Kaspar. Der war schlimmer als das Gestrüpp beim Dornröschen. Und heraus gekommen ist doch ein ziemlich attraktiver Mann.«
Balthasar starrt Fanny sprachlos an. Ihre Engelszunge und freundliche Hartnäckigkeit vermögen ihn beinahe zu überrumpeln.
Die erste Nacht, die er seit Langem wieder einmal in einem weichen Bett verbringt, lässt ihn beinahe nicht einschlafen. Er, der die letzten Jahre draußen auf dem harten Boden oder auf einer Parkbank übernachtet hat, ist das einfach nicht mehr gewöhnt.
Am nächsten Morgen fühlt er sich wie gerädert; es kommt ihm vor, als schmerzten sämtliche Knochen. Halb lahm schlüpft er umständlich in seine neuen Kleider und erscheint daraufhin humpelnd am Frühstückstisch.
»Guten Morgen, Herr Kaspar. Sie sehen heute aber gut aus! Der kurze Bart steht Ihnen ganz toll«, wird er von Mutter Pulver mit einem anerkennenden Nicken begrüßt. Sie eilt ihm durch den Frühstücksraum entgegen und nimmt ihn gleich in Empfang.
Ihre Freundlichkeit und Zufriedenheit entlocken dem guten Mann um ein Haar ein Lächeln. Ob er will oder nicht, es tut ihm tief in der Seele wohl.
Als ihm erst noch die anderen Altersheiminsassen freundlich zunicken und einige sogar zuwinken, kommt es ihm auf einmal vor, als fiele ihm ein Gewicht von den Schultern. In seinem Inneren wird eine Tür aufgestoßen und es wird plötzlich hell. Eine ungewohnte Wärme durchflutet ihn, als er die Menschlichkeit dieser Leute spürt. Hier ist niemand, der ihn ablehnt oder etwas gegen ihn zu haben scheint. Als ihm dies bewusst wird, beginnt er allmählich aufzutauen.
Ebenfalls hat er inzwischen schon festgestellt, dass die Annehmlichkeiten in diesem Haus gar nicht so furchtbar schlecht sind, wie er sie zunächst verteufelt hat. Zwar vermisst er sein freies Leben draußen auf der Straße und die frische Luft. Hingegen bekommt er schon wieder etwas Ordentliches zwischen die Zähne und hat es warm, sodass er nicht ständig im Mantel herumlaufen muss. Und dass ihn die anderen Insassen – vor allem die Frauen – mit einem Lächeln ansehen, beginnt ihm unvermutet zu gefallen.
Von diesem Moment an ist Balthasar Kaspar ein etwas zufriedenerer Mensch.
Ein Stänkerer bleibt er hingegen trotzdem. Er hat an allem ständig irgendetwas auszusetzen und gehorchen kann er schon gar nicht. Nach so langer Zeit lässt sich sein aufbrausendes Wesen nicht einfach so ändern, zu hart haben ihn das Leben auf der Straße und die Intoleranz seiner Mitmenschen gemacht.
Aber heimlich fühlt er sich im Sunneschyn plötzlich wohl. Und nachdem das Wochenende vorbei gegangen ist, hätten ihn keine zehn Pferde mehr aus seinem Zimmer und aus dem Haus gebracht.
Unerwartet bald gehört Balthasar Kaspar schon nach wenigen Tagen irgendwie zum Inventar. Fanny hat ihn sogar dazu gebracht, dass er sich in der Küche zum Gemüseputzen oder im Garten zum Schnee schippen einspannen lässt.
Die Arbeit tut ihm gut. Das Gefühl, gebraucht zu werden und nicht länger unnütz zu sein, ist unbeschreiblich wohltuend. In seinem Wesen wird Balthasar immer zugänglicher und freundlicher, aber das würde der kleine Wicht natürlich nie zugeben. So bleibt halt weiterhin alles nicht recht, unsinnig und unnütz.
Niemand ahnt, dass er mit der Welt seinen Frieden gemacht hat, weil ihm nach all den schlechten Jahren nun plötzlich so viel Gutes widerfährt. Aber er gibt keiner Menschenseele preis, wie es in seinem Innern aussieht, zu tief sind die Narben, die er erlitten hat, und zu groß die Angst, von Neuem verletzt zu werden.
Heimlich aber freut es ihn, wenn die Frauen über die schönen Gestecke auf den Tischen oder die Männer über die geputzten Schuhe diskutieren. Die lassen sie nämlich meistens abends draußen im Korridor stehen – vor allem, wenn sie stark schmutzig sind – um sie dann erst am nächsten Tag zu putzen. Nun kommt es plötzlich ab und zu vor, dass sie am Morgen frisch geputzte Schuhe vor der Türe vorfinden.
Niemand weiß, wer das Heinzelmännchen ist, das ihnen in der Nacht Gutes tut. Jeder kommt sich gebauchpinselt vor, wenn man ihn darauf anspricht, ihn fragt, ob er es gewesen sein könnte und man ihn für diesen guten Geist hält. Dann lächelt er oder sie nur geheimnisvoll und sagt nichts Weiteres dazu.
Balthasar grinst dann jeweils nur stumm in sich hinein. Es macht ihm nichts aus, dass andere das Lob für seine Arbeit einheimsen. Es bereitet ihm im Gegenteil viel Vergnügen. Damit anderen Freude zu schenken ist unheimlich befreiend und gibt seinem Leben einen neuen Sinn.
Zwar bleibt Kaspar weiterhin ein Einzelgänger, aber er hält Augen und Ohren offen.
Nach dem ersten Advent verschwindet er plötzlich einfach spurlos und kommt auch des Nachts nicht nach Hause. Damit versetzt er Fanny und Mutter Pulver zunächst in Angst und Schrecken, bis sie nach dem zweiten Mal erleichtert feststellen, dass er doch immer wieder zurückkehrt. Fragen nach seinem Aufenthalt beantwortet er hingegen nicht.
Noch beunruhigender ist allerdings, dass er sich daraufhin plötzlich in seinem Zimmer einschließt, und je näher das zweite Adventswochenende rückt, desto länger hockt er mutterseelenallein in seinem kleinen Zimmer. Alle denken, dass es wohl wegen Weihnachten sei und lassen ihn gewähren.
Der Abend des 6. Dezember nimmt auch ohne Balthasar Kaspar seinen üblichen, ruhigen Gang.
Nachdem sich hingegen die alten Leute zum Schlafen zurückgezogen haben, kommt plötzlich Leben in die Bude.
Frau Blatter schießt mit einem Brief in den Fingern aus ihrem Zimmer heraus und klopft um ein paar Ecken weiter drüben bei Herrn Liechtis Türe an. Bei dem steht eine Flasche Wein mit zwei Gläsern auf dem Tisch.
Alle anderen finden Mandarinen, kleine Lebkuchen, Erdnüsse und einen Nikolaus aus Schokolade als kleines Überraschungsgeschenk vor. Für jede und jeden hat der Nikolaus etwas gebracht, und im Fall der verliebten alten Leute sogar einen Herzenswunsch erfüllt.
Auf den Gängen und Korridoren stehen Mutter Pulvers Schützlinge aufgeregt schnatternd beisammen und beratschlagen, wer wohl dieser edle Spender sein könnte. Aber obgleich es Vermutungen gibt, kommt die Wahrheit darüber nicht ans Tageslicht. Allgemein wird angenommen, dass es sich offenbar um denselben Wichtel handelt, der ihnen auch sonst schon Gutes tat. So wird schließlich dem unbekannten Wohltäter gedankt und das Leben nimmt wieder seinen – jedenfalls fast – normalen Lauf.
Von da an sieht man Frau Blatter und Herrn Liechti händchenhaltend zusammen durchs Altersheim oder den Park spazieren. Und bei den weiteren Diskussionsrunden über den geheimnisvollen Nikolaus nehmen sogar Altersheimbewohner an den Gesprächen teil, die sich bisher während dieser Tage sonst eher schwermütig von den anderen distanziert und zurückgezogen haben.
Einzig Balthasar Kaspar schließt sich weiterhin stundenlang in seinem Zimmer ein. Praktisch immer zur selben Zeit wie am 6. Dezember. Man hätte beinahe die Uhr nach ihm richten können.
Weinachten steht wie jedes Jahr wieder viel zu schnell vor der Tür, und wie immer ist Mutter Pulver von den Sorgen um ihre einsamen Frauen und Männer bedrückt. Zu allem Übel geht es ihr wegen einem bösen Misstritt gesundheitlich nicht mehr gut, sodass sie die Zügel aus den Händen geben und viele ihrer Aufgaben delegieren muss. Zum Glück sind ihr die neue Erika und Fanny dabei eine große Hilfe, die ihre freien Tage opfern und für sie einspringen müssen. Aber beruhigt ist sie deswegen überhaupt nicht, weil sie mit ihren Krücken kaum mehr selbst etwas zum guten Gelingen für Heilig Abend beitragen kann.
Ihre Nerven sind zum Zerreißen angespannt, obwohl mit den festlichen Vorbereitungen bisher auch ohne ihr Zutun so ziemlich alles reibungslos geklappt hat. Die Menükarten sind besprochen, die nötigen Zutaten eingekauft. Auch die Tischdekorationen entsprechen ihren Vorstellungen. Und an der Wand in der Mitte des Speiseraums, in dem die Weihnachtsfeierlichkeiten stattfinden werden, steht ein riesiger, prächtig geschmückter Tannenbaum.
Mutter Pulver seufzt, als Balthasar Kaspar an Heilig Abend den ganzen Tag nicht mehr aus seinem Zimmer herauszubringen ist. Auch Fanny bedauert es sehr, dass sie den sturen alten Mann durch nichts aus seiner Einsamkeit herauslocken kann.
An diesem 24. Dezember werden auch sie beide vom Weihnachtsmann beschenkt. Die Heimleiterin findet eine Schachtel Pralinen auf dem Schreibtisch in ihrem Büro vor und Fanny ist überglücklich, als plötzlich ihr Schatz im Sunneschyn auftaucht, um hier mit ihr Weihnachten zu feiern. Er habe einen Brief mit einer Einladung erhalten, erklärt er die Überraschung, und Fanny bekennt:
»Ich habe ihn nicht geschrieben. Aber es stimmt, ich war sehr traurig, weil ich heute wieder arbeiten muss und dich nicht sehen konnte.«
Merkwürdig, denkt Mutter Pulver. Sie hätte sich noch Fanny als Weihnachtsengel vorstellen können, aber demnach ist ihre Vermutung also wieder falsch gewesen.
Es ist ihr ein Rätsel, wer denn sonst noch infrage kommen könnte, aber es will ihr beim besten Willen niemand anderer mehr dafür einfallen.
Händchenhaltend mit ihrem Freund, schielt Fanny während des Abendessens und dem anschließenden Weihnachtslieder singen immer wieder hinüber zur Türe, in der Hoffnung, dass Kaspar Balthasar plötzlich doch noch auftaucht, aber der alte Mann bleibt verschwunden.
So findet Heilig Abend halt ohne den grantigen Giftzwerg statt.
Ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit zieht sich auch Mutter Pulver außergewöhnlich früh zurück. Sie gibt vor, schlafen gehen zu wollen, hat aber ganz anderes im Sinn. Stattdessen stakst sie nach dem Abendessen mit ihren Krücken im Sunneschyn herum. Sie ist nämlich neugierig darauf, ob sich der merkwürdige Wundertäter an diesem Weihnachtsabend noch einmal zeigen wird und sie ihm diesmal vielleicht sogar würde abpassen können, um herauszufinden, wer er ist.
In der Dunkelheit des Fernsehzimmers muss sie nicht lange warten, bis sie leise tappende Schritte auf dem Gang vernimmt. Noch sind sie ziemlich weit entfernt, aber als Mutter Pulver den Kopf vorstreckt, um einen Blick um die Ecke zu werfen, sieht sie eine kleine Gestalt mit einem großen Sack in der Hand von einem Zimmer zum anderen marschieren.
Türen klappen auf und wieder zu, damit draußen im Korridor niemand etwas merkt. Es dauert jeweils einen Moment, den das Wesen in jedem Zimmer verbringt, bis es herauskommt und beim nächsten wieder hineingeht.
Das verschafft Mutter Pulver genug Zeit, sich ans letzte Zimmer heranzuschleichen, das genau in ihrer Nähe liegt. Behutsam öffnet sie einen kleinen Spalt breit die Türe und schielt hinein.
Im Zimmer von Frau Mörgeli ist es fast dunkel. Es wird lediglich vom Schein der Lichterkette vor dem Fenster ein wenig erhellt, der von draußen hereindringt. In dem engen Raum steht eine kleine Gestalt, die in der einen Hand einen großen Sack und in der anderen etwas Längliches hält, das aussieht wie eine Flasche.
Mutter Pulver stockt der Atem, aber da ist es schon zu spät.
Das Wesen hat sie bemerkt – wahrscheinlich gehört – und dreht den Kopf zu ihr um.
Wie verblüfft ist sie, als sie sieht, wer da im Raum steht und sein kleines Rentengeld für all die Überraschungen ausgegeben hat.
Balthasar Kaspar legt den Zeigefinger auf den Mund und macht: »Psst!«, währenddessen er ihr verschwörerisch zublinzelt und danach seelenruhig seine Weinflasche für Frau Mörgeli auf den Tisch stellt.
Mutter Pulver nickt überrumpelt, die Worte bleiben ihr im Hals stecken. Die Feststellung, von wem all diese netten Geschenke kommen, raubt ihr fast den Atem, so unglaublich ist es. Demnach ist der Weihnachtsengel gar kein Weihnachtsengel, sondern ein – Weihnachtszwerg!
Ausgerechnet das kleine, giftige Männchen, dem nichts recht gemacht werden kann – oder zumindest so tut, wie sich Mutter Pulver nun eingestehen muss – scheint vom weihnachtlichen Geist erfasst worden zu sein und mit seiner neuen Aufgabe als wohltätiger Hausgeist seinen Frieden gefunden zu haben.
ENDE
Der Geisterhund
von Mara Laue
Lea zog den Kragen ihres Mantels fester vor dem Hals zusammen, beugte den Kopf und stemmte sich gegen den eisigen Wind. Sie stapfte durch den Schnee, der so hoch lag, dass sie nicht mehr erkennen konnte, wo der Bürgersteig aufhörte und die Straße anfing. Hier, außerhalb der Stadt, standen nicht einmal eingeschneite Autos, an denen sie den Straßenverlauf hätte erkennen können. Die Sicht tendierte gegen Null.
Dicke Flocken flogen ihr ins Gesicht, schmolzen auf der Haut, und der Wind ließ die feuchten Stellen stechen wie Nadeln. Lea hatte das Gefühl, dass ihr Gesicht schon halb erfroren war. Sie beugte den Kopf tiefer. Mit dem Ergebnis, dass die Schneeflocken zielsicher auf dem schmalen Streifen zwischen Schal und Mütze in ihrem Nacken landeten, schmolzen und dort denselben Effekt erzielten. Dazu kam, dass ihre Stiefel beim Kauf zwar als »wasserabweisend« angepriesen worden waren, aber sie hielten einer Wanderung durch stiefelhohen Schnee nicht lange stand. Die Nässe drang inzwischen durch das Leder, nachdem die Kälte das schon längst getan und ihre Füße taub gemacht hatte.
Dementsprechend befand sich Leas Laune zusammen mit den Außentemperaturen unter dem Nullpunkt. Ausgerechnet am letzten Arbeitstag vor ihrem Weihnachtsurlaub hatten heftige Schneefälle den Verkehr lahmgelegt. Lea war zwar heute Morgen noch mit dem Bus zur Arbeit gekommen, aber danach hatte ein heftiger Schneesturm eingesetzt, der bis zum Nachmittag alles so eingeschneit hatte, dass nicht mal mehr die Räumungsfahrzeuge durchkamen. Kein Bus fuhr.
Da sie keine Möglichkeit hatte, in der Stadt zu übernachten, hatte sie sich notgedrungen zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht. Zum ersten Mal empfand sie es als Nachteil, in dem kleinen Dorf sieben Kilometer vor der Stadt zu wohnen. Sieben Kilometer – bei normalem Wetter ein Fußmarsch von anderthalb Stunden. Bei diesem Schneesturm würde sie mindestens drei Stunden brauchen.
Sie erreichte die Bushaltestelle, an der die Straße eine scharfe Kurve nach links machte, wo sie um das Naturschutzgebiet des Rabenwaldes herumgeführt wurde. Lea war bereits erschöpft vom anstrengenden Stapfen durch den Schnee und dem sich gegen den frostigen Wind Stemmen. Dabei war sie noch nicht mal eine Stunde unterwegs. Der Gedanke, noch über zwei weitere Stunden oder sogar noch länger laufen zu müssen, falls der Sturm stärker und die Schneewehen höher wurde, ließ sie fast verzweifeln.
Sie blickte nach rechts. Dort, wo normalerweise der Weg in den Rabenwald führte, war nichts zu sehen als eine gleichmäßig weiße Fläche. Selbst von der war nicht viel zu erkennen, denn das dichte Schneetreiben nahm ihr die Sicht. Sollte sie trotzdem riskieren, den Weg durch den Wald zu nehmen? Er kürzte die Strecke erheblich ab und kam ein paar Hundert Meter vor der Dorfgrenze heraus. Aber sie könnte sich in der Dämmerung und unter der Düsternis des Sturmhimmels allzu leicht verirren.
Egal! Lea bog in die kaum erkennbare Schneise zwischen den Bäumen ein und empfand es als wohltuend, dass sie den Wind nun im Rücken hatte. Dafür schwanken die Bäume links und rechts bedrohlich, und die Stämme und das Geäst knirschten, als würden sie jeden Moment brechen.
»Wolfswinter« hatte ihr schon lange verstorbener Großvater solche schneesturmintensiven Winter genannt, in denen früher die Wölfe, vom Hunger getrieben, bis zu den Gehöften und Dörfern vorgedrungen waren. »Fimbulwinter«, hatte die aus Norwegen stammende Großmutter geflüstert und damit den drei Jahre währenden Winter gemeint, der Ragnarök, dem Weltuntergang, vorausging. Auch wenn in der heutigen Zeit keine Wölfe mehr in die Dörfer einfielen und gerade in diesen Breiten selbst der härteste Winter nicht lange anhielt, kam Lea sich vor, als wäre sie der letzte Mensch auf der Welt, während sie sich durch den Schnee kämpfte.
Immer einen Fuß vor den anderen setzten, vorwärts, vorwärts. Ab und zu stehen bleiben und sich orientieren, ob sie noch dem richtigen Weg folgte. Auch wenn der nicht zu sehen war, konnte sie ihn eigentlich nicht verfehlen, denn die Bäume am Wegrand standen so dicht, dass Lea gegen einen Stamm oder Zweige gelaufen wäre, wenn sie vom Weg abgekommen wäre. Weiter, weiter. Ihre Erschöpfung nahm zu. Die Muskeln schmerzten von der ungewohnten Anstrengung. Inzwischen fühlten sich auch ihre Beine taub an. Lea verlor jedes Zeitgefühl.
Sie zuckte zusammen, als ein schauriges Heulen ertönte. Es klang erschreckend wölfisch. Da es aber in dieser Gegend keine Wölfe gab, musste wohl ein Hund geheult haben. Hoffnung kam auf. War sie dem Dorf schon so nahe, dass sie Bauer Walters Hund hören konnte? Da! Noch ein Heulen. Diesmal klang es näher. Lea blieb stehen und sah sich um. Sie konnte in der Dunkelheit nicht viel sehen. Aber ungefähr einen Meter neben ihr ragte die Informationstafel aus dem Schnee, die Besuchern erklärte, was den Rabenwald so besonders machte. Demnach war Lea nur noch ungefähr hundert Meter vom Rabenbach entfernt, der zwischen Wald und Dorf floss. Sie musste nur noch über die alte Holzbrücke und links die Straße hinauf, dann war sie in spätestens einer halben Stunde zu Hause.
Sie marschierte los.
Der Hund tauchte so plötzlich auf, als käme er aus dem Nichts. Groß und schwarz stand er vor ihr und versperrte ihr den Weg, das Fell gesträubt, die Zähne gefletscht. Er knurrte drohend und duckte sich wie zum Sprung. Lea blieb erschrocken stehen. Sie liebte Hunde und hatte noch nie vor einem Angst gehabt. Aber der hier war ihr unheimlich. Er stammte nicht aus dem Dorf, denn sie kannte jeden Hund, der dort lebte. Woher kam dieser? Bei diesem Sauwetter ging garantiert niemand mit seinem Hund spazieren. Und soweit sie sehen konnte, hatte der schwarze Riese kein Halsband. Dafür besaß er eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Wolf.
Lea machte einen Schritt zur Seite und noch einen, um möglichst vorsichtig an dem Tier vorbeizugehen und es nicht zu provozieren.
»Guter Hund, braver Hund. Lauf nach Hause!«
Der Hund dachte nicht daran. Stattdessen machte er einen Satz zur Seite und stand Lea wieder im Weg. Knurrte drohend und war offenbar fest entschlossen, sie nicht vorbeizulassen.
»Hau ab!«, brüllte sie ihn an.
Aber das beeindruckte den Hund nicht im Mindesten. Sie machte ein paar Schritte zur anderen Seite. Er sprang ihr in den Weg. Lea sah sich in der verzweifelten Hoffnung um, dass irgendwo sein Besitzer auftauchte. Aber weit und breit gab es nur den Wald, den Schneesturm, sie und den schwarzen Hund. Die Brücke war nur noch wenige Meter entfernt!
Verdammt, sie würde sich nicht von einem Hund aufhalten lassen. Sie bückte sich, nahm eine gehörige Handvoll Schnee, knetete ihn zu einem Ball und warf ihn dem Hund ins Gesicht.
»Verschwinde, du Mistvieh!«
Der Hund fing den Ball auf, als wäre es ein Spiel und zerbiss ihn zwischen den Zähnen. Lea nutzte den Moment, in dem er abgelenkt war, um an ihm vorbeizukommen. Der Hund war schneller. Sie hatte kaum zwei Schritte getan, als er ihr wieder den Weg versperrte. Ihr kamen vor Erschöpfung und Frust die Tränen. Obwohl sie dadurch riskierte, den Hund erst richtig wütend zu machen, schleuderte sie einen Schneeball nach dem anderen auf ihn, so schnell sie konnte und brüllte ihn an, er solle endlich verschwinden.
Der Hund ließ die Attacken über sich ergehen und sah sie nur an. Doch jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeizugehen versuchte, stellte er sich ihr in den Weg.
Lea sank schließlich entnervt und am Ende ihrer Kraft in den Schnee. Heiße Tränen rannen über ihr Gesicht, die der kalte Wind sofort gefror. Da war die Brücke zum Greifen nahe. Nur ein paar Schritte – aber unerreichbar wegen dieses dämlichen Hundes. Der Bach war noch nicht völlig zugefroren. Dafür war es noch nicht lange genug so winterlich kalt. Stattdessen hatten die vorherigen Regenfälle, der heutige Schneefall und der Sturm ihn anschwellen und zu einem reißenden Strom werden lassen. Lea konnte erkennen, dass das Wasser bis an die Brückenplanken reichte und jede größere Welle darüberschwappte. Wenn Lea nicht schnellstens nach drüben kam, würde sie möglicherweise gar nicht mehr hinüber können, weil die Brücke überspült würde.
Sie raffte sich auf, nahm ihre Handtasche von der Schulter und ihren ganzen Mut zusammen, stapfte brüllend in Richtung Brücke und schlug unablässig mit der Tasche nach dem Hund. Er sprang ein paar Sätze zurück. Doch Leas Hoffnung, dass er nun endlich begriffen hätte und sie in Ruhe ließ, erfüllte sich nicht. Der Hund sprang sie an und warf sie in den Schnee. Lea riss instinktiv den Arm vor ihre Kehle und erwartete den Schmerz des Bisses, der gleich folgen würde.