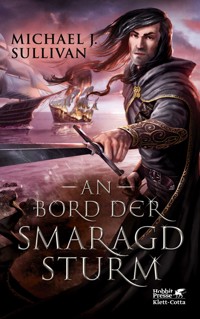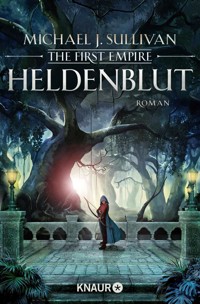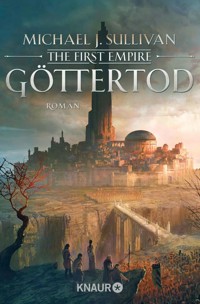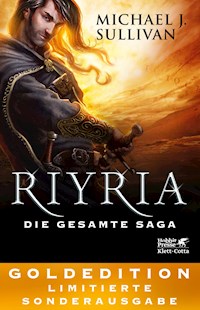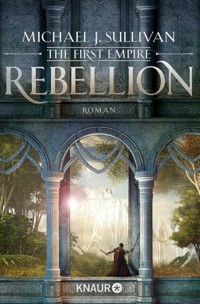13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Riyria-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Zwei Diebe wollen es wissen ... so wurde der legendäre Bund Riyria besiegelt. In Elan, einer Welt in der Stallburschen sich in Prinzessinnen verlieben und sie gegen Unholde verteidigen, einer Welt, in der Bischöfe finstere politische Pläne schmieden, in der Diebe manchmal für geordnete Verhältnisse sorgen, aber nicht immer, kämpft Gwen, die mutigste Frau weit und breit, um Gerechtigkeit für ihre Freundin, die in einem Bordell umgebracht wurde. Aber nicht nur das. Über ein Jahr lang hat Royce Melborn versucht, Gwen Delancy zu vergessen. Eben jene einzigartige Gwen, die ihn und seinen Partner vor dem sicheren Tod bewahrte. Als er schwach wird und schließlich zusammen mit Hadrian nach Medford zurückkehrt, müssen die beiden eine böse Überraschung erleben. Gwen will die beiden nicht sehen. Was die beiden aber nicht wissen: Gwendolyn wurde von einem Angehörigen des Adels Gewalt angetan. Sie fürchtet, dass Royce alle Vorsicht fahren ließe, wenn er davon erfährt, um Rache für sie zu nehmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Das Geheimnis der Dornigen Rose
Die Riyria-Chroniken 2
Aus dem Amerikanischen von Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Rose and the Thorn. Book two of the Riyria Chronicles« im Verlag Orbit, Hachette Group, New York
© 2014 by Michael J. Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung einer Illustration von © Larry Rostant
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98214-5
E-Book: ISBN 978-3-608-12096-7
Inhalt
1
Die Schlacht an der Torbrücke
2
Albert Winslow
3
Amraths Kronrat
4
Der Geist des Hohen Turms
5
Nach der Feier
6
Das
MEDFORDHAUS
und die Schenke
7
Die Herrin der Blumen
8
Das neue Schwert
9
Die Rote Hand
10
Der Stutzer und der Troll
11
Der neue Wachmann
12
Das Herbstfest
13
Der Kutscher, die Dame und die Trinker
14
Verräter
15
Rose
16
Der Großkonnetabel
17
Die Hüte mit den Federn
18
Brilli
19
Der Brand
20
Schlimme Folgen
21
Der Tag danach
22
Heimkehr
23
Hilfred
24
Die dornige Rose
25
Der Besucher
Glossar der Namen, Orte und Begriffe
1
Die Schlacht an der Torbrücke
Reuben hätte gleich fliehen sollen, als die Knappen aus dem Schloss gerannt kamen. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, sich im Stall in Sicherheit zu bringen, dann hätten sie ihn nur mit Äpfeln bewerfen und ihm Beleidigungen nachrufen können. Doch ihr Lächeln verwirrte ihn. Sie wirkten so freundlich – geradezu vernünftig.
»Reuben! He, Reuben!«
Reuben? Nicht Schmutzfink? Nicht Trolljunge?
Die Knappen hatten verschiedene Spitznamen für ihn, keiner davon war schmeichelhaft. Andererseits hatte er auch für sie welche – wenigstens in Gedanken. Im »Lied des Menschen«, einem Gedicht, das er besonders mochte, war von Alter, Krankheit und Hunger als den drei Plagen der Menschheit die Rede. Der dicke Horace war zweifellos der Inbegriff des Hungers. Willard mit dem bleichen, pockennarbigen Gesicht war die Krankheit, und das Alter passte am besten zu Dills, dem mit siebzehn Jahren Ältesten von ihnen.
Beim Anblick Reubens hatten die drei wie eine kleine Herde räuberischer Gänse sofort seine Richtung eingeschlagen. Dills hielt einen zerbeulten Ritterhelm in der Hand, dessen Visier im Takt seiner Schritte scheppernd auf und ab hüpfte. Willard hatte ein wattiertes Gewand über dem Arm, wie man es unter einer Rüstung trug, Horace aß – wenig überraschend – einen Apfel.
Reuben konnte es immer noch vor ihnen zum Stall schaffen. Höchstens Dills vermochte ein solches Wettrennen mit ihm zu gewinnen. Er wollte schon loslaufen, doch dann zögerte er.
»Das sind die alten Sachen, in denen ich immer geübt habe«, rief Dills fröhlich, als wären die letzten drei Jahre nicht gewesen, als wäre er ein Fuchs, der vergessen hatte, was man mit einem Kaninchen anstellen kann. »Mein Vater hat mir für meine Prüfungen neue geschickt. Jetzt verwenden wir die hier zum Spaß.«
Die Knappen hatten Reuben eingeholt – zum Weglaufen war es zu spät. Sie umringten ihn, immer noch lächelnd.
Dills hielt ihm den Helm mit den daran baumelnden Lederriemen hin. Auf dem Metall spiegelte sich die Herbstsonne. »Schon mal so was getragen? Setz auf.«
Verdattert starrte Reuben den Helm an. Ich kapiere das nicht. Warum sind sie auf einmal so nett?
»Ich glaube, er weiß gar nicht, wie das geht«, sagte Horace.
»Na los.« Dills wollte ihm den Helm in die Hand drücken. »Du trittst doch sowieso bald in die Schlosswache ein, oder nicht?«
Die reden ja mit mir? Seit …?
Er antwortete nicht gleich. »Äh … doch.«
Dills Lächeln wurde breiter. »Dachte ich mir. Aber ein Schwert hast du noch nicht oft in der Hand gehalten.«
»Wer übt schon mit einem Stalljungen?« Horace hatte einen Bissen Apfel im Mund und nuschelte dementsprechend.
»Eben«, sagte Dills und blickte zum wolkenlosen Himmel auf. »So ein schöner Herbsttag. Wer wollte da drinnen sein. Wir dachten, du lernst vielleicht gern ein paar Techniken.«
Alle drei trugen hölzerne Übungsschwerter und Horace hatte ein zweites Schwert dabei.
Meinen die das ernst? Misstrauisch studierte Reuben ihre Gesichter. Dills schien durch sein mangelndes Vertrauen gekränkt und Willard verdrehte die Augen. »Wir dachten einfach, du setzt gern mal einen Ritterhelm auf, weil du das doch noch nie getan hast. Wir dachten, wir würden dir eine Freude machen.«
Reuben sah, wie hinter ihnen der Präfekt der Knappen aus dem Schloss kam und sich auf den Rand des Brunnens setzte, um ihnen zuzusehen.
»Es ist ein Riesenspaß. Wir haben das auch alle gemacht.« Wieder drückte Dills ihm den Helm gegen die Brust. »Und mit der wattierten Jacke und dem Helm kann dir nichts passieren.«
Willard sah ihn finster an. »Wir wollen doch nur nett sein – sei nicht so stur.«
So bizarr das alles klang, Reuben konnte in ihren Blicken keine Bosheit erkennen. Sie lächelten ihn offenherzig an, wie sie sonst nur einander anlächelten. Und er glaubte zu verstehen, was hier vorging. Nach drei Jahren hatten sie endlich die Lust daran verloren, ihn zu piesacken. Dass er als einziger Junge in ihrem Alter nicht adlig war, hatte ihn zu einem leichten Opfer gemacht, aber die Zeiten hatten sich geändert, und sie wurden alle älter und reifer. Es handelte sich um ein Friedensangebot, und da Reuben sich seit seiner Ankunft im Schloss noch mit niemandem angefreundet hatte, durfte er nicht wählerisch sein.
Also nahm er den Helm, den sie mit Lumpen ausgestopft hatten, und setzte ihn auf. Der Helm war ihm trotz der Polster zu groß und wackelte. Reuben hatte den Verdacht, dass etwas nicht stimmte, war sich aber nicht sicher. Noch nie hatte er irgendeine Art von Rüstung getragen. Da er Soldat der Schlosswache werden sollte, hätte ihn sein Vater eigentlich ausbilden müssen, aber der hatte dazu nie Zeit gehabt. Schon deshalb war das Angebot der Knappen verlockend, und die Verlockung überwog schließlich das Misstrauen. Dies war seine Chance, etwas über das Kämpfen und den Umgang mit dem Schwert zu lernen. In einer Woche hatte er Geburtstag, und wenn er erst sechzehn war, würde er in die Schlosswache eintreten. Ohne entsprechende Ausbildung bekam man dort nur die schlechtesten Posten. Wenn die Knappen es ernst meinten, konnte er etwas lernen – egal was.
Die drei zogen ihm die dick wattierte Jacke über, sodass er sich kaum noch bewegen konnte, und Horace reichte ihm das Holzschwert, das er mitgebracht hatte.
Und dann begannen die Prügel.
Ohne Vorwarnung schlugen die Knappen mit ihren Schwertern auf seinen Kopf ein. Eisen und Polster des Helms fingen zwar einiges ab, aber nicht alles. Und der Helm hatte innen scharfe Kanten, die Reuben in Stirn, Wangen und Ohren schnitten. Er hob das Schwert in einem schwachen Versuch, sich zu verteidigen, konnte durch das schmale Visier aber so gut wie nichts sehen. Da die Polster ihm auf die Ohren drückten, hörte er das Gelächter der anderen nur gedämpft. Ein Hieb riss ihm das Schwert aus der Hand, ein zweiter traf ihn auf den Rücken. Er fiel auf die Knie. Und danach ging es erst richtig los. Ein Hagel von Schlägen ging auf seinen im Eisen steckenden Kopf nieder. Er versuchte, sich noch tiefer zu ducken.
Endlich ließen die Prügel nach und hörten schließlich ganz auf. Reuben nahm schweres Atmen wahr und wieder Gelächter.
»Du hattest recht, Dills«, sagte Willard. »Der Schmutzfink taugt als Übungspuppe wirklich gut.«
»Eine Zeitlang vielleicht – aber eine Puppe duckt sich nicht weg wie ein Mädchen.« Dills Stimme klang wieder so verächtlich wie eh und je.
»Dafür hat er den Vorteil, dass er bei jedem Treffer recht schön kreischt.«
»Habt ihr auch Durst?«, fragte Horace immer noch keuchend.
Reuben hörte, wie sie sich entfernten, und wagte es endlich, Luft zu holen und seine Muskeln zu entspannen. Sein Kiefer war ganz steif, so fest hatte er die Zähne zusammengebissen, und alles andere tat ihm von den Prügeln weh. Er blieb noch einen Moment am Boden, wartete und lauschte. Solange er den Helm aufhatte, war die Umgebung ausgesperrt und jedes Geräusch gedämpft, aber er traute sich nicht, ihn abzusetzen. Wenn er durch den Schlitz nach oben spähte, sah er nur ein Dach orangener und gelber Blätter, die sich in der nachmittäglichen Brise wiegten. Er drehte den Kopf und sah die drei Plagen in der Mitte des Schlosshofs stehen. Sie füllten ihre Becher am Brunnen und setzten sich dann auf den Apfelkarren. Einer rieb sich den Schwertarm und ließ ihn kreisen.
Es strengt offenbar an, mich bewusstlos zu prügeln.
Er nahm den Helm ab und spürte, wie die kühle Luft über seine schweißnasse Schläfe strich. Erst jetzt wurde ihm klar, dass der Helm sicher nicht Dills gehört hatte. Jemand musste ihn ausgemustert haben und die drei hatten ihn vermutlich gefunden. Er hätte wissen müssen, dass Dills ihm niemals etwas geben würde, das ihm gehörte. Er wischte sich über das Gesicht und war nicht überrascht, als er sah, dass seine Hand blutig war.
Er hörte jemanden näher kommen und hob schützend die Arme über den Kopf.
»Das war ein Trauerspiel.« Ellison stand über Reuben und verspeiste einen Apfel, den er vom Karren des Händlers geklaut hatte. Niemand würde sich über ihn beschweren – ganz sicher nicht der Händler. Ellison war der Präfekt der Knappen, der ranghöchste Junge mit dem einflussreichsten Vater. Eigentlich hätte er die Prügelei von eben verhindern müssen.
Reuben schwieg.
»Die Polster saßen viel zu locker«, fuhr Ellison fort. »Aber natürlich geht es vor allem darum, gar nicht erst getroffen zu werden.« Er biss erneut von seinem Apfel ab und kaute mit offenem Mund. Saft tropfte auf sein Wams und hinterließ einen Flecken. Er und die drei Plagen trugen alle die gleiche Jacke, blau mit dem Falken des Hauses Essendon in Weinrot und Gold. Mit dem Apfelflecken sah es aus, als würde der Falke weinen.
»Ich kann mit diesem Helm nichts sehen.« Reuben bemerkte, dass das Polster aus dem Helm, das vor ihm ins Gras gefallen war, sich von seinem Blut hellrot verfärbt hatte.
»Glaubst du, Ritter sehen besser?«, fragte Ellison immer noch mit vollem Mund. »Die sitzen beim Kämpfen auch noch auf Pferden. Du hattest nur einen Helm und die Jacke. Ritter schleppen fünfundzwanzig Kilo Eisen mit sich herum, also komm mir nicht mit Entschuldigungen. Das ist das Problem mit euch – immer habt ihr Entschuldigungen. Nicht genug damit, dass wir als Pagen die Schmach ertragen müssen, an eurer Seite zu arbeiten, nein, wir müssen uns auch noch euer ständiges Gejammer anhören.« Ellison verstellte seine Stimme, bis sie so hoch wie die eines Mädchens klang. »Ich brauche Schuhe, wenn ich im Winter Wasser hole. Ich kann nicht das ganze Holz alleine spalten.« In normalem Ton fuhr er fort: »Ich begreife schon nicht, warum junge Männer von Stand nach wie vor die Demütigung ertragen müssen, Ställe auszumisten, bevor sie richtige Knappen werden. Aber dass wir das auch noch zusammen mit Leuten wie dir tun müssen, einem Bauern und Bastard, der nur …«
»Ich bin kein Bastard«, sagte Reuben. »Ich habe einen Vater. Und einen Nachnamen.«
Ellison lachte und Apfelstückchen flogen aus seinem Mund. »Sogar zwei hast du – seinen und ihren. Nämlich Reuben Hilfred, der Sohn von Rose Reuben und Richard Hilfred. Deine Eltern haben nie geheiratet. Das macht dich zu einem Bastard. Und wer weiß, mit wie vielen Soldaten deine Mutter bis zu ihrem Tod zusammen war. Zofen tun so was ständig. Huren sind sie, allesamt. Dein Vater war nur so naiv, ihr zu glauben, als sie behauptete, du seist von ihm. Allein schon das zeigt, wie dumm er war. Angenommen, sie hat die Wahrheit gesagt, dann bist du also der Sohn eines Dummkopfs und einer …«
Reuben warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen Ellison, sodass der ältere Junge auf den Rücken fiel. Dann schlug er mit den Fäusten auf seine Brust und sein Gesicht ein. Doch Ellison bekam einen Arm frei und plötzlich tat Reuben seine Wange höllisch weh. Im nächsten Moment lag er auf dem Rücken und alles drehte sich. Ellison trat ihm so heftig in die Seite, dass er ihm eine Rippe hätte brechen können. Zum Glück spürte Reuben den Tritt kaum, weil er immer noch die gepolsterte Jacke trug.
Ellisons Gesicht war vor Wut rot angelaufen. Reuben hatte noch nie gegen einen Knappen gekämpft und erst recht nicht gegen Ellison. Sein Vater war ein hoher Adliger aus der Ostmark. Sogar die anderen Jungen rührten Ellison nicht an.
Der Knappe zog sein Schwert. Mit einem dunkel singenden Geräusch fuhr der Stahl aus der Scheide. Reuben hatte gerade noch Zeit, das hölzerne Übungsschwert zu packen, das neben ihm im Gras lag. Im letzten Moment konnte er verhindern, dass ihm der Kopf abgeschlagen wurde, aber das Holzschwert zerbrach in zwei Teile.
Da sprang Reuben auf und rannte.
Es war der eine Vorteil, den er über die anderen hatte. Er arbeitete viel und erledigte alles im Laufen, während sie sich wenig bewegten. Obwohl beschwert durch die wattierte Jacke, war er schnell und ausdauernd wie ein Rudel Hunde. Notfalls war er in der Lage, tagelang zu rennen. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass Ellison ihm einen letzten Streich quer über den Rücken verpasste. Der Hieb trieb ihn zu einem noch schnelleren Tempo an. Aber als er sich in Sicherheit gebracht hatte, entdeckte er einen tiefen Schnitt durch alle vier Lagen der Jacke und seinen Kittel. Sogar in die Haut war die Klinge eingedrungen.
Ellison hatte versucht, ihn zu töten.
Den Rest des Tages versteckte Reuben sich im Stall. Dorthin kamen Ellison und die anderen nie. Stallmeister Hubert hatte die Neigung, jeden Jungen aus dem Schloss, der bei ihm auftauchte, zur Arbeit anzustellen, und er schien den Unterschied zwischen dem Sohn eines Grafen oder Freiherrn und dem Sohn eines Mitglieds der Wache nicht zu kennen. Sie mochten eines Tages Herren sein, aber jetzt waren sie noch Pagen und Knappen, und für Hubert waren sie nur Rücken, die tragen, und Hände, die Schaufeln halten konnten. Wie erwartet, wurde Reuben gleich zum Ausmisten eingespannt, was freilich besser war, als Ellisons Schwert ausgesetzt zu sein. Der Rücken tat ihm weh, außerdem das Gesicht und der Kopf, aber wenigstens blutete er nicht mehr. Und da er leicht hätte sterben können, wollte er sich nicht beschweren.
Ellison war nur wütend. Wenn er sich wieder beruhigt hatte, würde er andere Mittel finden, seinen Ärger an ihm auszulassen. Er und die anderen Knappen würden ihm auflauern und ihn erneut verprügeln – wahrscheinlich nur mit Holzschwertern, aber dafür ohne die Jacke und den Helm.
Reuben lud eine Schaufel Mist auf den Karren, hielt inne und schnupperte. Holzrauch. In der Küche wurde das ganze Jahr über Holz verbrannt, aber im Herbst roch der Rauch anders – süßer. Er stellte die Schaufel auf den Boden, streckte sich und blickte zum Schloss hinauf. Es war für das Herbstfest schon fast vollständig geschmückt. Aus Anlass der Feier hatte man Fahnen und Wimpel aufgezogen, und in den Bäumen hingen bunte Laternen. Das Fest wurde jedes Jahr veranstaltet, in diesem Jahr sollte damit zugleich der neue Großkanzler geehrt werden. Entsprechend musste es größer und schöner sein, und man hatte das ganze Schloss innen und außen mit allen möglichen Kürbissen und Getreidegarben dekoriert. Als das Problem auftauchte, dass es im Schloss nicht genügend Stühle gab, hatte man stattdessen Strohbündel in die verschiedenen Zimmer geschafft. Seit einer Woche kamen Bauern mit ganzen Wagenladungen ihrer Produkte. Alles war sehr schön hergerichtet, und Reuben war zwar nicht eingeladen, wusste aber, dass es ein rauschendes Fest werden würde.
Sein Blick wanderte zu dem hohen, turmartigen Gebäude, von dem er in letzter Zeit geradezu besessen war. In den oberen Stockwerken residierte die königliche Familie und nur wenige hatten dort ohne besondere Einladung Zutritt. Die königliche Residenz war zwar nur wenige Fuß höher als die anderen Gebäude, aber in Reubens Phantasie hätte sie nicht höher sein können. Er kniff die Augen zusammen und meinte eine Bewegung zu erkennen, jemanden, der an einem Fenster vorbeiging. Aber er hatte sich getäuscht. Sowieso passierte dort tagsüber nie etwas.
Mit einem Seufzer kehrte er in den dämmrigen Stall zurück. Im Grunde machte es ihm Spaß, den Pferdemist wegzuschaufeln. Bei kühlerem Wetter gab es nur wenige Fliegen und der Mist war überwiegend trocken – mit Stroh gemischt und von der Beschaffenheit alten Brots oder Kuchens stank er nicht mehr. Solche einfachen Arbeiten, bei denen man nichts denken musste, verschafften ihm eine gewisse Genugtuung. Außerdem war er gern mit Pferden zusammen. Ihnen war egal, wer er war, was für eine Farbe sein Blut hatte und ob seine Eltern verheiratet gewesen waren. Sie begrüßten ihn immer mit einem leisen Wiehern und rieben die Schnauze an seiner Brust, wenn er vor ihnen stand. Er konnte sich, mit einer Ausnahme, niemanden vorstellen, mit dem er den Herbstnachmittag lieber verbracht hätte. Dann, als könnten Gedanken Wünsche erfüllen, sah er aus den Augenwinkeln plötzlich ein weinrotes Gewand.
Beim Anblick der Prinzessin durch die Stalltür hatte er auf einmal Mühe zu atmen. Immer wenn er sie sah, erstarrte er, und wenn er sich dann wieder bewegen konnte, brachte er nichts auf die Reihe – seine Finger wollten ihm nicht gehorchen und waren unfähig, die einfachsten Dinge zu tun. Zum Glück hatte er in ihrer Gegenwart bisher nie etwas sagen müssen. Seine Zunge wäre vermutlich noch viel ungeschickter gewesen als seine Finger. Er beobachtete die Prinzessin seit Jahren, versuchte einen kurzen Blick auf sie zu erhaschen, wenn sie in eine Kutsche stieg oder Gäste begrüßte. Gemocht hatte er sie vom ersten Augenblick an. Da war etwas an der Art, wie sie lächelte, an dem Lachen in ihrer Stimme und ihrem oft ernsten Blick, als sei sie älter als ihre Jahre. Er stellte sich vor, dass sie vielleicht gar kein Mensch war, sondern eine Fee – ein Geisterwesen, begabt mit natürlicher Anmut und Schönheit. Dass er sie nur selten sah, machte ihren Anblick zu etwas Besonderem, Erregendem, wie der Anblick eines Rehkitzes an einem stillen Morgen. Wenn sie auftauchte, konnte er den Blick nicht von ihr wenden. Mit fast dreizehn Jahren war sie so groß wie ihre Mutter. Aber etwas an ihrem Gang und an der Art, wie sie die Hüften bewegte, wenn sie zu lange an einer Stelle stand, ließ erkennen, dass sie schon mehr Frau als Mädchen war. Immer noch dünn und klein, aber anders. Reuben malte sich aus, wie er am Brunnen stand, wenn sie eines Tages allein und durstig im Hof erscheinen würde. Wie er Wasser hochziehen und ihren Becher füllen würde. Sie würde lächeln und ihm vielleicht sogar danken. Und wenn sie ihm den leeren Becher dann zurückgab, würden sich ihre Finger kurz berühren und in diesem kurzen Moment würde er ihre warme Haut spüren und zum ersten Mal in seinem Leben wirklich froh sein.
»Reuben!« Ian, der Stallknecht, schlug ihm mit einer Reitgerte auf die Schulter. Es tat so weh, dass sicher ein blauer Fleck zurückblieb. »Hör auf zu träumen – an die Arbeit!«
Reuben schwieg und griff wieder nach der Schaufel. Er hatte seine Lektion für den Tag gelernt. Mit gesenktem Kopf schaufelte er den Mist vom Boden. Die Prinzessin konnte ihn im Stall nicht sehen, dafür sah er sie durch die Tür, jedes Mal wenn er den Mist in den Karren warf, einen kurzen Augenblick lang. Sie trug ein neues, weinrotes Kleid aus der Calis-Seide, die sie zusammen mit dem Pferd zum Geburtstag bekommen hatte. Für Reuben war Calis nur ein sagenhaftes Land irgendwo weit weg im Süden, voller Dschungel, Goblins und Piraten. Es musste ein märchenhaftes Land sein, denn der Stoff des Kleids schimmerte beim Gehen geheimnisvoll und die Farbe passte ausgezeichnet zu ihren Haaren. Es war noch ganz neu. Die früheren Kleider waren für ein Mädchen gewesen – das hier war für eine Frau.
»Ihr wollt bestimmt Tamarisk, Hoheit?«, fragte Ian von irgendwo am Haupteingang des Stalls.
»Natürlich. Heute ist ein wunderschöner Tag für einen Ausritt. Tamarisk mag das kühlere Wetter. Da kann er nach Herzenslust galoppieren.«
»Eure Mutter hat Euch gebeten, nicht mit ihm zu galoppieren.«
»Traben ist unbequem.«
Ian sah die Prinzessin zweifelnd an. »Tamarisk ist ein Vollblut aus Maranon, Hoheit. Er trabt nicht – er geht im Passgang.«
»Ich mag den Wind in den Haaren.« Aus ihrer Stimme klang ein bestimmtes Etwas, ein Trotz, der Reuben schmunzeln ließ.
»Eurer Mutter wäre es aber lieber …«
»Seid Ihr der königliche Stallknecht oder ein Kindermädchen? Denn dann sollte ich Nora sagen, dass wir ihre Dienste nicht mehr benötigen.«
»Verzeiht, Hoheit, aber Eure Mutter will …«
Sie drängte an ihm vorbei und betrat den Stall. »Du da … Junge!«, rief sie.
Reuben hörte auf, mit der Schaufel zu scharren. Sie sah ihn an.
»Kannst du ein Pferd satteln?«
Er brachte ein Nicken zustande.
»Dann sattle Tamarisk für mich. Nimm den Damensattel mit dem Sitz aus Wildleder. Weiß du, welchen ich meine?«
Reuben nickte wieder und machte sich hastig an die Arbeit. Seine Hände zitterten, als er den Sattel vom Gestell hob.
Tamarisk war ein schöner Fuchs aus dem Königreich Maranon. Die dortigen Pferde waren für ihre edle Abstammung und hervorragende Ausbildung berühmt, weshalb sie sich auch besonders gut reiten ließen. Damit hatte der König das Geschenk möglicherweise seiner Frau schmackhaft machen können. Pferde aus Maranon waren allerdings auch für ihre Schnelligkeit bekannt, und das dürfte wiederum der Prinzessin besonders gefallen haben.
»Wohin werdet Ihr reiten?«, fragte Ian.
»Ich dachte, ich reite zur Torbrücke.«
»So weit dürft Ihr nicht allein reiten.«
»Mein Vater hat mir das Pferd zum Ausreiten geschenkt und nicht nur zum Traben im Hof.«
»Dann begleite ich Euch«, beharrte der Stallknecht.
»Nein! Euer Platz ist hier. Wer sollte außerdem sonst Alarm schlagen, wenn ich nicht zurückkomme?«
»Wenn Ihr mich nicht dabeihaben wollt, dann begleitet Euch Reuben.«
»Wer?«
Reuben erstarrte.
»Reuben. Der Junge, der Euer Pferd sattelt.«
»Ich will keinen Begleiter.«
»Entweder ich oder er, sonst bleibt das Pferd ungesattelt und ich gehe jetzt gleich zu Eurer Mutter.«
»Also gut, dann nehme ich … wie heißt er noch gleich?«
»Reuben.«
»Wirklich? Hat er auch einen Nachnamen?«
»Hilfred.«
Sie seufzte. »Dann nehme ich Hilfred mit.«
Reuben hatte zwar noch nie auf einem Pferd gesessen, aber er hatte gewiss nicht vor, das den anderen beiden zu verraten. Angst hatte er keine, höchstens davor, dass er sich vor der Prinzessin blamieren könnte. Die Pferde kannte er alle gut und er wählte Melancholie aus, eine ältere schwarze Stute mit einem weißen Stern auf der Stirn. Ihr Name passte zu ihrem Temperament und das wiederum entsprach ihrem Alter. Sie wurde in der Regel für Kinder gesattelt, die einmal auf einem »richtigen« Pferd reiten wollten, oder für Großmütter und Tanten gesetzteren Alters. Trotzdem klopfte sein Herz, als Melancholie Tamarisk nach draußen folgte.
Durch das Eingangstor gelangten sie nach Medford, die Hauptstadt des Königreichs Melengar. Reuben hatte zwar keine nennenswerte Bildung genossen, aber er konnte gut zuhören und wusste, dass Melengar das kleinste der acht Königreiche Avryns war – und Avryn war die größte der vier Nationen der Menschen. Alle vier Nationen – Trent, Avryn, Delgos und Calis – waren früher einmal Teil eines einzigen Reichs gewesen, aber das war lange her und interessierte nur noch Schreiberlinge und Historiker. Wichtiger war, dass Medford seit mindestens einer Generation eine angesehene Stadt war, in der Frieden und Wohlstand herrschten.
Das Königsschloss bildete den Mittelpunkt der Stadt und war von einem Festungsgraben umgeben, auf dessen anderer Seite Scharen von Händlern mit Karren alle möglichen Arten von herbstlichem Obst und Gemüse, Brot, Räucherfleisch, Lederwaren und Cidre verkauften – letzteren warm und kalt, mit Alkohol oder ohne. Drei Fiedler spielten eine lebhafte Weise, auf einem Baumstumpf neben sich einen umgedrehten Hut. Angehörige des niederen Adels in Mänteln und Umhängen spazierten durch die mit Ziegeln gepflasterten Straßen und ließen Ketten mit Glasperlen durch die Finger gleiten. Betuchtere Einwohner rollten in Kutschen durch die Stadt.
Reuben und Arista ritten die breite Ziegelallee entlang, vorbei an der Statue Tolin Essendons. Sie war überlebensgroß und der erste König von Melengar sah auf seinem Schlachtross aus wie ein Gott, obwohl er sich Gerüchten zufolge nicht durch körperliche Größe ausgezeichnet hatte. Vielleicht war es dem Künstler mehr um die innere Größe Tolins gegangen als um seine äußere Erscheinung, denn der Mann, der Lothomad bezwungen hatte, den Herrn von Trent, und der aus den Trümmern des Bürgerkriegs Melengar geschaffen hatte, war doch gewiss fast so bedeutend wie Novron selbst.
Niemand hielt die beiden an und stellte ihnen Fragen, dafür verbeugten sich viele oder knicksten. Gespräche verstummten, wenn sie sich näherten, und alle starrten sie mit großen Augen an. Reuben war das gar nicht recht, aber die Prinzessin schien es nicht zu bemerken und er bewunderte sie dafür.
Sobald sie die Stadt verlassen hatten und auf der Landstraße ritten, trieb Arista ihr Pferd an. Reubens Pferd begann zu traben, eine unangenehm holpernde Gangart, bei der das Schwert, das Ian ihm mitgegeben hatte, unablässig gegen seinen Schenkel schlug. Und wie Ian gesagt hatte, trabte das Pferd der Prinzessin nicht, es tänzelte vielmehr, als wollte es sich die Hufe nicht schmutzig machen.
Doch je länger sie ritten, desto besser kam Reuben mit seinem Pferd zurecht und desto breiter wurde das Lächeln auf seinen Lippen. Er war allein mit ihr, weit weg von Ellison und den drei Plagen, und er saß auf einem Pferd und trug dabei ein Schwert. So musste ein Mann leben und so hätte er vielleicht gelebt, wenn er als Adliger geboren worden wäre.
Es war Reuben bestimmt, wie sein Vater Richard als Soldat in den Dienst des Königs zu treten. Anfangen würde er als Wache auf der Mauer oder am Tor, und wenn er Glück hatte, konnte er sich wie sein Vater in eine gehobene Stellung hocharbeiten. Richard Hilfred war Feldwebel der königlichen Wache und zusammen mit anderen für den persönlichen Schutz des Königs und seiner Familie verantwortlich. Eine solche Stellung hatte ihre Vorzüge. So war es Richard Hilfred möglich gewesen, seinem ungelernten Sohn eine Stelle zu verschaffen. Reuben wusste, dass er für diese Chance dankbar sein musste. In einem Königreich, in dem Frieden herrschte, führten Soldaten ein angenehmes Leben. Bisher war das Leben auf Schloss Essendon für ihn allerdings alles andere als angenehm gewesen.
In einer Woche, an seinem Geburtstag, würde er die Uniform in Weinrot und Gold anlegen. Er wäre zwar immer noch der Jüngste und Schwächste, aber wenigstens kein Außenseiter mehr. Er würde einen Platz haben. Leider keinen Platz, an dem er auf einem Pferd und mit einem Schwert am Gürtel durch das offene Land ritt. Er stellte sich das Leben eines fahrenden Ritters vor, der nach Belieben durch die Welt zog, Abenteuer bestand und zu Ruhm und Ehren kam. Eine solche Zukunft erwartete die Knappen – als Belohnung dafür, dass sie Äpfel klauten und ihn verprügelten.
Womöglich war dieser Ritt bereits der Höhepunkt seines Lebens. An einem Spätnachmittag im Herbst, bei schönstem Wetter. Der Himmel war so blau wie sonst nur an klaren Wintertagen und die Bäume, die überwiegend noch ihr Laub hatten, leuchteten, als stünden sie der Zeit entrückt in Flammen. Vogelscheuchen mit Kürbisköpfen wachten über die braunen Halme des Getreides und über das späte Gemüse und Obst.
Reuben atmete tief ein. Die Luft roch irgendwie süßer.
Als sie ein Stück weit geritten waren, blickte die Prinzessin zurück. »Hilfred? Glaubst du, sie können uns von der Stadt aus noch sehen?«
»Wer, Hoheit?«, fragte er, erstaunt und dankbar, dass seine Stimme nicht versagte.
»Na, keine Ahnung, wer uns eben beobachtet … die Wachen auf den Mauern oder eine Frau, die ihre Handarbeit weggelegt hat und den Ostturm hinaufgestiegen ist, um aus dem Fenster zu sehen.«
Reuben blickte ebenfalls zurück. Die Stadt war hinter dem Berg und den Bäumen verschwunden. »Nein, Hoheit.«
Die Prinzessin lächelte. »Wunderbar.« Sie beugte sich tief über Tamarisks Rücken und schnalzte mit der Zunge. Das Pferd begann zu galoppieren und preschte die Straße entlang.
Reuben hatte keine andere Wahl, als ihr zu folgen. Er hielt sich mit beiden Händen am Sattel fest, während Melancholie tapfer versuchte, Tamarisk zu folgen. Doch die neunzehnjährige Stute, die meist nur noch auf der Weide stand, hatte gegen das siebenjährige Vollblut aus Maranon keine Chance. Schon bald waren die Prinzessin und ihr Pferd außer Sicht, und Melancholie verfiel wieder in Trab und schließlich in Schritt. Ihre Flanken hoben und senkten sich, und es gelang Reuben nicht, die Stute noch einmal zu einem schnelleren Tempo anzutreiben. Schließlich gab er mit einem ungeduldigen Seufzer auf.
Ratlos blickte er die Straße entlang und überlegte, ob er Melancholie besser stehen lassen und rennen sollte. Zu Fuß wäre er jetzt schneller gewesen als mit dem Pferd. Was sollte er tun? Wenn die Prinzessin nur nicht vom Pferd gefallen war. Wenn Melancholie doch so schnell laufen könnte, wie sein Herz schlug!
Er trottete zur nächsten Kuppe, da sah er die Prinzessin. Arista stand mit ihrem Pferd vor der Torbrücke, die die Grenze zwischen dem Königreich Melengar und dem benachbarten Königreich Warric markierte. Sie sah ihn, machte aber keine Anstalten, ihm erneut zu entkommen.
Bei ihrem Anblick legte sich seine Panik. Sie war in Sicherheit. Wie er sie da auf ihrem Pferd am Flussufer stehen sah, dachte er, dass er zwar den Ritt nicht genossen hatte – ihren Anblick dafür aber umso mehr.
Sie war schön, er hatte es nie stärker empfunden als in diesem Augenblick. Kerzengerade saß sie im Sattel und der Wind bauschte ihr prächtiges Gewand auf, das über den Rücken und die Seite des Pferdes fiel. Pferd und Reiterin wurden von der untergehenden Sonne beschienen, und Aristas langer Schatten erstreckte sich in seine Richtung. Das Licht spielte auf Tamarisks Mähne, auf der Seide ihres Gewands und glitzerte auf der Oberfläche des Flusses. Reuben empfand den Moment als Geschenk, als nicht in Worte oder Gedanken zu fassendes Wunder. Gemeinsam mit Arista Essendon in der Abendsonne zu stehen – sie in ihrem femininen Kleid und er zu Pferd und mit einem Schwert bewaffnet wie ein Mann –, das war ein vollkommener Traum.
Donner von Pferdehufen zerriss die Stille.
Eine Gruppe von drei Reitern sprengte aus dem Wald auf Reubens linker Seite. Hangabwärts galoppierten sie auf ihn zu. Er dachte schon, sie würden mit ihm zusammenstoßen, da vollführten sie im letzten Moment einen Schwenk und preschten mit flatternden Mänteln an ihm vorbei. Melancholie machte vor Schreck über den Beinahezusammenstoß einen Satz von der Straße. Selbst wenn Reuben ein erfahrener Reiter gewesen wäre, hätte er Mühe gehabt, sich im Sattel zu halten. Von dem unerwarteten Sprung überrascht, fiel er vom Pferd und landete auf dem Rücken.
Hastig rappelte er sich auf, während die Reiter geradewegs auf die Prinzessin zuhielten und sie lachend und johlend umringten. Reuben war zwar noch kein Mitglied der Schlosswache, aber Ian hatte ihm nicht ohne Grund das Schwert mitgegeben. Dass die anderen zu dritt waren, spielte keine Rolle. Und dass er selbst seine Fähigkeiten mit dem Schwert nur als erbärmlich beschreiben konnte, ließ ihn keinen Augenblick zögern.
Er zog das Schwert, rannte den Hang hinunter und schrie, als er bei den Reitern ankam: »Lasst sie ihn Ruhe!«
Das Gelächter erstarb.
Zwei der drei stiegen ab und zogen simultan ihr Schwert. Der polierte Stahl blitzte in der tief stehenden Sonne. Als die beiden ihm gegenüber standen, begriff Reuben, dass es sich um Kinder handelte, drei oder vielleicht vier Jahre jünger als er selbst. Ihre Gesichter waren sich so ähnlich, dass es sich um Brüder handeln musste. Ihre Schwerter sahen anders aus als die breiten, Falchion genannten Hiebwaffen der Schlosswache oder die kurzen Schwerter der Knappen. Sie hatten schmale, zerbrechlich wirkende Klingen mit reich verziertem Handschutz.
»Der gehört mir«, sagte der größere der beiden und Reuben konnte sein Glück kaum fassen, als die anderen beiden zurückblieben.
Die Prinzessin gegen Wegelagerer zu verteidigen, auch wenn es nur Kinder sind – vor ihren Augen für ihre Ehre zu kämpfen, zu ihrem Retter zu werden. Bitte, Maribor, steh mir bei … damit ich nicht gegen Kinder verliere!
Der Junge kam zu Reubens Verwirrung vollkommen unbesorgt auf ihn zu. Er war gut fünf Zoll kleiner als er, dünn wie eine Bohnenstange und wegen des Rückenwindes unablässig damit beschäftigt, seine wilden schwarzen Haare aus dem Gesicht zu streichen. Breit grinsend kam er näher.
Auf Schwertlänge herangekommen, blieb er stehen und verbeugte sich zu Reubens Erstaunen. Dann richtete er sich wieder auf und schwang das Schwert ein paar Mal pfeifend durch die Luft. Schließlich nahm er mit leicht gebeugten Knien Kampfhaltung ein, den freien Arm auf dem Rücken.
Dann griff er an.
Atemberaubend schnell. Die Spitze seines schmalen Schwerts fuhr über Reubens Brust. Sie verletzte ihn zwar nicht, zerschnitt aber seinen Kittel. Reuben wich taumelnd zurück. Der Junge setzte sofort nach und bewegte dabei die Füße auf eine Art, wie Reuben es noch nie gesehen hatte. Seine Schritte waren fließend und anmutig, geradezu als würde er tanzen.
Reuben schwang sein Schwert.
Der Junge wich nicht aus. Er hob nicht einmal sein Schwert, um den Schlag zu parieren, sondern lachte nur, als Reuben ihn um einen Zoll verfehlte. »Ich glaube, du würdest mich auch dann nicht treffen, wenn ich an einen Pfahl gefesselt wäre. Die Dame hätte sich einen besseren Beschützer suchen sollen.«
»Das ist keine Dame, sondern die Prinzessin von Melengar«, rief Reuben. »Ich werde nicht zulassen, dass du ihr etwas zuleide tust.«
»Ach wirklich?« Der Junge blickte über die Schulter. »Habt ihr das gehört? Wir haben eine Prinzessin erbeutet.«
Ich bin ein Dummkopf. Reuben hätte sich am liebsten selbst eine runtergehauen.
»Wir werden ihr nichts zuleide tun. Meine Kumpane und ich werden sie nur vergewaltigen, ihr die Kehle durchschneiden und sie dann in den Fluss werfen!«
»Schluss!«, rief Arista. »Das ist grausam!«
»Nein«, erwiderte der Junge, der nicht abgestiegen war. Er trug einen Kapuzenmantel und hatte die untergehende Sonne im Rücken, sodass Reuben sein Gesicht nicht erkennen konnte. »Das ist dumm. Ich schlage vor, wir nehmen die Prinzessin als Geisel und verlangen unser Gewicht in Gold als Lösegeld.«
»Ausgezeichnete Idee«, rief der jüngere der beiden Brüder. Er hatte sein Schwert wieder eingesteckt, holte dafür ein Stück Käse aus seinem Bündel und hielt es dem Jungen, der noch auf dem Pferd saß, beiläufig hin. Der Junge biss hinein und kaute genüsslich.
»Zuerst müsst ihr mich töten«, erklärte Reuben, doch die Jungen lachten nur.
Er schlug erneut zu und sein Gegner wehrte den Angriff ab, ohne den Blick von Reubens Gesicht abzuwenden. »Das war ein wenig besser. Der Hieb hätte mich zumindest treffen können.«
»Nicht, Mauvin!«, rief die Prinzessin. »Er weiß doch nicht, wer du bist.«
»Schon klar«, rief der Junge mit den wilden Haaren und lachte. »Deshalb macht es ja solchen Spaß.«
»Aufhören, habe ich gesagt!«, befahl die Prinzessin und ritt vor.
Der Junge schlug lachend nach Reubens Füßen. Reuben wusste nicht, wie er den Schlag abwehren sollte. Er schwang sein Schwert nach unten und versuchte zugleich, die Füße zurückzuziehen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel nach vorn. Sein Schwert bohrte sich in die Erde. Er rollte sich auf die Seite und rappelte sich auf, um festzustellen, dass der Junge jetzt beide Schwerter in der Hand hielt. Wieder lachten die Jungen – Arista jedoch nicht.
»Aufhören!«, rief sie. »Ihr seht doch, dass er nicht kämpfen kann. Er kann nicht mal reiten. Er gehört zu den Angestellten und hat in seinem ganzen Leben nur Holz gehackt und Wasser geholt.«
»Ich wollte doch nur Spaß.«
»Spaß vielleicht für dich.« Arista zeigte auf Reuben. »Er glaubt wirklich, dass ihr mir was antun wollt. Er meint es ernst.«
»Wirklich? Wenn das stimmt, wäre es ja noch viel peinlicher. Im Ernst, wenn er ein solcher Dummkopf ist, warum in Maribors Namen hat Lawrence ihn dann als deinen Begleiter ausgewählt? Ein echter Straßenräuber hätte ihn mit dem ersten Streich getötet und dich dann an sein Pferd gefesselt und eine Nachricht mit der Lösegeldforderung ins Schloss geschickt.«
Arista sah ihn böse an. »Wenn ihr echte Straßenräuber wärt, wären Tamarisk und ich längst über alle Berge und ihr würdet nur noch die Staubwolke einatmen, die ich zurückgelassen habe.«
»Eher nicht«, sagte der Junge auf dem Pferd.
»Nein?« Die Prinzessin beugte sich vor und flüsterte Tamarisk etwas ins Ohr. Das Pferd machte einen Sprung wie ein Reh und galoppierte die Straße hangaufwärts in Richtung Stadt.
»Ihr nach!«, befahl der Junge auf dem Pferd. Er stieß seinem Pferd die Fersen in die Flanken und nahm die Verfolgung auf.
Der Junge mit dem wilden Haarschopf warf Reuben sein Schwert zu. Dann stiegen er und sein Bruder ebenfalls aufs Pferd und ritten der fliehenden Prinzessin hinterher, von der, genau wie sie gesagt hatte, nur noch eine Staubwolke zu sehen war.
Im nächsten Moment war Reuben allein. Sein einziger Trost war, dass der Prinzessin keine Gefahr drohte. Arista kannte die drei offenbar, was seine Demütigung allerdings noch vergrößerte. Das Einzige, das noch schlimmer war, als von einem Kind geschlagen und in Gegenwart der Prinzessin ausgelacht zu werden, war, dass sie ihn verteidigt hatte statt umgekehrt er sie.
Ihr seht doch, dass er nicht kämpfen kann. Er kann nicht mal reiten. Er gehört zu den Angestellten und hat in seinem ganzen Leben nur Holz gehackt und Wasser geholt.
Reuben stand da, blickte zum dunkelnden Himmel auf und sah schwarze Wolken wie einen Bühnenvorhang über den Himmel ziehen. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er weinte sonst nie, obwohl man ihn schon so oft geschlagen hatte. Schmerzen und Beschimpfungen war er gewohnt, aber das hier war anders. Er hatte schon immer befürchtet, zu nichts nütze zu sein. Jetzt stand es zweifelsfrei fest. Wer immer diese Jungs waren, er wünschte, sie hätten ihn getötet – zumindest bräuchte er dann nicht mit seiner Schmach leben.
Er wischte sich mit seinen schmutzigen Händen über das Gesicht und sah sich um. Es wurde allmählich Nacht. Vom Fluss stieg Nebel auf und aus den Fenstern eines fernen Gehöfts drang Licht. Melancholie war verschwunden. Sie war entweder den anderen Pferden gefolgt oder sie wusste, dass es Zeit war, sich zum Stall zu begeben.
Reuben Hilfred steckte sein geliehenes Schwert in die Scheide und trat den Heimweg an.
Bei seiner Rückkehr zum Schloss war er erschöpft. Als er im Stall nachsah, standen Melancholie und Tamarisk wohlbehalten in ihren Boxen. Nach seiner Schmach, den Prügeln, der anstrengenden Arbeit im Stall und dem langen Fußmarsch in der einbrechenden Nacht hatte er keine Kraft mehr. Trotzdem blieb er auf dem Hof noch einmal stehen und blickte zum Schloss hinauf – und zum Turm.
Aus dem schönen Herbsttag war eine finstere Herbstnacht geworden. Der Vollmond war hinter schwarzen Wolken verborgen, der Wind hatte aufgefrischt. Die Äste der Bäume wogten wie schwarze Hexenfinger vor dem trüben Himmel, und von den Zweigen abgerissene Blätter wirbelten durch den Hof. Es war kalt geworden, und die Fackeln flackerten unruhig. Die Nächte zur Erntezeit waren Reuben nicht geheuer. Eine Vorahnung des Todes schien allgegenwärtig und bald würde alles von Schnee bedeckt sein wie von einem Leichentuch. In seine trostlosen Gedanken versunken, hielt er nach einem Lebenszeichen im Turmfenster Ausschau, doch alles blieb dunkel.
Vertraute Gefühle stiegen in ihm auf – Erleichterung, aber auch Enttäuschung.
Leise betrat er die Kaserne, aus der ihm das Schnarchen von einem Dutzend Männern entgegentönte. Tagsüber getragene Stiefel lüfteten hier aus und ihr Gestank vermischte sich mit dem Gestank von Schweiß und abgestandenem Bier. Reuben teilte sich mit seinem Vater ein eigenes Zimmer, aber besonders komfortabel war es nicht. In der ehemaligen Vorratskammer hatten kaum ihre zwei Feldbetten und ein Tisch Platz. Vor dem Einzug Reubens war die Kammer etwas Besonderes gewesen, ein Privileg, das sein Vater für seine Arbeit im Dienst des Königs erhalten hatte.
Als er eintrat, brannte noch eine Lampe.
»Schon zu Abend gegessen?«, fragte sein Vater.
Kein Wort darüber, wo er gewesen war. Sein Vater fragte so etwas nie, was Reuben erst in letzter Zeit merkwürdig vorkam. Der Alte lag auf seiner Pritsche. Die Stiefel hatte er ausgezogen, Schwertgurt, Kettenhemd und Wappenrock hingen ordentlich an Haken oder lagen auf dem Regalbrett. Sein Gürtel und die drei Lederbeutel, die er immer daran befestigte, lagen nebeneinander am Bett – stets in Reichweite. Wie Reuben wusste, enthielt ein Beutel Münzgeld und ein anderer einen Wetzstein. Der Inhalt des dritten Beutels war ihm hingegen unbekannt. Richard Hilfred hatte einen Arm über das Gesicht gelegt und bedeckte damit seine Augen. So schlief er immer ein. Er hatte sich seit ein paar Tagen nicht rasiert und ein Schatten schwarzer Stoppeln, die dick waren wie Borsten, zog sich über seine Wangen und sein Kinn. Seine Haare, ursprünglich kohlschwarz, waren inzwischen von grauen Strähnen durchsetzt. Reuben, der selbst dunkelblonde Haare hatte, musste daran denken, was Ellison über seine Mutter gesagt hatte.
»Ich habe keinen Hunger.«
Sein Vater nahm den Arm vom Gesicht und sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Was ist passiert?«
Eine Frage? Seit wann das?
»Nichts«, sagte Reuben. Er setzte sich auf sein Feldbett. Was für eine Ironie, dass er jetzt nichts sagte, wenn sein Vater schon einmal Interesse zeigte.
»Wo hast du das Schwert her?«
»Was?« Das hatte er ganz vergessen. »Ach so – das hat Ian mir gegeben.«
»Wozu?«
Vier Fragen auf einmal. Ist das Interesse oder Sorge oder liegt es nur daran, dass ich bald Geburtstag habe?
Sein Vater war um diese Jahreszeit immer jähzornig. In den Jahren, in denen Reuben bei seiner Tante gelebt hatte, hatte Richard ihn immer nur zum Geburtstag besucht – regelmäßig einmal im Jahr, ohne Ausnahme. Keine Umarmung, sein Vater schrie ihn für gewöhnlich nur an und sein Atem stank nach Alkohol. Als seine Tante gestorben war und sein Vater ihn auf das Schloss mitgenommen hatte, hatte Reuben geweint. Er war noch keine zwölf Jahre alt gewesen, aber sein Vater hatte gemeint, dass man in diesem Alter nicht mehr weinte, und ihn verprügelt. Reuben weinte nie mehr – bis zum heutigen Abend, an dem er die Prinzessin hatte wegreiten sehen. Mit ihr waren seine Hoffnungen verschwunden.
»Die Prinzessin wollte unbedingt einen Ausritt machen«, erklärte er. »Und Ian hat gesagt, ich sollte sie begleiten.«
Sein Vater setzte sich auf, und das Holz der Pritsche knarrte. Lange sagte er nichts, sondern starrte ihn nur an, bis Reuben sich unbehaglich fühlte. »Du hältst dich von ihr fern, hörst du?«
»Ich hatte keine Wahl. Sie …«
»Keine Entschuldigungen. Du bleibst von ihr weg, verstanden?«
Reuben nickte. Er hatte längst gelernt, dass er seinem Vater nicht widersprechen durfte. Feldwebel Richard Hilfred war es gewohnt, widerspenstige Männer zur Raison zu bringen. Wenn er einen Befehl gab, wurde der befolgt, oder man riskierte, die Zähne ausgeschlagen zu bekommen. So sorgte er unter den Wachleuten, in der Kaserne und in ihrer kleinen Kammer für Disziplin.
»Adlige sind gefährlich«, fuhr er fort. »Sie fallen wie wilde Tiere über dich her. Man darf ihnen nicht trauen. Für sie sind wir nur Käfer. Manchmal spielen sie mit uns, aber wenn ihnen langweilig wird, zerquetschen sie uns.«
»Warum bist du dann Leibwächter des Königs? Du bist den ganzen Tag in ihrer Gesellschaft.«
Sein Vater sah ihn mit einem sonderbaren Blick an und, Reuben überlegte, ob ihm etwa Prügel drohten. Doch sein Vater war nicht wütend, sondern nachdenklich. »Wahrscheinlich weil ich einmal wie du war. Ich habe an sie geglaubt, ihnen vertraut. Außerdem gibt es im Schloss keine bessere Stelle, außer vielleicht als persönlicher Leibwächter eines Mitglieds der königlichen Familie. Dann hat man Zugang zu allem und wird mit Respekt behandelt. Aber das werde ich nie schaffen, also bin ich Schlangenbeschwörer geworden. Ich weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, wie man die Blaublütigen hinter dem Kopf festhalten muss, damit man nicht gebissen wird.«
»Und wie muss man mit ihnen umgehen?«
»Man darf ihnen keinen Grund geben, dass sie einen bemerken. Ich bin ein Schatten, so unsichtbar und stumm wie ein Stuhl oder eine Tür. Ich muss auf sie aufpassen, aber solange es keine Bedrohung gibt, ist es meine Aufgabe, nicht zu existieren. Du dagegen wurdest bemerkt, und das sogar von der Prinzessin. War es schön, mit ihr auszureiten? Dass alle in der Stadt dich hoch zu Ross, mit einem richtigen Schwert an der Hüfte und einem schönen Mädchen an der Seite gesehen haben? Bist du dir vorgekommen wie einer von ihnen?«
Reuben starrte schweigend zu Boden.
»Ich sehe doch, wie du sie anstarrst. Sie ist hübsch, und sie wird noch hübscher werden, aber du wärst besser beraten, dir die Augen auszureißen. In ein, zwei Jahren wird Amrath sie verheiraten. Er wird nicht lange damit warten. Er braucht Verbündete und wird sie dafür eintauschen, solange sie noch jung und etwas wert ist. Sie wird nach Alburn oder Maranon gehen. Vielleicht hat er ihr deshalb das Pferd geschenkt, damit sie schon mal einen guten Eindruck von ihrem neuen Zuhause bekommt. Egal. Sie ist kein Mensch, sondern ein Wertgegenstand wie Gold oder Silber, und der König wird sich mit ihr mehr Macht oder Sicherheit an den Grenzen kaufen. Denk da dran, wenn du sie das nächste Mal ansiehst. Wenn du mit ihr zusammen sein willst, bestiehlst du den König in gewisser Weise. Und dafür werden Leute hingerichtet – auch Adlige.«
Reuben behagte das Gespräch nicht und er versuchte, das Thema zu wechseln. »Heute Abend brennt kein Licht im Turm.«
Sein Vater sah ihn noch einen Moment lang unverwandt an, um ihm klarzumachen, dass er es ernst meinte, dann wandte er den Blick ab. »Und?« Er legte sich wieder hin, ganz langsam, als habe er Schmerzen. In letzter Zeit bewegte er sich immer öfter so vorsichtig. Er wurde alt, das merkte man.
»Nichts. Ich dachte nur, das ist doch ein gutes Zeichen.«
»Es ist nur ein Zimmer in einem Turm, Reuben. Und manchmal nehmen die Leute in solche Zimmer Kerzen mit.«
»Aber das Zimmer war immer dunkel mit Ausnahme der beiden Nächte – der Nacht, in der Prinzessin Clare verbrannte, und dann der Nacht, in der der Kanzler starb. Ich habe es selbst gesehen.«
»Und?«
»Es heißt doch, der Tod holt immer drei.«
»Wer sagt das?«
»Die Leute.« Reuben machte das Schwert von seiner Seite los und hängte es neben das seines Vaters. Er empfand keinen Stolz dabei. »Ich habe nur überlegt, was in den Nächten, in denen ich Licht gesehen habe, da oben passiert ist.« Er bückte sich, um die Stiefel auszuziehen, und als er aufblickte, starrte sein Vater ihn wieder an.
»Geh mir nicht in die Nähe dieses Turms, verstanden?«
»Jawohl.«
»Ich meine es ernst, Reuben. Wenn ich höre, dass du dich dort herumtreibst, bekommst du von mir Prügel, die noch schlimmer sind als die der Knappen.«
Reuben blickte auf seine Füße. »Du weißt davon?«
»Dein Gesicht ist voller Schrammen, am Rücken deiner Jacke klebt Blut, und dein Kittel hat einen Schnitt. Von wem sollte das sonst sein? Aber keine Sorge.« Sein Vater pustete die Lampe aus. »Ab nächster Woche bist du Mitglied der Schlosswache.«
»Was nützt mir das?«
»Du bekommst ein Kettenhemd statt der Stoffjacke.«
2
Albert Winslow
Einen Besen schwingend kam die Alte auf sie zu. Für Hadrian sah sie aus wie der Inbegriff einer Hexe: Verfilzte schwarze Haare fielen ihr in wirren Locken ins Gesicht und ließen nur ein Auge und die Nasenspitze frei. Der bäuerliche Rock, den sie trug, verfing sich ständig an den Ästen der Büsche und hatte so viele Risse und Flecken, dass sie damit bestimmt schon mehr als einmal hingefallen war.
»Halt! Ich brauche Hilfe!«, schrie sie ihnen so verzweifelt entgegen, als galoppierten er und Royce die Straße entlang. In Wirklichkeit ritten sie in einem gemächlichen Schritttempo. Hadrian hielt an, während Royce noch ein kurzes Stück weiterritt und sich dann mit einem fragenden Blick nach ihm umdrehte. Hadrian kannte diesen Blick aus dem vergangenen Jahr zur Genüge und wusste aus Erfahrung, dass die Verwunderung zu Ungeduld werden würde, sobald sein Partner merkte, dass er wegen der alten Frau stehen geblieben war. Dann kam das Stirnrunzeln hinzu. Hadrian war sich nicht sicher, was es bedeutete – Missbilligung? Als Nächstes würde Royce in offener Verachtung die Augen verdrehen und ärgerlich die Arme verschränken. Zuletzt würde er sich wütend die Kapuze über den Kopf ziehen. Wenn er die Kapuze aufsetzte, war das immer ein schlechtes Zeichen, wie das gesträubte Nackenfell eines Wolfs. Es war eine Warnung und in der Regel die einzige, die man bekam.
»Ihr müsst mir helfen«, rief die Alte, zwängte sich durch das Gebüsch und kletterte aus dem Graben am Straßenrand. »In meiner Scheune ist ein Fremder, und ich fürchte um mein Leben.«
»In deiner Scheune?« Hadrian blickte über den Kopf der Frau hinweg, sah aber nirgends eine Scheune.
Er war zusammen mit Royce auf der Heerstraße in der Nähe der Stadt Colnora in Richtung Norden unterwegs. Am Vormittag waren sie noch an zahlreichen Gehöften und Hütten vorbeigekommen, aber jetzt hatten sie schon seit Längerem keine menschliche Behausung mehr passiert.
»Der Hof von meinem Mann und mir liegt hinter der Kurve.« Sie zeigte die Straße entlang.
»Wenn du einen Mann hast, warum sieht er nicht nach dem Fremden?«
»Mein lieber Danny ist verreist. Er will in Vernes unsere Lammwolle verkaufen und kehrt frühestens in einem Monat zurück. Der Mann in der Scheune ist betrunken und nackt, und er schimpft und tobt wie ein Wahnsinniger. Wahrscheinlich hat ein kranker Hund ihn gebissen und ihn mit seiner Tollheit angesteckt. Ich traue mich nicht in die Nähe der Scheune, aber ich muss doch das Vieh füttern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er bringt mich bestimmt um, sobald ich die Scheune betrete.«
»Du hast ihn noch nie gesehen?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Wenn Ihr mir helft und ihn verjagt, mache ich Euch etwas Gutes zu essen. Eure Pferde bekommen auch etwas. Ich gebe Euch sogar noch Proviant mit auf den Weg. Ich kann wirklich gut kochen.«
Hadrian stieg ab und warf Royce einen Blick zu.
»Was tust du da?«, fragte Royce.
»Es dauert doch nur eine Minute«, sagte Hadrian.
Royce seufzte, was er bisher noch nie getan hatte. »Du kennst die Frau doch gar nicht. Sie geht dich nichts an.«
»Ich weiß.«
»Warum willst du ihr dann helfen?«
»Weil sich das so gehört. Menschen helfen einander. Wenn du jemanden mit einem Pfeil in der Brust auf der Straße liegen siehst, würdest du doch auch anhalten.«
»Natürlich«, sagte Royce, »jeder würde das. Ein Verwundeter ist schließlich eine leichte Beute. Es sei denn, man sieht schon vom Pferd aus, dass ihm bereits jemand anders die Geldbörse abgenommen hat.«
»Was? Nein! Niemand würde einen Verwundeten ausrauben und ihn anschließend sterben lassen.«
Royce nickte. »Stimmt, du hast vollkommen recht. Wenn er eine Geldbörse hat und du sie ihm abnimmst, solltest du ihm danach die Kehle durchschneiden. So mancher Verwundete hat dann doch überlebt, und du willst ja nicht, dass er sich an dir rächt.«
Die alte Frau sah Royce entsetzt an.
Jetzt war es an Hadrian, zu seufzen. »Hör ihm nicht zu, er ist unter Wölfen aufgewachsen.«
Royce verschränkte die Arme. Seine Augen funkelten böse. Ich hätte dir das nicht erzählen dürfen.«
»Es ist ein so schöner Nachmittag und wir haben keine Eile«, fuhr Hadrian fort. »Außerdem jammerst du doch immer über meine Kochkünste. Bestimmt schmeckt dir ihr Essen besser. Ich schaue mir den Kerl nur schnell an.« Leiser fügte er hinzu: »Er ist bestimmt nur ein armer Tropf, der verzweifelt ein Dach über dem Kopf sucht. Wenn ich die beiden dazu bringen kann, miteinander zu reden, klärt sich alles. Vielleicht kann die Frau ihn als Knecht einstellen, solange ihr Mann weg ist. Dann hat sie eine Hilfe und er einen Platz zum Schlafen. Und wir bekommen eine warme Mahlzeit, so profitieren alle.«
»Aber wenn deine gute Tat danebengeht, hörst du das nächste Mal auf mich und mischst dich nicht in die Probleme anderer Leute ein.«
»Abgemacht. Aber was soll schon passieren? Der Kerl ist allein. Selbst wenn er ausrastet, werden wir mit einem betrunkenen Landstreicher doch wohl noch fertig.«
Der Herbst war sehr nass gewesen und die Straße ein einziger Morast. In den Pfützen lag totes Laub, die Bäume verwandelten sich immer mehr in schwarze Skelette und nur noch wenige Vögel waren zu hören. Hadrian vermisste sie immer, wenn das Laub fiel, und war überrascht, wenn sie im Frühling zurückkehrten, weil er ihr Zwitschern schon ganz vergessen hatte.
Der Bauernhof lag wie angekündigt gleich hinter der nächsten Biegung, wenn man überhaupt von einem Bauernhof sprechen konnte. Die Häuser, an denen sie bisher vorbeigekommen waren, waren ordentlich weiß verputzt gewesen, und ihre Strohdächer hoben sich leuchtend gelb vom Rot und Orange der Blätter ab. Golden standen auf den Feldern der Weizen und die Gerste und warteten darauf, geerntet zu werden. Das Gehöft der Frau dagegen bestand aus einer baufälligen Bretterhütte inmitten einiger windschiefer Zäune. Hadrian stellte sich in die Steigbügel, doch er entdeckte nirgends ein bestelltes Feld.
»Die Scheune liegt gleich hinter dieser Kuppe.« Die Alte streckte den Arm aus. »Ihr könnt das Dach sehen. Wenn Ihr wollt, versorge ich inzwischen Eure Pferde mit Getreide und Wasser und mache Euch etwas zu essen.«
»Du hast gesagt, der Mann war allein?« Hadrian schwang sich vom Pferd und ließ die Frau vorausgehen.
Sie nickte.
Hadrian, an dessen Gürtel bereits zwei Schwerter hingen, schnallte einen langen Zweihänder von seinem Pferd los und zog das Wehrgehänge über die Schulter, sodass ihm das Schwert über den Rücken hing. Nur so konnte es getragen werden. Es war die Waffe eines Ritters und für den Kampf zu Pferde gedacht. An der Hüfte getragen, hätte die Spitze über den Boden geschleift.
»Ganz schön viel Eisen für einen Landstreicher«, sagte die Frau.
»Macht der Gewohnheit«, erklärte Hadrian.
Royce stieg ebenfalls ab. Er trat zuerst mit dem rechten und dann vorsichtiger mit dem linken Fuß auf. Dann öffnete er seine Satteltasche und suchte nach etwas. Die Frau wartete, bis er fertig war, bedankte sich für die Hilfe und führte die Pferde zum Haus, ohne sich noch einmal nach Royce und Hadrian umzudrehen.
Ein aus Feldsteinen gemauerter Brunnen nahm die Mitte des Hofes zwischen Haus und Nebengebäuden ein. Die Scheune stand weiter hangabwärts. Alles war mit kniehohem Gras und mit Löwenzahn, der sich ausgesät hatte, überwuchert. Royce sah sich kurz um, dann setzte er sich auf die Steine eines Fundaments, auf dem offenbar einst ein Schuppen gestanden hatte – der Größe nach zu schließen höchstens ein Hühnerstall. Er hob den linken Fuß und betrachtete ihn. Durch das weiche Leder seines Stiefels zog sich eine Reihe von Löchern.
»Wie geht es deinem Fuß?«, fragte Hadrian.
»Tut weh.«
»Er hat ihn richtig fest gepackt.«
»Und mich durch den Stiefel gebissen.«
»Ja, das sah ziemlich schmerzhaft aus.«
»Warum hast du mir eigentlich nicht geholfen?«
Hadrian zuckte mit den Schultern. »Es war ein Hund, Royce, ein niedlicher kleiner Hund. Was hätte ich tun sollen, ein unschuldiges Tier töten?«
Royce legte den Kopf schräg und sah seinen Freund an. Die Augen hatte er gegen die späte Nachmittagssonne zusammengekniffen. »Soll das ein Witz sein?«
»Es war ein Welpe.«
»Das war kein Welpe, er wollte meinen Fuß fressen.«
»Gut, aber er hat sich ja auch von dir bedroht gefühlt.«
Royce runzelte die Stirn und ließ den Fuß sinken. »Gehen wir zur Scheune und sehen nach deinem Bösewicht.«
Sie stiegen den grasbewachsenen Hang hinunter. Ein Meer von weißen und gelben Wildblumen wiegte sich in der sanften Brise, und Honigbienen summten geschäftig zwischen Gänseblümchen und wilden Möhren hin und her. Hadrian lächelte. Wenigstens die Bienen taten noch ihre Arbeit und bestellten das Land. Sie näherten sich der Scheune, die genauso verfallen war wie das Haus.
»Du hättest ihn wirklich nicht aus dem Fenster werfen müssen«, sagte Hadrian.
Royce, der in Gedanken immer noch mit seinem Fuß beschäftigt war, blickte auf. »Was hätte ich mit dem Köter denn sonst tun sollen? Ihn hinter den Ohren kraulen, während er mir die Zehen wegfrisst? Und wenn er angefangen hätte zu bellen? Das wäre eine schöne Sauerei geworden.«
»Gut, dass unter dem Fenster ein Wassergraben war.«
Royce blieb stehen. »Ein Wassergraben?«
Jetzt runzelte Hadrian die Stirn. Manchmal wusste er nicht, ob Royce es ernst meinte oder nicht. Sie arbeiteten jetzt seit fast einem Jahr zusammen, aber er hatte immer noch Probleme, seinen neuen Partner zu verstehen. Eins stand jedenfalls fest: Royce Melborn war der bei Weitem interessanteste Mensch, den er je kennengelernt hatte – aber leider auch der am schwersten zu verstehende.
Sie waren an der Scheune angekommen, erbaut aus Holzbalken und Feldsteinen und mit einem Strohdach. Das Gebäude neigte sich zur Seite und lehnte mit dem Dachtrauf gegen den Stamm eines alten Ahorns. Es fehlten einige Schindeln, und auch das Strohdach hatte Löcher. Das zweiflügelige Tor stand einen Spalt offen, aber drinnen war es so dunkel, dass man nichts erkennen konnte.
»Hallo?«, rief Hadrian. Er drückte das Tor ganz auf und spähte hinein. »Ist da jemand?«
Royce stand nicht mehr hinter ihm. Er pflegte bei solchen Gelegenheiten zu verschwinden. Seine Stärke war es, sich lautlos zu bewegen, und er benutzte den lauten Hadrian gern als Ablenkung.
Niemand antwortete.
Hadrian zog ein Schwert und trat ein.
Drinnen sah es aus wie in jeder Scheune, nur dass diese verwahrlost wirkte und zugleich bewohnt – eine seltsame Mischung. Der durchhängende Dachboden war mit fauligem Heu gefüllt. Die wenigen Gerätschaften, die an den Wänden lehnten, waren rostig und voller Spinnweben.
In dem Licht, das durch die Löcher im Dach und in den Wänden fiel, sah man einen Mann schlafend auf einem Heuhaufen liegen. Er war dünn, unglaublich schmutzig und lediglich mit einem Nachthemd bekleidet. In seinen Haaren hing Gras, sein Gesicht verschwand fast vollständig im Gestrüpp eines wuchernden Barts. Er hatte die Beine angezogen, und ein alter Leinensack diente ihm als Decke. Sein Mund stand weit offen, und er schnarchte laut.
Hadrian steckte das Schwert wieder ein und stieß vorsichtig gegen den nackten Fuß des Mannes. Der Mann brummte nur etwas und drehte sich um. Auf einen zweiten Stoß hin gingen seine Augenlider auf. Als er Hadrian sah, fuhr er erschrocken hoch und kniff die Augen zusammen. »Wer seid Ihr?«
»Hadrian Blackwater.«
»Und was wünscht Ihr?« Die gewählte Ausdrucksweise passte nicht zu seinem heruntergekommenen Äußeren.
»Die Bäuerin schickt mich. Sie will wissen, was Ihr in ihrer Scheune zu suchen habt.«
»Ich fürchte, ich kann Euch nicht folgen.« Der Mann kniff die Augen noch stärker zusammen.
Beredt, aber nicht der Hellste. »Fangen wir mit Eurem Namen an. Wie heißt Ihr?«
Der Mann stand auf und klopfte das Heu von seinem Nachthemd. »Ich bin Vicomte Albert Tyris Winslow, Sohn des Armeter.«
»Ein Vicomte?« Hadrian lachte. »Habt Ihr getrunken?«
Der Mann sah ihn so traurig an, als hätte Hadrian nach seiner verstorbenen Frau gefragt. »Ich wünschte, ich hätte das Geld dazu.« Plötzlich hellte sich seine Miene hoffnungsfroh auf. »Dieses Hemd ist alles, was ich noch besitze, aber es ist aus feinstem Leinen gefertigt. Ich würde es Euch für einen Bruchteil seines Wertes verkaufen. Für nur einen Silbertaler, einen schlappen Taler. Habt Ihr einen übrig?«
»Ich brauche kein Nachthemd.«
»Aber Ihr könntet es wieder verkaufen.« Albert spuckte auf einen Fleck und rieb den Stoff zwischen den Fingern. »Man braucht es nur gründlich zu waschen, dann sieht es wieder aus wie neu. Es könnte Euch leicht zwei Silbertaler einbringen, vielleicht sogar drei. Ihr hättet Euren Einsatz verdoppelt.«
Royce sprang geräuschlos vom Dachboden herunter und landete neben ihnen. »Er ist allein.«
Albert fuhr erschrocken zurück und starrte Royce ängstlich an. Die meisten Menschen reagierten ähnlich – sie hatten Angst vor Royce. Er war zwar kleiner als Hadrian und trug keine Waffe, zumindest nicht offen, wirkte auf andere aber trotzdem bedrohlich, vielleicht mit Ausnahme einiger besonders Mutiger. Seine schwarzen und grauen Kleider und die dunkle Kapuze mochten diesen Eindruck verstärken, vor allem beruhte er aber darauf, dass diese Angst durchaus berechtigt war. Die Menschen spürten das. Royce roch nach Tod, wie ein Seemann nach Salz oder ein Priester nach Weihrauch.
»Jetzt verstehe ich … Ihr wollt mich ausrauben, ja?«, rief Albert. »Tut mir leid, reingefallen.« Er blickte auf seine Füße und gab ein wimmerndes Geräusch von sich – ein klägliches Lachen. »Ich habe nichts … keinen Heller.« Er fiel auf die Knie, schlug die Hände vor das Gesicht und begann zu schluchzen. »Und ich habe keine andere Bleibe. Die Scheune hält zwar nicht viel mehr Regen ab als der Baum, an dem sie lehnt, aber wenigstens bietet sie ein Dach über dem Kopf und eine weiche Unterlage zum Schlafen.«
Royce und Hadrian betrachteten ihn stumm.
»Das ist also dein Bösewicht, ja?« Royce grinste spöttisch.