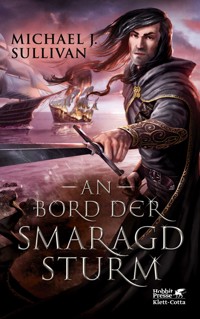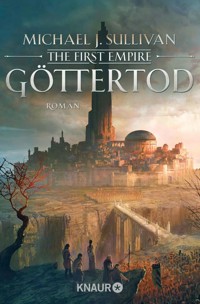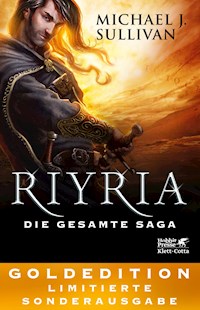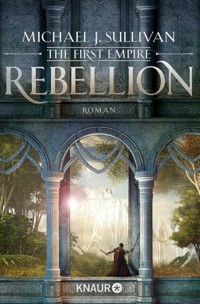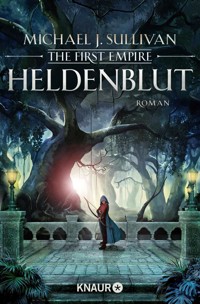
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Zeit der Legenden
- Sprache: Deutsch
In den Landen der Toten werden wahre Helden geboren! Teil 4 der High-Fantasy-Saga »The First Empire« von Bestseller-Autor Michael J. Sullivan Seit die Seherin Suri den mächtigen Gilarabryn erschaffen hat, herrscht eine Art Patt-Situation im Krieg der Rhune gegen ihre falschen Götter, die Fhrey. Um die Fhrey endgültig schlagen zu können, fordert Nyphron die Erschaffung weiterer Gilarabryn von Suri, doch die Seherin weigert sich hartnäckig, ihre Fähigkeiten ein weiteres Mal einzusetzen. Mittlerweile haben auch die Fhrey in der mächtigen Waffe den Schlüssel zum Sieg erkannt – und entführen Suri. Gegen den ausdrücklichen Befehl von Nyphron und Persephone wagt eine kleine Gruppe von Helden das Unmögliche, um die Seherin zu retten: Nur wenn sie sterben und durch die Lande der Toten reisen, können sie die Hauptstadt der Fhrey betreten, wo Suri gefangen gehalten wird. Ihre Aussichten auf Erfolg sind gering … Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Heldenblut
The First EmpireRoman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit die Seherin Suri den mächtigen Gilarabryn erschaffen hat, herrscht eine Art Patt-Situation im Krieg der Rhune gegen ihre falschen Götter, die Fhrey. Um die Fhrey endgültig schlagen zu können, fordert Nyphron die Erschaffung weiterer Gilarabryn von Suri, doch die Seherin weigert sich hartnäckig, ihre Fähigkeiten ein weiteres Mal einzusetzen.
Mittlerweile haben auch die Fhrey in der mächtigen Waffe den Schlüssel zum Sieg erkannt – und entführen Suri. Gegen den ausdrücklichen Befehl von Nyphron und Persephone wagt eine kleine Gruppe von Helden das Unmögliche, um die Seherin zu retten: Nur wenn sie sterben und durch die Lande der Toten reisen, können sie die Hauptstadt der Fhrey betreten, wo Suri gefangen gehalten wird. Ihre Aussichten auf Erfolg sind gering …
Inhaltsübersicht
Verlorene Unschuld
Exodus
Rückkehr des Fhans
Die Schlacht auf der Hochebene
Planänderung
Der Drache und die Taube
Die Schlacht im Harwald
Die Personifizierung des Bösen
Stillstand
Immer Ärger mit Tressa
Techylors
Avempartha
Mein Prinz
Unten am Fluss
Das Tier im Käfig
Sechs Tote, eine Gefangene
Malcolm hat es mir erzählt
Das Mysterium im Garten
Im Lande Nog
Jenseits des Tageslichts
Der Sumpf von Ith
Treyas Talente
Stimmen im Nebel
Beschwerliche Pfade
Die verborgene Insel
Auf dem Drachenhügel
Die Hexe von Tetlin
Der Schlüssel
Vater und Sohn
Der stinkende Tümpel
Das Treffen mit dem Fhan
Das Schicksal der Narren
Glossar
1
Verlorene Unschuld
Unschuld ist ein seltsamer Schatz, eine Tugend für die Alten und ein Fluch für die Jungen. Sie ist wertvoll und wird doch leichtfertig fortgegeben – die Schönheit makelloser Haut, eingetauscht für die Weisheit von Schwielen und Falten.
– Das Buch Brin
Suri saß mit einem Schwert im Schoß allein am Fuß eines Hügels und starrte das Wesen an, das die meisten als Drache bezeichnet hätten. Für die einstige Seherin von Dahl Rhen war die Kreatur allerdings ein weiterer Splitter ihres gebrochenen Herzens. Nachdem es mehrere Male zerschmettert worden war, waren die Bruchstücke ihres Herzens nun über zwei Kontinente verteilt. Der Splitter, den sie an diesem Morgen betrachtete, war nicht nur riesig, sondern auch der einzige noch sichtbare.
Tagelang hatte sie das drachenähnliche Wesen auf dem Hügel beobachtet. Da sie es erschaffen hatte, fühlte Suri sich verantwortlich für seine zukünftigen Taten. Sie hatte ihre Schöpfung im Auge behalten, doch das Ungeheuer hatte sich nicht mehr bewegt, seit es eine halbe Armee abgeschlachtet und damit die Bewohner von Alon Rhist gerettet hatte. Es hatte noch nicht einmal mit dem Schwanz gezuckt. Das war für fast alle gleichermaßen beruhigend wie besorgniserregend. Die meisten hofften, dass der einst wundersame, aber nun beängstigende Drache, der auf ihrer sprichwörtlichen Türschwelle lag, einfach davonfliegen würde. Sie wollten, dass das heldenhafte Monster wieder an jenen mysteriösen Ort verschwand, von dem es gekommen war. Die wenigsten wussten um seine Herkunft, obwohl sich das Gerücht verbreitet hatte, dass Suri mit seinem Auftauchen zu tun hatte. Die Seherin dachte sich, dass die meisten den Gilarabrywn wohl als eine Art permanentes Inventarstück ansahen, das ihnen allerdings jederzeit gefährlich werden konnte. Etwa wie ein Wespennest auf ihrer Veranda. Nur dass Wespen keine Steinmauern einreißen und kein Feuer speien konnten.
Das Biest lag jedoch weiterhin zusammengerollt auf dem Hügel und rührte sich nicht, wie eine riesige Statue oder eine unnatürliche Gesteinsformation. Ein ruhiger, schlafender Drache war zwar noch lange nicht ideal, aber besser als die Alternative.
Von Suris Standpunkt aus sah es mit der aufgehenden Sonne im Rücken des Wesens so aus, als ob der Gilarabrywn mit dem zerklüfteten Umriss des Hügels namens Wolfskopf verschmölze. Suri musste sich anstrengen, um seine Silhouette überhaupt noch zu erkennen. Sie hatte Mühe, sich daran zu erinnern, wo Kopf und Schwanz lagen. Nur die Flügel hoben sich klar und deutlich von der Hügelkuppe ab. Selbst zusammengefaltet ragten sie noch weit in die Höhe wie zwei spitz zulaufende Fahnenmasten.
Suri spürte das Gewicht des schwarzen und bronzefarbenen Schwertes in ihrem Schoß und überlegte, ob sie näher herangehen sollte. Sie würde die Kreatur irgendwann freilassen müssen, doch es schien immer einen Grund zu geben, diese Verpflichtung auf den nächsten Tag zu verschieben. Stattdessen saß sie auf einem Felsen neben einem toten Baum, während die Wogen ihrer Schuld über sie hereinbrachen.
Wenn ich da hochgehe, wird er die Augen öffnen. Dessen war Suri sich sicher. Die riesigen Pupillen würden sich auf sie richten und sie anstarren, so voller … ja, was? Hass? Furcht? Mitleid? Suri war sich nicht sicher und hatte keine Ahnung, ob sie den Unterschied erkennen würde. Das Schlimmste an einemGilarabrywn ist, dass ich ihn zweimal töten muss.
Trotz tagelanger Regengüsse war das Schlachtfeld von Grandford immer noch blutbefleckt. Der beigefarbene, felsige Untergrund hatte einen rostroten Ton angenommen, und es stank abscheulich, vor allem wenn der Wind von Westen kam. Nicht alle Leichen waren begraben worden. Viele Fhrey hatte man verrotten lassen. Es gab zu viel Arbeit und zu wenige Leute, um sie zu verrichten, sodass es nicht gerade eine Priorität war, den Feind zu begraben.
»Dies ist ein grauenhafter Ort«, sagte Suri und sah zu dem Wesen auf. »Aber das hast du immer gewusst, nicht wahr?«
Sie hatte die Trostlosigkeit der Hochebene von Dureya schon lange vor dem Tag gespürt, an dem sie die Vorahnung von Raithes Tod zu überwältigen gedroht hatte. Die Kunst verlieh ihr ein zweites Gesicht, einen sechsten Sinn. Arion hatte es manchmal als drittes Auge bezeichnet, aber das stimmte nicht. Das Gefühl hatte nichts mit Suris Sehvermögen zu tun. Es schickte ihr Gefühle, Eindrücke, und meistens erreichten sie sie in Form eines verworrenen, unübersichtlichen Wirrwarrs. Normalerweise stach die naheliegendste und stärkste Wahrnehmung aus den vielen Hintergrundgeräuschen heraus, aber an diesem Ort war der Lärm ohrenbetäubend. Mehrere Generationen hatten auf dieser Ebene gekämpft und waren hier gestorben.
Und nichts hat sich verändert.
Suri hielt Arions Mütze in den Händen. Sie rieb mit beiden Daumen über den dicken Wollstoff und erinnerte sich an Arions Stimme. Trotzdem fühle ich ihn, diesen kleinen Faden, der dich mit dem Frieden verbindet. Wenn ich dich ansehe, spüre ich Hoffnung. Du bist wie ein Licht in der Dunkelheit, und du scheinst jeden Tag heller. Das hatte Arion vor nur wenigen Tagen gesagt, doch es fühlte sich so an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Suri fühlte sich nicht heller.
Hinter ihr ertönten Geräusche. Jemand kam von den Ruinen der Festung über den blutgetränkten Boden zu ihr. Malcolm. Sie musste sich nicht umdrehen oder die Kunst benutzen, um zu wissen, wer da kam. Malcolm war der Einzige, der sich nicht vor dem Wespennest auf der Veranda oder dessen Schöpferin fürchtete. Und sie hatte ihn erwartet.
Seit Raithes und Arions Beerdigung hatte Suri die meiste Zeit an diesem Ort verbracht. Sie und der Gilarabrywn waren ungleiche Zwillinge, die miteinander verbunden waren. Suri verließ ihren Platz manchmal, um sich auf die Suche nach Essen zu begeben, achtete aber stets darauf, anderen aus dem Weg zu gehen. Sie wollte mit niemandem sprechen, keine Fragen beantworten und sich keinen mitleidigen oder ängstlichen Blicken stellen müssen. Sie wollte auch nicht mit Malcolm sprechen. Obwohl er nichts mit Arions Tod zu tun hatte, hatte er sie doch dazu gedrängt, Raithe zu töten und so den Gilarabrywn zu erschaffen.
»Ist schon komisch«, sagte er im Näherkommen, »wie mit der Zeit ganz einfache Dinge, alberne kleine Dinge wie Wollmützen, so wichtig für uns werden können. Hat irgendwie etwas Magisches.«
Suri sah auf die Mütze herab und nickte.
»Sie hat sie nur für kurze Zeit getragen. Hat gesagt, dass sie juckt. Aber so ist sie mir am klarsten in Erinnerung geblieben.«
Malcolm setzte sich neben sie. Seine großen, dürren Knie standen wie die eines Grashüpfers in die Höhe.
»Bist du ein …?« Suri wollte Miralyith sagen, doch während sie noch sprach, erkannte sie, dass er keiner war. Miralyith sendeten eine Art Signal aus, eine Art Hitze, ein Licht. Malcolm schien wie jeder andere zu sein, aber irgendwie war da noch mehr. Es war ihr vorher nie aufgefallen, aber wenn er ein Baum wäre, wäre er keiner der alten. Malcolm wäre die perfekt geformte Eiche im grünen Blätterkleid, die man sich vorstellte, wenn man an einen Baum dachte. Er war nicht gewöhnlich, das war eindeutig, und er war auch nicht leicht zu verstehen. Wenn sie ihn ansah, war es, als ob sie versuchte, eine Wolke zu fassen. Sie gab es auf, Malcolm verstehen zu wollen. Nicht jedes Rätsel musste gelöst werden, und manche waren den Aufwand nicht wert. Das traf wohl auf ihn zu.
»Bin ich was?«
»Nichts.« Sie schüttelte den Kopf. »Vergiss es.«
»Wie geht es dir? Alles in Ordnung?«
»Nein.«
Sie schwiegen, während der trockene Wind vergeblich versuchte, das spröde Gras zum Tanzen zu bringen.
»War es das?«, fragte Suri schließlich. »War das alles?«
Malcolm hatte verraten, dass er die Zukunft voraussehen konnte, und sie wusste nicht, wie viel mehr sie noch verkraften konnte.
»Das musst du schon ein bisschen genauer formulieren.«
Suri hatte angenommen, dass er wusste, worauf sie hinauswollte, dass er ihre Gedanken lesen konnte, aber das war wohl ungerecht. Es gab auch Leute, die glaubten, dass sie Gedanken lesen konnte.
»Arion glaubte, dass es Frieden zwischen unseren Völkern geben würde, wenn der Fhan wüsste, dass ein Rhune die Kunst beherrscht.« Sie nickte in die Richtung des Gilarabrywn. »Na ja, der Fhan hat es mit eigenen Augen gesehen, also müsste der Krieg doch vorbei sein. Ist er das?«
Malcolm schüttelte betrübt den Kopf. »Nein, ist er nicht.«
»Aber warum hast du dann …« Suris Augen füllten sich mit Tränen. »Wenn du gewusst hast, dass es nicht reichen würde, warum hast du mich dann Raithe opfern lassen?«
»Du kennst die Antwort darauf. Die Streitkräfte des Fhans hätten uns überrannt, und alle wären gestorben. Raithe hat uns gerettet. Du hast uns gerettet. Und …«
»Und?«
»Es war nötig, im Hinblick auf das, was noch kommen wird.«
»Und was ist mit mir? Habe ich meine Rolle gespielt? Ist es vorbei? Ich meine, ich habe getan, was Arion von mir wollte und was du verlangt hast, also bin ich doch jetzt fertig, oder?«
Die Zukunft war Suri egal, da sie von der Vergangenheit zerschmettert worden war. Sie war an einem ganz neuen Höhepunkt des Selbsthasses angelangt, nachdem sie zwei ihrer besten Freunde getötet hatte und eine Dritte nicht hatte retten können. Dies waren nicht die Taten einer tugendhaften Person. Es hatte sich herausgestellt, dass Schmetterlinge gar nicht schön waren. Sie waren Ungeheuer, genauso wie die Splitter eines gebrochenen Herzens. Sie hatte ihre Unschuld nicht einfach nur verloren, sie war vielmehr gnadenlos zertrümmert worden, und Suri fühlte sich nicht mehr nur einsam, sondern geradezu verlassen. Man hatte sie allein zurückgelassen. Sie wollte ins Weißdorntal zurückkehren, sich im Wald vergraben und nie wieder auch nur in die Nähe anderer Leute kommen.
Malcolm runzelte die Stirn. »Du willst weglaufen?«
Na klar, jetzt kann er auf einmal Gedanken lesen.
»Das kannst du nicht tun. Noch nicht. Leider hast du erst ein paar Schritte in Richtung der Rolle gemacht, die du einnehmen musst.« Er seufzte. »Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ab jetzt alles gut werden wird oder dass das Schlimmste hinter dir liegt, aber …«
»Es wird noch schlimmer?« Suris Augen wurden groß.
Malcolm zog erneut die Stirn in Falten. »Was ich sagen will, ist …«
»Wie kann es denn noch schlimmer werden?«
»Du musst dir immer vor Augen halten, dass sich am Ende alles …«
»Dass sich alles gelohnt haben wird?«, rief sie hitzig. »Nichts kann wiedergutmachen, was schon passiert ist. Nichts!« Suri stand plötzlich aufrecht, ohne sich erinnern zu können, aufgesprungen zu sein. »Minna ist tot. Arion ist tot. Raithe ist tot. Und ich habe sie alle umgebracht!«
»Du hast Arion nicht getötet, sie …«
»Sie war wegen mir in Alon Rhist!«
»Suri, beruhige dich«, sagte Malcolm sanft.
»Ich will mich nicht beruhigen! Ich werde mich nicht beruhigen! Ich …«
»Suri!«, sagte Malcolm scharf und deutete in Richtung Hügel.
Der Gilarabrywn hatte den Kopf gehoben, seine Augen waren geöffnet und funkelten bedrohlich. Auch wenn es kein Leichtes war, die Mimik einer verzauberten Kreatur zu interpretieren, war Suri sich ziemlich sicher, dass der Gilarabrywn nicht besonders erfreut war.
Die Seherin atmete ein paarmal tief durch, wischte sich über die Augen und setzte sich wieder.
»Ich habe nie um das alles gebeten«, wisperte sie.
»Ich weiß, aber es wurde dir trotzdem gegeben. Wir haben nichts als den Weg, der vor unseren Füßen liegt. Viel zu oft bleibt uns nur die Wahl zwischen zwei Richtungen: stehen bleiben oder weitergehen. Und wenn wir stehen bleiben, kommen wir nirgendwo an.«
»Können wir nicht zurückgehen?«
Malcolm schüttelte den Kopf. »Was du als Rückzug siehst, wäre lediglich dasselbe wie Vorwärtsgehen, nur in eine andere Richtung. Beide Pfade sind gleichermaßen risikobehaftet.«
»Also, was soll ich tun?«
»Es würde im Moment schon reichen, wenn du nicht davonläufst.« Er warf dem Gilarabrywn einen Blick zu. Das riesige Wesen hatte sich wieder beruhigt. »Und lass ihn noch nicht frei.«
»Nicht?« Suri hatte sich davor gefürchtet, das Schwert in ihre Schöpfung zu bohren. Es wäre kein Mord, nicht wirklich, aber es würde sich trotzdem so anfühlen. Sie musste nicht lange überredet werden, es nicht zu tun.
Malcolm schüttelte den Kopf. »Genau wie du hat er noch etwas zu tun. Die gute Nachricht ist, dass es nicht von deiner Hand geschehen muss. Gib mir das Schwert. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich darum kümmern.«
Sie übergab ihm das Bronzeschwert, auf dessen Klinge Raithes Name stand.
»Also, wenn ich nicht zum Weißdorntal zurückkehren kann, was soll ich dann tun?«
»Du wirst deinen neuen Weg erkennen, wenn du dort ankommst. Das ist das Schöne an Straßen, sie führen alle irgendwohin.«
Wie um seine Worte zu unterstreichen, stand Malcolm auf. Er lächelte sie an. Es war ein gutes Lächeln, es passte perfekt zu diesem Moment. Suri fühlte sich sofort besser. Er machte sich auf den Weg zurück zu den Ruinen von Alon Rhist, hielt dann aber inne und sah noch einmal zum Gilarabrywn zurück. »Hat Arion dir beigebracht, Drachen zu erschaffen?«
Seine Frage überraschte Suri, da sie angenommen hatte, dass Malcolm alles über die Erschaffung eines Gilarabrywn wusste. In jener Nacht in der Schmiede, als sie Raithe verwandelt hatte, schien er darüber Bescheid zu wissen. »Das Webmuster, das ich dafür benutzt habe, stand auf den Steinplatten in der Agave.«
Malcolms Augen verengten sich zu Schlitzen. Er sah Suri verwirrt an, als würden sie nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. »Steinplatten in der Agave?«
Suri nickte. »Tafeln aus Stein, die wir tief unter der Erde in Neith gefunden haben. Darauf waren Zeichen eingeritzt, die Brin übersetzt hat.«
»Woher kamen diese Tafeln?«
Suri zuckte die Achseln. »Der Ältere hat den Text darauf verfasst.« Nun war es an Suri, verwirrt die Brauen zusammenzuziehen. »Wie kommt es, dass du nichts darüber weißt? Ich dachte, du wüsstest alles.«
Das perfekte Lächeln war von Malcolms Lippen verschwunden. »Das dachte ich auch.«
Brin saß mit dem Rücken an die Steinwand gelehnt an einem kleinen Schreibtisch im Taubenschlag. Um sie herum gurrten ein Dutzend Vögel in ihren einzelnen Verschlägen. Persephone hatte sie gebeten, weiterhin Ausschau nach einer Antwort des Fhans zu halten, und da der Taubenschlag einer der wenigen Orte war, die von der Zerstörung der Schlacht verschont geblieben waren, hatte Brin beschlossen, dort einzuziehen. Es war der perfekte Ort, um an ihrem Buch zu arbeiten. Es gab bereits einen winzigen Schreibtisch, der dazu benutzt worden war, Nachrichten an die Fhrey-Außenposten zu verfassen.
Sie war so versunken in ihre Arbeit, dass sie Malcolm nicht kommen hörte, bis er sich räusperte. »Wie läuft es mit dem Buch?«
Sie sah ihn verblüfft an. Woher wusste er, dass ich hier oben bin?
»So nennst du es doch, oder? Ein Buch?«, fragte er.
»Ja, das Buch von Brin.«
Malcolm nickte. »Roan und Persephone sprechen oft davon, und zwar ziemlich stolz. Es hört sich nach einer wunderbaren Idee an, alles aufzuzeichnen, was passiert ist. Aber du musst vorsichtig sein. Achte darauf, dass du mit deiner persönlichen Sichtweise der Dinge nicht die Fakten verzerrst.«
Brin beugte sich vor und stemmte die Ellbogen auf den Schreibtisch. »Sprichst du etwa von Gronbach? Dieser niederträchtige Maulwurf hat nämlich alles Negative verdient, was ich über ihn geschrieben habe.«
»Der Zwerg?« Malcolm hielt inne und dachte einen Augenblick nach. »Nein, ich habe mich nicht direkt auf ihn bezogen. Aber jetzt, da du es ansprichst, sollte ich anmerken, dass du damit riskierst, ein ganzes Volk negativ darzustellen, was in der Zukunft ungeahnte Auswirkungen haben könnte. Was ich sagen möchte ist: Du solltest so wahrheitsgetreu wie möglich schreiben, denn dein Bericht wird höchstwahrscheinlich der einzige Bericht sein.«
Das war nichts Neues für Brin. Sie hatte ja damit begonnen, an ihrem Projekt zu arbeiten, um einen einzigen Bericht aller vergangenen Ereignisse zu verfassen. Eine allgemeine Quelle, die von nachfolgenden Hüterinnen der Wege benutzt und ergänzt werden würde. »Ich würde nie lügen. Für uns Hüterinnen ist es Ehrensache, beim Erzählen sorgfältig und genau vorzugehen.«
Malcolm nickte, rang sich aber ein schmerzliches Lächeln ab. »Und doch haben sie die Vergangenheit allzu oft falsch dargestellt.«
»Wovon sprichst …«
»Nehmen wir zum Beispiel Gath von Odeon. Er ist eine Legende deines Clans, nicht wahr?«
Brin hatte so im Gefühl, dass Malcolm drauf und dran war, weiter auszuholen, also schloss sie ihr Tintenfässchen und lehnte sich zurück. »Ja.«
»Aber was ist eigentlich eine Legende?«
Brin fand die Frage verwirrend. Malcolm versuchte eindeutig, sie von etwas zu überzeugen, doch sie wusste bereits, dass es ihr nicht gefallen würde. Er wollte auf etwas Bestimmtes hinaus, aber sie hatte keine Ahnung, was das war. Mit einem unverbindlichen Schulterzucken gab sie ihm die offensichtliche Antwort. »Eine bedeutende Geschichte oder Person.«
Malcolm seufzte. Anscheinend war das nicht die Antwort, die er hören wollte. »Du weißt doch, dass nicht alle Geschichten wahr sind, oder?«
»Ich weiß, dass manche Leute lügen, ja. Aber ich habe dir schon gesagt, dass ich niemals …«
Malcolm hob eine Hand, um ihr das Wort abzuschneiden, und deutete dann auf den freien Stuhl. »Darf ich?«
Brin machte eine einladende Geste, wobei sie es seltsam fand, dass er sie um Erlaubnis bat. Es war schließlich nicht ihr Taubenschlag.
Malcolm zog den Stuhl heran und setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. Er stützte seine Ellbogen auf den Knien ab und beugte er sich zu ihr vor.
»Brin«, begann er sanft, »manchmal sagen Leute, dass etwas passiert ist, was sich nicht wirklich so zugetragen hat, ohne dass sie dabei lügen. Sie glauben, dass es die Wahrheit ist, auch wenn das nicht stimmt. Manchmal irren sie sich lediglich. Zuweilen kommt es vor, dass jemand sie belogen hat oder sie zu gutmütig sind, um die Wahrheit auszusprechen. Und dann kann es wiederum sein, dass sich eine Geschichte mit der Zeit verändert. Hüterinnen würzen sie vielleicht mit ein paar Details, schmücken sie aus, um sie spannender zu machen.« Er dachte einen Augenblick nach. »Oder um etwas Bestimmtes herauszustellen.«
Brin sah ihn nur verwirrt an.
»Na schön, kommen wir auf Gath zurück. Er wird als weise und heldenhafte Person dargestellt, richtig? Er ist derjenige, der die zehn Clans aus dem Osten geführt hat, als die Große Flut kam. Gath gilt als Retter der Rhunes, und das zu Recht. Aber die Geschichten über ihn sind noch größer als er selbst. Er ist nicht als ein ganz normaler Bursche bekannt, der in Krisenzeiten den Mut und die Entschlossenheit aufgebracht hat, alle zur Flucht zu bewegen. In den Legenden ist er viel mehr als das.«
»Du meinst zum Beispiel, dass er als Kind so viele Rätsel gelöst hat?«
»Ganz genau. Vielleicht war er wirklich ungewöhnlich schlau, aber womöglich wurde dieser Teil seiner Geschichte erst später von Leuten hinzugefügt, die aufzeigen wollten, dass er weise war. Es ist sehr gut möglich, dass er gar nicht schlau war. Wenn du mal darüber nachdenkst, erweckt es sogar den falschen Eindruck, dass man ihn als so besonders dargestellt hat. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass jeder Großes vollbringen kann, aber viele es gar nicht erst versuchen, weil sie sich selbst für gewöhnlich halten.«
Das erinnerte Brin an Konnigers erste Versammlung im Langhaus vor langer Zeit. Persephone hatte ihren Ehemann zu überreden versucht, mit dem Clan an einen anderen Ort zu ziehen, doch Maeve, die damalige Hüterin, hatte die Idee abgeschmettert. »Gath von Oden war schon vor der Flut berühmt«, hatte Maeve gesagt. »Helden wie er wandeln heute nicht mehr unter uns.«
Und doch taten sie es, oder wie Malcolm es ausgedrückt hatte: Helden wurden nicht geboren, sondern gemacht – in Krisenzeiten wurden gewöhnliche Menschen zu Helden.
»Mit dem Buch von Brin«, fuhr Malcolm fort, »sorgst du dafür, dass Ereignisse nicht vergessen oder beschönigt werden, was es zu der wohl wichtigsten Sache macht, die je ein Mensch geschaffen hat. Aber wenn die Wahrheit darin nicht genau wiedergegeben wird, könnten daraus Probleme entstehen. Man wird dein Buch als Quelle ansehen, als Zeitzeugen, und als solches wird es nicht leicht anzufechten sein. Es verleiht dir so viel Verantwortung, dass du vorsichtig damit umgehen musst. Findest du nicht auch?«
Brin nickte und bekam es plötzlich mit der Angst zu tun. Sie hatte sich selbst und den zukünftigen Hüterinnen mit ihren Aufzeichnungen doch nur das Leben erleichtern wollen. Mit einem Mal war daraus etwas potenziell Gefährliches geworden. Sie fühlte sich wie ein Kind, das ein Bärenjunges mit nach Hause gebracht hatte, weil es niedlich war. Sie sah auf die Seiten ihres Buches hinab, die auf dem Tisch verstreut lagen, und fragte sich besorgt, was wohl passieren mochte, wenn der Bär ausgewachsen war.
Malcolm warf ebenfalls einen Blick auf die Pergamentpapierseiten. »Wie weit bist du denn bisher gekommen?«
»Noch nicht mal annähernd so weit wie vorher.« Wut überkam sie so heftig, dass Tränen in ihren Augen brannten. Mit allem, was passiert war, waren ihre Gefühle in letzter Zeit wie Milch in einem zu vollen Eimer – sie schwappten viel zu leicht über den Rand. »Ich hatte viel mehr geschafft, aber vieles wurde während des Miralyith-Angriffs zerstört. Ich habe so hart gearbeitet, und jetzt«, sie deutete auf die verstreuten Seiten, »ist das alles, was ich habe. Ich musste wieder von vorn anfangen.«
»Ich verstehe.« Er nickte ernst und schenkte ihr dann ein freundliches Lächeln. »Aber der zweite Versuch ist meistens besser als der erste.«
Sie runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich arbeite gerade an der Schlacht von Rhen und …«, sie zuckte mit den Schultern, »es läuft ziemlich gut. Es könnte tatsächlich besser als beim ersten Mal sein.«
»Hast du schon den Teil über euren Aufenthalt in Neith fertig geschrieben?« Sein Blick fuhr zu dem höchsten Papierstapel.
Sie seufzte. »Nein, noch nicht.«
»Aber du erinnerst dich noch daran?«
»Ich bin eine Hüterin, das ist meine Aufgabe.«
»Natürlich.« Malcolm nickte. »Könntest du mir etwas darüber erzählen? Über Neith, meine ich. Vor allem über die Steintafeln.«
Brin nickte. »Natürlich.«
Malcolm lächelte und lehnte sich zurück.
»Wir haben aus Stein gehauene Platten mit Markierungen darauf gefunden.« Brin lächelte verlegen. »Siehst du, ich habe das, was Arion Schreiben nennt, also nicht wirklich erfunden. Ich hatte es versucht, aber es war nie so ganz rund. Zumindest nicht, bis ich die Tafeln gefunden habe. Fast alles, was ich jetzt aufzeichne, basiert auf ihnen.«
»Wie konntest du die Markierungen denn verstehen?«
»Das war nicht schwer. Die oberste Tafel war eine Anleitung. Sie zeigte die Liste aller Symbole, die je nach Laut in Gruppen aufgeteilt waren. Als ich erst einmal verstanden hatte, dass jede Markierung für einen Laut steht, war es ganz einfach, sie einzusetzen.«
Malcolm sah verwirrt aus. »Ich verstehe immer noch nicht. Wenn ich mir das anschaue, was du hier gemacht hast, ist es wirklich hübsch, aber ich kann dir nicht sagen, was da steht. Wie hast du das geschafft?«
»Natürlich kannst du das nicht. Du hast dir ja die Anleitung noch nicht angesehen. Ich habe sie auswendig gelernt, also fällt es mir leicht. Ich zeige es dir.« Sie deutete auf die Seite, an der sie arbeitete. »Siehst du hier, dieses Symbol steht für wa wie Wasser oder waschen, und dieses steht für and wie in Hand. Wenn du sie zusammenfasst, steht da Wand.« Sie fuhr mit der Hand über die Steinwand hinter sich.
Er nickte. »Gut, ja, das ergibt Sinn, aber woher weißt du« – er zeigte auf eins der Symbole –, »dass das hier wa heißt?«
»Na, das ist doch offensichtlich. Die Symbole sind universell einsetzbar.« Sie zeigte wieder auf die Seite. »Als ich zum ersten Mal Sonne geschrieben habe, habe ich einen Kreis benutzt, um den s-Laut darzustellen. Das passt ja, nicht wahr? Also ist der Kreis ein universelles Symbol für s. Nachdem ich mich erst einmal durch die Anleitung gearbeitet hatte, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war.«
Malcolm schüttelte den Kopf. »Das würde nur Sinn ergeben, wenn jeder auf der Welt Rhunisch spräche. Auf Fhrey heißt die Sonne aber arkum, und auf Belgriclungreianisch heißt sie halan. Die Goblins nennen sie rivik. Warum steht der Kreis also nicht für die Laute ar, ha oder ri?«
Brin hielt inne, um über seine Worte nachzudenken. »Ich weiß nicht, aber ich muss richtiggelegen haben, denn es hat ja funktioniert. Nachdem ich die Symbole der Anleitung folgend eingesetzt hatte, ergaben die Worte Sinn. Selbst die Namen stimmten.«
»Namen?«
»Ja. Auf den Tafeln stand die Geschichte der Entstehung der Welt. Darauf wurden Ferrol, Drome und sogar Mari erwähnt. Also muss ich recht haben. Ich nehme an, dass der Verfasser Rhunisch gesprochen haben muss.«
Malcolm schüttelte den Kopf. »Diese Namen sind in allen Sprachen gleich, selbst auf Ghazel, aber das erklärt nicht die anderen Worte. Du hast recht. Ich kann nicht leugnen, dass du die Symbole richtig entschlüsselt hast. Also …« Malcolm drehte eine Seite zu sich herum. Brin hatte keine Ahnung, was er zu sehen hoffte. Es musste ihm wie endlose Reihen nicht zu unterscheidender Symbole vorkommen. »Es gibt nur eine Erklärung«, sagte er. »Diese Tafeln wurden für dich geschaffen.«
»Für mich?Das ist unmöglich.«
»Natürlich. Vor Giffords Geburt erzählte Tura Padera, dass er eines Tages einen Wettlauf gewinnen würde, um die Menschheit zu retten. Sowohl er selbst als alle anderen dachten, dass das lächerlich sei, und doch hat er genau das getan. Der Beweis, dass die Prophezeiung stimmt, ist selbsterklärend, da sie eingetreten ist. Da du die Tafeln lesen konntest, ist meine Hypothese also hieb- und stichfest.«
»Aber das heißt noch lange nicht, dass sie unbedingt nur für mich und niemand anderen geschaffen wurden, oder?« Brin gefiel der Gedanke nicht, dass ihr ein uraltes Wesen, das in der Lage war, ein Monster wie den Balgargarath zu erschaffen, eine persönliche Nachricht hinterlassen hatte. Das war so beängstigend wie die Hexe von Tetlin. »Jeder, der Rhunisch spricht, hätte die Markierungen entschlüsseln können.«
»Hast du jemand anderem die Bedeutung der Symbole beigebracht? Kennt noch jemand außer dir den Zusammenhang der Markierungen und Laute?«
»Äh, nein, aber …«
»Dann war der Verfasser sicher, dass du sie finden würdest. Entweder das oder …« Malcolm tippte nachdenklich mit dem Finger gegen seine Lippen.
»Oder was?«
»Oder er oder sie wusste, dass deine Markierungen eines Tages so bekannt sein würden, dass jeder die Tafeln lesen könnte. Das würde bedeuten, dass deine Symbole in Zukunft wirklich universell einsetzbar werden. So oder so konnte der Verfasser eindeutig die Zukunft vorhersehen. Aber da du es warst, die sie gelesen hat, und weil es außerdem ein viel zu großer Zufall wäre, bleibe ich bei meinem ursprünglichen Fazit: Sie waren für dich und niemand anderen bestimmt.«
Brin begann sich langsam zu wünschen, Malcolm wäre sie an diesem Morgen nie besuchen gekommen. Er war erst seit ein paar Minuten hier, und sie hatte bereits Angst vor ihrem eigenen Buch und davor, dass irgendein uraltes, mächtiges Wesen ihren Namen kannte.
»Suri hat etwas namens Agave erwähnt. Was ist das?«, fragte Malcolm.
»Äh … es ist eine Kammer, die sich tief, tief unter Neith befindet. Regen sagte, dass es sich so anfühlte, als ob die Welt dort aufhören würde. Er ist ein Gräber, weißt du? Dort war der Ältere eingesperrt. Er ist derjenige, der die Tafeln geschrieben hat. Er hat den Zwergen beigebracht, wie man Bronze und Eisen herstellt. Das waren die Geheimnisse, die er ihnen im Austausch für seine Freiheit gegeben hat. Aber die Zwerge hielten nicht Wort. Ich hab im Gefühl, dass das so ihre Art ist. Wie dem auch sei, er bot ihnen schließlich einen Samen vom Ersten Baum an und versprach ihnen, dass sie ewig leben würden, wenn sie seine Früchte äßen. Als sie ein Loch gruben, um an den Samen zu kommen, entkam der Ältere und ließ Balgargarath zurück, um die Zwerge zu bestrafen und niemanden mehr nach Neith zu lassen.«
Malcolm sah betroffen aus, wie ein Vater, der seine Kinder aus den Augen verloren hat und plötzlich in der Ferne einen Wolf heulen hört.
»Malcolm, stimmt etwas nicht?«
»Etwas stimmt ganz und gar nicht, glaube ich. Du hast gerade viele Fragen beantwortet, über die ich schon seit sehr langer Zeit nachdenke. Aber du hast gleichzeitig eine lange Liste neuer Fragen aufgeworfen. Ich werde für eine Weile fortgehen müssen.«
»Fortgehen? Nach Neith?«
Er nickte. »Zuerst, ja. Ich werde versuchen, die Tafeln zu bergen. Wenn ich es schaffe, kannst du sie dann für mich übersetzen?«
»Natürlich!« Brin grinste von einem Ohr zum anderen. Bei dem Gedanken daran, alle Tafeln lesen zu können, wurde sie ganz außer sich vor Vorfreude. »Bevor du gehst, solltest du bei Roan vorbeischauen. Sie kann dir Kohle und Pergament geben und dir zeigen, wie du damit die Markierungen kopieren kannst. Es sind zu viele Tafeln, um sie zu tragen. Sie wären sowieso viel zu schwer …« Dann brach die Realität über sie herein, und Brins Grinsen verflüchtigte sich. »Aber du kommst nicht an sie ran! Suri hat den Berg zum Einsturz gebracht. Du kommst nicht hinein.«
»Vielleicht nicht, aber ich werde es trotzdem versuchen.«
»Warum?«
Malcolm lachte und schüttelte den Kopf. »Es würde zu lange dauern, dir das zu erklären, und ich – wir – haben nicht so viel Zeit.«
»Wenn du nach Caric kommst, sei vorsichtig, was Gronbach angeht. Vertraue ihm nicht. Der Zwerg ist ein böser Lügner.«
Malcolm lächelte amüsiert. »Ich werde vorsichtig sein, und das solltest du auch. Im Moment bist du die Einzige, die in der Lage ist, die Tafeln und dein Buch zu lesen. Das wirst du in Zukunft ändern müssen, oder wofür soll es sonst gut sein? Bring es den anderen bei, während ich weg bin, damit deine Symbole wirklich eines Tages von allen gelesen werden können.«
»Wirst du lange fort sein?«
»Ich glaube schon. Wenn ich es nicht schaffe, nach Neith zu gelangen, werde ich mich vielleicht auf die Suche nach dem Älteren begeben müssen.«
»Aber müsste er nicht längst tot sein? Oder glaubst du, dass er wirklich unsterblich ist?«
»Wir haben gerade herausgefunden, dass jemand, der Tausende Jahre am Grund der Welt verbracht hat, dir eine Nachricht hinterlassen hat, die dich auch noch erreicht hat. Ich glaube, alles ist möglich.«
»Würde es dir helfen, seinen Namen zu kennen?«
»Du meinst, er hat noch einen anderen als der Ältere?«
»So haben ihn die Zwerge genannt, aber auf den Tafeln hat er von sich selbst als Die Drei gesprochen.«
Einmal mehr wurden Malcolms Augen groß. »Jetzt muss ich aber wirklich gehen.«
2
Exodus
Am Anfang waren unsere Clans Nomaden. Dann ließen wir uns in Dahls nieder und bewegten uns generationenlang nicht mehr vom Fleck. Der Krieg hat einmal mehr Wanderer aus uns gemacht.
— Das Buch Brin
Persephone bestand darauf, selbst zu gehen, aber Moya wollte davon nichts wissen. Der Schild der Keenigin hatte die Hände in die Hüften gestemmt. Sie bedachte sie mit demselben tödlichen Funkeln in den Augen, mit dem sie Udgar angesehen hatte, bevor sie ihm einen Pfeil durch den Hals gejagt hatte. Für so eine hübsche Frau konnte Moya so furchterregend wie die Hexe von Tetlin sein.
»Ich habe dir einen Wagen organisiert«, sagte Moya, als ob das Argument jeder weiteren Diskussion vorgreifen würde.
»Alle anderen gehen zu Fuß. Ich kann doch nicht in einem Wagen fahren. Als wäre ich eine privilegierte …«
»Seph, du kannst nicht laufen. Es ist weniger als eine Woche her, dass dir der Bauch aufgeschlitzt wurde. Du kannst kaum aufrecht stehen und bist immer noch so blass wie ein Gänseei. Du kannst froh sein, wenn du es ohne Hilfe bis runter zum Tor schaffst.« Moya seufzte, und ihr Gesichtsausdruck wurde weicher. »Ich weiß, dass es dir vor allem anderen um deinen Ruf geht, aber stell dir nur mal vor, wie alle sehen, dass du auf die Schnauze fällst. Du bist die Keenigin, unsere furchtlose Anführerin. Lass uns dieses verstörend perfekte Bild, das alle von dir haben, nicht zerstören, indem du vor aller Augen im Schlamm landest. Außerdem ist es ein schöner Wagen. Ich hab ihn höchstpersönlich ausgesucht und an alles gedacht. Es gibt mehr als genug Kissen und Decken, Wein, Käse, ein Mädchen, das deinen Becher hält und dir die Stirn abtupft, einen Jungen, der dir Luft zufächelt, einen Dudelsackspieler für die musikalische Untermalung und zwei gut aussehende, muskulöse Männer oben ohne. Sie werden dich nicht nur vor Gefahren, sondern auch vor der Sonne schützen, denn sie halten einen Baldachin, um dir Schatten zu spenden, während du mit allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten stilvoll dahinrollst.«
Persephone starrte sie schockiert an.
»Ich nehme dich doch bloß auf den Arm. Entspann dich. Bei Mari, wann hast du denn deinen Sinn für Humor verloren?«
Persephone wusste genau, wann das passiert war, und Moya hätte es auch gewusst, wenn sie kurz nachgedacht hätte. Aber das hatte sie nicht. Alle taten in letzter Zeit ihr Bestes, nicht zu denken, zurückzuschauen, zu reflektieren – dafür war später noch genug Zeit. Im Moment waren alle lieber so beschäftigt wie möglich: Sie arbeiteten, gruben, sammelten, packten, waren immer in Bewegung. Das Entsetzen der Schlacht war jedem noch frisch in Erinnerung. Wenn sie innehielten, würde ihr Kummer sie überwältigen. Solange alle etwas zu tun hatten, konnten sie es aufschieben, sich mit dem Verlust ihrer Häuser und ihrer Lieben auseinanderzusetzen, und so tun, als ob das Leben weiterginge wie an jedem anderen Tag.
Da sie an ihr Bett gefesselt war, kam Persephone nicht in diesen Genuss. Sie hatte nichts anderes zu tun, als über die Fehler nachzudenken, die sie gemacht hatte, die Leben, die sie verloren hatte, und all die Dinge, die sie bereute. Letztere türmten sich zu einem immer höheren Berg auf.
Moya tippte sich mit einem Finger an die Lippen. »Obwohl jetzt, wo ich darüber nachdenke …« Sie grinste verschlagen. »Der Teil mit den Männern, die den Baldachin halten, klingt verlockend. Ich wünschte, ich hätte das wirklich organisiert.« Doch dann richtete sie ihren Todesblick erneut auf Persephone und wedelte warnend mit dem Finger. »Aber dass du im Wagen fährst, war kein Scherz.«
Man hatte Persephone in dem wohl besten, noch intakten Raum in der ehemaligen Festung einquartiert, die nach der dreitägigen Schlacht zu einer Ruine geworden war. Moya hatte darauf bestanden, dass die verletzte Keenigin die bestmögliche Unterkunft bekam. Während Persephone in einer der winzigen Gefängniszellen unter dem eingestürzten Verenthenon lag, war ihr nur allzu bewusst geworden, dass Alon Rhist beinahe vollständig zerstört worden war.
Sie hatten den Raum eilig geputzt und die Wände mit Vorhängen dekoriert, doch die Zelle war so klein, dass nicht mehr als ein Bett hineinpasste. Deshalb musste Moya im Gang stehen, während sie mit ihr sprach.
Mehrere Tage lang hatte das Labyrinth voller Gefängniszellen, auch bekannt als Duryngon, als Wohnraum und administratives Zentrum für das Bündnis des Westens gedient. Persephone hatte sich den Namen ausgedacht, da sie jene, die sie anführte, nicht mehr als die zehn Clans oder die Rhune-Horde bezeichnen konnte. Das würde ihre neuen Verbündeten, die Fhrey und die drei Zwerge, ausschließen. Das Bündnis des Westens hörte sich außerdem ziemlich beeindruckend und stark an.
»Wie geht es mit den Vorbereitungen voran?«, fragte Persephone.
»Gut«, sagte Moya, doch Persephone fragte sich, ob sie ihr lediglich weiteren Stress ersparen wollte. Vielleicht spürte Moya, dass ihre Keenigin mehr hören wollte, denn sie fügte hinzu: »Wohin gehen wir denn eigentlich?«
»Merredydd, nehme ich an, aber ich muss noch mit Nyphron sprechen. Ich kenne nur Alon Rhist und weiß nicht, welche der anderen Fhrey-Außenposten unseren Bedürfnissen am besten gerecht werden. Ich habe gehört, dass Merredydd am nächsten liegt. Aber passen wir alle dort hinein? Alon Rhist war die Hauptfestung der Instarya, also gehe ich davon aus, dass es die größte war. Aber all die neuen Gula würden selbst hier nicht reinpassen. Wenn keiner der anderen Außenposten unser Heer aufnehmen kann, wäre Rhen vielleicht die bessere Lösung.«
»Es gibt keine Mauern mehr in Rhen«, merkte Moya an.
»Die kann man neu errichten.«
»Haben wir Zeit dafür? Und was nützen uns schon Holzpalisaden?«
»Ich habe mir gedacht, dass Frost, Flut und Suri uns damit helfen könnten.«
»Suri mag keine Mauern.«
»Stimmt, aber ich glaube, sie wird uns trotzdem helfen. Das Wichtigste ist, dass Rhen nicht zu weit weg ist und es dort mehr als genug Platz, Holz, Wasser, bestellte Felder und Wild im angrenzenden Wald gibt. Wer weiß schon, was wir in den anderen Instarya-Festungen vorfinden werden.«
»Sollten wir nicht einfach hierbleiben? Kann Suri nicht alles wieder aufbauen?«
»Das bezweifle ich. Ich weiß nicht, wie die Kunst funktioniert, aber ich bin mir sicher, dass es einfacher ist, etwas zu zerstören, als es wieder aufzubauen. Würdest du wissen, wohin jeder kleine Steinsplitter passt? Denkst du, Suri weiß es? Sie könnte wohl helfen, den Schutt fortzuschaffen, vielleicht neue Mauern aufzubauen, aber wenn wir so viel Arbeit in den Wiederaufbau stecken, können wir auch gleich irgendwo anders neu anfangen. Irgendwo, wo wir nicht auf den Leichen der Gefallenen bauen. Nein, hier können wir nicht bleiben. Ich möchte, dass wir uns auf den Weg machen, sobald Nyphron zurück ist.«
Moyas Brauen schossen in die Höhe. »Er ist seit gestern zurück.«
»Wie bitte?«
Moya verzog das Gesicht. »Das verheißt nichts Gutes, oder? Dass du nichts davon wusstest, meine ich.«
»Was willst du damit sagen?«
»Ich habe gehört, dass ihr beiden heiraten wollt.« Sobald die Worte raus waren, zuckte Moya zusammen, als ob sie erwartete, geohrfeigt zu werden.
»Von wem hast du das gehört?«, fragte Persephone schockiert.
»Von Nyphron.« Moya sah leicht verwirrt aus. »Es hat sich so angehört, als ob ihr das besprochen hättet.«
»Wir sprechen seit etwa einem Jahr darüber, aber ich habe noch nicht Ja gesagt.«
»Oh, äh, ich verstehe, warum. Er ist zurück und kommt noch nicht mal vorbei, um Hallo zu sagen? Wenn Tekchin das getan hätte, hätte ich …«
»Wie läuft es denn mit ihm?« Persephone wollte hauptsächlich das Thema wechseln, um nicht über die Hochzeit sprechen zu müssen, aber da sie mit Nyphron eine ähnliche Beziehung plante wie Moyas und Tekchins, war sie außerdem neugierig.
Soweit sie wusste, waren die beiden das einzige Rhune-Fhrey-Paar in der Geschichte. Es ergab nicht viel Sinn, dass ein arroganter, tausendeinhundert Jahre alter Fhrey-Krieger eine sechsundzwanzig Jahre alte Rhune als würdige Partnerin ansah. Von einem anderen Standpunkt aus ergab es wiederum sehr viel Sinn. Beide waren wild, leidenschaftlich, aggressiv und ehrgeizig. Sie waren sich sehr ähnlich – wie zwei Spiegelbilder, die in verschiedenen Realitäten geboren worden waren. So unwahrscheinlich es auch erscheinen mochte, passten sie perfekt zusammen.
Persephone sah auch einige Gemeinsamkeiten zwischen der Affäre der beiden und ihrer eigenen Beziehung zu Nyphron. Sie und Nyphron sahen sich beide primär als Anführer und stellten ihr Privatleben stets hinten an. Sie konzentrierten sich ganz auf das Erfüllen der Rollen, die sie beim Gestalten der Zukunft spielten, anstatt auf ihre persönlichen Wünsche. Selbst dass er sie nicht sofort besuchen gekommen war, war nur logisch. Nyphrons Priorität wäre es sicher, sich die Berichte der Defensivkräfte anzuhören, die er in Alon Rhist zurückgelassen hatte, und nicht, seiner zukünftigen Braut einen Besuch abzustatten.
Ein Rhune wäre an seiner Stelle vielleicht zu Persephone geeilt, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. So eine Gefühlsregung wäre allerdings unbegründet. Es gab keinen Anlass zur Annahme, dass es ihr nicht gut ging. Sie wurde ausreichend beschützt, und jegliche Sorgen, die ihr Verlobter sich vielleicht um sie machen würde, wären kindisch und irrational im Vergleich mit den wirklichen Problemen, die so eine verheerende Schlacht mit sich brachte. Nyphron war weder kindisch noch irrational.
Raithe war beides, und ich habe ihn dafür geliebt.
Was Persephone von Moya wissen wollte, war, ob Beziehungen zwischen Fhrey und Menschen funktionieren konnten. Ist so etwas überhaupt möglich?
»Bei uns läuft es gut.« Moya ließ die Schultern kreisen, hielt dann aber inne und sah Persephone mit zusammengekniffenen Augen an. Ein ganz anderes Lächeln breitete sich plötzlich auf ihrem Gesicht aus. Es sah selbstzufrieden aus. »Willst du etwa wissen, wie wir …«
»Bei der Großen Mutter, nein!« Persephone riss beide Hände in die Luft, um sie abzuwehren.
Moyas Grinsen wurde noch verschlagener. »Du wirst feststellen, dass Fhrey noch viel besser …«
»Stopp! Hör auf! Darüber will ich nichts wissen. Ich habe nur gedacht, dass, na ja, wir kommen aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Ich habe mich nur gefragt, ob … äh … na ja …«
Moya verschränkte die Arme vor der Brust und beobachtete amüsiert, wie Persephone verzweifelt nach den richtigen Worten suchte.
»Ich meine, Fhrey-Frauen sind so …«
»Langweilig? Sie sind wirklich unglaublich langweilig. Oder zumindest sehen Fhrey-Männer sie so.«
»Ich meinte eigentlich …«
»Nein, mal im Ernst. Tekchin sagt das ständig. Fhrey-Frauen sind zwar wunderschön, aber sie sind so öde. Wir niederen Rhunes leben nur kurz, also haben wir keine Zeit, langweilig zu sein. Zumindest ich nicht. Und in meinen Augen ist Tekchin so viel mehr als ein Rhune-Mann, vor allem im Bett. Er ist … er ist … na ja, er ist tatsächlich wie eine Art Gott – und erzähl ihm ja nicht, dass ich das gesagt habe.«
Moya sah plötzlich so besorgt aus, dass Persephone unwillkürlich lächeln musste. Sie bemerkte, dass es das erste Mal war, seit …
»Du wirst Nyphron heiraten, nicht wahr?« Nun war es an Moya, das Thema zu wechseln. Plötzlich fühlte sich ihr Gespräch wie eine Partie Wahrheit oder Pflicht an.
»Ja, ich denke, sobald wir uns irgendwo anders niedergelassen haben.«
»Wunderbar«, ertönte Nyphrons Stimme vom Flur.
»Psst.« Persephone hielt sich einen Finger an die Lippen. Einen Augenblick später erschien der Anführer der Galantianer neben Moya an der Tür. Sie machte ihm Platz.
»Wie viel hast du mit deinen Fhrey-Ohren gehört?«, fragte Persephone erschrocken.
Nyphron grinste. »Genug, um zu wissen, dass Tekchin gottgleich im Bett ist. Das wird ihm gefallen.«
Moyas Kinnlade klappte vor Verblüffung herunter. Nyphron gab ihr einen kurzen Moment Zeit für eine scharfe Antwort, doch der Schild der Keenigin schwieg.
»Und« – Nyphron sah Persephone an – »dass ich ein Festmahl organisieren muss, nachdem wir das neue Lager im Hochspeertal aufgeschlagen haben. So ist es Brauch bei uns. Wir verkünden unsere Vereinigung öffentlich, und die Versammelten essen und trinken, bis sie umfallen.«
»Unsere Vereinigung?«
»Vereinigung, Hochzeit, ist doch alles dasselbe.«
Persephone sah Moya entsetzt an. »Siehst du, mit was ich mich herumschlagen muss?«
»Tekchin ist noch schlimmer. Er will keine Zeremonie und weigert sich, mir zu sagen, dass er mich liebt. Er schwafelt immer irgendwas von wegen, Gesten sagen mehr als Worte.«
»Ausnahmsweise hat er mal recht«, merkte Nyphron an. »Liebeserklärungen sind nur dumme Banalitäten, aber in diesem Fall ist eine öffentliche Verkündung unumgänglich.«
»Warum das denn?«, fragte Moya.
»Politik«, erklärte Nyphron. »Persephone ist die Keenigin und ich der Anführer der Instarya, deshalb ist es wichtig, dass alle Zeugen unserer Verbindung werden. Das Volk muss uns als Einheit sehen. Sie müssen hören, wie wir uns einander die Treue geloben und uns gemeinsam unserer Sache verschreiben.«
»Ist er nicht romantisch?«, fragte Persephone.
Trotz seiner guten Ohren schien Nyphron es nicht zu hören. Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter. »Ich habe draußen gesehen, dass sie Pferde vor einige der Wagen spannen. Was hat es damit auf sich?«
Persephone würde gern glauben, dass er das Thema gewechselt hatte, da es ihn pikierte, über Romantik zu sprechen, doch Nyphron strotzte nur so vor Selbstbewusstsein. Nichts konnte ihn aus der Fassung bringen. Er hatte nun schlicht genug Zeit mit belanglosem Geplänkel verschwendet.
»Roan kam auf die Idee, einen Wagen von einem Pferd ziehen zu lassen«, antwortete Persephone. »Ein einziges Tier kann viel mehr Gewicht ziehen als eine ganze Gruppe Männer.«
»Aber spielen die Pferde mit? Ich weiß aus Erfahrung, dass es unruhige, dumme Tiere sind, denen man lieber aus dem Weg gehen sollte. Werden sie nicht einfach aus purer Sturheit gegen die Wagen treten? Sie zerstören sie wahrscheinlich bloß und brechen sich dabei auch noch die Beine.«
»Roan und Gifford arbeiten mit den Pferden, die überlebt haben. Ich habe gehört, dass sie gut vorankommen.« Sie warf Moya einen Blick zu. »Nicht wahr?«
»Am Anfang gab es ein paar Probleme, aber sie haben sie gelöst. Und, oh, das hätte ich fast vergessen.« Moyas Gesicht hellte sich auf. »Gifford hat mich gestern auf eine Fahrt in einem kleinen zweirädrigen Karren mitgenommen, den Roan und die Zwerge gebaut haben. Er hat Naraspur davorgespannt, und, heilige Mari, wir sind so schnell über die Ebene gerast, dass meine Augen getränt haben. Wir haben eine Herde Rehe gejagt! Wenn ich Audrey dabeigehabt hätte, hätten wir unsere Vorratskammer auffüllen können.«
»Wirklich?« Nyphron schien interessiert. »Denkst du, dass du mit deinem Bogen Wild schießen könntest, während du in so einem Karren fährst?«
»Ich kann alles schießen, von egal wo.« Moya grinste ihn an. Nun war es an ihr, auf eine passende Antwort von ihm zu warten, aber auch diesmal kam keine. Vielleicht hatten die beiden endlich einen Weg gefunden, friedlich zusammenzuleben.
»Moya, ich muss unter vier Augen mit Nyphron sprechen. Kannst du bitte die Kunde verbreiten, dass wir bald abreisen werden?«
»Euer Wunsch ist mir Befehl, Keenigin.« Moya grinste und verbeugte sich vor Persephone, die die Augen verdrehte, während sich ihr Schild entfernte.
Nyphron starrte ihr hinterher. Wenn es sich um jemand anderen gehandelt hätte, hätte Persephone angenommen, dass er ihr Hinterteil begutachtete, doch Nyphron war lediglich in Gedanken versunken. Sein scharfer Verstand arbeitete auf Hochtouren an etwas, was nichts mit Moyas Anblick von hinten zu tun hatte.
»Also, was ist passiert?«, fragte Persephone.
Er brauchte eine Weile, um zu antworten. »Hm? Entschuldige, wie bitte?«
»Der Fhan? Was ist passiert, als ihr ihn eingeholt habt?«
Nyphron fuhr sich mit der Hand durchs Haar, das von seinem Helm platt gedrückt war. »Oh, ach so. Wir haben ihn nicht eingeholt. Die Truppen, die er zurückgelassen hat, haben uns keinen großen Kampf geliefert, uns aber lange genug aufgehalten, sodass er entkommen konnte. Um ehrlich zu sein, war ich nicht auf so einen bedeutenden Sieg vorbereitet. Dass wir ihn derart in die Flucht schlagen, hätte ich nie für möglich gehalten …« Er schüttelte den Kopf. »Ich habe Soldaten im Hochspeertal stationiert, und wir werden dort alle unsere Streitkräfte für den nächsten Schritt zusammenziehen.«
»Und was ist der nächste Schritt?«
»Wir bereiten uns auf den Vorstoß vor. Die Gula ließen alles stehen und liegen und kamen, sobald sie die Signalfeuer sahen. Deshalb haben die meisten nicht viel mehr als eine Decke dabei, wenn überhaupt. Es wird Monate dauern, eine Versorgungskette auf die Beine zu stellen, die unsere komplette Streitmacht versorgen kann, während wir uns auf einen Offensivschlag vorbereiten. Bis dahin wird es Winter sein, und im Winter werden keine Kriege gefochten. Wenn wir es richtig angehen, können wir den Kampf nächsten Frühling an Lothians Türschwelle bringen. Bis dahin sollte unsere Armee in guter Verfassung sein.«
»Sollten wir nicht irgendwohin, wo wir Schutz hinter Mauern finden können? Sind wir nicht aus genau diesem Grund nach Alon Rhist gekommen?«
Er tätschelte die Steinwand der Zelle. »Meine alte Freundin hat ihren Zweck erfüllt. Entgegen allen Erwartungen hat sich das Blatt gewendet, und jetzt sind wir die Jäger und nicht mehr die Gejagten. Der Fhan ist derjenige, der sich in einer Festung verstecken muss. Für uns ist die Zeit gekommen, den Kampf zu ihm zu tragen. Deshalb gehen wir ins Hochspeertal.«
»Ist es nicht gefährlich, so ungeschützt zu sein?«
»Nein. Der Fhan kann uns nicht angreifen, egal, wo wir sind. Er hat den Großteil seiner Streitkräfte verloren, und es bleiben ihm nur wenige Miralyith. Und das Beste ist, dass er mehr als drei Jahreszeiten brauchen wird, um seine Situation maßgeblich zu verbessern. Wir dagegen haben mehr als genug Männer und werden bis dahin gut versorgt und ausgerüstet sein. Und wir dürfen auch nicht den Drachen vergessen. Wusstest du, dass es dieses Mädchen namens Suri war, die ihn geschaffen hat?«
»Ich habe dir doch von ihr erzählt. Hast du mir etwa nicht geglaubt?«
Er runzelte die Stirn. »Ich dachte damals nicht, dass du lügst, sondern habe mir schlicht nicht vorstellen können, dass sie zu so etwas fähig ist. Erst dachte ich, dass Malcom dahintersteckt, aber dann kam heraus, dass es die Seherin war. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Über den Winter lassen wir sie mehr davon machen. Dann wird der Krieg nächstes Jahr um diese Zeit sehr wahrscheinlich vorbei sein.«
Die Schöpfung des ersten Gilarabrywn hatte Minnas Leben gefordert. Raithe hatte den Preis für den zweiten bezahlt. Doch das wirkliche Opfer hatte Suri gebracht. Persephone war sicher, dass nichts die Seherin dazu bewegen könnte, einen dritten zu erschaffen. Sie zog in Erwähnung, es Nyphron zu erklären, doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, vor allem nicht, da er ein Thema angerissen hatte, über das sie schon mit ihm sprechen wollte, seit er Alon Rhist verlassen hatte.
»Ich habe darüber nachgedacht … über das Ende des Krieges. Du hast selbst gesagt, dass wir uns unerwartet gut geschlagen haben. Und der Fhan ist geflohen. Das heißt wohl, dass er Angst hat, nicht wahr?«
»Er macht sich in die Hose, würde ich sagen. Er weiß, dass seine Tage gezählt sind.«
»Genau.« Sie nickte. »Wäre er dann jetzt nicht eher geneigt, einem Friedensvertrag zuzustimmen?«
Nyphron lachte. »Einem was?«
»Arion hat davon gesprochen. Sie glaubte, dass wir uns den Respekt der Fhrey verdienen und lernen könnten zu koexistieren, wenn wir beweisen, dass es Künstler unter uns gibt. So würden die Fhrey verstehen, dass wir keine ungebildeten Tiere sind. Während der Schlacht, als ich dachte, wir hätten verloren, habe ich eine Nachricht über Friedensverhandlungen an den Fhan geschickt. Ich habe noch keine Antwort erhalten, aber …«
»Du hast was getan? Wie?«
»Ich habe eine Brieftaube nach Estramnadon geschickt. Ich wusste, dass der Fhan zu der Zeit nicht dort war. Aber wenn er es zurückgeschafft hat, könnte es etwas bewirken. Vor allem jetzt, da er gesehen hat, wie gut wir uns behauptet haben. Und wir haben unsere Position sogar noch mehr gestärkt, als wir es uns je hätten erträumen können. Er ist geflohen, und er …«
»Du hast recht damit, dass wir den Fhan besiegt haben. Er rennt mit eingezogenem Schwanz zurück nach Erivan. Er hat nichts mehr. Aber du liegst falsch, wenn du denkst, du könntest mit ihm verhandeln. Das müssen wir nicht. Wir haben gewonnen. Warum sollten wir mit ihm sprechen? Es gibt keinen Grund, warum wir Zugeständnisse machen und Kompromisse eingehen sollten. Wir müssen nichts weiter tun, als über den Nidwalden zu marschieren und den Waldthron in Brand zu stecken. Ich plane, Lothian in seiner eigenen Arena hinzurichten, vor großem Publikum. Eroberer verhandeln nicht. Frieden werden wir erst haben, wenn Lothian und alle seine Miralyith tot sind.«
Seine Worte hätten Persephone nicht schockieren dürfen. Nyphron war ein Krieger, und Männer mit einem Hang zu Gewalt sahen die Dinge sehr einfach: Töte, damit du nicht getötet wirst. Nyphron verfolgte ein nicht einfach von der Hand zu weisendes Konzept, das von Grausamkeit geprägt und äußerst risikobehaftet war. Persephone hatte gelernt, dass es stets besser war, Feinde zu Freunden zu machen. »Aber wir müssen doch nicht alle töten, um …«
»Doch, das müssen wir. Vertrau mir. Ich kenne Lothian. Glaubst du, der Fhan wird mich begnadigen, nach der Rolle, die ich bei unserem Sieg gespielt habe? Ich würde es nicht tun. Ich kenne seine geheimsten Gedanken, da wir uns ähnlich sind, wenn es darum geht, wie wir mit jenen umgehen, die uns verletzt haben. Wenn wir ihn am Leben lassen, werden wir es bereuen.«
»Aber Arion wollte, dass unsere beiden Völker …«
»Arion ist tot.«
Er sagte es so kalt und gefühllos, dass sie verstummte. Sie war noch nicht in der Verfassung für einen großen Streit. Moya hatte recht gehabt, als sie von Persephones Wunden gesprochen hatte: Sie schmerzten immer noch, und nicht nur die körperlichen. Nyphron plante, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen, was bedeutete, dass es in nächster Zeit keine Kämpfe geben würde. Ihr blieb also noch Zeit, um ihn umzustimmen.
»Entschuldige. Du hast recht. Wir haben viel zu tun, und es ist am besten, wenn wir uns erst einmal auf den großen Umzug konzentrieren.«
»Gut.« Er straffte die Schultern und warf schon wieder einen Blick auf den Flur in die Richtung, in die Moya verschwunden war. »Glaubst du, dass sie wirklich einen Bogen auf einem von Pferden gezogenen Karren benutzen kann?«
»Ich dachte, du hättest verstanden, wie Moya tickt. Sie hat keinerlei Schamgefühl, und sie braucht keine Worte, um Männer zu manipulieren. Sie neigt nicht zu Übertreibungen oder Prahlerei.«
»Faszinierend.« Nyphron nickte und war schon wieder in Gedanken versunken.
»Was?«
»Ich erinnere mich gerade an den Wagen mit eurem Steingott, der den Hügel hinunterrollte und in die Mauern von Dahl Tirre krachte. Auf seinem Weg hat er alles zerstört, was ihm in die Quere kam.«
»Erinnere mich bloß nicht daran. In letzter Zeit fühle ich mich, als ob ich …«
»Entschuldige mich«, sagte Nyphron und war auch schon zur Tür hinaus verschwunden.
»Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Liebling«, murmelte Persephone, während sie seinen sich entfernenden Schritten lauschte.
Gifford stand auf der Straße und starrte verblüfft auf die Ausgeburt der grausamen Ironie des Schicksals, die sich vor ihm befand. Allein das Haus der Hoffnungslosen war von der Zerstörung verschont geblieben, die die restlichen Gebäude in Klein-Rhen heimgesucht hatte. Fast alle anderen der wunderschönen Häuser waren nur noch Trümmerhaufen, viele sogar völlig verschwunden, und nichts als Asche war von ihnen geblieben. Doch der scheußliche Schandfleck, der den ortsansässigen Außenseitern Gifford, Habet, Mathias und Gelston als Zuhause gedient hatte, hatte auf wundersame Weise nicht einmal einen Kratzer abbekommen.
»Weißt du, was mich am meisten stö-t, Woan?«, fragte er, während er ungläubig den Kopf schüttelte. »Ich habe nichts im Haus, das ich bwauche. Alle haben so viel ve-lowen, und ich« – er deutete auf das intakte Steinhaus –, »ich habe nichts zu packen.«
Überall um sie herum beluden die Überlebenden mit Tränen in den Augen Wagen mit dem wenigen, das sie aus den Trümmern hatten retten können. Kleider, Teller, Pflanzen und Teppiche. Die meisten von ihnen waren Fhrey.
Wir Menschen haben einen Vorteil: Wir sind daran gewöhnt, Dinge zu verlieren.
Alle bereiteten sich auf die Abreise vor. Viele der Zivilisten von Alon Rhist würden nach Merredydd gehen, aber die Rhunes und Instarya würden sich nach Osten in Richtung des Gula-Gebiets aufmachen. Im Osten lag das Hochspeertal, im Osten wartete der Krieg auf sie.
Gifford und Roan waren auf ihrem letzten Spaziergang durch die Stadt – oder was davon übrig war. Roan hatte die letzten Tage damit verbracht, die Herstellung Dutzender Wagen zu überwachen. Das meiste Holz dafür hatten sie aus den Trümmern der schönen, kleinen Häuser bergen können, und während sie nebeneinanderher gingen, suchte Roan die Umgebung nach weiteren nützlichen Dingen ab.
Sie hat sich nicht verändert, dachte Gifford. Dann sah er auf ihre Hand hinab, die in seiner lag und fröhlich hin und her schwang, und verbesserte sich: Vielleicht ein bisschen.
Bei dem Gedanken grinste er von einem Ohr zum anderen.
Seit dem Moment, als er sie zu sich auf Naraspurs Rücken gezogen und sie ihn zum ersten Mal umarmt hatte, waren sie unzertrennlich gewesen und hielten nun fast die ganze Zeit über Händchen. Seitdem schliefen sie unter einer Decke, wo Roan ihn an sich zog und er seine Arme um sie legte. In der ersten Nacht hatten sie beide geweint. Wahrscheinlich hatten das alle getan. Gifford wusste nicht, warum Roan geweint hatte. Ihre Tränen hatten so viele Gründe haben können: Reue, Schuldgefühle, Erschöpfung. Doch Gifford wusste genau, warum er geschluchzt hatte. Bis zu jener Nacht hatte er nicht gewusst, wie sich Freudentränen anfühlten.
Er hatte noch nicht versucht, sie zu küssen. Gifford, der nun offiziell der schnellste Mann auf Erden war, tastete sich in dieser Hinsicht so langsam voran wie eine Schnecke, aus Angst, diesen zerbrechlichen und wunderschönen Traum zu zerstören, in den er gestolpert war. Er war nicht sicher, wie sehr Roan sich verändert hatte oder was sie nun aushalten konnte. Er wusste nur, dass er sie jetzt berühren konnte, ohne dass sie erstarrte oder sich ihm entzog. Ihre Hand zu halten, war sein erster Triumph in dieser wundervollen neuen Welt gewesen. Irgendwie hatten an jenem Morgen die Rüstung, die Roan für ihn gemacht hatte, und die aufgehende Sonne plötzlich alles möglich gemacht.
Ich hätte sie an jenem Morgen küssen sollen. Im Nachhinein erschien es ihm so offensichtlich. Sie hätte es zugelassen. Es wäre so einfach gewesen, aber jetzt …
Gifford warf noch einen Blick auf ihre verschränkten Finger, als ob es ein Wunder wäre.
Das hier ist mehr, als ich mir je erträumt habe, und selbst wenn es alles ist, ist es genug für ein ganzes Leben.
»Da bist du ja«, sagte Nyphron, während er über die Steintrümmer neben der südlichen Treppe kletterte, die vom oberen Innenhof in die Stadt führte.
Er hatte den Blick auf Roan gerichtet, was Gifford nicht überraschte. Die meisten Leute ignorierten ihn, doch die Fhrey taten sogar stets so, als würde er gar nicht existieren.
»Moya hat mir erzählt, dass du herausgefunden hast, wie ein Pferd einen Wagen ziehen kann. Stimmt das?«
Roan schüttelte den Kopf. »Das war Gifford.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Ich habe nur an etwas gearbeitet, mit dem man den Wagen an ihnen befestigen kann. Gifford ist derjenige, der ein Talent für den Umgang mit ihnen hat.«
»Der da?« Nyphron sah verwirrt aus, als er den gebeugten Körper des Krüppels musterte. »Du bist Gifford? Du kannst doch nicht der sein, von dem Plymerath ständig spricht. Der Held in der Nacht, der durch das Lager des Fhans geritten ist?«
Roan nickte enthusiastisch. Sie schenkte Gifford ein Lächeln und zitierte dann die Zeilen aus Brins Nacherzählung der Schlacht:
»Der Held der Nacht in funkelnder Rüstung,
Besiegte die Angst und brachte uns Hoffnung,
Als die Nacht am dunkelsten war,
Ein Lichtblick jetzt und immerdar.«
Nyphron starrte sie einen Moment lang an, als ob sie den Verstand verloren hätte. Dann überwand er seine Verblüffung und wandte sich erneut an Gifford. »Du bist der erste Rhune, der je auf einem Pferd geritten ist.« Der Galantianer musterte einmal mehr Giffords gebeugten Körper. »Hätte nie erraten, dass du das warst.« Er richtete das Wort wieder an Roan. »Moya sagte, dass du einen kleinen Karren gebaut hast, einen schnellen. Ich habe mich gefragt, ob man so etwas wohl im Kampf einsetzen könnte.«
»Was meinst du?«
»Sie sagte, dass zwei Leute darauf Platz hätten. Da dachte ich, dass eine Person die Pferde lenken und die andere einen Bogen oder Speer benutzen könnte. Das würde so einen Karren zu einer tödlichen Waffe machen. Man müsste ihn allerdings mit Orinfar-Runen schützen. Kannst du mehr von dem Exemplar herstellen, in dem Moya gefahren ist?«
Roan nickte.
Nyphron sah Gifford an. »Und glaubst du, man könnte die Pferde im Chaos einer Schlacht unter Kontrolle halten?«
»Ich habe Nawaspu- gelenkt, wähwend ich von Speewen und Magie angegwiffen wu-de. Sie mochte es nicht, abe- sie hat es mitgemacht. Tiewe sind uns Menschen ähnlich. Mit eine- guten Ausbildung könnte es möglich sein.«
Nyphron grinste. »Diesen Krieg zu gewinnen wird einfacher, als ich es mir je erträumt habe. Es ist, als würde ein Gott mit dem Finger auf mich zeigen und sagen: Deine Zeit, Großes zu vollbringen, ist gekommen.«
Gifford sah wieder auf seine mit Roans verschränkten Finger hinab und nickte. »Ja, ich weiß genau, was du meinst.«