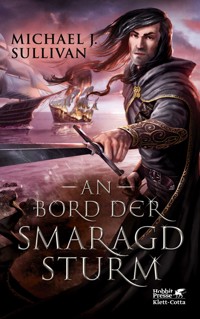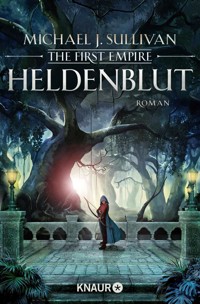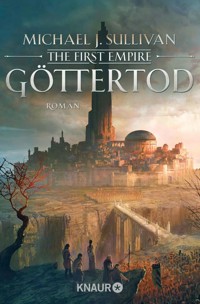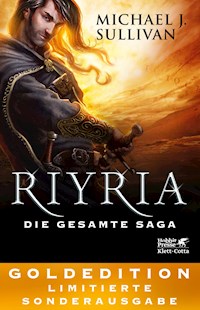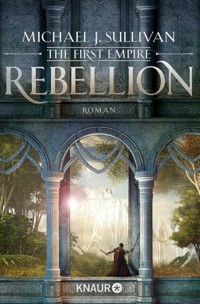
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Zeit der Legenden
- Sprache: Deutsch
"Rebellion" ist der furiose Auftakt zur neuen großen High-Fantasy-Saga des amerikanischen Bestseller-Autors Michael J. Sullivan. In den Ländern der Rhune leben die Menschen seit Anbeginn der Zeit im Schatten der Götter: Die Fhrey wohnen in kunstvoll angelegten Städten, verfügen über Magie und Schmiedekunst, altern nicht und scheinen unsterblich zu sein, während die Rhune unter rauen Bedingungen in kleinen Dörfern und Gemeinschaften hausen, und oft kaum genug zum Leben haben. Doch als zwei Menschen, der junge Raithe und sein Vater, von einem Fhrey angegriffen werden, tut der junge Mann etwas Undenkbares: Er schlägt zurück - und tötet das Wesen, das er bis dahin für einen Gott gehalten hat. Raithe flieht vom Ort des Geschehens, doch der Legende des Mannes, der einen Gott erschlagen hat, kann er nicht entkommen. Als er sich in der Siedlung Dahl Rhen verbirgt, trifft er auf Persephone, eine Witwe, die gerade erst das Erbe ihres Mannes als Anführerin ihres Stammes angetreten hat, und auf die junge Seherin Suri. Persephone glaubt, nichts mehr zu verlieren zu haben, und sieht in Raithe denjenigen, der die Menschen endlich gegen die Fhrey führen kann. Unerwartete Unterstützung erhält die wachsende Rebellion schließlich von Nyphron, einem abtrünnigen Fhrey, der sich weigert, den Aufstand der Menschen niederzuschlagen.. Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Rebellion
The First Empire I. Roman
Aus dem Englischen von Marcel Aubron-Bülles
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit Anbeginn der Zeit leben die Menschen im Schatten ihrer Götter, der Fhrey: Während diese in kunstvoll angelegten Städten wohnen, über Magie verfügen und niemals altern, hausen die Menschen in armseligen Dörfern, geplagt von Hunger und Krankheiten.
Als der junge Raithe von einem Fhrey angegriffen wird, tut er das Undenkbare: Er wehrt sich. Niemand könnte überraschter sein als Raithe, als der unsterbliche Gott plötzlich tot zu seinen Füßen liegt. Von da ab eilt sein Ruf ihm voraus – und ehe er es sich versieht, wird Raithe zum Anführer eines Aufstands, der die Welt für immer verändern soll.
Inhaltsübersicht
Von Göttern und Menschen
Die Seherin
Der Gottestöter
Der neue Stammesführer
Vor der Tür
Gerüchte
Der schwarze Baum
Fragen an die Eiche
In die Enge getrieben
Die Galantianer
Die Lehrerin
Die Götter unter uns
Die Knochen
In den Westen
Die Verlorene
Miralyith
Der Fels
Heilt die Verletzte
Warten auf den Mond
Der Prinz
Der Vollmond
Der Fluch des Braunen Bären
Die Höhle
Dämonen im Wald
Gefangen
Unter den Wasserfällen
Wenn Götter aufeinanderprallen
Der Erste Stuhl
Glossar
1
Von Göttern und Menschen
In den Tagen der Dunkelheit vor dem Krieg nannte man die Menschen Rhunes. Wir lebten in Rhuneland, das damals noch unter dem Namen Rhulyn bekannt war. Wir hatten wenig zu essen und viel zu fürchten. Was wir am meisten fürchteten, waren die Götter auf der anderen Seite des Flusses Bern, deren Land zu betreten uns verboten war. Die meisten Menschen glauben, unser Kampf gegen die Fhrey hätte mit der Schlacht von Grandford begonnen. In Wahrheit aber nahm er seinen Anfang an einem lauen Tag im Frühling, als zwei Männer den Fluss überquerten.
– Das Buch Brin
Raithes erster Impuls war, zu beten. Fluchen, schreien, weinen, beten – so etwas tat ein Mensch doch für gewöhnlich in den letzten Minuten seines Lebens. Auf den zweiten Blick allerdings erschienen Raithe Gebete ziemlich absurd angesichts der Tatsache, dass sein Problem ein wütender Gott war, der nur zwanzig Fuß von ihm entfernt stand. Götter waren nicht eben für ihre Duldsamkeit bekannt, und dieser schien auf dem besten Wege, sie beide zu erschlagen. Weder Raithe noch sein Vater hatten den Gott kommen hören. Das Wasser der beiden Flüsse, die sich ganz in der Nähe zu einem breiten Strom vereinten, toste laut genug, um eine ganze Armee unbemerkt vorüberziehen zu lassen. Eine Armee wäre Raithe lieber gewesen.
Gehüllt in schimmernde Gewänder saß der Gott auf einem Pferd, flankiert von zwei Dienern, die ihm zu Fuß folgten. Es waren Menschen, doch ihre Kleider waren aus demselben bemerkenswerten Stoff wie die des Gottes. Keiner der drei rührte sich. Keiner sprach. Sie schauten nur.
»He?«, rief Raithe leise, um die Aufmerksamkeit seines Vaters auf sich zu lenken.
Herkimer hatte sich neben einem gefallenen Hirsch ins Gras gehockt und war damit beschäftigt, den Bauch des Tieres mit seinem Messer aufzuschlitzen. Eine gute Weile zuvor hatte Raithe den Hirsch mit einem Speerwurf in der Flanke erwischt, und er und sein Vater hatten den größten Teil des Vormittags damit verbracht, ihn zu jagen. Jetzt hatte sich Herkimer sowohl seines wollenen Leigh Mor als auch seines Hemdes entledigt, denn das Ausweiden eines Hirsches war eine blutige Angelegenheit.
»Was denn?« Er sah auf.
Raithe deutete mit dem Kopf in Richtung des Gottes, und sein Vater folgte seinem Blick hinüber zu den drei Gestalten. Die Augen des alten Mannes weiteten sich, und das Blut wich ihm aus dem Gesicht.
Ich wusste, dass das eine dumme Idee war, dachte Raithe.
Herkimer hatte ihm mit großer Zuversicht versprochen, dass die verbotene Überquerung des Flusses all ihre Probleme lösen würde. Doch er hatte diese Gewissheit dermaßen oft betont, dass es Raithe schon ein wenig stutzig gemacht hatte. Nun wirkte der alte Mann, als hätte er mit einem Mal vergessen, wie man atmet. Herkimer wischte sein Messer an der Flanke des Hirsches ab, bevor er es wieder in seinen Gürtel steckte und auf die Beine kam.
»Äh …«, begann er, sah hinab auf den halb ausgeweideten Hirsch und dann zurück zu dem Gott. »Das … geht schon in Ordnung.«
Und das fasste die Weisheit von Raithes Vater auch schon zusammen; das war seine eindrucksvolle Rechtfertigung für die schwere Straftat, die sie begangen hatten: das unerlaubte Betreten göttlichen Landes. Raithe wusste nicht, ob das Abschlachten eines ihrer Hirsche vor den Göttern auch als Verbrechen galt, aber er nahm an, dass es zumindest nicht zur Entspannung ihrer Lage beitrug. Und wenn Herkimer noch so oft sagte, es ginge in Ordnung – der Ausdruck auf seinem Gesicht sagte etwas anderes. Raithe wurde flau im Magen. Er hatte keine Ahnung, welche Art von Verteidigung er von seinem Vater erwartet hatte, aber sicherlich mehr als das.
Es überraschte ihn daher auch nicht, dass der Gott nicht im Geringsten besänftigt schien, sondern sie mit wachsender Verärgerung anstarrte.
Sie standen auf einem winzigen Stück offenen Weidelands, nicht weit entfernt von der Stelle, an der sich die Flüsse Bern und Nordzweig vereinten. Ein dichter Kiefernwald wuchs ein Stück hinter ihnen auf der Böschung. Weiter unten, wo die Flüsse sich trafen, erstreckte sich ein steiniger Strand. Der wild schäumende Zusammenfluss der beiden Ströme blieb unter der gräulichen Wolkendecke das einzige Geräusch. Nur wenige Minuten zuvor hatte Raithe den Ort als paradiesisch empfunden. So schnell änderten sich die Dinge.
Raithe atmete langsam aus und wieder ein und ermahnte sich selbst, dass er keinerlei Erfahrungen mit den Göttern oder ihrer Mimik hatte. Er hatte noch nie einen Gott aus der Nähe gesehen, noch nie mit eigenen Augen buchenblattförmige Ohren betrachtet oder Augen so blau wie der Himmel und Haar, das wie geschmolzenes Gold über die Schultern des Gottes floss. Solch glatte Haut und weiße Zähne waren jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Dies war kein Wesen der Erde, es war aus Licht und Luft geboren. Seine schimmernden Gewänder bauschten sich in der leichten Brise und verbreiteten eine Aura andersweltlicher Pracht. Der vernichtend strenge Blick war genau das, was Raithe von einem unsterblichen Wesen erwartete.
Das Pferd allerdings versetzte ihn in noch größeres Erstaunen. Sein Vater hatte ihm viel über solche Tiere erzählt, doch bis jetzt hatte Raithe ihm nie geglaubt. Sein alter Herr hatte die Angewohnheit, die Wahrheit auszuschmücken, und seit mehr als zwanzig Jahren hörte Raithe nun seine Geschichten. Nach dem einen oder anderen Bier erzählte Herkimer jedem, wie er fünf Mann mit einem Schwertstreich getötet oder den Nordwind niedergerungen hatte. Je älter er wurde, desto größer wurden Herkimers Geschichten. Aber diese Mär auf vier Hufen starrte Raithe nun mit großen, glänzenden Augen an, und als das Pferd seinen Kopf schüttelte, fragte er sich unwillkürlich, ob das Reittier eines Gottes wohl seine Sprache verstand.
»Nein, wirklich, das geht in Ordnung«, wiederholte sein Vater, vielleicht weil er glaubte, der Gott und seine Begleiter hätten die Glanzleistung von seiner Ansprache zuvor nicht gehört. »Ich darf hier sein.« Er machte einen Schritt nach vorn und deutete auf das Medaillon, das an einem Fellstreifen zwischen dem Schmutz und den Kiefernnadeln auf seiner schweißnassen Brust klebte. Er war die lebende Verkörperung eines irren Barbaren – halbnackt, sonnengebräunt und blutverschmiert bis über die Ellbogen. Raithe würde ihm auch nicht geglaubt haben.
»Seht Ihr das?«, fuhr sein Vater fort. Das polierte Metall zwischen seinen dicken, rötlichen Fingern reflektierte blitzend die Mittagssonne. »Ich habe für Euer Volk gegen die Gula-Rhunes im Hochspeer-Tal gekämpft. Ich habe mich gut geschlagen. Ein Feldherr der Fhrey hat mir das hier gegeben. Er sagte, ich hätte eine Belohnung verdient.«
»Clan Dureya«, erklärte der größere der beiden Diener dem Gott. Sein Tonfall schwankte zwischen Enttäuschung und Abscheu. Um seinen Hals lag ein Wendelring aus Silber, der selbst aus der Ferne edel aussah – auch der andere Begleiter des Gottes trug ein solches Schmuckstück. Es musste eine Art Abzeichen ihres Ranges sein.
Der große Diener war ein schlaksiger Kerl, dem es an Bart mangelte, was seine lange Nase, die hohen Wangenknochen und seine kleinen, schlauen Augen betonte. Er erinnerte Raithe an ein Wiesel oder einen Fuchs, und er mochte beide nicht besonders. Raithe empfand auch die Haltung des Mannes als seltsam abstoßend: nach vorn gebeugt, die Augen gesenkt, die Hände vor sich gefaltet. Ein misshandelter Hund hätte mehr Selbstachtung gezeigt.
Welche Art von Mensch reist mit einem Gott?
»Das stimmt. Ich bin Herkimer, Sohn des Hiemdal, und das ist mein Sohn Raithe.«
»Ihr habt das Gesetz gebrochen«, erklärte der Diener. Sein näselnder Ton klang sogar nach einem sprechenden Wiesel.
»Nein, nein, so ist das nicht. Überhaupt nicht.«
Die Sorgenfalten im Gesicht von Raithes Vater gruben sich noch ein wenig tiefer, und sein Mund wirkte noch verkniffener. Er blieb stehen, hielt aber weiterhin das Medaillon an seinem Band in die Höhe wie einen Talisman. In seinem Blick lag Hoffnung. »Diese Medaille beweist es: Ich sage die Wahrheit, ich habe mir eine Belohnung verdient. Seht Ihr, ich dachte, dass wir« – er deutete auf Raithe – »also mein Sohn und ich, hier leben könnten.« Nun wies er mit ausgestrecktem Arm auf das kleine Stück Weideland, auf dem sie standen. »Wir brauchen nicht viel. Eigentlich fast gar nichts. Ihr müsst wissen, auf unserer Seite des Flusses – drüben in Dureya – ist die Erde zu nichts zu gebrauchen. Wir können nichts anbauen, und es gibt auch nichts zu jagen.«
In der Stimme seines Vaters schwang ein Flehen mit, das Raithe bisher noch nie von ihm gehört hatte und überhaupt nicht mochte.
»Ihr dürft hier nicht sein.« Diesmal sprach der andere Diener, auf dessen Schädel praktisch keine Haare mehr wuchsen. Auch ihm fehlte es – genau wie dem großen, wieselgesichtigen Kerl – an einem ordentlichen Bart, als ob Bartwuchs etwas wäre, das man einem Mann erst beibringen müsste. Der Mangel an Gesichtsbehaarung ließ jede Linie seines säuerlichen Gesichtsausdrucks deutlich hervortreten.
»Aber Ihr versteht nicht. Ich habe für Euer Volk gekämpft. Ich habe für Euer Volk geblutet. Ich habe drei Söhne im Kampf für Euch verloren. Und man hat mir eine Belohnung versprochen.« Herkimer hob das Medaillon erneut in die Höhe, doch der Gott sah es nicht einmal an. Er starrte an ihnen vorbei auf einen weit entfernten, unbedeutenden Punkt.
Herkimer ließ das Medaillon wieder sinken. »Wenn dieser Ort ein Problem ist, dann gehen wir woanders hin. Meinem Sohn gefiel eine Gegend westlich von hier recht gut. Wir wären dann weiter von Euch weg. Wäre das besser?«
Obwohl er sie immer noch nicht ansah, schien der Gott noch wütender zu sein als zuvor. Endlich ergriff er selbst das Wort: »Ihr werdet gehorchen.«
Eine durchschnittliche Stimme. Raithe war enttäuscht. Er hatte Donnergrollen erwartet.
Dann wandte sich der Gott in der göttlichen Sprache an seine Diener. Sein Vater hatte Raithe ein paar Grundlagen des Fhrey beigebracht. Nicht so viel, dass er es fließend hätte sprechen können. Aber genug, um zu verstehen, dass der Gott das Tragen von Waffen auf dieser Seite des Flusses missbilligte. Einen Augenblick später übersetzte der große Diener die Nachricht ins Rhunische: »Nur den Fhrey ist es erlaubt, westlich des Bern eine Waffe zu tragen. Werft eure in den Fluss.«
Herkimer warf einen Blick auf ihre Ausrüstung, die sie neben einem Baumstumpf aufgehäuft hatten. Dann wandte er sich mit resignierter Stimme an Raithe: »Hol deinen Speer und tu, was sie sagen.«
»Auch das Schwert auf deinem Rücken«, sagte der größere Diener.
Herkimer riss entsetzt die Augen auf und warf einen Blick über die Schulter, als ob er die Waffe dort ganz vergessen hätte. Dann aber wandte er sich dem Gott zu und sprach ihn geradeheraus in der Sprache der Fhrey an: »Diese Klinge ist ein Erbstück meiner Familie. Ich kann sie nicht wegwerfen.«
Der Gott entblößte seine Zähne zu einem höhnischen Lächeln.
»Es ist ein Schwert«, beharrte der Diener.
Herkimer zögerte nur einen Augenblick. »Na schön, na schön, in Ordnung. Wir gehen zurück auf unsere Seite des Flusses, jetzt gleich. Auf geht’s, Raithe.«
Der Gott gab einen unzufriedenen Laut von sich.
»Sobald du das Schwert abgelegt hast«, sagte der Diener.
Herkimer funkelte ihn wütend an. »Diese Klinge ist seit Generationen im Besitz meiner Familie.«
»Es ist eine Waffe. Wirf sie auf den Boden.«
Herkimer warf seinem Sohn einen Seitenblick zu.
Er mochte kein guter Vater gewesen sein – und war es noch immer nicht, was Raithe betraf –, aber er hatte allen seinen Söhnen eines anerzogen: Stolz. Selbstachtung entstand aus der Gewissheit, sich selbst verteidigen zu können. Solche Dinge verliehen einem Mann seine Würde. Herkimer war der einzige Mann in ganz Dureya, in ihrem gesamten Clan, der ein Schwert führte – eine metallene Klinge. Das gehämmerte Kupfer war über die Jahre schartig und stumpf geworden, doch ihr getrübter Glanz erinnerte noch immer an einen sommerlichen Sonnenuntergang. Eine Legende besagte, dass die kurze Klinge von einem genialen Dhergen-Schmied gefertigt worden war. Natürlich wirkte sie im Vergleich zum Schwert des Gottes erbärmlich, dessen Griff aufwendig gestaltet und mit Edelsteinen verziert war. Doch Herkimers Waffe war ein Teil von ihm, so untrennbar mit ihm verbunden, dass sie sein ganzes Wesen bestimmte. Feindliche Clans kannten Raithes Vater unter dem Namen Kupferschwert – ein gefürchteter und geachteter Titel. Er würde dieses Schwert niemals aufgeben.
Der gellende Schrei eines Falken durchschnitt das Tosen und Rauschen der Flüsse. Es war allgemein bekannt, dass Vögel die Verkörperung von Omen waren, und Raithe verstand dieses himmlische Wehklagen nicht als positives Zeichen. Das unheimliche Echo verhallte noch, als sein Vater sich erneut dem Gott zuwandte. »Ich kann Euch dieses Schwert nicht geben.«
Raithe konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Herkimer, Sohn des Hiemdal vom Clan Dureya, würde sich niemals so weit beugen, nicht einmal vor einem Gott.
Der kleinere Diener nahm die Zügel des Pferds entgegen, als der Gott abstieg.
Raithe sah ihm zu – es war unmöglich, dies nicht zu tun. Die Bewegungen des Gottes waren geradezu hypnotisch, so anmutig, fließend und selbstsicher. Nichtsdestotrotz war er nicht gerade eine körperlich beeindruckende Erscheinung. Er war weder hochgewachsen noch breitschultrig oder muskulös. Raithe und sein Vater hatten ihr Leben damit verbracht, im Kampf mit Speer und Schild ihre Schultern und Arme zu trainieren. Der Gott hingegen wirkte zerbrechlich, als ob er bettlägerig mit dem Löffel gefüttert worden wäre. Wäre der Fhrey ein Mensch gewesen, Raithe hätte keine Angst vor ihm gehabt. Bei einem solchen Unterschied in Gewicht und Größe hätte er nicht gegen ihn gekämpft, solange es sich irgendwie vermeiden ließ, selbst wenn er ihn herausgefordert hätte. Sich auf einen so unfairen Kampf einzulassen, wäre grausam gewesen, und Raithe war nicht grausam. Was von diesem Charakterzug in seiner Familie vererbt worden war, hatten seine Brüder unter sich aufgeteilt.
»Ihr versteht nicht«, versuchte Herkimer derweil einmal mehr zu erklären. »Dieses Schwert ist seit vielen hundert Jahren von Vater zu Sohn weitergereicht worden ...«
Der Gott stürmte vor und schlug Herkimer in den Magen, dass er sich vor Schmerzen krümmte. Dann griff er nach dem Schwert. Mit leisem Kratzen glitt die Klinge aus ihrer Scheide. Während Herkimer noch nach Atem rang, musterte der Gott angewidert die Waffe. Dann wandte er Herkimer kopfschüttelnd den Rücken zu, um dem großen Diener die erbärmliche Klinge zu zeigen.
Doch anstelle sich dem göttlichen Spott anzuschließen, zuckte der Diener zusammen. Raithe erkannte im Blick des wieselgesichtigen Mannes die Zukunft, denn er bemerkte Herkimers Reaktion als Erster.
Raithes Vater zog sein Messer aus dem Gürtel und stürzte sich auf seinen Gegner.
Diesmal enttäuschte der Gott Raithe nicht. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit wirbelte er herum und stieß Herkimer die Kupferklinge in die Brust. Herkimer, noch im Sprung begriffen, stürzte sich mitten ins Schwert, das sich tief in seinen Körper bohrte. Der Kampf war im gleichen Augenblick vorbei, in dem er begonnen hatte. Sein Vater keuchte und ging zu Boden, das Schwert noch in der Brust.
Raithe dachte nicht nach. Hätte er nur einen Augenblick lang innegehalten, er hätte es sich vielleicht doch noch anders überlegt, aber in ihm steckte mehr von seinem Vater, als er glauben wollte. Da es die einzige Waffe in Reichweite war, zog er das Kupferschwert aus der Leiche seines Vaters und schwang die Klinge mit aller Kraft gegen den Hals des Gottes. Er rechnete fest damit, einen sauberen Schnitt zu landen, doch das göttliche Wesen wich behende aus, und das Kupfer zerschnitt nur die Luft. Der Gott zog seine eigene Waffe, gerade als Raithe zum nächsten Schlag ausholte. Die beiden Schwerter krachten aufeinander. Ein dumpfes Klirren ertönte, und das Gewicht in Raithes Händen löste sich mitsamt einem Großteil seines Schwertes auf. Als er seinen Schlag zu Ende geführt hatte, blieb nur noch der Griff des Familienerbstücks zurück – der Rest wirbelte durch die Luft und landete in einer Gruppe junger Kiefern.
Der Gott starrte ihn mit einem angewiderten Grinsen an. »Das war es nicht wert, dafür zu sterben, oder?«, sagte er in der göttlichen Sprache.
Dann hob er seine Waffe erneut. Raithe wich rasch ein Stück zurück.
Zu langsam! Zu langsam!
Sein Rückzug war sinnlos. Raithe war tot. Lange Jahre des Kampftrainings ließen keinen anderen Schluss zu. In dem kurzen Moment, bevor diese Erkenntnis zur Realität wurde, hatte er die Gelegenheit, sein gesamtes Leben zu bedauern.
Ich habe nichts erreicht, dachte er, während sich seine Muskeln bereits in Erwartung schrecklichen Schmerzes verkrampften.
Doch der Schmerz kam nicht.
Raithe hatte im Lauf des Kampfes die Diener aus den Augen verloren – und der Gott ebenso. Keiner von ihnen erwartete oder gar sah den großen, wieselgesichtigen Mann, der seinen Herrn mit einem Stein von der Größe und Form eines Brotlaibs auf den Hinterkopf schlug. Raithe begriff erst, was geschehen war, als der Gott zusammenbrach und den Blick auf den Diener und den Stein in seiner Hand freigab.
»Lauf«, sagte der Diener. »Mit etwas Glück wird er beim Aufwachen zu starke Kopfschmerzen haben, um uns zu verfolgen.«
»Was hast du getan!«, rief der andere Diener. Mit schreckgeweiteten Augen wich er zurück. Das Pferd des Gottes zog er hinter sich her.
»Beruhige dich«, sagte der Mann mit dem Stein.
Raithe sah auf seinen Vater hinab, der vor ihm auf dem Rücken lag. Herkimers Augen waren noch geöffnet, als ob er die Wolken betrachtete. Raithe hatte seinen Vater im Lauf der Jahre oft verflucht. Der Mann hatte seine Familie vernachlässigt, seine Söhne gegeneinander aufgehetzt, und er war nicht einmal zu Hause gewesen, als Raithes Mutter und Schwester starben. In gewisser Hinsicht – in vielerlei Hinsicht – hatte Raithe seinen Vater gehasst, doch in diesem Augenblick war das, was er vor sich auf dem Boden liegen sah, ein Mann, der seinen Söhnen beigebracht hatte zu kämpfen und niemals aufzugeben. Herkimer hatte das Beste aus dem gemacht, was er hatte, und das war ein Leben auf unfruchtbarem Boden, denn die Götter und ihre Launen hatten ihm alles andere genommen. Raithes Vater hatte nie gestohlen, betrogen, gelogen oder geschwiegen, wenn ein klares Wort gesprochen werden musste. Er war ein harter Mann, ein kalter Mann, aber auch einer, der den Mut hatte, für sich selbst einzutreten und für das, was richtig war. Was Raithe vor sich auf dem Boden liegen sah, war das letzte Mitglied seiner Familie.
Er spürte das zerbrochene Schwert in seinen Händen.
»Nein!«, brüllte der Diener, der das Pferd am Zügel hielt, als Raithe die zersplitterte Kupferklinge in den Hals des Gottes rammte.
Beide Diener waren geflohen, der kleinere auf dem Pferd des Gottes, der andere war ihm zu Fuß hinterhergejagt. Nun kehrte Wieselgesicht, der den Stein auf den Kopf des Gottes geschmettert hatte, zu Raithe zurück. Schweißüberströmt trottete er auf die Lichtung und schüttelte besorgt den Kopf.
»Meryl ist weg«, sagte er. »Er ist nicht der beste Reiter, aber das muss er auch nicht sein. Das Pferd kennt den Weg zurück nach Alon Rhist.« Er hielt inne und starrte Raithe an. »Was machst du da?«
Raithe hatte sich über die Leiche des Gottes gestellt. Er hatte das Schwert des Fhrey in die Hand genommen und die Spitze auf seinen Hals gerichtet. »Ich warte. Wie lange dauert es normalerweise?«
»Wie lange dauert was?«
»Bis sie wieder aufstehen.«
»Er ist tot. Tote Leute stehen normalerweise nicht wieder auf«, sagte der Diener.
Es widerstrebte Raithe, den Gott aus den Augen zu lassen, daher warf er nur einen kurzen Blick auf den Diener, der sich vornübergebeugt hatte und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. »Wovon redest du?«
»Wovon redest du?«
»Ich will wissen, wie viel Zeit wir haben, bevor er wieder aufsteht. Dauert es länger, wenn ich seinen Kopf abschneide?«
Der Diener verdrehte die Augen. »Der steht nicht auf! Du hast ihn getötet.«
»Bei Tetlins Arsch! Das ist ein Gott – Götter sterben nicht. Sie sind unsterblich.«
»Eigentlich nicht so sehr«, sagte der Diener, und zu Raithes Entsetzen trat er gegen den reglosen Körper des Gottes. Er bewegte sich kaum. Der Diener trat erneut zu, und diesmal rollte der Kopf des Gottes auf eine Seite. Sand klebte an der Wange. »Siehst du? Tot. Kapierst du es jetzt? Nicht unsterblich. Kein Gott, nur ein Fhrey. Sie sterben. Es gibt einen Unterschied zwischen langlebig und unsterblich. Unsterblich bedeutet, dass du nicht sterben kannst … selbst wenn du es wolltest. Tatsache ist, die Fhrey sind den Rhunes sehr viel ähnlicher, als wir es gern hätten.«
»Wir ähneln uns überhaupt nicht. Sieh ihn dir doch an«, sagte Raithe und deutete auf den gestorbenen Fhrey.
»Oh ja«, antwortete der Diener. »Er ist so anders. Er hat nur einen Kopf, geht auf zwei Beinen, hat zwei Hände und zehn Finger. Du hast recht – überhaupt nicht wie wir.«
Der Diener sah auf die Leiche hinab und seufzte. »Sein Name war Shegon. Ein unglaublich talentierter Harfenist, hat beim Kartenspielen betrogen und war ein brideeth eyn mer – was bedeutet …« Der Diener hielt inne. »Nein, man kann es nicht anders ausdrücken. Er war nicht sonderlich beliebt, und jetzt ist er tot.«
Raithe musterte ihn misstrauisch.
Lügt er? Versucht er mich zu überrumpeln?
»Du hast unrecht«, sagte er im Brustton tiefster Überzeugung. »Hast du je einen toten Fhrey gesehen? Ich nicht. Mein Vater auch nicht. Und auch sonst niemand, den ich kenne. Und sie altern nicht.«
»Doch, das tun sie. Sie tun es nur sehr langsam.«
Raithe schüttelte den Kopf. »Nein, tun sie nicht. Mein Vater hat mir erzählt, er hat als Junge einen Fhrey namens Neason kennengelernt. Fünfundvierzig Jahre später sind sie sich wieder begegnet, aber Neason sah noch ganz genauso aus.«
»Natürlich. Ich habe dir gerade gesagt, dass sie sehr langsam altern. Fhrey können Tausende von Jahren leben. Eine Hummel lebt nur wenige Monate. Für eine Hummel erscheinst du unsterblich.«
Raithe war noch nicht ganz überzeugt, aber das würde das Blut erklären. Er hatte keins erwartet. Rückschauend hätte er den Fhrey gar nicht erst angreifen sollen. Das war eine sehr dumme Idee gewesen. Sein Vater hatte ihm beigebracht, nie einen Kampf zu beginnen, den er nicht gewinnen konnte, und gegen einen unsterblichen Gott zu kämpfen, fiel eindeutig in diese Kategorie. Andererseits hatte sein Vater die ganze Sache überhaupt erst angefangen.
Das ist wirklich eine Menge Blut.
Eine widerliche Lache hatte sich unter dem Gott gebildet und nicht nur den Rasen, sondern auch seine schimmernde Kleidung verschmiert. An seinem Hals klaffte immer noch die Wunde, ein hässlicher, schartiger Riss wie ein zweiter Mund. Raithe hatte erwartet, dass sie auf wundersame Weise verheilen oder vielleicht einfach verschwinden würde. Wenn der Gott sich erhob, wäre Raithe klar im Vorteil. Er war stark – er konnte die meisten Männer Dureyas besiegen, was bedeutete, dass er die meisten Männer aller Clans besiegen konnte. Selbst sein Vater hätte es sich zweimal überlegt, bevor er ihn wirklich wütend machte.
Raithe starrte auf den Fhrey herab, dessen Augen weit offen standen und nach oben verdreht waren, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Die klaffende Wunde in seinem Hals hatte sich sogar noch geweitet. Ein Gott – ein echter Gott – hätte sich niemals von einem Diener treten lassen. »Na schön, vielleicht sind sie nicht unsterblich.« Er entspannte sich und wich einen Schritt zurück.
»Ich heiße Malcolm«, sagte der Diener. »Und du bist Raithe?«
»Mmh-hmm«, machte Raithe. Mit einem letzten zornigen Blick auf den Gott schob er die juwelenbesetzte Klinge in seinen Gürtel und hob die Leiche seines Vaters auf seine Arme.
»Was machst du denn da?«, fragte Malcolm.
»Ich kann ihn nicht hier unten begraben. Diese Flüsse werden die Ebene überfluten.«
»Ihn begraben? Wenn die Nachricht über die Vorfälle hier Alon Rhist erreicht, dann werden die Fhrey …« Ihm schien allein bei dem Gedanken übel zu werden. »Wir müssen gehen.«
»Dann geh.«
Raithe trug seinen Vater hinüber zu einem niedrigen Hügel und legte ihn behutsam auf dem Rasen ab. Es war nicht eben eine prunkvolle letzte Ruhestätte, aber es musste reichen. Als er sich wieder zu dem ehemaligen Diener des Gottes umdrehte, bemerkte er, dass Malcolm ihn ungläubig anstarrte. »Was denn?«
Malcolm begann zu lachen, hielt dann aber verwirrt inne. »Du verstehst das nicht. Glyn ist ein schnelles Pferd – und er hat die Ausdauer eines Wolfs. Meryl wird Alon Rhist bei Sonnenuntergang erreichen. Er wird den Instarya alles erzählen, um seine eigene Haut zu retten. Sie werden uns jagen. Wir müssen hier weg, und zwar sofort.«
»Nur zu«, sagte Raithe, nahm das Medaillon von Herkimers Hals und legte es selbst um. Dann schloss er die Augen seines Vaters. Er konnte sich nicht entsinnen, das Gesicht des alten Mannes je zuvor berührt zu haben.
»Du musst mit mir kommen.«
»Erst beerdige ich meinen Vater.«
»Der Rhune ist tot.«
Raithe zuckte bei dem Wort zusammen. »Er war ein Mensch.«
»Rhune, Mensch, ein und dasselbe.«
»Nicht für mich – und nicht für ihn.« Raithe kehrte an das Flussufer zurück, das mit Tausenden von Steinen unterschiedlichster Größe übersät war. Das Problem war nicht, passende Steine für sein Vorhaben zu finden, sondern die richtigen auszusuchen.
Malcolm hatte die Hände in die Seiten gestemmt und starrte Raithe mit einem Blick an, der irgendwo zwischen Zorn und Verwunderung lag. »Es wird Stunden dauern! Du verschwendest deine Zeit.«
Raithe ging in die Hocke und nahm einen Stein in die Hand. Die Oberseite war von der Sonne gewärmt, die Unterseite feucht, kühl und mit nassem Sand bedeckt. »Er verdient ein ordentliches Begräbnis und hätte dasselbe für mich getan.« Raithe empfand seine eigenen Worte als Ironie, wenn er bedachte, dass ihm sein Vater fast nie mit Freundlichkeit begegnet war. Aber es stimmte; Herkimer hätte sein Leben aufs Spiel gesetzt, damit sein Sohn ein ordentliches Begräbnis erhielt. »Davon abgesehen: Hast du auch nur die leiseste Ahnung, was mit dem Geist geschehen kann, wenn der Körper nicht vernünftig bestattet wird?«
Der Mann starrte ihn fassungslos an.
»Sie kehren als Manen zurück und suchen dich heim, weil du ihnen nicht den nötigen Respekt erwiesen hast. Und Manen können bösartig sein.« Raithe nahm einen weiteren großen, sandfarbenen Stein in die Hand und ging den Hang wieder hinauf. »Mein Vater konnte ein richtiger Mistkerl sein, als er noch lebte. Ich möchte wirklich nicht, dass er mich den Rest meines Lebens verfolgt.«
»Aber ...«
»Aber was?« Raithe legte den Stein neben die Schulter seines Vaters. Er würde erst seinen Umriss mit den Steinen nachzeichnen und dann das Aufschichten beginnen. »Er ist nicht dein Vater. Ich erwarte nicht, dass du bleibst.«
»Darum geht es nicht.«
»Worum geht es dann?«
Der Diener zögerte, und Raithe nutzte die Gelegenheit, zum Ufer zurückzukehren und sich einen neuen Stein zu suchen.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte der Mann schließlich.
Raithe hob einen weiteren großen Stein auf und trug ihn gegen seinen Bauch gedrückt die Uferböschung hinauf.
»Wobei?«
»Du weißt … nun ja, du weißt schon … wie man … lebt. Hier draußen, meine ich.« Der Diener warf einen Blick auf den Hirschkadaver, auf dem sich inzwischen mehrere Fliegenschwärme niedergelassen hatten. »Du kannst jagen, kochen und dir eine Zuflucht suchen, oder? Du weißt, welche Beeren man essen kann, welche Tiere man streicheln darf und vor welchen man weglaufen sollte.«
»Man streichelt Tiere nicht.«
»Siehst du! Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wenig ich über solche Dinge weiß. Auf mich allein gestellt bin ich in ein oder zwei Tagen tot – erfroren, unter einem Erdrutsch begraben oder von irgendeinem Tier mit Geweih aufgespießt.«
Raithe plazierte den Stein, ging den Abhang wieder hinab und klopfte sich den Sand von den Händen. »Klingt logisch.«
»Natürlich klingt das logisch. Hör mal, ich bin ein vernünftiger Kerl. Und wenn du auch vernünftig wärst, dann würden wir jetzt gehen – sofort.«
Raithe hob einen weiteren Stein auf. »Wenn du wirklich bei mir bleiben willst und es so eilig hast, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, mir zu helfen.«
Der Mann sah zum Flussufer und seinen rund gewaschenen Steinen hinüber und seufzte. »Müssen wir so große nehmen?«
»Große nach unten, die kleineren obenauf.«
»Das klingt, als ob du das schon mal gemacht hättest.«
»Die Leute sterben oft, da wo ich herkomme. Und wir haben eine Menge Steine.« Raithe wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn und schob sich dunkle Haarsträhnen aus dem Gesicht. Er hatte die Wollärmel seiner Untertunika hochgerollt. Die Frühlingstage waren noch kühl, aber die Arbeit hatte ihn ins Schwitzen gebracht. Er überlegte kurz, auch sein Leigh Mor und die Lederkleidung auszuziehen, entschied sich aber dagegen. Seinen Vater zu begraben sollte eine unangenehme Aufgabe sein. Ein Sohn sollte in solchen Momenten etwas empfinden, und wenn unbequem das Beste war, das er zustande brachte, dann würde Raithe sich wenigstens daran halten.
Malcolm trug zwei Steine herüber und legte sie ab, damit Raithe sie plazieren konnte. Dann hielt er inne, um sich die Hände zu säubern.
»Okay, Malcolm«, sagte Raithe, »du musst dir größere Steine aussuchen, oder wir werden ewig hier sein.«
Malcolm blickte finster drein, wuchtete aber auf dem nächsten Weg zwei ordentliche Brocken hoch und klemmte sie sich unter die Arme wie Melonen. Er schwankte auf seinen Sandalen. Mit ihren dünnen Sohlen und den schmalen Riemen, die sie an Malcolms Füßen hielten, waren sie denkbar schlechtes Schuhwerk für diese Landschaft. Raithes Kleidung war minderwertig – grob zusammengenähte Wollfetzen mit Lederakzenten, die er selbst gegerbt hatte –, aber wenigstens war sie robust.
Raithe suchte und fand einen kleinen, glatten Stein.
»Ich dachte, du wolltest größere Steine haben?«, fragte Malcolm.
»Der ist nicht für den Haufen.« Raithe öffnete die rechte Hand seine Vaters und tauschte den Stein gegen das Jagdmesser ein. »Er wird ihn brauchen, um nach Rel oder Alysin zu kommen, sollte er sich als würdig erweisen – Nifrel, wenn nicht.«
»Oh, verstehe.«
Nachdem er den Umriss von Herkimers totem Körper vollendet hatte, begann Raithe die Steine von den Füßen nach oben aufzuschichten. Dann holte er den Leigh Mor seines Vaters, der immer noch neben dem Hirschkadaver lag, und legte ihn über Herkimers Gesicht. Eine schnelle Suche im nahen Piniengehölz förderte das abgebrochene Ende des Kupferschwertes zutage. Raithe dachte kurz darüber nach, die Waffe bei seinem Vater zu lassen, doch die Gefahr, dass Grabräuber sie ihm stehlen würden, schien ihm zu groß. Sein Vater war für das zerschmetterte Schwert gestorben; es verdiente eine bessere Behandlung.
Raithe warf noch einen Blick auf den leblosen Fhrey. »Bist du dir wirklich sicher, dass der nicht mehr aufsteht?«
Malcolm sah zu ihm hinüber, während er einen weiteren Stein auf seine Arme wuchtete. »Absolut sicher. Shegon ist tot.«
Gemeinsam schleppten sie ein weiteres Dutzend schwerer Steine zum langsam wachsenden Haufen. Dann fragte Raithe: »Warum warst du bei ihm?«
Malcolm deutete auf den Ring um seinen Hals, als ob das alles erklärte. Raithe war verwirrt. Doch dann fiel ihm auf, dass der Ring einen geschlossenen Kreis bildete. Es war kein halboffener Wendelring und keineswegs ein Schmuckstück, wie Raithe geglaubt hatte – es war ein Halsband.
Kein Diener – ein Sklave.
Die Sonne war schon tief gesunken, als sie die letzten Steine auf den Grabhügel schichteten. Malcolm wusch sich im Fluss, während Raithe seinen Trauergesang anstimmte. Dann warf er sich die zerbrochene Klinge seines Vaters über die Schulter, rückte das Schwert des Fhrey in seinem Gürtel zurecht und sammelte anschließend seine Sachen und die seines Vaters auf. Sie besaßen nicht viel: einen hölzernen Schild, einen Beutel mit einem guten Steinhammer, ein Hasenfell, aus dem Raithe einen Beutel machen wollte, sobald er es gegerbt hatte, das letzte Stück Käse, die Decke, die sie sich geteilt hatten, eine Handaxt aus Stein, Herkimers Messer und Raithes Speer.
»Wohin jetzt?«, fragte Malcolm. Seine verschwitzten Haare klebten ihm am Schädel, und der Mann besaß nichts, nicht einmal ein Messer.
»Hier, wirf dir die Decke über die Schulter – bind sie ordentlich fest –, und nimm meinen Speer.«
»Ich weiß nicht, wie man einen Speer benutzt.«
»Ist nicht so schwer. Nur zielen und zustoßen.«
Raithe sah sich um. Nach Hause zurückzukehren ergab keinen Sinn. Das lag im Osten, näher bei Alon Rhist. Außerdem hatte er keine Familie mehr. Der Clan würde ihn zwar wieder aufnehmen, aber sich in Dureya ein neues Leben aufzubauen war unmöglich. Eine andere Möglichkeit war, weiter in Richtung Westen vorzudringen, in die ungezähmte Wildnis von Avrlyn. Auf dem Weg dorthin müssten sie sich allerdings an einer ganzen Reihe von Außenposten der Fhrey entlang der westlichen Flüsse vorbeischleichen – allesamt Festungen wie Alon Rhist, deren einziger Zweck es war, die Menschen vom Land der Götter fernzuhalten. Herkimer hatte Raithe vor den Festungen Merredydd und Seon Hall gewarnt, ihm aber nie erklärt, wo genau sie eigentlich lagen. Raithe gefiel der Gedanke nicht, zufällig in eine von beiden hineinzustolpern. Und selbst wenn sie an den Festungen vorbeikamen – was für ein Leben würden sie in der Wildnis schon führen können? So wie Malcolm aussah und sich verhielt, würde er das erste Jahr nicht überstehen.
»Wir kehren nach Rhulyn zurück und gehen dann weiter Richtung Süden.« Er deutete über den Fluss auf die dramatisch steil ansteigenden Berge, die mit immergrünen Pflanzen bedeckt waren. »Das ist der Sichelwald, er erstreckt sich in jede Richtung auf mehrere Meilen. Nicht gerade der sicherste Ort, aber er bietet uns Deckung – dort können wir uns verstecken.« Er sah in den Himmel. »Es ist noch früh im Jahr, aber es sollte etwas Essbares zu finden und Wild zu jagen sein.«
»Was meinst du mit nicht gerade der sicherste Ort?«
»Nun, ich bin selbst noch nicht drin gewesen, aber man erzählt sich halt Geschichten.«
»Was für Geschichten?«
Raithe schnallte den Gürtel und den Riemen enger, mit dem das Kupferschwert auf seinem Rücken befestigt war, bevor er mit den Achseln zuckte. »Oh, na ja, Tabore, Rauhs, Leshien. So was halt.«
Malcolm starrte ihn unentwegt an. »Bösartige Tiere?«
»Oh ja – die auch, nehme ich an.«
»Die … auch?«
»Klar, bei einem Wald von der Größe.«
»Oh«, sagte Malcolm und beobachtete mit besorgtem Blick einen Ast, der in zügigem Tempo auf dem Fluss an ihnen vorbeiglitt. »Wie kommen wir da rüber?«
»Du kannst doch schwimmen?«
Malcolm wirkte kurz sprachlos. »Das sind tausend Fuß von einem Ufer zum anderen.«
»Und die Strömung ist ziemlich ordentlich. Je nachdem, wie gut du schwimmen kannst, werden wir mehrere Meilen südlich von hier rauskommen. Aber das ist gut. Macht es schwerer, unsere Spur zu verfolgen.«
»Unmöglich, würde ich meinen«, sagte Malcolm und verzog das Gesicht zu einer Grimasse, ohne seinen Blick auch nur für einen Augenblick von dem Strom zu nehmen.
Der ehemalige Sklave der Fhrey war blass vor Angst, und Raithe verstand, warum. Er hatte sich ganz genauso gefühlt, als Herkimer ihn zur Überquerung gezwungen hatte.
»Bereit?«, fragte Raithe.
Malcolm schürzte die Lippen, und Raithe bemerkte, dass auch die Hände an seinem Speer bleich waren vor Anspannung. »Dir ist schon klar, dass das Wasser eiskalt ist – das ist die Schneeschmelze vom Mador.«
»Nicht nur das«, sagte Raithe. »Da wir gejagt werden, dürfen wir nicht mal ein Feuer machen, wenn wir wieder an Land sind.«
Der schlanke Mann mit der spitzen Nase und den eng stehenden Augen zwang sich zu einem Lächeln. »Na wunderbar! Danke für den Hinweis.«
»Sicher, dass du das packst?«, fragte Raithe, als er sie ins eiskalte Wasser führte.
»Ich gebe zu, mein Alltag sieht ein bisschen anders aus.« Malcolms Stimme stieg in Oktaven an, während er in den Fluss watete.
»Wie ist dein Alltag denn so?« Raithe biss die Zähne zusammen, als das Wasser seine Knie erreichte. Die Strömung zerrte bereits an ihm und zwang ihn, seine Füße ins Flussbett zu stemmen. Das Wasser umfloss schäumend seine Beine.
»Hauptsächlich schenke ich Wein ein.«
Raithe lachte leise. »Ja – das hier wird ein wenig anders.«
Einen Augenblick später riss der Fluss sie beide von den Beinen.
2
Die Seherin
Dahl Rhen war ein grasbestandener Hügel, der sich an den Rand des Sichelwaldes schmiegte. Ein Langhaus und mehrere hundert Lehmrundhütten waren dort durch eine Mauer aus Holz und Erde geschützt. Wenn ich daran zurückdenke, so war es ein kleiner, primitiver Ort, an dem Hühner und Schweine frei umherliefen, aber es war auch der Ort, an dem der Stammesführer des Clans Rhen lebte und herrschte. Und es war mein Zuhause.
– Das Buch Brin
Persephone kannte alle im Dahl, deswegen fielen ihr Fremde sofort auf, und das Mädchen am Tor wirkte noch fremder als die meisten anderen. Die Besucherin war klein, jung und schlank und wirkte mit ihrem kurzen, ungleichmäßig geschnittenen Haar ein wenig jungenhaft. Persephone konnte nicht sagen, ob die Haut in ihrem Gesicht von der Sonne gebräunt oder einfach nur schmutzig war, aber sie war auf jeden Fall mit aufwendigen Tätowierungen verziert – zarte Linien, die wie Dornenranken ihre Wangen emporwuchsen, Augen und Mund umspielten und ihr eine geheimnisvolle Aura verliehen. Sie schien stets ernst dreinzublicken, zugleich aber auch immer fragend. Sie trug einen schmutzigen Umhang aus rötlicher Wolle, eine Weste aus Pelz und Leder, einen Rock aus gegerbtem Fell und einen ungewöhnlichen Gürtel. Persephone war sich nicht sicher, aber er schien aus Tierzähnen gefertigt zu sein. Neben dem Mädchen hatte sich ein weißer Wolf zusammengerollt und fixierte alle, die sich ihnen näherten, mit wachen blauen Augen. Doch das wagten ohnehin nur wenige.
Das Mädchen stand vor dem Tor zum Dahl, direkt neben Cobb, der von seinem Ausguck auf der Mauer heruntergekommen war und seinen Speer so bedrohlich wie möglich auf sie richtete – was so viel hieß wie: keine Spur bedrohlich. Cobbs eigentliche Aufgabe war es, die Schweine zu füttern und sie aus dem Gemeinschaftsgarten fernzuhalten. Eine Aufgabe, die zuvor die achtjährige Thea Wedon übernommen und sich dabei wesentlich geschickter angestellt hatte als er. Ein Großteil der Männer des Dahls wechselten sich damit ab, den Wachdienst auf der Mauer über dem Tor zu verrichten. An diesem Morgen war Cobb an der Reihe, und genau wie bei den Schweinen bereitete die Aufgabe ihm Mühe.
»Wir haben eine Besucherin, Herrin«, sagte Cobb und deutete mit dem Speer auf das Mädchen. Er hielt das Bockshorn hoch, das um seinen Hals baumelte, und grinste, als ob er sich mit dem Blasen des Horns ein Lob verdient hätte. Persephone musste zugeben, dass er sich bei der Wache geschickter angestellt hatte als beim Schweinehüten. »Sie sagt, sie sei eine Seherin und will mit dem Stammesführer sprechen.«
Das Mädchen konnte kaum älter als zwölf sein, und obwohl sie tatsächlich aussah, als ob sie den größten Teil ihres Lebens in der Wildnis verbracht hätte, war sie eindeutig zu jung für eine Seherin.
»Ich bin Persephone, die Herrin des Langhauses.« Sie wartete auf eine Reaktion, ein Zeichen, dass das Mädchen sie verstanden hatte. Als keine kam, fügte sie hinzu: »Ich bin die Frau von Stammesführer Reglan. Mein Mann ist auf der Jagd, aber du kannst mit mir reden.«
Das Mädchen nickte, sagte aber nichts. Sie stand einfach nur da und knabberte an ihrer Unterlippe. Jedes Mal, wenn eine Spitzhacke in den Boden, ein Hammer auf den Amboss geschlagen oder auch nur laut gerufen wurde, zuckte ihr Blick in die jeweilige Richtung.
Bei genauerer Betrachtung erkannte Persephone, dass das Mädchen vielmehr unterernährt war denn dünn, und schmutzig traf es nicht einmal annähernd. In ihren Haaren klebten Kiefernnadeln und Blätter, und ihre Beine starrten vor Dreck. An den Armen hatten sie blaue Flecke, an den Knien Schürfwunden, und ihr Gesicht war nicht sonnengebräunt, sondern einfach nur dreckverschmiert.
»Kann ich dir helfen?«
»Was jagt er denn?«, fragte das Mädchen.
»Entschuldigung?«
»Der Stammesführer.«
Persephone zögerte. Heute hatte sie sich bisher recht gut geschlagen, indem sie sich gezwungen hatte, nicht zu viel zu denken. Das schreckliche Ereignis hatte sie in eine dunkle Ecke ihres Kopfes gesperrt, die sie erst wieder aufsuchen wollte, wenn ihr Mann zu Hause war. Doch die Frage des Mädchens hatte ein grelles Licht in diese Ecke geworfen, und Persephone hatte Mühe, die Fassung zu bewahren.
»Geht dich nichts an.« Nun endlich erwachte auch Cobb wieder zum Leben und ging – diesmal ernsthaft bedrohlich – einen Schritt auf das Mädchen zu. Die Bedrohung lag nicht im Speer, der schlaff und vergessen an seiner Seite baumelte, sondern im ehrlich empfundenen Zorn in seiner Stimme.
»Einen Bären«, sagte Persephone. Sie atmete tief durch und richtete sich auf. »Einen schrecklichen Bären, den man den Braunen nennt.«
Das Mädchen nickte und blickte finster drein.
»Kennst du ihn?«, fragte Persephone.
»Oh ja, Herrin. Grinsie, die Braune, ist im Wald berühmt. Und niemand mag sie.«
»Grinsie, die Braune?«
»So nennen wir sie, weil sie alles und jeden höhnisch angrinst. Ich habe sie sogar die Sonne höhnisch angrinsen sehen, und wer hat schon etwas gegen die Sonne?«
»Diese Bärin hat meinen Sohn getötet«, sagte Persephone und bemerkte, dass ihr die Worte leichter fielen als erwartet. Es war das erste Mal gewesen, dass sie sie aussprach, und in gewisser Weise hatte sie geglaubt, sie würden sich weigern, ihren Mund zu verlassen.
»Hat auch Minnas Familie auf dem Gewissen«, sagte das Mädchen und sah den Wolf an. »Hab sie im Sichelwald gefunden, wie Tura mich gefunden hat. Ich habe sie bei mir aufgenommen, denn wir sind eindeutig Schwestern – und man lässt seine Familie nicht im Stich. Tura hat das auch so gesehen.«
»Du kennst Tura?«
»Sie hat mich großgezogen.«
Mit einem Schlag ergaben der Gürtel aus Tierzähnen, die Tätowierungen und selbst der verwitterte Eschenstab einen Sinn. Persephone erinnerte sich, in Turas knochigen Händen einen ganz ähnlichen Stab gesehen zu haben. »Also hat Tura dich zu uns geschickt?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Tura ist tot. Ich habe sie selbst angezündet.«
»Was hast du getan?«
»War ihr Wunsch, Herrin. Sie mochte den Gedanken an Würmer nicht. Ich glaube, sie wollte fliegen. Wer nicht?«
Persephone starrte das Mädchen einen Augenblick lang an und sagte dann: »Ich verstehe«, auch wenn sie in Wahrheit gar nichts verstand. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was das alles bedeuten sollte, aber dann wurde ihr klar, dass das gar keine Rolle spielte.
»Wie heißt du?«
»Suri«, antwortete das Mädchen.
»Gut, Suri.« Persephone musterte die Wölfin. »Ich würde dich ja gerne hereinbitten, aber wir haben Hühner und Schweine im Dahl, und daher darf – Minna, nicht wahr? – leider nicht mit.«
»Minna wird ihnen nichts tun«, sagte Suri und klang dabei beleidigt und zugleich ein wenig wütend. Die tätowierten Ranken um ihre Augen zogen sich zusammen.
»Wölfe fressen Hühner und Schweine.«
Das Mädchen grinste und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sie fressen auch Menschen, aber wenn ich das richtig sehe, knabbert sie noch nicht an deinem Bein, oder?«
Persephone richtete ihren Blick erneut auf die Wölfin, die sich wie ein treuherziger Hütehund zusammengerollt hatte. »Sieht ziemlich zahm aus. Was meinst du, Cobb?«
Der unfähige Schweinehüter, der nun eine halbwegs fähige Wache abgab, zuckte mit den Achseln.
»Na gut, aber achte auf sie. Wenn sie irgendetwas angreift, dann spießt sie wahrscheinlich jemand auf.«
Persephone ging ins Dorf voran.
Auf dem Weg hinein hörte sie Suri hinter sich flüstern: »Nicht gerade ein gastfreundlicher Ort, nicht wahr, Minna? Ich frage mich, wie es ihnen gefallen würde, aufgespießt zu werden, wenn sie in den Wald kommen und unsere Tiere jagen.«
Der Frühling ließ sich dieses Jahr reichlich Zeit, und die Welt war noch immer eine farblose Mischung aus verfilztem Gras, kahlen Bäumen und grauem Himmel. Doch die Bewohner von Dahl Rhen warteten nicht auf ihn. Sie hatten den langen Winter satt, und schon mit dem ersten milden Tag des Jahres zog es sie nach draußen an die Arbeit. Die Killian-Jungs, die selbst im Hochsommer ein sprudelnder Quell aufgestauter Energie waren, waren auf das kegelförmige Dach ihres Hauses gestiegen. Es war über den Winter abgesackt, und nun zogen sie neue Strohgarben ein, um die aufgerissenen Lücken zu stopfen. Bergin, der Brauer, hackte Holz und heizte das Feuer unter den Kesseln an, in denen der Baumsaft vor sich hin blubberte, den er gesammelt hatte. Andere kümmerten sich um den Gemeinschaftsgarten, der zu dieser Jahreszeit nicht viel mehr war als ein armseliges Fleckchen Erde, in dem die Stoppeln des vergangenen Herbstes wie ausgebleichte Knochen aus dem Boden ragten.
Cobb kehrte auf die Mauer zurück, und Persephone führte Suri den Kiesweg hinauf zum großen Langhaus in der Dorfmitte. Das fast schon vergessene Zwitschern der Vögel war zurückgekehrt, und Persephone entdeckte gelbe und blaue Wildblumen auf der Sonnenseite des Brunnens. Hörte man auf die Sterne, Vögel und Blumen, war der Winter vorüber, doch an schattigen Orten lag weiterhin Schnee. Persephone schlang ihr Trauertuch enger um sich. Der Frühling war launisch in diesem Jahr. Er kam noch nicht zu allen.
Auf dem Anger, vor den Stufen hinauf zum Langhaus hielt Persephone inne und verbeugte sich vor der Steinstatue der Göttin Mari. Suri sah ihr neugierig dabei zu und folgte ihr dann. Die großen Türflügel des Langhauses standen weit offen und ließen das Sonnenlicht in die Halle des Reglan fallen, die seit dem Herbst eine verrauchte Holzhöhle gewesen war. In den finsteren Wintertagen tauchte der Feuerschein die zwölf Jahreszeitenstämme, auf denen das Dach ruhte, in goldenes Licht. Der grelle Schein der Frühlingssonne aber enthüllte gnadenlos, wie alt und verwittert ihr Holz in Wahrheit war. Und er hatte noch mehr Wirklichkeiten offenzulegen als nur den Zustand der hölzernen Säulen: weggeworfene Schuhe; einen Umhang, der vom Geweih eines getöteten Hirsches herabhing; ein Kelch aus Bockshorn lag irgendwo in einer Ecke – Oswald hatte ihn schon vor Monaten nach Sackett geworfen. Asche und Schmutz überzogen den erhabenen Holzboden um die glimmende Feuerstelle. So war das Wesen von Sonnenlicht: Es zeigte eine Wirklichkeit, die die Schatten des flackernden Feuerscheins verbargen.
Das ewige Feuer glomm nur noch schwach in seiner Grube, und Habet, die dafür sorgen sollte, dass es stets brannte, war nirgendwo zu sehen. Persephone warf ein Stück Holz hinein, und der Raum erhellte sich ein wenig. Sie durchquerte den Raum zu einem Paar Stühle – den einzigen Stühlen – und nahm auf dem rechten Platz.
Suri war an der Tür stehen geblieben. Sie starrte zu den Sparren des Spitzdaches hinauf, wo die Schilde verstorbener Stammesführer neben Schädeln von Hirschen, Wölfen und Bären hingen. Sie verzog das Gesicht und sah dann quer durch den Raum zu Persephone hinüber. Misstrauisch beäugte sie den Boden, als wäre er ein tiefer See und sie selbst eine schlechte Schwimmerin. Dann aber, mit sichtlicher Überwindung, betraten das Mädchen und die Wölfin das Langhaus.
»Wie alt bist du, Suri?«, fragte Persephone, während Suri und Minna langsam die Halle durchquerten.
»Ich weiß nicht – vierzehn vielleicht.« Suris Antwort klang abwesend. Sie schien mit den Gedanken immer noch bei den Dachsparren zu sein.
»Vielleicht?«
»Besser kann ich es nicht schätzen. Könnte auch älter sein. Oder jünger.«
»Du weißt es nicht?«
»Kommt darauf an, wie viel Zeit ich bei den Krimbal verbracht habe. Tura war sich ziemlich sicher, dass ich ein Malkin bin.«
»Ein – ein was? Ein Malkin?«
Suri nickte. »Wenn ein Krimbal ein – weißt du, was ein Krimbal ist, Herrin?«
Persephone schüttelte den Kopf.
Suri atmete tief durch und warf ihrem Wolf einen kurzen Blick zu, als ob sie ein Geheimnis mit ihm teilte, und erklärte dann: »Also, ein Krimbal ist ein Waldwesen. Aber sie leben eigentlich nicht im Wald, sie kommen und gehen bloß, verstehst du? Im Sichelwald sind sie oft, es gibt viele Durchgänge wegen der ganzen Bäume. Sie wohnen in Nog, tief unter der Erde, in riesigen Hallen, in denen sie ständig Festessen abhalten. Sie tanzen und feiern, wie es sich niemand vorstellen kann. Jedenfalls, wenn ein Krimbal ein Baby stiehlt, dann ...«
»Sie stehlen Babys?«
»Oh Große Mutter, aber ja! Andauernd. Keiner weiß, warum. Ich glaube, sie sind einfach so. Jedenfalls, wenn sie ein Baby stehlen, dann bringen sie es nach Nog, und was dort mit ihm passiert, weiß niemand. Es kommt nur ganz selten vor, dass eins von ihnen sich fortstiehlt und zurückkehrt. Man nennt sie Malkin, und sie sind nicht ganz richtig im Kopf, denn wer Zeit in Nog verbringt, verändert sich für immer. Normalerweise ist ein Malkin älter, etwa zehn oder zwölf, aber irgendwie habe ich es geschafft, noch im ersten Jahr zu entkommen. Und dann hat mich Tura gefunden.«
»Wie bist du entkommen, wenn du noch nicht laufen konntest?«
Suri, die mittlerweile den größten Teil ihres Wegs zurückgelegt hatte, sah Persephone an, als ob sie gerade etwas völlig Verrücktes gesagt hätte: »Woher soll ich das wissen, Herrin? Ich war doch noch ein Baby.«
Persephone zog die Augenbrauen hoch und nickte. »Ich verstehe«, sagte sie. Aber was sie tatsächlich verstand, war, dass selbst eine so unverfängliche Frage wie »Wie alt bist du?« keine einfache Angelegenheit war. Nicht für ein Mädchen, das einen Gürtel aus Tierzähnen trug und einen Wolf als Haustier hatte. Vermutlich war es besser, das Gespräch auf das Wesentliche zu beschränken.
»Also gut, Suri, was brauchst du?«
»Was ich brauche, Herrin?«, fragte das Mädchen.
»Warum bist du hier?«
»Oh – ich bin gekommen, um dem Stammesführer zu sagen, dass wir sterben werden.« Das Mädchen sprach schnell und mit einer so beiläufigen Gleichgültigkeit, als ob sie verkündet hätte, dass an diesem Abend die Sonne untergehen würde.
Persephone verengte die Augen. »Entschuldigung? Was hast du gesagt? Wer wird sterben?«
»Wir alle.«
»Wer ist wir?«
»Wir.« Das Mädchen wirkte verwirrt, aber diesmal wusste Persephone nicht, ob es an den Tätowierungen lag oder nicht.
»Du und ich?«
Suri seufzte. »Ja – du, ich, der lustige Kerl mit dem Bockshorn am Tor, alle.«
»Alle in Dahl Rhen?«
Das Mädchen seufzte erneut. »Nicht nur in Dahl Rhen – überall.«
Persephone lachte. »Willst du behaupten, dass jedes Lebewesen einmal sterben muss? Diese Erkenntnis ist nämlich nicht gerade neu.«
Suri warf einen flehenden Blick zu Minna hinüber, als ob die Wölfin ihr helfen könnte, die Lage besser zu erklären. »Nicht alle Lebewesen, nur die Menschen – Menschen wie du und ich.«
»Du meinst die Rhunes? Alle Rhunes werden sterben?«
Suri zuckte mit den Achseln. »Vermutlich.«
»Ich glaube, du solltest noch mal von vorn anfangen. Erzähl mir, wann und wie das geschehen wird.«
»Wie, das weiß ich nicht – aber schon sehr bald. Dürfte noch vor dem Hochsommer anfangen, vermute ich. Auf jeden Fall vor dem Winter.« Sie hielt inne, dachte kurz nach und nickte dann. »Ja, auf jeden Fall vor dem ersten Schneefall, und nächstes Jahr um diese Zeit stecken wir in den größten Schwierigkeiten. Dann wird es sich entscheiden, wenn der Sturm am schlimmsten tobt.«
»Also wird ein Sturm über uns hereinbrechen?«
Das Mädchen blinzelte, runzelte die Stirn, verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Kein wirklicher Sturm, nur eine sehr schlimme Sache. Obwohl …« Sie zuckte mit den Achseln. »Es könnte auch ein Sturm sein, vermute ich.«
»Und du hast keine Ahnung, was dies auslösen oder warum so eine schlimme Sache passieren wird?«
»Nein – überhaupt nicht«, sagte die Seherin, als ob solche Details völlig unwichtig wären.
Persephone lehnte sich im Stuhl zurück und musterte das Mädchen. Ein trauriger Fall, ein einsames, verängstigtes Waisenkind. »Warum bist du wirklich hier, Suri? Hast du Hunger? Fühlst du dich einsam, jetzt, wo Tura tot ist?«
Suri wirkte verwirrt.
»Es ist schon in Ordnung. Ich werde jemanden finden, bei dem du übernachten kannst. Du bekommst auch ein wenig Brot. Möchtest du ein wenig Brot?«
Die Seherin dachte einen Augenblick nach. »Ein Stück Brot wäre nett.«
»Und möchtest du hier wohnen? Hier im Dahl?«
Suri starrte sie entsetzt an und wich einen Schritt zurück. Ihr ängstlicher Blick glitt wieder nach oben unter das Dach, und sie schüttelte mit Nachdruck den Kopf. »Nein, Herrin. Ich könnte niemals hier leben. Ich bin nur hergekommen, weil Tura es mir aufgetragen hat. Wenn ich jemals so etwas vorhersehe, soll ich euch aufsuchen, das hat sie mir gesagt. ›Geh zu dem Hügel auf dem großen Feld in der Waldmitte und bitte darum, den Stammesführer zu sprechen.‹ Nicht, dass wir im Augenblick irgendetwas tun könnten. Ich muss mit den Bäumen reden. Sie könnten uns mehr erzählen, aber sie schlafen noch.«
Persephone seufzte. Auch Tura war auf ihre Art exzentrisch gewesen. Aber mit ihr hatte man wenigstens reden können.
Ich kann das Reglan überlassen. Vielleicht wird er schlau aus ihr.
»Also dann, vielen Dank.« Persephone stand auf und schenkte ihr ein Lächeln. »Ich werde dafür sorgen, dass du das versprochene Brot bekommst, und dann kannst du mit meinem Ehemann über die Sache sprechen, sobald er zurückkommt. Du kannst hier in der Halle warten, wenn du möchtest.« Als sie sah, dass das Mädchen einen weiteren Schritt zurückwich, fügte sie hinzu: »Oder auf der Treppe, wenn dir das lieber ist.«
Suri nickte, drehte sich auf dem Absatz um und verließ die Halle. Ihr Wolf folgte ihr auf den Fersen.
So dünn.
Persephone war sich sicher, dass es sich bei der Prophezeiung um eine List handelte. Eine pfiffige Idee, aber das Mädchen hatte es übertrieben. Sie hätte es schlichter halten sollen – eine schlechte Ernte, schweres Fieber oder eine Dürre. Sie war zu jung und hatte das Ganze nicht bis zum Ende durchdacht. Jetzt, wo Tura tot war, hatte sie allein im Wald nicht die geringste Überlebenschance.
»Suri?«, rief Persephone ihr im letzten Moment nach. »Du solltest besser niemandem erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Du weißt schon, das mit dem Sterben.«
Das Mädchen drehte sich um und legte eine Hand auf einen der Winterstämme. »Warum?«
»Weil sie es nicht verstehen werden. Sie werden glauben, dass du lügst.«
»Tue ich aber nicht.«
Persephone seufzte. Auch noch stur.
Suri ging noch ein paar Schritte in Richtung Tür, dann hielt sie inne und drehte sich ein letztes Mal um. »Ich bin nicht Tura. Aber ich weiß, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Unsere einzige Hoffnung ist jetzt, auf den Rat der Bäume zu hören. Achte auf die Blätter, Herrin, achte auf die Blätter.«
In diesem Augenblick ertönte Cobbs Horn zum zweiten Mal.
Persephone war kaum aus dem Langhaus ins Freie getreten, da wusste sie schon, dass etwas Schlimmes geschehen war. Feld- und Gartenhacken lagen verlassen und vergessen in den Gärten. Die Killian-Brüder waren von ihrem Dach herabgesprungen, und die Menschen des Dahls hasteten zum Tor oder warfen sich weinend auf die Knie. Wer weinte, der gab seinen Schmerz an diejenigen weiter, die bislang nur verwirrt gewesen waren. Die Nachricht, nur im Flüsterton übermittelt, ließ sie entsetzt den Kopf schütteln. Dann weinten auch sie.
Persephone bereitete sich innerlich auf den nahenden Sturm vor, als wäre er ein echtes Unwetter, das sie mit Regen und Donner über das Feld auf das Dorf zukommen sah. Sie hatte schon viele Stürme überstanden. Zwanzig Jahre lang hatte sie ihrem Ehemann geholfen, ihr Volk zu führen. Sie hatte sich dem Langen Winter gestellt und der Großen Hungersnot, die ihm gefolgt war. Sie hatte ihren ersten Sohn bei der Geburt verloren, den zweiten an eine Krankheit, und vor gerade einmal drei Tagen nun auch den einzigen, der erwachsen geworden war. Mahn war ein wundervoller junger Mann gewesen, dem die Götter unverständlicherweise den Schutz versagt hatten. Was immer durch das Tor auf sie zukommen würde, Persephone würde es überstehen wie all die anderen Prüfungen zuvor. Sie musste es. Wenn nicht für sich selbst, dann für ihr Volk.
Am Tor hatte man beide Torflügel zur Seite gewuchtet, doch der Blick nach draußen wurde durch die Menschen versperrt, die sich auf dem Weg drängten. Mehrere waren die Leitern zur Mauer hinaufgeklettert und zeigten hinaus. Persephone erreichte die Stufen zum Langhaus in dem Augenblick, als die Menge sich teilte und ihr Geheimnis freigab.
Die Jagdgesellschaft war zurückgekehrt.
Acht Männer waren losgezogen. Sechs kamen heim. Einer von ihnen auf einem Schild.
Sie trugen Reglan durch das Tor – zwei Männer auf jeder Seite, und Konniger ging voran. Einer seiner Hemdsärmel war abgerissen und um seinen Kopf gewickelt, der einst helle Stoff blutverschmiert. Adler, der seit jeher einen scharfen Blick gehabt hatte, kehrte mit nur einem seiner beiden Augen zurück. Von Hegners rechter Hand war nicht mehr als ein blutiger Stumpf übrig geblieben.
Persephone ging die Stufen nicht hinunter. Der Sturm hatte sie erreicht, und es gab keinen Grund weiterzugehen.
Was sie am härtesten traf, war nicht das Entsetzen über den Tod ihres Ehemanns, sondern dass ihr diese Szene so vertraut erschien. Persephone fragte sich, ob sie vielleicht den Verstand verlor und einfach die Ereignisse vor drei Tagen noch einmal durchlebte – als sie ihren Sohn zurückgebracht hatten. Auch er war auf die Jagd gegangen. Auch ihn hatte man auf einem Schild nach Hause getragen. Sie erinnerte sich, zur exakt gleichen Tageszeit am exakt gleichen Ort gestanden zu haben.
Aber es ist nicht dasselbe.
Als Mahn heimkehrte, hatte ihr Ehemann an ihrer Seite gestanden. Er hatte ihre Hand gehalten, und seine Kraft hatte dafür gesorgt, dass sie nicht zusammengebrochen war. Reglan hatte geglüht vor Zorn, und der Druck seiner Finger um ihre war fast zu stark. Noch am selben Tag war er aufgebrochen, um Rache zu nehmen.
Die Träger näherten sich den Stufen. Grimmige Mienen wichen ihrem Blick aus. Nur einer besaß den Mut, ihr in die Augen zu sehen. Die Menge scharte sich um den Gefallenen und seine Begleiter.
»Wir bringen dir deinen Ehemann zurück«, sagte Konniger. »Reglan aus dem Hause Gath, Stammesführer von Dahl Rhen, ist heute im Kampf gefallen.«
Seine Worte ließen die Menge verstummen. Die Fahnen des Langhauses über Persephone knatterten im Wind. Es war ihre Aufgabe, dies anzuerkennen, wie ihr Ehemann den Tod Mahns anerkannt hatte – ihres Jungen. Reglan hatte die Würde bewahrt und Verständnis gezeigt, während er ihre Hand in seiner zerquetschte. Persephone hatte keine Hand, an der sie sich festhalten konnte, und ihr fehlte jegliches Verständnis. Stattdessen fragte sie: »Was ist mit dem Bären?«
Die Frage traf Konniger unerwartet, daher antwortete er nicht gleich. Er nahm sich einen Augenblick Zeit und fuhr mit der blutverschmierten Hand über die Verletzung an seinem Gesicht. »Das ist kein Bär. Das Ding, das wir gejagt haben, ist ein Dämon. Menschen können ein solches Ding nicht töten.«
3
Der Gottestöter
Sie nannten ihn den Gottestöter. Es waren Händler auf dem Weg nach Norden, die uns zum ersten Mal von ihm berichteten. Seine Legende wuchs mit jedem Tag, doch am Anfang glaubte niemand daran. Außer mir.
– Das Buch Brin
Raithe mochte ein gutes Lagerfeuer. Es lag etwas Beruhigendes in den tänzelnden Schatten, dem Duft des Rauchs und in der widersprüchlichen Empfindung, dass sein Gesicht und seine Brust warm waren, der Hintern aber kalt. Raithe empfand diese Doppelseitigkeit, genau wie die zuckenden Flammen selbst, als Mysterium. Der Feuergeist sprach zu ihm mit funkelndem Fauchen und beißendem Rauch, aber was er damit auszudrücken versuchte, blieb ihm ein Rätsel. So war alles in der Natur. Alles redete mit ihm – mit jedem – in einer Sprache, die nur die wenigsten verstanden. Was für Weisheiten, Gräuel und Geheimnisse sich ihm wohl offenbaren würden, wenn er nur wüsste, was das alles bedeutete?
»Einer der wenigen Geister, mit denen ich mich recht gut verstehe«, sagte Raithe und warf einen weiteren Ast in die Flammen.
»Mit wem?«, fragte Malcolm. Der ehemalige Sklave, der nun sein Mitflüchtling war, saß neben Raithe, wie er den Wind im Rücken, um keinen Rauch abzubekommen. Er war gerade dabei, an der Decke zu nesteln, die er um den Hals gelegt hatte. Der Stoff war so dünn, dass man ihn knoten konnte, und wenn sie unterwegs waren, trug Malcolm sie wie eine Schärpe.
»Dem Feuer«, sagte Raithe und griff nach einem weiteren Ast aus dem kleinen Vorrat, den sie sich zusammengesucht hatten. Er zerbrach ihn und warf ihn in die Flammen.
»Du hältst das Feuer für einen Geist?«
Raithe hob eine Augenbraue. »Was denn? Hältst du es etwa für einen Dämon?« Das hatte er schon mal gehört, vor allem von seinem Nachbarn, der sein brennendes Kochfeuer unbeaufsichtigt gelassen hatte, um zum Pinkeln an den Fluss zu gehen. Als der Mann zurückkehrte, brannte sein Dunghaus lichterloh. »Schon möglich«, sagte Raithe. »Es kann ziemlich garstig sein, wenn man kein Auge darauf hat, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich ein Dämon so leicht herbeirufen lassen würde. Schon gar nicht von Leuten wie mir.«