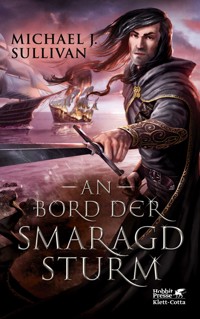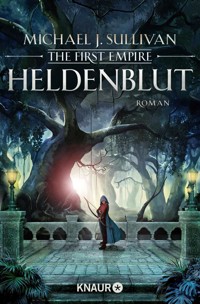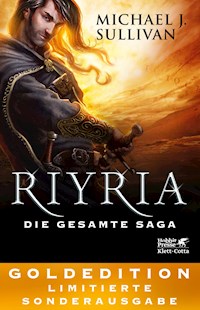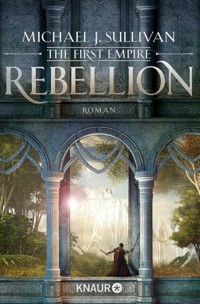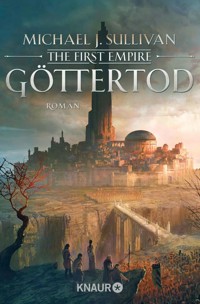
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Zeit der Legenden
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Michael J. Sullivan kehrt mit dem dritten Band der packenden High-Fantasy-Saga "Zeit der Legenden" zurück in die Welt der falschen Götter: mythisch, magisch, mitreißend! Die Zeit der Rache ist gekommen: Ausgestattet mit den mächtigen Waffen vom Volk der Dherg und angeführt von ihrem Helden, dem Göttertöter Raithe, gehen die Clans der Menschen zum Angriff über. Tatsächlich gelingt ihnen ein überraschender Sieg gegen ihre falschen Götter, die Fhrey – bis diese mit all ihrer magischen Macht zum vernichtenden Gegenschlag ausholen. In der Stunde der größten Not werden alte Abmachungen infrage gestellt und neue Bündnisse geschmiedet, und die Seherin Suri greift zu einer verzweifelten Maßnahme. Denn wenn alle Hoffnung verloren ist, werden neue Helden geboren. Doch zu welch furchtbarem Preis? Magie und Mythen, Abenteuer, Verrat und Liebe – meisterhafte epische Fantasy eines großen Geschichtenerzählers! Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Göttertod
The First Empire IIRoman
Aus dem Englischen von Carina Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Zeit der Rache ist gekommen: Ausgestattet mit den mächtigen Waffen vom Volk der Dherg und angeführt von ihrem Helden, dem Göttertöter Raithe, gehen die Clans der Menschen zum Angriff über. Tatsächlich gelingt ihnen ein überraschender Sieg gegen ihre falschen Götter, die Fhrey – bis diese mit all ihrer magischen Macht zum vernichtenden Gegenschlag ausholen. In der Stunde der größten Not werden alte Abmachungen infrage gestellt und neue Bündnisse geschmiedet, und die Seherin Suri greift zu einer verzweifelten Maßnahme. Denn wenn alle Hoffnung verloren ist, werden neue Helden geboren. Doch zu welch furchtbarem Preis?
Inhaltsübersicht
Der Weg zum Krieg
Vor den Bronzetoren
Der Rhist
Keenigsrat
Der Riese und der Kobold
Der Zweitbeste
Träume und Albträume
Die Hexe von Tetlin
Der Töpfer
Der Herr des Rhist
Monster in der Dunkelheit
Der Zeuge
Avempartha
Haus der Knochen
Durch ein schmales Fenster
Entzünde das Feuer
Das Signal
Der Wettlauf beginnt
Auf in den Kampf
Die Schlacht von Grandford
Opfer
Der Holzstoß von Perdif
Im Kype
Das erste Licht der Morgendämmerung
Die Kunst des Krieges
Der Schmetterling und das Versprechen
Malcolm
Wölfe auf der Türschwelle
Der Ritter in glänzender Rüstung
Der Drache
Abschied
Die Nachricht
1
Der Weg zum Krieg
Jahrhundertelang war das Leben unverändert gewesen. Dann kam der Krieg, und nichts war je wieder, wie es einst war.
– Das Buch Brin
Suri, die Seherin, sprach mit Bäumen, tanzte zum Klang von Windspielen, hasste es zu baden, heulte den Mond an und hatte jüngst einen Berg dem Erdboden gleichgemacht, womit sie in einem einzigen Augenblick Jahrhunderte der Zwergenkultur ausgelöscht hatte. Sie hatte es hauptsächlich aus Trauer getan, aber teilweise auch aus Wut. Ein Zwerg hatte sich nach dem Tod von Suris bester Freundin taktlos verhalten. Er hätte mitfühlender sein sollen, doch Suri war in den Tagen danach klar geworden, dass sie mehr Selbstbeherrschung hätte an den Tag legen können. Vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen, Gronbach einfach nur in Brand zu setzen oder den elenden Wicht vom Erdboden verschlucken zu lassen. Ihr war zu jenem Zeitpunkt keine der beiden Möglichkeiten in den Sinn gekommen, und so hatte ein ganzes Volk leiden müssen. Es war ein schlechter Tag für alle Beteiligten gewesen.
Beinahe eine Woche später erwachte Suri auf einem Feld inmitten von Salifan, Greiskraut und Kratzdistel, als die Sonne gerade über die fernen Hügel lugte. Die goldenen Sonnenstrahlen verwandelten Tautropfen in Diamanten und offenbarten die Arbeit Tausender Spinnen, die ihre Netze zwischen den Grashalmen gewebt hatten. Da sie die Nacht draußen verbracht hatte, war auch Suri durchnässt und ziemlich durchgefroren, doch der Kuss der Sonne versprach Besserung. Sie saß inmitten des Taus, die Sonne im Gesicht, lauschte dem leisen Summen der Hummeln, die ihre frühmorgendliche Arbeit begannen, und schaute auf die Felder, die den Küsten-Dahl umgaben. Dann flog ein Schmetterling durch ihr Blickfeld und machte alles zunichte.
Suri begann zu weinen.
Sie senkte ihren Kopf nicht. Sie hielt ihr Gesicht weiterhin in die Sonne und ließ die Tränen ihre Wangen hinabrinnen, auf das Gras tropfen, sich mit dem Tau vermischen. Ihr kleiner Körper zitterte und bebte. Suri weinte, bis keine Tränen mehr übrig waren, doch der Schmerz zerrte noch immer an ihrem Herzen. Schließlich saß sie einfach nur mit gebeugten Schultern und schlaff herabhängenden Armen auf dem Feld, während ihre Finger nach dem warmen Fell tasteten, das nicht da war.
Seitdem sie von jenseits des Meeres zurückgekehrt war, begannen die meisten Tage wie dieser. Die Morgenstunden boten eine kurze Atempause vom Schmerz, doch allzu schnell erinnerte sie sich wieder daran, und die Realität holte sie ein. Dann wurde der Himmel weniger blau, die Sonne schien nicht annähernd so hell, und noch nicht einmal die Blumen konnten sie zum Lächeln bringen. Und es gab einen weiteren Verlust, dem sie sich stellen musste. Arion lag im Sterben.
»Suri!«
Sie reagierte träge, realisierte nur langsam, dass es ihr Name war, der gerufen wurde. Irgendwo hinter ihr raschelte das Gras, und stapfende Schritte näherten sich. Das rasche Tempo der Schritte ließ keinen Zweifel daran, dass es sich nur um eine Person handeln konnte, und das konnte nur eins bedeuten.
»Suri!«, rief Brin noch einmal.
Die Seherin machte sich nicht die Mühe, sich umzudrehen. Sie wollte nicht sehen – wollte nicht konfrontiert werden mit –
»Sie ist wach!« Diesmal brüllte Brin.
Suri wirbelte herum.
»Ihre Augen sind offen.« Brin rannte, stürzte durch das hohe Gras, durchnässte dabei ihren Rock.
Jeder Muskel in Suris Körper erwachte. Sie sprang auf wie ein aufgeschrecktes Reh und sprintete an Brin vorbei auf die Straße zu. Schon war sie an dem Zelt angekommen, das Roan eigens für die Miralyith aufgebaut hatte. Als Suri hineinstürzte, lag Arion noch immer auf der Pritsche, doch ihre Augenlider flatterten. Padera half ihr gerade dabei, sich aufzusetzen, um zu trinken.
»Kleine Schlucke«, herrschte die alte Frau sie an. »Ich weiß, du willst es runterkippen wie eine Trinkerin, aber glaub mir, es wird gleich wieder hochkommen und dich vollsauen – und mich ebenso. Dir mag das egal sein, mir aber nicht.«
Suri stand unter der Zeltplane am Eingang und starrte. Ein Teil von ihr wollte ihren Augen nicht trauen. Sie hatte Angst, dass es nur ein Traum war, und befürchtete, dass sich die Illusion, sobald sie sich ihrer völlig hingab, in Luft auflösen und der Schmerz doppelt so stark über sie hereinbrechen würde. Sie wusste nicht, wie viele Rückschläge sie noch überleben könnte.
»Entweder rein oder raus – entscheide dich!«, fuhr Padera sie an. Die alte, zahnlose Frau, deren Lippen sich nach innen über ihr bloßes Zahnfleisch wölbten, blinzelte mit ihrem gesunden Auge gegen das blendende Sonnenlicht an.
Suri trat einen Schritt vor und ließ die Zeltplane wieder hinter sich herunterfallen. Die Lampe brannte nicht, doch das Sonnenlicht schien hell durch die Stoffwände. Arion lehnte an Paderas Schulter. Die alte Frau half der Fhrey, einen Keramikbecher an ihre Lippen zu halten. Arion sah mit erschöpftem Blick über den Rand des Bechers und schlürfte laut.
»Gut, gut, das ist erst mal genug«, sagte Padera. »Wir schauen mal, wie du das verträgst. Wenn es unten bleibt und nicht wieder aus dir rausschießt wie bei einem Geysir, gebe ich dir mehr.«
Der Becher wurde weggenommen, und Suri wartete.
Arions Stimme – Suri musste sie hören, um sicherzugehen, um es wahr werden zu lassen.
Die Fhrey versuchte etwas zu sagen, doch es gelang ihr nicht. Sie deutete entschuldigend auf ihren Hals.
Suri geriet in Panik. »Was fehlt ihr?«
»Nichts«, brummte Padera. »Na ja, nichts, außer dass sie beinahe eine ganze Woche lang geschlafen hat, ohne zu essen oder zu trinken. Deshalb ist sie so trocken wie der Staub, zu dem sie fast selbst wurde.« Padera schüttelte einmal leicht den Kopf, während sie die Fhrey mit verwundertem Gesichtsausdruck ansah. »Sie hat so wenig Wasser zu sich genommen, dass sie tot hätte sein müssen. Egal, ob Mann, Frau, Kind, Hase oder Schaf – jeder andere wäre bereits vor drei Tagen gestorben. Aber natürlich ist sie nichts davon, nicht wahr?«
Einmal mehr durchflutete Sonnenlicht den Raum und blendete alle. Brin stand im Eingang und hielt die Plane hoch. Sie sagte nichts, schaute nur vom Zelteingang herüber.
»Entweder rein oder raus – entscheide dich!«, blafften Suri und Padera im Chor.
»Entschuldigung.« Brin trat ein und ließ die Plane hinter sich herabfallen.
Alle beobachteten Arion. Die Fhrey hob langsam den Kopf, sah Suri an und lächelte. Arion streckte eine zitternde Hand aus. Das reichte. Suri fiel auf die Knie und stellte fest, dass sie doch noch Tränen übrig hatte. Sie vergrub ihr Gesicht an Arions Hals. »Ich hab’s versucht, ich hab’s versucht, ich hab’s versucht …«, brachte Suri zwischen Schluchzern hervor. »Ich wusste nicht, was ich tat. Ich öffnete eine Tür und fand einen dunklen Fluss. Ich folgte ihm bis zu einem Licht, einem wunderschönen und doch schrecklichen Licht. Ich … ich … ich habe versucht, dich zurückzuholen, dich zu retten, aber … aber …«
Sie spürte, wie Arions Hand über ihren Kopf streichelte.
Suri sah auf.
»Nicht … versucht«, krächzte Arion mit einer Stimme, die rau wie Kies klang. Dann formte sie das Wort geschafft mit dem Mund.
Suri rieb sich die Augen und blinzelte. »Was?«
Mit noch größerer Anstrengung sagte die Fhrey: »Du … hast … mich … gerettet.«
Suri starrte sie weiter an. »Bist du dir sicher?«
Arion lächelte. »Ziemlich … sicher.«
Raithe weigerte sich zu sitzen. Sich hinzusetzen, würde sich zu sehr danach anfühlen, als akzeptierte er diesen Irrsinn. Die übrigen Stammesführer, die sich selbst als Keenigsrat bezeichneten, saßen im Hof von Dahl Tirre wie gewohnt im Kreis zusammen. Vier Stühle waren hinzugefügt worden: drei für die Stammesführer der Gula-Clans und ein kunstvoll verzierter Sitz mit geschnitzten Armlehnen für Persephone. Gavin Killian, der fruchtbare Vater vieler Söhne und neue Stammesführer von Clan Rhen, saß auf Persephones altem Stuhl.
Nyphron hatte sich ebenfalls nicht gesetzt. Er stand und sprach. Persephone nickte, als der Galantianer innehielt.
Sie zieht das nicht wirklich in Betracht, oder doch?
Neben den zehn Stammesführern waren die meisten der üblichen Anwesenden da, außer Brin, die persönliche Hüterin der Wege der Keenigin. Raithe hatte sie zuletzt gesehen, als sie auf dem Weg zu Paderas Zelt gewesen war, in dem sich Arion befand. Manche nannten es das Haus des Todes, da die Miralyith seit fast einer Woche kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Weitere anwesende Nicht-Stammesführer waren Moya, Persephones allgegenwärtiger Schild mit ihrem berühmten Bogen, der Zwerg namens Frost, der immer für Roan einsprang und über den Fortschritt bei der Waffenherstellung berichtete, Malcolm, der es sich einfach zur Gewohnheit gemacht hatte aufzutauchen, und Nyphron, der die Fhrey repräsentierte. So sah Raithe Nyphrons Rolle – er war die Stimme einer kleinen Kriegertruppe. Doch da Raithe nur sich selbst und Tesh vertrat, konnte er dem Galantianer einen Platz im Rat nicht streitig machen.
Zumindest sollte ich das nicht, aber ich bin es nicht, der irrsinnige Vorschläge macht, die alle umbringen werden.
»Wir müssen Alon Rhist einnehmen, und zwar sofort«, wiederholte Nyphron. Es war keine Frage oder ein Vorschlag, kein Rat oder eine Meinungsäußerung. Der Anführer der Fhrey forderte die Zustimmung der anderen ein.
Raithe schwieg normalerweise während der Versammlungen, und er fand, dass Nyphron aus demselben Grund ebenfalls den Mund halten sollte: Sie repräsentierten praktisch niemanden. Aber Raithe gefiel der Ausdruck auf Persephones Gesicht nicht. Ihre Miene zeugte davon, dass sie Nyphrons Worte sorgfältig abwog.
Keiner der anderen Stammesführer besaß den Mut, den Anführer der Fhrey zu hinterfragen, also musste Raithe etwas sagen. Das Fehlen vernünftiger Waffen war der Grund gewesen, aus dem er es ursprünglich abgelehnt hatte, Keenig zu werden, und Nyphron wollte den Rhist einnehmen, bevor sie überhaupt Zeit zur Vorbereitung gehabt hatten. Persephone hatte das Geheimnis zur Bearbeitung von Eisen aus Belgreig mitgebracht, doch es würde lange dauern, genug Waffen für eine Armee herzustellen.
»Dein Leichtsinn zeigt, warum Persephone Keenig ist und nicht du«, sagte Raithe laut zu Nyphron, womit er die Aufmerksamkeit auf sich zog. »Du bist ein Fhrey. Die Leben von Rhunes sind dir egal. Du denkst nur ans Gewinnen. Wie viel Blut vergossen wird, damit du deine Ziele erreichst, interessiert dich nicht – denn es wird ja nicht euer Blut sein. Es ist Selbstmord, Alon Rhist anzugreifen, bevor wir ordentlich ausgebildet sind und anständige Waffen haben. Hunderte, wenn nicht Tausende könnten auf diesen Mauern sterben. Und dann –«
»Niemand wird sterben«, antwortete Nyphron in einem überlegenen Ton, als spräche er mit einem Schwachsinnigen.
Raithe trat einen Schritt auf ihn zu. »Wenn wir eine der wehrhaftesten Festungen der Welt mit Bauern angreifen, die nur mit Mistgabeln bewaffnet sind, werden Männer sterben. Viele Männer.« Raithe wandte sich den anderen Stammesführern zu. »Ihr wart doch schon in Alon Rhist, oder?« Er zeigte auf Nyphron. »Ist es nicht vollgestopft mit einer ganzen Armee von Fhrey-Kriegern wie ihm? Diese Mauern anzugreifen ist, als würde man mit einem Stock gegen ein Bienennest schlagen, und hätte denselben Effekt. Nur, dass diese Bienen nicht bloß stechen. Sie schlagen euch die Köpfe mit ziemlich scharfen Bronzeschwertern ab, während sie sich hinter riesigen Schilden verstecken.«
Persephone hatte ihre Aufmerksamkeit jetzt auf ihn gerichtet, hörte ihm zu.
Wenigstens etwas.
»Ich verlange von niemandem, hier zu kämpfen.« Nyphron richtete sich an Persephone statt an Raithe. »Eure Leute müssen noch nicht einmal in die Nähe des Rhist kommen. Sie werden lediglich einem dekorativen Zweck dienen, sie sind sozusagen eine Verzierung.« Nyphron begann, auf und ab zu gehen. »Diese Festung ist mein Zuhause. Sie gehört mir. Mein Vater war der Anführer der Instarya-Sippe, dem Volk, das seit Jahrhunderten in dieser Festung lebt. Er war der Oberbefehlshaber aller westlichen Außenposten. Diese Position fällt nach dem Tod des Vaters gewöhnlich dem Sohn zu, was mich zum Herrn des Rhist macht.«
»Aber der Fhan – der Anführer eures Volkes – hat einem anderen den Oberbefehl übertragen, nachdem dein Vater ihn herausgefordert hat, nicht wahr?«, fragte Tegan vom Warric-Clan.
Danke, Tegan. Wenigstens eine Person passt auf.
»Das ist wahr«, antwortete Nyphron. »Aber dieser Fhrey wird von meiner Sippe nicht besonders gemocht, und die Instarya wurden jahrhundertelang unverschuldet schlecht behandelt, entfremdet und verbannt. Sie brauchen einen Anführer, der ihr Leid versteht und das an ihnen begangene Unrecht wiedergutmachen kann.« Nyphron seufzte. »Denkt ihr, das wäre nur so eine unüberlegte Idee, die mir heute Morgen gekommen ist? Ich habe nun schon seit einiger Zeit an diesem Plan gearbeitet. Ich weiß, wie Alon Rhist einzunehmen ist. Und ich kann es schaffen, ohne dabei ein einziges Leben zu verlieren.«
»Das ist unmöglich«, sagte Raithe. »Wir müssen –«
Nyphron verdrehte die Augen. »Erlaube mir, zu erklären, warum wir sofort handeln müssen. Ich werde es in kurzen Sätzen und einfachen Worten tun. Im Moment stellt der Fhan seine eigenen Streitkräfte auf. Er wird seine Truppen an der Grenze zusammenziehen müssen, um uns anzugreifen. Seine besten Soldaten sind die Instarya-Sippe – mein Brethren – und ihr Hauptsitz ist Alon Rhist. Die Instarya sind die besten Krieger der Welt, ohne sie hat der Fhan keine Truppen. Ich plane, ihm seine Stärke zu stehlen, aber wir müssen schnell handeln. Lothian darf Alon Rhist nicht zuerst erreichen.« Nyphron näherte sich Persephone. »Ich kann die gesamte Instarya-Sippe von Ervanon bis Merredydd aus dem Spiel nehmen. Damit werden dem Fhan die Hände gebunden sein. Er wird keine Armee haben, die für ihn kämpft.«
»Werden sie für uns kämpfen?«, fragte Siegel.
Nyphron sah den Gula-Rhune-Stammesführer an, als wäre er ein Kind. »Natürlich nicht. Fhrey töten keine Fhrey, aber wenn ihr tut, was ich sage, werde ich dafür sorgen, dass sie auch keine Rhunes töten. Und ohne seine Kriegersippe wird der Fhan andere ausbilden müssen. Das« – er zeigte auf Raithe, ohne ihn anzusehen –»wird uns Zeit geben, Waffen herzustellen, was wir hinter den Mauern des Rhist besser bewerkstelligen können.« Nyphron begann, an seinen Fingern abzuzählen. »Alon Rhist hat Werkzeuge, Werkstätten, bietet Schutz und Nahrung, alles, was wir benötigen, um die Art von Streitmacht auf die Beine zu stellen, die wir brauchen, um uns dem unausweichlichen Angriff des Fhans entgegenzustellen.«
»Aber wie nehmen wir es ein?«, fragte Tegan.
»Überlasst das einfach mir.«
»Siehst du, genau das ist mein Problem«, sagte Raithe. »Du erwartest von uns, dir zu vertrauen?«
Nyphron fuhr sich frustriert mit der Hand über das Gesicht. »Deine Zweifel spielen keine Rolle. Die Rhunes werden absolut sicher sein. Ich will keinen von ihnen näher als eine Viertel Meile am Rhist. Ich und meine Galantianer werden die Festung einnehmen. Ich will nur, dass ihr vor Ort seid.«
»Bist du dir sicher, dass die Rhunes nicht werden kämpfen müssen?«, fragte Persephone.
»Korrekt. Ihr und eure Leute sollt an der Schlucht auf der anderen Seite des Bern-Ufers in den Hochebenen Dureyas stehen. Ist das zu viel verlangt?«
Persephone sah Raithe an.
»Du kannst nicht auf ihn hören«, sagte Raithe. »Das ist Irrsinn. Er kann keine ganze Festung mit nur sieben Leuten einnehmen. Entweder er ist wahnsinnig, oder es ist eine Falle. Wartet wenigstens, bis wir tausend Schwerter und Schilde haben.« Er wandte sich an Frost. »Wie lange wird das dauern?«
Der Zwerg pustete die Haare seines Barts und Schnauzers aus dem Weg, um zu sprechen. »Wir haben ein Dutzend gute Männer ausgewählt, die lernen wollen und können, aber die Vorgehensweise und das System machen uns immer noch Probleme. Roan hat den Schwertschmieden sehr genau bei der Herstellung eines Eisenschwerts zugesehen, aber ihr sind anscheinend trotzdem einige Details entgangen. Wir arbeiten also noch am Herstellungsprozess – aber wir sind bald so weit. Sobald wir alle Arbeitsschritte kennen, werden unsere zwölf Männer jeweils einen Schmied in jedem Dorf in Rhulyn ausbilden. Und diese Schmiede werden wiederum Lehrlinge aufnehmen, um die Anzahl der Lernenden weiter auszuweiten. Wenn das System erst einmal perfektioniert ist und Leute ausgebildet wurden, wird die Arbeit nicht lange dauern. Das Problem ist, es ins Rollen zu bringen.« Er rieb sich das Kinn. »Ich schätze, wir könnten eine kleine Armee in … einem Jahr ausrüsten.«
»Na also«, sagte Raithe. »Und in der Zwischenzeit können wir Männer ausbilden, um –«
»Bis dahin wird es zu spät sein«, sagte Nyphron. »Der Fhan wird seine Kontrolle über die Grenze noch vor dem Winter festigen. Es ist ein Wettlauf, und wir haben schon zu viel Zeit verloren. Abgesehen davon gibt es in der Festung einen guten Schmied, und auch einige Bewohner der Stadt besitzen hervorragende Schmieden und Werkzeuge. Außerdem« – der Fhrey sah Persephone an –, »wo sollen die Leute aus Rhen überwintern? Hier? Wird euch diese Mauer vor den eisigen Winden schützen?« Er sah zu Lipit hinüber. »Habt ihr Platz für sie im Inneren der Stadtmauern?«
Persephones Augen verdunkelten sich.
Sie entglitt Raithe. Er verlor sie an ihn, was es noch schlimmer machte.
»Wenn wir es auf meine Art machen, stellen wir sicher, dass wir uns verteidigen können, wenn etwas schiefgehen sollte«, verkündete Raithe. »Wenn er seine absurden Versprechen nicht einhält –«
Nyphron lächelte, als er Raithe ins Wort fiel. »Und wenn wir es auf meine Art machen, gewinnen wir diesen Krieg.«
Raithe funkelte Nyphron an, doch der Fhrey weigerte sich eisern, auch nur in seine Richtung zu schauen. Er musterte weiterhin Persephone.
»Wann würdest du mit dem Angriff auf Alon Rhist beginnen wollen?«, fragte sie.
»Unverzüglich«, sagte Nyphron. »Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet.« Er deutete mit einer weit ausholenden Geste auf die Mauern und Häuser des Dahl. »Während wir hier sitzen und reden, tut der Fhan gerade wer weiß was.«
»Ich würde mich besser fühlen, wenn wir etwas künstlerische Unterstützung hätten.« Persephone sah zu Raithe hinüber. »Falls etwas schiefgeht. Aber Arion kann nicht transportiert werden, und Suri wird sie nicht verlassen.«
»Wir brauchen keinen Miralyith, um Alon Rhist einzunehmen, und wir können es uns nicht leisten zu warten«, sagte Nyphron. »Es ist wahrscheinlicher, dass Arion stirbt, als dass sie sich erholt, und dieses seherisch begabte Kind ist keine Künstlerin. Es wird nichts ändern, auf Arions Tod zu warten.«
Brin raste in den Hof, und alle Köpfe wandten sich ihr zu. Sie bewegte sich so schnell, dass sie nur schlitternd zum Stehen kam. Ein breites Lächeln ließ sie bis über beide Ohren strahlen. »Arion ist aufgewacht!«
Sie waren keine Armee – weit davon entfernt.
Die Menschheit hatte im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Weg eingeschlagen. Suri war sich sicher, dass sie Regenfälle mit einer geringeren Anzahl an Tropfen gesehen hatte als die Anzahl der nordwärts ziehenden Menschen. Und obwohl Suri keine Expertin auf diesem Gebiet war, nahm sie an, dass sogar die schlechteste Armee bewaffnet war, ganz im Gegensatz zu diesem Haufen. Es waren Schäfer, Bauern, Gerber, Jäger, Holzfäller, Fischer, Brauer und Händler. Die meisten besaßen keine Waffen. Sie trugen Taschen und Körbe. Die zerfledderte Heerschar, aus der diese Möchtegernarmee bestand, hatte schon Mühe, in einer Reihe zu gehen. Sie beschwerten sich außerdem über die Geschwindigkeit, die Straße und die Sonne – oder deren Abwesenheit, wenn es regnete. Die meisten Frauen waren zu Hause gelassen worden, außer jene aus Dahl Rhen, die keinen Ort hatten, an dem sie hätten bleiben können. Diejenigen unter ihnen, die keine kleinen Kinder hatten, gingen neben ihren Männern her und trugen Bündel mit Essen und Kleidung. Der Großteil der Schar befand sich vor dem Wagen, auf dem Suri und Arion saßen. Alle marschierten die Straße entlang, die an Dahl Rhen vorbeiführte, derselbe Weg, den sie vor einer gefühlten Ewigkeit in die entgegengesetzte Richtung gewandert waren.
Arion und Suri saßen inmitten von Fässern, Säcken, Töpfen und Wolle und wurden jedes Mal durchgeschüttelt, wenn die Wagenräder über Unebenheiten im Boden holperten. Die Fhrey hatte erklärt, sie sei gesund genug, um zu reisen, aber nicht für den langen Marsch. Padera und Gifford, die bei der Völkerwanderung als Köche fungierten und sich außerdem um Arion kümmerten, fuhren mit ihnen. Da es Nyphrons Wunsch war, schnell voranzukommen, hatten die beiden Sitzplätze auf dem Wagen ergattert.
Suri fuhr gewöhnlich nicht im Wagen mit, sah aber regelmäßig nach Arion und hielt manchmal nachmittags ein Nickerchen zwischen den Säcken. Niemand hinterfragte ihr Recht darauf. Niemand sprach wirklich viel mit ihr.
Gerüchte über ihren Vorfall im Land der Zwerge hatten die Runde gemacht. Und obwohl Suri schon immer aufgrund ihrer Rolle als Außenseiterin und Seherin angestarrt worden war, wurden die neugierigen und missbilligenden Blicke nun von Angst abgelöst. Die Leute beschleunigten oder verlangsamten ihre Schritte oder schlugen gar eine andere Richtung ein, um ihr nicht zu nahe zu kommen. Da Persephone, Moya, Roan und die Zwerge alle beschäftigt waren, waren Padera, Gifford und Brin nun die Einzigen, die mit Suri sprachen. Alle anderen behandelten sie, als wäre sie giftig.
Ich habe es immer gemocht, allein zu sein, erinnerte sie sich. Es ist mir lieber so. Zu viele Leute an einem Ort – das ist nicht normal. So ist es besser. Doch sie war nicht allein. Suri war von Leuten umgeben, gehörte aber nicht dazu. Sie war das Gänseblümchen zwischen lauter Narzissen, die Fliege in der Ziegenmilch, der Schmetterling in der Armee.
Suri drehte sich um und betrachtete die Bäume zu ihrer Linken, einen ansteigenden Hang, belaubte Äste, die sich an dunklere, kieferbedeckte Bergkämme drängten. Sie kannte diese Linie, wo die Bäume anstiegen, und auch diese Kurve in der Straße. Direkt dahinter lag ein Fluss, und wenn sie den nächsten Hügel überquert hatten, würden sie die gesamte Fläche des Waldes sehen – den Sichelwald.
»Wir sind fast zurück«, sagte Suri. Sie prüfte den Stand der Sonne. »Gegen Mittag werden wir da sein. Wie fühlst du dich?«, fragte sie Arion. »Wir werden langsam gehen. Kein Grund zur Eile.«
Arion, die aufrecht saß und in ein dünnes Tuch gewickelt war, sah verwirrt aus. »Gehen wir woanders hin als die anderen?«
»Ja, ins Weißdorntal. Nach Hause.«
»Aber Persephone – ich dachte, wir wären auf dem Weg nach Alon Rhist.« Arion wirkte jetzt leicht verärgert.
»Sie geht dorthin, wir gehen heim«, sagte Suri. »Du wirst es lieben, Arion. Der Garten ist sicher ein einziges Chaos, aber ich werde mich darum kümmern. Du wirst nichts tun müssen, außer dich auszuruhen und stärker zu werden. Wir werden schwimmen gehen!«
»Suri, ein Krieg zieht herauf«, sagte Arion. Suri glaubte, dass die Stimme der Fhrey ihre Gesundheit widerspiegelte, und Arions Stimme war immer noch viel zu zittrig und schwach.
»Ja.« Sie sah zu den Männern mit Mistgabeln und Hacken über den Schultern hinüber. »Und im Tal werden wir davon gar nichts mitbekommen. Wir werden sicher und glücklich sein. Fast wie in alten Zeiten – wie es mit Tura war.«
Persephone wollte, dass Suri und Arion zur Fhrey-Festung gingen, aber Suri fand nicht, dass das besonders angenehm klang. Stattdessen hatte sie sich einen besseren Plan ausgedacht. Die beiden würden auf dem Wagen bis zum Sichelwald fahren, dann abspringen und zu Fuß ins Weißdorntal gehen. Arion war immer noch schwach, also würden sie langsam gehen und oft anhalten. Das mochte den ganzen Tag dauern, aber wenn sie erst einmal angekommen waren, würde Suri Arion den schönsten Ort der Welt zeigen: das kleine Tal, in dem das Sonnenlicht goldener, das Wasser süßer war und wo die verschiedenen Vogelarten harmonisch miteinander sangen. Suri wusste, dass es Arion gefallen würde, und an diesem wundersamen Ort würde die Fhrey ihre einstige Stärke zurückerlangen, und dann –
»Suri?« Arion starrte sie an. »Bist du bereit, darüber zu sprechen?«
Suri sah weg, konzentrierte sich auf den Wald, als ihr Zuhause langsam hinter dem Hügel sichtbar wurde.
»Wirst du mir sagen, was passiert ist?«, fragte Arion.
»Was meinst du?«
»Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir unter einem Berg gefangen waren. Wir hatten eine Abmachung, du und ich. Da ich hier bin, muss ich annehmen, dass du deinen Teil der Abmachung nicht eingehalten hast. Denkst du nicht, es ist an der Zeit, darüber zu sprechen?«
Padera verlagerte unbehaglich ihr Gewicht. »Du solltest dich ausruhen«, sagte die alte Frau.
Arion ignorierte sie und konzentrierte sich weiter auf Suri.
Der Sichelwald zeigte sich in einem vornehmen Kleid von tiefstem Sommergrün. Einen Kontrast dazu bildeten die umliegenden Felder, die in hellem Gold mit orangenen, gelben und violetten Sprenkeln leuchteten. Vögel stießen im Sturzflug herab, Bienen flitzten umher, und über allem zogen helle, weiße Wattewolken sorglos dahin.
»Wirst du mir nicht erzählen, was mit Minna passiert ist?«
Als sie den Namen hörte, löste Suri ihren Blick von dem wunderschönen Bild, sah die Fhrey aber weder an, noch sagte sie ein Wort.
»Suri, ich bin keine Idiotin.«
»Das habe ich auch nicht behauptet.«
»Warum, Suri? Warum hast du es getan?«
Suri senkte ihren Kopf, ihre Lippen waren trotzig zusammengekniffen. Sie wollte dieses Gespräch nicht führen – nicht jetzt, nicht mit Arion, mit niemandem jemals.
»Du hast sie geliebt«, sagte Arion.
»Tu ich immer noch.« Die Worte rutschten ihr heraus.
Eine schwache, zitternde Hand berührte Suris Handgelenk, lange, dünne Fhrey-Finger rieben sanft darüber. »Ich wollte, dass du mich tötest, nicht sie.«
»Ich weiß.«
»Suri … ich kann nicht mit dir nach Hause gehen.«
Suri entzog sich ihr, faltete ihre Hände vor sich und sah wieder zum Wald hinüber. Die riesige grüne Fläche füllte im Westen ihr gesamtes Blickfeld aus. Während Suri zusah, wie sie an ihnen vorbeizog, dachte sie: Es sieht so merkwürdig klein aus. War das schon immer so?
»Du kannst auch nicht gehen«, sagte Arion. »Das weißt du doch, oder? Du bist jetzt ein Schmetterling – mehr noch, als ich es je erwartet hätte. Die Tage, in denen du Blätter gegessen hast, sind vorbei. Die Blumen brauchen dich. Dein Zuhause ist nicht das Weißdorntal, Suri, es ist der Himmel. Du kannst dich nicht verstecken. Du musst fliegen. Du musst allen die Schönheit dieser Flügel zeigen.«
Suri zog die Stirn in Falten und kletterte von dem langsam fahrenden Wagen herunter. »Ich glaube, ich würde jetzt lieber laufen.«
Sie ließ den Wagen an sich vorbeirollen und fand sich am Ende der langen Kolonne wieder. Ruhig war es hier, weniger hektisch, und sie genoss das Gefühl ihrer Füße auf dem vertrauten, aber leider zertrampelten Gras. Obwohl sie jetzt am hintersten Ende ihres Zuges lief, entdeckte Suri, dass sie nicht allein war. Raithe stapfte durch die weichen Rillen, die die Wagenräder hinterließen. Er hatte seinen Leigh Mor gefaltet und ihn kürzer und weiter geknotet, wie die meisten Männer es zu dieser Jahreszeit zu tun pflegten. Dadurch kam mehr von seinen haarigen Armen und Beinen zum Vorschein – pelzig war das Wort, das Suri bei dem Anblick in den Sinn kam. Er sah in ihre Richtung, sagte aber nichts, und die beiden verfielen in stillen Gleichschritt.
Sie liefen schweigend nebeneinander her, bis sie den Weg kreuzten, der zum Dahl Rhen führte. Suri glaubte nicht, dass sie sich dem Dahl aus dieser Richtung genähert hatte, seit dem Morgen, nachdem Grinsie die Braune getötet worden war. Sie und Raithe wurden langsamer. Beide betrachteten den unscheinbaren Weg, nur ein schmaler Pfad, der sich durch hohes, braunes Gras wand. Ein Stück weiter standen die zertrümmerten Überreste einer Mauer, einer Hütte und eines Brunnens – Überbleibsel der Vergangenheit, die einen Wendepunkt dargestellt hatte.
»Schon komisch, wie es dein ganzes Leben verändern kann, wenn du dich dazu entscheidest, eine Richtung einzuschlagen anstatt einer anderen.« Raithe gelang es, ihre eigenen Gedanken in Worte zu fassen. »Ich hätte wahrscheinlich besser nicht diesen Weg nehmen sollen.«
Ein Teil von Suri stimmte ihm von ganzem Herzen zu. Wenn sie in jenem Frühling nicht nach Dahl Rhen gegangen wäre, wäre Minna noch am Leben und sie beide würden jetzt einen weiteren gemeinsamen Sommer genießen. Natürlich wären alle anderen vermutlich tot, wenn sie nicht gegangen wäre.
Sind schlimme Dinge überhaupt real, wenn ich nichts davon weiß?
Suri seufzte und fragte sich, ob Raithe mit ihr oder nur mit sich selbst gesprochen hatte. Sie war auch nicht ganz sicher, zu wem sie sprach, als sie sagte: »Das Schlimmste ist, dass ich immer noch nicht sagen kann, ob es sich gelohnt hat.«
Sie tauschten einen wissenden Blick und folgten dann den Wagen in größerer Entfernung, fielen zurück, ließen die Welt davondriften.
»Ich wünschte, ich wäre auf dem Weg nach Hause.« Suri kickte einen losen Stein ins hohe Gras.
»Ich wünschte, das wäre ich nicht«, sagte Raithe. Er schaute zu ihr herüber. »Ich bin sicher, deins ist viel schöner.« Er zeigte auf den Wagen vor ihnen. »Wie geht es Arion?«
»Sie nervt.« Suri erwartete, dass er überrascht reagieren und nach dem Grund fragen würde. Stattdessen nickte Raithe nur, als würde er alles verstehen. »Ich wollte, dass sie mit mir nach Hause in den Wald kommt, in das Tal, in dem ich früher gelebt habe. Ich dachte, wir könnten dort glücklich sein, aber sie besteht darauf, dass wir Teil dieses Krieges sein müssen.«
»Hört sich verdammt nach Persephone an.«
»Wirklich?«
Raithe nickte. »Hört mir nicht zu. Aber Nyphron. Ihm hört sie zu. Wir ziehen gegen die Fhrey in den Krieg, und wessen Rat nimmt sie an?«
»Also willst du auch nicht zu diesem Rhist-Ort gehen?«
»Ich fände es besser, wenn wir alle in deinem Tal wären.« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und starrte hinauf zur brennenden Sonne, als ob er mit ihr streiten würde. »Kann man dort schwimmen?«
Suri lächelte. »In einem klaren See mit Schwänen.«
»Gibt’s was zu essen?«
»Mehr als genug.«
»Hört sich perfekt an.«
»Ist es«, sagte sie und meinte es ernst.
»Da drüben, oder?«, fragte er und zeigte auf den Einschnitt im Wald.
»Jap«, antwortete sie. »Den Hügel dort hinauf, nach links und dann ins Tal hinein. Wir könnten leicht vor Einbruch der Nacht da sein. Keinem würde auffallen, dass wir fort sind.«
Die beiden betrachteten die Wagen und die lange Menschenkolonne, die sich wie eine Schlange nach Norden wand und dabei eine Staubwolke aufwirbelte. Niemand schaute zurück, und selbst wenn jemand es getan hätte, wären Suri und Raithe von der Wolke verdeckt gewesen. Sie hätten ungesehen davonschlüpfen und sich für immer in Luft auflösen können. Der Krieg würde weitergehen, aber ohne sie.
Sind schlimme Dinge überhaupt real, wenn ich nichts davon weiß?
Sie blieben beide stehen, standen unbewegt in der Mitte der Straße und lauschten den sich entfernenden Wagengeräuschen.
»Was meinst du?«, fragte Suri.
Raithe seufzte, dann schüttelte er den Kopf. »Wir können sie nicht im Stich lassen. Und es kommt mir dumm vor, auf einmal mit dem Schlausein anzufangen.«
Suri nickte. »Ja. Du hast vollkommen recht. Du musst die weiseste aller –« Sie verstummte, ertappt und beschämt. Alles hatte sich so vertraut angefühlt, dass die Worte einfach aus ihr herausgesprudelt kamen, wie sie es immer getan hatten, als würde sie mit jemand anderem sprechen, mit …
Suri begann zu weinen. Sie fühlte sich schuldig und hasste sich selbst dafür, Minnas Andenken so leichtfertig betrogen zu haben.
Raithe blieb schweigend stehen, wartete neben ihr, ohne sie zu verurteilen.
Da umarmte Suri ihn. Sie dachte gar nicht darüber nach. Sie musste etwas umarmen, und er war da. Suri rechnete damit, dass er sich abwenden würde, aber er tat es nicht. Stattdessen spürte sie, wie sich seine Arme um sie legten, sie sanft umschlossen, sie festhielten. Raithe sagte nichts, und sie wusste, dass es genauso sein sollte zwischen Freunden.
2
Vor den Bronzetoren
Alon Rhist war nur eine der sieben Fhrey-Festungen, die unsere Grenzen bewachten. Aber es war mehr als nur der Hauptsitz der Instarya-Sippe und das Grab eines lange verstorbenen Fhans. Alon Rhist war die Personifizierung der Macht der Fhrey und der Absurdität, diese infrage zu stellen.
– Das Buch Brin
Raithe zog Persephone auf den letzten Felsvorsprung. Sie hätte allein hinaufklettern können, und keiner der anderen Stammesführer hatte Hilfe gebraucht oder sie angeboten bekommen, doch sie nahm seine an. Persephone dachte, dass es am besten wäre, sich solche Sonderbehandlungen gefallen zu lassen, so lange sie es sich erlauben konnte – wohl wissend, dass sie nicht immer so großzügig damit würde umgehen können. Zumindest rechtfertigte sie es so vor sich selbst, aber sie wusste auch, dass sie abgewunken hätte, wenn die Geste von jemand anderem gekommen wäre.
Raithe war mutig, fähig und gut aussehend, wie er seinen Leigh Mor so mit lässiger Gleichgültigkeit trug. Der junge Dureyaner war ein beliebtes Thema bei den Frauen, machte sich aber nichts aus ihren Avancen. Doch was er wirklich wollte, konnte sie ihm nicht geben. Persephone war noch immer mit ihrem verstorbenen Ehemann verheiratet, auf eine Art und Weise, die sie nicht in Worte oder Gedanken hätte fassen können. Gefühle hatten ihre eigene Sprache, die sich nicht immer übersetzen ließ.
Raithe und Persephones Ehemann hatten nichts gemeinsam. Reglan, der beinahe dreißig Jahre älter gewesen war als sie, war mehr ein Vater, Lehrer oder Führer für sie gewesen. Mit Raithe war sie nun die Weise, die ruhige Hand, die das Steuer führte. Und trotzdem fühlte Raithes Hand sich gut an – sicher, warm und stark. Sie war Keenigin, Stammesführerin der zehn Stämme und oberste Herrscherin von Millionen, doch sie brauchte immer noch mehr als das. Macht konnte Respekt nicht ersetzen, Hingabe konnte Freundschaft nicht ersetzen, und nichts konnte die allumfassende Wärme von Liebe ersetzen. Raithe liebte sie wirklich, er wollte sie, und auch wenn sie ihm seinen Wunsch nicht erfüllen konnte – jedenfalls noch nicht –, gefiel ihr der Gedanke. Das Geschenk seines Verlangens nach ihr war ein weiteres dieser unmöglich in Worte zu fassenden, schwer greifbaren Gefühle. Leidenschaft war etwas Wildes, Egoistisches, das keine Grenzen und keine Vernunft kannte, doch ohne sie war das Leben sinnlos.
»Wie habt ihr das hier genannt?« Sie sah sich um, spürte den Empfindungen nach, die die natürliche Felssäule, die sich sechs Fuß hoch über die Ebene erhob, in ihr auslöste.
»Kummerfelsen«, antwortete Raithe.
Persephones Magen kribbelte angesichts der zu allen Seiten steil abfallenden Säule, die viel zu klein war, um sich darauf wohlfühlen zu können. Sie nickte. »Verständlich.«
Persephone lief in einem engen Kreis einmal um die Spitze herum, wobei sie mit den Füßen über den Borden schlurfte, zu ängstlich, um sie zu heben. Die Angst zu fallen war unbegründet, solange sie nichts Verrücktes tat. Der Felsen war hier oben so flach wie ein Tisch, doch sie vertraute sich selbst nicht. Stolpern ist keine Option, es sei denn, fliegen wäre eine.
Persephone war noch nie eine Freundin großer Höhen gewesen. Als Kind hatte sie schon in jungen Jahren aufgehört, auf Bäume zu klettern, und war ihren Dachdeckerpflichten entkommen, indem sie stark übertriebene Krankheiten vorgetäuscht hatte. Als sie nun auf dem Kummerfelsen stand und auf die walnussgroßen Köpfe aller versammelten Rhulyn-Clanmitglieder hinuntersah, wurde ihr schwindelig. Wie habe ich nur jemals den Mut aufgebracht, den Wasserfall im Sichelwald hinunterzuspringen? Dieser Vorfall schien eher Jahrzehnte als nur wenige kurze Monate zurückzuliegen.
Wölfe, erinnerte sie sich. Ja, ein Wolfsrudel auf meinen Fersen hat mir damals den nötigen Ansporn gegeben.
Persephone beobachtete bewundernd, wie Suri zu ihnen heraufkletterte, als läge die Felskuppe nur einen Fuß über dem Boden. Die junge Frau war mehr als nur unerschrocken, sie wirkte regelrecht gelangweilt.
Von ihrem Standpunkt aus konnte Persephone meilenweit sehen. »Hast du irgendwo hier in der Nähe gelebt?«, fragte sie Raithe.
Er zeigte Richtung Nordosten.
Der Großteil Dureyas war eine staubige Hochebene, ein einziger großer Felsen, der von schroffen Felsformationen wie der, auf der sie gerade standen, durchzogen wurde. Als Persephone in die Richtung sah, in die Raithe deutete, erkannte sie einen schwarzen Fleck auf der sonst einheitlich hellen Ebene.
»Das war mein Dorf, Clempton«, sagte Raithe. »Siebenunddreißig Gebäude, vierzig Familien und fast zweihundert Personen.« Er starrte weiter, ohne zu blinzeln, ein harter, brutaler Blick. Persephone fragte sich, was er wohl dachte, und stellte sich dann vor, wie sie selbst die Ruinen von Dahl Rhen betrachtete.
Sie legte eine Hand auf seinen Arm. Ihre Berührung riss ihn von dem Anblick los, und er schenkte ihr ein gezwungenes Lächeln.
Alle Rhulyn-Stammesführer waren bei ihr auf der Felskuppe, während die Gula-Anführer bei ihren Männern geblieben waren, die sich strategisch zwischen den Absenkungen und Spalten der Dureyanischen Hochebene aufgestellt hatten. Nyphron hatte sie in der Nacht zuvor positioniert, mit der Erklärung, er kenne die toten Winkel des Wachturms von Alon Rhist. Persephone hatte seine Anweisungen noch einmal wiederholen müssen. Die Gula nahmen keine Befehle von Fhrey entgegen. Sie waren ein ungezähmtes und grausames Volk, wenig mehr als ein Rudel wilder Tiere – hilfreich, wenn man so etwas gerade brauchte, schier unerträglich, wenn nicht.
Persephone zwang sich, vorsichtig näher an die Kante heranzutreten, um einen besseren Blick auf die Welt unter ihr zu bekommen. Eine steile, zerklüftete Schlucht bildete die nördliche Grenze des gelben Hochlands. Von ihrem Standpunkt aus hatte sie die Form einer Kurve, das an ein Stirnrunzeln erinnerte. Über den Grund dieser Schlucht, die den Namen Grandford trug, strömte der Fluss Bern, der seit Anbeginn der Zeit das Ende Rhulyns und den Anfang des Fhrey-Territoriums markierte. Irgendwo unterhalb des Kummerfelsens führte ein ausgetretener Pfad, kaum mehr als eine Kreidemarkierung auf der offenen Ebene, von Dureya Richtung Norden zur Schlucht. Die undeutliche Linie endete an einer weißen Steintreppe, die zu einer Brücke führte. Dieser Brückenbogen, der die beiden Seiten der Schlucht wie ein einzelner Faden in einer offenen Wunde miteinander verband, war über Meilen hinweg der einzige Ort, an dem der Fluss sicher zu überqueren war. Auf der anderen Seite befanden sich die Stadt und Festung von Alon Rhist, mit ihrer riesigen Kuppel und dem hoch aufragenden Wachturm, geschützt von massiven Steinmauern und zwei unüberwindlichen Bronzetoren.
Als sie mit Reglan verheiratet gewesen war, hatte Persephone diese aus Stein gemeißelte Brücke jedes Jahr überquert. Und jedes Mal hatte sie in Schrecken versetzt.
Wir waren eingeladen, aber ich hatte trotzdem Angst.
»Sie sind an der Treppe«, verkündete Tegan. Der Stammesführer von Clan Warric sah aus wie ein zu groß geratener Zwerg mit gepflegtem, dunklem Haar und einem gekämmten Bart. Er besaß einen sarkastischen Humor und scharfen Verstand und war zu einem von Persephones engsten Beratern geworden. Als Tegan nach unten wies, sahen alle, die sich auf dem Kummerfelsen befanden, zur Grandford-Brücke hinüber.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass du das hier mitmachst.« Raithe schüttelte den Kopf und sah zum Himmel hinauf.
»Nyphron weiß, was er tut«, sagte Persephone und bemühte sich, zuversichtlicher zu klingen, als sie sich fühlte. Ihre Hände hatten sich zu Fäusten geballt. Persephone zwang sich, die Finger zu öffnen, und versuchte ihre Schultern zu entspannen.
»Was, wenn er falschliegt? Was, wenn sie ihn umbringen?«, fragte Raithe.
»Darauf sind meine Leute nicht vorbereitet«, sagte Harkon. »Die meisten von Clan Melen haben nur Hacken und Mistgabeln bei sich. Wir können nicht kämpfen.«
»Sollte es dazu kommen, ziehen wir uns zurück. Wir haben bereits einen beträchtlichen Vorsprung«, sagte Persephone.
»Und Nyphron?«, fragte Harkon. »Wenn es nicht gut läuft, wird er sich dann auch zurückziehen?«
»Ich glaube nicht, dass Nyphron oder seine Galantianer mit diesem Konzept vertraut sind«, sagte Tegan. »Sie denken immer, sie würden gewinnen.«
»Dann hoffen wir, dass sie einen guten Grund dafür haben.« Persephone drückte den Rücken durch. Sie musste sich immer wieder selbst ermahnen, gerade zu stehen. Schon ihre Mutter hatte sie stets wegen ihrer schlechten Haltung getadelt. Niemand wird die Frau eines Stammesführers respektieren, wenn sie sich zusammenkrümmt wie ein Troll. Ihrer Mutter wäre wohl nie in den Sinn gekommen, dass Persephone selbst einmal Stammesführerin, geschweige denn Keenigin sein würde, doch Persephone schätzte, dass ihr Rat auch dafür gelten konnte.
»Es gibt für alles ein erstes Mal«, sagte Krugen.
»Dann betet, dass es nicht dieses Mal ist.«
Nyphron hatte Wort gehalten und keinen einzigen Menschen aufgefordert, die Brücke mit ihm zu überqueren. Persephones Armee befand sich auf der anderen Seite des Bern, außer Sichtweite der Fhrey. Die Gula waren noch weiter entfernt – weiter als eine Meile – und hatten sich am Bergrücken der Hochebene formiert. So hatte Nyphron es gewollt. Persephone hoffte, dass er es so eingerichtet hatte, um ihnen genug Zeit zu geben, sich zu zerstreuen, sollte etwas schiefgehen. Doch Tegan hatte recht: Galantianer verstanden das Konzept einer Niederlage nicht. Auch Persephone glaubte, dass Nyphron mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit sein eigenes Versagen voraussah, wie er mit einem Tag ohne Sonnenaufgang rechnete.
Von ihrem Aussichtspunkt auf dem Kummerfelsen konnte Persephone sehen, wie sich die Galantianer Alon Rhist näherten. Die kleine Fhrey-Truppe wirkte dabei wie eine Reihe von sieben Ameisen. Sie erreichten die Brücke und machten sich ohne Zögern daran, sie zu überqueren.
Um besser sehen zu können, machte Persephone einen Schritt nach vorne und vergaß dabei – wenn auch nur für einen Augenblick –, dass sie in der Nähe eines tödlichen Abgrunds stand. Raithe packte sie am Arm und erinnerte sie damit wortlos an die Gefahr und seine Sorge um sie. Sie warf ihm einen raschen Blick zu, und Raithe ließ sie los. Er wirkte peinlich berührt.
Harkon, der Stammesführer von Clan Melen, schüttelte bewundernd den Kopf. »Furchtlos.«
»Verrückt«, murmelte Krugen, der sich neben feiner Kleidung einzig und allein fürs Schlafen interessierte – Letzteres tat er allzu oft, wobei er viel zu laut schnarchte, als dass er es hätte geheim halten können.
»Warum hält sie niemand auf?«, fragte Lipit.
»Aus demselben Grund, aus dem man abwartet, wenn man Hasen fängt«, antwortete Raithe. »Du musst sicher sein, dass du sie wirklich in der Schlinge hast, bevor du sie zuziehst.«
Persephones Hände ballten sich wieder zu Fäusten, und sie ahmte, sehr zum Leidwesen ihrer toten Mutter, erneut einen Troll nach.
»Was ist das?« Krugen zeigte auf etwas.
»Seht ihr das?«, fragte Harkon. »Auf der Ebene – auf unserer Seite!«
»Noch mehr Fhrey«, sagte Raithe.
Persephone sah sie auch. Zwei Dutzend Krieger in Bronzerüstungen waren aus dem Nichts aufgetaucht und schnitten Nyphron den Rückweg ab.
»Wo sind die hergekommen?«, fragte Tegan.
»Risse«, erklärte Raithe. »Die Felsen da draußen sind überall durchzogen von Spalten und Kluften. Du kannst hineinklettern, dich mit einer schlammfarbenen Decke zudecken, und ein Feind wird einfach an dir vorbeigehen. Wir haben das ständig gemacht.«
»Müsste Nyphron nicht davon wissen?«, fragte Krugen.
»Da haben wir’s – doch nicht so schlau, wie er denkt«, schloss Raithe in düsterem, selbstgerechtem Ton. Persephone wusste, dass sein Frust sich gegen Nyphron richtete, aber sie spürte, wie er auch auf sie überschwappte. Immerhin war sie es gewesen, die diese Mission abgesegnet hatte. Die Gefühlskälte seines harten Urteils verletzte sie, weil er recht gehabt und sie ihm nicht zugehört hatte.
»Glaubt ihr, dass sie das eingeplant haben?« Alward von den Nadak flehte, als ob die auf dem Felsen versammelten Personen Wünsche erfüllen könnten.
»Die Galantianer?«, sagte Tegan mit skeptischer Miene. »Die planen gar nichts. Voraussicht zerstört das Abenteuer, wie ich gehört habe.«
Alward zog die Stirn in Falten, sein Mund stand immer noch leicht offen, seine Schultern hingen herab.
Persephone machte einen weiteren Schritt nach vorn. Einmal mehr griff Raithe nach ihrem Arm.
Das erste Mal war schlimm genug gewesen, das zweite Mal war völlig unangebracht. Persephone wollte ihn gerade zurechtweisen, als sie nach unten sah und erkannte, dass sie weniger als einen Fuß vom Rand entfernt war. Sie sog kurz und scharf die Luft ein und wich zurück.
»Wir können’s uns nicht leisten, dich und die Galantianer an einem Nachmittag zu verlieren«, sagte Raithe.
Die Galantianer verlieren? Der Gedanke, so unmöglich er auch schien, nahm zum ersten Mal Gestalt an. Was, wenn sie getötet oder festgenommen werden? Was passiert dann mit ihnen? Was passiert mit uns?
Persephone sah hinab auf ihr Volk, Hunderte Menschen in der Nähe und Tausende in der Ferne. Sie drehte sich um, um sich zu vergewissern, dass Suri noch da war. Das Mädchen hatte einen Berg dem Erdboden gleichgemacht, also sollte sie in der Lage sein, sie vor ein paar hundert Fhrey zu beschützen. Deshalb war sie hier auf dem Felsen, deshalb hatte Persephone darauf bestanden, dass sie mitkam. Doch Persephone wusste im Grunde nichts darüber, wie Magie funktionierte, wozu Suri wirklich in der Lage war. Und die Seherin hatte sich Arions Abscheu dem Töten gegenüber zu eigen gemacht. Eine gute Sache, wie Persephone sich oft sagte, doch in diesem Moment war sie sich nicht mehr so sicher.
Sie sah zu dem schwarzen Fleck auf der Ebene, dem Dorf, das einst das Heim von vierzig Familien gewesen war, und sie fragte sich, ob sie ihren ersten und letzten Fehler als Keenigin der Zehn Stämme gemacht hatte.
Das eingerollte Banner fest in der rechten Hand, führte Nyphron seine Galantianer über die Grandford-Brücke auf die Bronzetore zu. Die gekreuzten Speere, das Symbol des ehemaligen Fhans Alon Rhist, sahen von ihrem Platz in vierzig Fuß Höhe über dem Eingang finster auf sie herab. Sie wären verdammt schwer zu entfernen gewesen, doch der Umstand, dass Petragar es nicht einmal versucht hatte, verdeutlichte den Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Herrscher des Rhist und Nyphron selbst – einen der vielen Unterschiede. Allein Ferrol wusste, wie lang diese Liste wäre, sollte sich jemals jemand die Mühe machen, sie beide ausführlich miteinander zu vergleichen. Nyphron ging davon aus, dass er und Pertragar nicht einmal ihr Essen auf dieselbe Weise kauten. Wären ihre Rollen vertauscht gewesen, hätte Nyphrons eigenes Symbol Rhists Zeichen ersetzt. Nyphron besaß noch kein eigenes Symbol, aber das würde sich bald ändern – ein Drache oder vielleicht ein Löwe. Etwas Grimmiges, etwas Mächtiges, etwas Angemessenes. Alle großen Anführer mussten ihre Spuren auf der Welt hinterlassen, und er hätte seine längst in diese Mauer gemeißelt.
»Ihr hättet nicht zurückkommen sollen«, sagte Sikar, der – flankiert von zwei Wachen – auf der anderen Seite der Brücke stand. Er war in voller Rüstung, als rechnete er damit, dass es Ärger geben würde. Zudem trug er das rot gefiederte Wappen am Helm, was darauf hinwies, dass der Speerkommandant seit der Verbannung der Galantianer in der Rangordnung aufgestiegen war.
»Wir konnten einfach nicht länger wegbleiben.« Tekchin warf Sikar Kusshändchen zu. »Wir haben euch zu sehr vermisst.«
Sikar runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Der Hauptmann des Rhist war nicht in der Stimmung für Scherze. »Du bist ein Idiot, Tekchin.« Sein Blick glitt zu Grygor und blieb kurz an der Holzkiste hängen, die der Riese trug, dann wanderte er weiter zu dem Banner in Nyphrons Hand. »Kapitulation oder Waffenstillstand?«
Elysan, ein älterer Fhrey, der ein enger Freund und Berater von Nyphrons Vater gewesen war, stand an Sikars rechter Seite und antwortete zuerst. »Waffenstillstand. Seit wann geben die Galantianer sich geschlagen?«
Sikars Augen waren weiterhin auf Nyphron gerichtet. »Weißt du, üblicherweise schwenkt man die weiße Flagge, bevor man sich nähert. Nicht, dass es irgendetwas helfen würde. Der Fhan hat euch verbannt – Ferrols Gesetz beschützt euch nicht mehr.« Es lag eine schreckliche Ernsthaftigkeit in seinem Ton und genug Bedauern in seinen Augen, dass Nyphron beschloss, es im Hinterkopf zu behalten.
Tekchin gluckste und verschränkte die Arme vor der Brust. Nyphron hatte befohlen, dass keiner von ihnen seine Waffen auch nur anrühren durfte, und Tekchin machte wahrscheinlich gerade eine Art Entzug durch. »Also ist das jetzt deine große Chance, deine Spielschulden bei mir loszuwerden, oder?«
»Das ist kein Witz!«, brüllte Sikar. »Sie werden –«
Über ihren Köpfen wurden Hörner geblasen, und die Tore öffneten sich.
»Still jetzt«, sagte Tekchin. »Dein Chef kommt. Aber keine Angst. Ich werd ihm nichts verraten.«
Sikar sah nicht verärgert, sondern traurig aus. Er schüttelte langsam den Kopf und seufzte.
»Entspann dich, Sikar«, sagte Nyphron zu ihm. »Ich bin jetzt wieder da. Ich werde alles wiedergutmachen.«
»Sie werden euch hinrichten – das versteht ihr doch, oder?«
Nyphron lächelte nur.
Aus dem Tor ergoss sich eine Kohorte Instarya-Krieger. Nyphron musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass noch mehr davon ihnen den Rückweg abschnitten. Er vermutete, dass Petragar den gesamten Ersten Speer nach draußen beordert hatte, um sie willkommen zu heißen. Diese Machtdemonstration war mehr als ein Kompliment, sogar mehr als ein Beweis für Petragars Feigheit. Es war genau das, was Nyphron brauchte.
Die Krieger schwärmten zu beiden Seiten der Brücke hin aus, füllten rasch die freie Fläche vor den Toren und verwehrten ihnen den Zutritt. Nyphron hatte nicht vor, auch nur einen einzigen Schritt weiterzugehen. Er hatte dieses Treffen bis auf den Steinblock geplant, auf dem er stand, und, was noch wichtiger war, die Fläche, auf der die Instarya sich versammelt hatten. Nach Jahrhunderten kannte Nyphron jeden Schwachpunkt und Beobachtungsposten.
Petragar war der Letzte, der nach draußen kam. Mutig ist er ja.
An seiner Seite watschelte Vertumus, der Abgesandte des Fhans. Der beleibte Gwydry hatte es irgendwie geschafft, sich seinen Posten in der Wildnis von Avrlyn zu verdienen – entweder indem er in der Rangordnung aufgestiegen oder weil er beim Fhan in Ungnade gefallen war. Vertumus hatte Petragar begleitet, als dieser gekommen war, um Nyphrons toten Vater als Herrn des Rhist abzulösen. Alles, was Nyphron über den Mann wusste, war seine Beteiligung an dem Plan, Rapnagar und die anderen Riesen zu schicken, um Dahl Rhen zu zerstören und Nyphron, Arion und Raithe umzubringen. Was für ein Gespann – der Junge und sein Wiesel.
»Nyphron, Sohn des Zephyron«, begann Vertumus, »du wurdest –«
»Halt’s Maul«, befahl Nyphron. »Ich bin nicht den ganzen Weg hierhergekommen, um mit dir zu sprechen.«
Petragars Augen weiteten sich. »Du hast kein –«
»Ich bin auch nicht hier, um mit dir zu sprechen, du Sohn von Tetlins Hexe.«
Petragar schien verwirrt von der rhunischen Beleidigung, von Nyphrons Tonfall und … von so ziemlich allem. Das war einfach genau die Art von Fhrey, die er war. Während er die anderen ansah, in der Hoffnung, sie würden ihm helfen zu verstehen, betrachtete Nyphron die versammelten Gesichter seiner Familie. Er kannte sie alle.
Nyphrons Vater war ein Tyrann gewesen, was seinen Sohn anging. Zephyron, Herr von Alon Rhist und Oberbefehlshaber aller westlichen Außenposten, ließ Nyphron keine Privilegien oder besondere Behandlung zukommen. Sein Sohn war gezwungen gewesen, mit den anderen Instarya in den Kasernen zu schlafen, und er hatte seine Mahlzeiten im Gemeinschaftsspeisesaal einnehmen müssen. Nyphron war durch denselben Schlamm marschiert und hatte Seite an Seite mit den niedersten Soldaten gekämpft und geblutet. Damals hatte er sich beschwert, aber jetzt, als er auf der Grandford-Brücke stand, dankte er seinem Vater im Geist. Es war erst das zweite Mal, dass er das tat. Das erste Mal war der Moment gewesen, als Zephyron sich während des Uli Vermar hatte töten lassen.
»Ich bin heimgekehrt, um mit meinen Brüdern zu sprechen.« In dem Moment, in dem er das sagte, stellte Grygor die Kiste auf den Boden, und Nyphron sprang darauf. »Instarya!«, rief er von seiner erhöhten Position aus und schwang das noch immer eingerollte Banner wie einen Dirigentenstab, mit dem er eine Symphonie von Augen dirigierte. »Der Herr von Alon Rhist ist zurückgekommen. Ich komme als Befreier, um euch von der Tyrannei, die ihr unter der Führung von Schwachköpfen und Feiglingen erleidet, zu erlösen.«
»Wie kannst du es wagen!« Petragar schrie beinahe, seine Stimme glich einem Kreischen, das seine Autorität perfekt untergrub. »Du bist ein –«
»Viel zu lange haben wir unter den Demütigungen und Erniedrigungen eines Fhans gelitten, der uns nicht respektiert, der uns nicht wertschätzt, der uns nicht liebt.« Nyphron hatte keine Mühe, Petragars Gequieke zu übertönen. Der Anführer der Galantianer hatte eine gute Sprechstimme: laut, tief, selbstbewusst.
»Du bist ein Verräter!«, rief Petragar. »Und der Sohn eines Verräters!«
Ohne ihn anzusehen, entschied sich Nyphron, auf seine Anschuldigung zu antworten, hauptsächlich, weil sie sich so gut in seine Rede einfügte. Er hatte keine Hilfe erwartet, schon gar nicht von Petragar, doch Nyphron nahm sie gerne an, wenn sie angeboten wurde. »Mein Vater gab sein Leben für seine Sippe, im Dienste seines Volkes, um sie aus ihrem Exil zu befreien, aus dem Schlamm und Blut, unter dem nur wir zu leiden gezwungen sind. Wir kämpfen und sterben, während die Miralyith, Umalyn, Nilyndd, Eilywin und Gwydry die Früchte unserer Opfer ernten. Sogar den Asendwayr ist es erlaubt, über den Nidwalden zurückzukehren. Nur die Instarya sind aus unserer angestammten Heimat verbannt. Warum ist das so?«
»Weil es die Entscheidung des Fhans ist, nicht eure«, rief Petragar. Seine Stimme klang dünn und durchdringend.
»Ganz recht!« Nyphron begann wirklich, Petragars Unterstützung wertzuschätzen. Dieser Trauerkloß von einem Fhrey hatte die unerwartete Gabe, ihn gut aussehen zu lassen, ein Geschenk, das Nyphron mehr liebte als alle anderen. »Weil der Fhan verfügt hat, dass wir – wir, die wir die größte Bürde zu tragen haben – mit Verachtung und Erniedrigung belohnt werden sollen. Diejenigen unter euch, die in Estramnadon waren, die Zeuge der Herausforderung meines Vaters wurden, können das bezeugen. Waren das die Taten eines ehrenhaften Fhans, der sein Volk respektiert? Oder benahm er sich wie ein Tyrann, der seine Herrschaft mit Terror durchsetzt?«
»Sikar«, schrie Petragar. »Nimm ihn fest! Bring ihn von dieser Kiste runter!«
Sikar zögerte.
Sie hassen ihn wirklich. Das könnte leichter werden, als ich es mir vorgestellt habe.
»Lasst mich erklären, warum ich gekommen bin.« Nyphron ließ seine Stimme weicher werden und sagte: »Ich bin hier, um euch zu befreien, euch alle. Alon Rhist ist das einzige Zuhause, das ich je gekannt habe, die Instarya sind meine Familie. Ich bin gekommen, um euch zu retten.«
»Du bist derjenige, der gerettet werden muss«, knurrte Petragar, während er sich durch die starren Reihen nach vorne kämpfte.
»Seit vielen Jahren habe ich euch gewarnt, dass die Rhunes ebenso in der Lage sind zu kämpfen wie die Fhrey. Wenige haben mir geglaubt.« Er wandte sich an Sikar. »Meine Worte haben sich als richtig erwiesen, als Shegon getötet wurde, während er an der Grenze auf Patrouille war.«
»Shegon wurde ermordet, als er bewusstlos am Boden lag«, sagte Sikar.
»Ist doch egal. Ich habe selbst mit angesehen, wie ein Rhune-Krieger Gryndal tötete. Schlachtete ihn ab mit einem perfekten Hieb gegen den Hals, der ihm den Kopf von den Schultern trennte. Ihr erinnert euch an Gryndal, oder?«
Das rief auf jedem Gesicht eine Reaktion hervor, auch auf Sikars. Er drehte sich um und sah, wie viele andere auch, Petragar an.
»Stimmt das?«, fragte Sikar.
»Ich – mir wurde gesagt –«
»Ein Rhune hat Gryndal getötet und du hast es uns nicht erzählt?«
»Und Gryndal war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusstlos«, sagte Nyphron. »Wenn euch das immer noch nicht reicht, dann lasst mich euch sagen, dass ich selbst gegen die Rhunes gekämpft habe und in Rhen fast in einem Zweikampf getötet wurde. Allein Sebeks rechtzeitiges Einschreiten hat mich gerettet.« Er hielt inne und sah Sebek an, der nickte.
Dies löste noch schockiertere Reaktionen unter den Versammelten aus.
»Dann hast du deine Fähigkeiten verloren«, sagte Petragar, während er sich an den verbliebenen Schilden vorbeidrängte, um sich neben Sikar zu stellen. Der Herr des Rhist brüllte frustriert: »Zieht eure Waffen und bringt sie ins Duryngon oder tötet sie hier und jetzt. Aber tut es sofort oder ihr werdet als Aufrührer gegen den Fhan angeklagt und als solche gerichtet.«
Sikar wich vor Petragars Geschimpfe zurück. Er machte ein unglückliches Gesicht, seufzte dann und griff nach seiner Waffe.
»Das willst du nicht tun«, sagte Tekchin.
»Halt’s Maul.« Sikar zog sein Schwert, als würde es mehr wiegen als Grygor. »Kannst du nicht ein einziges Mal deine Fresse halten?«
»Ich weiß, es ist schwer zu glauben«, sagte Nyphron zu Sikar. »Aber diesmal hat Tekchin recht. Steck das Schwert weg.«
»Ich kann nicht.« Sikar schüttelte den Kopf. »Ihr hättet nicht zurückkommen sollen.«
Sikar war ein guter Soldat, was bedeutete, dass er kein Freidenker war. Er hatte zwei starke Arme, die demjenigen zugutekamen, der gerade die Fäden zog, und in diesem Moment war der Puppenspieler Petragar.
Zeit, die Fäden durchzuschneiden.
»Bevor du meinen Freunden befiehlst, uns zu töten …« Nyphron sprach langsam, deutlich und laut, während er das rote Banner entrollte. »Lasst mich euch noch eine Sache zeigen, die euch vielleicht entgangen ist.«
»Du kannst dir dein theatralisches Gehabe sparen. Wir haben den abgerissenen Haufen Rhunes, mit dem ihr reist, schon gesehen«, sagte Sikar.
»Ihr habt nur die gesehen, die ihr sehen solltet«, sagte Nyphron. »Lasst mich euch die übrigen vorstellen.«
Er schwenkte die Flagge über seinem Kopf.
In der Ferne antworteten Hörner.
Nyphron brauchte sich nicht umzudrehen. Alles, was sich hinter ihm abspielte, spiegelte sich in den weit aufgerissenen Augen derer wider, die vor ihm standen. Sogar Sikars Mund öffnete sich. Petragar sah so aus, als würde er gleich in Ohnmacht fallen.
»Schließt das Tor! Schließt das Tor!«, rief Petragar.
»Auch das würde ich lieber lassen.« Tekchin grinste.
»Einmal mehr hat Tekchin entgegen aller Wahrscheinlichkeit recht.« Nyphron hörte auf zu winken und ließ die Flagge sinken. »Was ihr da seht, sind fünftausend kampferprobte, von den Dherg mit Waffen ausgerüstete Gula-Rhune-Krieger. Und bevor ihr zu glauben beginnt, dass die Mauern von Alon Rhist euch retten werden, bedenkt dies – wir haben auch eine Miralyith.«
»Miralyith?«, sagten Sikar und Petragar gleichzeitig, und das Wort wurde wie ein Echo in einer Höhle von der Menge wiederholt.
»Ihr kennt sie als Arion, Lehrerin des Prinzen.«
»Sie wurde geschickt, um dich festzunehmen«, sagte Petragar.
»Hat ihre Meinung geändert. Sogar sie sieht ein, dass der Fhan verrückt geworden ist.«
»Und der Fhan schickte Riesen, um sie für diese Fehleinschätzung zu bestrafen.«
»Ein riesiger Fehler.« Tekchin gluckste.
Nyphron lächelte und schüttelte den Kopf. »Ja, das ging für die Riesen nicht so gut aus. Die sind jetzt tot, und Arion arbeitet mit uns. Also wird es euch nicht helfen, die Tore zu schließen. Sie wird sie aufsprengen und eure Mauern einfach niederreißen.«
»Du lügst«, sagte Petragar.
Nyphron drehte sich zu den Galantianern um. »Bei eurer Ehre, sagt die Wahrheit vor euren Brethren und unserem Herrn Ferrol. Befindet sich die Miralyith Arion, einstige Ausbilderin des Prinzen, freiwillig unter uns und unterstützt uns bei unseren Vorhaben?«
Wie ein Mann antworteten die Galantianer: »Ja, bei unserer Ehre.«
»Du lügst!«, brüllte Petragar. »Sie lügen alle.«
So verärgert, dass er nicht mehr an sich halten konnte, drehte Elysan sich zu ihm um. »Das sind Galantianer.«
»Und es sind Lügner!« Seine Stimme war ein schrilles Röcheln.
»Sag das nicht noch mal«, sagte Sikar, wobei er seine Kiefer so fest zusammenpresste, dass er seine Worte zwischen den Zähnen hervorstieß.
»Du befiehlst Petragar nicht, was er zu tun hat«, mischte sich Vertumus ein. »Petragar hat hier den Oberbefehl.«
»Das ist richtig«, sagte Petragar. »Ich habe den Oberbefehl. Diese … diese Galantianer sind gesuchte Ketzer und Verräter und sind nach Estramnadon zurückzubringen oder, sollten sie sich wehren, hinzurichten. Dies ist der Wille des Fhans.« Er sah Sikar an. »Tu deine Pflicht.«
»Der Krieg wird hier beginnen«, sagte Nyphron zu Sikar. »Ich kann diese Festung nicht stehen lassen, wenn sie gegen mich steht.«
»Du kannst nicht verlangen, dass wir unsere eigenen Leute töten. Auch wenn der Fhan ein erbärmlicher Herrscher ist, Ferrols Gesetz gilt immer noch.«
»Ich verlange gar nicht, dass ihr etwas tut.« Nyphron begann, das Banner wieder aufzurollen. »Tatsächlich will ich, dass ihr absolut gar nichts tut.«
Das war der Schlüssel, den Nyphron ins Schloss steckte und sich darauf vorbereitete, ihn herumzudrehen. Er konnte die Überraschung in Sikars Augen sehen und, was noch wichtiger war, das rege Interesse. Der Soldat war zwischen Pflicht und Ehre hin- und hergerissen, suchte verzweifelt nach einem Ausweg.
»Nichts? Ich verstehe nicht –«
»Ich sagte, nehmt ihn fest oder tötet ihn!«, bellte Petragar und brachte Elysan dazu, die Augen zu verdrehen.
»Ich bin der Anführer der Instarya«, antwortete Nyphron an Sikar gewandt und ignorierte Petragar dabei völlig. »Ich verlange von meinen Leuten nichts, was ich nicht selbst zu tun bereit wäre. Und ich bin nicht bereit, Ferrols Gesetz zu brechen. Wenn ich es wäre, glaubst du wirklich, dass der da noch am Leben wäre?« Nyphron benutzte die eingerollte Flagge, um auf Petragar zu zeigen. »Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr uns nicht in die Quere kommt. Haltet euch einfach raus. Wenn ihr müsst, berichtet dem Fhan einfach, dass ihr überwältigt wurdet, dass ihr keine andere Wahl hattet, als euch einer weit überlegenen Streitmacht zu ergeben, die sicher jeden einzelnen Fhrey in Alon Rhist abgeschlachtet hätte, was leider die Wahrheit ist. Aus diesem Grund habe ich sie hergebracht, deshalb sind sie hier. Die Rhunes sind hier, um euch Absolution zu erteilen, um jegliche Sorge über die Verletzung eurer Ehre im Keim zu ersticken.«
Sikar verengte seine Augen zu Schlitzen. »Was ist dein Plan?«