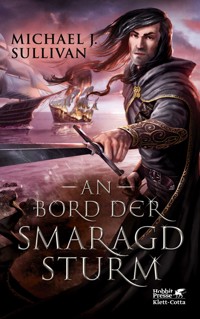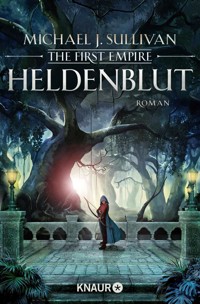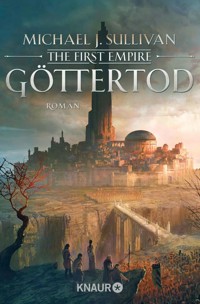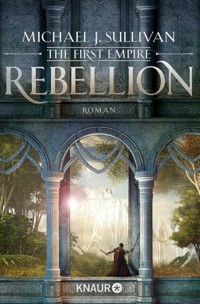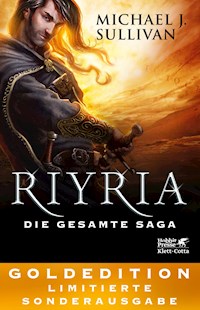
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Riyria
- Sprache: Deutsch
Die Hobbit Presse Gold Edition umfasst alle sechs Teile sowie die Vorgeschichte der Riyria-Saga. Auf mehr als 2500 Seiten erzählt Michael J. Sullivan die Geschichte der beiden Diebe, die immer wieder in großartige Abenteuer geraten. Die Limited Edition ist nur begrenzte Zeit verfügbar. Für das Gaunerduo Riyria endet die kriminelle Karriere, als ein Auftrag scheitert und sie festgenommen werden. Das Schicksal hat andere Pläne für Royce und Hadrian und so kämpfen die beiden gegen Ungeheuer, schlagen sich mit Piraten herum und versuchen zusammen mit der Prinzessin Arista die Invasion des Neuen Imperiums in ihr kleines Königreich zu verhindern. Dieses E-Book enthält: - Der Thron von Melengar - Der Turm von Avempartha - Der Aufstieg Nyphrons - An Bord der Smaragdsturm - Das Fest von Aquesta - Die verborgene Stadt Percepliquis - Hadrian & Royce - Ein Riyria-Abenteuer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Michael J. Sullivan
RIYRIA
GOLDEDITION DIE GESAMTE SAGA
Inhalt
Dieses E-Book enthält die folgenden Bände aus der Reihe »Riyria«:
Der Thron von Melengar (Band 1)
Der Turm von Avempartha (Band 2)
Der Aufstieg Nyphrons (Band 3)
An Bord der Smaragdsturm (Band 4)
Das Fest von Aquesta (Band 5)
Die verborgene Stadt Percepliquis (Band 6)
Hadrian & Royce (Ein Riyria-Abenteuer)
Michael J. Sullivan
DERTHRONVONMELENGAR
RIYRIA 1
Aus dem Englischen vonCornelia Holfelder-von der Tann
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Theft of Swords /The Crown Conspiracy« im Verlag Orbit, Hachette Book Group, New York
© 2011 by Michael J. Sullivan
© Karten by Michael J. Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: © Birgit Gitschier
Cover design von Lauren Panepinto
Cover illustration von Larry Rostant
Cover © 2011 Hachette Book Group, Inc.
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96012-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10694-7
Dieses E-Book beruht auf der 1. Auflage 2013 der Printausgabe
Für meine Frau Robin, die nicht nur meine Lebenspartnerin ist, sondern auch meine Partnerin beim Abenteuer dieser Serie – ohne ihre Arbeit und ihr Engagement wäre das alles nicht möglich gewesen. Für meine Tochter Sarah, die die Geschichte nicht lesen wollte, ehe sie als Buch erschienen war. Für Steve Gillick, dem ich für sein Feedback danke, und für Peter DeBrule, der das Ganze initiiert hat. Und für die Mitglieder der Dragonchow-Gilde, meinen Ur-Fanclub.
DeWitt hatte Hadrian erklärt, er habe das Schwert hinterm Altar versteckt, also wandten sie sich dorthin. Als sie zur ersten Bankreihe kamen, erstarrten sie. Dort lag, bäuchlings in einer frischen Blutlache, ein Mann. Aus seinem Rücken ragte der runde Griff eines Dolchs. Während Royce rasch nach Pickerings Schwert suchte, prüfte Hadrian, ob der Mann noch lebte. Er war tot, das Schwert nirgends zu finden. Royce tippte Hadrian auf die Schulter und zeigte auf die goldene Krone, die auf die andere Seite der Säule gerollt war. Schlagartig wurde ihnen der ganze Ernst der Situation bewusst – sie mussten hier weg.
Sie eilten zur Tür. Royce horchte nur kurz, ob auf dem Gang die Luft rein war. Dann schlüpften sie hinaus, schlossen die Tür und schlichen rasch zu dem leer stehenden Zimmer zurück.
»Mörder!«
Der Schrei war so nah und so gellend, dass sie beide mit gezogenen Klingen herumfuhren. Hadrian hielt das Bastardschwert in der einen Hand und das Kurzschwert in der anderen. In Royces Faust glänzte ein Weißstahldolch.
Vor der offenen Tür der Kapelle stand ein bärtiger Zwerg.
»Mörder!«, rief der Zwerg wieder, aber das war eigentlich nicht mehr nötig. Sie hörten bereits hastige Schritte, und im nächsten Moment stürmten Soldaten mit gezogenen Schwertern von beiden Seiten in den Gang.
Michael J. Sullivan
Inhalt
Karte der Welt Elan
1 Gestohlene Briefe
2 Geschäftstreffen
3 Verschwörungen
4 Windermere
5 Esrahaddon
6 Nächtliche Erkenntnisse
7 Drondilsfeld
8 Intrigen
9 Retter
10 Der Krönungstag
Die Welt Elan
Avryn im Detail
1 Gestohlene Briefe
Sehen konnte Hadrian in der Dunkelheit wenig, aber er hörte sie – Zweige knackten, Laub knirschte, Gras streifte über Stoff. Es waren mehrere, mehr als drei, und sie kamen immer näher.
»Keine Bewegung, alle beide«, befahl eine rauhe Stimme aus dem Schattenschwarz. »Unsere Pfeile zielen genau auf eure Rücken und wir schießen euch aus dem Sattel, wenn ihr zu fliehen versucht.« Der, dem die Stimme gehörte, befand sich noch im Schutz der Bäume, war nur eine diffuse Bewegung im Unterholz. »Wir wollen euch nur ein bisschen was von eurer Last abnehmen. Keinem muss was passieren. Tut, was ich sage, dann lassen wir euch am Leben. Wenn ihr’s nicht tut, nehmen wir euch auch das.«
Zerknirscht dachte Hadrian: Ich bin schuld. Er blickte zu Royce hinüber, der neben ihm auf seiner dreckbespritzten grauen Stute saß, die Kapuze hochgeschlagen. Der Freund schüttelte leise den gesenkten Kopf. Hadrian brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, um zu wissen, was es ausdrückte.
»Tut mir leid«, entschuldigte er sich.
Royce sagte nichts, schüttelte nur weiter den Kopf.
Vor ihnen versperrte eine Barrikade aus frischgeschnittenem Gestrüpp den Weg. Dahinter lag die mondbeschienene Straße wie ein langer, leerer Korridor. In den Senken und Gräben hing Nebel, und irgendwo plätscherte ein unsichtbarer Bach über Steine. Sie waren tief im Wald auf der alten Straße nach Süden, in einem endlosen Tunnel aus Eichen und Eschen, deren kahle Äste über die Straße hingen und im kalten Herbstwind wackelten und klackten. Fast einen Tagesritt von jedweder Ortschaft, seit Stunden schon hatte Hadrian nicht mal mehr ein einzelnes Bauernhaus gesehen. Sie waren allein mitten im Nichts – in der Art Gegend, wo Leichen nie gefunden wurden.
Das Knirschen zertretener Blätter wurde lauter, bis die Räuber schließlich in den schmalen Mondlichtstreifen hinaustraten. Hadrian zählte vier Männer mit unrasiertem Gesicht und gezogenem Schwert. Sie trugen grobe Kleider, Leder und Wolle, fleckig, schmuddelig und verschlissen. Bei ihnen war ein Mädchen, das einen Bogen mit angelegtem Pfeil hielt. Auch sie trug Hosen und Stiefel, und ihr Haar war wirr und fettig. Allen fünfen schien der Dreck so tief in den Poren zu sitzen, als kämen sie direkt aus einem Erdloch.
»Die sehen nicht aus, als ob sie viel Geld hätten«, sagte ein plattnasiger Mann. Ein, zwei Zoll größer als Hadrian, war er der Kräftigste der Bande, ein bulliger, stiernackiger Kerl mit mächtigen Pranken. Derjenige, der ihm die Nase gebrochen hatte, schien ihm auch gleich noch die Unterlippe gespalten zu haben.
»Aber sie haben jede Menge Gepäck«, sagte das Mädchen mit einer Stimme, die ihn überraschte. Das junge Ding war trotz des Drecks auf eine fast kindliche Art niedlich, hatte aber einen aggressiven, ja boshaften Ton. »Schaut doch, was sie alles mit sich rumschleppen. Was soll das viele Seil?«
Hadrian war sich unsicher, ob die Frage an ihn gerichtet war oder an ihre Kumpane. Beantworten würde er sie ohnehin nicht. Er erwog, einen Scherz zu machen, aber sie wirkte nicht wie die Sorte Mädchen, bei der sein Charme verfangen würde. Außerdem zielte sie auf ihn, und es sah aus, als müsste ihr Arm allmählich erlahmen.
»Ich will das große Schwert, das der da auf dem Rücken hat«, sagte Plattnase. »Scheint ungefähr meine Größe.«
»Ich nehm die anderen beiden, die er umhängen hat.« Das kam von einem Kerl mit einer Narbe, die sich schräg über sein Gesicht zog und die Nasenwurzel gerade so kreuzte, dass ihm das Auge erhalten geblieben war.
Das Mädchen zielte jetzt auf Royce. »Ich will den Mantel von dem Kleinen. So eine feine schwarze Kapuze steht mir bestimmt gut.«
Der, der am nächsten bei Hadrian stand, ein Mann mit tiefliegenden Augen und sonnenverbrannter Haut, schien der Älteste. Er trat einen Schritt näher und packte Hadrians Pferd an der Trense. »Macht jetzt bloß keinen Fehler. Wir haben an dieser Straße schon eine Menge Leute getötet. Dumme Leute, die nicht auf uns gehört haben. So dumm seid ihr doch nicht, oder?«
Hadrian schüttelte den Kopf.
»Gut, also lasst jetzt die Waffen fallen«, sagte der Räuber. »Und dann steigt ab.«
»Was meinst du, Royce?«, fragte Hadrian. »Wir geben ihnen ein bisschen Geld, damit keinem was passiert.«
Royce drehte den Kopf. Zwei Augen warfen einen vernichtenden Blick unter der Kapuze hervor.
»Ich sage ja nur, wir wollen doch keinen Ärger, oder?«
»Meine Meinung interessiert dich doch sowieso nicht«, sagte Royce.
»Dann willst du also stur bleiben?«
Schweigen.
Hadrian schüttelte seufzend den Kopf. »Warum musst du alles so kompliziert machen? Sie sind wahrscheinlich gar keine schlechten Menschen – nur arm, verstehst du? Sie nehmen sich nur, was sie brauchen, um einen Laib Brot für ihre Familie zu kaufen. Kannst du’s ihnen verdenken? Der Winter kommt, und es sind schwere Zeiten.« Er nickte den Räubern zu. »Stimmt’s?«
»Ich hab keine Familie«, entgegnete Plattnase. »Ich geb das meiste, was ich hab, für Schnaps aus.«
»Ihr macht es nicht gerade leichter«, sagte Hadrian.
»Will ich auch gar nicht. Entweder ihr zwei tut jetzt, was ich sage, oder wir schlitzen euch auf der Stelle den Bauch auf.« Zur Unterstreichung seiner Worte zog er einen langen Dolch aus dem Gürtel und wetzte ihn geräuschvoll an der Klinge seines Schwerts.
Kalter Wind heulte durch die Bäume und rüttelte an den Ästen. Rote und goldene Blätter wirbelten durch die Luft, Spielzeug der Böen, die die schmale Straße entlangfegten. Irgendwo im Dunkeln schrie eine Eule.
»Hört zu, wie wär’s, wenn wir euch die Hälfte unseres Gelds geben? Meine Hälfte. Dann geht ihr immerhin nicht ganz leer aus.«
»Wir reden von keiner Hälfte«, sagte der Mann, der Hadrians Pferd festhielt. »Wir wollen alles, auch die Pferde hier.«
»Moment mal. Unsere Pferde? Ein bisschen Geld abzukassieren, ist ja in Ordnung, aber Pferdediebstahl? Wenn sie euch erwischen, hängen sie euch. Und euch ist doch klar, dass wir das melden, sobald wir in eine Ortschaft kommen.«
»Ihr seid aus dem Norden, was?«
»Ja, gestern in Medford losgeritten.«
Der Mann, der das Pferd hielt, nickte, und Hadrian bemerkte eine kleine rote Tätowierung in seinem Nacken. »Seht ihr, das ist euer Problem.« Sein Gesicht wurde jetzt weicher, geradezu mitleidig, was allerdings noch bedrohlicher wirkte, weil die Distanz wegfiel. »Ihr seid vermutlich auf dem Weg nach Colnera – nette Stadt. Jede Menge Läden. Jede Menge reiche Leute. Da unten wird jede Menge Handel getrieben, und hier auf dieser Straße kommen jede Menge Reisende durch, die alle möglichen Sachen runterbringen, um sie den reichen Leuten zu verkaufen. Aber ich nehm mal an, ihr wart noch nie hier im Süden, stimmt’s? Droben in Melengar macht König Amrath sich die Mühe, Soldaten auf den Landstraßen patrouillieren zu lassen. Aber hier in Warric geht’s ein bisschen anders zu.«
Plattnase kam näher und leckte sich die gespaltene Lippe, während er das Langschwert auf Hadrians Rücken musterte.
»Soll das heißen, Räuberei ist hier erlaubt?«
»Na-ah, aber König Ethelred sitzt in Aquesta, und das ist ganz schön weit von hier.«
»Und der Graf von Chadwick? Verwaltet er nicht diese Ländereien hier im Namen des Königs?«
»Archie Ballentyne?« Die Nennung dieses Namens löste unter den Räubern enorme Heiterkeit aus. »Archie kümmert es einen Dreck, was im gemeinen Volk vor sich geht. Der hat viel zu viel damit zu tun, sich zu überlegen, was er anziehen soll.« Der Mann grinste und entblößte eine Reihe schiefstehender gelber Zähne. »Also, los jetzt, Schwerter fallen lassen und absteigen. Ihr könnt ja dann zu Fuß zum Schloss Ballentyne gehen, beim alten Archie anklopfen und schauen, was er unternimmt.« Erneutes Gelächter. »Wenn ihr nicht findet, dass das hier der ideale Ort zum Sterben ist, dann tut jetzt, was ich sage.«
»Du hattest recht, Royce«, sagte Hadrian resigniert. Er öffnete die Schließe seines Mantels und legte ihn hinter sich über den Sattel. »Wir hätten nicht die Straße nehmen sollen, aber mal ehrlich – wir sind doch hier mitten im Nichts. Wie groß war da schon das Risiko?«
»Angesichts der Tatsache, dass wir gerade ausgeraubt werden – ziemlich groß, würde ich sagen.«
»Das entbehrt wirklich nicht der Ironie – Riyria wird ausgeraubt. Hat fast schon eine gewisse Komik.«
»Es ist überhaupt nicht komisch.«
»Habt ihr ›Riyria‹ gesagt?«, fragte der Mann, der Hadrians Pferd hielt.
Hadrian nickte, zog seine Handschuhe aus und steckte sie unter seinen Gürtel.
Der Mann ließ das Pferd los und trat einen Schritt zurück.
»Was ist los, Will?«, fragte das Mädchen. »Was ist Riyria?«
»Es gibt zwei Männer in Melengar, die sich so nennen.« Er sah die anderen an und senkte die Stimme. »Ihr wisst doch, ich hab Verbindungen dort oben. Die sagen, zwei Männer, die sich Riyria nennen, operieren von Medford aus, und wenn die mir je über den Weg laufen, soll ich bloß Abstand halten.«
»Und was denkst du jetzt, Will?«, fragte Narbengesicht.
»Ich denke, wir sollten das Gestrüpp da wegräumen und sie durchlassen.«
»Was? Warum? Wir sind zu fünft und sie nur zu zweit«, wandte Plattnase ein.
»Aber sie sind Riyria.«
»Und?«
»Und meine Geschäftsfreunde im Norden sind nicht blöd. Und sie haben allen gesagt, dass sie bloß die Finger von den beiden hier lassen sollen. Und meine Geschäftsfreunde sind auch nicht grad zimperlich. Wenn die sagen, wir sollen denen hier aus dem Weg gehen, dann gibt’s dafür einen guten Grund.«
Plattnase beäugte sie wieder kritisch. »Glaub ich ja, aber woher weißt du, dass die zwei hier wirklich die sind? Nur weil sie’s sagen?«
Will deutete mit dem Kinn auf Hadrian. »Schau dir seine Schwerter an. Wenn einer eins trägt – kann sein, er weiß damit umzugehen, kann auch nicht sein. Wenn einer zwei hat – spricht das eher dafür, dass er keine große Ahnung vom Fechten hat, aber so tut als ob. Aber drei Schwerter – die sind ganz schön schwer. So viel Stahl schleppt keiner mit sich rum, außer, er lebt davon, dass er die Dinger benutzt.«
Hadrian zog in einem einzigen eleganten Schwung beide Schwerter aus seinen Gürtelscheiden. Er ließ eins davon in der halbgeöffneten Hand einmal um die Längsachse kreisen. »Das hier braucht wirklich eine neue Heftwicklung. Ist schon wieder abgewetzt.« Er sah Will an. »Können wir wieder zur Sache kommen? Ich glaube, ihr wart gerade dabei, uns auszurauben.«
Die Räuber wechselten unsichere Blicke.
»Will?«, fragte das Mädchen, das den Bogen immer noch gespannt hielt, jetzt aber längst nicht mehr so selbstsicher klang.
»Wir räumen das Gestrüpp aus dem Weg und lassen sie durch«, sagte Will.
»Sicher?«, fragte Hadrian. »Dieser nette Herr mit der eingeschlagenen Nase scheint doch sehr erpicht auf ein Schwert.«
»Schon gut«, sagte Plattnase mit einem Blick auf Hadrians Klingen, deren polierter Stahl im Mondlicht glänzte.
»Nun ja, wenn ihr ganz sicher seid.«
Alle fünf nickten, und Hadrian steckte seine Schwerter wieder weg.
Will rammte sein Schwert in den Erdboden und winkte den anderen mitzukommen, um die Straßensperre wegzuräumen.
»Ihr macht das übrigens völlig falsch«, erklärte ihnen Royce.
Die Räuber hielten inne und blickten sich betroffen um.
Royce schüttelte den Kopf. »Nicht das mit dem Gestrüpp da – die Räuberei. Ein nettes Fleckchen habt ihr ja gewählt, das muss ich euch lassen. Aber ihr hättet von beiden Seiten kommen müssen.«
»Und, William – du heißt doch William, oder?«, fragte Hadrian.
Der Mann zuckte zusammen und nickte.
»Also, William, die meisten Leute sind Rechtshänder, deshalb müssten die, die am nächsten an sie herangehen, von links kommen. So hätten wir den Nachteil gehabt, das Schwert erst um den Körper herumschwingen zu müssen. Die mit den Bogen sollten von rechts kommen.«
»Und warum nur ein Bogen?«, fragte Royce. »Sie hätte nur einen von uns treffen können.«
»Nicht mal das«, sagte Hadrian. »Ist dir aufgefallen, wie lange sie den Bogen schon gespannt hält? Entweder ist sie unglaublich stark – was ich nicht glaube –, oder aber das da ist ein selbstgemachter Grünholzbogen, der den Pfeil gerade mal ein paar Fuß weit zu schnellen vermag. Ihr Part war reines Theater. Ich bezweifle, dass sie je mit dem Ding geschossen hat.«
»Hab ich wohl«, sagte das Mädchen. »Ich bin eine gute Schützin.«
Hadrian schüttelte lächelnd den Kopf. »Du hattest den Zeigefinger auf dem Schaft, Mädchen. Beim Loslassen der Sehne hätte die Befiederung deinen Finger gestreift, und der Pfeil wäre irgendwohin geflogen, nur nicht dahin, wo er hinsollte.«
Royce nickte. »Investiert in Armbrüste. Das nächste Mal bleibt versteckt und jagt einfach jedem eurer Opfer zwei, drei Bolzen in die Brust. Dieses ganze Gerede ist einfach nur dumm.«
»Royce!«, ermahnte ihn Hadrian.
»Was? Du sagst doch immer, ich soll netter zu den Leuten sein. Ich versuche ja nur zu helfen.«
»Hört nicht auf ihn. Wenn ihr einen guten Rat wollt – errichtet eine bessere Straßensperre.«
»Ja, fällt das nächste Mal einen Baum, sodass er quer über der Straße liegt«, sagte Royce. Mit einer abfälligen Handbewegung in Richtung des Gesträuchs setzte er hinzu: »Das da ist jämmerlich. Und, bei Maribor, verhüllt eure Gesichter. So ein großes Reich ist Warric auch wieder nicht, und jemand könnte euch wiedererkennen. Klar, Ballentyne wird sich vermutlich nicht aufraffen, euch wegen dem bisschen Wegelagerei zu verfolgen, aber es könnte euch eines Tages passieren, dass ihr in ein Wirtshaus geht und plötzlich ein Messer im Rücken habt.« Royce wandte sich an William. »Ihr wart bei der Roten Hand, stimmt’s?«
Will starrte ihn erschrocken an. »Davon hat doch keiner was gesagt.« Er ließ den Ast los, an dem er gerade gezogen hatte.
»War auch nicht nötig. Die Hand verlangt von all ihren Zunftmitgliedern, sich diese idiotische Tätowierung im Nacken verpassen zu lassen.« Zu Hadrian sagte Royce: »Es soll sie als besonders harte Kerle ausweisen, führt aber nur dazu, dass man sie ihr Leben lang als Räuber und Diebe identifizieren kann. Jedem ihrer Männer eine rote Hand aufzustempeln, ist doch wirklich ganz schön blöd.«
»Das soll eine rote Hand darstellen?«, fragte Hadrian. »Ich habe es für ein rotes Huhn gehalten. Aber jetzt, wo du’s sagst, klar, eine Hand ist logischer.«
Royce taxierte Will mit schräggelegtem Kopf. »Hat wirklich was von einem Huhn.«
Will klatschte sich eine Pranke in den Nacken.
Als das Gesträuch weggeräumt war, fragte William: »Wer seid ihr denn jetzt genau? Was ist Riyria? Die Hand hat’s mir nie verraten. Sie haben nur gesagt, ich soll mich nicht mit euch anlegen.«
»Wir sind niemand Besonderes«, erwiderte Hadrian. »Nur zwei Reisende, die einen Ritt durch eine kühle Herbstnacht genießen.«
»Aber mal im Ernst«, sagte Royce. »Ihr solltet auf uns hören, wenn ihr das hier weitermachen wollt. Schließlich halten wir uns ja auch an euren Rat.«
»Welchen Rat?«
Royce gab seinem Pferd sachte die Sporen und nahm die Straße wieder in Angriff. »Wir werden dem Grafen von Chadwick einen Besuch abstatten, aber keine Angst – wir verraten euch nicht.«
***
Was er da in den Händen hielt, dachte Archibald Ballentyne, war die Welt, handlich verpackt in fünfzehn gestohlenen Briefen. Jeder Brief war mit größter Sorgfalt in einer hübschen, eleganten Handschrift verfasst. Man sah, dass die Person, von deren Hand die Briefe stammten, diese Worte für höchst bedeutungsvoll und für das Medium oder die Quelle einer tiefen Wahrheit gehalten hatte. Archibald hielt sie für Gesülze, stimmte aber jener Person immerhin darin zu, dass sie enorm wertvoll waren. Er nahm einen Schluck Branntwein, schloss die Augen und lächelte.
»Euer Erlaucht?«
Widerstrebend öffnete Archibald die Augen und sah seinen Gardeführer finster an. »Was gibt’s, Bruce?«
»Der Markgraf ist da, Herr.«
Archibald lächelte jetzt wieder. Er faltete die Briefe sorgsam zusammen, umschnürte den Stapel mit einem blauen Band, legte ihn in seinen Panzerschrank, machte die schwere Eisentür zu, schloss sie ab und rüttelte sicherheitshalber noch zweimal daran. Dann ging er hinunter, um seinen Gast zu begrüßen.
Als er in die Halle kam, erspähte er Victor Lanaklin in der Vorhalle. Er blieb stehen und beobachtete, wie der alte Mann ungeduldig auf und ab ging. Dieser Anblick erfüllte Archibald Ballentyne mit einer gewissen Befriedigung. Obwohl der Markgraf der Höhergestellte war, hatte er den Grafen doch nie zu beeindrucken vermocht. Victor mochte ja einst eine stolze, imposante oder gar edle Erscheinung gewesen sein, aber der Glanz war längst dahin: Geblieben war ein gebeugter Alter mit grauem Haar.
»Darf ich Euch etwas zu trinken anbieten, Herr?«, fragte ein schüchterner Diener den Markgrafen mit einer tiefen Verbeugung.
»Nein, aber du kannst mir deinen Herrn herbeischaffen«, sagte dieser gebieterisch. »Oder muss ich mich selbst auf die Jagd nach ihm machen?«
Der Diener zuckte zusammen. »Mein Herr wird gewiss gleich hier sein.« Der Diener verbeugte sich abermals und verschwand hastig durch eine Tür am anderen Ende des Raums.
»Markgraf!«, rief Archibald im Eintreten artig aus. »Ich bin ja so froh, dass Ihr gekommen seid – noch dazu so schnell.«
»Ihr klingt überrascht«, erwiderte Victor in scharfem Ton. Er schwenkte ein zerknittertes Schreiben, das er in der Hand hielt, und sagte: »Ihr schickt mir eine solche Botschaft und glaubt, ich würde mir Zeit lassen? Archie, ich will sofort wissen, was los ist.«
Archibald kaschierte seinen Ärger darüber, dass er mit seinem Kindheitskosenamen angeredet wurde. Den verdankte er seiner verstorbenen Mutter, was zu den Dingen gehörte, die er ihr nie verzeihen würde. Jeder, von der Ritter- bis zur Dienerschaft, hatte ihn so genannt, und diese Vertraulichkeit hatte Archibald immer als entwürdigend empfunden. Sobald er zum Grafen ernannt war, hatte einer seiner ersten Erlasse gelautet, dass jeder in Chadwick, der ihn bei diesem Namen nannte, ausgepeitscht würde. Dem Markgrafen gegenüber hatte er jedoch nicht die Macht, diesen Erlass durchzusetzen, und er war sich sicher, dass Victor dies gezielt ausnutzte.
»Bitte, versucht Euch zu beruhigen, Victor.«
»Sagt Ihr mir nicht, ich solle mich beruhigen!« Die Stimme des Markgrafen hallte von den Mauern wider. Er baute sich direkt vor dem Jüngeren auf und starrte ihm wütend in die Augen. »Ihr schriebt, die Zukunft meiner Tochter Alenda stehe auf dem Spiel, und Ihr hättet Beweise dafür. Also, heraus damit – ist Alenda in Gefahr oder nicht?«
»In Gefahr ist sie ohne Zweifel«, erwiderte der Graf ruhig, »aber nicht akut. Es gibt keine Entführungs- oder Mordpläne gegen sie, falls es das ist, was Ihr fürchtet.«
»Warum dann diese Botschaft? Wenn Ihr glaubt, Ihr könntet mich wegen nichts und wieder nichts dazu treiben, meine Kutschpferde zuschanden zu fahren und mich auf dem ganzen Weg halbtot zu sorgen, dann gnade Euch –«
Archibald unterbrach ihn mit erhobener Hand. »Ich versichere Euch, Victor, es war nicht wegen nichts und wieder nichts. Doch ehe wir dieses Gespräch weiterführen, lasst uns in mein Arbeitszimmer gehen, wo ich Euch die erwähnten Beweise vorlegen kann.«
Victor funkelte ihn grimmig an, nickte aber.
Die beiden Männer durchquerten die Halle und den großen Empfangssaal und nahmen dann eine Seitentür, die zum Wohntrakt des Schlosses führte. Während sie immer neuen Gängen folgten und diverse Treppen nahmen, veränderte sich das Ambiente beträchtlich. Im Bereich des Haupteingangs schmückten erlesene Tapisserien und Steinmetzarbeiten die Wände, und die Böden waren aus edlem Marmor. Doch abseits der Repräsentationsräume fehlte jede Pracht: Nacktes Mauerwerk bestimmte das Bild.
Architektonisch und auch sonst hatte Schloss Ballentyne wenig zu bieten. Kein bedeutender Herrscher oder Held hatte hier je gewohnt. Keine Sage oder Gespenstergeschichte rankte sich darum, und auch militärisch hatte es nie eine wichtige Rolle gespielt. Es war vielmehr der Inbegriff des Mittelmäßigen und Belanglosen.
Nach einer mehrminütigen Wanderung blieb Archibald vor einer mächtigen Eisentür stehen. Imposante Türbänder und Bolzen hielten sie an der einen Seite, aber eine Klinke oder ein Knauf war nicht zu sehen. Flankiert war die Tür von zwei bulligen, gepanzerten Wachen mit Hellebarden. Bei Archibalds Erscheinen pochte einer der beiden dreimal an die Eisenplatte. Ein winziges Guckfenster öffnete sich, und gleich darauf war das Zurückschnappen eines Schließriegels zu hören. Als die Tür aufging, quietschten die eisernen Angeln ohrenbetäubend.
Victor hielt sich die Ohren zu. »Bei Mar! Lasst diese Dinger ölen!«
»Niemals«, entgegnete Archibald. »Das hier ist der Eingang zum Grauen Turm – meinem persönlichen Arbeitszimmer. Es ist mein sicheres Refugium, und wenn diese Tür aufgeht, will ich es im ganzen Schloss hören. Nur so kann ich das.«
Hinter der Tür empfing Bruce die beiden mit einer tiefen Verbeugung. Mit einer Laterne vorausleuchtend, führte er sie eine breite Wendeltreppe hinauf. Auf halber Höhe des Turms verlangsamte sich Victors Schritt, und sein Atem schien schwerer zu gehen.
Höflich blieb Archibald einen Moment stehen. »Verzeiht den langen Aufstieg. Ich bemerke ihn kaum noch. Ich habe diese Treppe bestimmt schon tausendmal erklommen. Als mein Vater dem Haus noch vorstand, war dies der einzige Ort, wo ich allein sein konnte. Niemand wandte je die Zeit und Mühe auf, bis ganz nach oben zu steigen. Wenn er auch vielleicht mit dem majestätischen Kronturm von Ervanon nicht mithalten kann, dieser Turm ist jedenfalls der höchste meines Schlosses.«
»Kommen dann nicht Leute einfach der Aussicht wegen herauf?«, sinnierte Victor.
Der Graf schmunzelte. »Das könnte man meinen, ja, aber dieser Turm hat keine Fenster, deshalb ist er ja der perfekte Ort für mein Arbeitszimmer. Außerdem habe ich die Türen anbringen lassen, um zu schützen, was mir teuer ist.«
Am oberen Ende der Treppe stießen sie auf eine weitere Tür. Archibald zog einen großen Schlüssel aus der Tasche, schloss auf und bedeutete dem Markgrafen einzutreten. Bruce nahm seinen üblichen Posten vor dem Arbeitszimmer ein und zog die Tür zu.
Der große, runde Raum enthielt nur wenig Mobiliar: einen mächtigen, mit allem Möglichen beladenen Schreibtisch und vor dem kleinen Kamin zwei gepolsterte Sessel mit einem zierlichen Tischchen dazwischen. Hinter einem schlichten Messing-Kaminschirm brannte ein Feuer, das den größten Teil des Zimmers erhellte. Wandkerzenhalter beleuchteten den Rest und verbreiteten einen anregenden Duft nach Honig und Salifan.
Archibald lächelte, als er Victor zu dem mit Schriftrollen und Landkarten übersäten Schreibtisch hinüberäugen sah. »Keine Sorge, Markgraf. Die wirklich verfänglichen Pläne für die Übernahme der Weltherrschaft habe ich vor Eurem Besuch versteckt. Setzt Euch doch bitte.« Archibald deutete auf die beiden Sessel am Kamin. »Ruht Euch von der langen Reise aus, ich schenke uns unterdessen etwas zu trinken ein.«
Der Ältere sah ihn finster an und brummte: »Genug jetzt mit Schlossführungen und sonstigen Artigkeiten. Wir sind hier, also kommen wir zur Sache. Erklärt mir, was das alles soll.«
Archibald ignorierte den Ton des Markgrafen. Er konnte sich eine gewisse Großmut leisten, jetzt, da ihm gleich der Lohn seiner Mühen zufallen würde. Er wartete, bis der Markgraf Platz genommen hatte.
»Euch dürfte ja bekannt sein, dass ich mich für Eure Tochter Alenda interessiert habe?«, fragte Archibald, während er an den Schreibtisch ging, um zwei Gläser Branntwein einzuschenken.
»Ja, sie hat es erwähnt.«
»Hat sie auch erwähnt, warum sie meine Avancen zurückgewiesen hat?«
»Sie mag Euch nicht.«
»Sie kennt mich kaum«, konterte Archibald, den Zeigefinger schwenkend.
»Archie, habt Ihr mich deshalb hergebeten?«
»Markgraf, ich wäre sehr dankbar, wenn Ihr mich mit meinem korrekten Namen ansprechen würdet. Mich so zu nennen, ist unangemessen, da mein Vater tot ist und ich jetzt der Graf bin. Aber Eure Frage geht nicht völlig am Thema vorbei. Wie Ihr wisst, bin ich der zwölfte Graf von Chadwick. Zugegeben, es ist kein riesiger Besitz, und die Ballentynes gehören nicht zu den einflussreichsten Geschlechtern, aber einiges habe ich doch vorzuweisen. Ich gebiete über fünf Dörfer und zwölf Weiler sowie über das strategisch wichtige Hochland von Senon. Ich befehlige derzeit eine stehende Truppe von über sechzig Bewaffneten, und zwanzig Ritter leisten mir Gefolgschaft – darunter Baron Enden und Baron Breckton, vielleicht zwei der bedeutendsten Ritter unserer Zeit. Um unsere Woll- und Lederexporte beneidet uns ganz Warric. Es ist sogar die Rede davon, dass die Somershohspiele hier stattfinden sollen – auf ebenjenem Rasen, den Ihr vorhin überquert habt.«
»Ja, Archie – ich meine Archibald –, Chadwicks Status in der Welt ist mir wohlbekannt. Ich brauche keine Lektion in Wirtschaftskunde von Euch.«
»Ist Euch auch bekannt, dass König Ethelreds Neffe hier mehr als einmal getafelt hat? Oder dass mich der Herzog und die Herzogin von Rochelle dieses Jahr zum Wintertidemahl eingeladen haben?«
»Archibald, das ist alles ziemlich ermüdend. Worauf wollt Ihr hinaus?«
Archibald runzelte die Stirn – wie konnte sich der Markgraf so ganz und gar unbeeindruckt zeigen! Er kam mit den Gläsern herüber, reichte eines Victor, setzte sich in den anderen Sessel und trank erst mal schweigend von seinem Branntwein.
»Worauf ich hinauswill, ist Folgendes: In Anbetracht meines Standes, meines Ansehens und meiner glänzenden Zukunftsaussichten ist nicht zu verstehen, warum Alenda mich abweist. Mein Äußeres ist gewiss nicht der Grund. Ich bin jung und präsentabel und trage nur die erlesene ausländische Mode aus teuersten Seidenstoffen. Ihre übrigen Freier sind allesamt alt, fett oder kahl – in mehreren Fällen sogar alles zugleich.«
»Vielleicht sind Aussehen und Reichtum ja nicht ihre einzigen Kriterien«, entgegnete Victor. »Frauen denken nicht immer an Politik und Macht. Alenda gehört zu den Mädchen, die der Stimme ihres Herzens folgen.«
»Aber sie wird auch den Wünschen ihres Vaters Folge leisten. Oder etwa nicht?«
»Ich weiß nicht, was Ihr sagen wollt.«
»Wenn Ihr sie bitten würdet, mich zu heiraten, würde sie es tun. Ihr könntet es ihr sogar gebieten.«
»Deshalb also habt Ihr mich genötigt, hierher zu kommen? Tut mir leid, Archibald, aber da habt Ihr Eure und meine Zeit vergeudet. Ich habe nicht die Absicht, sie zu irgendeiner Ehe zu zwingen, schon gar nicht mit Euch. Sie würde mich ihr Leben lang hassen. Mir sind die Gefühle meiner Tochter wichtiger als die politische Bedeutung einer möglichen Ehe. Ich liebe Alenda nämlich. Von all meinen Kindern ist sie meine größte Freude.«
Archibald nahm noch einen Schluck Branntwein und dachte über Victors Antwort nach. Er beschloss, das Thema von einer anderen Seite anzugehen. »Und wenn es nun zu ihrem eigenen Wohl wäre? Wenn es sie vor der sicheren Katastrophe bewahren würde?«
»Ihr spracht davon, dass ihr Gefahr drohe. Seid Ihr jetzt endlich bereit, das näher zu erläutern, oder wollt Ihr lieber sehen, ob dieser alte Mann hier noch eine Klinge zu führen vermag?«
Archibald ignorierte die, wie er wusste, leere Drohung. »Als Alenda meine Avancen mehrfach zurückwies, habe ich mir gesagt, dass da etwas nicht stimmt. Es entbehrte jeglicher Logik. Ich habe Verbindungen und vor mir liegt eine glänzende Zukunft. Da habe ich dann den wahren Grund für die ablehnende Haltung Eurer Tochter entdeckt – sie hat sich bereits mit einem anderen eingelassen. Eure Tochter hat ein heimliches Liebesverhältnis.«
»Das ist mir schwer vorstellbar«, erklärte Victor. »Sie hat nie jemanden erwähnt. Wenn jemand ihr Augenmerk auf sich gezogen hätte, würde sie es mir erzählen.«
»Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sie Euch nichts davon gesagt hat. Sie schämt sich. Sie weiß, diese Beziehung kann nur Schande über Eure Familie bringen. Der Mann, um den es geht, ist ein Gemeiner, in dessen Adern nicht ein Tropfen edlen Blutes fließt.«
»Ihr lügt!«
»Ich versichere Euch, ich lüge nicht. Und das ist leider noch nicht alles. Er heißt Degan Gaunt. Das sagt Euch doch wohl etwas? Er ist der Anführer der nationalistischen Bewegung, die von Delgos ausgeht. Ihr wisst ja wohl, dass er zusammen mit anderen Gemeinen dort unten im Süden alle möglichen Emotionen entfesselt hat. Diese Leute sind berauscht von der Idee, den Adel abzuschlachten und selbst die Herrschaft zu errichten. Er und Eure Tochter treffen sich in Windermere, beim Kloster. Sie verabreden sich dort, wenn Ihr unterwegs und mit Staatsangelegenheiten beschäftigt seid.«
»Das ist doch lächerlich. Meine Tochter würde niemals –«
»Habt Ihr nicht einen Sohn dort unten?«, fragte Archibald. »Im Kloster, meine ich. Er ist doch Mönch?«
Victor nickte. »Mein dritter Sohn, Myron.«
»Vielleicht ist er den beiden ja behilflich. Ich habe Nachforschungen angestellt, und offenbar ist Euer Sohn ein höchst intelligenter Bursche. Vielleicht organisiert er ja das Liebesleben seiner teuren Schwester und befördert die Korrespondenz der beiden. Das sieht wirklich gar nicht gut aus, Victor. Bedenkt doch mal, Ihr als Markgraf eines stramm imperialistischen Königs habt eine Tochter, die sich mit einem Revolutionär einlässt und ihn im royalistischen Königreich Melengar trifft, sowie einen Sohn, der das Ganze auch noch deckt. Manch einer könnte das für eine Familienverschwörung halten. Was würde König Ethelred sagen, wenn er es erführe? Wir beide wissen, dass Ihr ihm treu ergeben seid, aber andere könnten zweifeln. Wenn mir auch klar ist, dass es sich lediglich um die fehlgeleiteten Gefühle eines unschuldigen jungen Mädchens handelt, könnten Alendas Eskapaden doch Eure Familienehre irreparabel beflecken.«
»Ihr seid verrückt«, schoss Victor zurück. »Myron kam ins Kloster, als er gerade mal vier Jahre alt war. Alenda hat nie mit ihm gesprochen. Dieses ganze Lügengespinst ist ein durchsichtiger Versuch, über mich zu erzwingen, dass Alenda Euch heiratet. Und ich weiß auch, warum. An ihr liegt Euch gar nichts. Ihr wollt nur ihre Mitgift, das Rilantal. Diese Ländereien grenzen so überaus praktisch an Eure, darum geht es Euch in Wahrheit. Und natürlich um Euren eigenen Aufstieg per Einheirat in eine gesellschaftlich und politisch bedeutendere Familie. Ihr seid erbärmlich.«
»Erbärmlich – ich?« Archibald stellte sein Glas ab und zog einen Schlüssel an einer Silberkette aus seinem Hemd. Er stand auf und ging zu einem Wandteppich, auf dem ein kalischer Prinz hoch zu Ross eine blonde Edelfrau entführte. Er schlug ihn zurück und enthüllte einen versteckten Panzerschrank. Mit dem Schlüssel öffnete er die kleine Metalltür.
»Ich habe einen Stapel Briefe von der Hand Eurer kostbaren Tochter als Beweis. Jeder einzelne spricht von ihrer unsterblichen Liebe zu dem revolutionären Bauernlümmel.«
»Wie kommt Ihr an diese Briefe?«
»Ich habe sie entwendet. Um herauszufinden, wer mein Rivale ist, ließ ich Eure Tochter beobachten. Sie sandte Briefe ab, deren Weg zu dem Kloster führte, und ich habe dafür gesorgt, dass sie abgefangen wurden.« Dem Panzerschrank entnahm Archibald einen Stapel zusammengefalteter Pergamente und ließ ihn in Victors Schoß fallen. »Da!«, verkündete er triumphierend. »Lest, was Eure Tochter treibt, und befindet selbst, ob es nicht besser für sie wäre, mich zu heiraten.«
Archibald kehrte zu seinem Sessel zurück und erhob sein Branntweinglas gleichsam auf sich selbst: Er hatte gewonnen. Um dem politischen Ruin zu entgehen, würde Victor Lanaklin, der große Markgraf von Glouston, seiner Tochter befehlen, ihn zu heiraten. Dem Markgrafen blieb gar nichts anderes übrig. Wenn etwas von dieser Sache zu Ethelred durchdrang, drohte Victor vielleicht sogar eine Anklage wegen Hochverrats. Imperialistische Könige verlangten von ihren Gefolgsleuten, dass sie ihre politische Haltung und ihre Kirchentreue uneingeschränkt teilten. Archibald bezweifelte zwar, dass Victor wirklich mit den Royalisten oder den Nationalisten sympathisierte, doch schon der kleinste Schatten eines Verdachts wäre dem König Grund genug, sich ungehalten zu zeigen. Im glimpflichsten Fall wäre es für Victor eine Beschämung, von der sich das Haus Lanaklin womöglich nie mehr erholen würde. Die einzig vernünftige Reaktion für den Markgrafen wäre, Alenda mit ihm zu verheiraten.
Dann würde Archibald das Land zufallen, das an seine Grafschaft grenzte, und mit der Zeit würde er vielleicht sogar die gesamte Mark kontrollieren. Mit Chadwick in der einen und Glouston in der anderen Hand würde er bei Hofe so viel Macht haben wie der Herzog von Rochelle.
Archibald blickte auf den grauhaarigen alten Mann in der vornehmen Reisekleidung hinab: Er tat ihm fast schon leid. Einst, vor langer Zeit, hatte Lanaklin als außerordentlich kluger und tapferer Mann gegolten. Als Markgraf war er nicht wie ein gewöhnlicher Graf einfach nur ein Lehensmann gewesen, der seine Ländereien für den König verwaltete. Victor war dafür verantwortlich gewesen, die Grenzmark des Königreichs zu verteidigen. Das war eine wichtige Aufgabe, die einen wachsamen, kampferprobten Mann und fähigen Heerführer erforderte. Doch die Zeiten hatten sich geändert, Warric lebte jetzt mit den Nachbarn jenseits der Grenze im Frieden. Also hatte sich der mächtige Grenzhüter in einem ruhigen Leben eingerichtet, und seine Kräfte waren mangels Herausforderung verkümmert.
Während Victor das Band von dem Briefstapel löste, dachte Archibald an seine Zukunft. Der Markgraf hatte recht. Archibald hatte es auf das Land abgesehen, das Alenda mit in die Ehe bringen würde. Dennoch, das Mädchen war hübsch, und die Vorstellung, dass sie notgedrungen das Bett mit ihm teilen würde, war durchaus reizvoll.
»Soll das ein Scherz sein, Archibald?«, fragte Victor.
Aus seinen Gedanken gerissen, stellte Archibald das Glas ab. »Was?«
»Auf diesen Pergamenten steht nichts.«
»Was? Seid Ihr blind? Da –« Archibald verstummte jäh, als er die leeren Bögen in der Hand des Markgrafen sah. Er schnappte sich eine Handvoll Briefe und riss sie auf, fand aber nur weitere unbeschriebene Seiten. »Das kann nicht sein!«
»Vielleicht waren sie ja mit einer Geheimtinte geschrieben, die von selbst verschwindet«, sagte Victor grinsend.
»Nein … das verstehe ich nicht … Es sind nicht mal dieselben Pergamente!« Er sah im Panzerschrank nach, aber der war leer. Seine Verwirrung schlug in Panik um. Er riss die Tür auf und rief hektisch nach Bruce. Der Gardeführer stürzte mit gezogenem Schwert herein. »Wo sind die Briefe, die ich in diesem Panzerschrank hatte?«, brüllte Archibald den Soldaten an.
»Ich – ich weiß nicht, Erlaucht«, antwortete Bruce. Er steckte das Schwert weg und nahm Haltung an.
»Was heißt, du weißt es nicht? Hast du heute Abend irgendwann deinen Posten verlassen?«
»Nein, Herr, natürlich nicht.«
»Hat irgendjemand in meiner Abwesenheit mein Arbeitszimmer betreten?«
»Nein, Herr, das geht gar nicht. Ihr habt den einzigen Schlüssel.«
»Wo um Maribors Willen sind dann diese Briefe? Ich habe sie doch selbst hineingelegt. Als der Markgraf kam, habe ich ja in ihnen gelesen. Ich war doch nur ein paar Minuten weg. Wie können sie einfach verschwunden sein?«
Archibalds Gedanken rasten. Er hatte sie doch vorhin noch in der Hand gehalten. Und sie dann im Panzerschrank eingeschlossen. Dessen war er sich ganz sicher.
Wo waren sie geblieben?
Victor trank sein Glas aus und erhob sich. »Wenn Ihr nichts dagegen habt, Archie, gehe ich jetzt. Ich habe schon genug Zeit vergeudet.«
»Wartet, Victor. Geht nicht. Die Briefe gibt es wirklich. Ich versichere Euch, ich hatte sie hier.«
»Natürlich, Archie. Wenn Ihr mich das nächste Mal erpressen wollt, rate ich Euch, mit einer besseren Finte aufzuwarten.« Er ging hinaus und verschwand die Treppe hinab.
»Überlegt Euch, was ich gesagt habe, Victor!«, rief ihm Archibald nach. »Ich werde diese Briefe wiederfinden. Mit Sicherheit! Dann gehe ich damit nach Aquesta! Und lege sie bei Hofe vor!«
»Was soll ich jetzt tun, Herr?«, fragte Bruce.
»Warten, Idiot. Ich muss nachdenken.« Archibald fuhr sich mit zittrigen Fingern durchs Haar und ging im Turmzimmer auf und ab. Er inspizierte die Blätter noch einmal genau. Es war tatsächlich eine andere Sorte Pergament als das der Briefe, die er so oft gelesen hatte.
Obwohl er sich sicher war, die Briefe in den Panzerschrank gelegt zu haben, begann er nun doch, Schubladen aufzuziehen und die Schriftstücke auf seinem Schreibtisch durchzusehen. Er schenkte sich noch einen Branntwein ein, ging an den Kamin, zog den Kaminschirm weg und stocherte mit einem Schüreisen in der Asche nach möglichen Pergamentresten. Nichts. Frustriert warf Archibald die leeren Bögen ins Feuer. Er leerte sein Glas in einem Zug und ließ sich in einen der Sessel fallen.
»Sie waren doch eben noch hier«, sagte Archibald ratlos. Langsam nahm ein Gedanke in seinem Kopf Gestalt an. »Bruce, jemand muss die Briefe gestohlen haben. Der Dieb kann noch nicht weit gekommen sein. Ich will, dass du das ganze Schloss durchsuchst. Verschließe alle Ausgänge. Lass niemanden hinaus. Keine Bediensteten, keine Wachen – niemanden! Durchsuche jeden einzelnen!«
»Sofort, Herr«, antwortete Bruce, stutzte dann aber. »Und der Markgraf, Herr? Soll ich ihn auch aufhalten?«
»Natürlich nicht, Idiot, er hat die Briefe nicht.«
Archibald starrte ins Feuer und horchte Bruces eiligen Schritten auf der Turmtreppe hinterher. Dann war er allein mit dem Knistern der Flammen und hundert offenen Fragen. Er zermarterte sich das Hirn, kam aber einfach nicht darauf, wie ein Dieb das angestellt haben konnte.
»Euer Erlaucht?« Die schüchterne Stimme des Dieners riss ihn aus seinen Gedanken. Archibald funkelte den Mann, der den Kopf zur offenen Tür hereinstreckte, so grimmig an, dass dieser noch einmal tief Luft holte, ehe er sagte: »Herr, ich störe Euch ungern, aber es scheint drunten im Schlosshof ein Problem zu geben, welches Eure Anwesenheit erfordert.«
»Was für ein Problem?«, fauchte Archibald.
»Herr, man hat mir keine Einzelheiten mitgeteilt, aber es geht irgendwie um den Markgrafen. Man hat mich geschickt, Euch zu sagen, dass Ihr herunterkommen sollt – die Güte haben mögt herunterzukommen, meine ich.«
Archibald ging die Turmtreppe hinab und fragte sich, ob der alte Mann vielleicht vor seiner Tür tot umgefallen war, was so schlimm nicht gewesen wäre. Im Schlosshof jedoch traf er den quicklebendigen und wutschnaubenden Markgrafen an. »Da seid Ihr ja endlich, Ballentyne! Was habt Ihr mit meiner Kutsche gemacht?«
»Womit?«
Bruce kam und winkte Archibald ein Stück beiseite. »Euer Erlaucht«, flüsterte er dem Grafen ins Ohr. »Anscheinend sind die Kutsche und die Pferde des Markgrafen verschwunden.«
Archibald erhob den Zeigefinger in Richtung des Markgrafen und sagte laut: »Ich komme sofort, Victor.« Dann flüsterte er Bruce zu: »Verschwunden? Wie kann das sein?«
»Ich weiß nicht, Herr, aber, nun ja, der Torwächter sagt, dass der Markgraf und sein Kutscher oder jedenfalls zwei Personen, die er für dieselben hielt, schon zum Haupttor hinausgefahren sind.«
Von jähen Schwindelgefühlen überfallen, wandte sich Archibald wieder dem zornroten Markgrafen zu.
2 Geschäftstreffen
Mehrere Stunden nach Einbruch der Dunkelheit traf Alenda Lanaklin mit einer Kutsche in der Unterstadt von Medford ein. Das Wirtshaus ZUR DORNIGEN ROSE lag zwischen anderen armseligen Häusern mit krummen Dächern an einer namenlosen Straße, die in Alendas Augen kaum mehr als eine finstere Gasse war. Vor kurzem hatte es heftig geregnet; das Kopfsteinpflaster war nass und voller Pfützen. Vorbeifahrende Kutschen bespritzten die Front des Wirtshauses mit der schlammigen Brühe, die Dreckspuren auf dem düsteren Stein und verwitterten Holz hinterließ.
Aus einer Tür trat ein schwitzender, glatzköpfiger Mann mit freiem Oberkörper; er trug einen großen Kupfertopf und kippte den Inhalt, der aus knochigen Fleischüberbleibseln bestand, kurzerhand auf die Straße. Sofort stürzten sich ein halbes Dutzend Hunde darauf. Abgerissene Gestalten, im flackernden Licht der Wirtshausfenster nur vage zu erkennen, brüllten in einer Sprache, die Alenda nicht identifizieren konnte, übelgelaunt auf die Hunde ein. Einige warfen Steine nach den dürren Tieren, die jaulend davonrannten. Die Gestalten eilten herbei und sahen, was die Hunde übriggelassen hatten, und stopften es sich in Mund und Taschen.
»Seid Ihr sicher, dass wir hier richtig sind, Herrin?«, fragte Emily. »Das kann uns Vicomte Winslow doch nicht im Ernst zumuten.«
Alenda inspizierte noch einmal die stachlige Ranke mit der einen Blüte auf dem verzogenen Schild über der Tür. Das Rot der Blüte war zu Grau verblasst, und die verwitterte Ranke ähnelte einer Schlange. »Das muss es sein. Ich glaube nicht, dass es in Medford mehr als ein Wirtshaus ZUR DORNIGEN ROSE gibt.«
»Es ist nicht zu fassen! Er bestellt uns in so eine – Örtlichkeit!«
»Mir gefällt es so wenig wie dir, aber es ist nun mal so vereinbart. Ich wüsste nicht, was uns für eine andere Wahl bliebe.« Alenda staunte selbst, wie unerschrocken sie daherredete.
»Ich weiß, Ihr wollt es nicht mehr hören, aber ich halte diese Sache immer noch für einen Fehler. Mit Dieben sollte man keine Geschäfte machen. Denen kann man nicht trauen, Herrin. Ich sage Euch, diese Männer, die Ihr da gedungen habt, werden Euch genauso bestehlen, wie sie’s mit allen anderen machen.«
»Jedenfalls sind wir jetzt hier, also sollten wir’s hinter uns bringen.« Alenda öffnete die Tür der Kutsche und stieg aus, wobei sie mit Sorge bemerkte, dass einige der herumlungernden Gestalten sie äußerst aufmerksam beobachteten.
»Das macht einen Silbertaler«, erklärte der Kutscher, ein mürrischer älterer Mann, der sich schon länger nicht mehr rasiert hatte. Seine schmalen Augen lagen sehr tief zwischen so vielen Falten, dass Alenda sich fragte, wie er genug sehen konnte, um die Kutsche zu lenken.
»Ach, ich dachte, ich bezahle dich am Ende der Fahrt«, erklärte Alenda. »Wir halten hier nur kurz.«
»Wenn ich warten soll, kostet das extra. Und was ich bis hierher von Euch kriege, will ich jetzt, für den Fall, dass Ihr beschließt, nicht wiederzukommen.«
»Das ist doch lächerlich. Ich versichere dir, wir kommen zurück.«
Das Gesicht des Mannes zeigte die Nachgiebigkeit von Granit. Vom Bock aus spuckte er Alenda vor die Füße.
»Also wirklich!« Alenda zog eine Münze heraus und gab sie dem Kutscher. »Hier hast du deinen Silbertaler, aber rühre dich nicht vom Fleck. Ich weiß nicht genau, wie lange wir brauchen, aber wie gesagt, wir kommen zurück.«
Emily stieg aus der Kutsche, zupfte Alendas Kapuze zurecht und vergewisserte sich, dass die Knöpfe ihrer Herrin ordentlich geschlossen waren. Sie strich zuerst Alendas Umhang glatt und verfuhr dann genauso mit ihrem eigenen Kleidungsstück.
»Ich wollte, ich könnte diesem dummen Kutscher sagen, wer ich bin«, flüsterte Alenda. »Und dann würde ich ihm auch noch ein paar andere Sachen sagen.«
Die beiden Frauen trugen die gleichen wollenen Umhänge, und unter den hochgeschlagenen Kapuzen sah man kaum mehr als ihre Nasen. Alenda bedachte Emily mit einem unwirschen Blick und wischte ihre geschäftigen Hände weg.
»Sei nicht so eine aufgeregte Glucke, Emmy. Ich bin sicher, es waren schon andere Frauen in diesem Etablissement.«
»Frauen schon, aber Edelfrauen wohl eher nicht.«
Als sie durch die schmale Holztür des Wirtshauses traten, traf sie eine Wolke aus Rauch und Alkoholdunst und noch einem anderen Geruch, den Alenda bisher nur von Abtrittsbesuchen kannte. Zwanzig Unterhaltungen versuchten sich gegenseitig zu übertönen, während ein Fiedler eine muntere Melodie spielte. Vor dem Schanktisch tanzten Leute, indem sie im Rhythmus der Fiedelmusik laut mit den Absätzen auf den welligen Holzboden stampften. Gläser klirrten, Fäuste hieben auf Tische, Gäste lachten und sangen viel lauter, als es Alenda schicklich schien.
»Was machen wir jetzt?« Emilys Stimme kam aus den Tiefen der Wollkapuze.
»Den Vicomte suchen, würde ich sagen. Bleib dicht bei mir.«
Alenda fasste Emily an der Hand und zog sie hinter sich her, während sie sich zwischen den Tischen durchschlängelte, den Tanzenden auswich und einen Hund umging, der freudig verschüttetes Bier aufleckte. Noch nie war Alenda an einem solchen Ort gewesen. Überall drängten sich vulgär aussehende Männer. Die meisten trugen zerlumpte Kleidung, und etliche hatten keine Schuhe an. Sie entdeckte überhaupt nur vier Frauen im Raum, allesamt Schankmägde in unanständig tief ausgeschnittenen, verschlissenen Kleidern. Ihre Aufmachung, dachte Alenda, lud die Männer regelrecht ein, sie unsittlich zu berühren. Ein zahnloser, behaarter Wüstling packte eine der Schankmägde um die Taille, zog sie auf seinen Schoß und strich ihr mit beiden Händen über den ganzen Körper. Schockiert stellte Alenda fest, dass das Mädchen kicherte anstatt zu schreien.
Schließlich entdeckte sie ihn. Vicomte Albert Winslow trug nicht wie sonst immer Wams und Strumpfhosen, sondern ein schlichtes Leinenhemd, wollene Kniehosen und eine gutsitzende Wildlederweste. Seine Garderobe entbehrte jedoch nicht jeder aristokratischen Note: Seinen Kopf zierte ein hübscher, fast schon geckenhafter Federhut. Er saß an einem kleinen Tisch, zusammen mit einem kräftigen, schwarzbärtigen Mann in billiger Arbeitskleidung.
Als sie auf ihn zugingen, erhob sich Winslow und zog zwei Stühle für sie herbei. »Willkommen, meine Damen«, sagte er mit einem strahlenden Lächeln. »Ich bin ja so froh, dass Ihr es heute Abend einrichten konntet. Nehmt doch bitte Platz. Darf ich Euch etwas zu trinken bestellen?«
»Nein, danke«, sagte Alenda. »Ich möchte nicht lange bleiben. Der Kutscher ist nicht der Verlässlichste, und ich würde unser Geschäft gern abwickeln, ehe er beschließt, uns hier sitzenzulassen.«
»Verständlich, ja ich möchte sagen, überaus klug von Euch, Comtesse. Aber bedauerlicherweise ist die Ware für Euch noch nicht eingetroffen.«
»Ach?« Alenda fühlte Emilys Hand tröstend die ihre drücken. »Warum?«
»Das weiß ich leider nicht. Über den genauen Ablauf des Unternehmens bin ich nicht informiert. Mit derlei Kleinigkeiten befasse ich mich nicht. Aber Ihr könnt Euch gewiss vorstellen, dass es keine einfache Aufgabe war. Da kann sich schon allerlei ereignen, das zu einer Verzögerung führt. Darf ich Euch wirklich nichts bestellen?«
»Nein, danke«, sagte Alenda wieder.
»Aber setzen werdet Ihr Euch doch wenigstens?«
Alenda drehte sich zu Emily um, in deren Augen tiefe Besorgnis stand. Dennoch setzten sie sich, und dabei flüsterte sie Emily zu: »Ich weiß, ich weiß, ich sollte mit Dieben keine Geschäfte machen.«
»Macht Euch keine Sorgen, Comtesse«, sagte der Vicomte beruhigend. »Ich würde weder Eure Zeit und Euer Geld vergeuden noch Eure gesellschaftliche Stellung gefährden, wenn ich nicht vom Erfolg des Unternehmens überzeugt wäre.«
Der Bärtige am Tisch lachte leise. Er sah finster und verwahrlost aus, und seine Haut war wie gegerbtes Leder. Alenda beobachtete, wie seine dreckigen, schwieligen Hände den Trinkkrug an seine Lippen führten. Als er ihn wieder absetzte, rannen Biertropfen über seinen Bart und fielen aufs Tischtuch, ohne dass er etwas dagegen unternahm. Alenda befand, dass sie ihn nicht leiden konnte.
»Das ist Mason Grumon«, erklärte Winslow. »Verzeiht, dass ich ihn Euch nicht gleich vorgestellt habe. Mason ist Schmied hier in der Unterstadt. Er ist … ein Freund.«
»Die Burschen, die Ihr da gedungen habt, sind wirklich gut«, erklärte Mason. Seine Stimme erinnerte Alenda an das Geräusch von Kutschenrädern auf Schotter.
»Ach ja?«, fragte Emily. »So gut, dass sie Schätze aus Glenmorgans Zeiten aus dem Kronturm von Ervanon stehlen könnten?«
»Wovon sprecht Ihr?«, fragte Winslow.
»Ich habe einmal gehört, dass Diebe uralte Schätze aus dem Kronturm von Ervanon gestohlen und sie in der nächsten Nacht wieder zurückgebracht haben«, erklärte Emily.
»Warum sollte jemand so etwas tun?«, fragte Alenda.
Der Vicomte lachte leise. »Das ist sicher nur eine hübsche Geschichte. Kein vernünftiger Dieb würde sich so verhalten. Die meisten Menschen verstehen nicht, was Diebe und Räuber treibt. In Wahrheit stehlen die meisten von ihnen, um sich die Taschen zu füllen. Sie brechen in Häuser ein oder lauern Reisenden irgendwo an der Landstraße auf. Die Kühneren entführen vielleicht Edelleute, um Lösegeld zu erpressen. Manchmal schneiden sie ihrem Opfer sogar einen Finger ab und schicken ihn den nächsten Angehörigen, um zu demonstrieren, wie gefährlich sie sind und dass die Familie die Lösegeldforderungen ernst nehmen sollte. Im Allgemeinen sind das ziemlich unangenehme Kerle. Es geht ihnen nur darum, mit möglichst wenig Anstrengung zu Geld zu kommen.«
Wieder fühlte Alenda, wie ihre Hand gedrückt wurde, diesmal so fest, dass sie das Gesicht verzog.
»Die Diebe der besseren Sorte wiederum bilden Zünfte, ähnlich den Zünften der Steinmetze oder Zimmerleute, nur natürlich viel geheimer. Sie sind sehr gut organisiert und machen den Diebstahl zum Gewerbe. Sie stecken Gebiete ab, auf denen sie das Monopol in Sachen Diebstahl und Räuberei beanspruchen. Oft haben sie Arrangements mit den lokalen Ordnungshütern oder Amtsträgern: Gegen eine gewisse Gebühr können sie relativ ungestört arbeiten, solange sie bestimmte Personen und Orte verschonen und sich an beiderseits akzeptierte Regeln halten.«
»Beiderseits akzeptierte Regeln zwischen Amtsträgern und notorischen Verbrechern?«, fragte Alenda skeptisch.
»Oh, ich glaube, Ihr würdet staunen, wie viele Kompromisse geschlossen werden, um die reibungslosen Abläufe in einem Königreich zu garantieren. Es gibt jedoch noch einen weiteren Typus des Missetäters: den freischaffenden Spezialisten, oder genauer gesagt den Auftragsdieb. Diese Bösewichte dingt man für einen bestimmten Zweck, beispielsweise, um an etwas zu gelangen, das sich im Besitz eines adligen Standesgenossen befindet. Der Ehrenkodex und die Angst vor peinlichen Enthüllungen«, sagte er mit einem Augenzwinkern, »zwingen Adlige und reiche Kaufleute zuweilen, die Dienste eines solchen Spezialisten in Anspruch zu nehmen.«
»Dann stehlen sie also alles für jeden?«, fragte Alenda. »Die Männer, die Ihr für mich gedungen habt, meine ich.«
»Nein, nicht für jeden – nur für diejenigen, die die entsprechende Summe zu zahlen bereit sind.«
»Dann ist es also egal, ob der Auftraggeber ein Verbrecher oder ein König ist?«, mischte sich Emily ein.
Mason schnaubte verächtlich. »Verbrecher oder König, wo ist da der Unterschied?« Erstmals seit ihrer Ankunft verzog er den Mund zu einem breiten Grinsen, das etliche Zahnlücken entblößte.
Angewidert wandte sich Alenda wieder Winslow zu, doch der hatte den Kopf in Richtung Tür gedreht und versuchte, über die Gäste hinwegzuspähen. »Die Damen wollen mich bitte entschuldigen«, sagte er und stand unvermittelt auf. »Ich brauche noch etwas zu trinken, und die Bedienungen scheinen allesamt schwer beschäftigt. Kümmere dich doch solange um die Damen, einverstanden, Mason?«
»Ich bin doch keine Amme, Idiot!«, brüllte Mason dem Vicomte hinterher, als der sich durchs Gedränge entfernte.
»Ich – ich dulde nicht, dass Ihr so über die Comtesse redet«, warf sich Emily tapfer in die Bresche. »Sie ist kein Säugling. Sie ist ein Fräulein von hohem Stand, also besinnt Euch gefälligst, wo Euer Platz ist.«
Masons Gesicht verfinsterte sich. »Mein Platz ist hier. Ich wohne fünf Häuser weiter. Mein Vater hat diese Höllenspelunke mitgebaut. Mein Bruder schuftet hier als Koch. Meine Mutter hat hier in der Küche gearbeitet, bis sie von einer von Euren Nobelkutschen totgefahren wurde. Mein Platz ist hier. Ihr solltet Euch besinnen, wo Eurer ist.« Mason hieb so fest mit der Faust auf den Tisch, dass die Kerze hüpfte und die Damen zusammenschreckten.
Alenda zog Emily dicht an sich heran. Was habe ich mir da eingebrockt? Allmählich kam sie zu der Überzeugung, dass Emily recht hatte. Sie hätte diesem dahergelaufenen Winslow niemals trauen dürfen. Sie wusste ja gar nichts über ihn, außer, dass er als Gast von Baron Daref auf dem Herbstball in Aquesta gewesen war. Gerade sie hätte doch inzwischen gelernt haben sollen, dass nicht alle Edelleute edle Menschen waren.
Sie saßen schweigend da, bis Winslow ohne Bier zurückkam.
»Wenn die Damen mir bitte folgen wollen?« Der Vicomte winkte ihnen.
»Was ist?«, fragte Alenda beunruhigt.
»Folgt mir einfach, hier entlang.«
Alenda und Emily standen auf und folgten Winslow durch den Nebel von Pfeifenrauch und den Hindernisparcours aus Tanzenden, Hunden und Betrunkenen bis zum Hinterausgang. Gegen das, was sie hinter dem Wirtshaus erwartete, wirkte alles Bisherige kultiviert. Sie landeten in einer Gasse, die ihre schlimmsten Vorstellungen überstieg. Überall lag Abfall, und in einem offenen Graben mischten sich Exkremente, die man aus den darüberliegenden Fenstern gekippt hatte, mit Schlamm. Bretter dienten als Stege über den stinkenden Bach von Unrat. Die Edelfräulein rafften angewidert ihre Röcke.
Eine fette Ratte huschte unter einem Holzstoß hervor, um sich zu zwei anderen in der Abwasserrinne zu gesellen.
»Was sollen wir hier?«, flüsterte Emily mit zitternder Stimme Alenda zu.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Alenda, verzweifelt bemüht, ihre eigene Angst im Griff zu behalten. »Ich glaube, du hattest recht, Emily. Ich hätte mich nie mit diesen Leuten einlassen dürfen. Ganz egal, was der Vicomte sagt, Leute wie wir sollten mit Leuten wie denen keine Geschäfte machen.«
Der Vicomte führte sie durch einen Holzzaun und um zwei armselige Hütten herum zu einem notdürftig zusammengezimmerten Stall. Es war kaum mehr als ein Verschlag mit vier Abteilen, die jeweils eine Schicht Stroh und einen Wassereimer enthielten.
»Schön, Euch wiederzusehen, Comtesse«, sagte ein Mann vor dem Stallverschlag.
Es war der größere der beiden, aber an seinen Namen konnte sich Alenda nicht mehr erinnern. Sie hatte sie ja nur ein Mal kurz gesehen, bei einem von Winslow arrangierten Treffen auf einer einsamen Landstraße in stockdunkler Nacht. Jetzt, da der Mond mehr als halbvoll war und der Mann die Kapuze zurückgeschlagen hatte, konnte sie sein Gesicht erkennen. Er war hochgewachsen, in seiner ganzen Erscheinung ein rauher Bursche, der aber nichts Bedrohliches oder Unfreundliches hatte. Fältchen, die aussahen, als kämen sie vom Lachen, umspielten seine Augenwinkel. Alenda fand, dass er erstaunlich fröhlich, ja sogar freundlich wirkte. Sie konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass er gut aussah – welch seltsame Reaktion auf jemanden, dem sie an einem solchen Ort begegnete! Er war in Leder und Wolle gekleidet, dreckbespritzt und gut bewaffnet. An seiner linken Seite hing ein kurzes Schwert mit schmucklosem Heft, rechts ein ähnlich schlichtes, etwas längeres und breiteres Exemplar. Auf dem Rücken schließlich trug er eine mächtige Klinge, fast so lang wie er selbst.
»Mein Name ist Hadrian, falls Ihr es vergessen haben solltet«, sagte er und ließ der Vorstellung eine schickliche Verbeugung folgen. »Und wer ist die hübsche Dame, die Euch begleitet?«
»Das ist Emily, meine Zofe.«
»Zofe?« Hadrian mimte Überraschung. »So, wie sie aussieht, hätte ich sie für eine Herzogin gehalten.«
Emily neigte den Kopf, und zum ersten Mal bei diesem Unternehmen sah Alenda sie lächeln.
»Ich hoffe, wir haben Euch nicht allzu lange warten lassen. Der Vicomte sagt, er und Mason hätten Euch Gesellschaft geleistet?«
»Ja, das haben sie.«
»Hat Euch Grumon die tragische Geschichte erzählt, wie seine arme Mutter von einer rücksichtslosen königlichen Kutsche überfahren wurde?«
»Ja, das hat er. Und ich muss sagen –«
Hadrian hob gespielt-abwehrend die Hände. »Masons Mutter lebt und ist wohlauf. Sie wohnt im Handwerkerviertel in einem Haus, das um einiges hübscher ist als Masons Bruchbude. Sie war nie Köchin in der DORNIGEN ROSE. Er erzählt die Geschichte allen Adligen, denen er begegnet, um ihnen einen Dämpfer zu versetzen und ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich entschuldige mich für ihn.«
»Danke. Er war auch sonst ziemlich unhöflich, und ich fand seine Bemerkungen mehr als irritierend, aber …« Alenda holte tief Luft. »Habt ihr – ich meine, wart ihr … konntet ihr sie an euch bringen?«
Hadrian lächelte freundlich und rief dann über die Schulter zum Stall hin: »Royce?«
»Wenn du einen ordentlichen Knoten machen könntest, bräuchte ich nicht so lange«, sagte eine Stimme von drinnen. Gleich darauf kam der andere der beiden heraus.
Ihn hatte Alenda klarer in Erinnerung behalten, denn er war der Beängstigendere der beiden. Er war kleiner als Hadrian, mit feinen Gesichtszügen, dunklem Haar und dunklen Augen. Ganz in Schwarz gekleidet, trug er eine knielange Tunika und einen langen, fließenden Umhang, der ihn in Dunkelheit hüllte wie ein Schatten. Obwohl er nicht besonders kräftig wirkte und offensichtlich unbewaffnet war, fürchtete Alenda diesen Mann. Mit seinen kalten Augen, seinem ausdruckslosen Gesicht und seiner schroffen Art verbreitete er die Freundlichkeit eines Raubtiers.
Aus seiner Tunika zog Royce einen Stapel Briefe, der mit einem blauen Band umschnürt war. Er reichte ihn ihr und sagte: »Es war nicht leicht, da heranzukommen, bevor Ballentyne sie Eurem Vater zeigen konnte. Es war sogar ein äußerst knappes Rennen, aber wir haben gewonnen. Vielleicht verbrennt Ihr sie besser, ehe so etwas noch einmal passiert.«
Sie starrte auf den Packen Briefe, und ein erleichtertes Lächeln breitete sich über ihr Gesicht. »Ich – ich kann’s kaum glauben! Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt und wie ich euch danken soll!«
»Bezahlen wäre schon mal ein guter Anfang«, antwortete Royce.
»Oh, ja, natürlich.« Sie gab den Packen Emily, löste den Beutel von ihrem Gürtel und reichte ihn dem Dieb. Der inspizierte rasch den Inhalt und warf dann den Beutel Hadrian zu, der ihn, schon auf dem Weg in den Stall, in eine Innentasche seiner Weste steckte.
»Ihr solltet vorsichtig sein. Es ist ein riskantes Spiel, das Ihr und Gaunt da spielt«, erklärte Royce.
»Ihr habt meine Briefe gelesen?«, fragte sie ängstlich.
»Nein. So viel habt Ihr uns auch wieder nicht bezahlt.«
»Woher wisst ihr dann –«
»Wir haben Euren Vater und Archibald Ballentyne belauscht. Der Markgraf hat zwar so getan, als glaubte er Ballentyne nicht, aber ich bin sicher, er weiß, dass es stimmt. Briefe hin oder her, Euer Vater wird Euch von jetzt an sehr genau beobachten. Trotzdem, der Markgraf ist ein anständiger Mann und wird das Rechte tun. Ich vermute, er ist so erleichtert, dass Ballentyne keine Beweise hat, die er bei Hofe vorlegen kann – da wird ihm Eure Affäre nicht allzu viel ausmachen. Aber, wie gesagt, ich an Eurer Stelle wäre in Zukunft vorsichtiger.«
»Woher will jemand wie du irgendetwas über meinen Vater wissen?«
»Oh, Verzeihung, habe ich von Eurem Vater gesprochen? Ich meinte den anderen Markgrafen, den mit der dankbaren Tochter.«
Alenda fühlte sich, als hätte ihr Royce eine Ohrfeige verpasst.
»Machst du dich wieder beliebt, Royce?«, fragte Hadrian, der jetzt die beiden Pferde aus dem Stall führte. »Ihr müsst meinem Freund verzeihen. Er wurde von Wölfen großgezogen.«
»Das sind ja die Pferde meines Vaters!«
Hadrian nickte. »Die Kutsche haben wir hinter einer Brombeerhecke an der Brücke über den Fluss abgestellt. Ach, übrigens, es könnte sein, dass ich ein Wams Eures Vaters etwas ausgeleiert habe. Es liegt bei seinem übrigen Gepäck in der Kutsche.«
»Ihr habt Sachen von meinem Vater angezogen?«
»Ich sagte doch schon«, erwiderte Royce, »es war äußerst knapp.«
***
Sie nannten es das Dunkelzimmer, wegen der Geschäfte, die dort geplant wurden, aber das kleine Hinterzimmer der DORNIGEN ROSE war alles andere als dunkel. Mehrere Kerzen in Wandleuchtern und auf dem Besprechungstisch sowie ein ordentliches Kaminfeuer spendeten ein warmes, gemütliches Licht. Von einem Holzbalken hingen eine Reihe Kupfertöpfe; sie erinnerten an die Zeit, als das Dunkelzimmer zugleich als Vorratskammer gedient hatte. Der Platz reichte gerade für den einen Tisch und eine Handvoll Stühle, doch für ihre Zwecke war das mehr als genug.
Die Tür ging auf, und eine kleine Gesellschaft kam herein. Royce goss sich ein Glas Wein ein, zog die Stiefel aus und wackelte vor dem Kamin mit den Zehen. Hadrian, Vicomte Albert Winslow, Mason Grumon und eine hübsche junge Frau nahmen am Besprechungstisch Platz. Gwen, die Wirtin der DORNIGEN ROSE, bereitete ihnen immer ein köstliches Festmahl, wenn sie von einem Auftrag zurückkehrten. So auch an diesem Abend. Das Menü bestand aus einer Kanne Bier, einem großen Braten, einem frischgebackenen Laib süßen Brotes, gekochten Kartoffeln, einem Laib Weißkäse, der in ein Tuch eingeschlagen war, sowie Karotten, Zwiebeln und Salzgurken aus dem Fass, das normalerweise hinter dem Schanktisch stand. Gwen war für Royce und Hadrian nur das Beste gut genug, und dazu gehörte auch die eigens aus Vandon importierte Flasche Montemorcey. Sie hatte den Wein stets vorrätig, weil es Hadrians Lieblingssorte war. So appetitlich allerdings auch alles aussah – Hadrian interessierte sich nicht dafür. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der jungen Frau.
»Und? Wie ist es letzte Nacht gelaufen?«, fragte Esmeralda, die jetzt auf Hadrians Schoß saß und ihm einen Krug mit dem schäumenden Hausgebrauten füllte. Eigentlich hieß sie Falina Brockton, aber alle Mädchen, die in der DORNIGEN ROSE oder im benachbarten MEDFORDHAUS arbeiteten, hatten sich zu ihrer eigenen Sicherheit Spitznamen zugelegt. Esmeralda, ein aufgewecktes, munteres Ding, war die oberste Schankmagd der DORNIGEN ROSE und eine der beiden Frauen, die das Dunkelzimmer