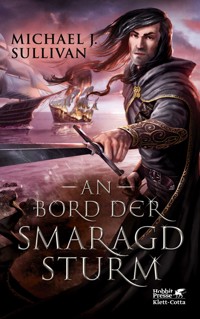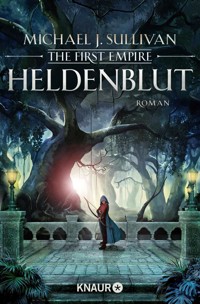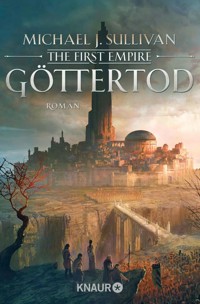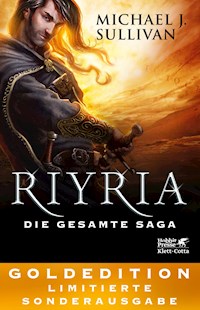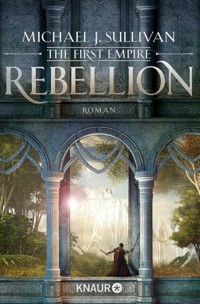13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Riyria-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Die US-Nr.1 Bestsellerserie Dreimal hatten sie schon versucht, sie zu ermorden. Schließlich wurde ein Profikiller angeheuert. Die Zeit für Riyria einzugreifen ist gekommen. Im Zentrum des dritten Bandes der Riyria-Chroniken steht ein einzigartiges Mordkomplott. Als Nysa Dulgath, die letzte Nachkommin der ältesten Adelsfamilie Avryns, Ziel eines Attentats werden soll, bekommt Riyria den Auftrag, die Sache zu verhindern. Dafür reisen Hadrian und Royce in eine der entlegensten Ecken des Landes, an einen Ort, der sogar älter ist als das gesamte Reich. Und sie müssen, um die Gräfin schützen zu können, eine Antwort auf die Frage finden, wie hier wohl ein professioneller Mörder vorgehen würde. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung, denn Lady Dulgath hat ein dunkles Geheimnis, das unbedingt gehütet werden muss. Womöglich hat es mit der Kirche Nyphrons zu tun, deren Macht immer obskurer wird...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Der Anschlag auf Dulgath
Die Riyria-Chroniken 3
Aus dem Amerikanischen von Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Death of Dulgath« im Verlag RIYRIA ENTERPRISES
© 2015 by Michael J. Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Illustration von © Larry Rostant
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98215-2
E-Book ISBN 978-3-608-11684-7
Inhalt
1
Das neue Schild
2
Der Maler
3
Maranon
4
Jenseits des Meeres
5
Burg Dulgath
6
Herberge und Schlafgemach
7
Eine Partie Zehn Finger
8
Im Auge des Sturms
9
Der Diebstahl der Schwerter
10
Der Geist im Hof
11
Breckenmoor
12
Gräfin Dulgath
13
Fawkes und Komplizen
14
Die Nachricht
15
Das Gemälde
16
Die Straße nach Süden
17
Shervin Gerami
18
Gebrochene Knochen
19
Ein Spektakel
20
Der Attentäter
21
Das Unwetter
22
Lange Rede, kurzer Sinn
23
Unter dem Kloster
24
Das Bedürfnis zu töten
25
Fünf lebenswichtige Dinge
Glossar der Namen, Orte und Begriffe
Nachbemerkung des Autors
Für 1876 großzügige Sponsoren
und eine unermüdliche Helferin.
Ohne euch hätte ich es nicht geschafft.
1
Das neue Schild
Wenn jemand Royce Melborn in diesem Moment gefragt hätte, was er am meisten hasste, hätte er gesagt: Hunde! Hunde und Zwerge führten seine Liste an, beide gleichermaßen verhasste Wesen, weil sie so viel gemeinsam hatten – sie waren gedrungen, bösartig und unentschuldbar haarig. Dass Royce’ Ablehnung über die Jahre noch gewachsen war, hatte in beiden Fällen denselben Grund: Hunde wie Zwerge hatten großes Leid über ihn gebracht.
An diesem Abend war es ein Hund.
Zuerst hielt er die behaarte Kreatur auf der Matratze der Schlafkammer im zweiten Stock für ein Nagetier. Das dunkle Etwas mit dem geringelten Schwanz und der platten Nase war so klein, dass es sich um eine große Kanalratte handeln konnte. Er überlegte gerade, wie eine Ratte in ein so vornehmes Haus wie Gut Hemley gelangt war, da stand das Tier auf. Die beiden starrten einander an, Royce in seinem Kapuzenmantel das Tagebuch in der Hand und die Promenadenmischung auf ihren kleinen Beinchen. Eine Schrecksekunde genügte Royce, seinen Fehler zu erkennen. Er zog eine Grimasse, weil er wusste, was als Nächstes kommen würde, was immer als Nächstes kam, und der kleine Köter enttäuschte ihn nicht.
Er begann zu bellen. Kein ehrbares Knurren oder tiefkehliges Lautgeben, sondern ein ohrenbetäubend schrilles Kläffen.
Ganz klar keine Ratte. Warum konntest du keine Ratte sein? Mit denen habe ich keine Probleme.
Royce griff nach seinem Dolch, aber der Rattenhund sprang weg, und man hörte das Klicken seiner kleinen Nägel auf den Dielen. Royce hoffte, er würde nach draußen Reißaus nehmen. Denn selbst wenn das kleine Monster sein Herrchen weckte, konnte es ihm doch nicht melden, dass ein mit einer Kapuze verhüllter Fremder in Frau von Martels Boudoir eingedrungen war. Aus seinem friedlichen Schlummer gerissen, warf das Herrchen womöglich etwas nach ihm, um es zum Schweigen zu bringen. Aber das kleine Monster war eben ein Hund, und Hunde taten wie Zwerge nie das, was Royce wollte. Stattdessen blieb das Tier mit dem rübenförmigen Kopf in sicherer Entfernung stehen und jaulte und kläffte zum Steinerweichen.
Wie kann ein so kleines Tier einen solchen Krach machen?
Marmor und Mahagoni warfen den Lärm zurück und verstärkten ihn zu einem alarmierenden Geheul.
Royce tat das Einzige, was ihm übrig blieb: Er sprang aus dem Fenster. Es war nicht der geplante Abgang, nicht einmal die dritte Wahl, aber die Pappel war in Sprungweite. Er bekam einen dicken Ast zu fassen, der zu seiner Erleichterung nicht unter seinem Gewicht brach. Allerdings erzitterte der Baum und raschelte laut durch den stillen, dunklen Hof. Als Royce mit den Füßen auf dem Boden landete, bekam er deshalb wenig überraschend Folgendes zu hören:
»Keine Bewegung!« Die heisere Stimme passte perfekt zu dem Befehl.
Royce erstarrte. Der Mann, der auf ihn zutrat, hielt eine Armbrust. Sie war geladen und gespannt und zielte auf seine Brust. Leider wirkte der Wächter sehr kompetent, sogar an seiner Uniform war nichts auszusetzen. Sämtliche Knöpfe waren dran und blitzten im Mondlicht. Die Falten waren messerscharf. Offenbar ein Streber oder noch schlimmer – ein Profisoldat, zum Wachdienst degradiert.
»Hände hoch, wo ich sie sehen kann.«
Er weiß, was er tut.
Hinter dem ersten Wächter erschien mit schweren Schritten und klirrenden Gurten und Ketten ein zweiter. Er war größer als der erste, aber weniger gut gekleidet. Die Ärmel seines Mantels waren zu kurz. Ein fehlender Knopf verdarb die Symmetrie der Doppelreihe von Messingknöpfen, und ein dunkler Fleck verunzierte den Kragen. Anders als der erste Wächter trug er auch keine Armbrust. Stattdessen war er mit drei Schwertern bewaffnet: einem kurzen an der linken Hüfte, einem etwas längeren an der rechten und einem gewaltigen Zweihänder auf dem Rücken. Die Wächter von Gut Hemley besaßen keine solchen Waffen, aber der Mann, der Royce gestellt hatte, sah sich nicht um, als der zweite Mann hinter ihn trat.
Der Neuankömmling zog das kürzeste seiner Schwerter, richtete es aber nicht auf Royce, sondern hielt es mit der Spitze an den Nacken des Wächters. »Armbrust runter«, sagte er.
Der Mann zögerte nur ganz kurz, dann ließ er die Armbrust fallen. Der Aufprall löste den Abzug aus, und der Bolzen flog zischend durch das Gras des gepflegten Rasens. Hinter ihnen kläffte immer noch der Rattenhund, doch wurde der Lärm durch die Mauern des Hauses gedämpft. Jetzt, wo sein Partner Hadrian die Lage im Griff hatte, steckte Royce das Tagebuch in seinen Gürtel und blickte zum Herrenhaus. Kein Licht. Adlige hatten einen gesunden Schlaf.
Er wandte sich Hadrian zu, der dem penibel gekleideten Wächter immer noch das Schwert an den Hals hielt. »Töte ihn und lass uns gehen.«
Der Wächter erstarrte.
»Nein«, erwiderte Hadrian so empört, wie Royce es auf die Aufforderung erwartet hätte, eine gute Flasche Wein wegzuschütten.
Er seufzte. »Nicht schon wieder. Warum müssen wir immer darüber streiten?«
Der seiner Armbrust beraubte Wächter hatte in Erwartung des Schwerthiebs, der sein Leben beenden würde, die Schultern hochgezogen und die Fäuste geballt. »Bitte, ich schlage auch nicht Alarm.«
Royce hatte diesen Blick schon oft gesehen und fand, dass der Mann sich tapfer schlug. Kein Winseln, kein Schreien, kein Betteln. Er hasste es, wenn seine Opfer wimmernd auf die Knie fielen, obwohl es so zugebenermaßen leichter war, sie zu töten. »Mund halten!«, befahl er und sah Hadrian wütend an. »Töte ihn und lass uns gehen. Wir haben keine Zeit zum Streiten.«
»Er hat die Armbrust fallen lassen«, erwiderte Hadrian. »Wir brauchen ihn nicht mehr zu töten.«
Royce schüttelte den Kopf. Da war das Wort wieder – brauchen. Hadrian verwendete es oft, als bedürfte es einer Rechtfertigung fürs Töten. »Er hat mich gesehen.«
»Und? Du bist ein Mann mit einer schwarzen Kapuze. Davon gibt es Hunderte.«
»Darf ich was sagen?«, fragte der Wächter.
»Nein«, sagte Royce barsch.
»Ja«, sagte Hadrian.
»Ich habe eine Frau.« Seine Stimme zitterte.
»Er hat eine Frau.« Hadrian nickte mitfühlend, während er zugleich das Schwert weiter an seinen Hals drückte.
»Und auch Kinder – drei.«
»Beim Bart Maribors, er hat drei Kinder«, sagte Hadrian, als sei die Sache damit entschieden, und senkte sein Schwert.
Der Wächter atmete aus. Irgendwie gingen er und Hadrian beide davon aus, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, sei in dieser Situation von Belang. Sie war es nicht.
»Und ich habe ein Pferd«, erklärte Royce mit derselben Überzeugung. »Auf dem ich wegreiten werde, sobald du diesen Wicht getötet hast. Zieh es nicht in die Länge. Du bist grausam, nicht ich. Bring es hinter dich.«
»Ich werde ihn nicht töten.«
Der Wächter riss hoffnungsvoll die Augen auf, und seine Mundwinkel verzogen sich zu einem kaum merklichen Lächeln der Erleichterung. Er sah Royce an, auf ein Zeichen wartend, dass er den nächsten Morgen tatsächlich erleben würde.
Royce hörte eine Tür aufgehen. Jemand rief: »Ralph?«, und im Haus ging Licht an. Hinter sieben Fenstern auf vier Stockwerken leuchteten Kerzen.
Vielleicht hat es nur so lange gebraucht, sie anzuzünden.
»Hier!«, rief Ralph zurück. »Diebe! Hol Hilfe!«
Nein, natürlich würde er keinen Alarm schlagen!
Das reichte. Royce griff nach seinem Dolch.
Doch bevor er ihn ziehen konnte, schlug Hadrian Ralph mit dem Schwertknauf nieder. Ralph fiel ins Gras neben die abgeschossene Armbrust. Ob Hadrian ihn geschlagen hatte, weil er gerufen hatte oder weil Royce seinen Dolch hatte ziehen wollen, war unmöglich zu entscheiden. Ersteres wäre Royce lieber gewesen, er vermutete aber Letzteres.
»Verschwinden wir«, sagte Hadrian. Er stieg über Ralph und zog Royce am Arm mit sich.
Ich habe nicht getrödelt, dachte Royce, er wollte aber nicht schon wieder streiten. Wo es eine Armbrust gab, da gab es auch noch weitere. Armbrüste waren zwar weder klein noch behaart, aber sie gehörten eigentlich auch auf seine Liste. Geduckt eilten sie hinter den blühenden Rosenbüschen im Schatten der Mauer entlang, obwohl Royce nicht wusste, warum sie sich überhaupt versteckten. Hadrian machte in seiner Wächtermontur ein Getöse wie ein fertig aufgezäumtes Kutschpferd.
Die Provinz Galilin in Melengar war eine ruhige, ländliche Region, in der es kaum Diebe gab, entsprechend ineffektiv waren die Sicherheitsvorkehrungen auf Baron Hemleys Landsitz. Royce hatte auf verschiedenen Erkundungsgängen insgesamt sechs Wächter gezählt, aber in dieser Nacht waren nur drei davon da: ein Posten am Tor, Ralph und der Hund.
»Ralph!«, rief wieder jemand. Die Stimme klang fern, war aber über den Rasen deutlich zu hören.
In der Dunkelheit hinter ihnen hüpften fünf Laternen auf und ab. Sie bewegten sich willkürlich wie ein orientierungsloser Suchtrupp oder ein Schwarm betrunkener Glühwürmchen.
»Aaron, weckt alle auf!«
»Lasst Herrn Hippel von der Leine«, rief die Stimme einer Frau empört. »Er findet sie.«
Und über allem war weiter das schrille Gekläff des Rattenhunds zu hören – zweifellos Herr Hippel.
Das Eingangstor war nicht besetzt. Offenbar war der Posten damit beschäftigt, auf Ralphs Schrei hin Hilfe zu holen. Sie passierten es ungehindert. Royce konnte über Hadrians Glück nur staunen. Der Mann war eine wandelnde Hasenpfote. Drei Jahre in Royce’ Schule des praktischen Lebens hatte seinem idealistischen Panzer kaum einen Kratzer zufügen können. Wenn Herr Hippel größer und angriffslustiger gewesen wäre, wären sie womöglich nicht so leicht davongekommen. Hadrian war zwar durchaus in der Lage, einen Hund zu töten, aber Royce war sich nicht sicher, ob er es auch getan hätte.
Der Hund hat Junge, Royce! Drei!
Sie tauchten in die Sicherheit des Waldesdickichts ein, in dem sie ihre Pferde gelassen hatten. Hadrians Stute hieß Tänzerin. Royce dagegen sah keinen Sinn darin, seinem Pferd einen Namen zu geben. Er verstaute das Tagebuch in einer Satteltasche. »Wie viele Jahre warst du Soldat?«
»In Avryn oder Calis?«
»Wo auch immer.«
»Fünf, aber die letzten beiden waren … mehr inoffiziell.«
»Fünf Jahre? Du hast fünf Jahre gekämpft? In Schlachten?«
»O ja – in bestialischen Schlachten.«
»Mhm.«
»Du bist sauer, weil ich Ralph nicht getötet habe, ja?«
Royce hielt kurz inne und lauschte. Nichts zu sehen und zu hören, kein Verfolger, kein Licht zwischen den Bäumen, nicht einmal das besessene Kläffen des Rattenhunds. Er schwang das Bein über den Sattel und schob den Fuß in den Steigbügel auf der anderen Seite. »Glaubst du?«
»Ich wollte doch nur ein Mal einen Auftrag ausführen, ohne dass es dabei Tote gibt.« Hadrian zog den Uniformrock aus und ersetzte ihn durch das Wollhemd und das lederne Wams aus seiner Satteltasche.
»Warum?«
Hadrian schüttelte den Kopf. »Egal.«
»Das ist doch albern. Wir haben schon ganz viele Aufträge ausgeführt, ohne dass wir jemanden getötet haben. Aber gut, kein Problem.« Royce nahm die Zügel, die er miteinander verknotet hatte.
»Was? Was hast du zuletzt gesagt?«
»Kein Problem. Alles gut.«
»Gut?« Hadrian hob die Augenbrauen.
Royce nickte. »Hörst du schlecht?«
»Nein, nur …« Hadrian sah ihn verwirrt an. Dann verfinsterte sein Blick sich. »Du hast vor, später noch mal herzukommen, richtig?«
Der Dieb schwieg.
»Warum?«
Royce wendete sein Pferd. »Ich bin nur gründlich.«
Hadrian stieg ebenfalls auf. »Du bist ein solcher Sturkopf. Es gibt dafür doch überhaupt keinen Grund. Ralph wird nie eine Bedrohung für uns sein.«
Royce zuckte mit den Schultern. »Das weißt du nicht. Weißt du überhaupt, was gründlich bedeutet?«
Hadrian runzelte die Stirn. »Und weißt du, was ein Sturkopf ist? Du brauchst Ralph doch nicht zu töten.«
Da war das Wort wieder – brauchen.
»Lass uns das später besprechen. Ich töte ihn nicht mehr heute Nacht.«
»Wie du meinst«, brummte Hadrian verärgert. Sie verließen das Dickicht und kehrten zu dem Weg zurück, der zur Straße führte.
Nebeneinander ritten sie durch das offene Gelände. Es begann zu regnen, noch bevor sie die Straße des Königs erreichten. Die Sonne war inzwischen aufgegangen, was sich allerdings aufgrund der Wolken, die kohlschwarz über ihnen hingen, kaum bemerkbar machte. Zum Glück schwieg Hadrian. In einer Schenke begann er sofort ein Gespräch, egal, ob er jemanden kannte oder nicht. Er unterhielt sich mit Fremden genauso ungezwungen wie mit alten Freunden. Er klopfte ihnen auf den Rücken, gab eine Runde Getränke aus und hörte geduldig so spannenden Geschichten zu wie der von der Ziege, die wiederholt in den Nachbargarten eingedrungen war.
Wenn sie nur zu zweit unterwegs waren, gab er Kommentare zu Bäumen, Kühen, Hügeln und Wolken ab, zum Wetter, das heiß war oder kalt, und zum Zustand aller möglichen Dinge von seinen Stiefeln, die neue Sohlen benötigten, bis zu seinem Kurzschwert, dessen Griff eine neue Umwicklung brauchte. Nichts war so unbedeutend, dass es keine Bemerkung verdiente. Dass es zu viele Hummeln gab oder zu wenige, konnte Hadrian zu einem zwanzigminütigen Vortrag inspirieren. Royce sagte dann nichts – er wollte seinen Partner nicht auch noch ermutigen –, aber Hadrian redete weiter über seine Bienen, die Blumen und den Morast der Straße, ein weiteres Lieblingsthema seiner Selbstgespräche.
So unermüdlich er sonst vor sich hin brabbelte, Regen brachte ihn immer zum Schweigen. Vielleicht bekam er davon schlechte Laune, oder er konnte seine Stimme im Prasseln der Tropfen nicht mehr hören. Was auch immer der Grund war, bei Regen schwieg er, und deshalb mochte Royce solche Tage. Das Glück war ihm während fast des ganzen Heimwegs hold. Melengar erlebte das feuchteste Frühjahr seit Jahren.
Ab und zu blickte Royce zu Hadrian hinüber. Hadrian hielt den Kopf gesenkt, und seine Kapuze hing ihm – schwer vom Wasser – in die Stirn.
»Warum redest du eigentlich nie, wenn es regnet?«, fragte Royce schließlich.
Hadrian schob den Daumen unter den vorderen Rand seiner Kapuze und hob sie an, um hinauszusehen. »Wie bitte?«
»Du redest sonst die ganze Zeit, aber nicht, wenn es regnet – warum nicht?«
Hadrian zuckte mit den Schultern. »Wusste nicht, dass es dich stört.«
»Tut es auch nicht. Mich stört, wenn du ununterbrochen quasselst.«
Hadrian sah zu ihm hinüber, und im Schatten seiner tropfenden Kapuze erschien ein Lächeln. »Du magst es doch, wenn ich rede.«
»Gerade habe ich gesagt …«
»Schon, aber das hättest du nicht, wenn dir mein Schweigen recht wäre.«
»Glaub mir, es ist mir recht.«
»Mhm.«
»Was soll das heißen?«
Hadrians Lächeln verbreiterte sich zu einem Grinsen. »Wir sind jetzt schon seit Monaten unterwegs, in denen ich lange Selbstgespräche geführt habe. Du hast nie etwas gesagt, obwohl einige richtig gut waren. Du hast keinen Ton von dir gegeben, aber jetzt, wo ich aufgehört habe – sieh einer an … quasselst du ununterbrochen.«
»Eine einzige Frage zu stellen ist nicht ununterbrochen quasseln.«
»Aber du zeigst Interesse. Wahnsinn!«
Royce schüttelte den Kopf. »Ich dachte nur, dass mit dir vielleicht was nicht stimmt – was ja offenbar der Fall ist.«
Hadrian behielt sein übertrieben selbstzufriedenes Grinsen bei, als hätte er in einem imaginären Wettkampf gepunktet. Royce zog sich die Kapuze tiefer über die Augen, damit er ihn nicht zu sehen brauchte.
Die Pferde trotteten durch Morast und gelegentlichen Schotter und schüttelten das Wasser von ihren Köpfen, sodass das Zaumzeug klirrte.
»Regnet ganz schön heftig, was?«, sagte Hadrian.
»Ach, sei doch still.«
»Die Bäuerin in Olmsted meinte, es sei der nasseste Frühling seit zehn Jahren.«
»Ich schneide dir die Kehle durch, wenn du schläfst, wirklich.«
»Sie hat die Suppe in Tassen serviert, weil ihr Mann und Jacob, also ihr Schwager, der tagsüber schläft und nachts trinkt, ihre guten Tonschalen kaputt gemacht haben.«
Royce trat sein Pferd in die Flanken und trabte voraus.
Royce und Hadrian waren in die Schiefe Straße in der Unterstadt von Medford zurückgekehrt. Das Frühjahr war fast vorbei. In anderen Gegenden der Welt ging die Baumblüte zu Ende, und die rosafarbenen Blüten wichen grünem Laub. Warme Winde bliesen erdige Gerüche über das Land, während die Bauern sich beeilten, die Saat auszubringen. In der Schiefen Straße dagegen regnete es seit vier Tagen ununterbrochen, und die Senke am Ende der Straße hatte sich wieder in einen trüben Teich verwandelt. Der offene Abwasserkanal, der hinter den Häusern verlief, war wie immer bei solchem Wetter randvoll und ergoss sich, nach menschlichen und tierischen Fäkalien stinkend, unter zwei euphemistisch »Brücke« genannten Planken hindurch in den wachsenden Teich.
Es regnete immer noch, als Royce, Gwen und Hadrian auf der aus Brettern gezimmerten Veranda des MEDFORDHAUSES standen und über den Tümpel hinweg das neue Schild der Schenke auf der anderen Straßenseite betrachteten. An einem schmiedeeisernen Winkel hing eine schön lackierte Holztafel mit einer leuchtend roten Blüte an einem gebogenen Stängel, an dem ein einzelner spitzer Dorn saß. Um die Blume rankten sich in schwungvollen Buchstaben die Worte ZUR DORNIGEN ROSE.
Das Schild wirkte an dem heruntergekommenen Gebäude mit seinem Satteldach aus nicht zusammenpassenden Schindeln und dem verwitterten Fachwerk merkwürdig fehl am Platz. Doch bei aller Baufälligkeit sah die Schenke schon deutlich besser aus. Noch vor einem Jahr hätten die des Lesens und Schreibens unkundigen Gäste des FRATZENKOPFS kein Schild gebraucht, um zu wissen, um was für ein Etablissement es sich handelte. Schmutzstarrende Fenster und Mauern, an denen der Mist klebte, sprachen eine deutliche Sprache. Doch Gwen hatte Fenster und Wände seit ihrer Übernahme geputzt. Die eigentlichen Verbesserungen aber hatten innen stattgefunden. Das neue Schild war nur der erste, von außen sichtbare Anfang.
»Schön!«, sagte Hadrian.
»Bei Sonne sieht es noch besser aus.« Gwen verschränkte kritisch die Arme. »Die Blüte ist wirklich perfekt gelungen. Emma hat sie vorgezeichnet, Dixon hat beim Malen geholfen. Ich glaube, sie hätte Rose gefallen.« Sie blickte zu den dunklen Wolken auf. »Ich hoffe, sie sieht das von dort oben – wie ihre Rose über Grues alter Tür hängt.«
»Bestimmt«, sagte Royce.
Hadrian starrte ihn an.
»Was?«, sagte Royce scharf.
»Seit wann glaubst du an ein Leben nach dem Tod?«
»Glaube ich nicht.«
»Warum hast du dann eben gesagt …?«
Royce schlug mit der Hand auf das Verandageländer, dass das Regenwasser auf dem Balken spritzte. »Siehst du?«, sagte er anklagend zu Gwen. »Das muss ich die ganze Zeit aushalten. Immer hat er etwas zu meckern. Warum lächelst du nie?, fragt er. Warum hast du dem Kind nicht zurückgewinkt? Hätte es dich umgebracht, zu der alten Frau nett zu sein? Warum sagst du nie ein freundliches Wort? Und jetzt, wenn ich mal freundlich sein will, was ist die Reaktion?« Er streckte die Hände zu Hadrian aus, als wollte er ihn Gwen zum ersten Mal vorstellen.
Hadrian starrte ihn weiter an, aber jetzt mit geschürzten Lippen, als wollte er sagen: Ist das dein Ernst? Stattdessen sagte er: »Du bist ja nur nett, weil sie hier ist.«
»Ich?«, fragte Gwen und blickte zwischen den beiden hin und her, die Unschuld in Person. »Was habe ich damit zu tun?«
Hadrian verdrehte die Augen und lachte schallend. »Ihr seid mir ein Paar! Immer wenn ihr zusammen seid, kommt ihr mir vor wie zwei Fremde – nein, nicht Fremde, Personen, die das Gegenteil von euch sind. Royce verwandelt sich in einen Kavalier, und du tust so, als hättest du keine Ahnung von Männern.«
Royce und Gwen sahen ihn mit abwehrend verständnislosen Blicken an.
Hadrian lachte leise. »Na gut, dann geht der heutige Tag eben als Tag der Gegenteile in die Geschichte ein. Und in diesem Sinn überquere ich jetzt das Meer der Düfte und nehme im Palast der köstlichen Speisen und sauberen Betten ein Getränk zu mir.«
»He!«, protestierte Gwen und stützte empört die Hände in die Hüften.
»Genau!«, fiel Royce ein. »Wer ist hier unhöflich?«
»Hört doch auf. Ihr macht mir Angst.« Hadrian ging und ließ sie allein.
»Ich habe dich vermisst«, sagte Gwen, nachdem Hadrian in der Schenke verschwunden war, den Blick auf die riesige Pfütze gerichtet, die der Regen scheinbar zum Kochen brachte.
»Es waren doch nur ein paar Tage.«
»Ich weiß, aber ich habe dich trotzdem vermisst. Wie immer. Manchmal habe ich Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte.«
»Angst?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Du könntest getötet oder gefangen genommen werden oder vielleicht eine schöne Frau kennenlernen und nicht mehr zurückkommen.«
»Wie kann dir das Angst machen? Du kennst doch die Zukunft.« Royce lachte. »Hadrian sagte, du hättest ihm einmal aus der Hand gelesen.«
Gwen lachte nicht. »Ich habe schon aus vielen Hände gelesen.« Sie blickte zu dem Schild mit der einzelnen Rosenblüte hinüber, und ihr Gesicht wurde traurig.
Royce hätte sich ohrfeigen können. »Entschuldige, ich … so habe ich das nicht …«
»Ist schon recht.«
Aber so fühlte es sich gar nicht an. Royce spannte die Muskeln und ballte die Hände zu Fäusten. Er war froh, dass Gwen ihn nicht ansah. Sie hatte so eine Art, seinen Abwehrpanzer zu durchschauen. Für alle anderen war er wie eine zwanzig Meter hohe, massive Mauer mit rasiermesserscharfen Stacheln obendrauf und unten einem tiefen Graben. Für Gwen dagegen war er ein offenes Fenster, das sich nicht mehr schließen ließ.
»Ich habe trotzdem Angst«, sagte sie. »Du bist schließlich kein Schuster oder Maurer.«
»Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tue gerade nichts, weswegen man Angst haben müsste. Hadrian erlaubt das gar nicht. Ich begnüge mich damit, Dinge zurückzuholen, die verloren gegangen sind, oder in Fehden zu vermitteln – wusstest du, dass wir einem Bauern geholfen haben, sein Feld zu pflügen?«
»Albert hat euch Feldarbeit vermittelt?«
»Nein, Hadrian. Der Bauer war krank geworden und seine Frau deshalb verzweifelt. Sie hatten Schulden.«
»Und du hast ein Feld gepflügt?«
Royce grinste ein wenig verlegen.
»Also hat Hadrian gepflügt, und du hast zugesehen.«
»Ich sage dir, was der alles für Sachen macht.« Royce seufzte. »Manchmal verstehe ich ihn wirklich nicht.«
Gwen lächelte. Vermutlich stand sie auf Hadrians Seite, wie die meisten Menschen. Gute Taten lobten alle – zumindest nach außen hin –, und in Gwens Blick lag Nachsicht, als wollte sie das nur aus Höflichkeit nicht sagen. Aber egal, sie lächelte, und in diesem Moment regnete es nicht mehr. Stattdessen schien die Sonne, und er war nie ein Mörder und sie nie eine Prostituierte gewesen.
Er streckte die Hände aus, hätte sie am liebsten berührt und in die Arme genommen und dieses Lächeln geküsst, damit es nicht gleich wieder verging und nur als verglimmender Funke in Erinnerung blieb. Doch dann hielt er inne.
Gwen blickte auf seine Hände und anschließend sein Gesicht. »Was ist?«
Klingt sie enttäuscht?
»Wir sind nicht allein«, sagte er und wies mit einem Nicken über die Straße. Im Schatten neben der Küchentür machten sich drei zerlumpte Gestalten zu schaffen. »Du musst mit deinem Wirt sprechen. Dixon lässt Essensreste draußen stehen, und das zieht Fliegen an.«
Gwen sah hinüber. »Fliegen?«
»Elben. Sie durchwühlen deinen Abfall.«
Gwen kniff die Augen zusammen. »Oh, die habe ich gar nicht gesehen.« Sie machte eine Handbewegung. »Das ist in Ordnung. Ich habe Dixon gesagt, er solle ihnen die Essensreste geben. Hoffentlich wirft er sie nicht einfach nur in den Dreck. Ich sollte ein Fass rausstellen oder einen Tisch.«
Royce beobachtete die Kreaturen mit einem Stirnrunzeln. Die zerrissenen Lumpen, die an ihren Gliedern hingen, hatten mit Kleidern kaum noch etwas gemein. Vom Regen durchnässt, sahen die Elben aus wie in Haut gewickelte Skelette. Ihnen zu essen zu geben war ein Beispiel dafür, dass Nächstenliebe grausam sein konnte. Gwen machte ihnen falsche Hoffnungen. Besser ließ man sie sterben – besser für sie und besser für alle.
Er sah Gwen an. »Dir ist schon klar, dass sie wiederkommen werden. Die wirst du nie mehr los.«
Gwen stieß ihn in die Seite und zeigte die Schiefe Straße entlang. »Da kommt Albert.«
Zu Fuß und hinter einem dichten Regenschleier nur verschwommen zu erkennen näherte sich Albert Winslow mit sichtlicher Abscheu dem gefürchteten Teich. Der neue randlose Hut des Vicomte lag mit Wasser vollgesogen platt auf seinem Kopf und war an einer Seite über die Schläfe gerutscht. Der Mantel klebte ihm am Körper. Stirnrunzelnd betrachtete er die Brühe und blickte zu beiden hinüber. »Wenn das jetzt immer so ist«, rief er, »könnt Ihr dann nicht eine Brücke bauen lassen, die zu Eurer Festung führt, Gwen?«
»Ich darf leider nicht über die Straße bestimmen«, rief sie zurück. »Oder über Brücken. Damit müsst Ihr Euch an den König wenden oder zumindest an die Kaufmannschaft der Unterstadt.«
Albert blickte noch einmal auf das brodelnde Wasser, dann watete er mit einer Grimasse hinein. »Ich will ein Pferd!«, rief er zu den Wolken hinauf. Das Wasser reichte ihm bis zur Mitte der Waden. »Ich bin ein Vicomte, bei Maribor! Ich sollte nicht durch Abwasser waten müssen, wenn ich zu Euch will.«
»Drei Pferde können wir uns nicht leisten«, erwiderte Royce. »Es reicht schon kaum für zwei.«
»Jetzt schon.« Albert öffnete seinen Mantel, und eine Geldbörse wurde sichtbar. Er schüttelte sie. »Wir wurden bezahlt.«
Sechs glänzende Goldmünzen, geprägt mit dem Falken von Melengar, und zwanzig Silbermünzen mit demselben Bild lagen auf dem Tisch im Dunkelzimmer. Der einzige fensterlose Raum des Wirtshauses hatte früher als Vorratskammer gedient. Gwen hatte ihn zum Hauptquartier von Riyria umgebaut, dem Unternehmen, in dem Royce und Hadrian ihre Dienste als Diebe und mehr anboten. Hinzugekommen waren ein Kamin für die Beheizung und Beleuchtung und der Tisch, auf dem Albert die Börse ausgeleert hatte.
Royce stellte eine Kerze daneben. Jedes Königreich und jeder Stadtstaat prägte seine eigenen Münzen, aber der Taler galt überall und musste ein bestimmtes Gewicht haben – entsprechend dem durchschnittlichen Ei eines Rotkehlchens. Ein Silbertaler war genauso schwer wie einer aus Gold, dafür aber größer und dicker, um das geringere Gewicht des Silbers auszugleichen. Diese Anforderungen wurden überwiegend eingehalten, und das schien auch für die Münzen zu gelten, die vor ihnen lagen.
»Ihr habt übrigens nichts zu befürchten.« Albert stand am Feuer und nahm seinen durchweichten Hut ab. »Frau von Martel weiß entweder nicht, dass ihr Tagebuch gestohlen wurde, oder es ist ihr so peinlich, dass sie es verschweigt. Ich tippe auf Letzteres.«
Er begann, seinen Hut auf den Boden auszuwringen.
»Nein, nein, nein!«, rief Gwen aufgeregt. »Hier – gebt ihn mir. Und zieht Eure restlichen Sachen aus. Sie müssen gewaschen werden. Dixon, holst du bitte eine Decke?«
Albert sah Gwen, die mit ausgestreckten Händen wartend vor ihm stand, mit erhobenen Augenbrauen an. Dann blickte er fragend zu Royce und Hadrian hinüber. Sie sagten beide kein Wort, sondern grinsten nur.
»Albert, glaubt Ihr wirklich, Ihr habt etwas, das ich noch nicht gesehen habe?«, fragte Gwen.
Albert runzelte die Stirn, wischte sich die nassen Haare aus dem Gesicht und begann, sein Wams aufzuhaken. »Jedenfalls lässt Baron Hemley Euch nicht suchen. Laut unserer Auftraggeberin Gräfin Constantine hat Frau von Martel nur ausgesagt, sie hätte sich mitten in der Nacht erschreckt, allerdings aus nichtigem Anlass.«
»Nichtigem Anlass?«, wiederholte Royce.
»Ralph und Herr Hippel wären wahrscheinlich anderer Meinung«, sagte Hadrian.
»Von was für einem Anlass hat sie denn gesprochen?«, fragte Royce.
Albert schlüpfte aus dem tropfenden Brokatstoff und gab ihn Gwen. Dixon kehrte mit einer Decke zurück, und sie tauschten beides aus. »Kannst du das bitte Emma bringen und sie fragen, was sie tun kann?«
»Sie soll bitte vorsichtig sein«, sagte Albert. »Der Stoff kostet ein Vermögen.«
»Wissen wir doch«, warf Royce ein.
»Emma hat Erfahrung mit Brokat«, versicherte Gwen, während Dixon ging. »Jetzt gebt mir Strümpfe und Kniehose.«
»Kann ich einen Stuhl haben?«
»Zuerst die Hose.«
»Vor was hat sich Frau von Martel denn so erschreckt?«, fragte Royce noch einmal.
»Ach …« Albert lachte leise, während er seine langen Strümpfe abrollte. »Sie meinte, ein Waschbär sei durch das Fenster in ihr Schlafzimmer eingedrungen, und deshalb habe ihr Hund angefangen zu bellen. Auf den Lärm hin sei ein Wächter herbeigeeilt und im Dunkeln mit dem Kopf gegen den Ast einer Pappel geknallt. Er habe geglaubt, er würde angegriffen, und deshalb um Hilfe gerufen.«
»Nur geglaubt?«, fragte Royce.
»Der Wächter stellte es so dar, als seien zwei Männer eingebrochen und hätten gedroht, ihn zu töten. Frau von Martel meinte, er leide unter Wahnvorstellungen.«
Royce setzte sich ans Feuer und klopfte mit den Fingerspitzen aneinander. Er fragte sich, was wohl in dem Tagebuch stand, wenn Frau von Martel so unbedingt Ermittlungen vermeiden wollte.
Hadrian lachte nur.
»Was?«, fragte Albert und reichte Gwen seinen zweiten Strumpf, die ihn mit gerümpfter Nase entgegennahm.
»Frau von Martel hat Ralph das Leben gerettet«, sagte Hadrian.
»Wirklich? Wer ist Ralph?«
»Der Wächter mit den Wahnvorstellungen. Royce wartet nur darauf, dass der Regen aufhört, dann will er ihm noch mal einen Besuch abstatten.«
Albert klatschte in die Hände. »Also haben wir heute alle was zu feiern.«
Gwen sah ihn finster an. »Erst wenn Ihr die Hose ausgezogen habt.«
»Seid Ihr bei allen Euren Kunden so hartnäckig?«, fragte Albert.
»Ihr seid kein Kunde, Albert.«
»Nein … ich bin ein Vicomte.«
Eine kurze Pause entstand, dann mussten alle lachen. »Also gut, bitte sehr, meine Hose! Nehmt sie. Wozu brauche ich noch eine? Meine Würde habe ich sowieso schon eingebüßt.«
»Wer braucht Würde, wenn er Geld hat?« Royce warf ihm einen Stapel Silbermünzen zu, auf denen ein Goldtaler lag.
Albert, der nackt am Feuer stand, fing sie geschickt wie ein Jongleur auf und betrachtete sie mit einem zufriedenen Lächeln. »Jetzt bin ich wieder ein richtiger Adliger!«
»Wickelt Euch die um die Hüften.« Gwen gab ihm die Decke. »Für heute haben wir von Eurem Adel genug gesehen.«
Sie nahm seine restlichen Kleider und ging.
Albert wickelte sich in die weiche Wolle und setzte sich auf einen Stuhl so nah am Feuer, wie es ging, ohne dass er selbst Feuer fing. Er rieb die Münzen zwischen den Fingern. »Münzen aus Silber und Gold sind etwas so Schönes. Ein Jammer, dass man sie ausgeben muss.«
»Und lange reichen werden sie nicht.« Royce seufzte und sah Albert an. »Es wird eng, wenn wir nur so wenige und schlecht bezahlte Aufträge haben. Wir brauchen etwas Lukratives.«
»Ich habe tatsächlich noch einen Auftrag, mit dem es gleich losgehen könnte. Bezahlt werden – aufgepasst – zwanzig Goldtaler plus Spesen. Was gut ist, weil dazu eine weite Reise in den Süden von Maranon nötig ist.«
Royce und Hadrian hatten sich aufgesetzt.
»Das ging aber schnell«, sagte Hadrian. »Sonst dauert das bei Euch länger.«
»Stimmt, aber der ist uns in den Schoß gefallen.« Ein Wassertropfen lief Albert über das Gesicht, und er rubbelte seine nassen Haare mit einem Zipfel der Decke. »Klingt auch unglaublich leicht.«
»Das könnt Ihr nicht beurteilen, Albert«, sagte Royce.
»Doch, diesmal wirklich. Ihr braucht im Grunde gar nichts zu tun.«
Royce beugte sich vor und betrachtete ihn forschend. »Wer zahlt zwanzig Goldtaler für nichts? Was ist das für ein Auftrag?«
»Jemand scheint die Comtesse Nysa Dulgath umbringen zu wollen.«
»Wir sind keine Leibwächter, die man mieten kann.«
»Nein, Leibwächter hat sie schon. Nysa Dulgath ist eine Gräfin und wird, sobald sie König Vincent den Treueid geschworen hat, über eine kleine Provinz in der südwestlichen Ecke von Maranon herrschen. Ihr Vater, Graf Beadle Dulgath, ist offenbar jüngst verstorben, und sie ist sein einziges Kind.«
»Wurde er ermordet?«, fragte Royce.
»Nein. Es lag am Alter. Er war schon steinalt, fast sechzig. Aber jemand hat es auf seine Tochter abgesehen. Nach dem, was man mir gesagt hat, gab es allein im letzten Monat drei Anschläge auf ihr Leben. Alle sind gescheitert, jetzt soll ein Profi es richten. Und da kommt Ihr ins Spiel.« Albert sah Royce an.
»Ich würde den Mord an einer Gräfin nicht nichts nennen. Außerdem wisst Ihr, wie sehr er sich über solche Aufträge aufregt.« Royce zeigte auf Hadrian.
Albert machte eine wegwerfende Handbewegung. »Nein, Ihr missversteht mich. Ihr sollt sie gar nicht töten. Dafür gibt es den Gerüchten zufolge schon jemand anderen.«
Royce schüttelte den Kopf. »Wenn sie nicht eine billige Lösung gewählt haben, haben sie einen Eimermann des Schwarzen Diamanten beauftragt. Aber der Diamant und ich haben die Abmachung, dass wir uns nicht gegenseitig in unsere Geschäfte einmischen.«
»Ich weiß«, sagte Albert. »Aber Ihr sollt ja gar nicht den Mörder fangen. Ihr sollt die Situation einschätzen und den Chef der dortigen Polizei Knox informieren, wie Ihr einen Mord an Comtesse Dulgath planen würdet, damit er entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen kann.«
»Warum ich?«
Albert lächelte. »Ich habe erwähnt, dass Ihr früher für den Schwarzen Diamanten gemordet habt.«
Royce sah ihn wütend an.
»Niemanden in Maranon kümmert es, was Ihr anderswo getan habt. Wir sprechen hier von Adligen. Für sie ist Moral etwas Flexibles. Und sie freuen sich auf jemand mit Erfahrung.«
»Klingt …« Hadrian suchte nach einem passenden Wort.
»Verdächtig«, ergänzte Royce.
»Ich dachte an merkwürdig, aber ja. Es ist seltsam. Will womöglich der Polizeichef selbst den Tod der Gräfin?«
»Unwahrscheinlich. Könnte sogar sein, dass er gar nichts davon weiß. Denn nicht er hat uns engagiert. Und ich glaube nicht, dass unser Kunde sonst Staatsoberhäupter ermordet.«
»Wer hat uns denn engagiert?«
Albert zögerte einen Moment. »Die Nyphronkirche.«
2
Der Maler
Sherwood Stow merkte gar nicht, wie er den Pinsel hielt, so tief war er in den Anblick von Comtesse Nysa Dulgath versunken. Sie stand drei Meter von ihm entfernt, die eine Hand über ihrem Bauch, die andere, in der sie Reithandschuhe hatte, als wollte sie gleich zur Jagd aufbrechen, an der Seite. Den Rücken hielt sie kerzengerade, das Kinn erhoben und den Kopf waagrecht, sodass die Perlenohrringe genau auf gleicher Höhe baumelten. Die Haare waren zu Zöpfen geflochten und um den Kopf gelegt, sodass sie aussahen wie das Diadem einer Königin. Sie trug ein Kleid aus kostbarem goldenen Seidenbrokat mit bauschigen Ärmeln und um die Schultern eine Stola mit einem grinsenden Fuchsgesicht, als sei auch der Fuchs entzückt, dieser herrlichen Gestalt so nahe zu sein. Ihr nach oben und in die Ferne gerichteter Blick war von großer Majestät, Sherwood bedauerte nur, dass sie nicht ihn ansah. Stattdessen blickte sie über seinen Kopf hinweg auf den Kronleuchter, der in der Mitte ihres privaten Schreibzimmers hing.
Das Zimmer war klein für die Verhältnisse von Burg Dulgath. Sherwood fand es geradezu intim, wie ein Ankleidezimmer oder einen privaten Salon, in dem man einer Frau den Hof machte. Zumal in solchen Salons immer Aufsichtspersonen saßen, sie aber in diesem Fall die beiden einzigen Anwesenden waren.
»Warum seht Ihr mich nicht an?«, fragte er.
»Muss ich das denn?«, fragte die Comtesse, den Blick auf den Kronleuchter geheftet. Um ihre Lippen spielte ein gleichgültiges Fastlächeln, wie es für offizielle Anlässe obligatorisch war. Gewöhnlich wusste Sherwood eine gewisse statuenhafte Qualität seiner Modelle während des Malens zu schätzen, aber die Reaktion der Gräfin auf seine Bitte war extrem. Sie posierte nicht für ihn, sie versteckte sich.
»Sagen wir, es ist eine Bitte.«
»Bitte abgelehnt.« Die Worte waren genauso neutral wie ihre Lippen, weder so freundlich, dass dadurch Nähe entstanden wäre, noch ablehnend kalt.
Ich könnte nicht einmal sagen, ob sie atmet.
Nysa war viel zu steif. Natürlich war dieser Eindruck beabsichtigt, aber Sherwood Stow war nicht daran interessiert, die künftige Gräfin von Dulgath zu malen. Ihn interessierte die Frau. Und in Gedanken war sie für ihn immer Nysa, nie die Comtesse – obwohl er das natürlich nicht laut sagte.
Die Familie Dulgath war wie ein Monument von historischer Bedeutung, eine staubbedeckte Dynastie mit einem großen Namen. Nysa war eine Frau Anfang zwanzig – er wusste nicht, wie alt genau, es war aufgrund der jugendlichen Frische ihres Körpers schwer einzuschätzen, doch ihr Blick war uralt. Eine schöne und geheimnisvolle Lichtgestalt, die sich mit einer unglaublichen Anmut bewegte. Sherwood kannte viele Frauen – Adlige, Prinzessinnen und sogar Königinnen. Keine davon besaß auch nur einen Bruchteil ihrer Anmut und Eleganz. Nysa war wie ein von einem Luftzug erfasstes wirbelndes Blatt, das, wenn es auf der Oberfläche eines stillen Sees landete, nicht die kleinste Welle hinterließ.
»Meister Stow, ist es beim Malen nicht gewöhnlich so, dass man den Pinsel auch auf die Leinwand setzt?«, sagte die Comtesse zum Kronleuchter. »Ihr steht jetzt schon seit zwanzig Minuten da, mischt Farbe und haltet diesen Stock mit Borsten, aber kein einziges Mal habt Ihr damit etwas gemalt.«
»Wie könnt Ihr das wissen, wenn Ihr nur den Kronleuchter anseht?«
»Ansehen und wahrnehmen haben nichts miteinander zu tun. Besonders Ihr solltet das wissen.«
Sherwood nickte und fügte dem dicker werdenden Umbra erneut etwas Walnussöl hinzu. Zweifellos drehte sich sein alter Lehrer Yardley jetzt im Grab um. Er hatte immer darauf bestanden, mit Eitempera zu arbeiten, aber Sherwood bevorzugte Öl. Nicht nur weil es seinen Porträts eine durchscheinende Tiefe verlieh, er konnte das Bild aufgrund der langen Trocknungszeit auch beliebig bearbeiten.
»So ist es, und da Ihr das wisst, versteht Ihr sicher auch, wie wichtig es ist, dass ich mir Zeit lasse.«
»Langsam ist in Eurem Fall nicht das richtige Wort, Meister Stow. Ein Honigtropfen im Winter ist langsam. Er fällt gleichsam nur mit größtem Widerwillen, aber er fällt. Ihr dagegen seid kein Honigtropfen. Ihr seid ein Stein.«
»Schade, wo ich Honig doch so gern mag. Vielleicht wollt Ihr Eure Einschätzung noch einmal überdenken?«
»Ein Stein, sage ich. Ein Fels aus Granit, vollkommen unbeweglich in dem Beharren auf Eurer Art.«
»Das bin ich?«
»Was sollte sonst der Grund für zwei Monate täglicher einstündiger Sitzungen sein? Das sind insgesamt sechzig Stunden. Ich habe von guten Malern gehört, die ein Porträt in einer Woche fertigstellen.«
»Das stimmt.« Er klopfte sich mit dem Finger ans Kinn und hinterließ dort einen kleinen Farbfleck. »Die einzige Erklärung dafür ist vermutlich, dass ich kein guter Maler bin.«
Er verkorkte die Ölflasche und stellte sie auf die Ablage der Staffelei zu den fleckigen Lappen und den Fläschchen mit Pigmenten, denen man zum Teil nicht ansah, wie teuer sie waren. Ultramarin – »Über das Meer« – war das kostbarste, weil der Stein zur Herstellung der dunkelblauen Farbe über das Meer aus demselben sagenhaften Land hergeschafft werden musste, aus dem auch der unvergleichliche Montemorcey-Wein kam. Die Farbe war das Zwanzigfache ihres Gewichts in Gold wert. Zum Glück wussten das nur wenige, die keine Maler waren, sonst müssten seine Kollegen ständig damit rechnen zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden.
»Ihr gebt es also zu?«
»Natürlich, ich bin kein guter Maler.« Er benutzte den Lappen, den er aus seinem letzten anständigen Hemd geschnitten hatte, um etwas Öl abzuwischen, das vom Stil seines Pinsels auf seine Hände getropft war. Egal, wie sehr er aufpasste, seine Hände zogen Farbe und Öl geradezu magnetisch an. »Ich bin der beste.«
Sie ließ ein ungewohntes Schnaufen hören, das sich fast wie ein Lachen anhörte, und hob skeptisch eine Augenbraue. »Ihr seid ein eingebildeter Mensch.«
Endlich eine Reaktion.
»Nein, ich habe nur Selbstvertrauen, das ist etwas anderes. Einbildung ist der ungerechtfertigte Glaube an sich selbst. Selbstvertrauen beruht auf der richtigen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ich prahle nicht damit, ein großer Liebhaber zu sein – obwohl ich das vielleicht auch bin. Aber ich bin nicht in der Lage, mich in dieser Hinsicht richtig einzuschätzen. Das überlasse ich den Frauen, die bei mir zu Gast sind.«
Diesmal hoben sich ihre beiden Brauen, und dazwischen bildete sich eine kleine Falte.
»Aber wir haben über Kunst gesprochen, und darin bin ich Experte. Ihr könnt mir also glauben, wenn ich sage, dass es keinen größeren Maler gibt als mich, und das sage ich wiederum, weil niemand die Verdienste eines Malers besser beurteilen kann als ich.«
»Ich glaube nicht, dass ich Euch in Sachen Kunst oder in sonst etwas vertrauen kann, Meister Stow. Wie auch, wenn Ihr Euch weigert, mir das Bild zu zeigen? Ihr habt bisher noch niemandem auch nur einen kurzen Blick auf Euer Meisterwerk der letzten beiden Monate gewährt.«
»Die Wahrheit entsteht nicht nach einem festen Zeitplan.«
»Die Wahrheit? Ihr malt die Wahrheit? Ich dachte, Ihr malt mich.«
»Ich male Euch – oder versuche es zumindest –, aber weil Ihr euch weigert mitzuarbeiten, zögert Ihr die Arbeit hinaus.«
»Was soll das heißen?«
»Ihr versteckt Euch vor mir.«
»Ich …« Fast hätte sie ihn angesehen. Er sah, wie ihre Pupillen vor mühsamer Beherrschung zitterten. Sie biss sich auf die Unterlippe, fasste sich wieder und starrte mit doppelter Anstrengung auf den Kronleuchter. Trotzig hob sie das Kinn. »Ich bin doch hier.«
»Nein … seid Ihr nicht. Vor mir steht die Gräfin von Dulgath in ihrer ganzen Pracht und Majestät, aber das seid nicht Ihr – nicht die, die Ihr wirklich seid. Ich möchte die Person in Euch entdecken. Die Person, die Ihr vor allen anderen versteckt – aus Angst, sie könnten sehen …«
Da blickte sie ihn an. Nicht flüchtig oder erstaunt, sondern voller Leidenschaft und loderndem Zorn. Nur ganz kurz, aber er sah in diesem Augenblick mehr, als er in zwei Monaten gesehen hatte. Eine Kraft, ein stürmisches Temperament, einen im Körper einer Frau eingesperrten Sturm, überlagert von Trauer, Verlust und Reue. Er hatte sie gesehen, dachte er und trat erschüttert einen Schritt zurück.
»Wir sind fertig«, erklärte die Comtesse, beendete ihre Pose und warf den Fuchs ab. »Und ich wüsste nicht, warum ich mit diesem Unsinn weitermachen sollte. Ich habe dem Porträt nur zugestimmt, weil mein Vater es unbedingt wollte. Jetzt ist er tot, es besteht also keine Notwendigkeit mehr.«
Sie machte auf dem Absatz kehrt und schritt zur Tür.
»Dann sehen wir uns morgen«, rief Sherwood ihr nach.
»Nein, eben nicht.«
»Ich werde hier sein.«
»Ich nicht.« Sie schlug die schwere Eichentür hinter sich zu. Sherwood blieb allein im Zimmer zurück und lauschte dem Echo ihrer verklingenden Schritte.
Er starrte auf die Tür, die sie so heftig zugeschlagen hatte, dass sie wieder aufgegangen war und einen Spalt offen stand, und sah in einiger Entfernung noch ganz kurz das goldene Kleid aufblitzen.
Faszinierend.
Im nächsten Moment hob er Pinsel und Lappen auf, die er beide hatte fallen lassen, ohne es zu bemerken, und begann zu malen. Mühelos und wie von selbst flog der Pinsel zwischen Palette und Leinwand hin und her. Er war so konzentriert, dass er den jungen Mann, der das Zimmer betrat, erst bemerkte, als er etwas sagte.
»Gibt es ein Problem?«
Sherwood erkannte das Wams aus blauer Atlasseide, noch bevor er den Spitzbart sah, und zog hastig das Abdecktuch über das Bild. Er hatte es zu diesem Zweck an der oberen Leiste des Leinwandrahmens befestigt. Unfertige Werke zu bedecken, um Fliegen, Staub und Haare von der Farbe fernzuhalten, war durchaus üblich, aber in seinem Fall diente es einem noch wichtigeren Zweck.
»Baron Fawkes, Verzeihung, ich habe Euch nicht gesehen. Was habt Ihr gesagt?«
»Ich habe gefragt, ob es ein Problem gibt.« Fawkes sah sich mit der für ihn typischen Mischung aus verwirrter Unschuld und finsterem Misstrauen in der Stube um. »Ich hörte einen lauten Knall und sah die Comtesse aus dem Zimmer stürzen. Kann ich irgendwie behilflich sein?«
»Überhaupt nicht. Es war eine besonders gute Sitzung, aber jetzt ist sie vorbei. Ich packe nur noch meine Sachen zusammen. Wir haben heute große Fortschritte gemacht.«
Baron Christopher Fawkes kam um die Staffelei herum und betrachtete das zugedeckte Porträt stirnrunzelnd. »Das ist hoffentlich kein Bettlaken.«
»Nein, mein Nachthemd oder was davon übrig ist.«
»Was trag Ihr dann im Bett?«
»Gegenwärtig? Gar nichts. Ich kann mir kein Nachthemd leisten.«
»Novron sei Dank, dass es Anfang Sommer ist.« Baron Fawkes griff nach dem Fläschchen mit Ultramarin und warf es von einer Hand in die andere. Dass er ausgerechnet dieses Pigment gewählt hatte, konnte kein Zufall sein. Anders als seine Standesgenossen, kannte der Baron sich offenbar im Kunsthandel aus. »Warum seid Ihr noch hier, Sherwood?«
Der Maler wies lächelnd auf das abgedeckte Bild. Auf das Bild zu zeigen war leicht, das Lächeln fiel ihm deutlich schwerer, weil Fawkes das blaue Fläschchen weiter hin und her warf.
Der Baron blickte mit einem verächtlichen Schnauben über die Schulter. »Im vergangenen Sommer habt Ihr meine Tante Mobi in ihrer Villa in Swanwick gemalt.«
»Ja, ich erinnere mich. Ein schöner Ort. Die Baronin war äußerst liebenswürdig und entgegenkommend.«
Fawkes nickte. »Yardley hat sie zwei Jahre davor ebenfalls porträtiert, trotzdem wollte sie unbedingt auch noch von Euch gemalt werden, seinem Lehrling.«
»Das passiert eigentlich ziemlich oft.«
Fawkes unterbrach sein Spiel mit dem Fläschchen und zeigte mit dem Daumen auf das verdeckte Bild. »Alle erschraken, als ihr Porträt enthüllt wurde.«
»Auch das passiert oft.«
»Tante Mobi brach in Tränen aus. Sie brachte zehn Minuten lang kein Wort heraus. Onkel Karl war überzeugt, Ihr hättet sie schwer gekränkt.«
Sherwood nickte. »Graf Swanwick hat die Wachen rufen lassen.«
»Wie ich hörte, packten sie Euch an den Händen und wollten Euch gerade abführen, da fand Tante Mobi die Sprache wieder und hielt sie auf. Das bin ich!, sagte sie. So bin ich wirklich – niemand hat mich je so gesehen.«
»Auch das bekomme ich immer wieder zu hören.«
»Habt Ihr mit ihr geschlafen?« Der Baron warf das Fläschchen höher als zuvor.
»Entschuldigung?«
»Habt Ihr sie damit so beeindruckt? Dass sie so entgegenkommend war?«
»Habt Ihr das Porträt gesehen?«
Fawkes lachte leise. »Nein. Ich kenne es nur aus Erzählungen. Tante Mobi hat es in ihrem Schlafgemach eingeschlossen. Bestimmt träumt sie dort von dem jungen Maler, der sie so treffend eingefangen hat. Ich frage mich, wie eine mit einem Grafen verheiratete Frau so sehr von einem mittellosen Künstler beeindruckt sein kann.«
»Sagt Ihr das aus einem bestimmten Grund?«
Fawkes lächelte boshaft. »Mein Grund ist, dass Ihr für dieses Porträt – das Tante Mobi so perfekt getroffen hat, dass sie womöglich ihren Mann hintergangen hat – fünf Tage gebraucht habt. Ich frage also noch einmal, warum seid Ihr immer noch hier, Sherwood?«
»Manche Porträts sind schwieriger als andere.«
»Und manche Frauen schwerer zu verführen.«
Sherwood ergriff das Fläschchen mitten im Flug. »Pigmente sind kein Spielzeug.«
»Die Comtesse Dulgath auch nicht.« Fawkes starrte das Fläschchen in Sherwoods Hand einen Moment an, dann wandte er sich ab. »Ich dachte, Ihr wärt nur ein Schmarotzer, der den guten Willen seines Gönners ausnutzt und womöglich bleibt, weil er keine anderen Aussichten hat. Jetzt glaube ich, dass ich naiv war.«
Er blickte wieder auf das verhüllte Bild, als sei es ein Gesicht, das die beiden Männer durch einen Schleier hindurch beobachtete. »Das Leben als wandernder Maler muss anstrengend und gefährlich sein. In einer Burg zu wohnen und ein eigenes Bett und Atelier zu haben ist da bestimmt eine deutliche Verbesserung. Aber Ihr habt eins vergessen. Die Comtesse ist adlig, Ihr nicht. Es gibt Gesetze gegen so etwas.«
»Nein, die gibt es nicht.« Sherwood stellte das Fläschchen mit dem blauen Pigment auf die Ablage der Staffelei und trat zwischen die Staffelei und den Baron.
Fawkes starrte ihn wütend an. »Es sollte sie aber geben.«
»Wenn wir davon sprechen, was sein sollte, dann wärt Ihr als Milchbauer in Kelsey geboren worden und nicht als Cousin von König Vincent. Obwohl das eine schreckliche Ungerechtigkeit gegenüber den Kühen gewesen wäre, was sicher auch der Grund ist, warum Maribor Euch kein Land gegeben hat.«
Sherwood war über alle Maßen erleichtert, dass Baron Fawkes das kostbare Fläschchen mit Ultramarin nicht mehr in der Hand hielt. Der Adlige aus Maranon, der kein eigenes Land hatte, unterdrückte ein Schnauben, und seine Schultern hoben sich, wie sich das Rückenfell eines Hundes aufstellt. Bevor er zu einer Beschimpfung ansetzen konnte, sagte Sherwood: »Warum seid Ihr noch hier? Das Begräbnis war vor über einem Monat.«
Die Wirkung war der von Wasser vergleichbar, das man auf eine Flamme gießt. Erst sah Fawkes ihn verwirrt an, dann trat ein mörderisches Glimmen in seine Augen. »Weil Ihr ausschließlich damit beschäftigt wart, in das Bett der Comtesse zu kommen, ist Euch vermutlich entgangen, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet.«
»Und was soll das jetzt heißen?«
»Ich bin noch hier, um sie zu beschützen.«
»Wirklich?«, sagte Sherwood schärfer als beabsichtigt, aber der Baron hatte ihn in Rage gebracht. »Vielleicht ist es Eurer Aufmerksamkeit entgangen, dass sie dafür eine Truppe von gut ausgebildeten Wachen zur Verfügung hat. Oder bildet Ihr Euch ein, zwischen Comtesse Dulgath und dem Tod stünde nur die Furcht des Mörders vor dem Cousin zweiten Grades des Königs?«
Die Bemerkung trug nicht dazu bei, Fawkes’ Zorn zu beschwichtigen. Sein Blick wanderte wieder zur Staffelei.
Sherwood wusste, an was er dachte, und trat noch einen Schritt vor. Er gab sich keinen Illusionen darüber hin, aus einer Schlägerei als Sieger hervorgehen zu können. Es gab tatsächlich ein Gesetz, das es verbot, einen Adligen zu schlagen, er mochte noch so verachtenswert sein. Von daher diente der Schritt nur der Einschüchterung, die der Maler noch dadurch zu steigern versuchte, dass er sich zu seiner vollen Größe aufrichtete, was ihn einen Zoll größer als Fawkes machte, und dessen wütenden Blick entschlossen und mit erhobenen Händen erwiderte.
Fawkes ließ nicht erkennen, ob er eingeschüchtert war. Er spuckte nur auf Sherwoods Schuh und ging.
Auch er knallte die schwere Tür hinter sich zu, und diesmal blieb sie geschlossen.
3
Maranon
Das Wetter blieb auf dem ganzen Weg bis Mehan scheußlich. Wenn die Wolken ihnen nicht folgten, wie Hadrian sich einbildete, und der ganze Norden Avryns von derselben Sintflut heimgesucht wurde, dann war die Pfütze in der Schiefen Straße nach drei zusätzlichen Regentagen, in denen Royce und Hadrian bis auf die Knochen durchnässt wurden, vermutlich zu einem See angewachsen. Bei Anbruch des vierten Tags dagegen war der Himmel blau und klar, und die große südliche Sonne beschien ein herrliches Land sanft gewellter Hügel.
Die meisten Aufträge, die Riyria übernahm, wurden in und um Medford abgewickelt, einige wenige führten sie bis nach Warric im Süden. Für Hadrian war es die erste Reise nach Maranon, obwohl er weniger als fünfzig Meilen von der Grenze entfernt aufgewachsen war. Wenn man sich die Halbinsel von Delgos als Fausthandschuh vorstellte, war Maranon der Daumen – ein grüner Daumen. Es war ein üppiges Land, das sich gelb, braun und grün in alle Richtungen erstreckte, unterbrochen durch kleine Wäldchen von Laubbäumen. Maranon war für seine Pferde bekannt – die besten der Welt. Zuerst meinte Hadrian, dass Rehe auf den Wiesen grasten, aber Rehe waren nicht in Herden von fünfzehn und mehr unterwegs. Und sie galoppierten auch nicht donnernd über den Boden oder bewegten sich im Kreis wie ein Schwarm Stare.
»Gehören die jemand? Oder darf man sich eins nehmen?«, fragte er. Royce und er ritten magere Klepper aus dem Norden, die dank der drei Regentage nun wenigstens sauber waren.
Royce, der die Kapuze abgesetzt hatte und den Mantel auf seinen Schultern von der Luft trocknen ließ, betrachtete die über einen fernen Hang trabenden Pferde. »Ja und nein. Es ist wie mit den Rehen im Norden – oder eigentlich überall. Immer gibt es irgendeinen Besitzer. Die Pferde hier leben zwar wild, aber in Maranon gehört alles König Vincent.«
Hadrian ließ sich von Royce gerne informieren. Sein Partner war nicht gesprächig, aber dafür weitgereist – zumindest in Avryn. Besonders gut kannte er sich in den dicht besiedelten Gebieten um die großen Städte Colnora und Rehagen aus, Gegenden, in denen ein Dieb und ehemaliger Auftragsmörder die meiste Arbeit fand. Für Hadrian fühlte sich die Reise nach Maranon wie Urlaub an. Der Wetterwechsel verstärkte noch das Gefühl, dass ihnen eine erholsame Zeit bevorstand.
Er stellte sich in den Steigbügeln auf und ließ den Blick über das offene Land schweifen. Abgesehen von der Straße, der sie folgten, und den Bergen in der Ferne war nichts zu sehen, keine Menschenseele, kein Dorf und keine Stadt. »Was sollte mich also daran hindern, eins einzufangen und nach Hause mitzunehmen?«
»Du meinst, abgesehen von dem Pferd selbst?«, fragte Royce.
»Äh, ja.«
»Im Grunde nichts. Es sei denn, du wirst erwischt, dann wirst du gehängt.«
Hadrian grinste, aber Royce sah ihn nicht an. »Wir würden für das meiste, das wir tun, gehängt, wenn man uns erwischt.«
»Und?«
»Hier wäre es doch viel angenehmer. Ich meine …« Er blickte zu einigen bauschigen weißen Wolken hinauf, deren Schatten über die Hügel wanderten. »Es ist unglaublich schön hier. Als wären wir aus einem Abwasserrohr direkt ins Paradies gekommen. Ich habe noch nie so viele Schattierungen von Grün gesehen.« Er blickte zu Boden. »Als sei das Gras bei uns in Medford irgendwie krank. Wenn wir schon Diebe sein müssen, können wir unseren Lebensunterhalt dann nicht mit Pferdediebstahl verdienen? Das ist doch bestimmt viel leichter, als Mauern und Türme hinaufzuklettern.«
»Wirklich? Schon mal versucht, ein wildes Pferd einzufangen?«
»Nein – du?«
»Nein, aber kannst du mir sagen, wie ein Reiter ein reiterloses Pferd einfangen soll? Und noch dazu eins aus Maranon? In dieser offenen, hügeligen Gegend kann man sie nirgends in eine Falle locken. Und selbst wenn es dir gelingt, eins zu fangen, was dann? Es besteht ein Unterschied zwischen einem Wildpferd und einem Pferd, das noch nicht eingeritten ist. Ist dir bekannt, ja?«
Hadrian erinnerte sich ganz vage daran, schon einmal davon gehört zu haben, aber erst als Royce davon sprach, fiel es ihm wieder ein. Auf Bauernhöfen geborene Pferde wuchsen in der Gesellschaft von Menschen auf. Sie wurden zwar nicht eingeritten und mochten es genauso wenig wie Hunde, wenn ihnen Leute auf den Rücken sprangen, aber deshalb waren sie doch vergleichsweise zahm.
»Du kriegst auf ein Wildpferd genauso wenig einen Sattel drauf wie auf einen Hirsch.«
»War nur eine Idee«, sagte Hadrian. »Ich meine, wie lange wollen wir das noch machen?«
»Was?«
»Stehlen.«
Royce lachte. »Seit ich mit dir zusammenarbeite, habe ich noch kaum etwas gestohlen. Was eigentlich schade ist. Ein gut gemachter Diebstahl hat eine eigene Schönheit. Ich vermisse das.«
»Wir haben dieses Tagebuch gestohlen.«
Royce sah Hadrian mitleidig an und schüttelte traurig den Kopf. »Das ist doch kein Diebstahl, sondern eine Bagatelle. Und jetzt das. Jemanden daran zu hindern, jemanden zu ermorden, fühlt sich irgendwie …«
»Schmutzig an?«
Wieder ein Blick, diesmal verwirrt. »Nein, es fühlt sich falsch an, wie Rückwärtsgehen. Es klingt theoretisch einfach, ist aber völlig unklar. Ich weiß gar nicht, was genau ich tun soll. Soll ich mit dieser Frau reden, dieser wandelnden Zielscheibe? Mit Leuten, die demnächst tot sein werden, unterhalte ich mich sonst nicht.«
In den vergangenen Jahren hatte Royce beim Reiten nie so viel gesprochen. Sein wütender Ton lieferte die Erklärung. Seit dem Debakel des Kronturms war er nicht mehr in einer Situation gewesen, die ihm so wenig vertraut war. Den Meisterdieb brachte nur selten etwas aus dem Gleichgewicht, aber wenn es der Fall war, wurde er gesprächig.
»Und sie ist eine Adlige«, fuhr er fort. »Ich mag Adlige nicht. Sie sind immer so eingebildet.«
»Sie wachsen so auf«, sagte Hadrian, als hätte er damit viel Erfahrung.
Er hatte einige Adlige kennengelernt, aber sie kamen alle aus Calis. Genauso gut hätte er sagen können, er würde Nagetiere kennen, weil er einmal ein paar Eichhörnchen gefüttert hatte. Die Adligen in Calis waren grundverschieden von denen in Avryn. Sie waren ungezwungener, derber, weniger eingebildet und viel gefährlicher. Royce hätte sie vermutlich gemocht, zumindest bis sie ihn umarmt hätten. Dass Royce Melborn sich nicht gern umarmen ließ, hatte Hadrian früh gelernt.
»Eben.« Royce nickte. »Und sie ist eine Frau – noch dazu eine Frau aus Maranon.«
»Was ist an denen so anders?«
»Weißt du noch das Unwetter im Hochland bei Fallenried? Wo der Wind, der über Chadwick fegte, auf den Wind traf, der von den Bergen herunterkam?«
»O ja.« Hadrian nickte. Sie hatten in dieser Nacht beide nicht geschlafen.
»So sind sie.« Royce zeigte mit einer wegwerfenden Handbewegung auf die schöne Landschaft, die sich um sie erstreckte, so weit das Auge reichte. »Sieh dir diese Gegend an. Müssen die Menschen hier hart arbeiten? Glaubst du, dass die Hacken der Bauern von den Steinen im Boden stumpf sind? Oder die Menschen an drei Tagen in der Woche hungrig ins Bett gehen? Die Fronarbeiter auf den Gutshöfen hier leben besser als Gwen. Und jetzt stell dir vor, wie erst die Adligen sind. Diese Dulgath ist wahrscheinlich eine von der schlimmsten Sorte. Wusstest du, dass die Provinz Dulgath das älteste Lehen von ganz Avryn ist?«
»Woher genau sollte ich das wissen?« Hadrian lächelte, amüsiert über seine Gesprächigkeit.
»Es stimmt jedenfalls«, sagte Royce irritiert, als hätte Hadrian ihm widersprochen. »Wenn Albert sich wirklich mit der Geschichte der verschiedenen Adelsgeschlechter auskennt, dann wurde Dulgath etwa zur selben Zeit gegründet wie das novronische Imperium, und die Familie, die hier herrscht, ist so alt wie das Erste Imperium. Die meisten Adligen übernehmen den Namen der Gegend, in der sie herrschen, aber hier war es andersherum. Die Provinz Dulgath wurde nach ihren Gründern benannt. Wenn das so ist, wie ausgeprägt ist dann wohl das Selbstbewusstsein dieser Gräfin Dulgath? Ihre Familie reicht mehrere Hundert Generationen zurück. Und ich soll sie retten?«
»Streng genommen wollen die nur wissen, wie du sie ermorden würdest.«
Royce schenkte Hadrian ein böses Lächeln. »Der schwierige Teil wird sein, das nicht zu tun. Vielleicht hilft mir dabei ausnahmsweise, wenn du mir ins Ohr flüsterst, dass ich es nicht tun soll.« Er blickte zum Himmel auf, der sich makellos über ihnen wölbte. »Aber ein paar Flecken blauen Blutes werde ich bestimmt abbekommen.«
Die Landstraße gabelte sich. Die linke Abzweigung bog nach Süden ab, während ihr Weg in die Ferne weiterführte, wo die grünen Hügel an einer Falte aus grünen Bergen endeten.
Royce blieb so lange stehen und blickte die linke Abzweigung entlang, dass Hadrian schließlich dasselbe tat. Die Straße führte gerade und eben am Rand eines grünen Hügelkamms längs auf einige größere Felsenberge zu, die vom Licht der späten Morgensonne blau gefärbt wurden. Minuten vergingen, ohne dass Royce sich rührte, bis Hadrian überzeugt war, dass er den Weg verloren hatte, was allerdings sehr ungewöhnlich war. Drei Jahre lang hatte Royce’ innerer Kompass sie kein einziges Mal im Stich gelassen, nicht im dichtesten Wald, nicht bei Nebel, der so dick war wie eine Wolldecke, und nicht in sternenlosen Nächten oder einem heftigen Schneesturm. Doch jetzt saß der Dieb bewegungslos auf seinem Pferd und blickte nach Süden.
»Ist das unser Weg?«, fragte Hadrian endlich.
Royce hob den Kopf, als hätte er geschlafen. »Was?«
»Kommen wir auf diesem Weg nach Dulgath?«
»Dort lang?« Royce schüttelte den Kopf. »Nein – nein, das ist nicht unser Weg. Er führt nirgendshin.«
Hadrian betrachtete die breite, ausgefahrene Straße mit den tiefen Rinnen der Wagenräder und den halbkreisförmigen Hufabdrücken. »Für eine Sackgasse ist er aber ziemlich gut befahren.«
Royce grinste, als hätte Hadrian einen obszönen Witz gemacht. »Ja, das kann man sagen.«
Er trieb sein Pferd an der Abzweigung vorbei, blickte aber noch mehrmals zu der Straße zurück, als traue er ihr nicht. Was immer ihm zu schaffen machte, er sagte es nicht, und Hadrian fragte ihn auch nicht danach.
Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit, als sie ihre jeweils einzigartigen Fähigkeiten zu gegenseitigem Nutzen vereint hatten, hatte Hadrian bei zahllosen Gelegenheiten versucht, in das Geheimnis von Royce’ Vergangenheit einzudringen, doch ohne Erfolg. Nur Nahtoderfahrungen oder, wie es schien, die Vorfreude auf die Adligen von Maranon vermochten seine Verschlossenheit zu lockern. Von Royce würde er jedenfalls nicht erfahren, wohin die südliche Abzweigung führte. Er wusste nur, dass Royce die Straße kannte und dass sie irgendwohin führte.
Auch die Straße, auf der sie ritten, führte irgendwohin, nämlich bergauf.
Nachdem sie einige Stunden schweigend geritten waren, wurde die Straße schmaler und führte in Serpentinen nach oben und über einen engen Pass. Dahinter öffnete sich der Blick auf eine andere Welt, die sogar noch schöner war als die, die sie zurückließen. An Wiesen voller Wildblumen und Laubwälder schloss sich das Meer an, eine endlose Wasserfläche, gesäumt von zerklüfteten Buchten, die die Brandung aus den gewaltigen Küstenfelsen gefräst hatte. Offenbar waren sie am westlichen Rand von Maranon angelangt, wo das Sharonmeer begann. Hadrian sah es zum ersten Mal, doch unterschied es sich aus der Ferne nicht von den Meeren im Osten. Hier, im Hinterland von Maranon, wo die Straßen schmaler waren und kaum mehr als grasbewachsene Wege, gab es mehr Bäume, mehr Bäche und viel mehr Wasserfälle.