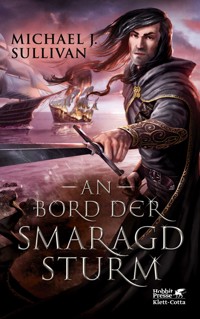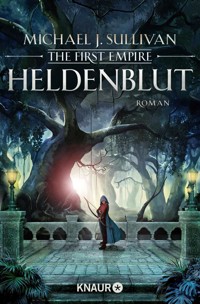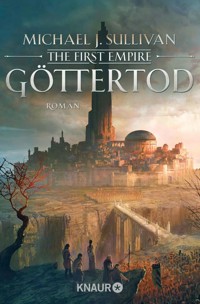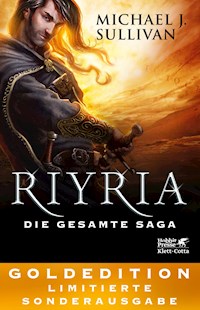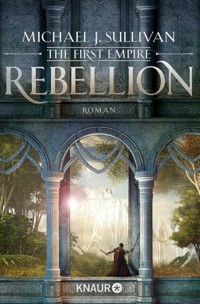9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Zeit der Legenden
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist erst der Anfang: Teil 5 der epischen High-Fantasy-Saga »The First Empire« von Bestseller-Autor Michael J. Sullivan Seit die Seherin Suri vom grausamen Fhan Lothian entführt wurde, scheint alle Hoffnung verloren. Die große Macht des Turms von Avempartha hindert die westliche Armee daran, in die Heimat der Fhrey einzudringen. So muss sie einen Weg über den Fluss Nidwalden suchen, bevor Fhan Lothian das geheime Wissen zum Erschaffen von Drachen erlangt. Alle Hoffnung liegt nun auf den Helden, die bereitwillig die Lande der Toten betraten, um Suri zu retten und den Krieg zu beenden. Die kleine Gruppe ist alles, was den Menschen noch bleibt – kann es ihnen gelingen, das Totenreich zu durchqueren und Suri zu retten? Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: • »Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« • »Heldenblut« • »Drachenwinter«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael J. Sullivan
Drachenwinter
The First Empire. Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Tod ist erst der Anfang:
Teil 5 der epischen High-Fantasy-Saga »The First Empire« von Bestseller-Autor Michael J. Sullivan
Seit die Seherin Suri vom grausamen Fhan Lothian entführt wurde, scheint alle Hoffnung verloren. Die große Macht des Turms von Avempartha hindert die westliche Armee daran, in die Heimat der Fhrey einzudringen. So muss sie einen Weg über den Fluss Nidwalden suchen, bevor Fhan Lothian das geheime Wissen zum Erschaffen von Drachen erlangt.
Alle Hoffnung liegt nun auf den Helden, die bereitwillig die Lande der Toten betraten, um Suri zu retten und den Krieg zu beenden. Die kleine Gruppe ist alles, was den Menschen noch bleibt – kann es ihnen gelingen, das Totenreich zu durchqueren und Suri zu retten?
Der Amerikaner Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken«, hat mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes High-Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und bitteren Verrat geschaffen.
Die High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen:
• »Rebellion«
• »Zeitenfeuer«
• »Göttertod«
• »Heldenblut«
• »Drachenwinter«
Inhaltsübersicht
Das große Tor
Schuld und Sühne
Meister der Geheimnisse
Vom Verlieren und Wiederfinden
Die Schwanenpriesterin
Die Einladung
Das Ende einer Ära
Unbeantwortete Fragen
Ein gerechter Handel
Goll
Der Held
In einem finsteren Wald
Kein Zurück
Hinein in die Dunkelheit
Drachengeheimnisse und Mausschuhe
In der Halle des Zwergenkönigs
Der Abschiedstrunk
Regen der Große
Opfer
In der Gegenwart von Legenden
Kriege in einem Krieg
Das Loch
Das Schwert der Worte
Königin des Weißen Turms
Glossar
1
Das große Tor
Die gute Nachricht ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Aber das ist gleichzeitig auch die schlechte Nachricht.
– Das Buch Brin
Oh, heilige Mari, was habe ich bloß getan? Der Gedanke kam Brin zu spät. Sie versank bereits im Tümpel. Es schmatzte laut, während sie unaufhaltsam tiefer nach unten gezogen wurde. Sie spürte den schleimigen Sog an ihren Füßen, als würde sie von einer zahnlosen Schlange verschluckt werden. Die eisige Kälte, kälter als alles, was sie je zuvor empfunden hatte, kroch ihr an Beinen und Hüfte hinauf. Sie war weder in einer Flüssigkeit noch in Matsch gefangen, es fühlte sich vielmehr wie eiskalter Teer an, der lebendig zu sein schien. Brin zitterte vor Angst, während sich die klebrige Masse Stück für Stück über ihre Brust schob, sodass ihr das Atmen stetig schwerer fiel.
Tesh schrie, als würde er ebenfalls sterben – als würde sein Leben mit Brins enden.
Wie kann ich ihm das nur antun? Er liebt mich und ich …
Wie die Hand einer Leiche in einem Albtraum kroch der Schlamm um ihren Hals. Brin sank tiefer, legte den Kopf in den Nacken, um einen letzten verzweifelten Atemzug zu nehmen. Doch als ihr der Schleim in Mund und Augen drang, konnte sie einen Schrei nicht länger unterdrücken. Der Laut wurde vom Matsch erstickt. Kein Laut drang über ihre Lippen. Tesh würde nie erfahren, dass ihr letztes Wort sein Name gewesen war. Danach weigerte Brin sich einzuatmen. Der Instinkt, unter Wasser die Luft anzuhalten, war stärker als ihr Verlangen nach Sauerstoff.
All die heldenhaften Gedanken, die ihr den Mut verliehen hatten, in den Tümpel zu waten, waren von gesundem Menschenverstand abgelöst worden. Einzelne Bilder zuckten durch Brins Geist: Sonnenschein auf Waldlaub, Regen in einem Eimer, klein geschnittene Karotten, das Lachen ihrer Mutter, ein gefrorener Teich. Als ihre Gedanken vor Panik erstarrten, begann ihr Körper seinen aussichtslosen Überlebenskampf. Sie schlug und trat um sich, reckte einen Arm in die Höhe. Ihre Finger durchbrachen kurz die Oberfläche. Luft – sie spürte Luft!
So nah dran.
Doch gleich darauf wurden ihre Finger bereits wieder verschlungen.
Ihre Arme wurden schwächer, die Bewegungen langsamer. Ihre Beine gehorchten ihr nicht mehr, hingen nur noch schlaff herab.
Neue Bilder blitzten auf: das Feuer im Langhaus, Schafe in einem Sturm, Teshs Hand in ihrer, Worte auf einer Seite.
Während Atmen sie eindeutig umbringen würde, schien ihr Körper davon überzeugt zu sein, dass es sie ebenfalls töten würde, wenn sie es nicht wenigstens versuchte. Also atmete Brin ein. Schlamm drang ihr in Mund und Nase. Sie musste husten, wollte ihre Luftröhre vom Matsch befreien, doch es war in etwa so nutzlos, wie wenn ein angsterfülltes Kind gegen einen Sturm anschrie.
Ihre Panik löste sich in Luft auf. Ruhe überkam Brin, als sie reglos in der kalten, zeitlosen Leere schwebte.
Langsam bekam sie wieder Zugang zu ihrem Geist. Gedanken formten sich einmal mehr. Der erste war der offensichtlichste.
Ich habe einen Fehler begangen – meinen allerletzten Fehler.
Brin wartete geduldig, in dem Wissen, dass der Tod sie längst hätte ereilen müssen.
Mehr Zeit verstrich. Nichts geschah.
Ist es vorbei? Bin ich …?
Die Dunkelheit war so allumfassend, dass Brin sich nicht sicher war, ob ihre Augen offen oder geschlossen waren. Der Gedanke war lächerlich, da sie gleichzeitig nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob sie überhaupt noch Augen besaß.
Bin ich tot? Ich muss tot sein.
Eine seltsame Ruhe überkam sie, als Brin ihre Lage vollkommen akzeptierte. Es war eine merkwürdig vernünftige Reaktion auf eine höchst ungewöhnliche Situation. Ihre Schlussfolgerung war allerdings nur eine Vermutung, da sie immer noch keinerlei Anhaltspunkt dafür hatte, ob sie tot war oder nicht. Sie verspürte keine Panik mehr, glaubte nicht mehr zu ersticken und ihr war auch nicht mehr kalt. Doch das musste nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie tot war. Brin zog in Erwägung, dass sie womöglich noch lebte, aber das Bewusstsein verloren hatte.
Sie versuchte, ihre Arme und Beine zu bewegen, und sie gehorchten ihr. Dadurch erkannte sie, dass sie sich in einer Art Flüssigkeit befand, die allerdings nichts mit dem dickflüssigen Schlamm des Tümpels gemeinsam hatte.
Wasser. Ich bin im Wasser.
Einen Augenblick später durchbrach ihr Kopf die Oberfläche. Brin atmete tief ein und begann, wild um sich zu schlagen.
Habe ich irgendwie überlebt? Bin ich …?
Um sie herum herrschte weiterhin nichts als Schwärze, einige Dinge waren dennoch offensichtlich. Sie befand sich nicht mehr im Teich, nicht mehr auf der Insel und schon gar nicht mehr in Gegenwart der Hexe. Auch Tesh war verschwunden – für immer außerhalb ihrer Reichweite.
Der Fluss des Todes.
Brin kannte die Geschichten. Jene, die beinahe gestorben waren, sprachen von einem starken, düsteren Wasserlauf, der sie in Richtung eines hellen Lichts getragen hatte. Brin sah kein Leuchten, und sie fühlte sich auch nicht tot. Ihre Arme und Beine waren vollzählig vorhanden, und sie war immer noch eine miserable Schwimmerin. Brin hörte auf zu paddeln und ließ ihre Arme schlaff herabhängen. Anstatt unterzugehen, trieb sie auf der Oberfläche dahin. In diesem Zustand der Schwerelosigkeit nahm sie nichts wahr: kein Licht, kein Geräusch, keinen Geruch, keinen Geschmack und kein Gefühl. Brin schien in einem riesigen Nichts dahinzutreiben, und das ließ die Frage in ihr aufsteigen: Bilde ich mir nur ein, Arme und Beine zu haben? Wie konnte sie sich dessen sicher sein, wenn es nichts gab, womit sie interagieren konnte? Einmal mehr stieg Angst in ihr auf.
Existiere ich überhaupt noch? Dieser Gedanke führte zum nächsten, der noch beängstigender war: Gab es überhaupt jemals eine Person namens Brin? Ist mein Leben wirklich so passiert, wie ich mich daran erinnere?
Brin hatte keine Antworten. Um klar denken zu können, brauchte sie Rahmenbedingungen, Referenzen, etwas, worauf sie ihre Theorien gründen konnte. Doch sie hatte nichts. Es fühlte sich an, als würde sie sich langsam auflösen, genau wie all ihre Sinne.
Bin ich …?
Auf einmal war da kein Wasser mehr um sie. Das Gefühl dahinzutreiben verschwand.
Existiere ich?
Ohne jegliche Verbindung konnte Brin sich selbst nicht mehr fassen.
Ich gehe nicht unter. Ich löse mich auf.
Das letzte bisschen, das noch von ihr übrig geblieben war, zerfiel, brach auseinander, schmolz. Brin verblasste – doch dann …
Da war ein Licht.
Brin sah es. So klein wie ein Nadelöhr, ein weit entfernter Stern.
Etwas anderes existiert, also existiere ich wohl auch. Ich bin nicht vollständig verschwunden.
Das Schimmern wurde größer. In seinem Schein erkannte Brin den Fluss. Wie eine tintenschwarze Schlange wand er sich durch eine riesige, steinerne Schlucht. Dank der hohen, an ihr vorbeirauschenden Wände wusste Brin, dass sie sich bewegte. Diese Gewissheit verschaffte ihr einen Moment, um nachzudenken. Um sich zu erinnern. Sofort überkam sie das Bild von Tesh, der vor Gram geschrien hatte. Nie würde sie diesen schrecklichen Laut vergessen können. Sein Ruf war ihr den ganzen Weg bis hierher gefolgt.
Es tut mir leid, dachte Brin, während das Licht stetig größer wurde.
Es war weder gelb noch orangefarben, sondern eher blass und trüb wie die Sonne, die sich an einem späten Winternachmittag hinter einer dicken Wolkendecke verbirgt. Im Näherkommen konnte Brin im schwachen Licht mehr als nur die zerklüfteten Steinwände zu beiden Seiten erkennen. Der Fluss endete in einem See, der an einen hell erleuchteten Strand brandete. Brins Aufmerksamkeit wurde von Bewegungen am Ufer auf sich gezogen.
Da sind Leute! Ja, hier unten gibt es noch andere.
Da die Lichtquelle hinter den Personen lag, konnte Brin nur Silhouetten ausmachen. Hunderte drängten sich dort. Dahinter entdeckte Brin ein riesiges Tor mit zwei Flügeltüren. Sie waren verschlossen, doch das Strahlen dahinter war so hell, dass es durch die Öffnungen drang.
Plötzlich berührten Brins Füße sandigen Boden. Die Strömung trug sie noch ein wenig weiter, bis sie aus eigener Kraft stehen bleiben und sich aufrichten konnte.
»Brin!« Roan rannte auf sie zu. Sie wirkte ganz und gar nicht tot, sondern genauso, wie sie ausgesehen hatte, bevor sie in den Teich gewatet war. Kein bisschen Schlamm klebte an ihr, als sie Brin aus dem Wasser half.
»Du dummes Mädchen.« Moya kam ebenfalls herbei und zog Brin fest an sich. Dann hielt sie Brin von sich und schob ihr eine Haarsträhne aus der Stirn. »Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht mitkommen sollst. Befohlen habe ich es dir. Warum? Warum hast du nicht auf mich gehört?«
»Mir ist etwas aufgefallen, was mir schon viel früher hätte klar werden müssen. Muriels Name stand auf den Steintafeln in der Agave neben Ferrol, Drome und Mari. Wenn sie eine Göttin ist, muss ihr Vater auch ein Gott sein. Tressa hatte recht, was Malcolm angeht. Und er wollte, dass ich dabei bin.«
»Also glaubst du jetzt auch an den ganzen Unsinn? So sehr, dass du dich dafür umgebracht hast?«
»Das ist noch nicht alles. Malcolm hat mir auch erzählt, dass mein Buch in der Zukunft zu der wichtigsten Sache werden wird, die die Menschheit je erschaffen hat. Er wusste, dass ich alles aufschreiben würde. Er will, dass ich die Wahrheit erzähle, und er denkt, dass ich sie hier unten finden werde.«
»Du hättest es trotzdem nicht tun dürfen.« Moya klang angespannt. »Persephone wird mir niemals verzeihen.«
»Doch. Wenn unser Vorhaben gelingt.«
»Die Chancen dafür stehen nicht gut.«
Zusammen gesellten sie sich zu Gifford, Tressa und Regen, die abseits der großen Menge vor den Toren standen. Alle lächelten Brin an und nickten ihr zu, als teilten sie ein Geheimnis. Brin wusste, was es war. Sie waren wieder vereint, aber sie waren alle tot.
Regen hatte seine Spitzhacke dabei, Moya ihren Bogen und Tressa trug noch immer das viel zu große, an der Taille mit einem Seil zusammengehaltene Hemd von Gelston. Brin hatte die neue Kleidung noch nicht fertiggestellt, die sie Tressa im Gegenzug für den Unterricht im Lesen versprochen hatte. Ein schlechtes Gewissen überkam sie, als ihr klar wurde, dass Tressa nun ihre Ewigkeit in diesem schäbigen Hemd verbringen würde.
Moya musterte Brin und warf dann einen Blick über die Schulter in Richtung Fluss. Ihr Blick verdüsterte sich. »Tesh?«
Brin schüttelte den Kopf und rang sich ein Lächeln ab. »Er hat mich gehen lassen«, sagte sie leichthin, doch sie hörte, wie gezwungen es sich anhörte.
Moya nickte traurig.
»Zuerst hat er versucht, mich aufzuhalten. Es hat ein bisschen gedauert, ihn zu überzeugen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ihr ohne mich losgezogen wärt und ich euch hier unten nicht mehr finden würde.«
»Die Gefahr ist nicht sehr groß.« Gifford deutete auf die vor den Toren Versammelten. »Anscheinend warten alle darauf, eingelassen zu werden.«
Roan fuhr zu ihrem Ehemann herum. »Gifford?« Sie starrte ihn fasziniert an.
»Was ist denn?«
»Du hast … Was hast du gerade gesagt?«
Gifford zuckte mit den Schultern. »Ich denke bloß, dass es eine große Schlacht oder so gegeben haben muss, weil so viele Leute darauf warten, ins Nachleben gelassen zu werden.«
»Du hast es schon wieder getan!« Roan hüpfte vor Freude auf und ab.
»Was denn?«
»Gifford, sag meinen Namen.«
Er runzelte die Stirn und warf den anderen einen verwirrten Blick zu. »Roan, was …« Doch dann weiteten sich seine Augen, und sein Mund öffnete sich vor Staunen.
»Du sprichst auf einmal wie alle anderen.« Roan strich ihm sanft über die Lippen.
»Roan.« Er wiederholte es lauter. »Roan, Roan, Rrr-oan!«
Gifford schlang die Arme um seine Frau, und sie lachten gemeinsam.
Auch Brin bemerkte, dass sie lächelte. Alle grinsten sich an, doch da fiel ihr auf, dass jemand fehlte. »Wo ist Tekchin?«
»Er ist zum Tor gegangen.« Moya musste ihn in der Menge entdeckt haben, denn sie winkte mit ihrem Bogen. »Da kommt er ja schon.«
Der Fhrey bewegte sich mit derselben Grazie wie im Vorleben. »Die Tore sind fest verschlossen. Niemand kann hinein, und keiner weiß warum. Die meisten Leute nehmen an, dass etwas nicht stimmt.«
»Tja, so sieht’s also aus.« Moya blickte finster drein. »Wir machen uns die Mühe zu sterben, nur um dann hier unten festzusitzen? Wissen wir überhaupt, wohin dieses Tor führt?«
»Ja. Nach Phyre. Und dieses Tor steht normalerweise offen«, erklärte Tekchin. »Das Licht im Inneren zieht die Verstorbenen an. Und wenn sie nahe genug herankommen, finden sie ihre Angehörigen und Freunde, die am Eingang auf sie warten.«
»Woher weißt du das alles?«
»Da drüben steht eine Frau, die schon mal hier war, aber sie ist wieder in ihrem Körper aufgewacht. Das hat sie mir zumindest erzählt. Und laut einem Kerl, der in Süd-Rhulyn an einem Fieber starb, ist das Tor schon seit langer Zeit verschlossen.«
»Und wie lange genau?«
Tekchin deutete vielsagend auf die Dunkelheit hinter ihnen. »Wer kann das schon wissen?«
Moya führte die anderen in Richtung des Tores. Die Menge, die davor wartete, bestand zu großen Teilen aus Rhunes, und es war beängstigend zu sehen, wie viele Kinder unter ihnen waren. Tekchin war der einzige Fhrey, doch es gab einige Zwerge. Eins allerdings hatten alle Anwesenden gemeinsam: Sie sahen verängstigt, verloren und verwirrt aus.
Alle hier sind tot.
Moya würde eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Niemand unter den Anwesenden sah aus wie ein Geist. Es waren einfach nur gewöhnliche Leute, auch wenn viele von ihnen merkwürdig gekleidet waren. Nur wenige trugen Reisekleidung wie Moya und ihre Gefährten. Die meisten Frauen trugen elegante Kleider, die Männer offenbar ihre besten Tuniken. Niemand hatte Umhänge oder gar Taschen dabei, doch alle trugen Steine bei sich. Manche hatten sie sich an Kordeln um den Hals gehängt, die meisten hielten sie in der Hand.
»Macht Platz, macht Platz!« Tekchin bahnte ihnen einen Weg durch die Leute, die sie klaglos passieren ließen. Er benutzte seine ausgestreckte Hand, um die Menge zu teilen, als wäre er ein Schiffsrumpf, der durch ein Meer aus toten Seelen pflügte. Seine grobe Art schien niemandem etwas auszumachen. Im Gegenteil. Durch das selbstbewusste Auftreten der Truppe schienen die Leute zu glauben, dass sie eine gewisse Autorität genossen, denn einige wandten sich mit Bitten an sie, als sie an ihnen vorübergingen.
»Das ist ein Fehler«, sagte ein in Lumpen gekleideter Mann zu ihnen. Im Gegensatz zu vielen anderen hatte er keinen Stein. »Ich sollte gar nicht hier sein. War nicht mal krank. Als ich im Wald unterwegs war …«
Doch sie gingen bereits weiter, und Moya war froh, dass sie sich nicht die ganze Geschichte anhören musste.
Als Nächstes kamen sie an einer schluchzenden Frau vorbei, die ihre Arme um sich geschlungen hatte und sich vor und zurück wiegte. »Meine Kinder, meine Kinder …«, weinte sie und sah Moya dabei direkt an. »Wie sollen sie ohne mich überleben?«
Eine in feine Stoffe gekleidete Dame hatte die Arme vor der Brust verschränkt und funkelte zuerst Moya und ihre Gefährten, dann das Tor an. »Sollen wir etwa ewig warten? Wenn immer mehr Leute sterben, wird es hier bald sehr eng werden.«
Tekchin nahm Moyas Hand, während sie sich weiter durch die immer dichter stehende Menge schoben. Im Näherkommen erkannte Moya, dass der Eingang noch riesiger war, als er aus der Entfernung gewirkt hatte. Über den Torflügeln waren drei Figuren in den Stein gehauen. Sie standen Schulter an Schulter und blickten auf sie herab: ein männlicher Zwerg und zwei Frauen, eine Rhune und eine Fhrey. Zu ihren Füßen waren mehrere Kreaturen dargestellt, die Steine warfen. Direkt unter den Figuren befanden sich die riesigen Torflügel. Sie schienen aus massivem Gold zu bestehen und waren sogar mächtiger als jene in Alon Rhist, größer noch als der Eingang nach Neith. Beide Flügel waren mit Reliefs von Personen verziert, die auf die eine oder andere Weise litten. Manche stürzten aus großer Höhe herab, andere hoben schützend die Arme, während sie von den Steinen der Kreaturen am oberen Torrand getroffen wurden. Viele weitere wurden erstochen, erwürgt oder geköpft.
Besonders eine Darstellung nahe dem unteren Torrand fiel Moya ins Auge, auf der eine Frau von riesigen Wellen verschluckt wurde. Sie hatte einen Arm nach oben gereckt, auf der Suche nach Hilfe, die nie kommen würde.
Durch die Ritzen zwischen den Torflügeln und den Scharnieren sickerte Licht und badete den Strand in weiches Glühen.
Als wäre der Mond dahinter gefangen.
»Was soll die Eile?«, fragte ein Zwerg, an dem Tekchin sich vorbeischob. »Habt ihr etwa noch was vor?«
Der Galantianer strafte ihn mit einem drohenden Blick, unter dem der Zwerg augenblicklich verstummte. Doch bis sie am Tor ankamen, musste Tekchin noch einige weitere Schubser und finstere Blicke verteilen.
Moya ging direkt darauf zu und berührte den kalten Stein des Torbogens. Dann fuhr sie mit den Fingern über das goldene Gesicht der Ertrinkenden. »Was für ermutigende Bilder. Da bekommt man doch gleich Lust einzutreten. Was glaubt ihr, wer sind wohl die drei Figuren ganz oben?«
»Keine Ahnung«, antwortete Tekchin. »Aber hast du einen Plan, wie wir reinkommen?« Er schenkte ihr ein verwegenes Lächeln. Nahezu alles, was Tekchin sagte, wurde von irgendeiner Form von Grinsen begleitet. Für ihn war das Leben ein nie endendes Abenteuer. Der Tod hatte an dieser Einstellung offenbar nicht rütteln können, und Moya war froh darüber.
Er liebt mich. Der große Galantianer, der einstige Gott von der anderen Seite des Flusses, liebt mich – Moya, die unkontrollierbare Tochter von Audrey, der Wäscherin.
Sie konnte immer noch nicht fassen, dass Tekchin mehr als tausend Lebensjahre für sie aufgegeben hatte. In all den Jahren, die sie zusammen verbracht hatten, hatte er sich stets geweigert, »Ich liebe dich« zu sagen. Doch in diesem einen unglaublichen, aufopferungsvollen Moment, als er sie auf seine Arme gehoben und in den Teich getragen hatte, hatte er ihr seine Hingabe bewiesen.
Moya starrte zu den riesigen Toren auf und zuckte mit den Achseln. Sie wandte sich an die Umstehenden. »Hat es schon mal jemand mit Klopfen versucht?«
»Bist du verrückt?«, fragte die ungeduldige Frau.
Moya nickte. »Höchstwahrscheinlich.« Sie reckte sich, um eine glatte Fläche zu erreichen, und schlug dreimal mit der flachen Hand gegen das Tor.
Das Geräusch war lauter als erwartet, doch nichts passierte.
Moya versetzte dem Torflügel einen kräftigen Stoß, doch alles was sie damit erreichte, war, dass sie selbst zurückprallte.
Die Frau verdrehte gereizt die Augen.
»War ’nen Versuch wert.« Moya stellte sich auf die Zehenspitzen, um den Fluss hinter der Menschenmenge erkennen zu können. Immer mehr Leute kamen am Strand an. Auf dem Wasser hüpften die Köpfe der Neuankömmlinge auf und ab wie Treibholz.
»Es müssen ein paar Hundert Menschen hier sein, vielleicht sogar mehr.« Sie wandte sich an einen Mann im Nachthemd, der in der Nähe stand. Über seiner Brust und unter den Armen hatte sich der Stoff gelblich verfärbt. Sein Oberlippenbart war hart vor getrocknetem Schleim. »Wie lange müssen wir hier warten?«
»Als ob ich das wüsste.« Mit missmutiger Miene zupfte er an seinem Nachthemd. »Ich lag im Bett, hab geschlafen. Und dann wache ich auf und bin hier!«
Moya starrte nicht weniger unfreundlich zurück. »Oh, du armer Kerl. Du bist in deinem eigenen Bett gestorben? Wie traurig. Andere hier sind in ekligem Schleim ertrunken, und der arme Bastard da drüben«, sie deutete auf den zerlumpten Mann, der sie zuvor angesprochen hatte, »sieht aus, als wäre er von einem Bären angefallen worden. Und hast du dir mal diese Tore angesehen? Die Bilder hier? Du hättest durch sonst was den Löffel abgeben können.« Sie schüttelte den Kopf. »Im Bett gestorben. Ernsthaft?«
Der Schleimbart wich vor ihr zurück und verschwand in der Menge, sodass sie den Platz vor dem Tor nun für sich hatten.
Moya wandte sich an Regen. »Also, wie funktioniert das jetzt? Wir benutzen doch den Du-weißt-schon-was, oder?«
Der Zwerg versteifte sich, als hätte sie ihn bei etwas Verbotenem ertappt. »Was? Oh, äh …« Er sah sich ebenfalls um, wie um sicherzugehen, dass sich niemand in der Nähe aufhielt. Er senkte die Stimme. »Ein Schlüssel braucht immer ein Schloss.«
»Und was ist das?«, fragte Moya.
»Na ja, also das ist so eine kleine Öffnung, wie ein Loch, in das der Schlüssel perfekt hineinpasst.«
Auch die anderen musterten jetzt die riesige Oberfläche des Tores. »Hier gibt es Dutzende Öffnungen«, sagte Moya. Sie deutete aufwärts. »Da oben ist zum Beispiel eine Höhle und dort ein Türbogen. Welche ist die richtige?«
»Wir könnten alle ausprobieren«, warf Gifford ein.
Moya schüttelte den Kopf. »Wir haben zu viel Publikum. Vergiss nicht, dass wir den Schlüssel geheim halten müssen.«
»Ja, du hast natürlich recht«, sagte Tressa. »Lass uns lieber ewig hier rumstehen und warten. Übrigens ist ewig hier unten nicht nur eine Redensart.«
Moya warf ihr einen Todesblick zu. »Ich hatte gehofft, dass der Tod dich ein bisschen erträglicher machen würde, aber das war wohl zu viel verlangt.«
»Ich bin, wie ich bin.« Tressa fuhr dramatisch mit den Händen über ihren Körper, als würde sie ein neues Kleid präsentieren.
»Das Schloss wird sich nicht so weit oben befinden«, erklärte Regen. »Dann könnte man es nicht erreichen. Die meisten Schlösser befinden sich auf einer praktischeren Höhe. Wie dieses zum Beispiel.« Er deutete auf eine Öffnung nahe der Mitte des rechten Torflügels neben dem Relief eines Bären, der drei Männer verschlang. Daneben war die Sonne als ein Mann mit wild abstehendem Haar dargestellt. Sein Mund war weit aufgerissen, darin befand sich eine Öffnung. »Das da ist Eton, und wir haben seinen Schlüssel.«
Er wandte sich an Tressa. »Schieb ihn mit dem Bart voran hinein – das ist das gezackte Ende – und dreh ihn dann herum.« Er deutete eine Drehung im Handgelenk an.
»Vielleicht solltest lieber du das tun.« Tressa klang plötzlich ängstlich. »Du weißt, wie es funktioniert.«
»Nein«, warf Moya ein. »Malcolm hat den Schlüssel dir gegeben, und du hast uns überhaupt erst in diese Lage gebracht. Also versuch ja nicht, deine Verantwortung auf andere zu übertragen.«
Tressa schaute zu dem klaffenden Mund ein Stück über ihr, dann zurück zu der Menschenmenge. »Wenn ich mich da hochstrecke, wird es jemand sehen.«
Sie starrte Moya an, als hätte diese die Antworten auf alle Fragen des Lebens. Die hatte sie allerdings nicht, und selbst wenn es so gewesen wäre … waren sie jetzt tot, und das änderte alle Regeln.
Roan flüsterte Gifford etwas ins Ohr. »Ich kümmere mich darum«, verkündete er. »Macht euch bereit.«
»Wofür?«, fragte Moya, doch bevor sie nachhaken konnte, war Gifford bereits auf dem Weg den Hang hinunter.
Sie wandte sich an Roan. »Was macht er denn?«
Roan lächelte. »Sieh selbst.«
Gifford nahm seine Beinstütze ab und warf sie fort. Hoch aufgerichtet schritt er zurück zum Flussufer. »Hallo zusammen!« Er griff in seine Umhängetasche und zog drei Steine heraus. »Ich frage mich, ob mich vielleicht jemand von euch kennt. Ich bin Gifford aus Dahl Rhen. Früher war ich Töpfer.«
»Ich!«, rief eine Frau aus der Menge, als hätte sie einen Preis gewonnen. »In Vernes habe ich eine Schüssel von einem Töpfer namens Gifford aus Rhen gekauft. Eine wirklich gute Schüssel.« Dann runzelte sie verwirrt die Stirn. »Aber mir wurde gesagt, sie wäre von einem Krüppel gemacht worden.«
»Das ist richtig«, antwortete Gifford mit lauter Stimme. »Das war ich. Mein Leben lang konnte ich nicht richtig gehen. Ich hatte ein Sprachproblem. Konnte nicht mal den Namen meiner wunderschönen Frau aussprechen. Sie heißt übrigens Roan – RrrOOOAAN!«, brüllte er. »Als ich noch am Leben war, konnte ich keine Worte mit R aussprechen, wie Regen, rennen oder ehrlich.« Gifford strahlte über das ganze Gesicht. Viele Menschen in der Menge lächelten zurück.
Roan stand neben Moya und Brin, sie hatte die Hände vor den Mund geschlagen. Vor Aufregung wippte sie auf und ab, kurz davor, in Tränen oder lautes Gelächter auszubrechen.
»Ja, ich hatte wirklich kein schönes Leben. Mein Rücken war verdreht wie eine Karotte, die keinen Platz zum Wachsen hatte. Die Leute in meinem Dahl nannten mich Goblin, weil ich so herumtrampelte. Ich war ein armer Tropf, aber schaut euch das an!«
Gifford begann mit den drei Steinen zu jonglieren, die Suri ihm gegeben hatte. Die Zuschauenden drängten sich näher an ihn heran, verfolgten, wie die Steine hoch in die Luft flogen. Moya nahm an, dass sie sich über die Abwechslung freuten. Viele von ihnen warteten sicher schon eine Ewigkeit an diesem Strand. Alle schauten Gifford zu, selbst Tressa.
»He!« Moya rüttelte sie am Arm. »Los! Tu es jetzt! Beeil dich!«
»Ach ja, richtig.« Tressa griff in ihren Ausschnitt und holte das winzige Stück Metall hervor, das an einer Kette um ihren Hals hing.
»Und jetzt – schaut euch das an«, rief Gifford am Strand.
Moya sah nicht, was er tat, doch die Zuschauer schienen beeindruckt zu sein, denn sie stießen bewundernde Laute aus.
Tressa steckte den Schlüssel in Etons Mund und drehte ihn. Ein lautes Klicken ertönte. Als Moya besorgt herumfuhr, waren aller Augen immer noch auf Gifford gerichtet, der die Steine nun hinter seinem Rücken auffing.
Tressa zog den Schlüssel zurück und verbarg ihn wieder unter ihrem Hemd.
Moya drückte vorsichtig gegen beide Torflügel, und sie schwangen nach innen auf. Das Licht wurde heller und zog die Aufmerksamkeit der Menge auf sich. Alle drehten sich um, um zu sehen, was dort vor sich ging.
Immer weiter öffnete sich das Tor, als würde es von Riesen aufgezogen. Als der Spalt zwischen den Flügeln endgültig aufbrach, blendete das Licht sie alle.
2
Schuld und Sühne
Für jeden Fehler gibt es einen Schuldigen, der zur Verantwortung gezogen und bestraft werden muss. Wer anders denkt, der glaubt, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind und sich die Welt nicht um uns dreht.
– Das Buch Brin
Ein kalter Wind schnitt durch Persephones Breckon Mor, als sie in der verhüllten Morgensonne stand. Vereinzelte Schneeflocken segelten wehmütig durch die Luft, verspielt und schön anzusehen. Durch die weißen Sprenkel auf der Wiese wirkte der Hügel heller als sonst. Obwohl Persephone nicht weit vom Lager entfernt war, wusste sie, dass sie hier ihre Ruhe hatte. Sie stand auf der windabgewandten Seite der Kreatur. Immer noch fürchteten die meisten die riesige geflügelte Schlange, die auf der Hügelkuppe lag, aber nicht schlief. Das riesige Wesen hatte die Augen geschlossen. Der Drache regte sich nie, egal wie oft Persephone ihn besuchte, und er hatte nur dieses eine Mal mit ihr gesprochen. Doch dieses eine Mal war genug gewesen.
Persephone hielt Abstand. Auch sie hatte Angst vor dem Drachen, besuchte ihn aber dennoch fast jeden Tag. In den frühen Morgenstunden oder spät in der Nacht, wenn niemand sie sah, erklomm sie den Hügel und stellte sich vor das Biest, um ihm von ihren Ängsten und Sorgen sowie von ihren Hoffnungen und Träumen zu erzählen. Sie wusste, dass der Drache sie hören und verstehen konnte. Und sie hoffte, dass er sie ebenfalls verstand. Persephone hatte keine Ahnung, wie die Magie funktionierte, doch sie war davon überzeugt, dass Raithe zuhörte, wenn sie zu dem Drachen sprach.
»Sie hätten längst zurück sein müssen«, sagte sie. »Ich mache mir Sorgen. Sie sollten doch bloß den Sumpf erkunden und dann sofort hierher zurückkehren. Es hätte nicht länger als einen oder zwei, maximal drei Tage dauern dürfen.«
Sie rang die Hände. »Ich habe Moya mitgeschickt, damit sie auf die anderen aufpasst. Tekchin war auch dabei. Und dann natürlich Tesh, das hätte Schutz genug sein müssen. Also warum sind sie noch nicht zurück?« Sie hatte keine Antwort erwartet und bekam auch keine. Der Drache öffnete nicht einmal die Augen. »Warum habe ich sie bloß gehen lassen?«
Persephones Seufzer hinterließ eine weiße Wolke in der frostigen Luft. Sie richtete ihren Blick auf die riesigen Klauen des Drachen. »Weil ich Angst hatte, dass sich der Himmel mit vielen deiner Art verdunkeln würde. Deshalb. Und das fürchte ich immer noch.« Als sie diesmal in den grauen Himmel aufschaute und den sanften Kuss der Schneeflocken auf ihren Wangen spürte, stellte Persephone sich riesige schwarze Schatten vor, ganze Schwärme wie bei einer Heuschreckenplage. »Wir brauchen ein weiteres Wunder, Raithe.«
Persephone fiel auf die Knie, schlang die Arme um sich und senkte den Kopf, als würde sie beten. »Ich glaube genauso wenig an Nyphrons Pläne wie an meine eigenen. Wir haben Elysan nach Norden geschickt, um mit den Riesen zu verhandeln, und die Hälfte der Zweiten Legion marschiert nach Süden, um einen einfacheren Weg über den Fluss zu suchen. Beide Missionen sind nicht gerade Erfolg versprechend. In letzter Zeit scheinen wir nichts anderes zu tun, als unsere Leute in die Wildnis zu schicken, die sie dann verschlingt. Ich habe keine Ideen mehr. Wir haben keine Ideen mehr. Er würde es nie zugeben, würde es weder sich selbst noch mir gegenüber eingestehen, aber ich glaube, Nyphron ist genauso verzweifelt. Er spürt, dass sich das Blatt erneut gewendet hat – und dieses Mal nicht zu unseren Gunsten. Alles fühlt sich so hoffnungslos an, geradezu absurd. Als wir damals erfuhren, dass die Fhrey auf dem Weg waren, um unsere Dahls zu zerstören, war es nicht schwer, unsere Niederlage zu akzeptieren. In Tirre, als wir keine Keenigin und keine Waffen hatten, ergab es noch Sinn zu glauben, dass wir aussterben würden. Selbst in Alon Rhist schien der Sieg so unwahrscheinlich wie ein ferner Traum. Und doch haben wir jedes Mal überlebt. Oft war es sehr knapp – es gab so viele Wunder.«
Persephone dachte an all die Hungersnöte, Krankheiten und Auseinandersetzungen zwischen den Clans, die Rhen zu ihren Lebzeiten überstanden hatte. Nichts war auch nur annähernd mit den harten Zeiten vergleichbar, die sie in den letzten Jahren durchgestanden hatten. Die Menschen waren wie eine schwache Flamme, die der Wind unbedingt auspusten wollte, doch immer kam ihm etwas dazwischen – ein glücklicher Zufall, etwas, das unter normalen Umständen nie möglich gewesen wäre.
»Es ist fast, als ob …«
Hinter sich vernahm Persephone schweres Atmen und knirschendes Gras. Als sie sich umdrehte, entdeckte sie einen dürren, hochgewachsenen Mann in einem Umhang. Er stützte sich auf seinen Speer wie auf einen Wanderstab, während er den Hügel erklomm. Ein bekannter, wenn auch unerwarteter Anblick.
»Malcolm?«
»Guten Morgen«, grüßte er sie heiter. »Dachte ich mir doch, dass ich dich hier antreffe.«
Persephone kam auf die Beine und starrte ihm entgegen. In ihrem Inneren rangen Freude und Verwirrung über sein Auftauchen um die Oberhand. »Ich habe dich seit Jahren nicht gesehen. Wo warst du denn?«
»An vielen verschiedenen Orten: Tirre, Caric, Neith und auf einer kleinen Landzunge, die ins Grüne Meer hinausragt.«
»Falls du es noch nicht gehört hast: Wir befinden uns im Krieg. Warum bist du fortgegangen? Wir hätten jeden fähigen Mann gebraucht.«
Malcolm hatte die Kuppe des Hügels inzwischen erreicht. Er lehnte sich auf seinen Stab und lächelte Persephone an. »Ich habe dich auch vermisst.«
»Ich …« Plötzlich schämte Persephone sich. »Es tut mir leid. Ich wollte nicht vorwurfsvoll klingen. Ich habe dich wirklich sehr vermisst.«
Erst in diesem Moment wurde ihr bewusst, wie wahr ihre Worte waren. Darum umarmte sie ihn fest, wie es einem alten Freund zustand. Doch Malcolm war mehr als das. Vor seinem Verschwinden war Raithes unscheinbarer Gefährte zu Persephones geschätztem Berater geworden. Schon nach der Schlacht von Grandford hatte Roan ihr gegenüber erwähnt, dass Malcolm irgendwie besonders war, doch Roans Beobachtungen waren oft wirr und schwer zu verstehen.
Persephone hatte Malcolms verstecktes Talent zum ersten Mal bemerkt, als er die Geburt ihres Sohnes Nolyn vorhergesagt hatte. Er hatte nicht nur verkündet, dass sie bald ein Kind gebären würde, sondern sogar erwähnt, dass sie Nyphron in einem Zelt am Ufer des Flusses Bern im Hochspeertal während der ersten Schlacht des nächsten Frühlings einen Sohn schenken würde. Zu jener Zeit war das eine mutige Vorhersage gewesen, da Persephone sich immer noch in Alon Rhist aufgehalten hatte und nicht sicher gewesen war, ob sie Nyphron je wiedersehen geschweige denn heiraten würde. Persephone hatte bereits in der Vergangenheit mit Seherinnen zu tun gehabt, sodass sie sein scheinbar neu entdecktes Talent nicht beunruhigte. Suri und Tura hatten jedoch immer mit Knochen gearbeitet und nur vage, verwirrende Dinge vorausgesagt. Sie hatten nie genau gewusst, was passieren würde, wohingegen Malcolm jedes Detail beschrieb.
Persephone löste sich von ihm und lächelte traurig. »Es ist nur so, dass es gerade nicht besonders gut läuft und, na ja, ich …«
Er nickte, ein wissendes Lächeln umspielte seine Mundwinkel. »Du hast panische Angst. Du fürchtest, dass die Fhrey die gesamte Menschheit auslöschen werden.«
Persephone blinzelte. »Tja, also … ja.«
»Aber das ist noch nicht alles, was dir Sorgen bereitet, nicht wahr?«
»Ist das nicht genug?«
»Für die meisten wäre es das wohl, doch die Chancen, dass die Rhunes gegen die Fhrey gewinnen, standen schon immer schlecht. Deine Ängste sind tiefer in deinem Herzen verwurzelt.« Malcolm schaute zu dem Drachen. »Du glaubst, dass Raithes Blut an deinen Händen klebt, dass es dumm war, Suri nach Avempartha zu schicken, und dass all deine engsten Freunde im Sumpf von Ith ums Leben kommen werden, weil du sie dorthin gehen lassen hast.«
Seine Worte versetzten ihr einen Stich. »Vielleicht war ich doch zu vorschnell, mich über deine Rückkehr zu freuen«, erwiderte sie scharf. Er hatte mit allem recht, doch die Worte laut ausgesprochen zu hören, war vernichtend – vor allem von einem Freund. »Bist du nur zurückgekommen, um mich daran zu erinnern, was für eine Versagerin ich bin?«
Er wandte sich von dem Drachen ab und schenkte ihr einen mitfühlenden Blick. »Ganz und gar nicht. Ich bin unter anderem hier, um dir zu zeigen, wie falsch du liegst.«
»Wie kannst du das sagen? Ich habe Vögel ausgeschickt, war dumm genug zu glauben, wir könnten Frieden aushandeln. Mir hätte klar sein müssen, dass der Fhan nicht mit Suri verhandeln wollte. Ich habe unsere kostbarste Waffe gehen lassen, und Lothian wird sie dazu bringen, ihr das Geheimnis zur Erschaffung von Drachen zu verraten. Ich habe diesen Krieg verloren, Malcolm. Ich habe alles kaputt gemacht.«
Er schüttelte den Kopf. »Dieser Krieg wird nicht durch Vögel oder Drachen und schon gar nicht durch Gier oder Hass entschieden werden, sondern durch den Mut und die Tugendhaftigkeit einiger weniger, die alles aufgeben werden, um die Zukunft zu retten. So wird es passieren. Weißt du, die Stolzen, Gierigen und Rachsüchtigen sind nie diejenigen, die die Welt verändern – zumindest nicht zum Guten. Sie können es nicht, denn ihnen stehen nicht die richtigen Werkzeuge zur Verfügung. Es ist, als würde man einen Fisch bitten zu fliegen. Es liegt nicht in ihrer Natur, sich für andere zu opfern. Aber jene, die in den Sumpf aufgebrochen sind, verstehen, wie wichtig es ist, zu tun, was getan werden muss, wenn die Zeit kommt. Und sie sind nicht die Einzigen.«
»Was meinst du damit?«
»Dich, Persephone. Deine Opfer haben einen Unterschied gemacht und werden es auch in Zukunft.«
Sie lachte traurig. »Ich? Vielleicht habe ich in der Vergangenheit ein paar gute Entscheidungen getroffen. Die Reise nach Neith, die Verlegung unserer Truppen nach Alon Rhist … aber ich habe seit Jahren nichts Wertvolles mehr getan.«
»Wirklich? Das ist es also, was du denkst?« Wieder warf er dem Drachen einen Blick zu. »Warum hast du Nyphron gewählt und nicht Raithe?«
»Ich verstehe nicht, wie sich meine Entscheidung, welchen Mann ich heirate, auf das alles auswirkt.«
»Ich aber schon, und ich glaube, du verstehst es auch. Warum zögerst du, es auszusprechen? Sag es mir.«
Sie wollte nicht antworten, doch es waren nicht mehr viele Leute übrig, mit denen sie frei sprechen konnte, und Malcolm war einer davon. Persephone seufzte peinlich berührt. »Weil er der Bessere für die Aufgabe war.«
»Für welche Aufgabe? Die des Liebhabers? Vaters? Vertrauten?«
»Nein.« Persephone sah zu Boden.
»Wofür dann?«
Persephone war überrascht, dass er so sehr darauf beharrte. Malcolm war früher nie so provokativ gewesen. »Weil er ein besserer Herrscher ist«, sagte sie schließlich.
»Ja.« Malcolm nickte. »Das ist nicht gerade der Charakterzug, nach dem viele Frauen in einem Ehemann Ausschau halten. Aber warum ist das wichtig? Die Rhunes haben doch ihre Stammesführer.«
»Die Welt hat sich gewandelt. Wir können jetzt nicht mehr zu unserem System der verstreuten Clans zurückkehren, da wir die Vorteile einer einzigen Anführerin erkannt haben.«
»Aber du bist doch schon Keenigin. Du bist die Herrscherin aller Rhunes, oder nicht? Wo kommt Nyphron ins Spiel?«
»Noch. Aber ich bin vierzig Jahre alt. Wenn ich Glück habe, erlebe ich gerade noch, wie Nolyn zum Mann heranwächst. Als ich noch dachte, wir hätten eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen, sah ich Nyphron als verlässlichen und gerechten Anführer. Er ist zwar kein besonders guter Ehemann, kein leidenschaftlicher Liebhaber, aber er ist stark, denkt rational und stellte unsere beste Chance auf eine bessere Zukunft dar. Höchstwahrscheinlich wird er noch tausend Jahre leben. In dieser Zeit wird er uns Stabilität bringen und große Taten für uns Menschen vollbringen.«
»Und aus diesen Gründen hast du deine Zukunft geopfert – das Glück, das du mit Raithe hättest haben können. Du hast es zum Wohle der Welt getan, für alle zukünftigen Generationen. Und das wirst du weiter tun, bis zum Ende deines Lebens.«
Persephone atmete tief durch und schüttelte den Kopf. »Wenn es meine alleinige Bürde gewesen wäre, wäre es kein Problem, aber so ist es nicht. Raithe ist meinetwegen gestorben. Ich habe sein Leben gestohlen!«
»Nein, hast du nicht.« Gerade als Persephone ein besonders reges Interesse an dem Gras zu ihren Füßen entwickelte, blickte Malcolm in den Himmel, als kündigte sich schlechtes Wetter an. »Raithe ist nicht gestorben, weil du ihn abgewiesen hast. Suri ist nicht nach Avempartha gegangen, weil du sie darum gebeten hast. Und Brin, Moya, Roan und Gifford sind nicht gegangen, weil du sie gelassen hast. Denk doch mal einen Moment darüber nach. Stell deine Reue und dein Selbstmitleid wenigstens für eine Weile hintenan und überlege, ob all diese Dinge nicht vielleicht so gekommen sind, weil sie so kommen sollten. Alle haben ihre Rolle zu spielen. Ihre eigene Rolle. Nicht deinetwegen, sondern ihretwegen. Zum Wohle aller anderen bringen sie Opfer, genau wie du es getan hast.«
»Also willst du damit sagen, dass sich die Welt nicht bloß um mich dreht?«
Malcolm lächelte. »So ungefähr. Viele Dinge sind zwar dank dir geschehen, aber die Niederlagen und Fehltritte sind nicht deine Schuld. Nichts davon. Nicht der Krieg, nicht Raithes Tod und auch nicht Suris Gefangennahme.«
»Wessen Schuld ist es denn dann?«
Malcolm zögerte und sah sich dann um, als hätte er etwas gehört. »Wo ist Nolyn?«, fragte er, als wäre ihm gerade erst aufgefallen, dass sie allein auf dem Hügel waren.
»Was?« Persephone war verblüfft über den abrupten Themenwechsel.
»Ich weiß, es ist noch früh, aber wachen kleine Jungen nicht immer zur Morgendämmerung auf?«
»Justine kümmert sich um ihn.«
Malcolm nickte. »Natürlich«, sagte er in einem vielsagenden Tonfall.
»Was denn?«
Malcolm runzelte die Stirn, drückte damit eindeutig sein Missfallen aus. »Ich habe mich nur gefragt … Verbringt Nyphron überhaupt jemals Zeit mit seinem Sohn?«
»Du weichst meiner Frage aus.«
»Hmm?«
Persephone verschränkte die Arme vor der Brust. »Wessen Schuld ist es, Malcolm?«
Der Mann mit dem Speer blickte finster drein. Dann ließ er jedoch die Schultern hängen und seufzte. »Schuld. Ein interessantes Wort, findest du nicht? Als du Keenigin wurdest, hast du auch nicht gefragt, wessen Schuld das war, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Anführer der Gula es sich fragte. Die Schuld wird nur gesucht, wenn etwas Schlechtes passiert. Dem Erfolg wird diese Bürde nicht auferlegt. Vielleicht sollte man lieber abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, bevor man nach dem oder der Schuldigen sucht.«
Tura hätte einfach gesagt: Ich weiß es nicht. Suri hätte wahrscheinlich etwas von Schmetterlingen oder Wolken oder etwas ähnlich Sinnfreiem erzählt. Malcolm kannte die Antwort, dessen war Persephone sich sicher, doch er wollte sie ihr nicht verraten.
Warum?, fragte sie sich.
Sie starrte ihn an, während sich eine neue Idee in ihrem Kopf formte. Seher waren Personen, die hin und wieder mystische Zeichen deuten konnten, die ihnen einen Einblick in die Zukunft gaben. Ihres Wissens war keiner von ihnen in der Lage, die Zukunft selbst zu gestalten.
Ist so etwas überhaupt möglich?
Als Tressa erwähnte, dass es Malcolm gewesen war, der ihr von einem Übergang erzählt hatte, durch den sie Suri möglicherweise retten konnten, hatte Persephone sich nichts dabei gedacht. Jetzt allerdings …
Malcolm war dabei gewesen, als Raithe Shegon tötete – jenes Ereignis, das dazu geführt hatte, dass die Rhunes die Göttlichkeit der Fhrey infrage zu stellen begannen. Als Persephone Raithe kennengelernt hatte, hatte Malcolm ihr geholfen, Raithe zur Rückkehr nach Dahl Rhen zu überreden – gerade rechtzeitig, um dort Nyphron und den Galantianern zu begegnen.
Und als Arion gekommen war, um Nyphron in Gewahrsam zu nehmen, hatte Malcolm sie mit einem Stein niedergeschlagen, was dazu geführt hatte, dass der Anführer der Galantianer und die Miralyith in Dahl Rhen geblieben waren.
Können das wirklich alles Zufälle sein?
»Malcolm? Woher hast du gewusst, dass Suri gefangen genommen werden würde – Jahre bevor es tatsächlich passiert ist?«, fragte sie.
»Das ist nicht das, was du wirklich wissen willst, oder?«
Er hatte recht. »Gibt es noch Hoffnung auf das Überleben der Menschheit?«
Er nickte. »Ich sage das nicht mit absoluter Sicherheit. Und während ich fort war, habe ich Dinge aufgedeckt, die alles verkomplizieren. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass einige Ereignisse in Gang gesetzt wurden und dass ich immer noch an einen guten Ausgang glaube. Und ich möchte, dass du das auch tust.«
»Du sprichst von der Gruppe, die in den Sumpf ausgebrochen ist, oder? Geht es ihnen gut? Was ist mit ihnen geschehen?«
»Vielleicht möchtest du dich lieber zuerst hinsetzen.«
»Oh, bei Mari!« Persephone schwankte. Sie ließ sich wieder auf die Knie sinken, als würde sie auf die Axt des Henkers warten.
Malcolm kniete sich ebenfalls hin und nahm ihre Hände in seine. »Moya, Tekchin, Brin, Roan, Gifford, Tressa und Regen sind …«
»Was?«
Er verlagerte unbehaglich sein Gewicht.
»Sag es mir!«, schrie sie.
»Sie sind … tot.«
Persephone fühle sich, als würde ihr Herz stehen bleiben und zugleich auch die Zeit.
»Das ist unmöglich. Es kann nicht sein. Kann es einfach nicht. Sie sind doch nur gegangen, um den Sumpf auszukundschaften … sonst nichts. Ich habe sie nicht in einen Kampf geschickt.«
»Du hast recht. Es gab keinen Kampf. Sie sind ertrunken.«
Persephone schüttelte heftig den Kopf. »Alle auf einmal? Nein … nein …«
Oh, liebe Mari, nicht auch noch sie. Wie viele müssen noch sterben?
»Aber …« Malcolm hielt inne und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Es ist in Ordnung.«
Persephone war nicht sicher, ob sie ihn richtig verstanden hatte, doch sein Gesicht, sein schwaches Lächeln, bestätigten seine Worte. »Wie in Elans Namen, kann das in Ordnung sein?«
»Weil«, Malcolm straffte die Schultern, »die Chancen gut stehen, dass sie zurückkommen werden.«
Sie starrte ihn an. Diesmal fiel es ihr nicht schwer, ihm in die Augen zu blicken. »Hast du den Verstand verloren?«
Er schüttelte den Kopf und hob beschwichtigend beide Hände. »Es, äh … wird natürlich nicht leicht. Tatsächlich wird es sogar noch viel schwerer sein, als ich erwartet hatte.«
»Du wusstest, dass es passieren würde?« Langsam wurde Persephone klar, was das bedeutete, und ihr Atem ging keuchend. »Du hast es geplant.« Sie schüttelte wieder den Kopf. »Das alles ist nicht meine Schuld … sondern deine!«
»Ja.« Er nickte. »Alles. Aber ist es ist noch nicht vorbei. Erlaube mir, dir zu erklären, wohin sie gegangen sind. Ich habe sie nämlich geschickt, Persephone, und zwar nach …«
»In ihren Tod! Du hast sie alle in den Tod geschickt!«
»Das ist richtig.« Er hob einen Finger. »Aber ich schicke ihnen auch Hilfe.«
3
Meister der Geheimnisse
Bildung ist nie umsonst. Alle wahren Lektionen hinterlassen eine Narbe.
– Das Buch Brin
Alle toten Fhane hatten ihre eigenen Krypten, die mit Darstellungen ihrer unzähligen großen Taten geschmückt waren. Diese heiligen Hallen waren nicht nur ewige Ruhestätten, sondern zollten den Verstorbenen auch Tribut. So war jede Krypta ein wahres Meisterwerk der Architektur und die Eilywin hatten beim Bau keine Kosten und Mühen gescheut. Alle fünf Grabkammern standen an einem geweihten Ort, nicht weit vom Florella-Platz entfernt im Herzen Estramnadons, wo jeder Fhrey sie besuchen und bestaunen und sich von den vergangenen Herrschern inspirieren lassen konnte.
Nur wenige kamen je vorbei.
Die fehlende Verehrung stimmte Imaly traurig und lieferte ihr weitere Beweise dafür, dass sich das Fundament der Fhrey-Gesellschaft im Zerfall befand, sodass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis alles in sich zusammenfallen würde. Doch die selten besuchten Krypten besaßen auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie boten einen perfekten Ort für geheime Treffen.
»Warum sind wir hier?«, fragte Nanagal, als Imaly die Tür des Mausoleums schloss, in dem Gylindora Fhans letzte Ruhestätte lag.
»Nanagal, du bist doch von der Sippe der Eilywin«, sagte Imaly heiter. »Würdest du bitte ein zusätzliches Feuer in dem Kohlebecken dort bauen? Es ist ziemlich finster hier drin, findest du nicht?«
»Man baut kein Feuer, man macht Feuer. Ich muss es nur entzünden.«
»Oh, ja, wie klug von dir. Kannst du dich darum kümmern, mein Lieber? Du bist so groß, du kommst am besten an das Becken heran.« Sie lächelte ihn an.
»Du hast Nanagals Frage nicht beantwortet, Imaly«, warf Hermon ein. Für einen Fhrey war er ungewöhnlich stämmig und stark behaart. Er musste sich dringend mal wieder rasieren. »Was sollen wir hier? Mit den Toten sprechen? Mit deiner Urgroßmutter?« Er warf Volhorik einen Blick zu. »Erlaubt Ferrol so etwas überhaupt?«
»Ganz und gar nicht.« Der Hohepriester verschränkte die Arme vor der Brust.
»Für so einen Unsinn sind wir auch nicht hier«, antwortete Imaly verärgert. »In Ferrols Namen, wir befinden uns in der Grabstätte meiner Vorfahrin. Erweist ihr etwas mehr Respekt.«
»Also, warum dann?«, bohrte Hermon nach.
»Wir halten eine Sitzung ab.«
Das Feuer in dem Kohlebecken loderte auf und erhellte die Krypta. Der flackernde Schein brachte die goldenen und silbernen Verzierungen zum Glühen. Auch der hintere Teil des Gewölbes wurde nun sichtbar, und mit ihm Gylindoras Sarkophag. Die in den Stein gehauene Darstellung darauf sah ihr überhaupt nicht ähnlich. Das Abbild war viel zu steif und ohne wahre Kunstfertigkeit gestaltet. Es fing nichts vom wahren Wesen der ersten Fhan ein.
»Eine Ratssitzung?«, frage Nanagal, als er sich von dem Becken abwandte, das an einer eisernen Kette über ihren Köpfen hin und her schwang. »Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber wir haben einen offiziellen Treffpunkt für solche Dinge, gleich die Straße runter. Es nennt sich Airenthenon. Ist wirklich hübsch dort, hohe Säulen, bequeme Bänke. Es wurde allein für Treffen wie diese gebaut.«
»Es ist keine offizielle Sitzung«, erwiderte Imaly.
Fast alle Vertreter der Fhrey-Sippen waren anwesend: Nanagal von den Eilywin, Osla von den Asendwayr, Hermon von den Gwydry und Volhorik von den Umalyn. Obwohl Vidar von den Miralyith fehlte, hatten sie genug Ratsmitglieder für eine Abstimmung beisammen. Der Beschluss wäre verbindlich, selbst wenn sie sich dafür nicht im Airenthenon trafen.
»Ich habe euch hierhergebeten, da unser erhabener Rat das Einzige sein könnte, das unsere Gesellschaft vor der totalen Vernichtung bewahren kann. Ich brauche eure Meinungen zu Fhan Lothian und seiner Fähigkeit zu herrschen – eure ehrlichen Meinungen.«
»Und du hältst es wirklich für notwendig, das hier unten zu tun?«, fragte Osla. Sie war dem Aquila erst vor Kurzem beigetreten und sprach nicht oft, weshalb Imaly es interessant fand, dass sie ihr jetzt als Erste antwortete. Die anderen, erfahreneren Ratsmitglieder hingegen warteten noch ab.
»Ja«, sagte Imaly. »Was wir im Airenthenon besprechen, ist öffentlich. Was wir hier besprechen, bleibt hier.« Die letzten zwei Worte betonte sie so nachdrücklich, dass sie durchaus als Drohung verstanden werden konnten.
»Was genau willst du von uns wissen?«, fragte Nanagal in unverbindlichem Tonfall. Er war nicht dumm, doch er machte sich nichts aus Spekulationen und Andeutungen. Er zog es vor, alle Fakten auf dem Tisch zu haben, klar verständlich und unwiderruflich.
»Wie viele von euch heißen die Handlungen des Fhans gut, seit er den Waldthron bestiegen hat?«
Niemand antwortete.
»Da stimme ich euch zu«, sagte Imaly. »Seit seiner Machtergreifung haben wir unter der Miralyith-Rebellion gelitten, durch die beinahe das Airenthenon zerstört wurde. Wir haben eine offene Revolte der Instarya-Sippe erlebt und einen Krieg angezettelt, der gut und gerne unsere gesamte Zivilisation auslöschen könnte. Und das alles, obwohl er erst seit ein paar Jahren an der Macht ist. Das ist kaum ein Herzschlag in der Herrschaftsspanne eines Fhans. Nichts davon war notwendig oder unumgänglich, und all diese Dinge sind auf seine Handlungen oder seine Unterlassung derselben zurückzuführen.«
Imaly strich ihre Asika glatt, um den anderen Zeit zu geben, den Duft des Festmahls in sich aufzunehmen, das sie ihnen soeben serviert hatte. »Und warum war seine Herschafft bisher ein derartiges Desaster? Weil Lothian nie unseren Rat einholt. Seit er den Thron bestieg, hat er das Airenthenon kaum mit seiner Anwesenheit beehrt. Wenn er kam, dann nur, um Verordnungen zu erlassen, ein Ultimatum zu stellen oder etwas zu verkünden, das er allein beschlossen hat. So sollte es nicht sein. Der Aquila wurde geschaffen, um dem Fhan zu assistieren, um seine Entscheidungen mit unserer vereinten Weisheit in die richtige Richtung zu lenken. Aber Lothian will keine Hilfe, keine anderen Ansichten als seine eigenen. Das Ergebnis spiegelt sein schlechtes Urteilsvermögen wider.«
»Worauf willst du hinaus, Imaly?« Wieder war es Osla, die die Frage stellte – weil sie die Einzige war, die es wirklich noch nicht verstanden hatte.
»Auf gar nichts – noch nicht. Im Moment stelle ich euch einfach nur eine Frage. Aber vielleicht sollte ich sie umformulieren: Wenn es möglich wäre, einen anderen Fhan auf den Thron zu setzen, würdet ihr das wollen?«
»Lothian wurde von Ferrol erwählt«, erwiderte Osla, als würde ihre offensichtliche Feststellung etwas an Imalys hypothetischer Frage ändern.
Imaly musterte die anderen, suchte in ihren Blicken nach Anzeichen für ein ähnlich gedankenloses Klammern an die Traditionen. Doch sie fand keine. Da Volhorik den Plan mit ihr gemeinsam entwickelt hatte, brauchte sie sich um ihn ohnehin keine Sorgen zu machen. Alles hing davon ab, wie sich Nanagal und Hermon entscheiden würden. Keiner von beiden sagte ein Wort, doch sie beäugten Imaly misstrauisch.
»Ferrol hat Lothian nicht allein zum Fhan gemacht«, fuhr sie fort. »Und vielleicht sind wir es, die vor unserem Herrn versagten, weil wir keinen besseren Herausforderer als Zephyron gewählt haben. Aber heute geht es nicht um die Vergangenheit. Es geht um die Zukunft. Also, will niemand von euch meine einfache, harmlose Frage beantworten?« Imaly verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich mit dem Rücken an die reich verzierte Wand.
»Du sprichst von Verrat«, sagte Osla.
»Nein, meine Liebe, ich stelle einfach nur eine Frage. Wir unterhalten uns. Niemand schlägt vor, dass wir uns bewaffnen und den Palast stürmen sollen – das wäre Verrat. Ich bitte lediglich um eure Ansichten und ersuche die vereinte Weisheit des Aquila. Genau dafür existiert unser Rat doch, oder etwa nicht?«
»Aber wir haben uns hier getroffen und nicht im Airenthenon, also tu nicht so, als wäre dies ein harmloser Meinungsaustausch«, beharrte Osla in anklagendem Ton.
Imaly neigte den Kopf, um ihr diesen Punkt zuzugestehen. »Das mag sein. Trotzdem: Ich habe immer noch keine Antwort erhalten.«
Nanagal trat vor. »Ich schätze, es käme darauf an, wer Lothian ersetzen sollte.« Im Gegensatz zu Imalys entspannter Haltung, die sie absichtlich zur Schau trug, um Selbstbewusstsein auszustrahlen, wirkte er steif und angespannt.
»Ein gutes Argument, aber lass mich dir eine Gegenfrage stellen: Was müsste Lothian tun, damit du jeden anderen Fhrey lieber auf dem Thron sehen würdest als ihn?«
Dafür erntete Imaly ein paar Lächeln und sogar unterdrückte Lacher von den anderen.
Nanagal jedoch zuckte anhand der Absurdität ihrer Frage nur mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Vermutlich, wenn er den Verstand verliert und nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu denken.«
»Also gibst du zu, dass das Absetzen eines Fhans unter gewissen Umständen nötig sein könnte? Was, wenn er die bloße Existenz unseres gesamten Volkes bedrohen würde? Wärst du dann gewillt, Schritte einzuleiten, um ihn seines Amtes zu entheben?«
Nun lächelte niemand mehr.
Nanagal warf Volhorik einen Blick zu. »Wäre geistige Unzurechnungsfähigkeit ein Grund, das Bündnis mit Ferrol zu brechen? Würde unser Herr unter diesen Umständen nicht sogar verlangen, dass wir den amtierenden Fhan absetzen?«
Volhorik schüttelte den Kopf. »Streng genommen besagt Ferrols Gesetz, dass der Fhan tun und lassen kann, was immer er will, ob er geistig gesund ist oder nicht. Allein unsere Tradition besagt, dass er zum Wohl der Fhrey handeln muss. Theoretisch wäre es sogar rechtens, dass er jeden einzelnen Fhrey hinrichten lässt, wenn er Lust dazu hätte.« Er hob einen Finger. »Andererseits sind wir auch allein aufgrund unserer Tradition dazu verpflichtet, ihm zu gehorchen. In Ferrols Gesetz steht nichts davon, dass wir seinen Befehlen folgen müssen.«
Imaly setzte nach. »Also lassen wir Lothian trotz seiner Unfähigkeit zu regieren weitermachen, oder obliegt es unserer Verantwortung, einen gerechten und fähigen Herrscher an die Spitze der Fhrey zu setzen? Lothian könnte tatsächlich unser gesamtes Volk auslöschen, wenn wir ihn nicht in die Schranken weisen. Glaubt ihr, dass dies Ferrols Wille ist? Sollten wir nicht eingreifen?«
Die anderen tauschten unsichere Blicke aus.
Wonach suchen sie? Hilfe? Unterstützung? Führung?
In der Vergangenheit hatte Imaly es stets zu schätzen gewusst, wie fügsam die Mitglieder des Aquila waren, doch in diesem Moment wünschte sie sich, sie hätten ein wenig mehr Rückgrat gehabt.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte Nanagal schließlich. Er sah sich zu den anderen um. »Ferrols Wille ist in diesem Fall nicht eindeutig, oder?«
»Also würdest du über so ein Verhalten einfach hinwegsehen? Du willst zulassen, dass ein verrückter Fhan uns alle umbringt?«, fragte Imaly. »Wäre das nicht dasselbe, als würdest du dich selbst so verhalten? Hast du als Mitglied des Aquila nicht eine Verantwortung gegenüber der Sippe, die du vertrittst?«
»Na ja, ich …«
»Ich denke, unter solchen Umständen wäre es unsere Pflicht gegenüber unserem Herrn Ferrol, einzuschreiten und den Fhan abzusetzen«, sprang Volhorik ein.
»Ja.« Nanagal nickte widerwillig. »Ja, ich denke schon.«
Imaly wandte sich Hermon zu.
»Da muss ich Nanagal zustimmen«, sagte er.
Natürlich, dachte Imaly. Das tust du immer.
Osla schien tief in Gedanken versunken zu sein. Sie starrte auf ihre Füße und hatte die Hände vor dem Körper zu Fäusten geballt. »Ich stimme euch zu, aber … ich möchte noch einmal zu bedenken geben, dass wir rein hypothetisch sprechen. Die Gefahr, die von Lothian ausgeht, hat noch nicht die von Imaly beschriebenen Ausmaße angenommen. Er mag inkompetent sein, aber im Moment befindet sich der Krieg mit den Rhunes im Stillstand. Ich sehe keine Hinweise darauf, dass wir demnächst von ihnen überrannt werden. Es besteht aktuell keine ernst zu nehmende Bedrohung für unser Volk. Außerdem verstehe ich nicht ganz … Wie sollten wir überhaupt …« Sie stockte. »Gibt es eine Gesetzesregelung, die vorsieht, dass der Aquila den Fhan absetzt?«
»Nein«, antwortete Volhorik.
»Aber wie könnten wir dann …«
»Wir müssten ihn töten«, sagte Imaly, ohne zu zögern.
Oslas Kinnlade fiel herab. »Damit würden wir Ferrols Gesetz brechen.«
»Genau«, sagte Imaly. »Ein geringer Preis für die Rettung von ganz Erivan. Wir sind die Anführer unserer Sippen. Sie haben uns die Verantwortung anvertraut, unsere Zivilisation zu beschützen, und manchmal bedeutet diese Bürde eben, dass man mehr tut, als nur in einem pompösen Gebäude zu sitzen und den sichersten Weg zu wählen.«
Ihre Worte hallten noch einen Moment in der Luft nach, dann senkte sich Stille über die Gruppe, die Imaly entsetzt anstarrte.
Gylindora hatte Imaly einmal erzählt, dass einer der geheimen Kniffe beim Korbflechten war, vorherzusehen, wie weit man das Schilfrohr biegen konnte, bevor es brach. Besonders steife Rohre ließ man über Nacht einweichen oder sogar länger, falls nötig. So wurde das Material biegsamer.
Für heute ist es genug, dachte sie.
»Schön, das war doch eine gute Diskussion, nicht wahr? Ich stimme Osla zu. Die Situation ist noch nicht so schlimm, und wie ich bereits sagte, ist das bisher alles nur Spekulation. Wir müssen uns aktuell noch nicht damit befassen. Es ist ein Gedanke, mit dessen Umsetzung wir uns, so Ferrol es will, hoffentlich niemals eingehender auseinandersetzen müssen.« Imaly öffnete die Tür und ließ Tageslicht in die Grabstätte. »Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid.«
Mithilfe zweier Seile hoben Vaseks Helfer den Sarg langsam aus dem Loch im Boden. Volhorik hatte Vasek keinen Zugang zum Friedhof von Estramnadon gewährt, doch der Wald vor der Stadt taugte genauso gut für sein Vorhaben.
Die hölzerne Kiste, in die Vasek die Seherin gesperrt hatte, war ein waschechter, unten spitz zulaufender Sarg. Obwohl Lothian angeordnet hatte, dass Vasek die Rhune in das Loch werfe – ein paar kleine Zellen unter den Kasernen des Löwenkorps –, war dem Meister der Geheimnisse stattdessen eine andere, noch drastischere Idee eingefallen, wie er die Seherin lebendig begraben konnte. Ihre Abneigung für enge Räume erschien ihm die beste Methode, um sie zu brechen und dabei keine körperlichen Schäden zu verursachen.
Er hatte einen Sarg ausgewählt, der ihr besonders wenig Bewegungsfreiheit ließ. Je kleiner der Raum, desto besser die Ergebnisse. Er war sich sicher, dass das Geräusch und der Geruch der auf den Sargdeckel prasselnden Erde, der langsame Verlust des Tageslichts und die darauffolgende allumfassende Stille die Seherin zum Reden bringen würden.
Doch dabei musste der perfekte Moment abgepasst werden. Wenn er sie nicht lange genug eingesperrt hielt, würde die Rhune sich ihm weiterhin widersetzen, wenn sie hingegen zu viel Zeit unter der Erde verbrachte, wäre sie vielleicht nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Es war ein gefährliches Unterfangen, sowohl für die Rhune als auch für ihn. Wenn er die wichtigste Gefangene des Fhans brach oder gar tötete, würde Lothian als Nächstes ihn in diesen Sarg stopfen.
Der Meister der Geheimnisse fand keinen Gefallen an seiner Arbeit. Rhunes waren ihm schlicht egal. Die Erzählungen, die Rhunes seien nichts als wilde, bösartige und grausame Tiere, waren lediglich Propaganda. Vasek wusste dies, da er die meisten davon selbst verbreitet hatte. Seine Aufgabe war es, die Rhunes als möglichst unzivilisiert und den Fhrey unterlegen darzustellen.
Durch die richtige Mischung würden die Geschichten zwar Furcht unter den Fhrey auslösen, aber keine Verzweiflung. Sein Ziel war es, sie zu motivieren, nicht verzweifeln zu lassen. Denn Lothian brauchte die Unterstützung des Volkes, nicht dessen Wut. Der Fhan war der absolute Herrscher, Ferrols Verkörperung in Elan, doch Angst war so mächtig, dass sie selbst das heiligste aller Symbole zu Fall bringen konnte.
Dies war nur ein weiteres Problem, das Vasek für den Fhan aus dem Weg räumte. Er musste der Rhune ein Geheimnis entlocken. Wenn der Fhan ihm befohlen hätte, das Gelbe vom Ei zu trennen, wäre er mit derselben Logik vorgegangen. Und doch hoffte Vasek tief in seinem verdorbenen Inneren, dass die Rhune es überleben würde, in etwa aus demselben Grund, wie man es bedauerte, einen Marienkäfer zerquetscht zu haben, nachdem man feststellte, dass es sich nicht um eine Stechmücke gehandelt hatte.
Kein Laut drang aus dem Inneren des Sargs und Vaseks Herz sank.
Es waren doch nur zwei Stunden!
Stemmeisen wurden am Deckel angebracht, und Vasek bereitete sich innerlich auf den Anblick der toten Rhune vor – was den Tod seiner eigenen Zukunft bedeutet hätte. Der Sarg öffnete sich, und da lag sie. Sie hatte die Augen geschlossen, die Hände zu beiden Seiten ihres Körpers, und ihre Brust hob und senkte sich gleichmäßig.
Sie lebt!
Doch der Gedanke würde schnell von einem ebenso überraschenden ersetzt: Sie schläft.