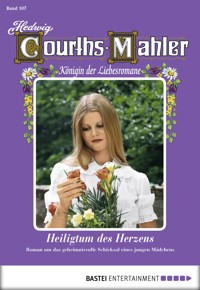Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Graf Joachim gesteht kurz vor seinem Tod ein dunkles Geheimnis. Um für das daraus entstandene Unrecht Wiedergutmachung zu leisten, wird die bürgerliche Waise Jonny Warrens auf Schloss Wildenfels aufgenommen. Als jedoch Lothar, der Sohn des verstorbenen Grafen, und Jonny mit der Zeit ihre Gefåhle füreinander entdecken, müssen sie sehr um ihre Liebe kämpfen ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Das Halsband
Trotz allem lieb’ ich dich Die schöne Unbekannte
Saga
Das Halsband
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1913, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950472
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1
Gräfin Susanne wollte nach Ostende reisen. Es war ihr zu langweilig auf Schloß Wildenfels. Sie brauchte Bewunderer ihrer Schönheit, Geselligkeit, Schmeicheleien und Publikum für ihre neuesten Pariser Toiletten. Das alles hoffte sie in Ostende zu finden. Vor der Welt reiste sie natürlich nur dahin, um mit einigen befreundeten Familien zusammenzutreffen.
Der Graf hatte keine Lust, sie zu begleiten. Er blieb lieber daheim bei seiner Mutter und seinem Sohne.
Susanne war das sehr angenehm. Sie amüsierte sich immer besser, wenn ihr Gatte nicht dabei war, obwohl er ihr in allen Dingen freie Hand ließ. Wußte er doch, daß ihr kaltes, hochmütiges Wesen sie davor behütete, jemals die Grenzen zu überschreiten, die einer vornehmen Frau gesteckt sind. Mochte ihre Eitelkeit Triumphe feiern – das war ihr Lebensinhalt.
Der Wagen mit einem Diener, einer Zofe und Gepäck war bereits zur Stadt gefahren, die etwa eine Stunde von Wildenfels entfernt lag. Es war eine kleine Kreisstadt.
Für Gräfin Susanne stand ein besonders luxuriös ausgestatteter Wagen immer bereit. Ihr Gatte wollte sie bis zum Bahnhof begleiten.
Sie verabschiedete sich eben in der großen, hochgewölbten Halle des Schlosses von ihrer Schwiegermutter, Gräfin Thea Wildenfels. Diese, eine aristokratisch aussehende Dame mit graumeliertem Haar, feinen durchgeistigten Zügen, hatte klare, gütige Augen.
Der Abschied zwischen den beiden Damen war betont herzlich. Beide gaben sich Mühe, einen warmen Ausdruck in ihre Stimme zu legen, aber gerade der gezwungene Ton verriet, daß sich ihre Herzen nicht sehr nahestanden. Während Gräfin Susanne die alte Dame auf die Wange küßte, kam ein schlanker, etwa vierzehnjähriger Knabe den langen Gang vom westlichen Flügel hergestürmt. »Mama – du hättest wohl vergessen, mir Adieu zu sagen!« rief er vorwurfsvoll.
Susanne wandte ihr schönes, stolzes Gesicht lächelnd ihrem einzigen Sohne zu.
»Du bist kein Baby mehr, Lothar, sondern ein kleiner Kavalier. Als solcher wirst du deiner Mutter das Geleit zum Wagen geben!«
Lothar sah mit seinen klaren, blauen Augen, die zu dem dunklen Haar und dunklen Wimpern einen eigenartigen Kontrast bildeten, erst zu seiner Mutter, dann zu seiner Großmutter empor. Sein von Luft und Sonne gebräuntes Gesicht rötete sich.
»Ich wußte nicht, daß es schon Zeit zur Abreise ist. Mein Lehrer hat mich mitten aus der Geschichtsstunde entlassen müssen, als ich den Wagen vorfahren hörte. Wie leicht hätte ich zu spät kommen können. Großmama kommt immer zu mir, um mir Lebewohl zu sagen, wenn sie verreist.«
Seine Mutter lachte. Es war kein gutes, warmklingendes Lachen, welches wohltat. Ein gereizter, spöttischer Klang lag darin.
»Ja, ja«, sagte sie halb scherzend, halb tadelnd, »Großmama verzieht dich sträflich.«
In dem feinen, gütigen Gesicht Gräfin Theas zeigte sich eine leise Röte. »Den Vorwurf solltest du mir nicht machen, Susanne. Ich verziehe Lothar gewiß nicht.«
Susanne legte die Hand auf den Arm ihrer Schwiegermutter und lenkte sofort ein.
»Ich bitte dich, ein Scherz, Mama. Du nimmst es sehr ernst mit Lothars Erziehung. Aber in bezug auf Zärtlichkeiten verwöhnst du ihn.«
»Liebe geben ist nicht verwöhnen, Susanne. Ein Kind braucht Liebe, um zu gedeihen.«
Susanne zuckte die Achseln und sah nach der im Hintergrund der Halle emporführenden Treppe, ob ihr Mann noch nicht erscheine. Sie nannte im stillen ihre Schwiegermutter sentimental, obwohl diese in ihrer klaren, ruhigen Art diese Bezeichnung nicht verdiente. Der wahre Inhalt ihres Wesens war Güte und Vornehmheit.
Gräfin Thea liebte freilich ihren Sohn und ihren Enkel anders, als Susanne ihr Kind liebte. Diese hatte nie viel Zärtlichkeit übrig, weder für ihr Kind noch für ihren Mann. Sie war mit ihrer eigenen Persönlichkeit vollauf beschäftigt, liebte zu sehr sich selbst, als daß sie noch einem anderen Wesen besonderes Interesse zu widmen imstande gewesen wäre.
Da soeben Graf Joachim Wildenfels die Treppe herabkam, beugte sich Susanne zu ihrem Sohn hernieder und küßte ihn.
»Adieu denn, kleiner Mann. Sei brav, solange Mama nicht zu Haus ist. Belästige Großmama nicht zuviel.«
Lothar sah mit einem fast traurigen Blick in das unbewegte Antlitz seiner Mutter.
»Adieu, Mama. Gute Reise – und komme gesund wieder heim. Und wegen Großmama brauchst du dir keine Sorge zu machen. Wenn ich hundertmal am Tag zu ihr käme, es wäre ihr nicht lästig, gelt, Großmama?«
Er trat zu der alten Dame und legte mit ungestümer Zärtlichkeit seinen Arm um ihre Taille. Sie strich ihm leicht über das wellige, ziemlich kurz gehaltene Haar und nickte ihm zu.
Ein mokantes Lächeln huschte um Susannes Lippen. Ihrem Wesen lagen alle Gefühlsergüsse fern. Graf Joachim trat zu ihnen.
Eine vornehme Erscheinung von etwa vierzig Jahren. Aus seinem schön geschnittenen Gesicht leuchteten dieselben tiefblauen Augen wie aus dem seines Sohnes. Auch er hatte das dunkle, leicht gewellte Haar, die langen dunklen Wimpern. Aber seine Züge waren etwas weich – weicher noch als in dem Gesicht seines jungen Sohnes. Um des Knaben Mund und Kinn bildete sich schon jetzt ein charakteristischer energischer Zug, der seinem Vater völlig fehlte. So ähnlich sich Vater und Sohn auf den ersten Blick waren, so verschieden wirkten sie bei näherer Betrachtung.
Graf Joachim war eine etwas haltlose Natur. Sein verstorbener Vater, ein Mann wie aus Stahl und Eisen, hatte das frühzeitig erkannt und weil ihm jede Schwäche ein unverstandener Begriff war, suchte er diesen Charakterfehler seines Sohnes durch übertriebene Strenge auszumerzen. Aber er schoß über das Ziel hinaus. Statt seines Sohnes Leichtsinn und Haltlosigkeit zu bessern, trieb er ihn durch Unduldsamkeit dazu, allerlei Torheiten heimlich zu begehen. Je strenger ihn der Vater hielt, desto ärger trieb er es im stillen. Als Joachim vierundzwanzig Jahre alt war, hatte ihn sein Vater, ohne nach seinen Wünschen zu fragen, mit Komtesse Susanne Hagenau verheiratet. Joachim war damals in einer seiner Umgebung rätselhaften seelischen Depression gewesen und hatte sich fast willenlos in alles gefügt. Komtesse Hagenau schien Joachims Vater die passendste Lebensgefährtin für seinen Sohn. Obwohl sie erst achtzehn Jahre zählte, war sie eine vollendete Dame, deren kühle Selbstbeherrschung ihm genug Garantien bot, daß sie seinen Sohn nach seinen Wünschen beeinflussen würde.
Es schien auch, als habe er das Rechte getroffen. Joachim schien nach seiner Verheiratung ein ganz anderer geworden zu sein. Gräfin Thea hatte sich gegen diese Verbindung gesträubt. Sie kannte ihren Sohn besser, wußte, daß er mit Liebe eher zu leiten war als mit Strenge und Kälte. Von mancher Torheit hatte sie ihn abgehalten durch liebevolles Zureden. Sie wußte, daß Susanne eine kaltherzige Frau war und Joachim ein liebebedürftiges Herz hatte.
Aber ihr Widerspruch hatte nichts geholfen. So war diese Ehe zustande gekommen. Graf Joachim war ein artiger, ritterlicher Gatte, der seiner Frau um so ruhiger allen Willen ließ, als sie seine Person nicht in Anspruch nahm. Joachims Vater war zufrieden gewesen mit dem Erfolg seines Experimentes. Es war unleugbar eine große Veränderung in Joachims Wesen zu bemerken.
Aber seine Mutter hatte diese Veränderung nicht mit Befriedigung erfüllt. Im Gegenteil, sie machte ihr heimlich große Sorge. Sie allein hatte mit den scharfen, sorgenden Mutteraugen bemerkt, daß Joachim schon in der Zeit kurz vor seiner Verlobung ein anderer geworden war. Ungleichmäßig und gedrückt, nicht mehr in froher Laune überwallend, fast scheu und unruhig war er ihr erschienen. Sie hatte ihn einige Male in liebevoller Weise gefragt, ob ihm etwas fehle, ihn etwas bedrücke. Danach hatte er sich stets eine Zeitlang zusammengenommen, ohne je auf ihre Frage eine rechte Antwort zu geben.
Joachim war ihr einziges Kind – er war so recht ein Sorgenkind von Anfang an gewesen. Aber um so zärtlicher umfaßte ihn ihr Herz. Sie litt fast mehr unter der kalten, liebeleeren Ehe, die er führte, als er selbst. Sorgend suchten ihre Augen wieder und wieder in seinen Zügen.
Joachims Vater hatte noch erlebt, daß ihm ein Enkel geboren wurde. Es gelüstete ihn danach, auch an dem Enkel seine Erziehungstheorien zu erproben. Aber ehe er dazu kam, Einfluß auf den Knaben auszuüben, war er gestorben. Seit seinem Tode hatte sich Joachim inniger denn je an seine Mutter angeschlossen, während sein Verhältnis zu seiner Frau immer kühler wurde. Mit seiner Mutter und mit seinem Sohne lebte er in herzlicher Gemeinschaft. Seine Frau war ihm eine Fremde.
Graf Joachim half seiner Gattin in den Wagen. Lothar stand neben ihm und küßte seiner Mutter die Hand. Seinen Vater umarmte er herzlich, obwohl dieser nur bis zum Bahnhof mitfuhr.
Darauf fuhr der Wagen davon. Lothar sah ihm eine Weile nach. Dann sprang er mit zwei Sätzen die Freitreppe empor. Oben, unter dem Portal, stand Gräfin Thea. Lothar umfaßte sie stürmisch. So war auch Joachim als Kind oft zu ihr gekommen, Liebe erhoffend, Liebe gebend. So impulsiv hatte er auch den Regungen seines Herzens Ausdruck gegeben. Sie drückte Lothar fest an sich und sah ihn ernst an.
»Tut es dir nicht weh, daß Mama auf lange Wochen fortgeht?«
»Weißt du, Großmama, ich habe von Mama auch nicht viel, wenn sie zu Hause ist. Manchmal sehe ich sie kaum bei den Mahlzeiten. Freilich – wenn Papa mit abreiste – dann wäre ich mehr betrübt. So habe ich ja dich und Papa.«
Diese Worte kennzeichneten, welche Stellung Gräfin Susanne im Herzen ihres Sohnes einnahm. Er empfand nach Kinderart sehr genau, daß die Mutter nicht viel Liebe für ihn hatte. Ihr kaltes, spöttisches Wesen schreckte ihn, wenn er sich ihr liebevoll nahen wollte. So suchte er bei Großmutter und Vater die Liebe, die er zum Gedeihen brauchte. Und da fand er sie in reichem Maße. Fest umschlungen gingen die beiden in die Halle zurück.
»Jetzt muß ich ins Schulzimmer, Großmama, meine Geschichtsstunde ist noch nicht zu Ende. Der Lehrer wird schon warten. Ich habe noch eine Stunde Latein nach der Geschichtsstunde. Aber dann bin ich frei – dann darf ich doch zu dir kommen?«
Die alte Gräfin nickte zärtlich.
Er lief mit schnellen Schritten wieder den teppichbelegten Gang nach dem Schulzimmer zurück. Liebevoll blickte Gräfin Thea dem schönen Jungen nach. Dann stieg sie sinnend die Treppe zur ersten Etage hinauf, wo sich im westlichen Flügel ihre Zimmer befanden.
2
Als Graf Joachim aus der Stadt zurückgekehrt war, begab er sich in den Salon seiner Mutter. Er fand Lothar bei ihr und wurde von beiden herzlich begrüßt. Sie nahmen zusammen den Tee, und Lothar sorgte durch sein lebhaftes, übermütiges Wesen für eine heitere Stimmung. Gräfin Thea sah mit inniger Befriedigung, daß ihr Sohn froher aussah.
Später gingen sie alle drei zum See hinunter. Auf dem Wege dahin neckte sich Lothar mit seinem Vater, und schließlich brachte er ihn so weit, einen Wettlauf mit ihm zu veranstalten.
Mit glücklichem Gesicht schaute die alte Dame hinter ihnen her. Ein tiefer Atemzug hob ihre Brust. Wie geruhsam und schön war es, wenn Susanne nicht dabei war.
Sie erschrak über diesen Gedanken, aber zu bannen vermochte sie ihn nicht.
Am See lagen zwei Ruderboote und ein kleines Segelboot. Zu Lothars heller Freude entschloß man sich zu einer Segelfahrt. Joachim half seiner Mutter sorglich beim Einsteigen und hüllte sie in ein warmes Tuch. In glücklicher Stimmung, wie Kinder, die Ferien haben, fuhren sie über den See dahin.
Als sie nach einer Stunde zum Landungsplatz zurückkehrten, stand Lothars Hauslehrer auf dem Steg. Kandidat Wetzel war ein sympathischer, frischer, junger Mann, dem man es nicht anmerkte, daß er während seines Studiums gehungert hatte. Er wurde von Graf Joachim und Gräfin Thea als zielbewußter Erzieher und tüchtiger Lehrer sehr geschätzt. Mit Lothar stand er auf einem sehr guten, fast kameradschaftlichen Fuße. Herr Wetzel hatte die einträgliche Hauslehrerstelle angenommen, um sich die Mittel zu weiterem Studium zu verdienen. Er sollte Lothar bis zum Abitur unterrichten, also noch mindestens vier Jahre in Wildenfels bleiben. Ohne dazu aufgefordert zu werden, legte er bei der Landung des Segelbootes hilfreich Hand an. Graf Joachim und Gräfin Thea begrüßten ihn freundlich.
»Wollen Sie auch eine Wasserfahrt machen, Herr Lehrer?« fragte Lothar.
»Ja, ich möchte ein Stündchen rudern.«
»Oh – da helfe ich mit. Darf ich, Papa?«
»Wenn dich der Herr Lehrer mitnehmen will.«
»Sehr gern, Herr Graf.«
»Oh – fein. Kommen Sie, Herr Lehrer, wir machen das Boot los. Adieu, Papa – adieu, Großmama!« rief Lothar. Er sprang in das Ruderboot, welches zunächst lag, der Erzieher folgte. Gleich darauf ruderten sie davon. Graf Joachim und seine Mutter blieben noch ein Weilchen stehen und sahen dem Boote nach.
Dann gingen sie langsam nach dem Schlosse zurück. Sie sprachen über den Lehrer und lobten seine Art, mit Lothar umzugehen.
»Susanne mag ihn seltsamerweise nicht leiden, ich verstehe das nicht«, sagte Joachim im Laufe des Gesprächs.
Gräfin Thea lächelte fein.
»Sie behauptet, er habe demokratische Ansichten und fürchtet, daß er Lothar in dieser Hinsicht beeinflußt.«
Joachims Gesicht überflog ein Schatten. »Meine Frau ist in dieser Beziehung sehr kleinlich. Übrigens gefällt mir gerade der demokratische Einschlag des Erziehers. Ich wünsche nicht, daß Lothar sich dem Einfluß seiner Zeit entzieht. Viele unserer Standesgenossen sind noch rückständig. Ich fühle, daß wir am Anfang einer Zeit stehen, in der nur das gilt, was ein Mensch ist und leistet, nicht der Zufall seiner Geburt.«
Gräfin Thea nickte versonnen.
»Du magst wohl recht haben. Freilich – dein Vater hätte solche Ansichten nicht hören dürfen.«
Auf Joachims Stirn zeigten sich Falten des Unmuts.
»Vater war ein starrer Anhänger der alten Schule. Er glaubte an die Rechte der bevorzugten Geburt. Aber wir sind auch nur Menschen. Und es ist mir sehr lieb, daß Lothar eine freiere Auffassung vom Leben erhält als ich. Jedenfalls habe ich dafür gesorgt, daß Wetzel die Erziehung in der Hand behält, bis Lothar die Universität besucht. Sein Kontrakt bindet ihn und uns.«
»Und du willst, daß Lothar Jura studiert?«
Joachim zuckte die Achseln.
»Susanne will ihn unbedingt zum Diplomaten machen. Ihr Ehrgeiz sieht ihn schon in höchsten Ämtern.«
»Und du, Joachim?«
Er lächelte wehmütig.
»Ich habe diesen Ehrgeiz nicht, Mama. Aber daß Lothar ein Studium zu Ende führt, ist auch mein Wunsch. Und er selbst hat Lust dazu. Was später aus ihm wird, darüber soll er selbst entscheiden. Teilt er den Ehrgeiz seiner Mutter – nun, so mag er in das diplomatische Korps eintreten. Begnügt er sich aber damit, schlecht und recht, wie ich, seinen Kohl zu bauen – dann steht ihm auch das frei. Irgendeinen Zwang würde ich nie ausüben. Ich weiß, wie man an Leib und Seele verkümmert, wenn man immer unter Druck gehalten wird.«
Die letzten Worte klangen sehr bitter. Gräfin Thea legte die Hand auf seinen Arm und sah ihn bekümmert an.
»Joachim!«
Er zog die Hand an seine Lippen und küßte sie. Trübe sah er in das gütige Frauenantlitz.
»Ja, Mutter, ich bin ein unerfreuliches Menschenkind geworden – durch Anlage und Erziehung. Nein, sieh mich nicht so bang und traurig an. Du hast getan, was du konntest, um meine Seele freizumachen. Aber du und ich, wir waren zu schwach. Vaters eiserner Wille hielt uns fest.«
»Joachim, du bist unglücklich, ich weiß es längst. Susanne ist nicht die Frau, die du brauchtest. Ich hatte mich gesträubt gegen diese Verbindung.«
»Mache dir keine Sorgen, Mutter. Ob Susanne oder eine andere, ich wäre doch nicht glücklich geworden. Als ich mich verheiratete, war es dazu bereits zu spät – da war mein Leben schon zerstört.«
»Ich habe es geahnt, mein Sohn. Du weißt, ich fragte dich oft, ob du mir nicht anvertrauen wolltest, was dich drückt und quält. Willst du es auch heute noch nicht tun?«
Joachims Gesicht zeigte einen gequälten Ausdruck.
»Nein, ich kann nicht. Laß mich, damit muß ich allein fertig werden. Vielleicht erfährst du es eines Tages. Jetzt aber laß uns davon schweigen.«
»Ich möchte dir so gern helfen, mein Sohn.«
»Es könnte sein, ich nähme dich eines Tages beim Wort.«
»Tue es, du sollst mich stark und willig finden zu allem, was dir Frieden schaffen kann.«
Wieder führte er ihre Hand an seine Lippen. Im Schloß angekommen, zog sich Joachim in seine Zimmer zurück. Seine Mutter sah ihm bekümmert nach. Nun würde er wieder ruhelos auf und ab wandeln wie so oft.
Sie seufzte schwer und suchte zögernd ihre Räume auf. Deutlicher als seit langem fühlte sie wieder einmal, daß es im Leben ihres Sohnes ein Gespenst gab.
Zum Abendessen fand sich Joachim in dem kleinen Speisesaal ein, der neben der großen Halle lag. Hier nahm man die Mahlzeiten ein, wenn keine oder nur wenige Gäste anwesend waren.
Joachim sah bleich und abgespannt aus. Er zwang sich mühsam, an der Unterhaltung teilzunehmen. Die Anwesenheit des Lehrers, der stets seinen Platz neben Lothar hatte, ließ ein vertrauteres Gespräch nicht aufkommen. Es war schwül und drückend heiß. Ein Gewitter lag in der Luft.
Nach Tisch ging man hinaus auf die Terrasse. Die Diener hatten die rot und weiß gestreiften Sonnendächer hochgezogen. Bequeme Korbmöbel luden zum Sitzen ein. Lothar und der Lehrer trieben ein wenig Astronomie und suchten mit dem Fernglas den Himmel ab, der noch nicht von Wolken verhüllt war.
Graf Joachim rauchte eine Zigarette nach der anderen, und seine Mutter betrachtete ihn mit sorgender Schweigsamkeit.
Um neun Uhr zog sich der Lehrer zurück, und auch Lothar sagte Vater und Großmutter fröhlich gute Nacht.
Kaum war er verschwunden, da sprang Joachim auf und klingelte.
»Mein Pferd«, rief er dem herbeieilenden Diener zu.
Gräfin Thea sah erschrocken auf.
»Du willst ausreiten, Joachim?«
Er sah an ihr vorbei, hinaus in den schweigenden Park.
»Mutter – das tue ich doch oft.«
Sie seufzte. Diese späten Ritte ihres Sohnes, die sich weit über Mitternacht ausdehnten und von denen er sein Pferd abgehetzt und schaumbedeckt nach Hause brachte, waren ihr schon lange eine schwere Sorge. Sie hatte ihre Schwiegertochter heimlich gebeten, Joachim von diesen wilden Ritten abzuhalten. Aber Susanne hatte sie ausgelacht.
»Ich bitte dich, Mama, die sind das einzige, womit Joachim noch einigermaßen Schneid verrät. Wie kannst du dich darum sorgen? Willst du ihn ganz und gar nur noch im Schlafrock und Pantoffeln sehen? Er kann wirklich ein wenig Courage brauchen. Ich werde mich hüten, ihn davon abzuhalten.« Das war ihre Antwort gewesen. Gräfin Theas Sorge war damit nicht gemildert. Unruhig sah sie den Sohn an.
»Leider reitest du immer so spät aus. Aber heute solltest du es wirklich nicht tun, Joachim – es ist ein Gewitter im Anzuge«, sagte sie bittend.
Joachim starrte düster vor sich hin.
»Es hat noch lange Zeit. Bis es losbricht, bin ich wohl wieder daheim.«
Gräfin Thea blickte unruhig zum Himmel empor. Eine dunkle Wolkenwand erhob sich über den Bäumen des Parkes wie ein starres, fernes Gebirge. Dann wandte sie die Augen wieder ihrem Sohne zu. Seine Züge waren schlaff, und die Augen blickten matt und düster. Um den Mund zuckte es nervös, als sei es ihm schwer, sich zur Ruhe zu zwingen.
Er warf den Rest seiner Zigarette fort und trat zu seiner Mutter.
»Gute Nacht, Mama. Du bist wohl zur Ruhe gegangen, wenn ich heimkomme.«
Sie faßte ängstlich seine Hand.
»Bleib heute zu Hause, Joachim«, bat sie eindringlich.
Er lachte, aber dieses Lachen kam nicht aus dem Herzen. Es klang leer und unnatürlich.
»Aber Mama, sei nicht ängstlich. Ich brauche den Ritt wie einen Schlaftrunk. Gute Nacht.«
Er küßte ihr die Hand und ging eilig davon.
Seine Mutter erhob sich und trat an die Terrassenbrüstung. Wieder flog ihr Blick sorgend zum Himmel empor. Es war unheimlich still und schwül. Ruhe vor dem Sturm, mußte sie denken.
Und da führte ein Reitknecht bereits Joachims Pferd vorüber. Es hob den Kopf und sog mit den Nüstern wie prüfend die Luft ein.
Bald darauf sah sie ihren Sohn über den Rasenplatz reiten. Sie starrte ihm nach. Was war es nur, das ihn so ruhelos und freudlos gemacht hatte?
Der Reitknecht schritt wieder mit ehrfurchtsvollem Gruß an ihr vorüber zu den Ställen hinüber, die hinter dem Gebäude lagen, das an den westlichen Flügel des Schlosses angebaut war. In diesem Gebäude waren die Verwaltungsräume untergebracht. Im Parterre lag das Rentamt. Man konnte es durch den westlichen Schloßflügel betreten. Eine einzige Tür war durch die starken Schloßmauern gebrochen. Sie war aus Eisen; eine Doppeltür, zu der nur der Graf von Wildenfels den Schlüssel hatte. Niemand durfte diese Tür benützen als der Graf und der Rendant, denn sie führte direkt in den Raum, wo in eingebauten eisernen Wandschränken die Kasse, die Wirtschaftsbücher, wertvoller Schmuck und das silberne Tafelgerät, soweit es nicht täglich gebraucht wurde, untergebracht waren. Hier ruhte, wohlverwahrt gegen Feuersgefahr und Diebstahl, der Reichtum der Grafen von Wildenfels.
Im ersten Stock des Gebäudes befand sich die Wohnung des Rendanten und seiner Familie, im zweiten Stock wohnten die beiden ledigen Verwalter. Die sonstigen Wirtschaftsgebäude lagen hinter dem Park am See.
Gräfin Thea war hinaufgegangen in ihre Zimmer. Als sie ihr Vorzimmer betrat, erhob sich eine etwa fünfzigjährige Frau im schwarzen Kleid, mit weißem Häubchen und weißer Schürze. Sie hatte am Fenster gesessen und vor Eintritt der Dämmerung in dem Buche gelesen, das auf ihrem Schoße lag. Ihr frisches, rundes Gesicht wandte sich der Gräfin mit sorgendem Ausdruck zu.
»Heute hätten Frau Gräfin nicht zulassen sollen, daß der Herr Graf ausreiten. Es gibt schweres Wetter«, sagte sie fast vorwurfsvoll. Es war Frau Friederike Grill, Gräfin Theas langjährige Kammerfrau. Als junges Zöfchen hatte sie vor dreißig Jahren ihren Einzug in Wildenfels gehalten. Später war sie die Frau des Kammerdieners des Grafen, Heinrich Grill, geworden, ohne deshalb ihren Dienst bei der Gräfin Thea aufzugeben. Sie avancierte nur einfach zur Kammerfrau und blieb auf ihrem Posten, als ihr Mann vor etwa zehn Jahren starb. Gräfin Thea hielt große Stücke auf die ihr treu ergebene Person und sprach auch ein vertrauliches Wort mit ihr. Gelegentlich ließ sie sich sogar ein wenig von ihr tyrannisieren.
Jetzt blickte sie kummervoll in das treu besorgte Gesicht.
»Grill, du weißt doch – er läßt sich nicht halten«, sagte sie leise.
Grill – sie wurde seit ihrer Verheiratung nur so von der Gräfin genannt – nickte mit dem Kopfe.
»Na ja, na ja, aber heute hätte der Herr Graf doch lieber zu Hause bleiben sollen.«
»Hast du mal nach Lothar gesehen, Grill?«
Die nickte lächelnd.
»Na, das lasse ich mir nicht nehmen. Erst hat er noch sein Späßchen mit mir gemacht, dann ist er mit einem Purzelbaum quer durchs Zimmer, nun liegt er still und schläft fest und ruhig. Den weckt kein Gewitter auf, bis er ausgeschlafen hat.«
»Leg mir einen bequemen Morgenrock zurecht. Ich will zu ihm hinüber, dann hilfst du mir beim Umkleiden. Zu Bett will ich nicht gehen, das Wetter treibt mich doch wieder heraus.«
Sie ging zu Lothars Schlafzimmer. Liebevoll sah sie auf den Schläfer herab und freute sich an seinen ruhigen, tiefen Atemzügen. Ein heißes Gebet für sein Wohl stieg aus ihrem Herzen empor. Dann ging sie leise hinaus und kehrte in ihr Zimmer zurück.
Grill kleidete ihre Herrin flink und gewandt in ihren weichen Morgenrock und löste aus den noch recht ansehnlichen grauen Flechten die Nadeln. Während sie das Haar bürstete und für die Nacht in einen Zopf einflocht, plauderte sie von den Ereignissen des Tages, um ihre Herrin zu zerstreuen. Aber dabei lauschten beide immer wieder hinaus. Ein heftiger Wind hatte sich erhoben. Grill mußte die Fenster schließen. Dabei sah sie, daß die Wolkenwand gespenstisch und unheimlich näher zog. Gräfin Thea hatte sich erhoben und trat neben sie.
»Das sieht bös aus, Grill. Ich gehe hinüber in mein Wohnzimmer. Wenn du willst, kannst du zu Bett gehen.«
»Aber nein, Frau Gräfin können sich denken, daß ich bei dem Wetter wach bleibe. Frau Gräfin brauchen nur zu rufen, wenn Sie mich brauchen.«
»Es ist gut, Grill.«
Gräfin Thea ging in ihr Wohnzimmer. Es war ein großer Raum im Stil Ludwigs XIV. Prachtvolle Damastbezüge und Vorhänge in goldgelber Farbe gaben dem Raum sein Gepräge. Über dem Kamin hing ein kostbarer Gobelin. Mitten im Zimmer stand auf weichem, in grauen Tönen gehaltenem Teppich ein Tisch mit schwarzer Marmorplatte, deren Mitte eine Jardiniere mit dunkelroten Rosen zierte. Am Fenster hatte ein Schreibtisch Platz, darüber hing das lebensgroße Porträt ihres Sohnes. Er mochte höchstens dreiundzwanzig Jahre gezählt haben, als das Bild gemalt worden war.
Gräfin Thea stellte sich an das Fenster. Ihr Blick wandte sich in das Zimmer zurück auf das Bild ihres Sohnes. Ja, damals war er noch froh und glücklich gewesen. Gerade in jener Zeit hatte es wie Sonnenglanz auf seinen Zügen gelegen.
In Gedanken stand sie da und grübelte, wie so oft, über sein verändertes Wesen nach. Da schrak sie plötzlich zusammen, ein greller Blitz leuchtete auf, dann ein furchtbarer Donnerschlag, der die Fenster klirren machte. Es war, als sei dies ein Signal gewesen, das alle Elemente entfesselte. Ein orkanartiger Sturm brach mit plötzlicher Gewalt los. Die Baumriesen im Park wurden wie schwache Rohre hin und her gebogen. Es krachte und knatterte unaufhörlich, als sei alles, was sich dem Sturm entgegenstellte, dem Untergang geweiht. Und dann wieder in kurzer Folge Blitz und Donner, dazwischen das Heulen des Sturmes und endlich ein wolkenbruchartiger, mit Hagelschauern vermischter Regen.
Gräfin Thea war entsetzt in das Zimmer zurückgewichen und in einen Sessel gesunken. Schreckensbleich starrte sie vor sich hin und faltete die Hände. Wo mochte Joachim sein in diesem furchtbaren Unwetter? Kehrte er noch nicht heim?
Sie lauschte angstvoll hinaus und betete für ihren Sohn.
Wieder krachte ein knatternder Donnerschlag hernieder.
»Vater im Himmel, schütze meinen Sohn«, flüsterte sie mit bebenden Lippen.
Aber während dies Gebet zum Himmel stieg, lag Joachim Graf Wildenfels bereits blutüberströmt unter seinem Pferde auf der Chaussee. Ein durch den Sturm entwurzelter Baum hatte Pferd und Reiter unter sich begraben. Das Pferd war tot, und Graf Joachim lag schwer verwundet und bewußtlos unter dem leblosen Tierkörper.
3
Das Unwetter hatte sich ausgetobt. So schnell und furchtbar es gekommen, so schnell war es vorübergezogen. Der Mond schien bereits wieder friedlich zwischen den zerrissenen Wolkenfetzen hervor.
Gräfin Thea hatte in angstvoller Unruhe auf die Rückkehr ihres Sohnes gewartet. Die Unruhe steigerte sich von Minute zu Minute.
Noch hoffte sie, daß er im Dorf Unterschlupf gefunden hätte. Daß er aber dann sofort nach dem Gewitter heimkehren würde, um sie zu beruhigen, galt ihr als sicher.
Aber er kam nicht!
Nun hielt es die verängstigte Frau nicht länger. Sie eilte hinaus in das Vorzimmer. Da stand auch Grill mit blassem Gesicht und horchte hinaus.
»Grill, ruf die Leute zusammen! Es muß meinem Sohn ein Unfall zugestoßen sein, sonst wäre er daheim«, stieß Gräfin Thea atemlos vor Erregung hervor.
Grill rannte, so schnell sie konnte, die Treppe hinab.
Wenige Minuten später waren alle Dienstboten in der großen Halle versammelt. Gräfin Thea gab dem Hausmeister mit bebender Stimme Befehl, die Leute mit Fakkeln und Windlichtern auszurüsten und die Umgegend absuchen zu lassen. So schnell es anging, wurde der Befehl ausgeführt. Der Hausmeister führte selbst den Zug an und verteilte draußen die Leute in mehrere Gruppen.
Es dauerte nicht lange, da hatte man den Verwundeten gefunden. Laute Rufe schallten durch die Nacht. Die Suchenden stießen wieder zusammen. Es kostete viel Mühe, den Baum und das tote Pferd so weit beiseite zu räumen, um den Grafen zu befreien. Ein leises Stöh-nen zeigte dem niederknienden Hausmeister, daß sein Herr noch lebte. Zum Glück war es nicht weit bis zum Schloß. Der Hausmeister schickte einige Leute zurück. Einer sollte die Gräfin Thea vorbereiten, ein anderer sollte sofort zum Arzt fahren. Die übrigen bekamen den Auftrag, eine Tragbahre herbeizuschaffen, denn ohne eine solche konnte man den Verwundeten nicht fortschaffen.
Gräfin Theas Unruhe war auf das Unerträglichste gesteigert worden, als die Schreckensbotschaft eintraf. Einen Moment wankte die alte Dame, und Grill sprang erschrocken heran, um sie zu stützen. Aber nur einen Augenblick währte diese Schwäche, dann lief die unglückliche Mutter, wie sie ging und stand, in die Nacht hinaus. Grill folgte ihr wie ein treuer Schatten.
Gräfin Theas Morgenrock schleifte auf dem nassen Boden – sie achtete nicht darauf. Ihre grauen Flechten hatten sich gelöst, lose Haarsträhnen fielen über ihr entsetzensstarres Gesicht. Atemlos hastete sie vorwärts. Als sie bei der stumm und erschüttert um den Verunglückten dastehenden Gruppe anlangte, machte man ihr ehrfurchtsvoll Platz.
Schweigend, wie zerbrochen, sank sie neben dem fast leblosen Körper ihres Sohnes in die Knie, und dann stöhnte sie auf. Ein einziges Mal nur, aber der ganze furchtbare Schmerz ihres gemarterten Herzens kam in diesem qualvollen Laute zum Ausdruck.
Die ausgesandten Helfer kamen mit der improvisierten Tragbahre herbei. Die Zähne fest zusammengebissen, ein Bild versteinerten Jammers, half Gräfin Thea selbst mit, ihren Sohn darauf niederzulegen. Sie schritt dicht neben ihm, als sich der Zug in Bewegung setzte, und auf dem kurzen Wege bis zum Schloß litt sie tausendfältig die Schmerzen ihres Sohnes mit. Ihr Kleid war mit Blut besudelt, sie hatte nicht darauf geachtet, daß sie in eine Blutlache getreten war, als sie neben ihrem Sohne niedersank. Es war ein trauriger Zug, der sich schweigend dem Schlosse nahte.
Im Schlafzimmer des Grafen war inzwischen alles zur Aufnahme des Verwundeten vorbereitet worden. Man legte ihn sorgsam auf das Bett. Die Leute schlichen stumm und betreten hinaus, nur Grill und der Hausmeister blieben im Zimmer. Eigenhändig wusch Gräfin Thea mit zarter Sorgfalt das Blut von dem Antlitz ihres Sohnes. Sie vergaß sich selbst und ihren Jammer im Bestreben, ihm wohlzutun, ihm etwas Liebe zu erweisen.
Bange, martervolle Minuten, die sich zu Ewigkeiten dehnten, vergingen, bis der herbeigeholte Arzt eintraf.
Dann gab es ein geschäftiges Treiben. Der Arzt waltete seines Amtes. Grill war halb ohnmächtig und nicht imstande, zu helfen, so gern sie es getan hätte. Aber die Gräfin hielt sich wie eine Heldin. Sie wich nicht aus dem Zimmer und verrichtete mit zusammengebissenen Zähnen alle die kleinen Dienste, die der Arzt verlangte. Mit ihrer und des Hausmeisters Hilfe wurde der Verwundete untersucht und verbunden.
Sie sprach kein Wort, fragte nicht und weinte nicht, aber ihre Augen forschten voll brennender Unruhe in dem ernsten Gesicht des Arztes. Und als dessen Miene immer düsterer wurde, ahnte sie, daß ihr das Schlimmste noch bevorstand.
Grill hatte, ehe sie hinausging, gefragt, ob sie Lothar wecken und herbeirufen sollte. Schaudernd hatte Gräfin Thea den Kopf geschüttelt. Diesen gräßlichen Anblick wollte sie ihrem Enkel ersparen, wenn es möglich war.
Bis zum Schluß hielt die arme Mutter tapfer aus, aber als dann die Untersuchung zu Ende war, die Verbände angelegt waren, und als ein leises Stöhnen sich über die Lippen ihres Sohnes rang, brach sie kraftlos in einem Sessel neben dem Bett zusammen.
Der Arzt flößte ihr ein Glas Wein ein, und sie erholte sich schnell. Dann bot er ihr den Arm und führte sie in das Nebenzimmer mit einem bezeichneten Blick auf den Kranken. Er gab dem Hausmeister durch einen Wink zu verstehen, daß er den Verwundeten bewachen sollte, bis er zurückkam. Drüben führte er die Gräfin Thea zu einem Sessel. Sie sah zu ihm auf mit einer qualvollen Frage in den Augen.
»Die Wahrheit, Herr Doktor, die Wahrheit!«
Lallend rangen sich die Worte von ihren Lippen.
»Er lebt«, sagte der Arzt mit heiserer Stimme. Was er zu sagen hatte, wurde ihm schwer den leidvollen Mutteraugen gegenüber.
»Und?«
Der Arzt zögerte noch immer.
»Die Wahrheit, ich will die Wahrheit«, sagte sie noch einmal und krampfte die Hände um die Sessellehne.
Da trat der Arzt an ihre Seite, um sie zu stützen.
»Beten Sie, Frau Gräfin, beten Sie – daß er nicht am Leben bleibt.«
Da fiel das Haupt der alten Dame wie leblos zurück. Aber mit übermenschlicher Anstrengung zwang sie sich wieder empor.
»Tot – oder Krüppel. Nicht wahr?« fragte sie leise mit den blassen Lippen, kaum verständlich die Worte formend.
Der Arzt nickte: »Schlimmer noch – das Hirn ist verletzt.«
Da erhob sie sich langsam und wollte wieder hinüber. Er hielt sie zurück.
»Legen Sie erst dieses Kleid ab, Frau Gräfin. Er wird vielleicht bald zum Bewußtsein kommen. Ich gehe inzwischen hinüber und lasse Sie sofort rufen, wenn er zu sich kommt.«
Grill hatte schon ein anderes Gewand zurechtgelegt. Mit bebenden Händen half sie ihr beim Umkleiden. Gräfin Thea ließ sich kaum Zeit, das Haar festzustecken. Dann eilte sie wieder hinüber.
Graf Joachim lag bleich mit geschlossenen Augen auf seinem Lager. Mühsam hob sich die Brust in schweren Atemzügen, und zuweilen stöhnte er auf.
Seine Mutter setzte sich an sein Bett und wandte die Augen nicht von den geliebten Zügen. Der Arzt beugte sich zu ihr herab.
»Ich habe ein Telegramm an Gräfin Susanne aufgeben lassen«, flüsterte er.
Sie sah zu ihm auf.
»Sie fürchten – schon so bald?«
Der Arzt sah ernst und voll Mitleid in ihren vergehenden Blick.
»Es könnte – ein schnelles Ende ist hier nicht ausgeschlossen. Beten Sie darum!«
Sie preßte die Hände an das Herz, um den Schmerzensschrei zu ersticken. Ihr Gesicht schien versteinert in Jammer und Leid.
Dann haftete ihr Blick wieder auf ihres Sohnes Antlitz. Keine Träne brachte ihr Linderung. Das tiefste Leid ist tränenlos. Aber eine Zaubermacht lag in den Mutteraugen. Sie riefen den Todwunden noch einmal ins Leben zurück.
Joachim schlug plötzlich die Augen auf. Sein Blick irrte suchend umher und traf dann den der Gräfin.
Jede Mutter ist wohl in solchen Augenblicken eine Heldin. Auch Gräfin Thea vermochte es über sich, ihrem Sohn zuzulächeln. Aber er erkannte die Verzweiflung, die sich hinter diesem Lächeln verbarg.
»Mutter, meine Mutter«, sagte er matt.
Sie beugte sich über ihn, die Lippen lächelten noch immer – aber die Augen brannten vor Leid.
»Mein Joachim, mein geliebter Sohn – sprich nicht – liege ganz still.«
Er sann eine Weile nach, schien zu überlegen, was geschehen war. Ein Gefühl, als sei sein Geist nicht im Zusammenhang mit seinem Körper, beherrschte ihn. Aber trotzdem erkannte er mit unheimlicher Schärfe seinen Zustand. »Ah – jetzt weiß ich – der Baum – ich konnte nicht mehr ausweichen – Fafner scheute – wie steht es mit Fafner?« Die Sorge um sein Pferd schien ihn zu bedrücken.
»Er ist wohl und munter – im Stall«, sagte die Gräfin lächelnd. Es war eine jener frommen Lügen, die Wohltaten bergen.
»Das ist gut – ah – und da – Herr Doktor – bitte.«
Der Arzt trat näher.
»Wie lange noch – Doktor?« fragte er fest und klar.
Er sah den Doktor mit großen Augen an, als sich dieser über ihn beugte.
»Herr Graf –«
Joachims Augen zuckten unruhig.
»Ehrlich, Doktor – ich bin kein altes Weib.«
Der Arzt atmete gepreßt.
»Wo Leben ist – ist Hoffnung«, sagte er leise.
Joachims Blick erhielt etwas Starres. Aber dann lächelte er wehmütig.
»Also das Ende – arme Mutter.«
Er lag eine Weile mit geschlossenen Augen. Gräfin Thea saß mit zusammengepreßten Händen wie leblos da und sah ihn an.
Gleich darauf hob der Verwundete wieder den Blick.
»Doktor – ich habe noch – etwas zu regeln – es ist notwendig. Haben Sie etwas – nur eine Stunde noch Kraft und Klarheit – dann geben Sie es mir – bitte.«
Der Arzt verstand ihn. Er entnahm seinem Besteck ein Fläschchen und zählte einige Tropfen in einen Löffel. Die reichte er dem Kranken. Dieser dankte mit einem Blick.
»Nun lassen Sie mich, bitte, allein – mit meiner Mutter.«
»Ich bleibe in der Nähe, wenn Sie mich brauchen. In einer Stunde kann ich Ihnen diese Tropfen noch einmal geben«, sagte der Arzt und ging hinaus.
Nun waren sie allein, Mutter und Sohn.
Joachim sah seine Mutter eine Weile stumm an. Dann bat er leise:
»Nicht lächeln, Mutter – dein Lächeln tut mir weh.«
Die Gräfin brach in die Knie und küßte ihm die Hand. Dann legte sie einen Augenblick ihr Haupt mit geschlossenen Augen neben das seine. Joachim atmete schwer.
»Fasse dich, Mutter – sei stark – du hast schon so viel für mich getan – nun auch noch das. Ich brauche deine Hilfe, Mutter – du – mußt gutmachen – was ich verbrochen. – Wolltest immer wissen, was mich verändert hat. – Die Schuld – Mutter – die Schuld – jetzt will ich beichten – du wirst verzeihen – du – gute Mutter – du wirst gutmachen.«
Die Gräfin hob den Kopf und sah ihn an.
»Sprich nicht, wenn es dir Schmerzen macht«, bat sie flehentlich.
»Nein, nein – eine Wohltat – ich muß – sonst ist es zu spät. Versprich mir – daß du gutmachen willst – bitte.«
»Ich verspreche es dir, mein Sohn, daß ich alles tun werde, was du von mir verlangst.«
Ein tiefer Atemzug hob seine Brust. Dann fragte er leise:
»Wo ist der Rock, den ich trug – in der Brusttasche steckt ein kleiner Schlüssel.«
»Der Schlüssel liegt schon bei den anderen Sachen, wir haben alles aus der Tasche genommen.«
»Nimm den Schlüssel, Mutter, und geh hinüber ins Nebenzimmer. In meinem Schreibtisch links oben ist ein Fach. Öffne es mit diesem Schlüssel und bring mir die kleine Kassette, die du dort findest.«
Gräfin Thea erhob sich und ging, seinen Wunsch zu erfüllen. Mit der Kassette in der Hand kehrte sie zurück. Joachim öffnete sie mit einem Druck auf eine Rosette und nahm ein Etui heraus. Das reichte er seiner Mutter.
»Öffne es«, bat er.
Sie tat es und sah verständnislos auf ein kostbares Halsband, welches mit Brillanten von seltener Schönheit besetzt war. »Das Halsband – es ist – wie sonderbar – wie kommt es in diese Kassette?« stammelte sie betroffen.
Er faßte wieder in die Kassette und zog ein Schriftstück hervor. Das gab er seiner Mutter, sie mit brennenden Blicken betrachtend.
»Öffne – und lies – es erklärt alles – ich brauche dann nicht mehr viel zu reden.«
Gräfin Thea las die Aufschrift:
»An meine Mutter, Theodora Gräfin Wildenfels, geb. Gräfin Solnau. Nach meinem Tod zu öffnen.«
Die alte Dame brach in den Sessel nieder und öffnete mit zitternden Händen das Schreiben.
Während sie las, sah Joachim unverwandt in ihr Gesicht. Er sah das Erschrecken in ihren Zügen, sah Blässe und Röte darüber hinjagen, und ein tiefer Seufzer entfloh seinen Lippen. Da blickte sie auf und faßte seine Hand.
»Mein Sohn – mein armes, liebes Kind«, sagte sie erschüttert.
Seine Augen strahlten auf.
»Du verdammst mich nicht, Mutter, wendest dich nicht voll Abscheu von mir?« fragte er leise.
Sie beugte sich hernieder zu ihm und küßte ihn mit zuckenden Lippen.
»Wenn du Schuld auf dich geladen hättest, tausendfach größer als diese – ich würde dich nicht verdammen. Eine Mutter kann alles verzeihen. Ach, wärst du doch früher voll Vertrauen zu mir gekommen. Ich hätte dir tragen helfen, hätte mit dir zusammen gutzumachen versucht.«
Er seufzte wieder tief auf.
»Ich konnte nicht, Mutter. Immer hoffte ich, selbst zum Ziel zu kommen. Seit fünfzehn Jahren habe ich alles versucht – erfolglos – es ist, als wären sie vom Erdboden verschwunden. Aber vielleicht hast du nun mehr Glück. Nicht wahr, du versprichst mir, nach ihnen zu suchen und mein Unrecht gutzumachen?«
Er faßte ihre Hand und sah ihr mit brennenden Augen ins Gesicht.
»Ich verspreche es dir, mein Sohn. Nicht ruhen und rasten will ich, bis ich deine Schuld gesühnt habe.«
»Dank, heißen Dank, meine Mutter. Und nicht wahr – wenn du sie, glücklicher als ich, gefunden hast – und wenn du Annie noch einmal im Leben gegenüberstehst – dann sage ihr – ich habe sie geliebt – wie ich nie zuvor und nachher ein Weib geliebt habe. Du hast sie gekannt, Mutter – aber du weißt nicht, welch feine stille Seele sie war. Damals – ja – damals war ich glücklich – drunten am See – als ich sie im Arm hielt. Wie sie zitterte, Mutter – wie sie mich ansah mit den lieben, guten Augen. Damals vergaß ich alles – Vaters Strenge – meinen Namen, meine Geburt – ich war nichts als ein glücklicher Mensch. Und dann – dann habe ich sie selbst hinausgetrieben – vielleicht in Not und Elend – Mutter – das hat an mir gezehrt – mehr als alles andere.«
Er schwieg erschöpft und schloß die Augen einen Moment.
Seine Mutter sah mit heißem Erbarmen und unendlicher Liebe in sein Gesicht und streichelte seine Hand.
»Da konntest du freilich nicht glücklich werden mit Susanne. Auch wenn sie eine andere gewesen wäre, hätte es dir nichts geholfen.«
»Nein – in meinem Herzen lebt Annies Bild – und es wird bis zum letzten Atemzug in mir leben. Daß Susanne kalt und hochmütig war, hat mir das Leben mit ihr eher erleichtert. Sie forderte nichts, was ich nicht geben konnte. Eine Fremde ist sie mir geblieben – Vater hatte wahrlich gut für mich gewählt.«
Die letzten Worte klangen unendlich bitter.
»Verzeihe deinem Vater, Joachim. Er hat dein Bestes gewollt. Wenn er geahnt hätte, wohin er dich mit seiner Strenge getrieben, er würde manches anders gemacht haben. Aber nie hätte er seine Einwilligung gegeben zu deiner Verbindung mit Annie Horst. Er war in dieser Beziehung noch strenger als in jeder anderen.«
»Und du, Mutter? Hättest du eingewilligt, wäre dir das bürgerliche Mädchen als Schwiegertochter willkommen gewesen?«
Gräfin Thea sah mit leidvollen Augen zu ihm nieder.
»Dein Glück hätte mir mehr gegolten als törichte Standesvorurteile.«
Ein schattenhaftes Lächeln huschte um seinen Mund.
»Dann wirst du sie auch an dein Herz nehmen, wenn du sie findest. Denk immer daran, Mutter – was du ihr Gutes tust, das tust du mir. Und alle Liebe, die du ihr erweisest, wird meine Schuld geringer machen.«
»Sei ruhig, Joachim. Wie eine Tochter soll sie mir sein, das gelobe ich dir mit einem heiligen Eid.«
Er atmete auf, wie von schwerer Last befreit.
»Heißen Dank. Nun kann ich ruhig meine Augen schließen – für immer.«
»Joachim!«
Es war ein herzzerreißender Klang in diesem einen Wort.
Er sah matt zu ihr empor.
»Klage nicht, Mutter. Gönne mir die Ruhe. Ich habe furchtbar gelitten.«
Müde schloß er die Augen. Sein Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an.
Die Gräfin rief entsetzt nach dem Arzt, nachdem sie das Halsband und das Schreiben wieder in der Kassette geborgen hatte. Der Arzt flößte dem Verwundeten noch einmal die belebenden Tropfen ein. Seine Augen öffneten sich wieder und wurden klarer.
»Hole mir Lothar, Mutter. Nicht wahr, Doktor, es ist Zeit zum Abschiednehmen?«
Der Arzt antwortete nicht, er sah nur still und ernst in seine Augen.
Gräfin Thea war hinausgeeilt. Leise trat sie in Lothars Schlafzimmer und weckte ihn.
»Lothar, mein lieber Junge, komm, werde munter. Steh auf.«
Lothar setzte sich erstaunt im Bett empor und rieb sich die Augen.
»Was ist denn, Großmama, es ist noch ganz dunkel. Warum soll ich aufstehen?«
»Komm schnell, mein liebes Kind. Und sei recht tapfer und ruhig. Dein armer Papa ist krank. Weißt du – erschrick nicht – er ist gestürzt – mit Fafner. Und nun möchte er dich sehen.«
Mit einem Ruck war Lothar aus dem Bett. Sein frisches Gesicht war blaß geworden, und die Augen blickten erschrocken.
»Großmama, sag es mir, ist es sehr schlimm?«
»Ja, Lothar.«
In fliegender Hast warf Lothar einige Kleidungsstücke über. Seine Großmutter half ihm mit zitternden Händen. Und dann schritten sie, eng umschlungen, hinüber in das Krankenzimmer.
Ehe sie eintraten, flüsterte die Gräfin: »Bleibe recht ruhig, Lothar. Stark mußt du sein, damit du Papa nicht noch mehr Herzeleid machst.«
Er schluckte tapfer die Tränen hinunter. »Ich weine ganz gewiß nicht, Großmama«, sagte er mit bebender Stimme.
Und er hielt Wort, der kleine Mann. So sehr er erschrak beim Anblick seines Vaters, er ließ die Tränen nicht heraus, die ihn im Halse würgten.
Graf Joachim sah mit umflorten Augen auf seinen Sohn. Der Abschied von ihm war das Schwerste. Er legte seine Hand auf das junge Haupt.
»Sei stark und fest, mein Sohn und treu dir selbst. Gott segne dich«, sagte er eindringlich, wie beschwörend.
Der Arzt hatte das Zimmer verlassen, als Lothar mit seiner Großmutter eintrat. Der Knabe küßte des Vaters segnende Hand.
»Papa – lieber Papa – du wirst wieder gesund! Du mußt, Papa – du mußt!« brach es angstvoll über seine Lippen.
Eine Träne schimmerte in Graf Joachims Augen.
»Mein lieber Junge – geliebtes Kind«, murmelte er, und der Schmerz, von seinem Kinde fort zu müssen, übermannte ihn. Dann faßte er sich und wandte sich seiner Mutter zu.
»Wenn du das Werk nicht vollenden kannst, Mutter – dann soll Lothar alles wissen – dann soll er – gutmachen. Bewahre meine Aufzeichnungen – für ihn – wenn es sein muß.«
Sie beugte sich über ihn und küßte seine Augen.
»Dein Wille soll geschehen – und sei ruhig – wir werden sie finden – und alles sühnen – alles«, flüsterte sie.
Der Arzt trat leise wieder ein. Ein Blick in Joachims Gesicht verriet ihm, daß das Ende nahe sei. Er gab der Gräfin, auf Lothar zeigend, einen Wink.
Sie verstand und faßte erschreckt nach Lothar. Joachim schien bewußtlos. Liebevoll führte sie Lothar bis zur Tür.
»Gehe in dein Zimmer, mein Kind. Ich komme nachher zu dir. Papa muß jetzt Ruhe haben.«
Gehorsam ging Lothar hinaus. Sie sah ihm nach mit starrem Blick.
Er soll seinen Vater nicht sterben sehen, dachte sie erschauernd.
Dann trat sie wieder an das Bett ihres Sohnes. Er war in einen lethargischen Zustand verfallen. Der Arzt zählte den Puls und trat mit ernstem Gesicht zurück. Noch einmal schlug Joachim die Augen auf.
»Mutter!«
Sie beugte sich über ihn.
»Mein Sohn?«
Er lächelte.
»Annie – süßes blondes Kind – wie golden dein Haar – wie ich dich liebe – du bist mein Sonnenstrahl«, flüsterte er.
Und dann klärten sich noch einmal seine Sinne.
»Mutter – meine Mutter – Lothar und du – ihr beide – ach – schuldlos sein – schuldlos und Annie – Annie –«
Er brach ab, ein langer, schmerzlicher Seufzer, das Auge brach. Graf Joachim war tot.
Gräfin Thea drückte ihm mit sanfter Hand die Augen zu, dann sank sie ohnmächtig neben dem Bett nieder, ohne einen Laut. Bis zu diesem letzten Liebesdienst hatte ihre Kraft ausgereicht. Nun war sie zu Ende damit.
4
Gräfin Susanne fand das Telegramm, welches ihr den Unfall ihres Gatten meldete und sie heimrief, bereits im Hotel vor, als sie in Ostende ankam. Mehr ärgerlich als betrübt gab sie ihrer Zofe und ihrem Diener Befehl, alles zur Heimreise zu rüsten.
Es blieben ihr bis zur Abfahrt des nächsten Zuges einige Stunden Zeit. Sie nahm zur Erfrischung ein Bad, frühstückte und schrieb an ihre Bekannten, daß sie sofort wieder abreisen müsse.
Müde und verdrießlich saß sie am Fenster und schaute hinaus auf das Meer. Unten herrschte schon reges Leben. Susanne begriff nicht, daß alle Menschen so vergnügt aussahen. Sie konnte im Schlafwagen nicht rechte Ruhe finden. Und nun hatte sie die anstrengende Reise gemacht, um sofort wieder heimzukehren. Wieder stand ihr eine lange Bahnfahrt bevor. Und dann zu Hause, was erwartete sie da? Ein schwerer Unfall – so hatte der Arzt gemeldet. Da konnte sie möglicherweise den ganzen Sommer in Wildenfels sitzen und Krankenpflegerin spielen. Brrr – sie schüttelte sich. Kranke Mensehen waren ihr widerwärtig, sie mied sogar das Krankenzimmer, wenn ihr Sohn das Bett hüten mußte. Während seiner Krankheiten hatte sie ihm immer nur kurze Pflichtbesuche abgestattet.
Was mochte nur geschehen sein? Solche Telegramme waren entsetzlich. Man hätte Rücksicht darauf nehmen müssen, daß sie erst die weite Reise hinter sich hatte. Kehrte sie aber nicht sofort zurück, dann war ihre Schwiegermutter sicher wieder gekränkt und beleidigt.
Sie las die Depesche noch einmal durch. »Graf Joachim von schwerem Unfall betroffen. Zustand bedenklich. Sofortige Rückreise dringend erwünscht. Dr. Kreuzer.« Nervös nagte sie an der Unterlippe. Diese Nachricht hätte etwas weniger im Depeschenstil gehalten sein sollen. Dieser Dr. Kreuzer war sehr kurz angebunden. Ihre Schwiegermutter hätte wohl dafür sorgen können, daß man ihr ausführliche Nachricht gab. Aber die war natürlich kopflos vor Schreck. Wenn ihrem Sohn oder Lothar nur ein Finger weh tat, war sie schon außer sich.
Ärgerlich, zu ärgerlich. Hier in Ostende hätte es so amüsant werden können.
Sie erhob sich und trat vor den Spiegel. Aufmerksam betrachtete sie ihr schönes, regelmäßiges Gesicht. Ihr Teint war noch frisch und zart wie bei einem jungen Mädchen, obwohl sie schon im dreiunddreißigsten Jahre stand. Keinerlei seelische Erregungen hatten in diesen glatten Zügen Runen hinterlassen. Hätten die etwas zu hellen, blauen Augen nicht so kalt und seelenlos geblickt, Susanne wäre eine vollkommene Schönheit gewesen.
Mit beiden Händen umspannte sie ihre Taille und zog an dem elegant sitzenden Reisekleid. Schade, daß sie nun um die Seebäder kam, die ihr immer so gutgetan hatten. Man mußte etwas tun, um die jugendliche Schlankheit zu bewahren. Ihre Mutter war im Alter zu stark geworden. Soweit durfte es bei ihr nie kommen.
Sie drehte sich hin und her und stieß einen leisen Seufzer aus. Ohne sich zu schmeicheln, mußte sie sich gestehen, daß sie nicht älter aussah als fünfundzwanzig Jahre. Aber freilich, ihr großer Sohn kompromittierte sie. Er verriet ihr wahres Alter.
Sie ließ sich wieder nieder und seufzte von neuem. Ihre herrlichen Pariser Toiletten fielen ihr ein. Die durfte sie nun am Ende nur in Wildenfels tragen – zur Erbauung für die Krautjunker der Umgegend, oder, wenn es hoch kam, für die paar Besuche in der Kreisstadt. In Ostende wären sie ganz anders zur Geltung gekommen.
Ärgerlich – zu ärgerlich!
Gräfin Susanne ahnte nicht, daß sie schon am nächsten Tage würde Trauerkleider anlegen müssen.
Als sie in Wildenfels ankam, empfing sie eine seltsame Stille. Der Wagen war am Bahnhof, aber weder der Kutscher noch der Lakai hatten ihr gesagt was geschehen war. Und sie liebte es nicht, sich mit ihren Leuten zu unterhalten.
Eben empfing sie der Hausmeister in bedrückter, feierlicher Haltung, und in der Halle kam ihr Gräfin Thea, bleich wie der Tod und im schwarzen Gewand, entgegen.
»Mein Gott, Mama – was ist geschehen?« rief sie nun doch ernstlich erschrocken.
Gräfin Thea fühlte in diesem Augenblick mehr denn je, daß Susanne ihren Sohn nie geliebt hatte und daß sie mit der Trauerkunde keine tiefen, unheilbaren Wunden schlagen würde. Darum sparte sie sich eine lange Vorbereitung.
Sie öffnete stumm die Tür zu dem kleinen Empfangssalon und lud Susanne zum Eintreten ein. Als sie allein waren, sagte Gräfin Thea mit tonloser Stimme:
»Joachim ist diese Nacht gestorben.«
Susanne zuckte zusammen und verfärbte sich ein wenig.
»Tot – Joachim tot – nein, das kann ja nicht sein«, stammelte sie.
Die alte Dame berichtete kurz, sich mühsam die Worte abzwingend, was geschehen war.
Susanne war in einen Sessel gesunken und starrte betroffen in das grausam veränderte Gesicht ihrer Schwiegermutter. In diese Züge hatte das Leid Runen gezeichnet. Gräfin Thea war bisher eine stattliche Frau gewesen, der man nicht anmerkte, daß sie am Ende der Fünfzig stand. Diese eine Nacht hatte sie um Jahre altern lassen. Als sie zu Ende war mit ihrem Bericht, seufzte Susanne auf.
»Wie furchtbar – wie entsetzlich, Mama!«
Ein paar Tränen rannen über ihre Wangen. Sie trocknete sie umständlich mit dem feinen Spitzentuch.