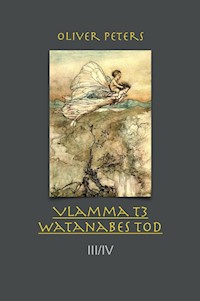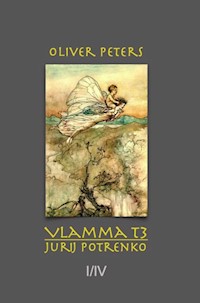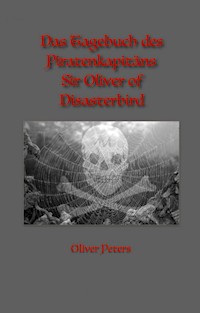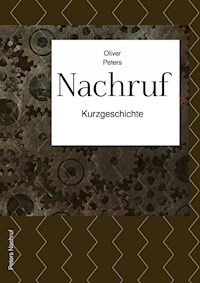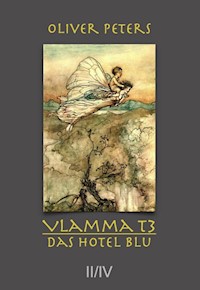
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Fluch. Die glücklose Fee Hagen Finwe ist seit 1978 an den Wünschen eines Kindes gebunden, das ihm das Leben rettete. Seitdem tüftelt er an einem Rennmotor. Die quadrologie »Vlamma T3« gibt Einblick, welche Auswir-kungen die unglückliche Entwicklung für Mensch und Fabelwesen hat. Wie zum Beispiel für Angelo, dem alten Nachtportier des Hotel Blu. Ein später Gast konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit, vor der er als junger Mann aus Italien floh. Die Quadrologie Vlamma T3 erzählt die Geschichte der Grauen Fee, deren Märchen beispiellos an der menschlichen Natur scheitert. Teil 1: Jurij Potrenko : Teil 2: Das Hotel Blu : Teil 3: Watanabes Tod : Teil 4: Sonntag das Rennen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vlamma T3 II
Das Hotel Blu
Oliver Peters
Überarbeitete und erweiterte Fassung
Covergetaltung: Oliver Peters Coverbild: Arthur Rackham: A Midsummer Night’s Dream – 1908 (Public Domain)
Zierstreifen Rücken Softcoverausgabe: Ausschnitt aus: Wolgemut: Tanz der Gerippe - 1493 (Public Domain)
Impressum
© 2021 Oliver Peters
Erste Auflage 2015
Druck und Verlag: epubli GmbH Berlin,
www.epubli.de
Hardcover: ISBN: 978-3-754935-04-0
Softcover: ISBN: 978-3-754935-09-5
E-Book: ISBN: 978-3-754935-72-9
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Manuela, Brian und Cati
»Sie werden, Herr Landvermesser, das sehe ich wohl, manche Phantasien aufgeben müssen, ehe Sie ein brauchbarer Schuldiener werden.«
Franz Kafka: Das Schloss (Siebentes Kapitel)
Einleitung
Das vorliegende Buch »Das Hotel Blu« stellt den zweiten Teil der Quadrologie Vlamma T3 dar. Die vorherige Ausgabe »Jurij Potrenko« (Bd. 1) führt in die Geschichte ein.
Für die Leser, die (noch) nicht die Zeit hatten, so weit voranzukommen, erleichtert eine kurze Übersicht den Zugang zur Erzählung.
Im Jahr 2012 wäre um ein Haar die Welt untergegangen. Wie das passieren konnte und warum Sie und ich so wenig davon wissen, wird dadurch aufgeschlüsselt, dass wir in Vlamma T3 nicht nur einen Zugang zur Welt, wie wir sie kennen, angeboten bekommen. Es wird darüber hinaus die Tür zur Pan Fabula geöffnet. Jenes hintergründig existierende Paralleluniversum der Geisterwesen wie Feen, Kobolde und Elfen, die sich im Regelfall nicht in unserem Alltag zeigen. Wenngleich manches Klopfen der Heizung oder Computerproblem in Vlamma T3 eine Erklärung findet.
Beide Welten treiben schon 600 Jahren auseinander und besonders die Menschen haben gelernt, ohne die andere Seite auszukommen – gleichwohl es noch immer unsichtbare Beziehungen gibt.
Trotzdem dieser Drift Dramatik genug verspricht, geht die Quadrologie von Vlamma T3 darauf nur am Rande ein. Es wird auf das Jahr 2012 ein Schlaglicht gesetzt. Ein Zeitpunkt, an dem es zu einer jähen – von einer Verkettung von Unglücken gekennzeichneten – Überschneidung beider Welten kam. Vor 600 Jahren hätte man dieses Crossover normal gefunden, aber 2012 führte es fast in eine Katastrophe.
Eine der unsichtbaren Verbindungen zwischen den Welten ist, dass Feen nur dann geboren werden, wenn zwei Menschen sich lieben. Und ihre Liebe muss über ein Jahr Bestand haben, damit die Fee zur Lebensfähigkeit heranreift. Verflacht das Gefühl oder, wie in unserem Fall, verstirbt ein Partner, ist auch die Fee verurteilt, ihr Leben abzuschließen. So legte sich 1978 Hagen Finwe zum Sterben in einen Busch, weil Aloys Stegmeyer, der Barbara liebte, auf dem Kriegsschiff Westerholt bei einer Detonation ums Leben kam. Doch der junge Angus Hold rettete die Fee und päppelte sie zu Hause auf.
Was sich wie eine Heldentat liest, führte zu einem Bruch im Selbstverständnis beider Welten. Fortan war Hagen am Leben, obschon er hätte tot sein sollen, was deprimierend genug für eine Fee ist. Durch einen der drei Wünsche des Jungen aber, Rennweltmeister der Formula Alpha zu werden, war er zudem von 1978 an bis 2012 verurteilt, an der Karriere von Angus mitzuwirken, bis er endlich frei sein würde.
Hierfür brauchte es zum Beispiel einen Rennmotor, den Hagen Finwe mit dem skandalösen Wissenschaftler Prof. Dr. Lambert Flammershausen entwickelte. Das Aggregat ist der Kern des Problems, denn der Motor besteht zu einer Hälfte aus naturwissenschaftlichen Elementen, zu einer geheimnisvollen zweiten Hälfte aber aus magischen Kräften der Pan Fabula.
Diese Mischung, ein übler Cocktail genannt, war nur durch den kurzfristigen Einsatz bei einem – aber dem entscheidenden – Rennen der Saison 2012 zu rechtfertigen. Der Motor unterlag der Kontrolle Hagen Finwes, dessen Magie sein enormes Potential bändigte. Was so lange gut ging, bis er seine Zauberkräfte durch Jurij Potrenko verlor und der Motor anfing, ein Eigenleben zu entwickeln.
Flankiert wurde der Verlust der Kontrolle über Vlamma T3 dadurch, dass der Thron der Pan Fabula aus unterschiedlichen Gründen in die Hand eines Menschen geriet. Dies unwahrscheinliche Szenario ist mit den komplizierten Regeln der Inthronisierung zu erklären, in die sich der Mafioso Jurij Potrenko verwickelt hatte. Zumindest ist es wichtig zu wissen, dass ihm die Ehre, König der Pan Fabula zu sein, unfreiwillig zuteilgeworden war.
Er ist ein Mensch, der weder die Regeln noch die Ordnung der Pan Fabula versteht. Die Überforderung Jurij Potrenkos zeigt sich in fast allen Belangen. Sowohl in Angelegenheiten der Pan Fabula sowie in seiner Rolle als Big Boss. Er verfällt nach und nach dem Wahnsinn.
Von großer Bedeutung ist sein Notizbuch, in dem er seine Verbrechen und seine Aufzeichnungen zur Pan Fabula festgehalten hatte. Ersteres Schriftgut ist für die Staatsanwaltschaft, zweiteres für den psychologischen Dienst von Bedeutung. So notwendig die Notizen für Potrenko waren, um sich in der Pan Fabula zu orientieren: Sie stellen das Material dar, welches jedem Richter helfen würde, den Russen wenn nicht für seine Verbrechen, doch aber auf Grund seiner seelischen Disposition aus dem Verkehr zu ziehen.
Der Bankangestellte Markus Pfeifenberger, dem das Bankgeschäft zu langweilig war, hatte das in einem Schließfach aufbewahrte Dokument dem Reporter Mehrbach »ausgeborgt«. Die Sache flog auf. Potrenko beginnt alles darauf anzusetzen, das Notizbuch zurückzubekommen. Mehrbach liegt seit Monaten mit Knochenbrüchen in einem französischen Krankenhaus. So spitzt sich die Situation zu.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Stück für Stück, durch Rückblenden auf 1978, den stillen, alltäglichen Kämpfen der Menschen, den Reaktionen in der Pan Fabula und die Perspektive der Polizei wird das sich abzeichnende Unglück zusammengesetzt – das im Hotel Blu einen bedeutsamen Zwischenschritt erfährt.
Dashiell Sun
PO box 733
Los Angeles
Ostfriesland
Bensersiel, 1977
Sie nannten es das Mallorca der Revierarbeiter – die Küste Ostfrieslands, beworben mit dem Slogan Südliche Nordsee. Nicht nur die Bergarbeiter strömten sommers an die Küstenstreifen, um die Dunkelheit und Gefahr, den Lärm und Dreck des Schachts gegen die Weite der See, die Gemächlichkeit der Tiden, den Wind, das Schweigen des Watts zu tauschen. ...
»… Auch uns, die wir aus einer dem Meer nahen Stadt kamen, zog es dorthin. Vater hatte jedes Jahr in Bensersiel die gleiche Ferienwohnung gemietet und war mit uns Kindern zur Hauptsaison hingefahren, bis mein Bruder und ich anfingen, andere Interessen zu entwickeln. 1977 beschloss die Familie, eine letzten gemeinsame Saison in dem Ferienort zu verleben – bevor ich ins Abitur ging und Wickel, mein Bruder, seinen Studienstart hatte. Die 68er waren vorbei, aber unsere Eltern wussten, es würde ihn verändern. Mehr, als die Zeit es ohnehin getan hätte.
Über die Jahre hatte er sich zu einem lupenreinen Hippie entwickelt: Lange Haare, bunte Klamotten, einen Dunst hinter sich herziehend, der im günstigen Fall Nikotin war. Natürlich Kriegsdienstverweigerer. Vater war enttäuscht.
Wir waren zunächst zu dritt in die Ferienwohnung gefahren, weil Wickel vor unserem gemeinsamen Urlaub in einem politischen Camp arbeitete. Er hatte versprochen, sofort nachzukommen – wir waren skeptisch, rechneten damit, dass er lediglich ein paar Tage vorbeischaute. Er würde dann bis zur vorzeitigen Abreise zu viel rauchen, sich womöglich Mädchen ausgucken und mit Vater in Streit zum Thema Politik geraten.
Ich genoss es, mit meinen Eltern am Meer zu sein. Es war friedlich, wenn man die gelegentlichen Düsenjets vom benachbarten Luftwaffenstützpunkt Manfred von Richthofen überhörte. Den ersten Teil des Tages verbrachten wir gewöhnlich zusammen bei einem langen Frühstück, Ausflügen, Einkäufen und den Vorbereitungen für ein Mittagessen. Einmal die Woche besuchten wir in ein Restaurant.
In der zweiten Hälfte des Tages verdrückte ich mich solo ans Meer, um zu lesen. Manchmal auch zur Attraktion am Standort: das modern gestaltete Wellenbad. Es stellte einen Gegensatz zum Rest der Strandanlage dar, die im Charme der 30er Jahre steckengeblieben war. Ich erinnere mich an den Strand, den Übergang vom gleißenden Licht des Sonne reflektierenden Sandes zum Meer, salzhaltige Luft, das Aroma von Algen und Sonnenmilch, die nach Klostein riechenden, kalten, dunklen Toiletten des alten Sanitär-Komplexes. Im Badeanzug war ich dem fragwürdigen Zustand der Betonmauern ungeschützt ausgeliefert. Kam ich von dort zurück, hatte ich den Drang, schnellstmöglich im Meer die in die Wände gefressenen Gerüche abzuwaschen, von denen ich glaubte, sie hätten sich auf mich übertragen.
Der Zustand der Duschen und des alten Freibads war vergleichbar. Hart und kalt wirkte der überall verbaute Stein. Die brüchigen Kacheln gemahnten mich meiner Verletzlichkeit. Bilder der KDF-Mädchen und HJ-Jungen auf Ausflug drängten hoch, deren Körper einst gestählt werden sollten.
Las ich, war das Meer für mich rau und rein. Später sammelte ich Bilder von den Ostseebadestränden, die mir nach dem Mauerfall in die Hände fielen. Bensersiel hatte eine andere Atmosphäre. Es herrschte nicht das 20er-Jahre-Feeling vor. Schon gar nicht, weil sie ein Hotelhochhaus namens Aquantis gebaut hatten, dessen kantiges, hoch aufragendes Grau jedes Flair altbackener Badekultur unter sich begrub. Kein weiß gestrichenes Holz, Leinen und Seil, flatterndes Tuch im Wind.
Das Wellenbad war sicherlich ein erster Versuch, dem überall vorherrschenden Beton etwas entgegenzustellen. Dort war alles hell, wirkte weich, hatte diesen grundlegenden Grünton aus den 70ern, der mit Orange und Gelb akzentuiert war. Sanft lief man auf gummierten Wegen. Die in Etagen am Fuße des Schwimmbeckens platzierten Bänke waren aus dunklem Holz, das in der Sonne Hitze auflud und nach einem kühlen Bad wärmte. Gedacht waren sie vielleicht für die Eltern, die ihre Kinder im Wasser beobachteten, aber sie waren bei allen beliebt. Man konnte von dort die Badenden, jung und alt, Boys and Girls, mit all ihren Facetten und Marotten im Auge behalten. Rechts lag der Innenbereich, den man vom Schwimmbecken außen durch einen schweren Plastikvorhang erreichte. Er war eng mit Inselchen und Sitzgelegenheiten gestaltet, zum Schwimmen blieb da wenig Platz.
Das ganze Wellenbad war angenehm, ließ jedoch die Leichtigkeit des Küstenlebens vermissen, von der meine Bücher über das Meer berichteten. Es versteckte sich ein Hauch von Massenbetrieb in seinen Ruheplätzen, seinen Wellen, seinem Rhythmus. Der Platz war künstlich und man dachte nicht daran, das zu verbergen.
Meine Eltern zogen den Natur-Strand weiter draußen vor oder machten Ausflüge. Das bewahrte für sie den ursprünglichen Charakter von Urlaub. Mit Picknick-Korb und Sand zwischen den Zähnen Schnittchen in der Hitze des Strandes kauen. Die Mayonnaise gefährlich warm.
Ich glaube, es gibt das Wellenbad immer noch. Sein damaliges modernes Ambiente ist sicher verloren gegangen. Heute mag man auf das Becken blicken wie wir damals auf die Anlagen aus den 30-er Jahren. Hauptattraktion aber wird, nach wie vor, der Wellenbetrieb sein. Über einen Lautsprecher am Aufsichtsturm angekündigt (Achtung: Wellenbetrieb!) und in den verschiedenen Abschnitten des Beckens unterschiedlich erlebbar. Am flachen Ende die auslaufenden Brecher wie Gischt, im Schwimmerbecken die hohen Wellen, die einen anhoben und fallen ließen. Dazwischen die Möglichkeit, zu stehen, um die Kraft des Wassers zu spüren.
Die Wiederholungen untergliederten den Nachmittag wie der Glockenschlag einer Kirchturmuhr. Ich sonnte mich auf der Wiese, mal auf den Holzbänken, und las. Nahm mir bei jedem Lautsprecherausruf die Freiheit zu entscheiden, ob ich den Wellengang mitnähme oder fortgesetzt faulenzte. Manchmal suchte ich den Kiosk auf, bis wir uns um 18 Uhr in der gemieteten Wohnung zum Abendessen zusammenfanden. Nichts bereite mich auf das vor, was noch passieren sollte.
Wir waren fünf Tage vor Ort. Ich kam nach dem letzten Wellenbetrieb aus dem Wasser, saß auf den Holzbänken, wickelte mich fröstelnd in ein übergroßes Tuch und genoss die Wärme des Holzes. Meine Augen brannten, trotzdem wollte ich lesen, vorher aber zum Kiosk, um mir ein Eis zu holen. Auf dem Weg sah ich dem Treiben im Becken zu. Fünf Jungs schwammen unvermittelt durch den Vorhang, der das Innenbecken vom Freiluftbecken trennte. Es gibt zwei Wege, ins Wasser zu gehen. Kalt Duschen und hinein, was Abhärtung verlangte, oder in die warme Brühe des Innenbereichs steigen, von wo man aus ins Freie schwamm, um ›langsam auf Temperatur‹ zu kommen. Die Jungen hatten die leichtere Variante gewählt.
Ich beobachtete sie, wie sie aus dem Schwimmerbereich hinten die Leitern am Beckenrand aufstiegen und auf den Startblöcken Startübungen vollzogen. Sie machten dabei jede Menge Faxen, der Bademeister wurde auf sie aufmerksam. Einer hatte rote Haare, er fiel mir auf. Er schien was zu sagen zu haben und war ernsthaft bei der Sache. Mein Eis in der Faust war geschmolzen. Ich erschrak, nachdem es auf die Haut tropfte, und leckte die Hand. Er war verschwunden, bevor ich wieder aufblickte.
An meinem Platz merkte ich, dass die Konzentration fürs Lesen futsch war. Ständig schaute ich auf und suchte nach dem Rothaarigen. Ich entdeckte ihn wieder, er war erneut am Springen. Um ihn besser im Auge zu behalten, setzte ich mich hoch. Ich trug einen großen roten Strohhut gegen die Sonne. Es war nicht möglich, das zu übersehen. Doch es wurden die falschen Typen aufmerksam. Seine Freunde zeigten auf einmal Interesse und gesellten sich zu mir. Obwohl ich abweisend war, blieben sie hartnäckig.
Immerhin, auf diese Weise erfuhr ich, dass die fünf Jungen zu einer Gruppe des hiesigen Sportvereins gehörten, der für einen Wettkampf in ein paar Tagen in Aurich trainierte. Hoffnungsträger auf den Sieg war Aloys Stegmeyer. Er bereitete sich gewissenhaft vor und blieb von der neuen Interessenslage seiner Gruppe für Mädchen unbeeindruckt. Am Ende war er allein bei der Einübung des Sprungs. Er wiederholte seine Übungen vom Startblock viermal, da verließ ich entnervt die Bewerber an meiner Seite und schloss an die Schlange vor dem Kiosk an. Ich hoffte, sie so abzuschütteln. Was war mit mir los, mich ihnen für ein paar nutzlose Informationen auszusetzen? Der Springteufel von Bensersiel würde mir ohnehin kaum seine Aufmerksamkeit schenken, so ehrgeizig, wie er immer wieder ins Wasser sprang. Selbst wenn, damit war längst nicht klar, dass ich ihm Zeit widmete.
Nach einem weiteren Eis, eines mit Schokolade, hatte ich vor, mich endlich meinem Buch zu widmen. In der Schlange schaute ich wieder zu den Startblöcken. Aloys Stegmeyer war nicht mehr auszumachen. Der Springteufel hatte ausgesprungen. Womöglich eine Pause eingelegt. Ich fing an, ärgerlich darüber zu werden, vertrieben worden zu sein. Dann tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Ich drehte mich um und sah ihm direkt ins Gesicht.
Es war eigenartig, ihm unvermittelt gegenüber zu stehen. Vor einer Stunde kannte ich ihn nicht, jetzt löste seine Gegenwart deutlich Gefühle bei mir aus. Eine Mischung aus Erschrecken und Freude. Ich erinnere mich, er grinste frech und sah, allein mit Badehose gekleidet, keck aus. Er hatte Sommersprossen und war, na ja, gut entwickelt. ›Schönen Hut hast du auf‹, sagte er und vertiefte meine Verlegenheit.
›Danke‹, erwiderte ich. ›Er hilft gegen die Sonne. Du solltest auch was tragen, sonst holst du dir Verbrennungen.‹ Er lachte und schüttelte den Kopf. ›Keine Sorge, ich habe mich eingecremt‹. Ich stand unter Druck. Mir fiel beim besten Willen nichts ein, das ich erwidern könnte und war außerdem gleich mit meiner Bestellung dran. Es war ein Moment, von dem du ahnst: Packt man ihn nicht mit beiden Händen, hat das weitreichende Folgen. Es bestand zum Beispiel die Gefahr, uns wieder aus den Augen zu verlieren. Rechtzeitig fiel mir ein, was die Recherchen bei seinen Freunden erbracht hatten und ich sprach ihn auf den Wettbewerb an. Seltsam, wie schnell Menschen zueinanderfinden, die zusammenpassen. Ich hörte zu, wie er redete, besah seinen Gesichtsausdruck und bewunderte seine Körperhaltung, bis ich merkte, wie meine Hand klebrig wurde.
›Sieht so aus, als wäre dein Eis geschmolzen.‹
›Ja, richtig. Das passiert mir immer häufiger.‹
›Macht ja nichts, ich kaufe dir ein neues. Noch einmal Schokolade?‹
Das rührte mich. Er lud mich ein. Ich mochte es nicht glauben, aber er war beeindruckend. Wir setzten uns auf die Holzbänke und ich erzählte von meinen Freizeitplänen der nächsten Tage. Um ehrlich zu sein, es war kein üppiges Programm. Dann verließ er mich. Ich hatte den unauslöschlichen Eindruck, verliebt zu sein – und ihn enttäuscht zu haben. Wütend packte ich meine Sachen ein, um zu unserer Ferienwohnung zurückzugehen.
Wickel war Gesprächsthema, der sein Kommen erwartungsgemäß um ein paar Tage verschoben hatte und damit Vaters Unverständnis hervorrief. Ich zog mich schnell zurück und war, nach einem langweiligen Abend, nachts die einsamste Frau der Welt. Ich hörte durch das geöffnete Fenster das Meer, Möwen kreischen, das Rauschen der Bäume und mitunter Stimmen von Nachtschwärmern. Ich hoffte, die Jungen zu hören, die zufällig vorbeikämen. Hätte ich die Kumpels von Aloys gehört, war es möglicherweise ein Fingerzeig, dass er meine Nähe suchte. Was würde ich dann tun? Ich hatte mich noch nie heimlich hinausgestohlen. Über diese Gefühle von Einsamkeit und Sehnsucht schlief ich ein.
Meine erste große Liebe. Es schien gleich ein Desaster zu werden. Mir war, dass ich ihm nicht ein zweites Mal begegnen würde, und war unglücklich. Die Gefühle der Menschen liegen nahe beieinander. Glück und Tragödie, sie trennt lediglich eine Sekunde, ein Wort oder eine Geste. Und nicht nur bei Teenagern.
Am nächsten Tag mied ich das Wellenbad. Ohne zu wissen, warum. Schätzungsweise aus Angst vor einer Enttäuschung. Die Stunden, die ich mit meinen Eltern verbrachte, waren von Vaters monologischem Thema zu Wickels fragwürdigen Zukunft bestimmt. Mutter betüdelte mich wortlos. Womöglich aus einem Instinkt heraus, der sich bei ihr im Angesicht einer leidenden Tochter offenbarte. Oder der sich trauernd auf ein verbliebenes Kind richtet, wenn sie ein anderes zu verlieren drohte. Mir war es recht, ich brauchte ihre Nähe. Und wir entflohen so stumm Vaters Erzählstrom, der das brotlose Ende meines Bruders im Gefängnis gegen die Möglichkeit abwog, dass Wickel irgendwann in der Zone oder unter einer Brücke vegetieren würde – was für ihn das Gleiche war.
Um ihn zu beruhigen und uns auf andere Gedanken zu bringen wurde beschlossen, den Tag gemeinsam zu verbringen. Mutters Erfahrungen, die sie mit ihrem Mann in ihren Ehejahren gemacht hatte, legten nahe, den etwas weiter entfernten Marinestützpunkt in Wilhelmshaven anzufahren. Vater hatte nicht in der Armee gedient, doch die Bundeswehr übte auf ihn etwas Beruhigendes aus. Wir hofften beide, seine Stimmung würde sich in der Gegenwart von U-Booten, Kreuzern oder Soldatenkneipen verbessern. Und so war es auch. Gegen Mittag war er bereits so gut gelaunt, dass er uns zu einem großzügigen Mittagessen bei Karstadt einlud und nicht wie sonst mit einem Imbiss zu sparen versuchte.
Wilhelmshaven ist eine schreckliche Stadt. Auf dem Reißbrett entstanden, die Straßen kilometerweit wie ein Strich, alles in Quarre gebaut. Das Aquarium ist spannend. Ich war in Gedanken im Wellenbad und kam auf die Idee, dass mein Fernbleiben dort etwas Gutes hätte. Sollte sich Aloys doch nach mir strecken. Das Mädchen mit dem roten Strohhut suchen. Derweil sorgte mich, dass der kasernenhafte Charakter der Stadt auf meinen Vater diese positive Wirkung zeigte.
Wir waren um fünf Uhr zurück in Bensersiel und ich besuchte nach dem Abendessen einen Töpferkurs. Es war mehr eine leichte handwerkliche Übung, die in den neuen, dem Wellenbad zugeordneten Gebäuden am Strand, stattfand. Das Haus Kunterbunt, eine Kombination aus Aufenthaltsräumen mit Spielzeug, Spielautomaten und abgelegenen Werkstätten. Nicht wirklich Töpfern war im Angebot. In fertige Formen konnte man Ton pressen und die so gewonnene Skulptur brennen und lackieren lassen.
Es hatte zu regnen angefangen und der Kurs war gut besucht. Gerade starteten wir, da öffnete sich die Tür und Aloys Stegmeyer betrat den Raum. Er grinste frech, entschuldigte sich und fand neben mir Platz. Genau genommen drängelte er sich zu mir. Es war für mich aus einem damals nicht begreiflichen Grund eine Katastrophe. Er zwinkerte mir zu. Wir begannen mit der Arbeit.
Den simplen Fertigkeiten mit dem Ton nachzukommen bereitete mir größte Mühe. Aloys hatte sich gleich gemeldet und gefragt, ob er etwas Eigenes herstellen dürfe, ohne eine Form zu nutzen. Er bekam freie Hand. So malträtierte er seine Tonmasse und raunte mir nach einer Weile zu, dass ich ihn gestern neugierig gemacht hätte, als ich von dem Töpferkurs erzählte. Und er fragte, warum ich nicht im Wellenbad war. Ich sprach leise von dem Familienausflug und mied seinen Blick. Er nickte zufrieden.
›Wilhelmshaven kenne ich gut. Werde dort bei der Marine einrücken. In ein paar Tagen geht das los.‹
›Wirst du zur See fahren?‹
›Aber ja, ich hoffe doch. Will auf ein Schiff. Bei der Marine werde ich viel lernen, dann kann man im Anschluss der Dienstzeit gucken, wie es weitergeht.‹
›Mach’ demnächst Abitur. Keine Ahnung, was danach wird.‹ In meinen Augen klang das besser als die Freizeitplanung vom Vortag. Eine gemeinsame Angst vor der Zukunft, das schuf Nähe.
Mich beschäftigte der Abdruck einer Bachbüste, die ich immer noch besitze. Aloys kreierte eine Skulptur, von der keiner zu sagen vermochte, was sie darstellte. Ich fragte ihn, da musste er zugeben, dass er es ebenfalls nicht wüsste. Aber so, wie er es arrangiert hätte, würde es nicht auseinanderfallen. Ich lachte. Der Regen trommelte auf dem Wellblech der Werkstatt und unsere Hände waren schmutzig vom Ton.
Er begleitete mich später zurück zu unserer Wohnung und zeigte Manieren. Vater sah kurz durchs Fenster. Wilhelmshaven hatte ihn in Balance zurückgebracht. Er stellte keine Fragen, schaute aber penetrant wissend. Ich beeilte mich, ohne Kommentierung der Begleitung ins Bett zu gehen.
Aloys und ich hatten seitdem schöne Momente miteinander. Wir trafen uns nachmittags im Wellenbad, wo er für seinen Wettkampf übte und zwischendurch Zeit mit mir verbrachte. Und die Skulptur hatte er mir gleich, nachdem sie gebrannt war, geschenkt.
Zwei Tage später der Kuss.
Dann war er weg zum Wettkampf. Ich blieb das erste Mal seit langer Zeit wieder allein auf dem Platz auf den Holzbänken und hatte Mühe, zu meinen Gewohnheiten zurückzukehren. Ich fand aber erneut keine Konzentration fürs Lesen. Ich vermochte auch nicht still in der Sonne zu liegen. Zuletzt versuchte ich einen Spaziergang am Deich, um über alles, was mit mir passierte, nachzudenken. Unstillbare Sehnsucht nach Aloys beherrschte mich. Und da war die Frage, ob eines Tages mehr geschehen würde als nur ein Kuss.
Ich kehrte am Abend spät zu meiner Familie zurück. Man roch es im Flur. Wickel war eingetroffen und hatte sich olfaktorisch verbreitet. Wahrscheinlich saß er in seinem Zimmer und rauchte, denn es war zu still für eine Begegnung mit meinen Eltern. Ich schaute nach ihnen und stellte fest, dass sie noch gar nicht vom Strand zurück waren. Dann klopfte ich bei meinem Bruder.
›Hallo Schwesterherz‹, rief er aus dem geschlossenen Raum. Keine Ahnung, wie er bemerkte, dass ich es war. Er zeigte sich in Bestform. Der Bart war weitere 10 Zentimeter länger, das Bad hatte er noch nicht gefunden und er rauchte ein französisches Indianerkraut, das, wie ich Wickel kannte, zurzeit in den dortigen Gefängnissen Furore machte. Er saß im Schneidersitz auf dem Bett, hatte eine Flasche Wein zwischen den Beinen und winkte mir entspannt zu. Wickel, wie er leibte und lebte. Wir nahmen uns herzlich in den Arm und nach dem ersten Begrüßungssturm gab er mir einen Schluck aus seiner Flasche ab. Wir unterhielten uns eine Weile, dann hörte ich meine Eltern zurückkommen.
›Gehen wir gemeinsam ’runter?‹
›Lass mal, ich will erstmal alleine und check’ die Lage. Du kannst ja später dazukommen, wenn der Alte ruhig bleibt.‹
Ich fasste ihn am Arm. Auf dem Deich, da ging mir durch den Kopf, kein Kind mehr zu sein. Mama, Papa, Wickels Streit, das hatte alles eine neue Bedeutung. Und ich fühlte mich nicht wie die kleine Schwester, die Deckung suchte bei den Streitigkeiten, sondern die etwas zu sagen hatte.
›Versuch’ Papa nicht auf die Palme zu bringen. Es ist unser letzter Urlaub.‹
Wickel schaute amüsiert.
›Meine kleine Schwester. Du hast dich verändert.‹
Ich lachte trotz allem verschämt und dachte, er hatte mich ertappt.
›Vielleicht.‹
Er flüsterte mir zu: ›Alles verändert sich, nur Papa nicht.‹ Wir lachten und ich gab Wickel einen Schmatz auf die Wange. Vielleicht nur, um den Unterschied zu einem Kuss mit Aloys herauszufinden. Oder weil mir einfach danach war. Zuletzt hatte ich meinen Bruder vor Jahren geküsst.
An dem Abend blieb es friedlich, aber man hörte aus der Küche ernsthaftes Gespräch. Ich entschied, sie reden zulassen. In meinen Gedanken war ich ohnehin beim nächsten Tag im Wellenbad.
Am folgenden Morgen begegnete ich Wickel nach dem Aufstehen und wir beschlossen, gemeinsam Brötchen zu holen. Unterwegs erzählte er von dem Abend. Vater und er hätten alles für sein Studium besprochen, insbesondere Unterhaltsfragen. Mein Bruder war aufgeregt und ich freute mich total für ihn. Es war klar, dass Papa seinen Weg nicht guthieß. Aber seine stille Zustimmung machte Wickel gelöster im Vergleich zu den Wochen zuvor. Ich überlegte, Vater das Modell eines Kriegsschiffs ins Arbeitszimmer zu stellen, falls dieser Friedensschluss die Auswirkungen von Wilhelmshaven war. Es gab da eins der Bismarck, das war zwei Meter lang.
Die Gedanken trieben zu Aloys ab. Ich fragte mich, ob er auf so einem Schiff dienen würde. Mit meinem Wissen über die Marine war es nicht weit her.
Nach dem Mittagessen nahm ich den Strohhut, verabschiedete mich an der Haustür von Wickel und marschierte ins Wellenbad. Aloys war nicht da, woraufhin ich wieder versuchte, zu lesen und die Sonne zu genießen: vergebens.
In der Schlange des Kiosks behielt ich den Hut auf, um gleich erkannt zu werden, falls er nach mir Ausschau hielt. Mein suchender Blick streifte die Startblöcke, an denen heute niemand übte, da tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Das Herz hüpfte bis zum Hals. Ich drehte mich schnell um, sah aber nicht in Aloys Sommersprossengesicht. Es war Fritz, sein Kumpel aus der Schwimmstaffel, zusammen mit den drei Halunken, die mich schon einmal gemeinsam belauert hatten. Ich war enttäuscht: ›Ist Aloys nicht mit?‹
Fritz schüttelte düster seinen Kopf und schwieg. Mir fiel sofort auf, wie unhöflich ich war.
›Und, wie habt ihr gestern abgeschnitten.‹
›Erster Platz beim Wettbewerb. Zweiter bei den Frauen, sage ich mal.‹
Die anderen lachten hämisch, ich war verunsichert.
›Was heißt das?‹
Sie drucksten herum.
›’Raus mit der Sprache‹, rief ich.
›Mal von Freund zu Freund. Wenn du auf Aloys wartest, dann verschwendest du deine Zeit, denn er hat sich ’ne Neue geangelt. Hatte er gleich in 10 Minuten, nachdem DU dir einen Typen angelacht hast. Ganz problemlos.‹
Ich fragte ungläubig zurück: ›Aloys hat eine Andere?‹
Sie nickten kurz, dann setzten sie sich ab. Offenbar war man nicht für Eis gekommen, sondern um die Nachricht zu platzieren.
Ich wartete zwei Kunden vor mir ab, um zu merken, dass auch ich nicht mehr für Eis anstand. Ich stand für nichts mehr an. Entgeistert verließ ich das Bad, schlich nach Hause und schloss mich ins Zimmer ein. Im Verlauf des Nachmittags weinte ich erst, dann setze eine Paralyse ein.
Gegen Abend kamen meine Eltern nach Hause. Mutter setzte sich zu mir, aber ich konnte nicht erzählen. Sie wunderte sich über die zerbrochene Tonstatue in der Ecke hinter der Tür, deren Aufprall an der Wand etwas Tapete gelöst hatte. Später rief Vater nach ihr und sie ließ mich allein. Wieder war ich die einsamste Frau der Welt. Nachdem Mama fortging, merkte ich, wie wichtig mir ihre Nähe war. Wie sich mein Gefühl des Erwachsenwerdens und alles Schöne auf der Welt zerbrechlich zeigte. Sie kehrte zurück und war noch sorgenvoller als vorhin.
›Wickel ist verprügelt worden.‹
›Was?‹
›Ein paar Rekruten. Oder solche, die es werden wollen. Papa hat ja gesagt, dass er eines Tages Ärger bekommt.‹
Mir stockte das Herz.
›Wo ist er?‹
›Unten, Papa versucht es mit Erster-Hilfe. Ich glaube nicht, dass ’was genäht werden muss. Wo auch. Das nächste Krankenhaus ist in Esens und der Weg dahin ist weit.‹
Ich schnellte aus meinem Bett, trat noch einmal zum Erstaunen von Mama gegen die Statue und rannte herunter. Sie waren im Bad. Wickel nervte sichtbar das Verarzten mit einer undefinierbaren Trias von väterlicher Sorge, männlicher Rachefantasie und politischer Rechthaberei durch den Familienvorstand. Er blieb stumm und spuckte Blut ins Waschbecken. Ich fasste ihn am Arm und prüfte ein geschwollenes Gesicht.
›Du siehst furchtbar aus.‹
Er nickte. Der ironische Kommentar, den er sonst gebracht hätte, blieb ihm an diesem Abend im Hals stecken.
›Ich habe eine Frage. Waren die zu fünft?‹
Er bejahte.
›War da ein Rothaariger bei?‹
Wieder Zustimmung, diesmal schaute er mich fragend an.
Ich hatte keine Zeit für Erklärungen. Vaters Versuch, mehr von mir zu erfahren, war erfolglos. Ich stieß: ›Na warte, du Schwein!‹ aus, und war vor der Tür.
›Wohin gehst du denn?‹, rief Mama mir nach, aber meine kurze Erwachsenenzeit hatte mich hart gemacht. Ich spürte Zorn. Zorn darüber, von Aloys hintergangen worden zu sein, über die Enttäuschung, wie er es mir mitgeteilt hatte. Zorn darüber, dass Wickel für mich blutete. Mein Bruder, der seit Wochen das erste Mal wieder in die Familie passte, an unserem letzten gemeinsamen Urlaub.
Mir ist nicht klar, wie ich die Bande fand. Aloys hatte mir vermutlich von ihrem Treffpunkt erzählt. Eine Bank hinter dem Parkplatz der Hafenbesucher, in erreichbarer Nähe zum Kiosk vom Hotel Aquantis, um sich mit Bier zu versorgen. Als ich auf sie zukam, stupste Fritz, der so etwas wie den ersten Offizier in der Gruppe darstellte, Aloys in die Seite und wies auf mich. Man hatte einiges an Bier getrunken und war entsprechend mutig. ›Oh la la, die Schlampe ist da‹, riefen sie. ›Was mag sie wollen?‹ ›Ob sie schon wieder einen Neuen hat?‹
Aloys schüttelte lachend den Kopf.
›Ihr hirnverbrannten Trottel, was sollte das?‹, schrie ich die erbärmliche Truppe an.
›Hey, langsam Mädchen‹, unkten sie und kicherten. Ich riss einem von ihnen die Bierflasche aus der Hand und schleuderte sie weg. Das Glas zersplitterte an einem Findling, womit wir die Aufmerksamkeit der Passanten hatten. Sicher der Grund, weswegen sie sich nicht wehrten. Oder ich hatte sie einfach überrumpelt. Und zuletzt ist ja bekannt, dass, wenn die Bierquelle erst versiegt, der Mut der Menschen ins Unermessliche fällt. Ich war, zugegeben, erschrocken über mich. ›Von wegen langsam‹, brüllte ich, um etwas zu sagen. ›Ihr verdammten Schläger. Na los, bekomme ich von euch auch Prügel? Na, was ist? Oder überfallt ihr nur wehrlose Menschen von hinten. In Überzahl. Bei Nacht. Was?‹
Fritz war der Erste, der seine Überraschung in den Griff bekam und nahe an mich herantrat. Sein Atem roch nach Bier und Zigaretten, so dass ich angeekelt das Gesicht verzog.
›Ist das ein Angebot, Mieze? Hast du deinen Stecher von heute schon abgeschossen und suchst Ersatz?‹
›WAS?‹
Aloys schob ihn sachte beiseite.
›Schon gut, Fritz. Ist doch mal ’was, dass sie hergekommen ist. Da kann ich sie mal direkt etwas fragen.‹
Der erste Offizier gesellte sich zu seinen Trinkkumpanen, die dem Anführer die Angelegenheit überließen und in einem der Rucksäcke nach Ersatz für die verlorengegangene Flasche suchten.
Noch bevor Aloys zu seiner Frage ansetzte, veränderte ein stoppender Polizeiwagen die Situation. Die Bierflaschen verschwanden wieder im Tornister, Aloys versteckte seine hinter dem Rücken, wir wandten uns dem aussteigenden Beamten zu und schwiegen. Der zweite Polizist blieb im Wagen und bediente das Funkgerät. Sie hatten zufällig gesehen, wie die Bierflasche zerschellt war.
Der etwas dickliche, ca. 1,70 Meter große Schutzmann setze seine Mütze auf, schaute sich die Beteiligten an und stützte die Fäuste auf den Hüften. Sein Gesichtsausdruck zeigte, er war gerade einem höchst unappetitlichen Vorgang begegnet. Etwa in der Kategorie eines verwesenden Kadavers an der Straße, der entsorgt werden musste. Oder eines Betrunkenen, den es nach Hause zu schaffen galt. Dinge, mit denen man sich ungern auseinandersetzte.
›Hallo Herr Wachtmeister‹, setzte Aloys nervös an. ›Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben hier alles im Griff.‹
Der Polizist holte Luft, um etwas zu entgegnen, doch ich konnte nicht an mich halten.
›Wie kannst du behaupten, du hast alles im Griff? Sagen Sie ihm, er hat GAR NICHTS im Griff. Er behandelt Frauen wie Abfall und versteckt sich hinter seiner Räuberbande, wenn es ernst wird. Am besten, Sie nehmen ihn fest wegen, wegen ...‹
›Ja?‹, fragte Aloys aufgebracht. ›Weswegen denn? Weil er der Lady sagt, dass man Menschen nicht einsammelt und wieder fallen lässt, wie man es offenbar in der Stadt gewohnt ist?‹
›Ach, das sagt der Richtige. Wer hat denn von einem Tag auf den anderen ein neues Mädchen und am Abend vorher noch alles Mögliche versprochen?‹
›Ja, wer?‹, antwortete Aloys. ›Fragen Sie sie mal, Herr Wachtmeister, ob man nicht eher mal Tussis wie sie ins Kittchen bringen soll!‹
Der Uniformierte setze erneut an, die Stimme zu erheben. Doch er kam nicht weit.
›Tussi? Ich? Fragen Sie den Herrn mal, ob er grundsätzlich die Frauen ins Kittchen bringen will, die seine jämmerliche Maskerade als Gigolo durchschaut haben und zur Rede stellen. Aber so läuft das nicht.‹
Der Polizist schüttelte den Kopf. Er glaubte auch nicht, dass das so liefe.
›Aber mit mir glaubst du ja, so umgehen zu können, Aloys Stegmeyer. Haben Sie den Namen? Stegmeyer heißt er. Und er hat eine Tendenz, Kriegsheld werden zu wollen. Erster Schritt: Kriegsdienstverweigerer verprügeln, bis man auf eines dieser todbringenden Schiffe kommt und die Sache professionell angeht.‹
Nun zückte der Wachtmeister sein Notizbuch und suchte nach einem Bleistift. Er wollte sich den Namen von Aloys notieren.
›Was ist los?‹, schrie Aloys. ›Ich verprügele keine Kriegsdienstverweigerer. Die sind mir scheißegal. Aber wenn du denkst, in meiner Stadt läuft dein Freier herum und muss nicht mit einem deutlichen Echo rechnen, nachdem er mir das Mädchen ausgespannt hat, dann hast du dich geschnitten.‹
›Freier? Spinnst du? Wir reden hier von Wickel. Wickel ist mein Bruder, du Perversling. Bruder, verstehst du? Wenn du denkst, wir haben etwas miteinander, dann tickst du nicht sauber!‹
›Heilige Scheiße‹, sagte Fritz und ließ den Rucksack fallen. Aus seinem Inneren klirrte es leicht. Der Polizist sah aufmerksam zu ihm herüber.
›Dein Bruder?‹
›Was dachtest du denn?‹
Aloys schaute zum Wachtmeister, der mit erhobenen Augenbrauen zurückblickte.
›Das wusste ich nicht‹, flüsterte er. ›Meinte, sie hätte sich einen Neuen angelacht.‹
Als ob nun ein sensibles Thema angeschnitten worden wäre, rieb sich der Polizeibeamte mit einer Hand die Wange und spitzte den Mund. Dann sah er mit zurückgeschobener Mütze zu mir.
›Du dachtest, Wickel sei mein Freund?‹
Aloys wandte sich hilflos zu seinen Kameraden um, die verlegen die Schultern zuckten. Aus dem Rucksack leckte Flüssigkeit.
›Das wussten wir doch nicht, Aloys‹, versuchte Fritz zu erklären.
›Hört doch auf. Herr Wachtmeister, ich weiß genau, was gelaufen ist. Dieser Matrose hat beim Wettkampf eine Badenixe kennengelernt und dann mit großer Freude seinen politischen Gegner in Gestalt meines Bruders, der nicht zur Bundeswehr geht, aufgemischt. Ich kenne solche Leute. Weiß, wie Menschen wie er über Zivis reden. Sie scheißen auf sie, so wie mein Vater. Die Sprüche sind mir vertraut. Aber es ist ein Unterschied, wenn man sie verprügelt.‹
›Herr Wachtmeister. Bitte‹. Aloys wirkte reumütig. ›Sagen Sie ihr, ich dachte, er sei ihr Freund. Mir ist piepe, ob er Kriegsdienstverweigerer ist. Total piepe. Es geht doch um sie.‹
Der Beamte sah wieder zu mir. Mein Zorn war verraucht. Leiser, ja vielleicht etwas weinerlich erwiderte ich:
›Aber ich war so sicher. Es hat sich genauso angefühlt, wie ich es von Papa kenne. Er ist so ein toller Vater, aber wenn er über Zivildienstleistende spricht, dann ist er voller Hass. Redet davon, ihnen den Hals umzudrehen. Und jetzt, Herr Wachtmeister, kommt Wickel nach Hause, verprügelt, gedemütigt, da muss man doch glauben, Aloys denkt genauso.‹
Wir schwiegen. Der Polizist setzte erneut an, zu sprechen, doch er schien vergessen zu haben, was. Gedankenverloren wandte sich Aloys an seine Freunde.
›Fritz. Sei so freundlich und räume mal die Glassplitter weg. Ich glaube, wir haben Mist gebaut.‹
Der Polizist nickte und steckte seinen Notizblock ein. Er tippte an die Mütze, um sich wortlos zu verabschieden.
›Danke‹, sagten wir gemeinsam, bevor er die Tür zu seinem Käfer zuschlug. Im Wagen fragte sein Kollege ihn, was passiert war. Er winkte ab und fuhr schnell davon.
›Ich dachte wirklich, ... !‹, stammelte Aloys, um den Gesprächsfaden aufzunehmen.
›Wieso denn?‹
›Meinte, du hast einen Neuen, weil, ich war ..., ja, ich war enttäuscht, bin nicht ins Wellenbad gegangen. Die Jungs haben mir erzählt, sie haben dich angezählt und du hättest dich dumm gestellt. Dann haben wir den Kerl, deinen Bruder, zufällig auf der Straße gesehen und es ist passiert. Er kann übrigens schlecht bei Diskussionen nachgeben.‹
›Das ist wahr.‹
Wir schwiegen. Mir schwirrten die Fakten durch den Kopf und ich wirkte, so wie ich dastand, wahrscheinlich ein stückweit dämlich. Mit der Situation war nur schwer umzugehen. Um genau zu sein: Ich konnte mich nicht entscheiden, Aloys entweder zu verzeihen, meinen Eltern davon zu erzählen oder Schluss zu machen. Und wie mit Wickel umgehen?
Knapp eine Woche später waren es nur noch wenige Tage bis zu Aloys Einberufung und meiner Familie blieb kaum mehr Zeit in Bensersiel. Aloys zu verzeihen war besonders wegen Wickel schwierig. Er war nicht schwer verletzt, aber verbrachte die ersten Tage nur zuhause. Ich kann sagen, dass Aloys seit dem Streit auf dem Parkplatz alles versuchte, um wieder an das Vorherige anzuknüpfen. Er stand vor dem Haus, er schrieb Briefe, er brachte mir Eis zu meinem Platz auf den Holzbänken. Ja, ich war nach zwei Tagen wieder ins Wellenbad gegangen. Nachdem Wickel wieder in der Lage war, das Haus zu verlassen. Als Aloys mir das Eis brachte, wirkte das so absurd, dass ich ihn ohne viel Aufhebens abblitzen ließ, meine Sachen packte und fortlief.
Mir war, er zeigte die gleiche Zerrissenheit, die ich empfand. Diese Abscheu und die Liebe. Es war verwirrend für mich, dass Gefühle nicht nur schnell einander ablösten, sondern gleichzeitig nebeneinander wirken konnten. Ich wusste noch nicht, dass es ein weit verbreitetes Phänomen der Menschen ist, uneindeutig zu sein.
Na ja, dafür hatte Wickels Prügel den Zusammenhalt in der Familie gestärkt. ›Der äußere Feind‹, wie man sagt, vermag das ja. Ich genoss es, dass wir wie früher beim Essen zusammensaßen. Mutter kochte, Vater schwadronierte, Wickel versuchte, durch den geschwollenen Mund zu ätzen und Mutter wies ihn dann zurecht. Dennoch, es hatte etwas Falsches. Ich sah auf der Straße Aloys, außen vor, einen vermeintlichen Schläger, meine Liebe. Und warum erzählte ich nicht Wickel, dass da draußen vor unserem Haus der Täter stand, der Geliebte, die Enttäuschung? Ich war nicht fähig, den Knoten zu lösen. Immer häufiger verzog ich mich in mein Zimmer und wartete ab. Zum Essen kam ich herunter, schlich zum Lesen herauf, das sonnige Wetter war mir egal. Vater und Mutter hätten etwas bemerken müssen. Aber sie genossen die überraschende Nähe, die wir zueinander hatten. Wenn es auch mein gebrochenes Herz und Wickels zerbeultes Gesicht dazu brauchte. Das Glück ist manchmal schmerzhaft.
Und dann geschah ein Wunder. Etwas, was meine Möglichkeiten überstieg und auf das ich nicht zu hoffen gewagt hätte. Aloys klingelte an unserer Tür.
Vater öffnete und von der Treppe aus, oben, versteckt, hörte ich die Stimme meiner verunglückten Liebe. Es schellte ja nicht oft, da konnte man ja mal schauen, wer da was wollte. So bekam ich alles mit.
Aloys stand unten und mir war, dass ich am liebsten heruntergestürzt wäre. Ich rannte zurück ins Zimmer, zog mir Schuhe an, schaute schnell in den Spiegel, ordnete mein Haar und wartete auf Vaters Ruf. Erst geschah nichts, dann rief er – und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie mich das empörte, wie ich fluchte und zur Tür eilte, um zu hören, ob ich es richtig verstanden hatte: ›WICKEL! BESUCH FÜR DICH!‹
Der Gerufene quälte sich aus seinem verrauchten Zimmer, humpelte die Treppe herunter und sagte laut: ›Wer soll mich denn hier besuchen? Ist sie schön?‹, dann standen sie sich unten an der Tür gegenüber.
›DU?‹, fragte Wickel, bevor er die Tür von außen zuzog.
Erneut Lähmung. ›Was war das denn?‹, flüsterte ich, zog die Schuhe wieder aus und legte mich aufs Bett. Mit schoss durch den Kopf, es wäre das Beste, von allem nichts zu wissen. Dem folgte ein schlechtes Gewissen. Wickel in die Arme seines Schlägers laufen zu lassen, das war eigentlich unverantwortlich. Aber ich hätte auch schon viel früher ...
Ich lief die Treppe herunter und suchte Vater. Weinend brüllte ich ihn an: ›Er bringt Wickel um, tu doch was?‹
Papa schwärmte zwar von der Armee, aber er war nicht in einem Zustand, den man ›In Alarmbereitschaft‹ nennen konnte. Erst legte er seine Zeitung ordentlich zusammen, dann fragte er, wer wen umbringen würde. Er versuchte, mich beruhigend in den Arm zu nehmen, und ich trommelte ihn gegen seinen ebenfalls sehr unmilitärischen Bauch, bis er mich an den Armen festhielt und eindringlich anblickte.
›WER BRINGT WEN UM?‹
›ALOYS DEN WICKEL! ODER UMGEKEHRT. DRAUSSEN!‹
Er schritt zügig zur Tür und riss sie auf. Ich wollte nicht hinblicken und versteckte mein Gesicht an Mamas Schulter, die mich reflexartig am Kopf streichelte und gewohnheitsgemäß staunend den Mund geöffnet hatte. Es war ihr in all den Jahren nie gelungen, die plötzlichen emotionalen Ausbrüche in unserer Familie einzuordnen. Ich erwartete Papas Eingriff in den Kampf, hörte aber nichts. Mamas Hand fuhr sanft über meinen Kopf, der Wind fächelte durch die offene Tür um die nackten Beine. Die Zeit verstrich. Dann, weil längst etwas hätte passieren müssen, schaute ich vorsichtig zur Tür. Papa stand mit der Klinke in der linken Hand da und betrachtete mich fragend. Er hatte sich mit einem Regenschirm bewaffnet, den er in der Rechten hielt. Auf den Stufen zu unserer Haustür saßen Aloys und Wickel gemeinsam nebeneinander und rauchten.
›Können wir hier mal in Ruhe quatschen?‹, fragte mein Bruder genervt und Aloys duckte sich nach unten, als ob er seine Zigarette löschen müsste.
›Klar‹, sagte Papa entgeistert. Und weil ihm nicht mehr einfiel, schloss er die Tür ohne weitere Worte.
›Du liest zu viel Krimis, Barbara‹, meinte er, schritt an mir vorbei und nahm kopfschüttelnd wieder seine Zeitungslektüre auf. Meine Mutter hielt mich noch weiter. Ich guckte zu ihr auf und meinte fassungslos: ›Er hat mich doch hoffentlich nicht so gesehen?‹
›Nein nein, Papa stand davor‹, log sie.
Ich stapfte zurück ins Zimmer. Es war klar, dass meine Karriere als liebende Frau und aufmerksame Tochter mit einem Schlag beendet war. Kurz erwog ich, ein paar Sachen zu packen und durchs Fenster zu verschwinden, damit mich niemand mehr auf diesen Vorfall anzusprechen in der Lage war. Ein Kloster, überlegte ich. Oder die Fremde. Übersee. Dann rechnete ich aus, wie weit ich käme. Es wäre eine zusätzliche Schande, von meinen Eltern aus einem Polizeirevier in Wittmund oder Jever abgeholt zu werden, kam ich zum Schluss. Die Niederlage wäre dann perfekt. Wahrscheinlich würde ein Gespräch folgen, das einen Aufenthalt in der Nervenklinik nahelegte. Nur für kurze Zeit, bis ich mich wieder gefangen hätte.
Ich schminkte meine Augen und dann die Lippen schwarz und überlegte, wie ich die Haare jetzt schnell ohne Farbmittel dunkel färbte. Wegen der beiden Jungs vor der Haustür war der Weg zum Einkaufen versperrt. Das Gefühl, in der Falle zu sitzen, vertiefte sich.
Unter der Bettdecke schien mir ein geeigneter Ort zu sein, zu warten. Worauf, konnte ich nicht sagen. Irgendjemand würde kommen und mich zur Rede stellen. Dann war da noch das Problem, was Aloys und Wickel besprachen? Ich fing an, eine Drogenkarriere in Erwägung zu ziehen, die würde meine Probleme auf den Körper verlagern und weitere Fragen überflüssig machen. Vielleicht fand ich in Wickels Zimmer Zigaretten – die Besonderen, die er immer dabei hatte ...
Ich hörte Schritte, die Tür ging auf und jemand setzte sich auf mein Bett. Langsam zog Wickel die Bettdecke weg und sah zu mir herunter.
›Hättest mir auch sagen können, dass du den Kerl kennst, der mir die Fresse poliert hat.‹
Ich nickte weinend.
›Was meinste denn, was ich getan hätte? Meinste, ich wäre mit ein paar anderen Jungs aufmarschiert und auf hätte Rächer gemacht?‹
Ich zuckte die Schultern. Wickel strich mir durch die ungefärbten Haare.
›Aloys hat mir erklärt, was passiert ist. Dass er rotgesehen hat, weil er meinte, wir sind zusammen.‹ Er überlegte kurz, vielleicht genoss er auch, was er dann sagte.