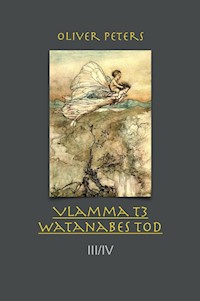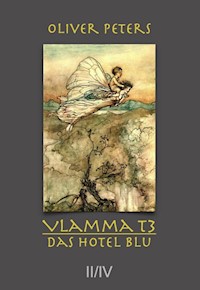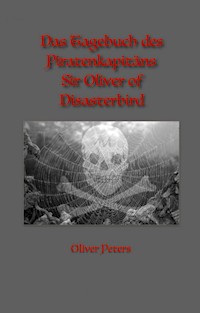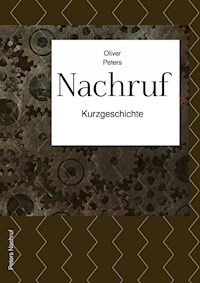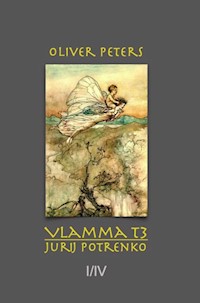
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist der mächtigste Mann der Stadt. Er hat den sibirischen Winter überlebt, die Moskauer Machtkämpfe der "Diebe im Gesetz" und Stalin. Jurij Potrenko ist fast am Ende seiner Karriere, voller Sehnsucht nach seiner sibirischen Heimat und unangefochtener Big Boss der Mafia in Deutschland. Doch hat er ein Geheimnis - er ist ein Bündnis mit den Kobolden eingegangen. Eigentlich war es nur ein mißglücktes Geschäft, doch die komplizierten Regeln der Geisterwelt sehen vor, ihn zum König zu machen. Es ist schwer, zwei so große Geschäftsbereiche zusammenzuhalten, zumal die Berater sehr speziell sind. Die Quadrologie Vlamma T3 erzählt die Geschichte der Grauen Fee, deren Märchen beispiellos an der menschlichen Natur scheitert. Teil 1: Jurij Potrenko : Teil 2: Das Hotel Blu : Teil 3: Watanabes Tod : Teil 4: Sonntag das Rennen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vlamma T3 I
Jurij Potrenko
Oliver Peters
Überarbeite Fassung
Covergetaltung: Oliver Peters Coverbild: Arthur Rackham: A Midsummer Night’s Dream – 1908 (Public Domain)
Zierstreifen Rücken Softcoverausgabe: Ausschnitt aus: Wolgemut: Tanz der Gerippe - 1493 (Public Domain)
Impressum
© 2021 Oliver Peters
Erste Auflage 2015
Druck und Verlag: epubli GmbH Berlin,
www.epubli.de
Hardcover ISBN: 978-3-754926-45-1
Softcover ISBN: 978-3-754926-44-4
E-Book ISBN: 9783754926413
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Manuela, Brian und Cati
»Sie werden, Herr Landvermesser, das sehe ich wohl, manche Phantasien aufgeben müssen, ehe Sie ein brauchbarer Schuldiener werden.«
Franz Kafka: Das Schloss (Siebentes Kapitel)
Auf der Westerholt
1978
Die Westerholt kreuzte nachts bei schwerem Wetter in der Danziger Bucht. Den Namen des ostfriesischen Städtchens stolz am Bug, pflügte ihr eiserner Rumpf das Wasser mit hoher Gischt, rollte, stampfte, durchmengte im Innern Männer und ihre bewegliche Habe. Die Matrosen hingen an allem, was Halt bot, und vollführten halsbrecherische Figuren wie Statisten eines chinesischen Zirkus’.
Das Lazarett war gefüllt mit den mühsam durchs schlingernde Schiff transportierten Verletzten, die hauptsächlich unter stumpfen Traumata litten. Ihre Behandlung fand so lange statt, bis der gelbsüchtige Schiffsarzt, Doktor Benjamin Schwarz, von einem übergewichtigen Patienten überrollt, verletzt ausschied.
Die Naturgewalten stellten das Schiff komplett auf den Kopf. Von Stunde zu Stunde verwandelte der Sturm den eindrucksvollen Zerstörer in einen bewaffneten, hilflosen Schrottfrachter.
Am Heck, in einem Kanonenturm, mit der Bewachung eines Geschützes betraut, verrichteten drei Kameraden ihren Dienst. Pelle, Pickel und Stegmeyer profitierten von der Enge des Turms, der keinen Platz bot, durcheinandergewürfelt zu werden. Die Männer waren trotzdem in Sorge.
Immer wieder blickten sie auf eine mögliche Sicherheitslücke des Geschützturms. Die in die Zentrale des Gefechtsstands ragende Munition hatte noch jedem Unbehagen bereitet, der dort Wache geschoben hatte, selbst bei ruhigem Wetter. Ein Magazin für die Projektile des 38-mm-Kanonenrohrs arretierte hinreichend die Sprengkörper, gleichwohl blieben sie frei für den flotten Zugriff im Ernstfall. Bei den herrschenden Windverhältnissen mehrten sich allerdings bei der Turm-Besatzung Zweifel an der Zuverlässigkeit des Arrangements. Hundertmal konnte man in Kursen den bewährten Schutz der Kartuschen durchnehmen – die nackten Metallkörper in unmittelbarer, ja sinnlicher Nähe, trieben einem Adrenalin ins Blut.
Alle drei hatten unablässig darauf zu achten, sich nicht zufällig auf einem der Zünder abzustützen, nach den Haltekrallen zu greifen, sie gar abzureißen oder versehentlich einen Sicherungsring mit einer Falte der Uniform abzuziehen. Stundenlang rangen sie konzentriert mit den Verhältnissen, waren beschränkt auf kurze Hinweise oder Vorsichtsrufe und gaben sich gegenseitig Hilfestellungen. Zunehmend versiegten ihre Kräfte.
Gegen 5.00 Uhr MEZ befahl der Kapitän, das Schiff in den Wind zu drehen. Zu diesem Zeitpunkt drohten die erschöpften Männer, nicht mehr ohne fremde Hilfe ihre Plätze verlassen zu können. Die Westerholt lag im Anschluss an das Manöver ruhiger im Wasser. Das verschaffte der Mannschaft eine Pause, bis der Sturm nach zwei Stunden langsam von selbst nachließ.
Ausgepumpt saßen Pelle, Pickel und Stegmeyer in den Sitzen festgeschnallt, bis Pickel entschied, die schmale Sichtluke für frische Luft zu öffnen. Durch das aufgeschobene, winzige Viereck trieb mit unerhörter Kraft das rötliche Licht der aufgehenden Sonne in ein dunstiges, schweißsattes Kämmerlein. Der Strahl zeichnete den Wasserdunst nach und hob sich gegen das feuchte Dunkel des Turms glühend ab. Ein Schmetterling, der plötzlich in ihr verriegeltes Reich geflogen wäre, hätte sie nicht mehr überraschen können.
»Es sind noch zwei Stunden«, sagte Pickel. Er sprach von der Wachablösung und spähte durch das Luk, um die Situation an Bord zu beurteilen. Die Schäden waren beträchtlich. »Vielleicht auch mehr, es sieht nach einer Menge Arbeit aus.«
Das Funkgerät piepte, die Brücke fragte den Status einzelner Stationen ab. Pelle meldete, dass sie keine Verluste hatten und einsatzbereit waren. »Super«, stichelte Pickel. »Eine Kanone ist genau das, was sie jetzt brauchen.«
Pelle war verärgert. »Hast du mal darüber nachgedacht, warum wir in diesem Turm eingepfercht sind?«
Pickel zeigte den Stinkefinger und machte sich am Ausstiegsschott zu schaffen.
»Was soll DAS jetzt?«, versetzte Pelle. »Du kennst die Vorschrift. Während der Wache bleibt das Ding zu.«
»Und du bist jetzt der Kapitän, ja?«, schnodderte Pickel und zog geräuschvoll die Nase hoch.
»Ich gehe auf jeden Fall nicht wegen dir in den Bau. Lass den verdammten Ausstieg zu.«
Pickel war von der anstrengenden Nacht ausgelaugt. Frische Luft, vielleicht ein Kaffee, das war ja wohl nach einer solchen Wache kein Grund für ein Disziplinarverfahren, Vorschriften hin, Vorschriften her. Sie waren schließlich nicht im Krieg.
»Hey, wir haben keinen Krieg!«, sagte er und schickte sich erneut an, das Schott zu öffnen. Doch Pelle hielt ihn am Arm.
»Mach’ keinen Quatsch jetzt. Du weißt doch gar nicht, wohin der Sturm uns getrieben hat.«
Pickel erstarrte bei dem Gedanken.
»Du meinst doch nicht, wir ...«
»Wer weiß das schon. Ich werde auf jeden Fall nicht über Funk die Brücke fragen, ob wir früher unsere Morgentoilette machen dürfen.«
Pickel sank auf den Sitz zurück. »Das wäre ’was. Gerade jetzt. Aber der Kapitän würde niemals auf das Gebiet der DDR geraten, dazu ist er doch ein zu alter Hase, oder?«
»Er hat den Kahn lange malträtiert. Das hat der nicht zum Spaß gemacht, denke ich.«
Kopfschüttelnd sah Pickel zu seinem Kameraden herüber.
»Und Stegmeyer? Was sagst du dazu? Sind wir noch auf Kurs?«
Der Angesprochene war bleich und schweißig. Er fixierte Pickel mit feuchten Augen.
»Unser Richtoffizier scheint die Hosen voll zu haben, Pelle«, lachte der und schlug sich auf den Schenkel. Pelle drehte sich um und sah nach dem Kameraden.
»Alles klar?«
Stegmeyer blieb bewegungslos sitzen. Die Augen versuchten, den Blick des Freundes auf ein Detail an seinem rechten Arm zu lenken. Dann konnte Pelle es sehen.
»Mist!«
Pickels Lachen erstarb.
»Was ist los Leute? Nicht so ernst, bitte.«
Sie antworteten nicht und er wurde unruhig. »Was los ist, habe ich gefragt!«
Pelle zeigte auf Stegmeyers Arm. Der zerrissene Ärmel trug eine seinem Sitz nahe Zündsicherung im Fleisch. Offenbar hatte sich sein Arm daran verfangen, war ins Gewebe eingedrungen und reflexartig von ihm zurückgezogen worden. Die erste Kartusche im Magazin ihres Turms war scharf. Lediglich eine schnelle Bewegung des Richtoffiziers mit dem gesunden Arm arretierte notdürftig die Sicherung und verhinderte eine Explosion, die schon im offenen Gelände im Umkreis von 25 Metern tödliche gewirkt hätte. In der Abgeschlossenheit des Turms war die Frage, ob sie noch den Blitz wahrnähmen, oder den Knall hörten.
Pickel wandte sich langsam zum Funkgerät und schaute fragend zu Pelle. Der nickte. Er versuchte, beim Ruf zur Brücke, nicht nervös zu wirken. So, wie sie es gelernt hatten, um auf kritische Situationen zu reagieren.
»Hier Turm II. Nicht gefechtsklar. Code Rot.«
Die Brücke bat um eine Wiederholung. Denn Code Rot beschrieb genau ihr Dilemma: Explosionsbereite Munition im Gefechtsstand, ungesichert.
Ihnen blieb im Moment nur abzuwarten, bis die Brücke Befehle gab. Fraglich, ob es an Bord Spezialisten für eine solche Situation gab und Hilfe unterwegs war. Pelle hielt vorsichtig Stegmeyers Arm, um ihn zu entlasten. Die Wunde war schlimm. Den Ring aus dem Fleisch zu ziehen würde die improvisierte Sicherung des Geschosses aufheben und es in 15 Sekunden zur Detonation bringen. Es wäre unmöglich, Stegmeyer in dieser Zeit aufs Deck zu bekommen und das Schott wieder zu verriegeln. Den stark verletzten Arm in dieser Position zu halten war der einzige Weg, um Zeit zu gewinnen. Aber Stegmeyer würde langsam verbluten. Erst Kälte, gefolgt von Müdigkeit. Dann würde er bewusstlos werden und mit dem herabsinkenden Arm die Detonation auslösen. Umgekehrt: Dann stürbe nur einer, überlegte Pelle kurz. Sie könnten jetzt aussteigen. Er bemerkte Stegmeyers bohrenden Blick. Er denkt das Gleiche, schoss es ihn durch den Kopf. Er weiß, was ich mir ausrechne.
Er fasste den Arm kräftiger an, wollte seinem Kameraden signalisieren, dass er ihn trotz seiner Kalkulation nicht im Stich lassen würde.
Stegmeyer schloss schmerzleidend die Augen. So oder so, machte er sich klar, ich habe eine gute Chance zu sterben. Er flüsterte: »Haut ab, ihr könnt nichts machen!«
Pickel hielt das Mikrofon des Funkgerätes in der Faust und sah zum verzweifelten Pelle herüber, der übliche Durchhalteparolen, predigte. »Red’ keinen Quatsch, wir schaffen das.«
»Mir ist komisch, Pelle.«
»Hilfe ist unterwegs, Stegmeyer, du musst durchhalten.«
»Ihr gottverdammten Arschlöcher! Haut ab.«
»Erzähl’ doch etwas, Stegmeyer. Erzähl’, wer auf dich zu Hause wartet. Und dann überlege noch einmal, ob wir aufgeben sollen.«
Eine Stimme aus dem Funkgerät gab knarzend Auskunft, dass die Brücke die Situation verstanden hätte.
»In dem Tempo wird das nichts«, knurrte Pickel.
Dann kam von der Brücke die Meldung: »Hilfstruppe mit Entschärfungskommando arbeiten sich durch eine Menge Schrott an Deck, das kann dauern. Wie lange könnt ihr das stabil halten?«
»Stabil? Uns fliegt gleich die ganze Munition um die Ohren«, rief er.
Nach einer Pause versuchte es die Brücke erneut.
»Wie lange kommt ihr klar?«
Sie wussten es nicht. »Erzähl’ von dem Mädchen, das auf dich wartet«, drängte Pelle weiter. Pickel nahm kraftlos das Mikrofon auf und informierte die Brücke leise, dass eine Einschätzung, wie lange sie den Status quo halten könnten, nicht möglich war. »Beeilt euch«, setzte er nach.
»Wir sind nicht richtig zusammen, wir haben uns nur verabredet«, stammelte Stegmeyer und Pelle nickte. Schweiß tropfte von der Stirn und Kondenswasser von den Stahlstreben. Pickel öffnete eine andere Sichtluke, um nach Hilfe zu schauen.
»Wenn ich zurück bin, treffen wir uns. Es gibt da ein Hotel, es heißt Hotel Blu, da wollten wir uns wiedersehen, wenn ich zurückkomme, das haben wir abgemacht. Jetzt wird sie vergebens warten, verdammt.«
»Blödsinn. Du wirst sie da treffen, du machst das schon.«
»Ich habe es so geliebt, das Segeln.«
Pelle wandt sich wieder zu Pickel um, der mit fantasievollen Handzeichen andeutete, dass der beginnende Schock bei Stegmeyer die Hirnfunktion zu beeinträchtigen schien und Pelle ihn wachhalten sollte.
»Steggy, das ist kein Segelschiff.«
»Ich weiß. Ich habe es so geliebt. Mit Vater aufs Wasser, die schmutzigen Segel, Leintuch, Seile, alles fühlte sich gebraucht und stark an. Wir auf dem Wasser. Deswegen bin ich zur Marine. Und jetzt bin ich eingeschlossen in ein Stahlfass und werde zu Fischfutter verarbeitet.«
»So ist das nicht.«
Über Funk kam die Meldung, dass der Hilfstrupp Fortschritte verzeichnete, man solle durchhalten. Pickel war ungeduldig. »Wir hören hier nichts. Bitten um Erlaubnis, den Turm verlassen zu dürfen.«
»Negativ, negativ, die Luken und Schotten dichthalten. Wir meinen, es besteht keine Gefahr. Denkt an eure Ausbildung!«
»Das hatten wir nicht«, murmelte Pickel trocken. Er sah, wie der verletzte Arm seines Kameraden zitterte. »Nicht mehr lange«, flüsterte Stegmeyer, dessen schweißige Gesichtsblässe sich verstärkte. Der Schock vertiefte sich.
Picekl legte das Mikrofon ab und schloss fluchend die geöffneten Sichtluken. Als ob man den eigenen Sarg schließt, schoss es ihm durch den Kopf.
»Erzähl’ weiter, Steggy, was ist mit dem Mädchen?«
Stegmeyer musste lächeln. »Sie kann nicht gut kochen.«
Alle drei lachten kurz.
»Sie kauft Fertigsachen und verfeinert sie. Verfeinern nennt sie es, wenn sie frische Sachen drauf tut und nachwürzt. Ich bin da anders. Ich glaube, man kann die meisten Sachen schlecht verfeinern. Das klingt, als ob man sie im Nachhinein veredeln kann. Das geht nicht mit einer Erbsensuppe aus der Dose. Das geht doch nicht, oder?«
»Nein«, sagte Pelle. »Das ist Unsinn, aber sie macht das offenbar ganz gut.«
Stegmeyer hustete etwas. »Das könnte eine Geschäftsidee sein. Fertigsachen verfeinern. Der noble Herr trägt Anzüge von der Stange mit einer Verfeinerung.«
»Du bist witzig, Alter«, sagte Pelle.
»Ich bin tot, Mann«, erwiderte Stegmeyer.
Pelle merkte, wie sein Kamerad wegdämmerte. »Pickel, kriegst du das zu fassen? Kannst du deinen Daumen da draufdrücken?«
»Und dann?«, antwortete der. »Er brauchte eine Infusion und wir ein Entschärfungskommando, verstehst du?«
Er griff wieder zum Mikrofon.
»Turm II an Brücke. Wie lange noch? Das spitzt sich hier zu.«
Pause. Dann hörten sie die Stimme des Kapitäns.
Der Alte sprach nur direkt zu den Matrosen, wenn es brenzlig wurde oder er verärgert war. Im Moment bestand zwar die Möglichkeit, dass der ordnungsliebende Schiffsführer fuchsig war, betrachtete man die Schäden an Bord. Die Drei ahnten aber, er sprach zu ihnen, weil es schlecht um sie stand.
»Jungs! Ich überlasse die Entscheidung euch. Nur trefft sie schnell. Wir werden von hier aus den Turm in 2 Minuten versiegeln. Wer dann noch drin ist, kommt nicht mehr heraus.«
»Verstanden«, sagte Pickel. Das war’s. Sie waren vor die Wahl gestellt zu gehen oder in die Luft geblasen zu werden. Die Westerholt wäre nur innerhalb des Zeitraums gefährdet, in der das Schott zum Turm offenstand. Sie mussten zusehen, es vor einer möglichen Detonation schnell von außen zu verschließen.
»Und der Hilfstrupp?«, fragte Pickel.
»Der braucht zu lange, mein Sohn.« Es war eine harte Entscheidung, wie sie nur ein Kapitän fällen kann.
»Geht!«, rief Stegmeyer geschwächt. Pelle und Pickel blieben stumm.
»Absoluter Schwachsinn, hierzubleiben. Ich habe schon taube Finger, haut ab.«
Dann bewegte sich Pickel schnell zum Ausstieg und drehte am Verriegelungsrad. Pelle sah auf Stegmeyer herunter.
»Ich ...«
»Geh ...«
»Das kann doch nicht ...«
»Pelle, wo bleibst du?«
Ein Blick, aufmunterndes Zuzwinkern von Stegmeyer, und er löste sich langsam von seinem Kameraden. Er wurde von Pickel am Arm gegriffen und zum geöffneten Schott gezogen. Dann schubste er ihn durch den engen Durchgang und stieg ihm auf das zerstörte Deck nach.
Der kalte Wind der Danziger Bucht schlug ihnen hart ins Gesicht und raubte beiden den Atem. Das grelle Licht blendete sie. Pelle legte schützend den Arm vor die Augen, während Pickel hastig das Schott von außen versiegelte.
Zehn Sekunden später hörten sie die brückengesteuerte Verriegelung des Zugangs zum Turm, die ein erneutes Öffnen verhinderte. Kurz sann Pickel darüber nach, warum es so einen Mechanismus überhaupt gab. Ob er in Kampfsituationen eingesetzt wurde?
Ein dumpfer Knall vom Innern des Turms, ohrenbetäubend, im gesamten Rumpf der Westerholt klang es nach. Wie ein Glöckchen, das man schlug. Nur dunkler. Die Vibration lief einmal vollständig durchs Schiff. Die Sonne stand hoch am Himmel, das Morgenrot war verschwunden. Sie rochen nicht die Frische des neuen Tags. Sie rochen ihren Schweiß, Metall und eine Spur Schwarzpulver, als ob es durch die Ritzen des Turms zu drängen vermochte. Sie rochen die erbarmungslose Gewalt, die von diesem Schiff ausging. Ein dumpfer Knall, der ein Universum beendete.
34 Jahre Später
Prof. Dr. Lambert Flammershausen
Von jeher war es ein Missverständnis, dass jene Welt der Geisterwesen und die der Menschen getrennt voneinander zu betrachtet seien, denn sie sind eins. Es ist tragisch, dass der Verlust an magischen Fähigkeiten den historischen Weg der Menschheit begleitet hat und sie von der Einheit dieser Welt abzutrennen scheint. Dass sie die Brücke zu ihrem Ursprung mit Nachdruck zerstören, verlängert die Tragödie noch. Mit dieser Brücke ist die Natur gemeint, insbesondere der Waldbestand. Doch dessen Vergiftung und Vernichtung kann nicht über die Beziehung zwischen Mensch und Geisterwesen hinwegtäuschen.
Inferior Globuli: Lex Libre spiriti domini scurrae fatuaquam
Institut Prof. Dr. Flammershausen,
Freitag Nacht, 22 Uhr
Professor Dr. Lambert Flammershausen stand am Fenster seines Büros im Institut und spähte auf den nächtlichen Parkplatz. Eine defekte Neonröhre flackerte unruhig am kiesbestreuten Fußweg zum Gebäude.
Er war 1,80 Meter groß, stabil und trug einen weißen, geöffneten Kittel. Darunter die obligatorische graue Bundfaltenhose und einen Wollpulli, der Hosenträger verbarg. Trotz der schlichten Kleidung wirkte seine Haltung wie die eines Königs, der halb stolz, halb scheel von seinem Büro das Gelände vor dem Institut studierte. Er war ein unruhiger und durch zahllose Gremienschlachten um Positionen und Budgets erfahrener Krieger, vernarbt und gestählt, so dass seinem Gesicht die tiefe Abneigung vor dem erwarteten Besuch nicht abzulesen war. Und doch erfüllte ihn Abscheu, dachte er an den angekündigten Gast.
»Verdammtes Schwein«, murmelte er. Wie so häufig, wenn er seine Gedanken auf den kleinen, deformierten Mann lenkte, den er erwartete. Er löste sich vom Fenster und kontrollierte eine Tür, maß Entfernungen ab und prüfte das Tablett mit Getränken. Sein Gang war fest und kraftvoll. Doch glich er einem Alkoholiker, der den Schnaps verfluchte und dabei einen tiefen Schluck aus der Flasche nahm.
Er begab sich zurück zu seinem Arbeitsplatz am Fenster und sah weiterhin missmutig auf den Parkplatz. Seine Lesebrille trug er an einer Kordel vor der Brust. Er setzte sie auf, drehte sich und widmete sich den Papieren vor ihm auf dem Schreibtisch.
Seine klaren, grünen Augen schweiften über die Dokumente. Den Großteil der Arbeitsfläche bedeckten Skizzen und Notizen mit technischen Zeichnungen. Die Striche, Linien und Markierungen wirkten wie das Zeichensystem okkulter Provenienz, Buchstaben aus einem exotischen Alphabet, die Grammatik einer unbekannten Sprache. Ein Experte würde erkennen, dass in den Symbolen unkonventionelle und fremdartige Details für ein Aggregat verborgen lagen. Es fiele ihm sicherlich schwer, die gelegentlichen Pentagramme Zauberformeln und Fledermauszeichnungen auf dem Papier einzuordnen.
Flammershausen nahm eines der Blätter zur Hand und las es im Schein der Schreibtischlampe. Sein heller Kittel reflektierte das Licht. In seinem Gesicht zeichnete sich ein Schimmer auf den Wangen.
Es gab einige Arbeitsbereiche im Institut, die das Tragen eines weißen Mäntelchens rechtfertigten – die Büros gehörten definitiv nicht dazu. Es gab aber aus den letzten Jahrzehnten kaum Bildmaterial, das ihn ohne dieses Accessoire zeigte. Die Allgegenwart des Kittels stilisierte zum Erkennungszeichen des Professors, der das Feuilleton mit einem Auftritt in einer Talkshow Mitte der 80er Jahre endgültig auf diesen Tick aufmerksam machte. Vom Moderator direkt auf die Bekleidung angesprochen, die er im Studio nicht wechseln wollte, antwortete er legendär: »Des Kittels entledige ich mich zu den gleichen Gelegenheiten, wie ein Cowboy sich seines Huts. In der Badewanne und in Gesellschaft einer schönen Frau.«
Das schiefe, faltenreiche Gesicht krönte lichtes, graues Haar. Das Gift unzähliger Zigaretten hatte den kurzen, melierten Vollbart um den Mund vergilbt und die Gesichtshaut angegriffen. Einzig die Augen strahlten frisch. Eingelassen in ein Feld verwelkender Lebenskraft glühten sie heiß. Man meint, ihre Kraft habe ringsum vom rosigen Gesichtsfleisch der Kindheit gefressen und es langsam zu Humus transformiert.
Die Zeit spielte gegen ihn, schon ein Leben lang.
Er las in den Konstruktionszeichnungen zu dem Motor, mit dem er nichts weniger als die Weltmeisterschaft in der Formula Alpha zu gewinnen gedachte. Es ging die Hoffnung um, dies Ziel im nächsten und einzigen Rennen der Saison zu erreichen. Angesichts seines Alters die letzte Chance, sich selbst und dem Kreise seiner Kritiker zu beweisen. Und zu zeigen dass er sich berechtigterweise von den Universitäten, denen er seine akademischen Titel verdankte, im festen Glauben an die Kraft des freien Markts, abgewandt hatte.
Er hatte den Antrieb Vlamma T3 genannt. Leistungsstark und innovativ wurde er durch ein geschicktes Marketingkonzept von vielen Sponsoren finanziert. Seit ein paar Wochen stand der Prototyp im Keller. Er ließ die Papiere in seiner Hand sinken und seufzte. Doch zu welchem Preis?, grübelte er angesichts des bevorstehenden Besuchs.
Er neigte dazu, den Motor als eigenes Werk zu begreifen. Über einen weiten Zeitraum hinweg unterlag er dieser Selbsttäuschung. Meinte, es sei sein Aggregat. Sein Vlamma T3. Doch der Gast heute Nacht erinnerte ihn daran, die Entwicklung keineswegs unabhängig vorangetrieben zu haben. Die bittere Erkenntnis war, dass er wahrscheinlich doch kein einsames Genie darstellte.
Flammershausen legte die Dokumente zurück und wandt sich wieder zum Fenster. Seine Gedanken schweiften zu den Tagen ihrer ersten Begegnung. Er hätte sich besser angesichts der Umstände damals auf keinen Handel einlassen sollen. Jetzt wusste er das. Es wäre allerdings viel verloren gegangen und noch mehr stand zu gewinnen. Wann erkennt man überhaupt, dass der Augenblick gekommen ist, auszusteigen?, dachte er.
Vielleicht hätte er es schon in jener Nacht Argwohn hegen sollen, in der er über seine fruchtlosen Versuche kapituliert hatte, den Verbrennungsmotor neu zu erfinden. Wann war das? Vor 10 Jahren?
Das Leben war damals ein Rausch. Ausgestattet mit Forschungsgeldern und zusätzlich unterstützt von einer überschaubaren Erbschaft, flogen die Tage und Nächte dahin. Er war damals Mitte 40 und seit kurzem alleinstehend. Er sprach nicht gerne darüber, aber sein exzessiver Arbeitsstil hatte in dieser Zeit seine geliebte Ruby als Tribut gefordert. Der Gedanke daran verursachte Kummer. Bevor sie ihn verließ, hatte sein Leben eine nie zuvor gekannte Balance von körperlicher und geistiger Produktivität erreicht.
Flammershausen seufzte. Immer seltener landete er mit seinen Gedanken bei Ruby. Anfangs war ihr Fortgehen ein schwarzes Loch, das alle Energie absorbierte. Es war lange her. Seltsam, dass er sich an diesem Abend erinnerte. Es lag was in der Luft.
Sie war sicherlich einer der wenigen Menschen auf der Welt, die ihm unmittelbare Liebe entgegengebracht hatte. Ihre Entscheidung vermittelte ihm das Gefühl, unfähig für die wichtigste Eigenschaft der Menschen zu sein: Halten zu können, was man liebt. Er zeigte sich zu dumm für die Gunst einer so wundervollen Frau wie Ruby. Hatte ihre Zuneigung unverdient genossen, um nach ihrem Weggang zurückzufallen auf das, was er nun einmal repräsentierte. Einen rohen, ungeschickten Klotz.
Seine Faust ballte sich in der Tasche des Kittels. Er fühlte wieder den Abgrund, der sich nach ihrem Abschied aufgetan und ihn in eine selbstzerstörerische Arbeitswut gestürzt hatte. In diese unselige, blindmachende Obsession, deren Energie ihn in die Arme des Motorsports treiben sollte. Der Ingenieur konnte sich im Rennzirkus mühelos für den urplötzlich auf die Bühne getretenen Arbeitgeber aufopfern: das Team Rorick in der Formula Alpha.
Was war naheliegender für einen, in seinem Narzissmus so tief verletzen Wissenschaftler wie Flammershausen, als in die Scheinwelt des motorisierten Rennsports zu fliehen? Pferdestärken, Männlichkeit und Egoismus waren die Leitlinien, Leistung eine übergeordnete, alles definierende, alles rechtfertigende Kategorie. Frei von Fragen der Treue, Loyalität und Intimität.
Er erinnerte sich genau, dass damals Gespräche aller Art an den Rennstrecken stattfanden. An kleinen Gartentischchen, die die Flüchtigkeit des Rennsports ausdrückten. Schnell montiert, schnell wieder abgebaut, Symbol der Umtriebigkeit des millionenschweren Rummels, der Wanderschaft, der Unbeständigkeit. Luxus gepaart mit Campingatmosphäre, Schampus aus Pappbechern, Shrimps im Stehen zwischen zwei Testfahrten.
Auch das Bewerbungsgespräch von Flammershausen verlief in dieser Atmosphäre. An einem sehr windigen, für den Sommer kühlen Samstag, im ohrenbetäubenden Lärm der Strecke von Silverstone, saß er dem Teamchef gegenüber. Um sie herum fegte die Brise Plastikgeschirr, Schirme und Hüte. Sie saßen trotzdem in der Sonne. Sein Gastgeber war ein dicklicher Mann mit rosiger Haut, den der Sturm das Haar zerzauste und scheinbar auch den Anzug. Später erfuhr Flammershausen, dass Theodor Dolmer immer schlechtsitzende Kleidung trug.
»Mögen Sie Motorsport, Lambert?«, rief er, und sah einem weit entfernten Punkt rechts von ihm nach. Es hätte eine Frau sein können, oder ein Rennbolide. Wahrscheinlich war es nur ein verlegender Blick zur Seite.
»Ich liebe Technik in allen Ausprägungen. Ich glaube, es hat etwas Natürliches, dass man sich mit Hilfe von Motoren misst«, hatte Flammershausen entgegnet.
»Sie weichen mir aus. Nehmen Sie sich an einem Sonntag trotz begrenzter Freizeit vor, ein Rennen zu schauen? Stehen Sie nachts auf, um ein Duell zwischen zwei Fahrern zu verfolgen? Tragen Sie sich Renntermine in Ihren Kalender ein?«
»Nein, Sir.«
»Gut. Denn ich möchte auf gar keinen Fall einen dieser Idioten bei mir einstellen, die glauben, dass wir hier Sport betreiben.«
»Sir? Das ist doch Rennsport.«
»Das ist Business. Es geht hier einzig um die Frage, wer vorne mitfährt, um Geld abzuschöpfen, Marken zu platzieren und Werbeflächen zu verkaufen. Wenn Sie für mich arbeiten, möchte ich, dass Sie das wissen, Lambert.«
»Ich kann damit zumindest leben.«
»Dann ist das klar. Ich habe nämlich eine Theorie, die hierbei eine ganz große Rolle spielt.«
»Eine Theorie, Sir?«
»Ja. Eine Menschentheorie, sozusagen. Was macht einen Löwen zum König der Tiere? Na?«
»Ich weiß es nicht. Seine Gefährlichkeit?«
»Elefanten sind gefährlicher. Bakterien sind gefährlich. Nein, zum König macht den Löwen die Einstellung, unbesiegbar zu sein. Sie können sagen, es ist eine Fehleinschätzung, Sie können sagen, es ist Arroganz. Aber es macht ihn zu einem König.«
»Denkbar.«
»Das heißt, was Menschen von sich denken, das bestimmt ihre Leistung.«
»Wow, Sir, das ist eine interessante Schlussfolgerung.«
»Ist doch klar. Wenn ich einen Ingenieur habe, der einen sportlichen Motor bauen will, baut er einen Motor, der konkurriert. Er misst sich an dem Gegner und hat ganz tief in seinem Innern eine Information in seinen Genen, dass die Möglichkeit besteht, verlieren zu können.«
»Die Gentheorie an Motoren anzuwenden ist allerdings ...«
»Ich will keinen Motor, der von einem gebaut wurde, der Niederlagen einkalkuliert. Ich will einen skrupellosen, einen überragend anderen, einen nie da gewesenen Motor, der keine Alternative zum Siegen kennt, weil sein Erbauer genauso denkt.«
Flammershausen zögerte. »Menschen, die keine Niederlagen kennen, Sir, dürften schwer zu finden sein. Und ich fürchte, ich wäre da keine gute Wahl.«