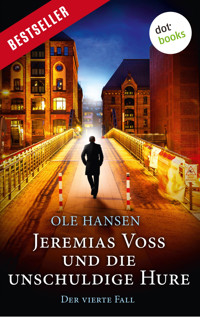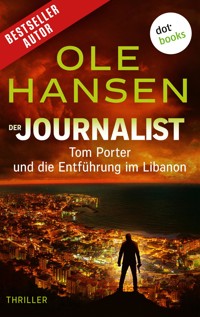12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hamburgs bester Privatdetektiv hat einen Nachfolger: Der fesselnde Krimi-Sammelband »Das kalte Licht von Hamburg« von Ole Hansen als eBook bei dotbooks. Jeremias Voss, Hamburgs bester Privatermittler, geht in den Ruhestand – und hat einen würdigen Nachfolger für seine Detektei gefunden: Als ausgebildeter Pathologe besitzt Marten Hendriksen die notwendigen Voraussetzungen für den Job – stahlharte Nerven und eine geniale Kombinationsgabe, mit der er seinem legendären Vorgänger in nichts nachsteht. Egal ob er mysteriöse Anschläge auf ein altes Gutshaus vor den Toren der Hansestadt untersucht, Attentäter jagt, die hinter einer dramatischen Explosion im Hamburger Hafen stecken, oder er eine tödliche Verschwörung aufdeckt – Marten Hendriksen scheint nie etwas aus der Ruhe bringen zu können. Oder vielleicht doch? In der Krimi-Bestseller-Reihe von Ole Hansen ermittelt nach Hamburgs berühmtestem Privatdetektiv Jeremias Voss nun Marten Hendriksen – der Pathologe mit der Leichenallergie: Hochspannung garantiert! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Krimi-Sammelband »Das kalte Licht von Hamburg« von Ole Hansen enthält die drei Bestseller »Hendriksen und der mörderische Zufall«, »Hendriksen und der Tote aus der Elbe« und »Hendriksen und der falsche Mönch«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Jeremias Voss, Hamburgs bester Privatermittler, geht in den Ruhestand – und hat einen würdigen Nachfolger für seine Detektei gefunden: Als ausgebildeter Pathologe besitzt Marten Hendriksen die notwendigen Voraussetzungen für den Job – stahlharte Nerven und eine geniale Kombinationsgabe, mit der er seinem legendären Vorgänger in nichts nachsteht. Egal ob er mysteriöse Anschläge auf ein altes Gutshaus vor den Toren der Hansestadt untersucht, Attentäter jagt, die hinter einer dramatischen Explosion im Hamburger Hafen stecken, oder er eine tödliche Verschwörung aufdeckt – Marten Hendriksen scheint nie etwas aus der Ruhe bringen zu können. Oder vielleicht doch?
In der Krimi-Bestseller-Reihe von Ole Hansen ermittelt nach Hamburgs berühmtestem Privatdetektiv Jeremias Voss nun Marten Hendriksen – der Pathologe mit der Leichenallergie: Hochspannung garantiert!
Über den Autor:
Ole Hansen, geboren in Wedel, ist das Pseudonym des Autors Dr. Dr. (COU) Herbert W. Rhein. Er trat nach einer Ausbildung zum Feinmechaniker in die Bundeswehr ein. Dort diente er 30 Jahre als Luftwaffenoffizier und arbeitete unter anderem als Lehrer und Vertreter des Verteidigungsministers in den USA. Neben seiner Tätigkeit als Soldat studierte er Chinesisch, Arabisch und das Schreiben. Nachdem er aus dem aktiven Dienst als Oberstleutnant ausschied, widmete er sich ganz seiner Tätigkeit als Autor. Dabei faszinierte ihn vor allem die Forensik – ein Themengebiet, in dem er durch intensive Studien zum ausgewiesenen Experten wurde. Heute wohnt der Autor in Oldenburg an der Ostsee.
Eine Übersicht über weitere Romane von Ole Hansen bei dotbooks finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe August 2021
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Foto-select / Feel good studio / Gayvoronskaya_Yana sowie © Pixabay / stux
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-678-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das kalte Licht von Hamburg« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ole Hansen
Das kalte Licht von Hamburg
Drei Krimis in einem eBook
dotbooks.
Hendriksen und der mörderische Zufall
Der erste Fall
Eine Bewährungsprobe, die es in sich hat! Die Herrin eines herrschaftlichen Anwesens bittet den ehemaligen Pathologen und unkonventionellen Privatdetektiv Marten Hendriksen um Hilfe. Schwerverletzte Lieferanten, zu Tode verängstigte Mitarbeiter und ein Baumeister, der sich das Genick bricht: Wer sich Schloss Bolkow auch nur nähert, muss um sein Leben fürchten. Hendriksens Auftraggeberin glaubt längst nicht mehr an Zufall. Will jemand ihre eigensinnige Tochter, die das alte Familienanwesen gerade zu einem Hotel umbauen lässt, um jeden Preis von Schloss Bolkow vertreiben – und wird sie womöglich das nächste Opfer sein? Hendriksen bleibt nicht viel Zeit, um das Geheimnis zu lüften…
Kapitel 1
Der Schreibtisch beherrschte das ganze Büro. Acht Vierkanthölzer aus Eiche trugen eine drei Zentimeter dicke Eichenplatte; die Schubladenschränke an der rechten und linken Seite, ebenfalls aus massiver Eiche, reichten bis zum Boden. Ecken und Kanten waren abgestoßen, und auch sonst sah das Möbel aus, als hätte es seine Glanzzeiten schon seit etlichen Jahren hinter sich. Das schien den kleinen Mann, der in dem wuchtigen, ledernen Chefsessel fast verloren wirkte, nicht zu stören. Er hatte ihn bei einer Sperrmüllsammlung an der Straße entdeckt und sich sofort in ihn verliebt. Für zwanzig Euro hatte er ihn dem Besitzer abgekauft und von vier Männern in sein Büro schaffen lassen. Wenn man ihn fragte, wie es gelungen war, das Ungetüm ins Büro zu kriegen, sagte er mit ernster Miene: »Durch Zauberei.« Lächelnd fügte er dann meist hinzu: »Zaubern ist nämlich mein Hobby.« Natürlich glaubte ihm das niemand, bis er plötzlich in der Geldbörse des Besuchers blätterte und dieser verblüfft an die leere Gesäßtasche seiner Hose griff.
Dr. Marten Hendriksen, der kleine Mann hinter dem riesigen Schreibtisch, war ausgebildeter Arzt und ein talentierter Rechtsmediziner. Der Grund, warum er jetzt in diesem Büro saß, war eine »Leichenallergie«, die er im Institut für Rechtsmedizin und Forensik von Professor Dr. Silke Moorbach entwickelt hatte.
»Lizzi, kommst du mal bitte«, rief er zum Nebenzimmer hinüber.
»Auf dem Weg.«
Gleich darauf trat eine junge, schlanke Frau ein, deren voluminöser roter Haarschopf alle anderen körperlichen Merkmale überstrahlte, sogar die mit Sommersprossen übersäte Nase und die Wangen. Ihr burschikoses Wesen stand im Einklang mit der Haarfarbe. In der Hand hielt sie einen Pott mit Kaffee. Erstaunt blickte sie auf die schwarze Augenklappe über Hendriksens linkem Auge, fragte aber nur: »Was gibt’s?«
Hendriksen drehte den Bildschirm seines Computers in ihre Richtung.
»Was hältst du davon?«
Lizzi, eigentlich Elizabeth Lambert, setzte sich auf den Besucherstuhl und drehte den Bildschirm ganz zu sich herum.
Hamburger Agentur für vertrauliche ErmittlungenInhaber: Jeremias VossGeschäftsführer: Dr. Marten Hendriksen
Sprechstunden: Mo. bis Fr. 09:00 bis 17:00 UhrTelefon: +49 40 73959673www.hamburger-agentur-für-vertrauliche-Ermittlungen.devertrauliche.ermittlungen@gmail.com
Verziert war das Ganze mit dem Konterfei von Sherlock Holmes.
»Na endlich, Marten. Ich hatte schon die Befürchtung, du könntest dich nie dazu durchringen, den Namen der Agentur zu ändern und zu zeigen, wer jetzt hier der Boss ist«, meinte Lizzi.
»Ich wollte diesen Schritt erst tun, nachdem ich sicher war, in Jeremias’ Schuhe zu passen. Es ist nicht leicht, die Arbeit von jemandem zu übernehmen, der als der berühmteste Privatdetektiv Hamburgs bekannt war.«
»Du und deine Bescheidenheit.«
»Also einverstanden?«
»Was soll die Frage? Natürlich!«
»Gut.« Hendriksen betätigte einige Tasten. »Dörte, ich habe dir unser neues Firmenlogo geschickt. Lass davon Briefbögen drucken und ein Firmenschild für die Tür gravieren – Bronze«, rief er zum Vorzimmer hinüber.
»Wird erledigt, Marten.«
Hendriksen hatte nach der Übernahme der Agentur vor einem Jahr das distanzierende »Sie« durch das kameradschaftliche »Du« ersetzt. Er wollte damit zeigen, dass sie ein Team waren, in dem jeder gleichwertig war, nur unterschiedliche Arbeit leistete.
Dörte Hausers Arbeitsplatz war der Schreibtisch, an dem viele Jahre lang Vera Bornstedt gesessen hatte. Seit drei Wochen war es jetzt ihrer. Heimisch geworden war sie daran jedoch noch nicht, denn sie wusste aus Hendriksens und Lizzis Berichten, dass Vera Bornstedt die Perfektion in Person gewesen war. Vera war Jeremias Voss gefolgt, als dieser die Chefin des Malakow-Konzerns geheiratet hatte und dort als Mitglied des Vorstands für die Sicherheit des Unternehmens verantwortlich wurde.
»Nachdem du heute Morgen schon so aktiv bist, nehme ich an, dass du die Kerle erwischt hast, die die Baumaschinen geklaut haben.«
»Lief wie geplant. Die Ganoven sitzen in Polizeigewahrsam und dürften für die nächsten Jahre hinter Gittern bleiben.«
»Und? Was hat die Augenklappe zu bedeuten?«
»Ach, das ist nichts.«
»Dann nimm sie mal ab. Ich möchte sehen, wie nichts aussieht.«
Da Hendriksen wusste, wie beharrlich seine Mitarbeiterin sein konnte, klappte er die Augenklappe hoch. Ein dick angeschwollenes, in allen Farben leuchtendes Auge kam zum Vorschein. Unter dem Auge war die Haut aufgeplatzt und mit einem Pflaster notdürftig versorgt.
»Mein Gott, wie ist denn das passiert?« Lizzi starrte entsetzt auf die Verletzung.
»Nicht der Rede wert. Bin hingefallen.«
»Quatsch!«
»Na ja, die Polizei kam ein paar Minuten später als geplant, und das hat einer der Ganoven genutzt und mir eine Rechte verpasst. War meine Schuld, ich war zu langsam.«
Lizzi hob in einer Geste der Verzweiflung die Arme. »Kannst du nicht einmal versuchen, einen Fall zu lösen, ohne dich verprügeln zu lassen?«
»Kann mal passieren. Nicht weiter schlimm«, wollte er Lizzi beruhigen.
»Doch, Marten, es ist schlimm. Sehr schlimm sogar! Ich habe keine Lust, dich irgendwann zusammengeschlagen im Krankenhaus zu besuchen. Warst du schon beim Arzt?«
»Ich bin selbst Arzt.«
»Soweit ich weiß, bist du Rechtsmediziner, und deine Patienten waren alle tot, und das wirst du vielleicht auch sein, wenn du dich nicht behandeln lässt. Du ziehst dich jetzt an, und ich fahre dich in die Uni-Klinik. Und danach werden wir etwas dagegen unternehmen, dass du immer der Punchingball für andere bist.«
»Unsinn, das ist nicht …«
»Vergiss es, du kommst jetzt mit!«
Drei Stunden später trat er an Lizzi heran, die im Warteraum geblieben war. Über dem Auge lag ein sauberer Verband. Er wirkte weniger furchteinflößend als die schwarze Augenklappe.
»Nun? Was hat der Arzt gesagt?«, wollte Lizzi wissen.
»Alles soweit in Ordnung. Sehnerv nicht beschädigt. Sobald die Schwellung abgeklungen ist, bin ich wieder wie neu.«
Lizzi atmete erleichtert auf. »Gott sei Dank. Sonst hat der Arzt nichts gesagt?«
»Doch, er meinte, ich solle zukünftig vermeiden, gegen Laternenpfähle zu laufen.«
»Laternenpfähle?«
»Habe ich als Begründung angegeben.«
»Und das hat er geglaubt?«
»Natürlich nicht. Der wusste, dass die Verletzung von einem Faustschlag stammt.«
»Bist du jetzt krankgeschrieben?«
»Warum? Ich kann dich doch auch mit einem Auge sehen.«
»Okay, dann lass uns zur Agentur zurückfahren.«
Sie hatten die Agentur fast erreicht, als Hendriksens Telefon klingelte. Er meldete sich und hörte Dörtes aufgeregte Stimme.
»Marten, ich habe eine Frau am Telefon, die unbedingt Herrn Voss sprechen will. Was soll ich machen?«
»Wir stehen fast vorm Haus. Frag sie, ob wir sie in zehn Minuten zurückrufen dürfen. Wir hätten gerade Besuch eines Klienten.«
»Ich werde sie fragen.« Dörtes Stimme klang wieder sicherer.
Hendriksen wandte sich an Lizzi. »Lass mich am Eingang raus. Jemand will Jeremias Voss sprechen.«
»Jetzt, nach einem Jahr?«
»So ist es. Ich werde versuchen herauszufinden, was die Dame will.«
Lizzi hielt in zweiter Reihe an, Hendriksen sprang heraus und eilte die Stufen zur Agentur empor. Seine Augenverletzung schien seine Dynamik nicht zu beeinträchtigen.
Als er das Büro betrat, sah Dörte ihn erleichtert an. »Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Nach Herrn Voss hat mich noch niemand gefragt.«
»Schon gut, Dörte, du hast alles richtig gemacht. Sollte so etwas noch einmal vorkommen, sagst du, dass Herr Voss an einem anderen Fall arbeitet und, wenn ich nicht im Büro bin, wir zurückrufen werden. Auf keinen Fall sagst du, dass er nicht mehr in der Agentur arbeitet. Das übernehmen ich oder Lizzi. Hast du die Telefonnummer der Anruferin aufgeschrieben?«
Dörte reichte ihm ein Notizblatt, auf dem Frau Brüning-Bolkow und eine Handynummer stand.
Hendriksen nickte ihr aufmunternd zu und ging in sein Büro. Nachdem er es sich in seinem Chefsessel bequem gemacht hatte, wählte er die Nummer. Er musste es einige Male klingeln lassen, bevor sich eine weibliche Stimme kurz mit »Ja« meldete.
Aufgrund der Art, wie sie es aussprach, schätzte er sie auf Mitte vierzig. Höchstwahrscheinlich eine Chefin, die es gewohnt war zu befehlen.
»Spreche ich mit Frau Brüning-Bolkow? Mein Name ist Dr. Hendriksen. Ich bin Geschäftsführer der Hamburger Agentur für vertrauliche Ermittlungen, vormals Jeremias Voss’ Agentur. Sie hatten bei uns angerufen.«
»Ja, ich bin Frau Brüning-Bolkow und wollte mit Herrn Voss sprechen.«
»Tut mir leid, Frau Brüning-Bolkow, Herr Voss arbeitet an einem Großprojekt und ist leider nicht verfügbar.«
»Aber ich wurde ausdrücklich an ihn verwiesen.«
»Herr Voss arbeitet schon seit einem Jahr nicht mehr hier. Ich bin sein Nachfolger. Ich bin sicher, ich kann Ihnen genauso gut helfen.« Um ihr keine Zeit zum Überlegen zu geben, fügte er hinzu: »Worum handelt es sich denn?«
Einen Augenblick herrschte Stille, dann sagte die Frau: »Na gut, sprechen können wir ja mal. Das ist jedoch noch kein Auftrag. Ich möchte Sie zunächst kennenlernen.«
»Das ist selbstverständlich und gilt für uns beide. Wollen Sie in die Agentur kommen, oder wählen Sie einen anderen Treffpunkt?«
»Ich komme zu Ihnen.«
»Sehr gut. Wann passt es Ihnen?«
»Haben Sie heute Abend um sechs Uhr Zeit?«
Hendriksen tat, als blättere er in einem Terminkalender. »Achtzehn Uhr ist okay. Sie wissen, wo Sie uns finden?«
»Wenn Sie noch im Mittelweg sind, dann ja, sonst weiß es hoffentlich der Taxifahrer.«
»Mittelweg stimmt, und die Taxifahrer kennen uns.«
Ob Frau Brüning-Bolkow die letzten Worte noch mitbekommen hatte, konnte Hendriksen nicht sagen, denn sie hatte schon aufgelegt.
Die Klientin erschien mit fünfzehn Minuten Verspätung. Anders als angenommen, schätzte er sie auf etwa sechzig. Sie war groß gewachsen, fast einen Kopf größer als er. Ihr Auftreten war selbstbewusst, auch wegen der streng blickenden, blauen Augen und der schmalen Lippen. Insgesamt eine Frau, die genau zu wissen schien, was sie wollte.
Hendriksen erhob sich bei ihrem Eintreten und begrüßte sie mit freundlicher Zurückhaltung. Dann stellte er Lizzi vor, die am Türrahmen zu ihrem Büro lehnte.
»Bitte nehmen Sie Platz.« Er deutete auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch, wartete, bis Frau Brüning-Bolkow sich gesetzt hatte, und nahm dann ebenfalls Platz.
»Wie können wir Ihnen helfen?«
Auf die Frage ging Frau Brüning-Bolkow nicht ein, sondern sah sich neugierig im Büro um, um schließlich Hendriksen und seine Verletzung ohne Scheu zu mustern. »Ich habe mir einen Privatdetektiv anders vorgestellt.«
Hendriksen konnte sich denken, worauf die Bemerkung hinauslief, und hatte schon große Lust, den Auftrag abzulehnen.
Lizzi, die an seinen zuckenden Wangenmuskeln sah, welche Reaktion zu erwarten war, griff schnell ein. Mit einem liebenswürdigen Lächeln sagte sie: »Wenn Sie mit Ihrer Bemerkung auf Dr. Hendriksens Körpergröße anspielen, dann haben Sie natürlich recht. Es gibt in Hamburg etliche Privatdetektive, die ihn an Länge überragen und auch größere Muskelpakete haben. An seine geistigen Fähigkeiten dürfte jedoch niemand auch nur annähernd heranreichen. Und ich gehe mal davon aus, Sie suchen keinen Privatdetektiv, der andere verprügeln kann, sondern einen, der Ihren Fall löst, und das, Frau Brüning-Bolkow, wird niemand schneller und nachhaltiger tun als Dr. Hendriksen und sein Team. Warum sonst hätte Herr Voss Dr. Hendriksen die Geschäftsführung seiner Agentur übergeben? Außerdem …«
»Lass es gut sein, Lizzi, sonst denkt Frau Brüning-Bolkow noch, du wolltest mich meistbietend versteigern.«
Frau Brüning-Bolkow hatte, während Lizzi sprach, ihre Aufmerksamkeit von Hendriksen weg auf sie gerichtet. Jetzt wandte sie sich zurück und sah ihn direkt an.
»Das war wohl keine gute Bemerkung, und schon gar kein guter Einstieg. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung. Ich hatte heute keinen guten Tag.«
»Ich weiß, dass Ihre Unternehmungen nicht so erfolgreich waren, wie Sie erwartet hatten«, antwortete Hendriksen.
Frau Brüning-Bolkow sah ihn mit großen Augen an. »Wie kommen Sie darauf?«
»Ihre dezente Business-Kleidung sagt mir, dass Sie geschäftlich in Hamburg sind, und Ihr verkniffener Mund deutet an, dass Ihre Geschäfte nicht so gelaufen sind, wie Sie gehofft haben. Meine Schlussfolgerung ist: Sie waren bei einer Bank und haben den erhofften Kredit nicht bewilligt bekommen.«
»Verblüffend!«
»Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte: Der Kredit war nicht für Sie. Im Grunde sind Sie noch nicht einmal böse, dass er nicht bewilligt wurde. Was Sie verärgert, ist, dass Sie nicht wie gewohnt Ihren Willen durchsetzen konnten. Ablehnung können Sie nur schwer ertragen.«
Frau Brüning-Bolkow sah ihn irritiert an. Offenbar hatte er mit seiner Bemerkung ins Schwarze getroffen.
»Haben Sie Erkundigungen über mich eingezogen?«, fragte sie nach einigen Sekunden argwöhnisch.
»Nein, warum sollte ich?«
»Wieso kommen Sie dann zu solchen Behauptungen, die übrigens im Wesentlichen richtig sind?«
»Sie standen, oder besser gesagt, sie stehen Ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch genug der Spielchen. Sind Sie nun bereit, mit uns über Ihr Problem zu sprechen?«
Wieder ließ sich Frau Brüning-Bolkow mit der Antwort Zeit. »Ich entschuldige mich nochmals für mein Auftreten. Sie haben mich überzeugt, dass ich an der richtigen Adresse bin. Mein Anliegen ist sehr eigenartig. Wenn ich Ihnen davon erzähle, werden Sie denken, ich fantasiere. Deshalb bitte ich Sie, daran zu denken, dass ich eine nüchterne Geschäftsfrau bin und mich nicht leicht von Spökenkiekereien einfangen lasse.«
»Keine Sorge, Frau Brüning-Bolkow, ich denke nichts dergleichen. Erzählen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Bitte ausführlich. Ich möchte das Gespräch aufzeichnen. Es erleichtert uns später die Arbeit und stellt sicher, dass wir nichts falsch verstehen. Habe ich dazu Ihre Genehmigung?«
»Ja.«
»Danke.«
Hendriksen holte ein Aufnahmegerät aus der Schublade des Schreibtischs, legte es auf den Tisch, drückte auf die Aufnahmetaste und sagte: »Donnerstag, achtzehn Uhr dreißig – Gespräch mit Frau Brüning-Bolkow. Anwesend Elizabeth Lambert und Dr. Marten Hendriksen.« Er schaltete das Gerät aus und sagte zu Frau Brüning-Bolkow: »Jetzt sind Sie an der Reihe. Erzählen Sie, weshalb Sie uns aufgesucht haben.« Er schaltete das Gerät wieder ein.
»Damit Sie mein Problem verstehen, möchte ich Ihnen kurz etwas zu unserer Familiengeschichte sagen. Die Bolkows sind ein sehr altes brandenburgisches Geschlecht. Es gab sie schon zur Zeit der Raubritter. Der Stammsitz der Familie ist Bolkow, heute ein halb verlassener Ort mit nicht einmal hundert Einwohnern, einer noch existierenden Dorfkneipe, einer verfallenen Burgruine und einem heruntergekommenen Schloss. Die beiden letzteren sind der sogenannte Stammsitz. Der Ort liegt direkt an der polnischen Grenze. Etwa die Hälfte des einst zu Bolkow gehörenden Landes liegt auf polnischer Seite. Nach der Wende forderte die Familie ihr Eigentum zurück und kam wieder in Besitz der Liegenschaft. Es wurden einige halbherzige Versuche unternommen, sie zu bewirtschaften, doch da die Hälfte des Bodens auf polnischer Seite liegt, scheiterten die Versuche, ihn wirtschaftlich zu machen. Meinen Mann und mich interessierte es wenig. Eine Cousine war die Besitzerin. Sie verstarb vor einem halben Jahr zusammen mit ihrem Mann – ein Autounfall –, und da sie keine Nachkommen hatte, war ich der einzige Erbe. Was bedeutete, dass ich plötzlich diesen unwirtschaftlichen Klotz am Bein hatte.«
»Darf ich fragen, was Sie und Ihr Mann tun?«
»Wir bewirtschaften zwei Hotels in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Mann und ich haben die Objekte nach der Wende gekauft und aufgebaut. Wir sind mit den Betrieben voll ausgelastet und haben keine Zeit, uns um den halb verfallenen Besitz in Bolkow zu kümmern. Deshalb wollte ich die Liegenschaft verkaufen.«
»Gibt es denn eine Chance zu verkaufen? So wie Sie das Anwesen beschreiben, scheint es für Investoren wenig attraktiv zu sein.«
»Sie haben völlig recht, die Chancen stehen schlecht. Inzwischen ist die Idee auch gestorben, denn meine Tochter, die sich sehr für die Familiengeschichte interessiert, hat sich vorgenommen, den Besitz zu übernehmen und ihm wieder zu altem Glanz zu verhelfen, wie sie sagt. Was sie sich im Detail vorstellt, ist mir nicht ganz klar. Offenbar will sie das Schloss zu einem Hotel ausbauen, einen Freizeitpark anlegen und die nahegelegene Burgruine als Spukschloss herrichten. Fragen Sie mich nicht, wie das im Einzelnen funktionieren soll.«
»Soweit habe ich alles verstanden«, sagte Hendriksen, der die Familiengeschichte hinter sich bringen wollte. »Was ich noch nicht erkannt habe, ist, worin Ihr Problem liegt.«
»Ich wäre gleich darauf zu sprechen gekommen. Meine Tochter hat mit den Arbeiten begonnen, und seitdem sind dort eigenartige Dinge geschehen. Der Baumeister, der sich den Dachstuhl ansehen wollte, fiel von der Leiter und brach sich das Genick. Ein Fahrer, der Fenster anliefern wollte, wurde abends von einer grellen, weißen Erscheinung geblendet, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Er kam mit schweren Verletzungen davon. Der Wagen hatte einen Totalschaden und die Fenster waren kaputt. Die Putzfrau meiner Tochter stolperte in der Dunkelheit auf ihrem Heimweg vom Schloss zum Dorf, brach sich das Bein und fällt für längere Zeit aus. Die Bank, bei der ich heute war, will den zugesagten Kredit erst genehmigen, wenn die Fälle aufgeklärt sind.« Frau Bolkow schwieg einige Augenblicke, bevor sie mit bewegter Stimme fortfuhr: »Es geht mir jedoch nicht um das Geld, sondern ich habe Angst, dass auch meiner Tochter etwas zustoßen könnte. Ich habe versucht, ihr das Projekt auszureden, doch sie ist so starrköpfig wie ihr verstorbener Vater.«
Frau Brüning-Bolkow schwieg. Ihre Lippen zitterten. Es war offensichtlich, dass sie mit ihren Gefühlen kämpfte. Hendriksen ließ ihr Zeit, sich zu sammeln. Schließlich beendete er das Schweigen.
»Dann ist Ihr Mann nicht der Vater?«
»Nein, ich habe nach dem Tod meines ersten Mannes wieder geheiratet.«
»Sie möchten also, dass wir die Hintergründe der Vorfälle aufklären?«
Frau Brüning-Bolkow schwieg wieder. Hendriksen hatte das Gefühl, dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders war. Er blickte zu Lizzi hinüber, doch die zuckte nur mit den Schultern.
Er wollte seine Frage gerade wiederholen, als sie zu sprechen begann. »Sie ist doch mein einziges Kind.« Sie sprach leise, mehr zu sich selbst. Dann schien sie zu merken, dass sie nicht bei der Sache war, richtete sich auf und sagte klar und deutlich: »Ich möchte, dass Sie meine Tochter beschützen und die Vorfälle aufklären.«
Wieder sah Hendriksen Lizzi an. Sie schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Was hat die Polizei unternommen?«, fragte Hendriksen.
»Nichts. Die hat die Vorfälle als Unfälle zu den Akten gelegt«, antwortete Frau Brüning-Bolkow aufgebracht.
»Wissen Sie, ob es früher schon ähnliche Vorfälle gegeben hat?«
»Ich glaube ja, aber die Einheimischen sprechen nicht darüber. Die Polizisten, die die Vorfälle untersuchten, haben so etwas erwähnt. Ich selbst weiß nichts davon.«
»Okay, das reicht uns erst einmal als Information. Wir werden eine Nacht darüber schlafen und Sie dann informieren, ob wir den Auftrag übernehmen. Eines kann ich Ihnen jedoch jetzt schon sagen. Wir übernehmen nur die Aufklärung der Vorfälle. Den Schutz Ihrer Tochter übernehmen wir nicht. Dies ist Aufgabe eines Personenschutzunternehmens. Beides können wir nicht leisten.«
»Sie sind doch eine Privatdetektei, wieso wollen Sie meine Tochter nicht beschützen?«
»Um genau zu sein, sind wir eine Agentur für vertrauliche Ermittlungen. Das ist nur dann zu leisten, wenn wir frei ermitteln können. Personenschutz hingegen bedeutet, dass sich die Bodyguards immer in der Nähe der zu schützenden Person aufhalten, was wiederum ein Ermitteln unmöglich macht. Warum engagiert sich Ihre Tochter keine Frau als Bodyguard?«
»Das habe ich ihr auch geraten, doch sie will davon nichts wissen. Sie hält meine Sorge sowieso für überspannt.«
»Das ist natürlich eine Einschränkung, die …« Er brach mitten im Satz ab, um nachzudenken. Ein paar Sekunden später fuhr er fort: »Der beste Schutz für Ihre Tochter ist, wenn die Fälle schnellstens aufgeklärt werden. Ich mache Ihnen deshalb einen Vorschlag. Sie rufen Ihre Tochter für ein oder zwei Wochen von Bolkow ab. Lassen Sie sich einen überzeugenden Grund dafür einfallen. Während dieser Zeit werden wir versuchen herauszufinden, ob es sich tatsächlich um eine ungewöhnliche Häufung von Zufällen handelt oder ob etwas anderes dahintersteckt.«
Frau Brüning-Bolkow dachte einige Augenblicke nach, dann hellte sich ihre Miene auf. »Ich denke, das könnte gehen.«
»Gut, das erleichtert uns die Arbeit. Was wir brauchen, ist ungehinderten Zugang zum Schloss und allen anderen Liegenschaften. Sollten Schlüssel existieren, so benötigen wir sie.«
»Die kann ich Ihnen morgen zuschicken.«
»In Ordnung. Wir fangen mit der Arbeit an, sobald der erforderliche Abschlag auf unserem Konto eingegangen ist.« Hendriksen erhob sich. »Frau Brüning-Bolkow, ich denke, für heute ist alles Erforderliche gesagt. Sie hören morgen von mir. Wenn Sie eine Geschäftskarte bei sich haben, geben Sie sie bitte Frau Lambert. Ansonsten wird sie die erforderlichen Daten notieren.«
Frau Brüning-Bolkow öffnete ihre Handtasche und entnahm ihr eine Visitenkarte, die sie Lizzi reichte.
Kapitel 2
»Gehen wir noch ein Bier trinken?«, fragte Lizzi, nachdem die Klientin gegangen war.
»Heute nicht. Es ist noch so schön warm, ich denke, ich werde es mir auf meiner Terrasse gemütlich machen. Wenn du Lust hast, kannst du vorbeikommen. Ich halte immer einen köstlichen Pfefferminztee für dich bereit.«
Sie standen im Eingang zur Agentur und sprachen, während Hendriksen sein Mountainbike auseinanderklappte und die Klemmriegel anzog.
»Brrr! Da mache ich doch lieber einen Zug um die Häuser.«
»Du hast keine Ahnung, welchen Genuss du verpasst.«
Hendriksen schwang sich auf sein Biki, wie er das Fahrrad liebevoll nannte, winkte Lizzi zu und fuhr los. Da er nur Nebenstraßen benutzte, kam er zügig nach Hamm-Süd. In der Süderstraße, gleich hinter der Braunen Brücke, lag sein Domizil. Ein Privatweg führte zu einem Anleger, an dem der zu einem Wohnboot umgebaute Alsterdampfer lag. Er hatte das Boot von seinem Vorgänger im Institut für Rechtsmedizin und Forensik übernommen. Den Namen Dwarsloeper, der in großen Buchstaben an Bug und Heck prangte, hatte er belassen.
Hendriksen schob Biki die Gangway hinauf, die das Boot mit dem Steg verband, schloss das Steuerhaus auf, lehnte das Rad gegen das Pult mit den Armaturen und stieg dann die fünf Stufen zum ehemaligen Fahrgastraum und jetzigen Salon hinunter. An der Steuerbordseite befand sich eine u-förmige Wohnlandschaft, gegenüber lag die Kombüse. Da sein Vorgänger Hobbykoch gewesen war, enthielt sie alles an Geräten, was zum Zubereiten anspruchsvoller Speisen notwendig war. Hendriksen hatte in den dreieinhalb Jahren, die er jetzt auf dem Boot wohnte, nur einen Bruchteil davon benutzt.
Im Anschluss an die Wohnlandschaft gab es einen Schreibtisch und gegenüber einen breiten Schrank zum Verstauen von Pütt und Pan. In der Mitte der Rückwand führte ein Gang in die Schlafkabine. An der Steuerbordseite stand ein französisches Bett. An der gegenüberliegenden Seite sorgten Einbauschränke für genügend Stauraum. Hinter dem Schlafzimmer befand sich das Bad mit Toilette und Dusche. Insgesamt stand ihm auf seiner sechsundzwanzig Meter langen und fünf Meter breiten Barkasse eine Wohnfläche von etwa sechzig Quadratmetern zur Verfügung.
Sein Vorgänger hatte fünfzehn Jahre auf dem Boot gewohnt und dafür gesorgt, dass es mit allem Luxus ausgestattet war. So gab es einen Anschluss für Frisch- und Abwasser und einen Stromanschluss. Die Zentralheizung wurde mit Heizöl betrieben. Angetrieben wurde das Boot von einem 130 PS starken Motor, den Hendriksen einmal jährlich warten ließ.
Er fühlte sich hier sehr wohl und konnte sich nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Zumal er auf dem Oberdeck noch eine Dachterrasse hatte, die genauso groß war wie sein Wohnraum. Als Mietwohnung wäre so etwas kaum bezahlbar gewesen. Er hingegen zahlte eine Liegeplatzgebühr, die den Bruchteil einer Wohnungsmiete ausmachte.
Hendriksen zog seinen Windbreaker aus und warf ihn auf den Schreibtischstuhl. Dann ging er zur Kombüse, öffnete eine Dose Kidney-Bohnen, schnitt zwei Chilischoten in kleine Würfel, zerteilte eine mittlere Zwiebel, briet diese in Kokosfett an, bis sie eine hellbraune Farbe hatte, und gab alles zusammen in einen Topf. Während das Ganze bei mittlerer Hitze köchelte, gab er einige Zweige Pfefferminze in eine Teekanne und goss heißes Wasser darüber. Als der Tee genügend gezogen hatte, füllte er ihn durch ein Sieb in eine Thermoskanne und brachte ihn zusammen mit seinem Lieblingsbecher auf die Dachterrasse. Anschließend holte er den Topf mit den Bohnen. Auf einen Teller verzichtete er – ein Teil weniger zum Abwaschen. Er setzte sich in einen Rattansessel, zog einen zweiten so zurecht, dass er die Beine darauf legen konnte, und löffelte seine Abendmahlzeit aus dem Topf. Als er fertig war, goss er etwas Pfefferminztee in den Topf, damit die Speisereste nicht am Boden festsetzten und er den Topf später nicht sauber schrubben musste. Dann schenkte er Pfefferminztee in den Becher und genoss mit geschlossenen Augen das Aroma des ungesüßten Tees. In diesen Augenblicken war er mit sich und der Welt zufrieden.
Der Entschluss, seinen Beruf als Rechtsmediziner aufzugeben und als Ermittler in Jeremias Voss’ Agentur einzutreten, war richtig gewesen. Arzt war er nur geworden, weil seine Eltern und Verwandten erwarteten, dass er mit einer Eins im Abitur Medizin studieren müsste. Er wäre auch ein guter Arzt geworden, wenn er es verstanden hätte, sein Mitgefühl für den Patienten auf Distanz zu halten. So aber belastete der tägliche Umgang mit dem Leid anderer seine Psyche.
Die Entscheidung, in die Rechtsmedizin zu wechseln, war noch schlechter gewesen. Zwar gab es hier kein Leiden mehr, dafür stieß ihn die Arbeit an den Leichen oder Leichenteilen ab. Obwohl er wusste, wie notwendig diese Tätigkeit war, empfand er sie als eine Verletzung der Würde der Toten. Es hatte nicht lange gedauert, dann hatte er eine regelrechte Leichenallergie entwickelt.
Diese psychische Belastung, das Zurückziehen in sich selbst, hatte dazu geführt, dass die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche gegangen war. Im Nachhinein war dies für ihn jedoch von Vorteil, denn sie war arg besitzergreifend und eifersüchtig gewesen. Von dieser Last befreit, hatte er die Kraft gefunden, eine sein ganzes Leben verändernde Entscheidung zu treffen. Der Schritt vom Arzt zum Privatdetektiv war gewaltig gewesen, er hatte ihn jedoch bis jetzt nicht bereut. Noch vor gut einem Jahr hatte er sich morgens zwingen müssen, zur Arbeit zu gehen; heute freute er sich darauf. Dass er sich für die Tätigkeit als Ermittler eignete, hatte er bewiesen, denn sonst hätte ihn Jeremias Voss nie zum Geschäftsführer seiner renommierten Agentur ernannt. Auf die Aufklärungsrate von hundert Prozent im letzten Jahr konnte er stolz sein.
Die wohlige Wärme, die Ruhe um ihn herum, der warme Pfefferminztee und der ruhige Fluss der Gedanken ließen ihn einschlummern.
»Halt! Identifizieren Sie sich! Alle Kanonen sind auf Sie gerichtet.«
Seine neueste Spielerei riss ihn aus dem Schlaf. Am Ende des Stegs hatte er zwischen zwei Holzpfosten eine Lichtschranke eingebaut. Jeder, der den Lichtstrahl unterbrach, löste einen Kontakt aus, der die Aufforderung über Lautsprecher erklingen ließ.
»Was soll der Quatsch?«, rief Lizzi.
Hendriksen stand auf und ging zur Reling. »Meine neueste Erfindung, um Besucher abzuschrecken – gut, nicht?«
»Na, ob das jemanden abschreckt? Mir kommt es eher so vor, als hättest du zu viel überflüssige Zeit, um Streiche aus deiner Jugend nachzuholen.«
Hendriksen grinste, zog sein Smartphone aus der Tasche und gab einen Code ein.
»Du kannst jetzt heraufkommen. Die Sperre ist ausgeschaltet.«
Als Lizzi auf dem Terrassendeck erschien, deutete er auf einen Rattansessel.
»Nimm Platz. Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs?«
»Du hast mich doch eingeladen. Schon vergessen?«
»Stimmt. Ich dachte jedoch, du ziehst lieber um die Häuser. Was darf ich dir als Erfrischung anbieten?«
»Nichts.« Lizzi öffnete ihre Handtasche und holte eine Flasche Bier heraus. »Bei dir bin ich lieber Selbstversorger.«
»Ich weiß nicht, was du gegen einen erfrischenden Pfefferminztee hast. Allein das Aroma regt zum Träumen an.«
»Brrr.« Lizzi nahm demonstrativ einen Schluck aus der Flasche.
»Hast du dir schon Gedanken über den Auftrag gemacht?«, fragte Hendriksen, um das Geplänkel zu beenden.
»Nicht wirklich. Willst du ihn annehmen?«
»Ich denke schon. Klingt irgendwie geheimnisvoll.«
»Geheimnisvoll? Ich weiß nicht so recht. Ich denke, das waren drei stinknormale Zufälle.«
»Im Grunde denke ich das auch«, gab er zu. »Wenn sie sich als solche herausstellen, dann haben wir auf die Schnelle ein paar Euros verdient, was auch nicht schlecht ist. Wenn nicht, dann haben wir einen interessanten Fall vor uns. Wenn ich ehrlich bin, dann wäre mir Letzteres lieber.«
»Könnte aber auch gefährlich werden«, gab Lizzi zu bedenken.
»Du meinst, jemand hat etwas zu verbergen, was ihm so wichtig ist, dass er dafür mordet?«
»Wäre durchaus möglich, oder?«
»Bereitet dir der Gedanke Sorgen?«
»Ja, das tut er.«
»Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja gar nicht!«
»Ich mache mir auch nicht Sorgen um mich, sondern um dich. Du bist, was Selbstverteidigung angeht, das reinste Baby, was dazu führt, dass du immer Prügel einsteckst, wie dein blaues Auge deutlich zeigt.«
»Übertreib nicht so maßlos. Manchmal, das gebe ich zu, kommt es schon vor, doch …«
»Du brauchst dich gar nicht rauszureden. Schließlich weiß ich, wie oft es passiert. Das aber ist es nicht, was mir Sorge bereitet, sondern … Wenn wir es wirklich mit einem Mörder zu tun bekommen, dann stehst du ihm ohne Waffen hilflos gegenüber.«
»Keine Sorge, mir fällt dann schon etwas ein.«
»Das möchte ich sehen, oder besser, ich möchte es nicht sehen. Und damit ich es nicht sehen muss, habe ich mir überlegt, dass ich dir einen Schnellkurs in Selbstverteidigung geben und dich im Umgang mit einer Pistole ausbilden werde.«
»Absolut unnötig«, begehrte Hendriksen auf. »Ich mag keine Waffen.«
»Dann solltest du dir einen anderen Beruf suchen. Morgen früh werden wir zu meinem Schützenverein fahren, und dort zeige ich dir, wie man schießt. Ausreden lasse ich nicht gelten. Und jetzt, mein lieber Chef, bekommst du eine Lektion in Selbstverteidigung.«
Hendriksen sah auf die Uhr und schüttelte den Kopf. »Zu spät. Wir fangen morgen damit an. Außerdem bin ich Invalide – das Auge.«
»Keine Ausreden. Du gibst dich doch sonst auch als tough guy«, sagte Lizzi und schüttelte vehement den Kopf. »Keine Chance! Wenn du den Auftrag annehmen willst, dann dürfen wir keine Zeit verlieren, dich fit zu machen. Sollte dir etwas passieren, will ich nicht schuld daran sein. Also fangen wir an. Einen Vorteil haben wir: Du bist Arzt und weißt, wo die kritischen Punkte liegen, die einen Menschen ausschalten können. Ich brauche dir also nur beizubringen, sie mit der richtigen Technik blitzschnell zu treffen. Bei deiner Statur ist Schnelligkeit das A und O.«
Widerwillig folgte er Lizzi zu dem Platz, den sie als Trainingsbereich ausgesucht hatte.
Zwei Stunden nahm sie Hendriksen in die Mangel. Immer wieder ließ sie ihn die gleichen Bewegungen wiederholen, bis sie zufrieden war. Sie selbst war die Zielperson. Sie wich seinen Bewegungen aus, bis er sie so schnell ausführte, dass sie sie nicht mehr abwehren konnte. Als sie merkte, dass er keine Kraft mehr hatte, brach sie das Training ab.
Hendriksen ließ sich in einen Sessel sinken und schnappte nach Luft. Er goss den Rest des Pfefferminztees in seinen Becher und stürzte ihn hinunter.
Auch Lizzi war außer Atem und durchgeschwitzt. Eine Weile saßen sie wortlos beieinander, um sich zu erholen. Dann verabschiedete Lizzi sich.
Am nächsten Morgen stieg Hendriksen mit einem Muskelkater aus dem Bett. Verärgert über seine schlechte Kondition, schwor er, etwas dagegen zu unternehmen.
Nach einem kleinen Frühstück mit Müsli und Obst ging Lizzi ins Büro hinunter, brachte die Kaffeemaschine in Gang und sah sich dann die eingegangenen E-Mails an. Das meiste waren Reklamen, die sie sofort löschte.
Als Dörte eintraf, holten sie sich Kaffee, gingen, während sie ihn tranken, die verbliebenen E-Mails durch und besprachen die Aufgaben für den Tag.
Hendriksen erschien kurz nach neun. Biki hatte er über der Schulter.
»Guten Morgen«, begrüßte er die Damen. »Gibt es etwas Neues?«
»Nichts Besonderes«, antwortete Lizzi. »Dörte und ich haben schon alles erledigt.«
Hendriksen sah seine Assistentinnen erstaunt an. »Gibt es einen Grund für eure Aktivität?«
»Gibt es. Wir beide müssen nämlich gleich los. Ich habe uns für zehn Uhr auf der Schießbahn in meinem Klub angemeldet.«
Hendriksen schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich jedoch anders. Schweigend brachte er Biki in sein Büro. Lizzi folgte ihm. Unaufgefordert berichtete sie ihm, was sie bezüglich der E-Mails veranlasst hatte.
Hendriksen nickte zustimmend.
»Ist etwas? Du bist so schweigsam. Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragte sie.
»Nein, alles ist gut. Du hast wie immer alles richtig gemacht.«
»Aber es bedrückt dich etwas, das sehe ich dir an.«
»Na ja, dass ich schießen soll, und wenn es nur auf eine Scheibe ist, belastet mich. Du weißt, ich hasse Feuerwaffen.«
»Ich weiß, doch in unserem Beruf muss man mit der Waffe umgehen können. Das kann nicht nur das eigene Leben, sondern auch das deines Partners oder Unschuldige retten.«
»Schon gut. Lass uns fahren.«
Der Schießstand lag an der Rissener Landstraße auf halber Strecke zwischen Blankenese und Rissen. Es war ein längliches, einstöckiges Gebäude, dreißig Meter von der Landstraße entfernt. Eine mannshohe Taxushecke schirmte es zur Straße hin ab. Auf der Rückseite reichte es bis an einen Golfplatz heran.
Lizzi stellte ihren roten Ford Escort auf dem Parkplatz vor dem Gebäude ab. Außer ihr befanden sich noch drei Autos dort.
Sie betraten den geräumigen Eingangsbereich durch eine breite Glastür. Eine Barriere teilte den Raum in zwei Bereiche. An dem Schalter in der Mitte der Absperrung saß ein Mann mittleren Alters. Er begrüßte Lizzi wie eine alte Freundin. Nach dem Austausch einiger flapsiger Bemerkungen trug sie sich und Hendriksen in eine Liste ein. Der Mann drückte auf einen Knopf, eine Tür schwang auf, und beide traten in den hinteren Raum. Von hier gingen zwei Türen ab.
Lizzi zeigte auf die linke. »Sie führt zu den Umkleideräumen.«
Sie gingen durch die rechte in den Schießbereich. Hendriksen zählte sieben Bahnen. Die Standplätze der Schützen waren durch Holzwände abgeteilt, Bahn eins war von einer Frau besetzt.
Lizzi ging zu den Schließfächern, die an der rückwärtigen Wand angebracht waren. Beim Schließfach Nummer elf gab sie einen Code ein, öffnete das Fach und entnahm ihm eine Sportpistole und zwei Kopfhörer.
»Wir üben zunächst mit einem kleinen Kaliber. Dabei ist der Rückschlag nicht so groß. Danach probieren wir Kaliber neun Millimeter.«
Sie schloss in ihrem Schließfach eine Schublade auf und entnahm ihr eine Schachtel mit Kleinkalibermunition. Dann wählte sie die Schießbahn Nummer sieben aus. Hier erklärte sie Hendriksen zunächst die Funktionsweise der Pistole und schob dann ein gefülltes Magazin in das Griffstück ein. Sie wies ihn an, den Kopfhörer aufzusetzen, und tat das Gleiche. Dann befahl sie ihm, die Pistole zu laden und zu entsichern, das Ziel anzuvisieren und zu feuern.
Hendriksen folgte ihren Anweisungen und zog den Abzugsbügel durch. Die Kugel schlug weit rechts neben dem Ziel ein. Der zweite Versuch war nicht besser, nur dass die Kugel oberhalb des Ziels eintraf.
Obwohl sie Hendriksen nach jedem Versuch korrigierte, blieben seine Schießleistungen miserabel. Nach dem zehnten Versuch nahm sie den Ohrenschutz ab.
»Marten, ich glaube, es hat keinen Zweck mit dir. Du scheinst zum Schießen kein Talent zu haben. Wir können uns deshalb die Übung mit dem Neun-Millimeter-Kaliber sparen.«
»Das hab ich dir doch schon immer gesagt, aber du wolltest mir nicht glauben.«
Lizzi konnte ihm ansehen, wie erleichtert er war.
Auf der Rückfahrt war sie schweigsam. Hendriksen war ihr dankbar dafür. Er fühlte, dass er sie enttäuscht hatte, was ihm leid tat. Er hatte nicht absichtlich so schlecht geschossen. Es war einfach seine Aversion gegen jede Art von Handfeuerwaffe. Dieses ungute Gefühl ließ ihn die Pistole immer kurz vor dem Schuss verreißen. Warum ihm Pistolen zuwider waren, konnte er nicht sagen. Es gab kein Erlebnis in seinem Leben, das dafür verantwortlich gemacht werden konnte. Dabei gab er Lizzi im Grunde Recht, wenn sie verlangte, dass er in diesem Beruf sich und andere verteidigen können musste.
Es war auch nicht so, dass er generell etwas gegen Waffen hatte. Er konnte gut mit Messer und Beil umgehen, treffsicher werfen. Auch mit Pfeil und Bogen war er vertraut. Er war zwar kein Robin Hood, traf jedoch auf vierzig Meter Entfernung fast immer ins Schwarze. All diese Fertigkeiten hatte er auf seinen Abenteuerreisen von Eingeborenen gelernt. Selbst den Gebrauch eines Blasrohrs hatten ihm Indianer am Amazonas beigebracht.
Er glaubte auch keine Probleme damit zu haben, solche Waffen gegen Menschen einzusetzen. An Feuerwaffen hingegen fand er keinen Gefallen. Es war das anonyme Töten, das Töten auf große Entfernung, das ihm widerstrebte.
Kapitel 3
Es goss in Strömen. Die Wassertropfen trommelten wie Hagelkörner auf das Dach des VW-Vans, und die Scheibenwischer kämpften vergeblich gegen die Wassermassen an. Hendriksen konnte nur im zweiten Gang fahren, denn er sah lediglich das verschwommene Nebelrücklicht des Vordermanns. Ein LKW rauschte an ihm vorbei. Die hochspritzenden Fontänen von den Hinterreifen schlugen gegen die Windschutzscheibe und nahmen ihm die restliche Sicht. Hendriksen fluchte und lenkte auf den Standstreifen der Autobahn Hamburg-Berlin. Im letzten Moment sah er eine Abfahrt. Fast wäre er vorbeigefahren. Er bog ab und rollte im Schritttempo auf einen Parkplatz. Völlig unvermittelt tauchte aus dem Regenschleier ein PKW auf. Er trat auf die Bremse und kam eine Handbreit hinter ihm zu stehen.
»Uff, das war knapp«, murmelte er.
Er griff in die Hosentasche, zog ein Stofftaschentuch heraus und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann schaltete er alle Lichter ein, kuppelte den Gang aus und zog die Handbremse an. Den Motor ließ er laufen, damit die Lichter die Batterien nicht entluden. Er blickte zu dem PKW vor sich. Die Lichter waren ausgeschaltet. Ob im Fahrzeug jemand saß, konnte er nicht erkennen, nur dass es hinten auf der Beifahrerseite ungewöhnlich tief herunterhing. Da niemand durch sein dichtes Auffahren aufgeschreckt worden war, beachtete er den Wagen nicht weiter, sondern ging nach hinten, klappte ein Wandbett herunter und legte sich hin, um das Unwetter entspannt vorüberziehen zu lassen.
Der VW-Van gehörte der Agentur und war von Jeremias Voss für längere Überwachungseinsätze hergerichtet worden. Neben zwei Sitzplätzen mit Tisch enthielt er die Liege, die Hendriksen jetzt benutzte, eine Chemietoilette, eine Miniküche mit einem Kühlschrank und an allen Seiten Fenster, durch die niemand von außen ins Innere sehen konnte.
»Hallo, können Sie mal die Tür öffnen?«, rief eine weibliche Stimme von draußen, kaum dass er sich ausgestreckt hatte. Gleichzeitig hämmerte es gegen die Seitentür.
Hendriksen sprang hoch und zog die Tür auf. Vor ihm stand eine junge Frau. Über ihren Kopf hielt sie eine Fußmatte vom Auto – ein höchst ineffektiver Schutz gegen die Sturzbäche vom Himmel. Ohne eine Aufforderung abzuwarten, sprang sie gewandt in den Van. Die klitschnasse Fußmatte warf sie nach draußen auf den Boden.
Hendriksen schob schnell die Seitentür zu, denn der Regen drückte durch die Türöffnung ins Innere.
Die Frau hatte inzwischen ihr Sweatshirt vom Körper gezogen und rubbelte sich damit die nassen Haare ab.
Hendriksen öffnete eines der über den Fenstern befindlichen Schapps, zog ein Handtuch heraus und reichte es ihr.
»Hat keinen Sinn, sich mit einem triefenden Pullover abzutrocknen«, sagte er lächelnd.
»Oh, vielen Dank.«
Er bemühte sich, nicht auf die wohlgeformten Rundungen zu blicken, die sich durch das ebenfalls feuchte Unterhemd abzeichneten. Seine Bemühungen waren jedoch nicht sehr erfolgreich, denn sie waren nicht in einem BH versteckt. Um nicht als Voyeur zu gelten, bückte er sich und zog eine Sporttasche unter einem der Sitze hervor. Er stellte sie aufs Bett und zog den Reißverschluss auf.
»Sie sollten sich trockene Sachen anziehen. Hier drinnen finden Sie alles, was Sie benötigen – Unterwäsche, Jeans, Sweatshirt. Die Sachen müssten Ihnen sogar passen, denn Sie scheinen etwas kleiner zu sein als ich. Sie brauchen auch keine Bedenken zu haben, die Kleidung ist frisch gewaschen. Und ich habe sie erst ein paarmal angehabt. Während Sie sich umziehen, setze ich mich auf den Fahrersitz und schiebe die Zwischentür zu.«
Bevor sie etwas sagen konnte, war er im Führerhaus verschwunden.
Es dauerte nicht lange, dann wurde die Metalltür zurückgeschoben.
Hendriksen schmunzelte. Die Frau drehte sich wie ein Model um die eigene Achse.
»Passt fast wie angegossen. In der Oberweite ein bisschen knapp, dafür ist die Hose in der Taille zu weit, aber sonst … Haben Sie vielen, vielen Dank. Es ist eine Wohltat, aus den nassen Klamotten zu kommen. Der Regen ist in den wenigen Augenblicken, die ich draußen war, bis auf die Haut durchgeschlagen«, sagte sie mit einem allerliebsten Lächeln.
»Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Ich hoffe, der Big Boss streicht mir dafür ein Minuszeichen in meinem Sündenregister. Übrigens, ich bin Marten.«
»Ich heiße Tina.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, auch wenn die Umstände sehr nass waren«, sagte Hendriksen, ging zur Pantry-Küche, drehte den Gashahn auf, ließ Wasser in einen Kessel laufen und stellte ihn auf den Gasherd.
»Mich freut es auch – sehr sogar. Und da ich schon Ihre Unterhose trage, können Sie ruhig Du zu mir sagen.«
Hendriksen grinste. »Das gilt auch für dich.«
Er bückte sich und zog einen Müllbeutel unter der Spüle hervor. »Hier, für deine nassen Sachen. Trocknen können wir sie hier drinnen doch nicht. Und nun setz dich. Ich brüh uns einen Pfefferminztee auf, damit du auch von innen warm wirst.«
»Ich denke, wenn ich meine Sachen über der Spüle auswringen und zum Trocknen ausbreiten darf, dann hilft das schon. Ich muss sie ja wieder anziehen.«
»Wieso anziehen? Wenn du dich nicht genierst, dann behältst du meine Klamotten an, bis du zu Hause bist. Du kannst sie mir anschließend zurückschicken.«
»Das geht wirklich nicht. Ich kann doch deine Sachen nicht anbehalten. Unmöglich.«
»Unsinn! Natürlich geht das. Ich will nicht daran schuld sein, wenn du dir eine Lungenentzündung holst. Und jetzt pack deine Sachen ein und setz dich.«
»Du bist wirklich sehr, sehr nett – danke.«
Tina war Hendriksen auf Anhieb sympathisch. Er mochte ihre unkomplizierte, direkte Art. Ihr hübsches Gesicht mit Grübchen in den Wangen und einer Stupsnase, dazu die großen, kastanienbraunen Augen und die langen Haare in der gleichen Farbe, gefielen ihm besonders.
Tina stopfte die nasse Kleidung gehorsam in den Müllbeutel. Als sie damit fertig war, stellte Hendriksen einen Becher Pfefferminztee und eine Packung Würfelzucker an ihren Platz. Das würzige Aroma erfüllte schnell den ganzen Raum.
Tina schnüffelte. »Hm, riecht ausgezeichnet.«
»Mein Lieblingsgetränk.«
»Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.«
Nachdem sie den Tee gesüßt und den ersten Schluck genommen hatte, sagte Hendriksen: »Nun erzähl, welchem Umstand ich es zu verdanken habe, dir helfen zu dürfen.«
Tina lächelte ihn an. »Das hast du lieb gesagt. Deine Frage ist schnell beantwortet – meiner Dusseligkeit! Ich hatte vergessen mein Smartphone rechtzeitig aufzuladen. Konnte daher keine Hilfe holen. Als ich an deine Tür klopfte, wollte ich dich nur bitten, einmal dein Handy benutzen zu dürfen. Trockengelegt zu werden, war nicht meine Absicht.«
»Probleme mit dem Auto?«
»Platten, und der Reservereifen ist ebenfalls platt.«
»Das ist wirklich Pech, vor allem, wenn man keine Hilfe rufen kann.«
»Wem sagst du das? Und bei dem Regen und der Sicht zur nächsten Telefonsäule an der Autobahn zu laufen, kommt einem Selbstmord gleich.«
Hendriksen zog sein Smartphone aus der Tasche und reichte es ihr. »Falls du den ADAC anrufen willst, die Nummer ist gespeichert. Ich werde derweil abwaschen.«
Tina telefonierte mit dem ADAC, wie Hendriksen aus dem Gespräch entnahm. Als sie fertig war, sagte sie: »In einer halben Stunde kommt Hilfe. Gewährst du mir so lange noch Asyl?«
»Mit dem größten Vergnügen.«
»Das ist lieb. Nun aber das Wichtigste. Wohin soll ich deine Sachen schicken?«
Hendriksen dachte einen Augenblick nach. »Ich habe in den nächsten Tagen auf einem Schloss Bolkow zu tun. Am besten …«
»Liegt das in der Nähe der polnischen Grenze nördlich von Görlitz?«
»Ja, kennst du es etwa?«
»Das Schloss selbst nicht, aber ich weiß, wo es liegt. Ich wohne nämlich nicht weit davon entfernt.«
»Ich glaub’s nicht. Die Welt ist ein Dorf. Schick mir die Sachen bitte dorthin. Die Besitzerin ist eine Frau Bolkow.« Hendriksen reichte ihr seine Geschäftskarte.
Tina las sie und sah ihn erstaunt an. »So, so, du bist ein Doktor und Privatdetektiv. Wie geht denn das zusammen?«
»Eine lange Geschichte. Erzähl ich dir, wenn du mich zum Kaffee einlädst.«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
Inzwischen hatte der Regen nachgelassen. Dafür prasselten jetzt Hagelkörner aufs Dach. Fünf Minuten später war auch dieser Spuk vorbei. Früher als erwartet traf der gelbe Engel des ADAC ein, und Tina verabschiedete sich. Sie wollte ihm nochmals danken, doch Hendriksen winkte ab. Dafür umarmte sie ihn und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Eine heiße Welle durchflutete ihn. Schnell setzte er sich auf den Fahrersitz und schaltete die Scheibenwischer ein. Sehen konnte er jedoch nichts, da die Windschutzscheibe und die Seitenfenster von innen beschlagen waren. Er stellte das Gebläse auf »Windschutzscheibe enteisen« und drehte die Heizung auf die höchste Stufe. Die Fenster auf der Fahrer- und Beifahrerseite ließ er nach unten und wieder hochfahren. Die Fenstergummis an den Türen reinigten die Scheiben so weit, dass er hinaussehen konnte. Er wollte gerade anfahren, als sein Smartphone klingelte. Lizzi rief an, wie er auf dem Display sah.
»Hallo, Lizzi, gut angekommen?«
»Alles bestens. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich nicht im Hotel Hubertus abgestiegen bin, sondern bei Petra wohne.«
»Wer ist Petra?«
»Petra Bolkow, die Besitzerin von Schloss Bolkow. Genau genommen ist sie nicht die Besitzerin. Doch die verworrenen Besitzverhältnisse erkläre ich dir später.«
»Wie kommst du denn dazu?«
»Erkläre ich dir alles später. Jetzt wollte ich nur einen neuen Treffpunkt mit dir ausmachen. Wo steckst du?«
»Etwa hundertsechzig Kilometer vor Berlin. Welchen Treffpunkt schlägst du vor?«
»Es gibt hier einen Ort, der nennt sich Weißkeißel. In dem Ort liegt der Gasthof Alte Schule. Dort können wir uns treffen. Du kannst dir da auch ein Zimmer mieten. Soll ich dir den Weg beschreiben?«
»Nicht nötig. Ich gebe ihn ins Navi ein. Buchstabiere den Namen.«
»Weiß, wie die Farbe, und keißel: Kilo, Emil, India, Sierra, Sierra, Emil, Lima.«
»Der Gasthof heißt Alte Schule?«
»Richtig. Wann denkst du, wirst du hier sein?«
Hendriksen überschlug im Kopf die Kilometer, die er noch fahren musste, addierte eine Dreiviertelstunde als Puffer und sagte: »Ich denke, ich bin gegen sechzehn Uhr dort.«
»Okay, ruf mich an, wenn du bei Kodersdorf die Autobahn verlässt. Die B115 Richtung Niesky und Bad Muskau geht direkt durch Weißkeißel. Ich benötige etwa eine halbe Stunde.«
»In Ordnung. Bis dann.«
»Nicht auflegen!«, rief Lizzi ins Telefon.
»Gibt’s noch was?«
»Ja, hast du schon in den Karton gesehen, den ich dir in den Stauraum unter den Sitz gelegt habe?«
»Nein, wie sollte ich? Was ist denn drin?«
»Sieh am besten selbst nach. Und nun tschüss.«
Die Windschutzscheibe bot inzwischen wieder klare Sicht, und die Hageldecke auf der Autobahn war bis auf kleine Reste abgetaut.
Hendriksen schaltete Gebläse und Heizung herunter und stellte die Beleuchtung bis auf das Abblendlicht auf »Aus«. Dann legte er den ersten Gang ein, wartete auf eine Lücke und gab Gas.
Während er mit hundertzwanzig dahinfuhr, beschäftigten sich seine Gedanken mit Tina. Allerdings nicht lange, dann siegte seine Neugierde und er fragte sich, was Lizzi unter einem der beiden Sitze im Beobachtungsraum deponiert haben mochte. So sehr er seine Fantasie auch spielen ließ, er kam zu keinem Ergebnis. Schließlich wurde die Neugier so groß, dass er bei der nächsten Raststätte abbog. Er hielt vor dem Restaurant, ging neugierig nach hinten und klappte den ersten Sitz hoch. In dem Stauraum lag eine Plastiktüte. Er holte sie heraus, öffnete sie und wollte nicht glauben, was er sah.
Die Tüte enthielt einen Schlagring, zwei Dosen Pfefferspray und einen Elektroschocker. Dabei lag ein Zettel.
Weil deine Schießkünste zu wünschen übrig lassen, musst du dich mit anderen Mitteln verteidigen. Ich habe dir dazu ein paar gängige Hilfsmittel besorgt. Bitte mach dich mit ihnen vertraut. Wer weiß, was uns bei unserem neuen Auftrag alles blüht. Ich sehe dich zwar schon den Kopf schütteln und vor allem den Schlagring missbilligend begutachten, doch für jemanden, der kein Boxer ist, ist er eine sehr gute Möglichkeit, die Schlagkraft zu verstärken. Der Elektroschocker ist ein besonderes Modell. Ich habe lange in Hamburg gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Bei diesem Modell können mittels Feder zwei spitze, etwa zwanzig Zentimeter lange Stahlnadeln ausgefahren werden. Der Federdruck reicht aus, um die Stahlspitzen durch leichte Kleidung (Anzug) dringen zu lassen. Damit kannst du den Gegner an jedem beliebigen Punkt seines Körpers ausschalten.Deine um deine Gesundheit besorgte Mitarbeiterin.
Hendriksen schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, was er denken sollte. Auf der einen Seite fand er die Besorgnis um seine Gesundheit rührend, auf der anderen ärgerte er sich über die Bevormundung. Unzufrieden mit seinen gemischten Gefühlen, entschloss er sich, einen Pfefferminztee zu trinken.
Er ging in die Gaststätte und stellte zu seinem Bedauern fest, dass der Ständer für Pfefferminztee leer war. Enttäuscht entschloss er sich, als Ersatz einen Becher Kakao und dazu zwei belegte Brötchen zu nehmen. An einem Tisch am Fenster nahm er Platz.
Es dauerte nicht lange, dann sorgte die entspannende Wirkung des Kakaos dafür, dass seine aggressive Stimmung verschwand. Jetzt kam es ihm kindisch vor, sich über Lizzis Fürsorge geärgert zu haben, anstatt ihr dankbar zu sein. Er war sich bewusst, dass er eine überspitzte Aversion gegen jede Art von Bevormundung hatte. Leider passierte es immer wieder, dass er gerade bei älteren Frauen, aber nicht nur bei ihnen, den Mutterkomplex weckte. Er führte es auf seine Größe und die schmächtige Gestalt zurück. Schon oft hatte er sich vorgenommen, solche weiblichen Bedürfnisse an sich abprallen zu lassen. Gelungen war es ihm jedoch meistens nicht.
Er verließ in ausgeglichener Stimmung die Raststätte und ging zu seinem Van. Er schlug den Autoatlas auf und prägte sich die Strecke nach Weißkeißel ein. Das Navi schaltete er aus. Wenn irgend möglich, verzichtete er auf die elektronischen Anweisungen. Er liebte es, die Fahrtstrecke im Kopf abzuspeichern und immer zu wissen, wo er sich geografisch gerade befand.
Die Fahrt zu seinem Ziel verlief ohne weitere Probleme. Einen Stau um Berlin herum konnte er dank der rechtzeitigen Warnung des Verkehrsfunks umfahren. Trotz dieser Verzögerung traf er eine halbe Stunde vor der Zeit beim Gasthof Alte Schule ein. Wie verabredet, hatte er Lizzi, als er von der Autobahn abfuhr, angerufen, so dass sie bereits zehn Minuten nach ihm die Gaststube betrat.
Als sie auf ihn zukam, sah Hendriksen, dass ihr Gesicht angespannt wirkte. Bevor er nach dem Grund fragen konnte, begrüßte sie ihn.
»Hallo, Marten.«
»Ebenfalls hallo. Hast du schon etwas herausgefunden?«
Lizzi ging auf die Frage nicht ein. »Hast du dir das Paket, das ich dir in die Sitzbank gelegt habe, angesehen?«
»Habe ich.«
»Und? Böse?«
»Im ersten Augenblick, ja. Du weißt ja, dass ich mich ungern bemuttern lasse.«
»Weiß ich. Doch du achtest so wenig auf deine Sicherheit, dass ich immer Angst habe, dir könnte etwas passieren. Schließlich sind wir hier wirklich am Arsch der Welt, und wir wissen nicht, was uns erwartet – deine Worte. Besser, du bist für alle Fälle gerüstet.«
»Schon gut, du hast ja recht, und ich bin dir wirklich dankbar. Nur hättest du mir sagen können, was du vorhast.«
Aus Lizzis Gesicht war die Anspannung gewichen. Mit einem Lächeln sagte sie: »Und du wärst damit einverstanden gewesen, dass ich die Sachen beschaffe?« Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern beantwortete die Frage gleich selbst: »Das willst du mir doch nicht weismachen.«
Hendriksen musste lächeln. »Wohl eher nicht.«
»Eben! Dich muss man vor vollendete Tatsachen stellen, wenn man etwas erreichen will. Du kannst nämlich ziemlich dickköpfig sein.«
»Das ist maßlos übertrieben. Doch lassen wir das. Zu meiner Frage. Hast du schon etwas erreicht?«
»Nein, dazu war die Zeit zu knapp. Ich habe mich zunächst mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht. Wie ich schon sagte, wir befinden uns am Ende der Welt. Der größte Ort im Umkreis von etlichen Kilometern ist Weisswasser. Die polnische Grenze ist nur wenige Kilometer von hier entfernt. Die Menschen sind gegenüber Fremden zurückhaltend. Vielleicht liegt es daran, dass es überwiegend Sorben sind.«
»Hatte ich dich vorhin richtig verstanden, du wohnst im Schloss?«
»Stimmt.«
»Wie bist du zu der Ehre gekommen?«
»Durch Zufall. Ich war in Bad Muskau. Liegt nur einige Kilometer nördlich von hier.«
»Ich weiß, wo es liegt.«
»Okay, ich bin also von dort die Straße an der Neiße entlang nach Süden gefahren. Ich wollte mir einen Eindruck von der Grenze zu Polen machen. Auf der Strecke traf ich auf einen Pick-up, der am Straßenrand stand und offensichtlich eine Panne hatte. Da wenig Verkehr herrschte, hielt ich an und fragte, ob ich helfen könnte, denn eine junge Frau stand ziemlich hilflos neben dem Wagen. Lange Rede kurzer Sinn: Ich bot an, sie zur nächsten Werkstatt zu fahren. Sie fragte mich, ob ich sie auch nach Hause fahren könnte. Na klar, sagte ich – und wo landeten wir? Ich nehme an, du kannst es dir denken – im Schloss Bolkow. Die junge Frau war niemand anders als Petra Bolkow, die Tochter, die wir beschützen sollen.«
»Du hast ihr doch hoffentlich nicht verraten, wer du bist und was du hier vorhast?«
»Natürlich nicht. Wofür hältst du mich? Sie bot mir einen Kaffee an, und darüber kamen wir ins Quatschen. Als sie hörte, dass ich einige Tage in der Gegend bleiben und mich in einer Pension einmieten wollte, bot sie mir an, bei ihr zu wohnen. Da wir beide uns auf Anhieb sympathisch waren, sagte ich zu. Außerdem dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über unseren Fall zu erfahren.«
Hendriksen schwieg einige Augenblicke, bevor er antwortete: »Gut gemacht. Als ihr Gast wird man dich nicht verdächtigen, herumzuschnüffeln.«
»Was hältst du davon, wenn ich sie in unser Vorhaben einweihe? Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mehr erfahren, als wenn ich weiter inkognito bleibe. Natürlich würde ich ihr klarmachen, dass sie nicht darüber reden darf. Es ist nämlich nicht leicht, das Gespräch immer wieder auf die Unfälle zu bringen, ohne verdächtig zu wirken.« Lizzi sah Hendriksen fragend an.
Der schwieg, um sich das Für und Wider zu überlegen.
»Ich denke, dein Vorschlag hat einiges für sich. Wenn du denkst, dass es für dich vorteilhaft sein könnte, tu es.«
»Übrigens, sie wohnt nicht allein. Ein älteres Ehepaar lebt ebenfalls dort. Er ist Hausmeister und sie Hauswirtschafterin. Unabhängig davon, hätte Petra sowieso nicht weg gekonnt. Sie hat nämlich seit einigen Tagen eine polnische Arbeitstruppe zum Renovieren im Haus. Arbeiter aus der Umgebung konnte sie nicht finden.«
»Das hat sie dir alles während des Kaffeetrinkens erzählt?«
»Natürlich nicht. Du vergisst, dass wir schon drei Tage zusammen sind, und dabei ergeben sich viele Gelegenheiten zur Unterhaltung.«
»Verstehe. Wenn du sie in deinen Auftrag einweihst, dann lass mich zunächst außen vor.«
»Mach ich. Wie hast du dir unsere Arbeit hier vorgestellt? Ohne eine glaubhafte Erklärung dauert es nicht lange und die Leute werden annehmen, dass du hier Nachforschungen anstellst. Die Menschen sind hier nämlich nicht nur verschlossen, sondern auch Fremden gegenüber sehr argwöhnisch.«
»Keine Sorge, du bist nicht die Einzige, die hier denkt. Ich werde als schrulliger Doktor, Spezialist für paranormale Vorgänge, auftreten. Mein Ziel ist es, die Einflüsse von Geistern auf die Unglücksfälle im Schloss nachzuweisen. Die entsprechende Ausrüstung habe ich mir in Hamburg noch besorgt.«
Lizzi lachte. »Meinst du das im Ernst?«
»Natürlich. Einen spinnerten Wissenschaftler wird niemand ernst nehmen. Ich kann problemlos herumschnüffeln, ohne dass jemand meine wahren Absichten erkennt.«
Obwohl Lizzi sich weiter über Martens Plan amüsierte, musste sie zugeben, dass dies eine gute Tarnung sein konnte.
»Wie gut kennst du den Ort Bolkow?«, fragte Hendriksen.
»Gut, denn er besteht nur aus ein paar Häusern, und erstaunlicherweise gibt es dort eine Kneipe, die sogar Zimmer vermietet. Allerdings hat sie nur drei, wie mir Petra erzählte.«
»Sehr gut, ich werde mich dort einmieten. Wir bleiben telefonisch in Verbindung. Wie ich vorgehen werde, weiß ich noch nicht. Das mache ich davon abhängig, was ich in dem Gasthaus so alles erfahre.«
Kapitel 4
Da Hendriksen den gleichen Weg benutzen wollte wie Lizzi, wartete er noch eine Viertelstunde, nachdem sie abgefahren war, und brach dann auf. Die Fahrt entlang des Grenzflusses Neiße führte durch die Muskauer Heide, eine Landschaft, die ein Refugium für die Tier- und Pflanzenwelt hätte sein können, wenn sie nicht durch den Braunkohleabbau entstellt worden wäre.
Schon nach einer halben Stunde erreichte Hendriksen das Dorf Bolkow. Es bestand in der Tat nur aus einigen Häusern und zwei dreistöckigen Gebäuden in Plattenbauweise. Hier am östlichen Rand Deutschlands gab es immer noch Anzeichen einstiger DDR-Wirtschaft. In der Mitte des Ortes lag die Gastwirtschaft Zum wilden Keiler. Der aus Holz geschnitzte Kopf eines männlichen Wildschweins hing über der Tür. Sonne und Wind hatten das Holz grau und rissig werden lassen. Wahrscheinlich war er genauso alt wie die Wirtschaft selbst. Gegenüber des Gasthofs zweigte eine Allee ab. Ein verbogenes Straßenschild zeigte, dass es von hier aus noch sechshundert Meter bis zum Schloss Bolkow waren.
Hendriksen parkte den Van neben der Eingangstür und stieg die fünf ausgetretenen Steinstufen zum Gasthof hoch. Er betrat einen verräucherten Raum. Bis hierhin schien das allgemeine Rauchverbot noch nicht vorgedrungen zu sein. Außer einem langen Tresen gab es noch fünf Vierertische und an der Seite zur Straße eine Sitzeckbank mit einem länglichen Tisch. Auf dem Tisch stand ein runder Aschenbecher, und darüber befand sich ein geschmiedetes Schild mit der Aufschrift Stammtisch. Zwei Männer mittleren Alters saßen daran. Vor jedem stand auf einem Bierdeckel ein Pilsglas.
Hendriksen grüßte höflich und ging zum Tresen, zog einen Barhocker hervor, setzte sich und bestellte ein Bier.
»Pils?«, fragte der Wirt hinter dem Tresen kurz. Dass weder er noch die Männer am Stammtisch seinen Gruß erwidert hatten, fand er eigenartig.
»Ja«, antwortete er genauso kurz angebunden.
Nachdem er einen Schluck genommen hatte, wandte er sich wieder dem Wirt zu. »Haben Sie ein Zimmer für mich?«
Der Wirt sah zu den beiden Männern am Stammtisch hinüber, als ob er von ihnen eine Erlaubnis benötige, Zimmer zu vermieten. Später erfuhr Hendriksen, dass einer der beiden Männer am Tisch der Wirt und der Mann hinter der Theke nur eine Aushilfe war.
Als vom Tisch keine Antwort kam, fragte die Bedienung: »Einzel- oder Doppelzimmer?«
»Einzelzimmer reicht mir.«
Die Bedienung zog einen Block unter dem Tresen hervor und schob ihn zusammen mit einem Kugelschreiber zu Hendriksen hinüber.
»Sie müssen sich eintragen. Wie lange bleiben Sie?«