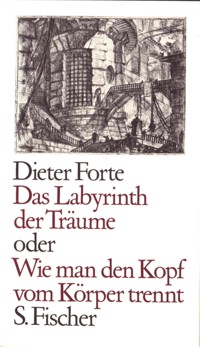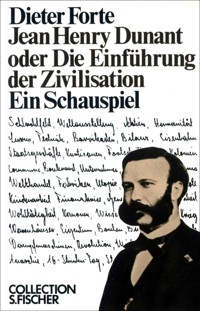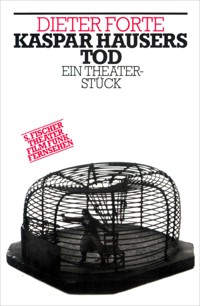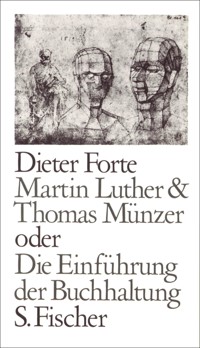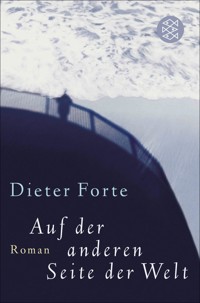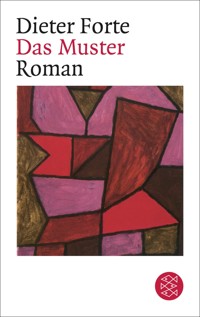
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Familien durchleben Höhen und Tiefen der Geschichte: Die Fontanas stammen aus Italien, wo sie seit der Renaissance die Kunst des Seidenwebens betreiben. Geschätzt wegen ihrer wertvollen Arbeit, aber auch verfolgt wegen Unbeugsamkeit und Freiheitsliebe, wandern sie von Lucca über Florenz und Lyon bis ins Rheinland, wo sie sich in Düsseldorf niederlassen. Dort treffen sie auf die polnische Bergarbeiterfamilie Lukacz, die Elend und Hunger gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Rücken zugewandt hat, um im industriell aufblühenden Ruhrgebiet ein besseres Leben zu finden. Als sich im Jahr 1933 die beiden Familien schließlich durch Hochzeit verbünden, repräsentieren sie eine fürs Rheinland typische Verflechtung aus südlicher Lebensfreude und östlicher Melancholie, aus Wissen und Frömmigkeit, Unabhängigkeit und Pflichtbewusstsein. »Das Muster« ist ein Buch der großen Historie und der kleinen Geschichten – und der Toleranz. Indem es die Identität Europas als ein Netzwerk von Völkern und Sprachen, Religionen und Eigenheiten charakterisiert, ist es voller Weisheit und Wissen, voller Menschlichkeit, Witz und Vitalität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dieter Forte
Das Muster
Roman
Über dieses Buch
Zwei Familien durchleben Höhen und Tiefen der Geschichte: Die Fontanas stammen aus Italien, wo sie seit der Renaissance die Kunst des Seidenwebens betreiben. Geschätzt wegen ihrer wertvollen Arbeit, aber auch verfolgt wegen Unbeugsamkeit und Freiheitsliebe, wandern sie von Lucca über Florenz und Lyon bis ins Rheinland, wo sie sich in Düsseldorf niederlassen. Dort treffen sie auf die polnische Bergarbeiterfamilie Lukacz, die Elend und Hunger gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Rücken zugewandt hat, um im industriell aufblühenden Ruhrgebiet ein besseres Leben zu finden. Als sich im Jahr 1933 die beiden Familien schließlich durch Hochzeit verbünden, repräsentieren sie eine fürs Rheinland typische Verflechtung aus südlicher Lebensfreude und östlicher Melancholie, aus Wissen und Frömmigkeit, Unabhängigkeit und Pflichtbewusstsein. »Das Muster« ist ein Buch der großen Historie und der kleinen Geschichten – und der Toleranz. Indem es die Identität Europas als ein Netzwerk von Völkern und Sprachen, Religionen und Eigenheiten charakterisiert, ist es voller Weisheit und Wissen, voller Menschlichkeit, Witz und Vitalität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Der Plan
I Chronik und Erzählung
II Das Leben geht weiter
III Die Zeit steht still (Teil 1)
III Die Zeit steht still (Teil 2)
Für Marianne
Die Völkerwanderungen, die der Geschichtsschreiber, gelenkt von den trügerischen Reliquien aus Steingut und Bronze, auf der Landkarte festzuhalten sucht, und welche die Völker, die sie herstellen, nicht begriffen.
Die Gottheiten der Morgenröte, die weder Götterbild noch Sinnbild hinterlassen haben.
Die Furche von Kains Pflug.
Der Tau auf dem Gras des Paradieses.
Die Hexagramme, die ein Kaiser auf dem Panzer einer der heiligen Schildkröten entdeckte.
Die Gewässer, die nicht wissen, dass sie der Ganges sind.
Das Gewicht einer Rose in Persepolis.
Das Gewicht einer Rose in Bengalen.
Die Gesichter, die eine Maske sich aufsetzte, die eine Vitrine bewacht.
Der Namen von Hengists Degen.
Shakespeares letzter Traum.
Die Feder, welche die merkwürdige Zeile niederschrieb: He met the Nightmare and her name he told.
Der erste Spiegel, der erste Hexameter.
Die Buchseiten, die ein grauer Mann las und die ihm enthüllten, dass er Don Quijote sein könnte.
Ein Sonnenuntergang, dessen Röte in einer Vase von Kreta überdauert.
Das Spielzeug eines Knaben, der Tiberius Gracchus hieß.
Der goldene Ring des Polykrates, den der Hades verwarf.
Da ist kein Einziges dieser verschollenen Dinge, das jetzt keinen langen Schatten wirft und nicht das bestimmt, was du heute tust oder was du morgen tun wirst.
J. L. Borges
IChronik und Erzählung
1 Von Luoyang nach Changang über Lou Zhou und Dun Huang nach Lop-Nor, um die Wüste Takla Makan nach Karashar, nach Khotan und Kashgar, über das Hochland von Pamir nach Tashkent, Samarkand, Hamadan, Palmyra zum Hafen von Antiochia; lange Karawanen aus fremden Ländern mit alten Geschichten von der Kaiserin Lei Zu, die in ihren Gärten in der Ebene des Gelben Flusses von einer Schlange angegriffen auf einen Maulbeerbaum flüchtete, auf dessen Blättern kleine hässliche Raupen durch dünne selbstgesponnene Fäden sich in harte Kokons verwandelten, aus denen erneut verwandelt zarte Schmetterlinge schlüpften; mit der Geschichte des großen Kaisers im Osten, der so kostbare Seidengewänder trug, dass alle Gesandtschaften ehrfürchtig davon berichteten, der bei Strafe des Todes verbot, das Geheimnis des Maulbeerbaumes und der Seidenraupe über die Grenzen seines Reiches zu tragen, und in seiner Hauptstadt auf hohen Stangen die Köpfe derer ausstellte, die das Verbot missachteten.
2 Die Nacht war so schwarz wie das Wasser, durch das der flache Kahn glitt. Sie hatten lange gewartet, die mondlose Stille abgewartet, dann den Kahn ins Moor gestoßen und, mit den langen Stangen sich abdrückend, die Wasserwege gesucht, die das Moor durchzogen, mit den Händen im Wasser die leichte Strömung erfühlt, mit den Stangen das Boot weitergestoßen, wenn es im Schlick oder im Ried hängen blieb, sich nicht mehr fortbewegte, schweigende, schweißtriefende Arbeit in der kalten Nacht, in der Dunkelheit, die ohne ein Zeichen war.
Dämmerte der Morgen im Dunst des Moores, schoben sie den Kahn tiefer in das nasse Gestrüpp, warteten reglos auf die nächste Nacht, die sie weiterbringen sollte, saßen auf diesem langen, schmalen Boot, das sie selber gezimmert hatten, unter schweren, dicken Umhängen, von der Nässe vollgesogen, stumm wie Erdhügel, auf diesen Holzbrettern, die ihre Heimat waren, und warteten auf die Nächte, die ihr Schutz waren, in denen sie ihren Weg suchten.
3 Im hellen Licht der sizilischen Sonne, in Palermo, der schönsten Stadt der Welt, wie Idrisi berichtet und Ibn Dschubair schwärmt, dem Königssitz des reichsten und zivilisiertesten Staates Europas, mit seinen hochgebauten Palästen, Kirchen, Synagogen, Moscheen, Herbergen, Bädern, Kaufläden; seinen belebten Straßen und Parkanlagen, in denen Sarazenen, Juden, Griechen, Byzantiner, Römer in allen Sprachen miteinander redeten; saßen in den Werkstätten der normannischen Könige Seidenweber aus Theben und Athen, Korinth und Byzanz, die das byzantinische Seidenweben mit den alten Webmustern der Araber verbanden, und schufen gemeinsam den großen königlichen Umhang in scharlachroter Atlasseide, gefüttert mit Goldbrokat, und als Muster, engumschlungen, den normannischen Löwen mit dem Kamel der Sarazenen; und trugen es ein in kufischen Zeichen, der alten würdigen arabischen Schrift, dass sie diesen königlichen Umhang webten: »Im Jahre der Hedschra 528, im Jahre 1133 nach Christus in der glücklichen Stadt Palermo«, den Krönungsmantel Kaiser Friedrichs II. Stupor Mundi, der die Welt in Erstaunen versetzende, den Krönungsmantel des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
4 Auf dem Eichberg, dort wo die Eiche mit dem verwirrenden Astwerk stand, dieser starke alte Baum, der seine Äste und Zweige ruhig über den Hügel legte, stand der Alte, genannt der Bärtige, der nur einmal im Jahr hier erschien, und breitete um Mitternacht seine Arme weit aus. So stand er lange Zeit mit geschlossenen Augen, schrie plötzlich laut auf, schrie die heiligen, schützenden, für alle anderen unverständlichen Worte und verdammte die Rod und die Rodjanitza und verjagte sie und bannte sie von diesem Land.
Im Schein des Vollmonds standen in einem respektvollen großen Kreis stumme Gestalten, Bauern aus den umliegenden Dörfern, vor ihren Füßen Holzgefäße mit Weizen, Honigbrot und Most, Weidenkörbe mit lebenden Hühnern und Gänsen, Opfergaben, die sie dem Swarog und seinem Sohn Dazbog brachten, die guten Götter, die das Getreide trockneten. Auf ein Zeichen des Bärtigen legten sie ihre Gaben in die Mitte des Kreises, traten wieder zurück in ihren stummen Kreis und warteten. Als die Morgendämmerung mit dem Nebel aufstieg, verbeugten sie sich tief gegen die schwache Helligkeit, danach ergriff der Bärtige das geschnitzte Eichenbrett mit dem groben Gesicht des Perun, dem Gott des Blitzes, trug es zum Fluss hinab und warf das Brett ins Wasser zu den Bereginen, den Flussnymphen. Die Bauern, die ihm gefolgt waren, nahmen die langen Stangen von den Booten, mit denen sie gekommen waren, stießen das schwimmende Brett mit den Stangen in die Mitte des Flusses und riefen: »Verschwinde, Perun verschwinde.« Sie riefen es so lange, bis das schwimmende Stück Holz nicht mehr zu sehen war.
Das wurde in jedem Frühjahr so gemacht, seit man sich erinnerte, und jede Generation erzählte es der nächsten Generation.
5 In der Dämmerung der Morgenfrühe, so die Erinnerung, kurz bevor die aufgehende Sonne ihre schmalen Streifen durch die engen Gassen der Stadt Lucca zog, sah man Messer Fontana auf seinem täglichen Gang zur Kathedrale San Martino. Er verbeugte sich kurz vor der Figur des heiligen Martin, der auf der weißen Marmorfassade sein Seidencape mit einem Bettler teilte, ging an dem im Portikus eingemeißelten Labyrinth vorbei und stand dann lange, in Gedanken versunken, in der dunklen Kathedrale vor dem von brennenden Kerzen erhellten Volto Santo, dem Heiligtum der Stadt Lucca, einem Kruzifix aus den Zedern des Libanon, das vor langer Zeit am Strand angeschwemmt wurde. Einige erzählten auch, es sei mit den Seidenwebern in die Stadt gekommen, die Palermo verließen, nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. und nach der Sizilianischen Vesper am Ostermontag des Jahres 1282, dem Aufstand gegen die Tyrannei der Franzosen, um sich in der freien Republik Lucca anzusiedeln.
Messer Fontana, geboren zu Lucca, dieser alten Stadt, entstanden aus einer Stadt der Etrusker, war Seidenweber, und im Musterbuch der Fontana finden sich von seiner Hand in griechischer Sprache, die damals noch die Sprache der Seidenweber war, die ersten Eintragungen: »Im dritten Mond müssen die Maulbeerbäume geschnitten werden, und die Frauen müssen mit der Zucht der Seidenraupen beginnen. Wechsle nach jedem dritten und fünften Faden, wechsle die Zahl, wechsle wieder, und gestalte das Muster unter dem Himmel, dies nennt man Brokat.«
6 Er baute sich das Haus auf einem Hügel aus Torf, den er den ganzen Sommer über gestochen hatte. Im nahen Birkenwald schlug er einige kleine Bäume, rammte die Stämme in den Boden und hatte einen starken, festen Grund. Die beim Dammbau liegen gebliebenen Eichenstämme zog er mit einem gemieteten Ochsen auf seinen Grund, mit einem Beil schlug er die schweren Holzbohlen viereckig, errichtete ein Rechteck und drehte die aufeinandergeschichteten Stämme so, dass sie fest aufeinanderlagen. Er füllte die Zwischenräume mit Torf, stampfte den Boden mit Lehm, den ihm ein Bauer brachte, deckte das Dach mit Stroh und nagelte aus einigen Abfallbrettern eine Tür. Dann zog er mit seiner Frau und den Kindern ein und wartete über den ganzen Winter, ob das Haus stehenblieb. Als es Frost, Schnee und Frühjahrsstürme überstand, war er zufrieden.
7 Giovanni Fontana liebte es, an heißen Nachmittagen in seinem stadtbekannten leichten karmesinroten Umhang im Schatten der Steineichen über die Wälle von Lucca zu promenieren. Es war Tradition in Lucca, dessen Bürger als vernünftig, stolz und freiheitsliebend galten, die freien Plätze, die Dächer der hohen Wohntürme, ja selbst den Stadtwall mit immergrünen Steineichen zu bepflanzen. Der Blick auf die Stadt war daher ein angenehmer Wechsel von dunklem Grün und warmem Ziegelrot verschachtelter Hausdächer, ein Bild voller Harmonie, das sich übergangslos in die Landschaft fügte. Auf dem Wall, unter einem lichtblauen Himmel, spürte man den Wind des nahen Meeres. Am Horizont sah man das harte, blendende Weiß der Marmorberge von Carrara und in der Ebene davor die geordneten Reihen der Maulbeerbäume.
Die freie Republik Lucca in der Toscana war die Hauptstadt der Seide, und Giovanni Fontana hatte seinen Anteil daran. Er war Gonfaloniere seines Stadtviertels, Vorsteher der Seidenweber und bestimmte mit den Bankiers und Handelsherren der Stadt das Schicksal dieser Republik. Luccas Seidenstoffe waren kostbar.
Auch Fontanas Werkstatt, die über zwanzig Seidenweber an sechs Webstühlen beschäftigte, webte den tiefgrünen und den leuchtend roten Brokat mit dem Gold- und Silbermuster, webte Seide und Gold auf einem Webstuhl in einem einzigen Webvorgang – eine Kunst, die nur die Seidenweber von Lucca beherrschten – zu paarweise aufsteigenden Löwen, umgeben von Ornamenten aus Blättern und Ranken. Die Kurie in Rom war ein unersättlicher Abnehmer dieser prachtvollen Arbeiten, und die Seidengewänder der Familie Fontana hingen in der päpstlichen Schatzkammer.
Als er vom Wall in das Viertel der Seidenweber zurückkehrte, empfing ihn schon von weitem das vertraute rhythmische Schlagen der Webstühle, das den Tag der Seidenweber genauer einteilte als der Glockenschlag von San Martino. In den Seitenstraßen der Färber hingen die frisch gefärbten bunten Seidenstoffe zwischen den Dächern der schmalen Häuser, leuchteten in der Sonne und tauchten die Gassen in ein orientalisches Licht. Vor seiner Werkstatt wurde ein neuer Kettbaum aufgebäumt. Die Kettfäden zogen sich durch die ganze Straße, und während sein Sohn die schwere Arbeit beaufsichtigte, saß sein Enkel lachend und schreiend auf dem zentnerschweren Marmorblock, der die Kettfäden spannte und sich mit jeder Umdrehung des Kettbaums mit einem kleinen Ruck nach vorn bewegte.
Er schaute noch kurz in die Werkstatt, wo seine Tochter mit anderen Frauen die Kettfäden eines Kettbaumes, der schon auf dem Webstuhl lag, in die Litzen einzog, die später an den Schäften befestigt wurden. Eine Arbeit, die Geduld und Konzentration erforderte, ein falsch eingezogener Kettfaden konnte das Muster zerstören. Einige Frauen spulten die farbigen Schussgarne auf die kleinen Rollen der Weberschiffchen, die dann in der genauen Folge des Webmusters griffbereit auf den Webstuhl gelegt wurden. Diese Vorbereitung des Webens war langwierig und oft komplizierter als das Weben selbst, und in diesen Tagen herrschte in der Werkstatt eine angespannte Atmosphäre. Fehler in der Vorbereitung konnten einen Webstuhl für Tage zu einem nutzlosen Instrument machen, sie konnten einen ganzen Auftrag gefährden.
Giovanni Fontana ging daher, ohne ein Wort zu verlieren, die schmale Treppe zum ersten Stock seines Kontors hinauf, holte das große, schwere Musterbuch aus einer Lade, schlug es auf und arbeitete weiter an der genauen Aufzeichnung eines neuen, von ihm entworfenen Musters: Auf rosa Atlasgrund zogen feine blaue Ranken ein Netz aus regelmäßigen Spitzovalen, in denen Drachen, Pfauen und Einhörner ihr Spiel trieben. Die Flügel und die Schweife der Tiere, die Blätter an den Ranken wurden so überreich mit Gold durchschossen, dass das Gold die Seide fast verdeckte. Für diesen Stoff lagen viele Bestellungen aus den europäischen Königshäusern vor, so dass die Arbeit der nächsten Jahre gesichert war.
8 Er wurde auf die Festung gebracht, weil er den Damm durchstochen hatte, um die alten Fischgründe zu erhalten, die der Fluss jedes Jahr im Bruch schuf. Fische im Überfluss, mit der Hand zu fangen, mit kleinen Netzen, Fische, die der Damm, der durchs Bruch gezogen wurde, um das Land vom Wasser zu trennen, nun in den Flusslauf zwang. Zehn Jahre Festung, so das Urteil, das der Fischer nicht verstand. Er gab zu, den Deich durchstochen zu haben, denn die Fische und er, und mit ihm sein flaches Boot, waren vorher da, und der Deich war ein Unrecht an ihm und an dem Fluss, dem er einen neuen Weg aufzwang.
Er starb in der Festung. Es war der erste Sohn. Er wurde in die Erde gelegt unter der alten Eiche, dem Ort, den sie sich als Friedhof gewählt hatten.
9 »Wir haben den Uguccione nicht gestürzt, damit sich Castruccio zum Herzog macht. Er wollte Capitano del popolo sein. Aber er hat das Bürgerstatut nie beachtet, und als Herzog von Lucca wird er es ganz abschaffen. Lucca wird keine Republik mehr sein. Das wird ein schöner Martinstag.«
Gianni Fontana, der Enkel des Giovanni, saß in dem alten, engen Kontor mit seinem jüngeren Bruder Paolo, der gerade als Teilhaber in die Firma eingetreten war, und seiner Frau Anna, Tochter eines Bankiers in Lucca, eine stolze, schöne Frau, die auch am Werktag nur in Seidenkleidern ging und ihr schwarzes, mit Goldfäden durchwirktes Haar wie eine Krone trug.
»Lucca wird sich wieder freikaufen«, war ihre Antwort.
Gianni stand auf, er war sehr groß und musste sich in diesem kleinen Kontor immer etwas bücken. »Die Bankiers von Lucca haben es gut, sie haben ihr Geld irgendwo in Europa, in Lucca haben sie nichts, worauf der neue Herzog seine Hand legen könnte. Wir haben unsere Werkstätten hier, wir sind leicht zu fesseln.«
Anna zeigte auf das Musterbuch, das wie ein entscheidendes, ausschlaggebendes Gewicht vor ihnen lag. »Im Buch steht, wer sich von den Maulbeerbäumen entfernt, der verliert seine Freiheit.«
»Im Buch steht auch, wer den Kokon nicht zeitig abstreift, der verliert sein Leben«, antwortete Gianni.
Paolo meinte, dass in diesem Buch sehr vieles stehe, nur nicht, wohin man jetzt gehen solle.
Gianni entfaltete ein Schreiben und zeigte es den anderen.
»Venedig bietet den Seidenwebern aus Lucca ein eigenes Stadtviertel am Ponte di Rialto. Florenz bietet sofortige Aufnahme in die Zunft.«
Nach langem Schweigen sagte Anna: »Florenz liegt nahe bei Lucca. Die Maulbeerbäume wachsen dort auch. Und es ist eine freie Republik.«
So verließ die Familie Fontana Lucca am Vorabend des Martinstages des Jahres 1327. An einem Tag, an dem sonst die Seidenweber feierten und jedes Jahr wetteiferten, wer das schönste Seidencape für San Martino gewebt hatte, an dem Tag, an dem sich jetzt Castruccio Castracani zum Herzog über Lucca einsetzte. Sie benutzten das Durcheinander am Vorabend des Festtages, um mit anderen Seidenwebern durch ein von Freunden geöffnetes Stadttor zu ziehen. Ihre Kinder zogen mit Lichtern voran und gaben dem Auszug den Anschein einer abendlichen Huldigung an den neuen Herzog, aber hinter dem Stadttor wurden die Lichter gelöscht, und die Menschen zogen schweigend durch die Nacht.
Die Familie Fontana ließ ihre Werkstatt, die Webstühle, das Stofflager und alle andere Habe zurück. Sie besaß nur noch das Musterbuch, einige kostbare Stoffe und das Wissen, wie man Seide webt.
10 Der flache Kahn trieb auf dem Fluss, der leise glucksend langsam durchs Bruch zog, im nächtlichen Schatten der Bäume, die mit Zweigen und Wurzeln sich vom Land ins Wasser neigten. Der Kahn drehte sich in den Strudeln, hing an einem Zweig, kam wieder frei, zog weiter, wie der Fluss weiterzog, an den verschlammten Ufern, den sandigen Inseln vorbei, in großen Bewegungen und gegenläufigen Strömungen, die den Kahn festhielten und mit einem Ruck wieder freigaben. In einer fast unmerklichen Bewegung, in einem labyrinthischen Kreisen zog der Kahn durch die Nacht mit ihren kalten klaren Sternen, die im Wasser aufblitzten, an die sich auch der Fluss hielt, der immer breiter wurde, schneller wurde, durch Seitenarme und Kanäle mit leichter Strömung in den Hauptarm mündete, sich vereinigte mit dem Wasser aus den fernen Bergen, schneller trieb das Boot, und das Ufer entfernte sich unter dem gleichbleibenden Sternenhimmel.
Ein Fischerboot fing den Kahn ein, kurz vor der Meeresmündung, der junge Mann, der darin lag, war tot. Das war der Sohn des Sohnes. Auch er wurde begraben unter der alten Eiche, unter der jetzt schon viele in der Erde lagen.
11 Anna erinnerte die Familie an jedem Jahrestag der Flucht an Das Gespräch von Lucca und an die Anfänge in den feuchten Seidenkellern von Florenz, dunkle Gewölbe, die niemals trocknen durften, damit die Seide beim Weben ihr Gewicht behielt.
Es gab zwar genug Seidenhändler in Florenz, die Webstühle und Seidengarne zur Verfügung stellten, aber die Webstühle und das Garn blieben ihr Eigentum. Die Webmuster wurden vorgeschrieben, die gewebten Stoffe mussten zum festgelegten Preis und zum festgelegten Termin abgeliefert werden. Kleinmeister nannten sich diese im Auftrag großer Handelshäuser arbeitenden Seidenweber. Sie waren an ihren Auftraggeber gefesselt, wollten sie nicht den Webstuhl verlieren, an das bestellte Muster, an die Konjunktur und die dadurch diktierten Preise. So webten die Fontanas am Anfang die gefragten Florentiner Muster, Szenen aus der Bibel, Engel, die Madonna in der Mandorla, das Christusmonogramm. Schmale Rapporte, die sich auf dem breiten Florentiner Webstuhl immer wiederholten, später dann, auseinandergeschnitten, als Besätze auf Paramente, den Messgewändern der Priester, appliziert wurden, aber damit hatten die Fontanas schon nichts mehr zu tun. Die Arbeit war aufgeteilt, in kleine Einheiten zerlegt, jeder hatte nur seinen Teil beizutragen, das Produkt, das schöne Gewand, sah nur der Händler.
Anna, die von ihrem Vater her etwas von den Finanzen verstand und das Geschäft immer mehr führte, tat dies so geschickt, dass bald ein eigener Webstuhl in einer kleinen Werkstatt stand. Von den Seidenzwirnern, die alle aus Lucca stammten, weil nur sie das Luccheser Filatorium, die große, in Lucca erfundene Seidenzwirnmühle, bedienen konnten, erhielt sie regelmäßig Garnlieferungen. So konnten nachts die Stoffe gewebt werden, die die Fontanas selbst entwarfen, bald entstand ein kleiner Kundenkreis wohlhabender Bürger, die Interesse an diesen Arbeiten hatten, und als Anna dem Salvestro de’ Medici, der sich beim Aufstand der Ciompi hervorgetan hatte, eines Tages, als er durch ihre Straße ritt, einen Goldbrokat über die Schulter warf, waren die Fontanas wieder selbständige Seidenweber mit eigenem Atelier für Prunkseide, so die Bezeichnung. Die Medici unterstützten die popolani, die für eine demokratische Verfassung eintraten, und förderten die aus Lucca zugewanderten Anhänger dieser Partei.
Die Fontanas gehörten nun zu den Florentiner Seidenwebern, die das Granatapfelmuster durch ihre Webkunst zu großer Feinheit entwickelten, indem sie die Palmetten und Rosetten, die sich um den Granatapfel zogen, zu großflächigen, vielfältig verschlungenen, repräsentativen Ornamenten ausweiteten, schwer zu webende goldfarbene Muster, die sie zusammen mit tiefrotem oder schwarzem Samt in einem Arbeitsgang herstellten. Viele tausend Kettfäden auf einem Kettbaum, unzählige Hebungen und Senkungen für den Schuss, Messer, die die Seidenschlingen zu warmem Samt aufschlitzten und die Farbe des Grundgewebes durchscheinen ließen, gewebte Vertiefungen, in denen das Muster aufleuchtete, königliche Stoffe aus schwarzgoldenem und rotgoldenem Brokatsamt, aus hellem samtenem Blau mit durchscheinendem Goldbrokat.
12 Zwischen den Erdschollen sah er blinzelnd ein schwaches Licht, ein winziger Spalt, durch den ein scharfgeschnittener Lichtstrahl einfiel, von dem er nicht genau wusste, woher er kam, auch nicht wusste, ob es ein Traum war oder schon der Tod, denn er sah auch den im Mondlicht glitzernden Fluss, der so breit und ruhig dahinzog, mit einem Floss darauf, auf dem Männer ein Feuer anzündeten, lachten, miteinander redeten, und er hörte ihre Stimmen so nahe, als säße er am Ufer, und das Floss gleite im Abendlicht an ihm vorbei, und die Flößer nickten kurz, ihn erkennend, in diesem vergehenden Licht, denn es wurde rasch dunkel, die Erdschollen nahmen ihm die Luft, aber wenn er atmete, nur atmete, immer nur atmete, würden sie sich vielleicht schützend um ihn legen, ihn nicht allzu sehr in die Tiefe drücken, in diese enge Dunkelheit, aus der man nie herauskam, an die man sich aber gewöhnen musste, so wie man sich auch an die Nächte gewöhnen musste, die für andere der Tag war, und die Nacht war nicht nur Finsternis und Angst und Leere, in dieser Finsternis gab es Lichter und Geräusche, helle Punkte, die über dem Moor schwebten, die Menschen vom Weg abbrachten, zu Geistern und Nymphen führten, die in der Nacht nicht schliefen, Geräusche aus dem Wasser und aus der Erde und die Lichter zwischen den hohen Bäumen, die Sterne, die man immer heller sah, wenn man die ganze Nacht nur in den Himmel starrte, in ein funkelndes Licht, heller als der Tag.
Das war der Urenkel. Er verschwand im Sumpf.
13 Als Anna starb, führten die Enkel schon das Geschäft. Es hatte sich eingebürgert, den Erstgeborenen, der das Geschäft übernehmen musste, Gianni oder Giovanni zu nennen, Paolo war immer der Zweitgeborene. Gianni war ein ernster Mensch, ein Tüftler, der tagelang über neuen Mustern brütete, sie am Webstuhl ausprobierte und dann auf die Patrone übertrug. Paolo hatte das kaufmännische Geschick von Anna geerbt, er führte die Geschäftsbücher und kümmerte sich um den Verkauf der Stoffe. Alessandro, von den jüngeren Geschwistern als dritter Teilhaber in die Firma aufgenommen, leitete in Livorno, dem Hafen von Florenz, eine kleine Filiale. Er liebte dieses bunte Leben zwischen Griechen, Juden, Arabern, Spaniern, Holländern, Engländern, die in allen Sprachen miteinander handelten, Firmen gründeten, ihren Religionen nachgingen, zusammenlebten. Alessandro war der Meinung, dass die Kunst des Seidenhandels mehr einbrächte als die Webkunst, und hatte die schöne Gabe, sich zu vergnügen und dennoch das Geschäft zu betreiben. Er erfuhr auch als Erster, dass 1439 Cosimo de’ Medici das Basler Konzil nach Florenz holen wollte. Es wurde eine Glanzzeit für die Seidenweber. Gianni, Paolo und Alessandro saßen während der großen Empfänge auf der Empore des Konzilssaals und verglichen die Stoffe, die Muster, die raffinierten Schnitte, die in Florenz Tagesgespräch waren. Sie empfingen Kardinäle in ihrem Geschäft, man zahlte große Summen, um von ihnen bevorzugt bedient zu werden. Die Seidenweber waren für einige Jahre die Könige von Florenz.
Die Erinnerung an dieses Fest war schrecklich. Als Alessandro in seinem Übermut und seinem Leichtsinn einen hohen Herrn, der seinen Seidenstoff nicht bezahlen wollte, dadurch verärgerte, dass er ihm in dem genau gleichen Stoff auf der Konzilstreppe entgegentrat und unter dem Gelächter der Dabeistehenden die Qualität der beiden Stoffe verglich, lachte er nur noch diesen Tag. Am anderen Morgen fand ihn Gianni erstochen auf einem Webstuhl liegend, das Blut war in den roten Samt geflossen, der auf dem Webstuhl aufgespannt war. Gianni schnitt nach der Beerdigung Alessandros diese blutige Stoffbahn vom Webstuhl ab und legte sie ohne jeden Kommentar in das Musterbuch.
Die Zeiten wurden wieder ruhiger: Gianni, der von nun an Stoffe für gewisse Herren nur noch Rot in Rot webte, starb, wie er gelebt hatte, still und ohne Aufsehen, über das Musterbuch gebeugt. Paolo führte die Geschäfte lustlos für die Nachkommen weiter, er war bald mehr Bankier als Seidenweber. Er freundete sich im Alter noch mit Benozzo Gozzoli an, der den Auftrag bekommen hatte, das Konzil in der Hofkapelle der Medici als großes Fresco zu verewigen. Da er viele Fragen nach den Stoffen, den Farben, den Mustern hatte, denn die Medici wollten sich in ihren Prachtgewändern sehen, stand Paolo oft staunend vor den durch eine paradiesische Landschaft ziehenden Konzilsteilnehmern, gekleidet in den Seidenstoffen der Firma Fontana. Gozzoli hatte sie so im Vordergrund aufgestellt, als wären sie dem Musterbuch der Fontanas entsprungen, und Paolo wünschte sich eine kleine Kopie des Bildes: »als Katalog für alle Kunden.« Gozzoli erfüllte seinen Wunsch, und so hing das Bild, das nur als Fresco in der Hofkapelle der Medici existierte, noch einmal im kleinen Format im Kontor der inzwischen sehr würdigen Seidenweberei Fontana. Als Paolo starb, musste man ihm dieses Bild in die Hand geben, und er sah nicht mehr nur den in Seide und Samt, in goldenen Borten und durchbrochenen Mustern auftretenden Festzug, er sah die wunderbare Landschaft seiner Heimat, der Toscana, das tiefe Blau des Himmels, das harte Weiß der Marmorberge, die fruchtbaren Hügel mit ihren Obstbäumen und Weinstöcken und in den Tälern neben den Flüssen das samtene Grün der Maulbeerbäume.
14 Aufstehen, den ganzen Tag im Nebeldunst diesen Erdwall aufschütten, die Erde von den Pferdewagen auf den Damm, um das hochgehende Wasser, diesen verrücktgewordenen Fluss, der schäumte und sich überschlug in seiner sinnlosen Kraft und in seiner Wildheit Bäume, Häuser, Vieh mit sich schleppte, ertrunkene Kühe, in Baumästen verfangen, Pferde, noch im Geschirr, stranguliert, aufgedunsene Menschen, für Sekunden auftauchend und weitertreibend. Sie trugen die Erdkörbe hoch, um diesen Fluss zu bändigen, zu zähmen, ihn zu zwingen, in seine Mündung zu rasen, ins Meer zu stürzen und nicht das Dorf zu überschwemmen, diese kleinen Hütten unter ihren Strohdächern, geduckt zwischen schmalen Gärten und Feldern, tief in die Erde gedrückt, um sich gegen den Sturm und den Regen zu schützen, der auf sie niederpeitschte.
Als am Abend der Damm in sich zusammensank, lautlos vor dem Fluss zurückwich und der Fluss sich durch die Lücke zwängte, sie weit aufriss und das Wasser sich mit einem tiefen Seufzer, wie später viele berichteten, breit auf das Dorf ausdehnte, schwammen die Strohdächer wie friedliche Inseln der Ruhe in einen sich immer weiter ausdehnenden See.
Es überlebten nur die, die auf dem Deich waren. Der Junge konnte seine Eltern nicht retten, die im Haus schliefen. Todmüde lag er auf der Erde zwischen den leeren Körben, auf dem Rest des Deiches, den es nun nicht mehr gab, so wie es das Haus nicht mehr gab und das Dorf nicht mehr gab und alle, die mit ihm darin gelebt hatten.
15 Giovanni Fontana, Enkel des Paolo Fontana, Alleininhaber der bekannten Seidenweberei am Ponte Vecchio, galt als typischer Florentiner. Klein, wendig, stets schlicht und unauffällig gekleidet, nach allen Seiten höflich grüßend, eilte er mit schnellen Bewegungen von den Bankiers und Geldwechslern auf dem Mercato Nuovo zu den Seidenhändlern auf der Piazza della Signoria, zu den Stadtpolitikern in der Loggia dei Lanzi. Leicht vornübergebeugt, mit seinen spöttischen Augen aus dem vorgestreckten Kopf das Treiben der Menschen immer ein wenig von unten nach oben betrachtend, glaubte er dieser Welt so rasch kein Wort. Ein zäher und listiger Geschäftsmann, der endlos verhandeln konnte, gefürchtet wegen seines bösartigen Witzes, mit dem er die Dummheiten und Vorurteile der Menschen kommentierte, sprach er mit einem Geschäftspartner, suchten seine Augen unruhig und spähend schon den nächsten Händler.
Er galt als Freigeist, weil der Buchhändler Bisticci für ihn griechische und lateinische Autoren sammelte, kannte den Dante auswendig, fand den Gottesdienst in griechischer Sprache vor der dekorierten Büste Platos als dem neuen Apostel eine vernünftige Angelegenheit und diskutierte mit jedermann leidenschaftlich und ausdauernd über die Form der idealen Republik. In späteren Jahren ein gemäßigter Anhänger Savonarolas, hasste er die Korruption der Signoria, die ohne ernsthafte Arbeit für jede selbstverständliche Handlung die Hand aufhielt. Seine Verachtung der Regierenden ging so weit, dass er mehrmals die Wahl in die Signoria ablehnte, zu gescheit, um nicht zu wissen, was man von ihm erwartete, entzog er sich der Würde mit höflichem Lächeln und bissigen Sentenzen über die Natur des Menschen. Als ihm Lorenzo de’ Medici wegen seiner ständigen Kritik an der Signoria mit Verbannung drohte, war er der Meinung, dass in einer Republik kein Mann so viel Macht haben solle, einen anderen Bürger dieser Republik verbannen zu können, denn dann dürfe man ja wohl nicht mehr von einer Republik reden, was ihm trotz der unwiderlegbaren Antwort zwei Jahre Verbannung eintrug, der er sich entzog, indem er bei Freunden mit seinen Büchern unterschlüpfte und nur in der Nacht ausging.
Seine Frau, viel jünger als er, Tochter des Malers Ghirlandaio, der aus einer Goldschmiedefamilie vom Ponte Vecchio stammte und die Familie Fontana bei der Auswahl der Farben für die Seidenstoffe beriet, besaß nicht nur den Kunstverstand ihres Vaters, sie verkaufte auch seine Bilder. Das machte sie so geschickt, dass auch andere Maler der Stadt ihr Bilder zum Verkauf übergaben, so dass im Geschäft der Fontanas ein Durcheinander von Bildern, Stichen, Büchern und Seidenstoffen herrschte und man nur schwer erraten konnte, worin eigentlich das Hauptgeschäft bestand. Verkauft wurde jedenfalls alles, zuweilen auch Bücher aus der Bibliothek des Hausherrn, was zu heftigen Auftritten führte, denn seine Bücher waren ihm heilig, während seine Frau mehr von Bildern hielt. Die Fiorentina, wie sie allgemein nur genannt wurde, weil sie ihre Meinung immer lautstark und ungeniert im Florentiner Dialekt von sich gab, war keine Frau, die sich etwas sagen ließ. Die Auseinandersetzungen zogen sich oft über den ganzen Tag hin. Wenn dann nicht nur die Nachbarn den Laden füllten, sondern auch die Seidenfabrikation stockte, weil die Weber ihre Webstühle verließen, um das Schauspiel zu genießen, fand man sich am Abend im großen Kreis bei Donati zusammen, einem Wirt, der an der Piazza Santa Trinita nicht nur ein gutes Speiselokal führte, sondern auch ein Kenner von Büchern und Sammler von Bildern war, so dass man sich auf neutralem Boden an einer umfangreichen Tafel wieder versöhnen konnte.
16 Das Getreide stand so dicht, dass man nur mit Mühe hindurchgehen konnte, bis zum Horizont stand es gelb und in der Sonne leuchtend, die Halme waren stark, der Sommer war heiß, kein Wind hatte die Ähren niedergedrückt.
Die Ernte war so reich, dass die Preise an einem Tag zerfielen und die Ernte vernichteten wie ein Hagelsturm, der über die Felder zieht. Einige Bauern verfütterten ihr frisch gedroschenes Getreide an das Vieh, keiner kaufte es. Der größte Teil der Ernte blieb auf dem Halm, die Schnitter standen vor den Feldern, warteten Tag um Tag, aber kein Händler war bereit, auch nur einen Doppelzentner abzunehmen. Das Getreide wurde schwarz und feucht und faulte langsam auf den Feldern, die Schnitter erhielten in diesem Jahr keinen Lohn, die reiche Ernte blieb ohne Segen.
Als wolle Gott strafen, wuchs im nächsten Jahr fast nichts auf den Feldern, die Erde weigerte sich, die Frucht zu tragen, die wenigen Halme wurden, um keine Körner zu verlieren, mit der Sichel statt mit der Sense geschnitten.
Es gab in diesem Jahr kein Brot, Hunger und Seuchen zogen durch die Dörfer, und die Menschen starben still und ergeben in ihren kleinen Holzhäusern. Das Vieh verendete auf der Suche nach Gras, die Tiere schrien durch die Nächte, es war keiner da, der sie erlöste. Die Dörfer verödeten, wer konnte, zog in die Fremde, die Felder verkarsteten, und die Deiche wurden brüchig; mit der Schneeschmelze im Frühling kam die Flut, und das Land versank im Wasser. Als die Sonne das Land wieder trocknete, sah man auf den Deichen und auf den schlammigen Feldern wieder Menschen.
Das war das Jahr, da die Ersten, die in das Dorf zurückzogen, eine alte Frau auf einem Stuhl vor einer Kate sitzend fanden, sie saß da, starrte aus ihren Augenhöhlen, ihrem tiefeingefallenen Gesicht auf die Felder, erst als sie ihren Körper berührten, fiel sie tot um.
17 Giovanni Fontana, der Kriege und Pestepidemien, Bankrotte von Handelshäusern und Konjunktureinbrüche überstanden hatte und mit seinem quirligen Temperament aus allen Schwierigkeiten immer wieder herausfand, starb an der Marotte, sein Alter je nach Laune und Belieben anzugeben. Als er vierzig war, behauptete er, schon sechzig zu sein, als er sechzig war, behauptete er, vierzig zu sein, als er auf die achtzig zuging, schwor er heilige Eide, neunundfünfzig zu sein. Das brachte eines Tages einen Gast bei Donati so in Rage, dass er dem Alten einen Hieb versetzte, Giovanni stürzte über einen Stuhl, schlug sich den Kopf auf und starb daran.
Er hinterließ vier erwachsene Kinder, die alle ihren Weg gegangen waren. Gianni, der Älteste, der schon lange die Seidenweberei hätte übernehmen sollen, überall in Florenz zu sehen, nur nicht im Geschäft, war ein Hitzkopf, hängte sich in alle politischen Streitereien, diskutierte nicht lange, wurde schnell handgreiflich, schlug sich auch oft für die Ehre seiner jeweiligen Dame, ein wüster, kraushaariger Draufgänger, trotzdem beliebt, weil er den palio, das kostbare, karminrote Tuch mit goldenen Seidenfransen, in einem besinnungslosen Ritt quer durch die Stadt auf einem halbwilden Pferd für sein Viertel gewonnen hatte; was einem jungen Burschen in Florenz unvergänglichen Ruhm eintrug.
Paolo, der Zweitälteste, früh von der Malerei gefangen, die ihn in immer neues Staunen versetzte, kurze Zeit Schüler von Botticelli, versuchte sich als Porträtist, ging schließlich nach Rom, wo er an der Pest starb.
Francesco war auf Wunsch seines Vaters, der den Medici nie traute, früh nach Lyon gegangen, wo er eine Filiale der Firma aufbaute, die mit der Zeit immer bedeutender wurde. Auch Leonarda, die Jüngste, lebte inzwischen in Lyon. Sie hatte den Teilhaber eines Florentiner Handelshauses, der die Lyoner Geschäfte betrieb, geheiratet, und so sorgten Francesco und Leonarda in Lyon oft für das Überleben der Fontanas in Florenz, denn die Zeiten wurden dunkler. Der Sacco di Roma, die Plünderung Roms durch die Söldner Karls V., hatte auch die Florentiner Geschäftsleute getroffen. Die moria, die unbegreifliche Geißel Gottes, die Pest, ergriff Florenz schwerer denn je. Wer nicht aufs Land flüchtete, verschloss sich in seinem Haus. Wer das Haus verlassen musste, lief mit Kräutern in der Hand und Schwämmen vor dem Mund durch die Gassen. Hinter den Mauern fanden keine Feste mehr statt, die Geschäfte und die Behörden waren geschlossen, auf den Marktplätzen lagerten Räuberbanden. Die Fiorentina entließ alle Seidenweber und setzte sich selbst an den Webstuhl, wenn es etwas zu weben gab.
Kaum war die Pest vorbei, erschien Karl V. mit seinen Truppen nun auch vor Florenz, um dieser aufsässigen Republik für alle Zeiten ein Ende zu machen. Machiavelli bildete eine Bürgerwehr, die mit grünen Fahnen und Danteversen auf den Lippen durch die Straßen marschierte. Michelangelo leitete als Prokurator die Befestigungsarbeiten und ließ in den Vorstädten Kirchen und Klöster abreißen, um freies Schussfeld zu haben. Die Belagerung dauerte fast ein Jahr. Die Kanonen des Kaisers zerstörten halb Florenz, die Menschen aßen Katzen, Eulen und Ratten, sie töteten sogar ihre Kinder, die sie nicht mehr ernähren konnten. Achttausend Menschen starben bei der Verteidigung der Republik, und als es nach einem Jahr nichts mehr zu verteidigen gab, legte man die grüne Fahne mit dem Wort Freiheit nieder.
Als Karl V. als Triumphator durch die Stadt zog, saßen die Fontanas in ihrem Seidenkeller. Gianni war auf den Wällen durch eine Kanonenkugel getötet worden, so dass nur noch die Fiorentina die Familie zusammenhielt. Sie hatte Nachrichten aus Lyon. Der französische König bot den Seidenwebern von Florenz Aufenthalt und Arbeit, Steuerfreiheit, Privilegien für neue Firmen. Lyon kannte keinen Zunftzwang, war der größte Stapelplatz für italienische Seide und konnte sich an freiheitlichen Stadtrechten durchaus mit Florenz vergleichen. Die Seide schuf auch hier die Unabhängigkeit und Freiheit, die Lucca und Florenz besessen hatte. Die Seide schuf die Toleranz, Angehörige vieler Nationen und aller Glaubensrichtungen zu beherbergen. Viele Florentiner Seidenweber waren schon in Lyon, es gab also keinen Grund, nicht dorthin zu gehen. Die Fiorentina übergab das Musterbuch dem Enkel, der jetzt die Firma übernehmen musste, und da es wieder einmal bei Todesstrafe verboten war, die Geheimnisse der Seidenweberkunst in fremde Länder zu tragen, ließen die Fontanas noch in der Nacht Geschäft, Webstühle, Seidenballen, Bilder, Bücher, das Haus mit allem Mobiliar, allen Besitz und alle Freunde zurück und zogen mit dem Musterbuch, mit einigen Seidenstoffen und mit in den Kleidern eingenähten Florentiner Goldmünzen als Pilger verkleidet im Jahre 1536 nach Lyon.
Sie verloren dabei nicht nur ihre Goldstücke und Seidenstoffe durch plündernde Banden, sie verloren einen jüngeren Bruder, der sich auf der Suche nach Brot in ein Dorf schlich und nicht mehr zurückkam, sie verloren eine jüngere Schwester, die an Entkräftung starb, und sie verloren die Fiorentina, die von einem betrunkenen Söldner niedergestochen wurde, als sie das Musterbuch, auf das er es abgesehen hatte, nicht hergeben wollte. Sie konnten sie nicht einmal beerdigen, weil sie wie verlorenes Vieh weitergetrieben wurden. Als sie in der Nacht an den Platz zurückkehrten, fanden sie im Dreck der Straße nur das blutverschmierte Musterbuch.
18 »Polen? Noch nie gehört. Wo liegt denn das?«, amüsierten sich die vier Kosaken, die auf ihren Pferden den Fluss durchquert hatten, der in der Morgensonne ruhig und mit kleinen silbernen Wellen vor sich hinplätschernd an der Insel vorbeizog, die den Fluss hier teilte. Sie hatten auf der Insel übernachtet, kamen durch den Fluss, ritten über die Felder mit der frischen Saat, machten Jagd auf einige Kälber, die hinter einem Gatter standen, stachen sie mit Kriegsgeschrei ab und waren dabei, ein Feuer anzuzünden, als der junge Viehhirte auftauchte. Er stand da hilflos vor den Kosaken, zeigte auf die Kälber und stammelte etwas von Polen.
Wo es denn nun läge, dieses Polen, wollte ein Alter wissen, der mit seiner schmutzigen Pelzmütze wedelnd das Feuer anfachte.
Der junge Viehhirte überlegte und zog mit einer Hand einen Kreis um sich.
Die Kosaken lachten.
Er wiederholte die Bewegung und zog diesmal mit beiden Händen einen Kreis um sich.
Die Kosaken lachten.
Der Junge überlegte, dann zeigte er so genau wie möglich in die vier Himmelsrichtungen, die man ihm beigebracht hatte. Er zeigte dahin, wo die Sonne aufging, dahin, wo sie am Mittag stand, dahin, wo sie unterging und dahin, wo man sie niemals sah. Er zeigte auch, um genau zu sein, die Richtungen an, die dazwischenlagen, wiederholte die Armbewegungen, zog einen schützenden Kreis um sich und nannte ihn Polen.
Die Kosaken schüttelten den Kopf, und der Ältere setzte ihm den Bratspieß auf die Brust.
Da zeigte er senkrecht nach oben in den blauen Morgenhimmel.
Die Kosaken schüttelten wieder den Kopf.
Der Junge in seinem zerrissenen Hemd, mit seiner kurzen, ausgebleichten Hose, stand da barfüßig und zeigte nach unten auf den Boden.
Die Kosaken grinsten. Einer von ihnen ging zum Lattenzaun, an dem die Werkzeuge der Bauern lagen, nahm eine große Schaufel, drückte sie dem Kleinen in die Hand und sagte: »Dann zeig uns mal, wo Polen liegt. Wir sehen es nicht. Vielleicht liegt es unter der Erde.«
Der Junge, der mit der Schaufel kaum zurechtkam, sie kurzfassen musste, fing an zu graben. Er schaufelte wortlos, hastig und duckte sich hinter die aufgeworfene Erde, als sei sie ein Schutzwall gegen die Kosaken.
Die Kosaken zerlegten eines der Kälber und brieten das Fleisch über dem Feuer. Als der Junge bis zur Hüfte in seinem Erdloch stand, blickte er keuchend auf.
Die Kosaken schüttelten die Köpfe.
Am Mittag war nur noch sein Haarschopf zu sehen. Als er aufblickte, schüttelten die Kosaken, die halb schlafend in der Sonne lagen, immer noch die Köpfe. Er grub weiter, auch als man ihn schon lange nicht mehr sah. Er grub weinend weiter, auch als er nicht mehr konnte, und sein Körper vor Schmerzen schon ganz taub war. Er grub weiter, als es schon dunkelte und die Kosaken längst fortgeritten waren.
Am nächsten Morgen sahen die Bauern den eingestürzten Erdhaufen, und in der Erde fanden sie den Jungen, in sich zusammengekrümmt, tot.
19 Jean Paul, wie er in Lyon genannt wurde, war ein wortkarger, zurückhaltender Mann, der das Schicksal der Fiorentina nie verwinden konnte. Über die Vergangenheit durfte man in seinem Haus nicht sprechen, geschah das einmal aus Versehen, verließ er sofort den Raum. Er saß früh im Kontor, ein seidenes golddurchwirktes Barett auf dem Kopf, stets mit der Entwicklung von Stoffen und Mustern beschäftigt. Er trug sie in das Musterbuch ein, das ihm die Fiorentina in Florenz vor allen Mitgliedern der Familie übergeben hatte. Mit der Hilfe von Francesco und Leonarda, die nun schon lange in Lyon lebten, überwand er den Widerstand der Lyoner Seidenweber gegen die plötzliche Überzahl der Italiener. Die alte Filiale der Fontanas war ein guter Grundstein, man konnte die Firma schnell wieder aufbauen und wurde rasch als Lyoner Bürger und Seidenweber angesehen, was auch am Auftreten Jean Pauls lag, der sich der Lyoner Art nicht anpassen musste, sie lag ihm und entsprach seinem ernsthaften, vernünftigen Wesen.
Wenn am Ufer der Sâone auf der ehemaligen place de la Draperie, die jetzt bezeichnenderweise place du Change hieß, die Ketten über die Steinpfeiler gelegt wurden, um den Platz für die Kaufleute freizuhalten, und die sechs Syndici, ein Gremium aus zwei Franzosen, zwei Italienern, zwei Deutschen, die Wechselkurse für die verschiedenen Währungen festgelegt hatten, der Handel also endlich unter großem Geschrei beginnen konnte, sah man sofort, dass Jean Paul zu den respektablen Händlern gehörte, die man um Rat fragte, deren Meinung galt. Sein Qualitätssinn war unbestechlich, Stoffe prüfte er mit einem festen Griff seiner Hand, der Craquant, das knisternde Geräusch der Seide, der Schrei der Seide, wie die Weber sagten, genügte ihm oft für sein Urteil. Während der Börsenzeit stand er stumm an seinem einmal eingenommenen, bald angestammten Platz, drängte sich nicht durch die Menge der Kaufleute, wer mit ihm handeln wollte, wusste, wo er zu finden war. Waren die Bedingungen eines Auftrags klar und seriös, war man mit ihm sofort handelseinig. Minderwertige Ware für den Export zu produzieren, lehnte er ab. Auf Kompromisse ließ er sich nicht ein. Er schwieg dann abrupt, unterbrach das Gespräch, indem er abwesend über die Köpfe der Kaufleute blickte.
Er gehörte auch zu den Webern, die die Kaufmannschaft ständig ermahnten, nicht nur an der Börse zu handeln, sondern auch Maulbeerbäume anzupflanzen, um unabhängig von Seidenlieferungen zu sein. So wurden denn bald sechzigtausend Maulbeerbäume aus Italien eingeführt und an den Ufern der Sâone und der Rhône angepflanzt. Lyon wurde endgültig zur Hauptstadt der Seide.
Jean Paul blieb Junggeselle, seine Liebe galt der Seide. Er ließ immer schwerere Gold- und Silberstoffe weben, Stoffe, die nur die italienischen Familien weben konnten. Ziselierter rot-schwarzer, blau-grüner Seidensamt mit strengen symmetrischen Ornamenten aus Spitzovalen und Blütensträußen. Die Aufträge für die königlichen Schlösser Frankreichs häuften sich, und François, ein Enkel der Leonarda, der begabteste Seidenweber der Familie, ließ sich in Paris nieder, wo der Hugenottenkönig Henri Quatre nicht nur eine Medici heiratete, sondern sogar in den Tuilerien Maulbeerbäume pflanzte und die sich um das Schloss ansiedelnden Seidenweber mit Privilegien überhäufte, um die kostbaren Stoffe mit der verschwenderischen Gold- und Silberbroschierung zu produzieren, die der König und seine Gemahlin aus Florenz trugen, die die Räume des Schlosses als Wandverkleidung und Vorhänge in luxuriöse Seidenkabinette verwandelten.
Die Familie war sich aber einig, zum König auf Distanz zu bleiben und das Geschäft in Lyon weiterzuführen, man war sich auch einig, dass es die Enkel von Francesco weiterführen sollten. Der Älteste, Jean Paul II. genannt, weil er die geschäftlichen Fäden der Firma schon fest in der Hand hielt, war mit der Tochter eines Pfarrers der reformierten Gemeinde Lyons verheiratet, den huguenots, wie man sie aus unerfindlichen Gründen nannte. Dieser reformierte Glaube verbreitete sich schnell unter den Seidenwebern. Da sie daran gewöhnt waren, mit Händlern vieler Nationen und Religionen zu verkehren, gab es auch keine Probleme, wenn katholische und reformierte Familien sich zusammenfanden. Man heiratete über die Straße, wie man das nannte, und lebte in Toleranz zusammen.
20 Er sah seinen Großvater, wie er vom Stuhl aufstand, auf dem er den ganzen Tag gesessen hatte, diesem Stuhl aus geflochtenem Stroh, der nur dem alten Mann vorbehalten war, der darin saß und aus dem Fenster ins Bruch sah, das nicht Land, nicht Wasser war, ein dunkel schimmerndes Stück Erde, von einer schwachen Sonne erhellt.
Wortlos, wie er da seit Tagen gesessen hatte, stand er auf, zog sich aus, legte die alten zerschlissenen Sachen sorgfältig zusammen, hängte sie über den Stuhl, ging zu der dunklen Truhe, klappte sie auf, legte die Uhr hinein, die er in den letzten Tagen immer in der Hand gehabt hatte, auf die Ziffern starrend, die er kaum kannte. Diese schwere Taschenuhr, die aus der Zeit stammte, als er, jung und unvernünftig wie er war, einen ganzen Lohn, den ganzen Schnitterlohn eines Sommers, dem Handelsjuden, der durchs Dorf kam, für diese Uhr gab, die er nie brauchte, denn er konnte die Zeit nach der Sonne bestimmen. Er stand nachdenklich vor der Truhe, bewegte sich nicht, stand da nackt, alt, frierend auf dem Steinboden, den er gelegt hatte, um keine Kate mit Lehmboden zu besitzen, bückte sich, schob den vertrockneten Brautstrauß seiner Frau beiseite, zerrte das steife, leinene Hemd hervor, das seine Frau mit in die Ehe gebracht hatte, das nie getragen wurde, das nur für das Ende bestimmt war, selber gewebt aus dem Flachs hinter dem Haus, das ihr Stolz war, denn sie wollten bestimmen, wie ihr Ende aussah, und nicht in einen alten Fetzen gewickelt aus dem Haus getragen und in die Erde geworfen werden. Er zog es über, schlurfte mit seinen schwachen Beinen zum Krug mit dem Wasser, goss das Wasser aus, ging zu dem kleinen Spiegel, nahm ihn von der Wand und zerschlug ihn, nahm das schwarze Kopftuch seiner Frau vom Haken und verhüllte damit das Bild der Heiligen Maria, nahm das bunte Tuch vom Haken, das er im Sommer um den Hals trug, das er bei der Ernte auf dem Feld trug, mit dem er bei der Ernte in der Sommerhitze seinen Schweiß abwischte, band sich das Tuch um den Kopf, so dass das Kinn fest anlag, bekreuzigte sich, verbeugte sich vor dem kleinen Kreuz, das über dem Bett hing, legte sich auf sein Bett und starb nach drei Tagen und Nächten.
21 Jean Paul, der sich im Alter immer mehr ins Schweigen zurückzog, in Gedanken stundenlang neben einem Webstuhl stehen konnte, auf die anscheinend langsam aber stetig und damit doch schnell ablaufenden Kettfäden starrte, sie mit der vergehenden Zeit, dem vergehenden Leben verglich; schon das Einziehen der einzelnen Kettfäden in die Litzen als schicksalhafte Bestimmung des Lebensweges ansah; und den Schussfaden, den das Weberschiffchen rastlos in die Kette einzog, als den Teil des Lebens, der das Vorgegebene in eine mehr oder weniger phantasievolle Variation verwandelte, die das Wirken des Menschen, seine Handlungen und Taten in einem Muster festhielt, das dem ablaufenden Leben Sinn und Richtung und Halt gab, ebendas ausmachte, was man als ein menschliches Leben bezeichnen durfte, als persönliches Schicksal, das unverwechselbar sein eigenes Muster hatte.
Angeregt durch die verwandtschaftliche Bindung und durch den Gesprächspartner, den er im Pfarrer La Mettrie fand, verließ er die römisch-katholische Kirche, die in Rom einen Medici zum Papst gemacht hatte, und ließ sich aus Vernunft und nachdenklicher Überzeugung in die reformierte Gemeinde Lyons aufnehmen. Er zog sich weitgehend aus den Geschäften der Firma zurück, zumal man ihm die Kasse der reformierten Gemeinde anvertraute, die er bis zu seinem Tode gewissenhaft verwaltete. Die Firma hinterließ er als ein blühendes und renommiertes Unternehmen, das über fünfzig Webstühle besaß, ganz Europa mit seinen Stoffen belieferte und inzwischen als Manufacture Fontana firmierte.
22 Sonntags und an den Feiertagen trafen sie sich auf dem Friedhof, saßen um die Gräber ihrer Familien, aßen ihr Brot, tranken Wodka, lachten, weinten, erzählten die alten Geschichten, die alle kannten und die von allen weitererzählt wurden, lagerten sich um die Gräber, tranken und aßen, opferten den Vorfahren Brot und Salz, auch ein Schlückchen vom Wodka, richteten die Kreuze auf, die umgefallen waren, malten die verblassenden Namen nach, erzählten die Geschichten von den Toten, die im weiten Umkreis bekannt waren, die trotzdem in immer neuen Ausschmückungen erzählt wurden, weil man es den Toten schuldig war, weil es die Pflicht der Söhne und Töchter war, denn auch von ihnen sollte man einmal erzählen, irgendwann, wenn auch sie hier liegen würden, neben Müttern und Vätern, Großmüttern und Großvätern, Onkeln und Tanten und all den anderen, deren Kreuze als morsches Holz auf den Gräbern lagen, die Erde tief eingesunken, im hinteren Teil des Friedhofes, wo die lagen, an die sich keiner mehr erinnerte, aber von denen alle wussten, deren Namen vergessen waren, deren Lebensjahre und Lebenszeit unbekannt waren, deren Geschichten man aber noch kannte.
Da lag der, der dem deutschen Inspektor vom Gut, das einem fremden Herrn aus Preußen gehörte, den Schädel mit dem Spaten gespalten hatte, mit einem Schlag in zwei Teile gespalten hatte, mit einem solchen Schlag, dass der Spaten im Brustkorb stecken blieb, der dann in einem Boot flüchtete, in dem er tot aufgefunden wurde.
Da lag auch die mit den roten Haaren, die Hexe, die das Dorf mit einem Zauberspruch und mit einem geheimnisvollen Trank vor dem Sumpffieber gerettet hatte und als Einzige daran starb, weil sie den Zauber für sich vergessen hatte und der Trank für sie nicht mehr reichte.
Und die Geschichte von dem Holzfäller, der mit einem gefällten Baum ins Wasser stürzte, Gott verfluchte, daraufhin mit dem Stamm flussaufwärts schwamm, wo der Baum an einer Furt neue Wurzeln schlug und als Wasserbaum immer noch steht, lange noch mit dem Gerippe des Holzfällers darin, den sie hier der Erde übergaben.