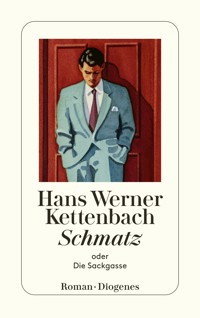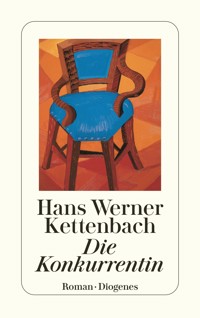7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oberstudienrat Kestner hält sich für tolerant und aufgeklärt. Aber als sich ein Fremder bei ihm zu Hause einnistet, zeigt sich, daß das Zusammenleben unter einem Dach nicht so einfach ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Davids Rache
Diogenes
1
Ninoschwilis Brief hat ein seltsames Unbehagen in mir hervorgerufen. Es ist geradezu lächerlich, aber so etwas wie eine Ahnung nahenden Unheils beschlich mich schon beim Anblick des schmutziggrauen Umschlags, der heute mittag, als ich nach fünf ekelhaften Unterrichtsstunden heimkehrte, auf der Konsole der Garderobe lag. Ich starrte auf die Briefmarke, eine farbenprächtige Darstellung Davids des Erneuerers, der sein Schwert gegen die Muselmanen schwingt, entzifferte den Poststempel Tbilissi, entfernte ein imaginäres Stäubchen von meinem Rockärmel und begann mich zu fürchten.
Ninoschwili schreibt, er sei sehr glücklich, mir mitteilen zu dürfen, daß er nach unablässiger Bemühung endlich mein Vaterland besuchen könne. Das Kulturministerium der Republik Georgien habe ihn offiziell beauftragt, in die Bundesrepublik Deutschland zu reisen und dort den Kontakt zu Verlagsunternehmungen herzustellen, die an der Publikation georgischer Literatur in deutscher Sprache interessiert seien. Leider könne Matassi ihn nicht begleiten, aber er hoffe zuversichtlich, daß wir auch ohne sie unsere Freundschaft nach nunmehr sieben Jahren zu erneuern vermöchten.
Der Brief hat von Tiflis bis hierher gut vier Wochen gebraucht, und da Ninoschwili geschrieben hat, er werde »bei günstiger Gestaltung letzter Vorbereitungen in approximativ einem Monat eintreffen«, kann er jederzeit vor der Tür stehen.
Ich bin tatsächlich vom Schreibtisch, an dem ich mich mit einem unterdrückten Ächzen niedergelassen hatte, alsbald wieder aufgestanden, habe die Gardine gehoben und hinausgespäht. Die Straße ausgestorben in der Mittagssonne. Kein Taxi in Sicht.
Vielleicht ist er zu Fuß von der Bushaltestelle gekommen, um die Valuta zu sparen, führt nicht mehr Gepäck als einen kleinen abgewetzten Koffer mit sich? Ist mit prüfendem Blick bereits am Haus vorbeigegangen. Nähert sich jetzt, seine Schritte dämpfend, durch den Garten, läßt die abgründig dunklen Augen ringsum wandern.
Genug der Absurditäten. Es gibt keinerlei stichhaltigen Grund, sich vor diesem Besucher zu ängstigen. Gewisse Unbequemlichkeiten wird er mir natürlich auferlegen, das ist vorhersehbar. Das Postskriptum seines Briefs, in dem er der Hoffnung Ausdruck verleiht, ich könne ihm »bei dem Beschaffen einer preisgünstigen Unterkunft hilfreich« sein, ist deutlich genug. Wahrscheinlich hält er es ohnehin für selbstverständlich, daß ich ihn bei mir einquartiere. Jeder zweite Trinkspruch in Tiflis handelte von der Gastfreundschaft des georgischen Volkes, und nun trifft mich halt nach sieben Jahren die Konsequenz dieser so begrüßenswerten Gesinnung.
Aber wozu haben wir ein Gästezimmer? Es kann ja nicht Julias vergnügungssüchtiger Schulfreundin vorbehalten sein, die es als Stützpunkt ihrer Exkursionen in den Westen nutzt und alle halbe Jahre mit der Wolke ihres aggressiven Parfums imprägniert, oder Ralfs Kumpanen, die schon zu zweit, wenn sie zu besoffen waren, auf ihren Mopeds nach Hause zu fahren, in dem Bett unter der Dachschräge ihren Bierrausch ausgeschnarcht haben, wahrscheinlich haben sie nicht einmal die Turnschuhe ausgezogen. David Ninoschwili wird diese Herberge sehr zu schätzen wissen. Er soll sie haben.
2
Ich mache mir etwas vor. Ob dieser Besuch aus Georgien so harmlos ist, muß sich noch erweisen.
Matassi. Der Abend in der Bar des Hotels Iveria. Der darauffolgende Nachmittag, an dem Ninoschwili mich zu einem Besuch seiner Wohnung eingeladen hatte. Und last, but not least der Mittag des folgenden Tages, als Matassi an der Tür meines Hotelzimmers klopfte, um mir den Artikel zu bringen, den sie in der Bibliothek für mich fotokopiert hatte.
Matassi trug helle Blusen und einfarbige Röcke, einmal auch ein buntes Sommerkleid mit weißem Kragen. Keine kreisrunde, hohe Kappe, kein verschnürtes Mieder, keine Perlenbänder, von den Schläfen herabhängend. Keine langgeflochtenen Zöpfe auf der Brust, ihre schwarzen Haare waren kurz geschnitten. Und doch übte sie den gleichen exotischen Reiz aus wie die Frauen in georgischer Nationaltracht, die den Besucher von den Plakaten des staatlichen Reisebüros Inturist, Filiale Tiflis/Tbilissi anlächelten. Runde Wangen, dunkle, dichte Brauen und Wimpern, umschattete Augen. Üppige Lippen.
An dem Abend, als Ninoschwili sie in die Hotelbar mitbrachte und als seine Lebensgefährtin vorstellte, begannen Dautzenbacher und der bärtige Slawist aus Heidelberg, dessen Namen ich vergessen habe, unverzüglich Männchen zu machen. Frau Doktor Bender, die einzige Frau in unserer Reisegruppe, zog sich, da die Unterhaltung immer bedenkenloser an ihr vorbeilief, pikiert auf ihr Zimmer zurück, sie schützte Kopfweh vor, jedoch ohne jede Anstrengung, glaubhaft zu wirken. Ich hatte mich zurückgehalten und fand mich belohnt durch den prickelnden Eindruck, daß Matassi mir weitaus interessiertere Blicke schenkte als den beiden unermüdlich posierenden Affen, sogar ein intensives Lächeln dann und wann.
Daß sie uns am nächsten Tag in seiner Wohnung erwarten würde, kündigte Ninoschwili mir nicht an. Er fragte mich nach dem gemeinsamen Mittagessen der Gruppe eher beiläufig, ob ich das Heim eines Georgiers kennenlernen wolle, und ich entschloß mich kurzerhand, das Studienprogramm des Nachmittags zu schwänzen, folgte unserem Dolmetscher durch verwinkelte Gassen der Altstadt, tauchte ein in einen Schwall von fremdartigen Gerüchen und Geräuschen. Litt zunehmend unter der Besorgnis, daß ich, wenn mein Führer mir abhanden kommen sollte, in diesem brodelnden Labyrinth verlorengehen würde.
Ich landete, nachdem Ninoschwili mit einladender Geste ein Pförtchen in einer hohen Mauer geöffnet hatte, auf einem stillen Hof, der auf drei Seiten von Balkonen gesäumt war. Hölzerne Balustraden, in Ornamenten geschnitzt und himmelblau gestrichen. Wäscheleinen, die bis hinauf zum zweiten Stock den Hof überspannten. An der Hauswand ein großer steinerner Bottich, darüber der Wasserhahn. Zwei Kinder, die im Schatten auf dem festgestampften Boden hockten, musterten mich aus dunklen Augen.
Der runde Tisch in Ninoschwilis Wohnstube war mit drei Tassen und drei Tellern gedeckt, es roch nach frischem Kaffee. Während ich noch um mich blickte, erschien Matassi in der Tür, die zur Küche nebenan führte. Sie trug das Sommerkleid mit weißem Kragen. Sie lächelte mich an und sagte: »Good afternoon, Mister Kestner. How are you?«
Ninoschwili erklärte, er werde zum Zuckerbäcker gehen und etwas zum Kaffee besorgen, er wedelte, als ich erwiderte, ich könne nach diesem opulenten Mittagsmahl unmöglich schon wieder etwas essen, stumm lächelnd mit beiden Händen und verschwand. Matassi holte den Kaffee herein. Ich fragte sie, ob sie nicht zur Arbeit gehen müsse. Nein, heute nicht. Und woher sie gewußt habe, daß ich kommen würde? Sie habe es nicht gewußt; aber sie habe es gehofft. Gehofft? Und warum das? Nur ein stummer Blick; ein Lächeln.
Vielleicht lag es an Wein und Wodka, mit denen unsere Gastgeber bereits das Mittagessen durchtränkt hatten, ein Trinkspruch nach dem anderen, und wer sein Glas nicht jedesmal leerte, verstieß gegen die geheiligten georgischen Tischsitten. Ich ließ mich jedenfalls, kaum daß Ninoschwili den Weg zum Zuckerbäcker angetreten hatte, auf einen resoluten Flirt mit seiner Lebensgefährtin ein, warf den Ballast meiner Vorstellungen vom gebührlichen Benehmen eines Gastes ab und begann zu schweben, unter blauem Himmel, im Sommerwind, der durch die Balkontür hereinfächelte.
Als Matassi mir ein von Ninoschwili verfaßtes Büchlein zeigte und sich über meine Schulter beugte, um mir, ihren bräunlichen Zeigefinger auf der Zeile voranschiebend, den Titel in georgischer Schrift zu übersetzen, wandte ich ihr mein Gesicht zu. Meine Nasenspitze berührte ihre Wange, ich roch einen Duft, den ich nie zuvor erfahren hatte, Morgenland, Myrrhe kam mir in den Sinn und haftet in meiner Erinnerung, obwohl ich bis heute nicht weiß, wie Myrrhe tatsächlich riecht. Ich küßte Matassi auf die Wange. Sie wich nicht zurück. Ich nahm sie in die Arme und küßte sie auf den Mund. Sie erwiderte den Kuß, bevor sie sich lächelnd von mir löste.
Den Skrupel, meinen Gastgeber zu betrügen, empfand ich nicht. Wenn ich hernach etwas bedauerte, dann nur, daß ich Matassi, als sie mir nach der Küche auch das kleine schattige Schlafzimmer zeigte, nicht auf die Liegestatt gezogen hatte, das mit einer gewebten Decke verhüllte, mit schwellenden Kissen gepolsterte Bett. Ich fürchtete, Ninoschwili könne, die Tüte mit Backwerk schwenkend, uns in einer Situation überraschen, die sich in der Eile nicht mehr verharmlosen ließe, die Hose auf den Füßen, das Sommerkleid hochgeschoben bis unter die Achseln. Er läßt die Tüte fallen und greift nach einem Messer, löscht die Schande mit Blut, mit Matassis Blut, aber fatalerweise auch dem meinen.
Ich hätte, wie ich hernach zu meinem Ärger glaubte, die Rache des Georgiers nicht zu fürchten brauchen, jedenfalls nicht in flagranti. Ninoschwili kehrte erst eine geschlagene Stunde nach seinem Aufbruch zurück. Er sagte, er sei aufgehalten worden.
3
Erst später, wir hatten Georgien schon verlassen und waren in die armenische Sowjetrepublik weitergereist, begann ich nachzudenken über Ninoschwilis und Matassis Arbeitsteilung bei der Betreuung eines Gastes. Wir waren in einem Bus unterwegs von Erewan nach Etschmiadsin, wo uns die Ehre einer Audienz beim Katholikos widerfahren sollte, als Dautzenbacher, dem kein Scherz zu abgeschmackt war, nach dem Mikrophon der Dolmetscherin griff und mit seinem Bierbaß hineingrölte: »Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage!«
Er räusperte sich, daß die Membrane krachte, und fuhr fort: »Denken Sie an die Wanzen! Wir befinden uns zwar auf dem Weg in ein Kloster, aber glauben Sie nur ja nicht, daß das Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche diese possierlichen Tierchen nicht zu schätzen weiß. Also bitte: Keine aufsässigen Fragen und vor allem keine destruktive Kritik an der Sowjetmacht! Es wird alles aufgezeichnet! Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.« Er gab das Mikrophon an die Dolmetscherin zurück, eine Irina oder Natascha von Inturist, die es mit leicht gequältem Lächeln entgegennahm, ließ sich in seinen Sitz fallen und erfreute sich – die breiten Schultern hüpften – an seiner Darbietung.
Mir fiel jählings das Memento ein, das mir zu Hause mit dem Programm der Reise ausgehändigt worden war und das ich kopfschüttelnd in den Papierkorb geworfen hatte. Unsere Studiengruppe könne, so hieß es darin, zwar mit freundlicher Aufnahme rechnen; wir sollten jedoch nicht vergessen, daß die Sowjetunion über ein hochentwickeltes System der Nachrichtenbeschaffung verfüge und dieses nicht zuletzt gegenüber Besuchern aus dem Ausland einsetze.
Die Einzelheiten weiß ich nicht mehr, jedenfalls warnte der Wisch die Teilnehmer der Reise nicht nur vor »Lausch-Einrichtungen« im Hotelzimmer, sondern auch vor unseren Gesprächspartnern, allesamt »erstklassige Fachleute des Bildungswesens«, was leider nicht ausschließe, daß der eine oder andere von ihnen auch »in nachrichtendienstlichem Auftrag« arbeite. Es folgten mehrere kategorische Imperative für den arglosen Studienreisenden, die nach meiner Erinnerung lauteten: Gehen Sie nicht allein aus! Hüten Sie sich vor verfänglichen Situationen!, und zur Krönung mit drei Ausrufezeichen: Liefern Sie unseren Gastgebern keinen Anlaß, Sie in irgendeiner Form unter Druck zu setzen!!!
Ich hatte die Auflistung solcher Banalitäten für eine Wichtigtuerei der Bundesbehörde gehalten, die unsere Studienreise finanzierte und der bei ihrem Auftrag, dem deutsch-sowjetischen Kulturaustausch nämlich, offenbar nicht recht geheuer war. Aber in demselben Augenblick, in dem diese kindischen Verhaltensregeln mir wieder einfielen, glaubte ich in ihnen ein gräßliches Menetekel zu erkennen, dessen Verwirklichung ich nur mit knapper Not entronnen war. Mir wurde heiß, ich begann, während meine Erinnerungen an Tiflis sich unaufhaltsam in einen ebenso beschämenden wie beängstigenden Alptraum verwandelten, auf meinem Sitz hin und her zu rutschen. Hatte ich eins und eins nicht mehr zusammenzählen können?
Matassi, die Angestellte der Universitätsbibliothek, und Ninoschwili, der Schriftsteller, Übersetzer und Dolmetscher, erschienen mir in einem neuen, bedrohlichen Licht. Zwei sympathische Charaktere, aufgeschlossen, offenherzig? Welch niederträchtige Täuschung! Diese beiden waren hinter der Fassade ihrer Gastfreundschaft in Wahrheit ein Agentenpärchen des sowjetischen Geheimdienstes. Und so fand ich auch für Ninoschwilis einstündigen Ausflug zum Zuckerbäcker eine einleuchtende Erklärung.
Die Falle war aufgestellt, als er mich in seine Wohnung einlud. Eine Wanze im Schlafzimmer, nicht als ständige Installation natürlich, sondern von Ninoschwili eigens für meinen Besuch plaziert, vielleicht auch von einer technischen Hilfskraft des KGB. Ninoschwili verläßt, nachdem er mich bei Matassi abgeliefert hat, das Haus, beauftragt die Kinder im Hof, das Backwerk im Laden nebenan zu besorgen, begibt sich alsdann zurück in eine neben seiner Wohnung gelegene fensterlose Kammer und schaltet das Abhörgerät ein. Er wartet auf Matassis Hilferuf, legt die Kopfhörer nur einmal ab, als die Kinder anklopfen und die Tüte abliefern.
Als nach einer Stunde noch immer nichts Verwertbares geschehen ist, bricht er das Unternehmen ab, kehrt mit seinem Einkauf zum Kaffee zurück und erklärt, er sei aufgehalten worden. Aber unverzüglich wird der nächste Anschlag vorbereitet. Matassi, mit weißen Zähnen in ein knuspriges Hörnchen beißend, bringt das Gespräch auf den Bericht eines französischen Ethnologen über seinen Besuch im Tiflis der Jahrhundertwende und erklärt, als ich mein Interesse bekunde, sie werde den Artikel aus dem Zeitschriftenarchiv der Bibliothek fotokopieren und am nächsten Tag in meinem Hotel hinterlassen.
Hätte ich nicht spätestens an diesem Tag den Unrat wittern müssen?
Matassi begnügte sich keineswegs damit, die Kopie an der Rezeption des Hotels abzugeben. Sie erschien vielmehr unangemeldet auf der zwölften Etage und klopfte an meine Zimmertür, als ich mich nach einem abermals strapaziösen Mittagessen zurückgezogen hatte, um vor dem nächsten Termin unseres Studienprogramms ein Schläfchen zu halten.
Uber ihre Erklärung dieses aufreizenden Überfalls – der Service des Hotels sei leider nicht sehr zuverlässig, selbst Auslandsbriefe gingen hin und wieder verloren – machte ich mir keine Gedanken, die mich hätten irritieren können. Ich ging ins Badezimmer, striegelte meine Haare, spülte den Mund, schloß die Knöpfe meines Hemds. Als ich herauskam, saß sie auf dem Bett und blätterte in meiner Nachtlektüre, einem Kriminalroman von Simenon.
Ich bot ihr von dem Bourbon an, den ich vor dem Abflug zollfrei als Reiseproviant erstanden hatte, und sie zögerte nicht eine Sekunde: »Oh, wonderful, thank you! Just a little bit, please.« Ich setzte mich mit den beiden Gläsern neben sie, stieß mit ihr an und verzichtete, während die dunkelbraunen Augen über den Rand des Glases in mich drangen, auf das Präludium, das ich in Erwägung gezogen hatte (einen Plausch über Georges Simenon und die erotische Komponente in seinem Werk). Zeitvergeudung. Schnickschnack, nicht erforderlich.
Ich nahm ihr das Glas ab, näherte mich ihr, indem ich einen Arm auf der anderen Seite ihrer Schenkel aufs Bett stützte, und sagte, ich müsse unbedingt noch einmal, einmal wenigstens an ihrer Haut riechen. Sie lachte. Ich fuhr mit meiner Nase sacht über ihre Wange, ihre Augenbrauen, dann abwärts über ihre Nase, ihren Mund, ihren Hals. Ich küßte den Hals, dann die Lippen. Da sie den Kuß erwiderte, kam ich nicht mehr dazu, sie zu fragen, ob sie Myrrhe verwende. Wir sanken auf das Bett, ich legte eine Hand zwischen ihre Schenkel. Die Haut war glatt und kühl. Matassi sperrte sich nicht, sie schloß die Augen.
Es klopfte hart an die Tür, dreimal, und nach einer kurzen Pause abermals. David Ninoschwili, mit dem Messer in der Faust. Matassi öffnete die Augen, aber sie blieb liegen. Ich fürchte, meine Reaktion hat sie an meiner Männlichkeit zweifeln lassen. Ich zog die Hand unter ihrem Rock hervor, als hätte mich ein bösartiges Insekt gestochen, sprang auf und starrte auf die Tür.
Es war nicht David der Rächer, sondern Karl-Heinz Dautzenbacher. Er rief: »Machen Sie auf, Kestner! Oder wollen Sie den ganzen Nachmittag verpennen?«
Matassi erhob sich, sie legte den Simenon, der zu Boden gefallen war, auf den Nachttisch, nahm ihr Glas und setzte sich in einen Sessel. Als ich mich nicht vom Fleck rührte, lächelte sie und fragte: »Why don’t you open?« Ich öffnete die Tür. Dautzenbacher hob die Augenbrauen, als er Matassi sah, grinste, sagte: »Hallo, Mistress Ninoschwili!« und entschuldigte sich, unablässig grinsend. Er habe mir nur ausrichten wollen, daß der Bus zur Besichtigung der Festung Nariqala eine halbe Stunde früher abfahre.
Ich hätte den feixenden Störenfried umbringen, ihm König Davids Jagdspeer durch sein dickes Fell rammen mögen, diesem Elefanten, der mein morgenländisches Gärtlein zertrampelt hatte. Hernach, auf der Fahrt nach Etschmiadsin, als ich die Wahrheit zu erkennen glaubte, begann ich wider Willen, ihn zu würdigen. Karl-Heinz Dautzenbacher, ein ungeschlachter, dümmlicher Schutzengel, der ahnungslos, aber zuverlässig den Weisungen des Fatums folgte, hatte mich aus der Falle gerettet.
Wieder hatte David Ninoschwili nebenan gesessen, in einem vom KGB in Beschlag genommenen Hotelzimmer, den Kopfhörer auf den Ohren. An seiner Seite steht wartend ein Milizionär, halbhohe Stiefel, runde Schirmmütze mit rotem Band und goldfarbenem Stern. Ninoschwili lauscht, hebt den Kopf, als er mich von Matassis Haut reden hört. Unversehens hört er das Türklopfen, erkennt Dautzenbachers Stimme. Mit einem Fluch reißt er den Kopfhörer herunter, wirft ihn auf die Schreibplatte.
Wäre Dautzenbacher nicht in die Szene hereingestampft, diese Inszenierung hätte zu einem ganz anderen, bösen Ende geführt: Ninoschwili, angestrengt lauschend, hebt einen Finger. Der Milizionär nimmt die Hände, die er hinter dem Rücken zusammengelegt hat, auseinander und streckt das Kinn heraus. Aus dem Zimmer nebenan, meinem Zimmer, dringt ein gellender Schrei, Matassis Hilfeschrei. Ninoschwili tritt den Stuhl zurück, stürzt aus dem Zimmer, hämmert an meine Tür. Die Tür springt auf, dahinter erscheint Matassi.
Ihre Bluse und ihr Büstenhalter sind zerrissen, sie rafft die Fetzen zusammen und preßt sie auf die nackten Brüste, läßt sich gegen die Wand sinken. Ihr Lebensgefährte stellt ihr auf russisch oder georgisch eine Frage, sie antwortet mit matter Stimme. Ich verstehe kein Wort.
Ninoschwili nähert sich mir langsam, bleibt vor mir stehen. Ich kämpfe, auf einem Bein balancierend, mit der Hose, in der mein Fuß sich verfängt. Der Georgier blickt mich an, fragt tonlos, als könne er das Ungeheuerliche nicht glauben: »Ist das wahr, mein Freund? Sie haben versucht, sie zu vergewaltigen?« Ich schreie: »Nein! Wenn sie das behauptet, dann lügt sie!«
In der noch immer offenstehenden Tür erscheint die bullige Gestalt des Milizionärs. Nach einem Blick auf Matassi mustert er mich, rückt sein Koppel zurecht und äußert in scharfem Ton einen Satz, eher eine Anschuldigung als eine Frage. Ninoschwili wendet sich zurück, redet auf den Milizionär ein, schiebt ihn in den Flur und schließt die Tür. Dann geht er mit schleppendem Schritt zum Sessel, läßt sich schwerfällig darauf nieder, betrachtet mich wie geistesabwesend, während ich meine Hose schließe. »Mein Freund, das ist eine schlimme Geschichte. Sehr schlimm. Sie können von Glück sagen, daß ich rechtzeitig gekommen bin.« Er schüttelt den Kopf. »Aber ich weiß nicht, was daraus werden wird.«
Er richtet den Blick auf Matassi, die noch immer an der Wand lehnt, die Augen zu Boden geschlagen. Bevor ich mir darüber schlüssig werde, was ich erwidern kann, ohne mich noch tiefer hineinzureiten, steht Ninoschwili auf. Er hüllt Matassi in seine Jacke und führt sie hinaus.
Am Abend kehrt er zurück, allein. Er nimmt ein Glas von meinem Bourbon, geht mit dem Glas im Zimmer auf und ab, bleibt hin und wieder vor dem Fenster stehen und wirft einen spähenden Blick hinab auf die Straße, während ich wie gelähmt auf dem Bett hocke.
Er war den ganzen Nachmittag unterwegs, sagt mein georgischer Freund, hat alles getan, um einen Skandal zu unterdrücken. Aber der Milizionär – den ein fataler Zufall über den Hotelflur kommen ließ – hat den Fall angezeigt, es wird eine polizeiliche Untersuchung geben, die sehr lange dauern kann. Die zuständigen Behörden wollen mir die Abreise untersagen. Sie sind, wie ihm unmißverständlich bedeutet wurde, nur unter einer Bedingung bereit, darauf zu verzichten.
Er trinkt einen Schluck, wendet sich von mir ab und spricht weiter, stockend, indem er durch die Gardine hinausspäht. Es handelt sich um eine Art von Tauschgeschäft, sagt er, wie es in der Sowjetunion leider, leider nicht unüblich ist. Auch in Georgien, einst einer freien und menschenwürdigen Republik, hat sich diese schändliche Praxis durchgesetzt. Um die bittere Wahrheit unverblümt auszusprechen: Die Behörden wollen den Fall niederschlagen und mir die Abreise gestatten, wenn ich (ein schwerer Atemzug) mich bereit erkläre, ihnen nach meiner Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland hin und wieder eine Information zu liefern. Nichts Weltbewegendes, nichts, was man Spionage nennen könnte. Aber diese Behörden sind nun mal krankhaft versessen auf jede Art von Information.
Als ich mich zur Wehr zu setzen versuche, gerät meine Stimme in ein lächerliches Zittern. Ich bringe hervor, daß ich Matassi keine Gewalt angetan hätte. Ich sei zu ihr zärtlich geworden, ja, das könne und wolle ich nicht leugnen, und es tue mir sehr leid, mich so leichtfertig vergessen zu haben. Aber von einer Vergewaltigung könne nicht die Rede sein, nicht einmal von dem Versuch eines solchen Delikts. Und den Zustand von Matassis Kleidung könne ich mir nur so erklären, daß sie selbst – vielleicht in einer panischen Überreaktion – ihre Bluse und den Büstenhalter zerrissen habe, bevor sie die Tür öffnete.
Ninoschwili schüttelt den Kopf, wie in schmerzlichem Bedauern. »Ich glaube Ihnen, mein Freund. Und auch Matassi möchte Sie nicht belasten. Aber der Milizionär hat etwas anderes zu Protokoll gegeben. Und die Behörden glauben nicht mir oder Ihnen, sondern diesem übereifrigen Polizisten.«
Eine von den Behörden vorbereitete, schriftliche Erklärung meines Willens, mich in den Dienst des Weltfriedens zu stellen, hat er bereits mitgebracht, er zieht sie aus der Brusttasche, überreicht sie mir mit bedauerndem Blick. Ich brauche das Papier nur zu unterschreiben, dann kann ich unbehelligt weiterreisen.
4
Julia und Ralf haben sich, als ich ihnen beim Abendessen Ninoschwilis Besuch ankündigte, noch ekelhafter aufgeführt, als ich es befürchtet hatte. Mein ungeratener Sohn wirft die Gabel auf den Teller, runzelt die Stirn und beugt sich vor. »Wo kommt der her, aus Georgien? Da schneiden sie sich doch gerade gegenseitig die Hälse ab. Will der hier etwa Asyl beantragen?«
Ich erwidere mit erhobener Stimme, er solle mich gefälligst mit seinen fixen Ideen verschonen und endlich zur Kenntnis nehmen, daß Ausländer im Normalfall weitaus Lohnenderes zu tun wüßten, als unser deutsches Vaterland auszubeuten. David Ninoschwili sei ein gebildeter und in seiner Heimat hochangesehener Mann, er komme im Auftrag des georgischen Kulturministeriums.
Während meine Frau stumm ißt und auf ihren Teller schaut, stopft sich dieser Rüpel den Mund voll, kaut und grinst. Er stößt die Luft durch die Nase. »Kulturministerium, ist ja zum Piepen. Was soll das denn für eine Kultur sein? Die laufen da doch alle noch mit dem Messer zwischen den Zähnen herum. Oder bestenfalls mit der Kalaschnikow.« Er ballt die Rechte, visiert mich mit dem ausgestreckten Zeigefinger an. »Prrrrr!«
Mir läuft die Galle über, ich werfe die Serviette auf den Tisch. »Sag mal, bist du auch noch stolz auf deine Unbedarftheit? Auf deinen absoluten Mangel an historischen Kenntnissen? In Kaukasien haben die Menschen schon in Städten gewohnt, als deine germanischen Vorfahren noch hinter den Büschen hockten und die Bärenknochen abnagten!«
»Jawohl, Herr Oberstudienrat.« Er läßt die Gabel fallen, wischt sich den Mund ab, stößt seinen Stuhl zurück und erhebt sich. »Aber vom Kaukasus weiß ich vielleicht mehr als du.« Er beugt sich über den Tisch. »Oder kannst du mir sagen, was vor einundfünfzig Jahren auf dem Elbrus passiert ist?«
Ich starre ihn an. Er grinst. »Da haben einundzwanzig Gebirgsjäger die deutsche Flagge aufgepflanzt. Und da oben würde sie immer noch flattern, wenn der Heeresgruppe A nicht der Sprit ausgegangen wäre.«
Ich schreie: »Mach, daß du rauskommst!«
»Wollte ich sowieso.« Er latscht auf seinen luftgepufferten Gummisohlen zur Tür hinaus. »Noch ein bißchen frische Luft atmen, bevor der Kanake hier aufkreuzt.«
Ich habe zu lange die Eskapaden dieses Burschen hingenommen. Die selbstgefällige Hoffnung, er sei von anderem Stamm als die renitenten Stinktiere, die Tag um Tag meinen Unterricht zu verpesten trachten, war trügerisch, die Erwartung falsch, er werde sich ganz ohne Zwang zu einem aufgeklärten Menschen entwickeln. Ich hätte beizeiten meine pädagogischen Prinzipien revidieren sollen. Die körperliche Züchtigung aus gegebenem Anlaß, ein paar saftige Ohrfeigen hin und wieder hätten vielleicht Wunder gewirkt. Aber dazu ist es jetzt zu spät, ganz abgesehen davon, daß er mittlerweile wahrscheinlich über größere Körperkräfte verfügt als ich und sich nicht scheuen würde, dem eigenen Vater den strafenden Arm auszukugeln.
Um den jungen Herrn Schumann, Gero, hätte ich mich früher kümmern sollen, in dessen Gartenhaus mein Sohn und seine Freunde ihr Gemeinschaftsleben pflegen und mit Bier begießen. Ich habe mich fatalerweise auf Julia verlassen. Herr Schumann hat in ihrer Sozietät seinen Vorbereitungsdienst als Rechtsreferendar absolviert und eine erstklassige Beurteilung erworben, ein angenehmer, hochintelligenter Mensch, der als Jurist seinen Weg machen wird. Gute Manieren, aus vermögender Familie, das Gartenhaus gehört seiner Großmutter, die über etlichen Grundbesitz verfügt.
Mittlerweile hat Herr Schumann mit Erfolg für den Stadtrat kandidiert, als Repräsentant einer rechtsradikalen Partei. Und mein Sohn und seine Freunde haben für ihn die Wahlplakate geklebt und unsäglich idiotische Handzettel verteilt. Gegen Ausländerhaß – aber gegen die Überfremdung! Ausländer ja – Schmarotzer nein! Für ein selbstbewußtes, unabhängiges Deutschland!
Ich bin immer davon ausgegangen, daß meiner Frau dieses aufgeblasene Gestammel ebenso zuwider ist wie mir, trotz ihrer ständigen Bemühungen, meinen Zorn zu dämpfen, reg dich nicht auf, das wird sich von selbst erledigen, er ist nun mal in einem schwierigen Alter, stell dir doch vor, er hätte Geschmack an Drogen gefunden, da sind mir offengestanden diese Dummheiten lieber, irgendwann wird er die Lust daran verlieren, und so weiter und so fort. Das Muttertier, das sein pechschwarz geratenes Schaf desungeachtet liebt.
Seit heute abend zweifle ich an dieser Erklärung ihrer Vermittlungsversuche. Ich blicke sie schwer atmend an, nachdem unser Sohn sich mit einem niederträchtigen Schimpfwort verabschiedet hat. Julia erwidert den Blick nicht, sie beendet stumm ihr Abendessen. Ich frage: »Hattest du zu dieser Unterhaltung gar nichts beizutragen?« Sie zuckt die Achseln, schüttelt den Kopf. »Du weißt doch, wie er auf das Thema reagiert. Argumente reizen ihn doch nur noch mehr. Er wird sich beruhigen.«
Ich höre wohl nicht recht. Wer wird sich beruhigen? Von Bedeutung ist der Gemütszustand dieses Lümmels, und nicht etwa der meine? Mein Ton gerät ein wenig scharf: »Das Thema war nicht die Asylfrage, sondern der Besuch eines Mannes, mit dem ich befreundet bin.« (Befreundet, o Gott.)
»Du hast ja recht, er benimmt sich wirklich unmöglich.« Sie faltet ihre Serviette zusammen. Ein paar Sekunden vergehen, dann rückt sie mit der Frage heraus, die ihr Sohn bereits gestellt hätte, wäre ihm ein wirkungsvoller, unflätiger Abgang nicht wichtiger gewesen. »Wie lange will dieser Mann denn bleiben?«
Ich weiß es nicht. (Verflucht noch mal!) Aus seinem Brief geht das nicht hervor. Und ich denke, das ist auch verständlich, denn er weiß ja nicht, wie lange er braucht, um seine Gesprächspartner für die Publikation georgischer Literatur zu gewinnen. (Hoffentlich weiß er wenigstens, an wen er sich wenden muß, um die georgische Literatur loszuwerden.)
Sie blickt auf von ihrer Serviette. »Du hast hoffentlich nicht vergessen, daß Erika Ende des Monats noch einmal kommen wollte.«
Erika? »Ja, Erika. Das habe ich dir doch schon vor einiger Zeit angekündigt.« Hat sie nicht, aber das ist auch unerheblich, ich konnte mir doch ausrechnen, daß der Schulfreundin aus Halle ihre graue Heimatstadt schon wieder zum Halse heraushängt, wann war sie das letztemal bei uns? Im Frühling, das ist zwar noch nicht einmal ein halbes Jahr her, hin und wieder fühle ich mich noch immer von einer festklebenden Spur dieses Parfums belästigt, aber das ist natürlich nicht Erikas Problem. Vermutlich rutscht sie bereits unruhig auf ihrem runden Hintern hin und her, begierig nach den Zerstreuungen des Westens.
Ich bemühe mich, meinen Ton zu kontrollieren. Na schön, es sei ja durchaus möglich, daß Herr Ninoschwili noch vor dem Monatsende die Heimreise antreten könne. Wenn er jedoch wider Erwarten länger bleiben wolle, bleiben müsse, dann dürfe man vielleicht ganz ausnahmsweise einmal Erika zumuten, im Hotel zu logieren.
Die Antwort kommt prompt und ohne jeden verbindlichen Schnörkel. »Das sehe ich aber ganz anders. Warum kann man denn Herrn Ninoschwili nicht zumuten, sich ein Hotelzimmer zu nehmen?«
»Weil er mit Sicherheit knapp bei Kasse ist.«
»Das ist Erika auch.«
»Du übersiehst einen erheblichen Unterschied.« Ich lege eine kleine Pause ein, während der sie mich mit funkelnden Augen ansieht. »Erika reist zu ihrem Vergnügen. Herr Ninoschwili hingegen unternimmt diese Reise, um ein nicht unbedeutendes kulturelles Projekt zu verwirklichen. Und nicht zuletzt, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.«
Sie nickt, lächelt bitter, als hätte ich mit diesem Vergleich eine niedrige Gesinnung offenbart, ihrer Schulfreundin eine schwere Kränkung zugefügt. »Ich fürchte, daß du einen anderen, erheblichen Unterschied übersiehst.«
»Und das wäre?«
Sie zögert, aber nicht lange. »Ganz so unrecht hat Ralf ja nicht. Dieser Mann kommt aus einem Land, in dem ein blutiger Bürgerkrieg ausgetragen wird. Weißt du denn, welcher Partei er angehört und was er in diesem Krieg schon alles angerichtet hat? Du kannst doch nicht ausschließen, daß er sich absetzt, um einer Bestrafung zu entgehen. Und du sagst selbst, daß er kein Geld hat. Woher willst du denn wissen, daß er nicht bei uns unterkriechen möchte? Und hier Wochen und Monate herumhängt, wenn wir ihn erst einmal aufgenommen haben?«
Ich sage: »Was du da beschreibst, ist die Situation eines politischen Flüchtlings. Der klassische Fall eines Menschen, der ein Recht auf Asyl beanspruchen kann.«
Sie zuckt die Achseln. »Nenn es, wie du willst. Ich setze mich, wie du weißt, oft genug dafür ein, daß auch solchen Leuten ihr Recht gewährt wird. Aber muß das unbedingt auf Kosten deiner Familie geschehen?« Sie verläßt den Eßtisch und geht in ihr Arbeitszimmer.
Ich räume das Geschirr zusammen und bringe es in die Küche. Eine Tasse rutscht mir aus der Hand und zerspringt auf dem Steinboden. Ich trete nach den Scherben, sie fliegen umher.
Ich werde diese beiden lehren, was ein Gast ist und wie zivilisierte Menschen mit ihren Gästen umgehen. Ja, ja, vielleicht kommt Ninoschwili tatsächlich, weil er in seiner Heimat nicht bleiben kann und hofft, bei uns ein anderes Leben beginnen, sich eine neue Existenz aufbauen zu können. Dann soll er, bis er Fuß gefaßt hat, in unserem Haus wohnen, verflucht noch mal! Ich werde, wenn es sein muß, Weihnachten mit ihm feiern und auch noch das neue Jahr.
Er wird ja nicht gerade bis Ostern bleiben wollen.
5
Ich habe nachzutragen, daß Julias Sozietät vor sieben Jahren einen Diplomingenieur aus dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung verteidigte, der trunksüchtig war und sich vom KGB hatte anwerben lassen. Die Verteidigung schlug fehl, das Oberlandesgericht schickte den Mann, soweit ich mich erinnere, auf drei Jahre hinter Gitter, wegen des Verrats einiger lächerlicher Staatsgeheimnisse für ein lächerliches Honorar, das nicht einmal die Schnapsrechnungen des Delinquenten deckte.
Ich hatte von diesem Mandanten meiner Frau noch nichts gewußt, als ich meine Reise in die Sowjetunion antrat, Julia erzählte mir erst nach meiner Rückkehr eher beiläufig, daß der Fall ihr viel Arbeit mache. Es war ein milder Herbstabend, wir saßen auf der Terrasse und sahen der Dämmerung zu, die aus dem Garten herankroch. Julia hatte angekündigt, daß sie sich noch einmal an ihren Schreibtisch zurückziehen müsse, aber sie hatte offenbar keine Lust dazu und versuchte, den Zeitpunkt hinauszuschieben, indem sie mir ihr Leid mit diesem unglückseligen Beschaffungstechniker klagte.
Als sie endlich gegangen war, trocknete ich den Schweiß auf meiner Stirn. Sie schien ihn zum Glück nicht bemerkt zu haben. Ich hatte meine Alpträume von Ninoschwili und Matassi fast schon vergessen gehabt, ein wenig mühsam zwar, nämlich durch die Inanspruchnahme des gesunden Menschenverstandes, aber letzten Endes doch befriedigend: Wozu hätten denn diese beiden, wenn sie tatsächlich als Menschenfänger tätig waren, einen schlichten Schulmeister mit der Lehrbefähigung für Deutsch und Geschichte in die Falle locken sollen? Die der deutschen Sache abträglichen Informationen, die ich dem KGB hätte liefern können, wären doch über meine Erfahrungen mit Schülern, die lustvoll die Sau abgaben, und Lehrern, die unter ihrem Schicksal als Sauhirten litten, nicht wesentlich hinausgegangen.
Nun aber begannen meine Phantasien wieder zu wuchern und sich mir auf die Brust zu legen: Das Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti, der sowjetische Geheimdienst, hatte versucht, über den Lehrer Christian Kestner und dessen Frau, die Rechtsanwältin Dr. Julia Kestner, sich Zugang zum Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Einblick in die streng geheimen Papiere zu verschaffen, aus denen ersichtlich war, wie viele Schrauben an welchen Stellen den Panzer Leopard zusammenhielten oder wer von den Bediensteten des Amtes so notorisch soff wie der bewußte Diplomingenieur oder wie viele Eimer Marmelade eine Division der Bundeswehr im Monatsschnitt benötigte.
Genug der Albernheiten. Nachtragen will ich noch, daß Julia und ihre Sozietät in den vergangenen Jahren mehrfach Mandanten aus Bereichen vertreten haben, die man absurderweise sensibel nennt (als ob nicht gerade eine profunde Empfindungslosigkeit dazu gehörte, mit Rüstung und deren Accessoires seinen Lebensunterhalt zu verdienen). Aber auch diese Teilhabe meiner Frau an den Staatsaffären der Bundesrepublik Deutschland gibt keinen vernünftigen Grund ab, warum ich dem Besuch Ninoschwilis mit Beklemmung entgegensehen müßte.
Selbst wenn der Georgier und seine Lebensgefährtin mich vor sieben Jahren im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes einzuwickeln versucht haben sollten: Es gibt die Sowjetunion nicht mehr. Und die Republik Georgien hat gewiß andere Sorgen, als den Oberstudienrat Kestner mit einem Delikt zu erpressen, das er gern begangen hätte, aber dank Karl-Heinz Dautzenbacher nicht begangen hat.
6
In der Morgendämmerung blickten sie nach Osten, und auf halbem Wege zwischen dem Meer und dem Himmel entdeckten sie schneegekrönte Gipfel, die sich glitzernd und strahlend über die Wolken erhoben. Und sie wußten, daß sie den Kaukasos erreicht hatten, am Ende der bewohnten Erde. Kaukasos, das höchste aller Gebirge, Vater der Ströme des Ostens. Auf seinem Gipfel war einst Prometheus angeschmiedet worden, an dessen Leber Tag um Tag der Adler nagte, und am Fuß seiner Abhänge flüsterten die dunklen Wälder rings um das magische Land Kolchis.
Das ist lesbar geschrieben, aber leider nicht von einem Georgier, sondern von einem Engländer. Mit der georgischen Literatur, in der ich mich ein wenig kundig mache, um meinem Gast gerecht zu werden, tue ich mich weniger leicht. Jüngere Texte in deutscher Übersetzung gibt es kaum, und aus den älteren, die ich in den Bibliotheken aufgetrieben habe, weht mich ein Hauch von Vergangenheit an, der mich hin und wieder frösteln läßt. Oder auch gähnen, um die Wahrheit zu gestehen (die ich bei mir behalten werde).
Das muß ein merkwürdiges Volk sein, wenn es stimmt, daß heute noch jeder zweite Georgier aus den Versen von Schota Rustawelis Der Mann im Pantherfell zu zitieren weiß und mit Emphase zitiert. Dieses »Buch der Bücher eines ganzen Volkes«, von dem ich bislang keine Ahnung hatte, ist immerhin fast 800 Jahre alt, und seine ehrwürdigen Metaphern würden einem hierzulande nicht über die Lippen gehen. Was mag ein Georgier empfinden, wenn er deklamiert, daß die Königin Tamar ein »Rosenantlitz« hatte, »Purpurlippen« und Zähne »wie geschliffener Kristall, zwischen Rubinen schimmernd«?
Ich muß mich freilich auch fragen, warum ich einen wesentlich größeren Reiz verspüre bei Rustawelis Schilderung der liebeshungrigen Patman, die an den Falschen gerät und sich hernach beklagt: »Ich Unglückselige war für ihn, was die Ziege für den Bock.« Und zudem erinnern mich die alten Illustrationen des Buchs, auf denen die Ritter mit ihren Damen hinter Portieren und auf Kissen sitzen, zu meiner Schande an die pornographischen Interieurs der Chinesen und Japaner, obwohl die Damen bei Rustaweli nur hochgeschlossen auftreten und die Ritter ihr Glied nicht ausgefahren präsentieren.
Gebricht es mir an sittlichem Ernst, an Verständnis für den Frauenkult dieses Minnesängers? Bin ich ahnungslos in einem Land zu Gast gewesen, in dem das weibliche Geschlecht noch immer wie vor 800 Jahren aufs Podest gehoben und gegen jeden Übergriff verteidigt wird – womöglich mit den Mordwerkzeugen, wegen deren Produktion die Georgier seit jeher ein Ansehen genossen?
In Puschkins Reisebericht habe ich ein makabres Beispiel für die Leistungsfähigkeit dieses ruhmreichen Handwerks gefunden. Er schreibt, die Waffen aus Tiflis seien »im ganzen Orient hochgeschätzt«, und fährt fort: »Graf Samoilow und W., die hier für ihre Körperkraft bekannt waren, probierten gewöhnlich ihre neuen Säbel aus, indem sie mit einem Hieb einen Hammel halbierten oder einem Stier den Kopf abschlugen.« Hilf Himmel. Und pfui Deibel.
Was soll das? Meine georgische Lektüre bietet mir ja keineswegs nur Anlaß, mich zu grausen oder zu langweilen. Dank eines Romans, der 1937 erschienen ist, bin ich vielmehr auf einen Gedanken gekommen, mit dessen Hilfe sich die Unruhe, in die Ninoschwilis Brief mich versetzt hat, ganz ohne abenteuerliche Phantasien erklären läßt.
Grigol Robakidse, der Autor des Romans, schildert ein Gastmahl, zu dem Schriftsteller, Schauspieler und Maler aus Tiflis auf ein Schloß unweit der Stadt eingeladen werden. Sie nehmen Platz an einer langen Tafel auf der Veranda, das Blattwerk eines alten, weitverzweigten Nußbaums streut Sonnenflecken auf den Tisch. Während sie die ersten Gläser Maghlari trinken, eines Weins, der wild an den Dattelbäumen wächst, wählen sie den Tamada, ihren Tischmeister, der von nun an das Mahl dirigiert und dessen Anordnungen widerspruchslos zu befolgen sind, sei es, daß er sie heißt, die Gläser zu leeren, sei es, daß er einen der Tischgenossen auffordert, ein Lied zu singen oder einen Volkstanz vorzuführen.
Robakidse hat gut daran getan, seine Leser vorab darauf hinzuweisen, daß das Mahl als solches in Urzeiten eine kultische Handlung gewesen und dies in Georgien bis dato geblieben sei. Ohne übersinnlichen Beistand hätten seine Gäste von 1937 wohl kaum das Menü bewältigt, das ihnen unter dem Nußbaum serviert wird.
Als Vorspeise gibt es junge Schnittbohnen, vermischt mit zermahlenen Paprikablättern und geriebenen Nüssen, dazu zweierlei Käse und heiße Maiskuchen. Es folgen – nach dem vom Tamada angestimmten Hochgesang der Ober-Imerier, eines alten georgischen Stammes – gekochte Hühner und gebackene Forellen. Als die nackten Knöchlein und Gräten abgetragen sind, verlangt der Tamada den Vortrag eines Gedichts. Einer der Literaten verfaßt aus dem Stegreif ein Sonett auf eine schöne Frau. Die Tischgenossen lassen ihn und die Gepriesene hochleben und erheben sich zum gemeinsamen Tanz.
Nachdem sie auf diese Weise die Verdauung gefördert haben, wird ihnen an zwölf langen Spießen der Hammelbraten serviert, bestreut mit Berberitze und übergossen mit einer Tunke aus Granatapfelsaft. Sie sprechen dem Hammel zu, bis die Spieße blankgeputzt sind, legen eine neuerliche Erholungspause ein, in der sie ergriffen einer Rede über den unvergleichlichen Rang der georgischen Sprache lauschen. Alsdann wird ein weiterer Gang aufgetragen: ein ganzes gekochtes Rindsschulterblatt, getunkt in Saft aus wilden Pflaumen, stark gewürzt mit Paprika und anderen Zusätzen.
Endlich lassen die Gäste, im schätzungsweise zehnten oder wer weiß zwanzigsten Trinkspruch des Tages, den Tamada hochleben, unter abermaliger Leerung ihrer Gläser. »Damit war das Festmahl zu Ende, aber nur sein ritueller Teil. Jetzt konnte jeder nach Belieben trinken, essen (sic!), reden, singen, tanzen.«
Ich hätte dieses Protokoll einer Völlerei mit musischen Beilagen für eine lustvolle Übertreibung des Romanautors gehalten, wie Königin Tamars Kristallzähne oder auch die makellose Haut der Prinzessin Wis, deren Glanz bei ihrer Geburt wie ein schimmernder Mond die Nacht erleuchtete – hätte ich vor sieben Jahren nicht selbst an einem ähnlichen Gelage teilgenommen. Es fand freilich nicht auf einem Schloß, sondern auf einer Sowchose, einem Gut in Staatsbesitz, unweit von Tiflis statt.
Wir saßen an einem langen Tisch im Amtszimmer des Direktors. Darauf standen ausgewählte Prachtexemplare der Äpfel und Trauben, mit denen die Sowchose die Hauptstadt belieferte; an der Wand hingen die Bilder Lenins und Stalins, des dereinst Josif W. Dschugaschwili, der zu dieser Zeit von der KPdSU schon seit drei Jahrzehnten in Acht und Bann geschlagen war, was jedoch in seinem Heimatland seinen Ruf als größter Sohn Georgiens offenbar nicht hatte ruinieren können.
Unser Tamada hieß Viktor, er war der Direktor der Sowchose. Viktor erteilte uns die Erlaubnis, ihn zu befragen, blieb eine Weile lang auch keine Antwort schuldig, eröffnete dann jedoch unversehens das Gelage, das uns für den Rest des Tages unserem Studienprogramm völlig entfremden sollte. Auf die Frage nach dem Lohnanteil an den Kosten des Staatsguts erhob er sich, stemmte die Arme auf den Tisch, ließ die Augen unter den dichten Brauen ringsum wandern und erklärte: »Diese Frage kann man nur mit einhundert Gramm beantworten.«
Die Dolmetscherin übersetzte, daß nach der Anordnung des Tamada ein jeder, bevor die Antwort erteilt werde, einen Zehntelliter des bernsteinfarbenen Wässerchens zu kippen habe, das die Sowchose aus ihren Trauben brannte. In diesem herzhaften Stil ging es dann weiter. Viktor fand immer neue Anlässe, einhundert Gramm zu verordnen.
Das eine Mal ließ er Dautzenbacher hochleben, der dem Gebot des Tischmeisters, ein deutsches Volkslied vorzutragen, ohne Zögern gefolgt war und Am Brunnen vor dem Tore gesungen hatte, wobei ihm wahrhaftig die Tränen in die Augen traten. Ein anderes Mal waren die hundert Gramm erforderlich, um das Vergehen des Bibliotheksrates Heinrich Weinzierl aus Passau zu sühnen, der eigenmächtig, nämlich ohne die erforderliche Genehmigung des Tamada, die Toilette aufgesucht hatte; Viktor schleuderte ihm, als er erleichtert, wenn auch schon deutlich schwankend zurückkehrte, den ausgestreckten Zeigefinger entgegen und sprach das Urteil unter Verwendung eines russischen Lehnworts aus dem Deutschen: »Cheinrich! Schtraf!«
Den Trinkspruch des Tamada auf die deutsch-sowjetische Völkerfreundschaft, die den Präsidenten Ronald Reagan Mores lehren möge, erlebte Frau Doktor Bender nicht mehr. Ich fand sie später, als ich von Viktor die Erlaubnis erbeten und erhalten hatte, wegen eines unabweislichen Bedürfnisses vorübergehend die Tafel zu verlassen, im Hinterhof. Sie saß, die Stirn in beide Hände gestützt, auf einem umgestülpten Holzbottich und schüttelte stumm den Kopf, als ich sie fragte, ob ich etwas für sie tun könne.
Ich ging ein paar Schritte weiter, atmete tief, betrachtete die kahlen, blaßgelben Fertigbauten, in denen die Arbeiter der Sowchose und ihre Familien wohnten, die grünen Hügel dahinter. Den leuchtend blauen Himmel, der im Norden auf dem fernen, glitzernden Grat des Gebirges ruhte. Ich suchte die Paßstraße, über die einst die Russen ins Land gekommen waren, den gewundenen, vereisten Pfad am Rand steiler Schluchten.
Unversehens fühlte ich mich ausgesetzt, verloren in einer Weltgegend, aus der ich nie mehr einen Weg zurückfinden würde. Die Stimmen der Vögel hüllten mich ein wie ein flirrendes Netz, das sich aus der Luft auf mich herabsenkte und immer dichter wurde. Aus den Lagerhallen des Guts wehte mich ein Geruch an, den ich nicht zu benennen wußte, das starke Aroma von exotischen Gewächsen, die ich nie genossen hatte und nicht genießen mochte. Bangnis ergriff mich, und zugleich Wehmut.
Es kann nicht an Viktors Obstwässerchen gelegen haben, obwohl ich zu dieser Stunde nicht mehr weit entfernt war von der Grenze meiner Kapazität. Das Gefühl, jeden Halt verloren zu haben, mich von einer Sekunde zur anderen inmitten einer uferlosen Traumwelt wiederzufinden, habe ich auf dieser Reise ein paarmal und auch in nüchternem Zustand erfahren. Es überfiel mich, als Ninoschwili mich durch die Gassen der Altstadt von Tiflis führte; auch, als ich über der armenischen Hochebene zum erstenmal den weißen Doppelgipfel des Berges Ararat aufsteigen sah; auch am Gestade des Sewan, des stillen, riesenhaften Sees, an dem die Eroberer aus Asien ihre Pferde getränkt hatten, bevor sie nach Tiflis vordrangen und die Stadt in Schutt und Asche legten.
Wenn der Besuch des Georgiers mich beunruhigt, dann könnten diese Erfahrungen, die ich schon vergessen hatte, die Ursache sein. Ninoschwili ein Agent? David, der Rächer? Dummes Zeug. Die schlichte Wahrheit lautet, daß er mich erneut mit der rätselhaften Fremde konfrontiert, die mich allzu oft auf solch beängstigende Art in ihren Bann geschlagen hat. Es hat mich Mühe genug gekostet, mich daraus zu befreien.
Wenn ich mich richtig erinnere, gelang mir das auf dem Staatsgut erst, als das Gastmahl wegen des definitiven Ausfalls einiger Tischgenossen abgebrochen werden mußte. Erst als ich Viktor half, den leichenblassen Heinrich Weinzierl in den Bus zu heben, gewann ich wieder Boden unter den Füßen.
7
Ralf hat sich eine unglaubliche Frechheit erlaubt, die ich nur durch Zufall entdeckt habe. Als ich gestern nachmittag ins Gästezimmer hineinschaute, um mich davon zu überzeugen, daß ich es jederzeit Ninoschwili als Unterkunft anbieten kann, fand ich auf der Innenseite der Tür eine große Karte der kaukasischen Region, mit Reißnägeln aufs Holz geheftet. Die Karte trug mehrere, sorgfältig aus dünnem Karton ausgeschnittene und beschriftete Aufkleber.
Auf dem obersten Aufkleber aus rotem Karton stand in sauberen Druckbuchstaben zu lesen: Operation Edelweiß, 1942. Darunter führte ein breiter, sich aufspaltender roter Karton-Pfeil von Rostow am Don nach Süden. Auf dem Schaft des Pfeils klebte das Namensschild Heeresgruppe A (Gen.fm. List). Die westliche Abspaltung, die über die Erdölstadt Maikop zur Küste des Schwarzen Meeres vordrang, trug die Benennung 17. deutsche und 3. rumän. Armee (Gen.oberst Ruoff); die östliche, die sich über Stawropol erstreckte und am Gebirgsfluß Terek endete, enthielt die Aufschrift 1. Panzerarmee (Gen.fm. von Kleist).
Ein am Terek sich anschließender, aus gelbem Karton ausgeschnittener Pfeil führte vorbei an der Flanke des Berges Kasbek und hinab nach Tiflis. Auf diesem Pfeil stand säuberlich geschrieben: Operationsziel wegen Sabotage des Nachschubs 1942/43 nicht erreicht.
Ich war außer mir vor Zorn, stürmte in Ralfs Zimmer, um ihn zur Rede zu stellen. Der Mistfink war ausgeflogen, seine Hefte und Bücher hatte er über Tisch und Boden verstreut, die Schranktür stand offen, ein paar Socken lagen davor. Ich nahm die Karte und fuhr zu Herrn Gero Schumanns Gartenhaus.
Das Haus, das ich zum erstenmal sah, liegt auf der Rückseite einer herrschaftlichen Villa der Jahrhundertwende. Zu beiden Seiten der Straße hohe Ulmen, die die breiten Bogenfenster der Villa mit Sonnenlicht und Schatten sprenkeln. Neben dem Portal sind mehrere Namensschilder angebracht, darunter das einer Firma für Industrieberatungen; die Großmutter weiß offenbar, wie man ein Vermögen mehrt.
Herrn Schumanns Namensschild, mit einem Lautsprecher ausgestattet, fand ich neben einem Gittertor, das in den parkähnlichen Garten führt. Das Tor war nur angelehnt. Ich drückte zweimal auf den Klingelknopf, der Lautsprecher blieb still. Ich zögerte. Es war ja wohl nicht möglich, daß Herr Schumann und seine Gefolgschaft bereits um diese Zeit benebelt waren.
Nach einem Blick ringsum trat ich ein, schob das Tor hinter mir zu, ohne es zu schließen. Ich ging, meine Sohlen knirschten auf dem weißlichen Schotter des Weges, an den Blumenbeeten vorbei in den rückwärtigen Teil des Gartens. Hinter den Fenstern der Villa war niemand zu sehen. Das Gartenhaus, ein eingeschossiger, aber weiträumiger Bau mit französischen Fenstern, lag still im Schatten knorriger alter Bäume am Ende des Grundstücks.
Ich trat auf die Terrasse davor, klopfte an eines der Fenster. Niemand antwortete. Ich versuchte, durch das Fenster zu lugen. Der Wohnraum offenbar, ein breites Sofa, Sessel. Es mag sein, daß ich mich täusche, der hintere Teil des Zimmers lag im Dämmerlicht, aber ich glaubte, an der Rückwand, neben einem Bücherregal ausgespannt, die Reichskriegsflagge zu erkennen.
Ich wußte, daß ich schon zu weit gegangen war, aber mein Zorn trieb mich weiter. Ich ging, nach einem Blick über die Schulter, um das Gartenhaus herum, betrat den schmalen Plattenweg, der zwischen der Rückseite und dem dichten Gebüsch am Zaun des Grundstücks hindurchführt. Dort waren die Gardinen hinter den Fenstern geschlossen. Ich fand eine Tür aus massivem Holz, klopfte an, lauschte. Niemand antwortete. Vögel zwitscherten. Der Geruch der feuchten Erde, des dichten Blattwerks schlug mir in die Nase.
Als ich mich aufrichtete und zurückwandte, stand drei Schritte von mir entfernt ein Bursche in Ralfs Alter, Turnschuhe, T-Shirt und Jeans, der mit beiden Händen einen Karton trug. Er stellte den Karton ab, ließ mich, während er sich bückte, nicht aus den Augen, trat einen Schritt näher. »Was suchen Sie hier?«
»Ich möchte zu Herrn Schumann.«
»Und wieso kriechen Sie dann hier im Gebüsch herum?«
»Ich krieche nicht im Gebüsch herum. Ich suche meinen Sohn, Ralf Kestner.«
»Ralf ist nicht hier.« Ein zweiter Bursche, ebenfalls einen Karton tragend, kam um die Ecke des Hauses, starrte mich an. Der erste zog seinen Schleim hoch und rotzte ins Gebüsch. »Außerdem kann das jeder behaupten. Können Sie sich ausweisen?«
»Machen Sie sich nicht lächerlich! Wollen Sie hier die Polizei spielen?«
»Die kann ich rufen, wenn Ihnen das lieber ist. Woher soll ich wissen, daß Sie nicht einbrechen wollten?«
Der zweite Bursche stellte seinen Karton ab. Der erste warf ihm einen Blick zu, dann sah er wieder mich an. »Also, was ist? Können Sie sich ausweisen?«
Ich habe die Demütigung hingenommen. Ich weiß auch jetzt noch nicht, was ich anders hätte tun sollen, ohne eine Schlägerei zu riskieren, bei der ich nicht nur einen seelischen Schaden davongetragen hätte. Ich zog meinen Ausweis, hielt ihn dem Burschen unter die Nase. Er nahm ihn mir aus der Hand, studierte ihn eingehend, bevor er ihn zurückgab. »Ich werde Gero Schumann sagen, daß Sie sich hier herumgetrieben haben. Das wird ihn bestimmt interessieren.«
»Sparen Sie sich Ihre dummen Verdächtigungen.« Ich steckte den Ausweis ein und ging. Die beiden wichen keinen Schritt zur Seite, ich mußte mich an den stechenden Zweigen der Büsche vorbeidrücken.
Ich habe lange gebraucht, bis ich wieder zu mir fand. Es begann schon zu dämmern, als ich Ralfs kaukasische Karte an die Innenseite seiner Zimmertür heftete. Quer über die roten und gelben Angriffskeile klebte ich zwei Papierstreifen, die ich zuvor in Druckbuchstaben beschriftet hatte. Die Aufschriften lauteten:
Und eine Furcht kommt uns, wir sind zu weit gefahren, Als daß wir je die Heimat wiedersehen.
Bertolt Brecht
Was der deutsche Soldat hält, kann ihm keine Macht der Welt wieder entreißen.
Adolf Hitler, 9. November 1942
Was sonst noch zu tun war, überließ ich Julia. Sie hatte, als ich ihr das Machwerk unseres Sohnes zeigte und ihr sagte, wo er es zur Begrüßung Ninoschwilis plaziert hatte, mit deutlicher Empörung reagiert, ich fühlte mich erleichtert. Wir waren schon beim Abendessen, als Ralf nach Hause kam. Julia stand sofort auf, empfing ihn im Flur und ging mit ihm in sein Zimmer, schloß die Tür. Ich glaube, sogar gehört zu haben, daß ihre Stimme laut wurde, was selten geschieht.