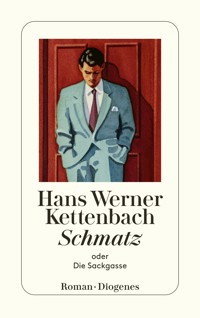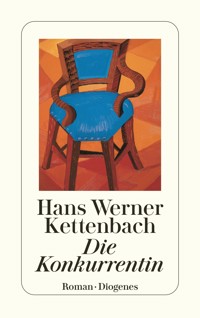10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum vorstellbar, daß Großonkel Wilhelm und Opa Heinrich, zwei biedere Kleinbürger, anno 1928 tatsächlich einen Schatz geraubt haben sollen. Aber Onkel Leo, der meist so verläßliche Mann in Maria Mendels Leben, behauptet es steif und fest. Sein ewiges Schwadronieren geht Maria so sehr auf die Nerven, daß sie auf Schatzsuche geht. Doch was sie findet, hat niemand erwartet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Die Schatzgräber
Diogenes
1
Wenn das Gold noch immer unter diesem Pflaumenbaum vergraben läge und wenn der Baum nicht mittlerweile von Einfamilienhäusern umzingelt wäre, sondern wie vor siebzig Jahren unbedrängt in einem weitläufigen Obstgarten stünde, um den tagelang niemand sich kümmerte, geschweige denn bei der Nacht, so daß der Schatz sich ausgraben ließe, ohne daß jemand aufmerksam würde und auf der Stelle Zeter und Mordio schriee, dann wäre es vermutlich ein leichtes, die Barren zum Leben zu erwecken, sie gegen ganz ordinäre, unauffällige Zahlungsmittel einzutauschen, bei einer verschwiegenen Bank etwa in Luxemburg oder in der Schweiz, und aller Sorgen los und ledig zu sein.
Und nicht nur aller Sorgen. Wenn die Beute des Bankraubs auch nur halbwegs so beträchtlich war, wie Onkel Leo behauptet, dann ließen sich mit diesem Gold sogar einige extravagante Wünsche befriedigen. Zum Beispiel der Kauf einer Wohnung für Leo in einem Seniorenheim, das so exquisit wäre, daß er nicht herumerzählen könnte, seine leibliche Nichte habe ihn ins Elend abgeschoben, um sich unbeobachtet ausleben zu können. Womöglich bliebe sogar so viel übrig, daß ich mich tatsächlich ausleben könnte, natürlich nicht mit einem der zerknitterten Romeos in meinem Alter, der nach zwei Dutzend Ehejahren nichts Interessanteres mehr zu bieten hat als das dringende Bedürfnis, seine Vitalität außerhäusig unter Beweis zu stellen, sondern mit einem glatthäutigen, einem appetitlichen Burschen, der, sagen wir: zwanzig Jahre jünger ist als ich, sich bereitwillig mit meinem Scheckbuch ködern und von mir aushalten läßt, bis ich ihn vor die Tür setze, weil ich seine Dummheit leid bin und den nächsten probieren möchte.
Aber die entscheidende Frage, ohne deren Beantwortung alle weiter gehenden Überlegungen müßig sind, lautet leider, ob es dieses Gold, mit dem sich die Welt so erfreulich verändern ließe, überhaupt einmal gegeben hat. Natürlich schwört Leo darauf Stein und Bein, wie auf alle Geschichten, die er mir in den vergangenen vierzig Jahren erzählt hat. Und wer ihn von dem Bankraub berichten hörte, ohne zu wissen, wer Leo Theisen ist und welchen Ruf er zeit seines Lebens nicht nur in seiner Familie, sondern auch bei seinen Freunden und Bekannten und sogar bei den Zeitungen genossen hat, die immerhin seine Artikel druckten, bevor er beschloß, nicht mehr zu arbeiten, der könnte glauben, Onkel Leo sei selbst dabeigewesen.
Das beginnt mit der Temperatur, die nach seinem Zeugnis an diesem Freitagnachmittag im Sommer 1928 exakt zweiunddreißig Grad erreichte. Als Wilhelm Theisen den hochbeinigen Ford auf der Rückseite der Bank in Sichtweite des Hoftors parkte und den Motor abstellte, verschleierte ihm der Schweiß, der aus seinen Augenbrauen abwärts rann, den Blick auf die enge, schattige Straße. Wilhelm fuhr sich mit dem Handrücken über die Brauen. Sein Bruder Heinrich, der neben ihm saß, zog ein großes weißes Taschentuch aus der Jackentasche und reichte es ihm, ohne ihn anzuschauen. Nachdem Wilhelm den schwarzen Hut gelüftet und die Stirn abgerieben hatte, trocknete auch Heinrich seine Stirn, dann seine Hände. Die Hände zitterten, als er die Anlasserkurbel unter dem Sitz hervorholte und damit ausstieg.
Heinrich blieb auf dem Trottoir neben dem Vorderrad stehen. Ein leichter Luftzug, der Vorbote eines Gewitters, wehte von der Mosel herauf durch die Schlucht der Straße, der Geruch des grünen Wassers milderte die stickige Ausstrahlung der Häuserwände. Während Heinrich sein Gesicht dem Luftzug zuwandte, versuchte er, die Kurbel so ungezwungen zu halten, daß sie keinem der Passanten auffiel und niemanden auf die Frage brachte, warum er da mit der Kurbel in der Hand verharrte, statt sie auf die Welle unter dem Kühler zu stecken und den Motor anzuwerfen. Die Brüder hatten sich wechselseitig eingeschärft, daß es gelte, sich so normal wie möglich zu verhalten, weil jede Besonderheit, an die ein Zeuge sich erinnern könne, gefährlich sei. An die Kurbel hatten sie nicht gedacht.
Um Viertel vor drei, als Heinrich schon überlegte, wie Wilhelm reagieren würde, wenn er wieder einstiege und ihm klarzumachen versuchte, daß das Risiko, Aufmerksamkeit zu erregen, zu groß sei, verließ der kleine schwarze Lieferwagen den Hof der Bank und fuhr die Straße hinauf zum Karthäuserplatz. Heinrich schreckte zusammen, als Wilhelm mit der flachen Hand gegen die Windschutzscheibe zu hämmern begann, dann sah er den Lieferwagen, sprang auf die Straße und steckte die Kurbel auf den Stutzen der Welle, warf den Motor an. Um ein Haar hätte Wilhelm ihn überfahren, Heinrich wich dem Kotflügel aus, warf die Kurbel ins Auto und zog sich, während der Ford beschleunigte, mit beiden Händen auf seinen Sitz.
Ein zweites Mal ließ Wilhelm zu seiner eigenen Bestürzung erkennen, daß die Angst ihn jagte und ganz unbedacht handeln ließ, er wollte dem Lieferwagen, der ein Pferdefuhrwerk überholt hatte, ohne Verzug folgen, mußte wegen zweier Radler, die ihnen unversehens entgegenkamen, auf die Bremse treten und tat das so heftig, daß der Ford auf dem Kopfsteinpflaster ins Schleudern geriet. Heinrich, der starr geradeaus blickte, hörte die Beschimpfung, die einer der Radler ihnen hinterherrief. Erst als sie die Landstraße nach Mainz und das Rheinufer erreicht, die Stadt verlassen hatten und der Verkehr verebbte, schien Wilhelm ruhiger zu werden; er folgte in gleichbleibendem Abstand dem Lieferwagen, der wie ein winziges, schimmerndes Spielzeugauto in den riesenhohen gelbschwarzen Gewitterhimmel über dem Rheintal hineinfuhr.
Als sie sich der ersten Seitenstraße näherten, die nach rechts und hinauf auf die grünen Berge abzweigte, blickte Wilhelm seinen Bruder an und nickte stumm. Heinrich legte den Hut auf den Schoß, griff in die Tasche und zog eine schwarze Halbmaske hervor. Er streifte die Maske über, setzte den Hut wieder auf, lockerte die Parabellum im Hosenbund. Seine Hände, die er zusammenlegte, krampften sich unwillkürlich ineinander. Wilhelm beschleunigte den Ford, bis er den Lieferwagen eingeholt hatte, setzte sich, nach einem Blick in den Rückspiegel, links neben den Lieferwagen, der plötzlich sehr groß geworden schien, und überholte ihn zur Hälfte, Heinrich sah die Gesichter des Fahrers und des Beifahrers, die wie zwei helle Flecken vorüberschwammen. Sekunden später, kurz vor der Einmündung der Seitenstraße, steuerte Wilhelm den Ford scharf nach rechts, er schnitt dem Lieferwagen den Weg ab, der Ford und der Lieferwagen schleuderten nebeneinander in die Seitenstraße und kamen zum Stehen.
Heinrich sprang mit gezogener Pistole von seinem Sitz, er erwartete, von einem Kugelhagel empfangen zu werden, aber dann sah er zu seiner jähen, fast schmerzhaften Erleichterung, daß der Fahrer und der Beifahrer des Lieferwagens die Hände erhoben hatten und wie erstarrt in ihren Sitzen lehnten. Er riß die Tür des Fahrers auf, wedelte heftig mit der Pistole und stieß in einer bemüht groben Stimme hervor: »Laderaum aufschließen!« Als Wilhelm, dessen Hut schief über der Halbmaske saß, hinzukam und seine Pistole vorreckte, war der Fahrer schon ausgestiegen; der Beifahrer, der anscheinend befürchtete, es könne ihm als ein Ansatz zur Gegenwehr übelgenommen werden, wenn er auf seiner Seite, in der Deckung durch den Lieferwagen, ausstiege, rutschte mit erhobenen Händen über den Sitz des Fahrers, blieb mit einer seiner Ledergamaschen am Bremshebel hängen und stürzte auf die Straße, von der er sich sofort wieder erhob, beide Arme emporgestreckt.
Es bedurfte keiner weiteren Aufforderung, Fahrer und Beifahrer stolperten nebeneinander, den Blick über die Schulter auf die Pistolen der Brüder gerichtet, zur Rückseite des Lieferwagens. Der Beifahrer zog einen Schlüssel hervor und schloß die Ladetür des Wagens auf, schwenkte beide Flügel zur Seite. Wilhelm winkte mit der Pistole und deutete auf die drei kleinen, flachen, mit Eisenbändern und Griffen beschlagenen Holzkisten, die auf dem Boden des Lieferwagens standen. Der Beifahrer öffnete auch die Schlösser der drei Kisten. Heinrich sah, als Wilhelm die Deckel zurückschlug, mit einem Seitenblick den Schimmer der Goldbarren. Er dirigierte mit der freien Hand den Beifahrer an die Seite des Fahrers, räusperte sich und fuhr die beiden an: »Umdrehen! Hände in den Nacken!« Während Wilhelm die erste Kiste hochhob und wegschleppte, sagte der Fahrer in einer dünnen, schwankenden Stimme: »Nicht schießen, bitte!« Heinrich zögerte, dann antwortete er: »Keine Angst, euch passiert nichts.«
Als Wilhelm die dritte Kiste vor die Rückbank des Ford gepackt hatte und mit einem scharfen Pfiff auf den Fahrersitz stieg, folgte Heinrich, rückwärts gehend, seinem Bruder. Er zog den Zündschlüssel des Lieferwagens ab und schleuderte ihn ins Gebüsch. Wilhelm reichte ihm die Kurbel, Heinrich warf den Motor an, der bei dem gewaltsamen Bremsmanöver abgewürgt worden war. Als sie aus der Seitenstraße hinausfuhren, ließ ein greller Blitz den Rhein aufleuchten, ein krachender Donnerschlag hallte von den Bergen wider, und es begann in Strömen zu regnen.
Wilhelm fuhr, der Scheibenwischer quietschte, zurück zur Stadt und über die Brücke hinüber aufs rechte Ufer. Die Brüder sprachen kein Wort miteinander, nur allmählich beruhigten sich ihre Atemzüge. Erst als sie das Ende der Brücke erreicht hatten, kam es zu einer Art Austausch zwischen den beiden: Wilhelm lachte einmal laut auf, dann stieß er Heinrich die Faust gegen den Oberarm; Heinrich antwortete mit einem ein wenig angestrengten Lächeln. Auf dem anderen Ufer stieg Heinrich aus, er nahm, nach einem Umweg durch Seitenstraßen, für den Rest der Heimfahrt rheinabwärts die Straßenbahn. Als er zu Hause ankam, hatte Wilhelm zwei Ecken weiter den Ford schon in dem Schuppen neben seiner Werkstatt abgestellt, die Nummernschilder ausgetauscht und den Schuppen verriegelt.
Gegen zwei Uhr in der Nacht fuhren die Brüder die drei Kisten mit dem Handwagen hinauf auf den Berghang über der Kleinstadt. Sie vergruben den Schatz unter einem Pflaumenbaum im Obstgarten der Familie. Heinrichs Frau schien den nächtlichen Ausflug nicht bemerkt zu haben, sie schlief, als er zurückkehrte und ins Bett kroch. Bei Wilhelms Heimkehr war das Fenster des Schlafzimmers im ersten Stock über dem Hof erleuchtet; aber das Licht erlosch, noch während er die Treppe hinaufstieg, und seine Frau fragte ihn nicht, wo er gewesen sei.
2
Ich muß einräumen, daß wohl nicht alle Details des Bankraubs, die ich mir hier vergegenwärtigt habe, schon in Onkel Leos Erzählungen enthalten waren; wahrscheinlich habe ich einige auch selbst erschaffen und hinzugefügt, sie sind, wann immer ich im Lauf der Jahre mich an die Geschichte erinnert und mir ihren Ablauf vorgestellt habe, von irgendwoher aus meinem eigenen Fundus aufgetaucht, sind in die Bilder, die ich vor Augen sah, hineingedriftet und haben sich darin festgesetzt, als hätten sie seit je dazugehört. Aber auch von solch windigen, unvermeidlich trügerischen Zutaten abgesehen, gibt es ja vielfältige Anlässe, am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte zu zweifeln. Nur ist halt der Gegenbeweis, daß sie auf bloßer Erfindung beruhe, keineswegs leicht zu führen.
Zum Beispiel bezweifle ich, daß Wilhelms Ford noch mit einer Kurbel angeworfen werden mußte. Wie jedermann weiß, der mit amerikanischen Gangsterfilmen ein wenig vertraut ist, sind um diese Zeit Bonnie und Clyde, auch Dillinger oder Scarface nach ihren Überfällen ganz einfach ins Auto gesprungen und in derselben Sekunde losgefahren, es hat auch nie einer von ihren Gehilfen mit der Kurbel in der Hand auf der Straße warten müssen. Ich habe, um zu klären, wann der elektrische Anlasser für Verbrennungsmotoren erfunden wurde, sogar nach einschlägiger Literatur geforscht und einige Titel gefunden, darunter Elektrische Zündung, Licht und Anlasser der Kraftfahrzeuge von E. Seiler, das 1938 in zweiter Auflage erschienen ist. Aber selbst wenn ich mir Herrn Seilers Werk oder das eines anderen Experten beschaffte, könnte ich damit Onkel Leos Behauptung, er habe selbst noch in Wilhelms Ford gesessen und die Anlasserkurbel in Händen gehalten, nicht widerlegen; denn vielleicht entstammte dieses Auto ja einem Baujahr, in dem der elektrische Anlasser eben doch noch nicht erfunden war.
Ich bezweifle andrerseits auch, daß Leos so präzise Angabe, das Gold sei unter einem Pflaumenbaum vergraben worden, gegebenenfalls als Ortsbestimmung taugte (was aber erforderlich wäre, wenn man den Schatz suchen und dazu nicht die Erde unter sämtlichen stehengebliebenen Bäumen des ehemaligen Obstgartens aufgraben wollte, seien es Pflaumen, Äpfel oder Birnen, die darauf wachsen). Der Wert dieser Information erscheint mir um so dubioser, als ich nicht weiß, ob überhaupt ein Pflaumenbaum, der schon zur Zeit von Leos Geburt ausgewachsen war, noch immer leben und Früchte tragen kann. Der fragliche Baum müßte ja für den Bauherrn des Eigenheims, der ihn vielleicht – vielleicht! – zwischen seiner Terrasse und dem Zaun zum Garten des Nachbarn hat stehenlassen, einen Nutzen gehabt haben, und wenn der Baum, als der Obstgarten parzelliert und die Häuser gebaut wurden, nur noch ein dürres Stück Holz war oder zu werden drohte, wird er kurzerhand gefällt worden sein.
Natürlich könnte ich mich auch in diesem Punkt kundig machen, aber selbst wenn ich das täte und feststellte, daß nicht nur Onkel Leo, sondern auch Pflaumenbäume imstande sind, rund siebzig Jahre lang zu leben und sich noch immer zu benehmen, als seien sie achtzehn, wäre das kein Beweis dafür, daß der Baum aus Leos Geschichte heute noch steht und das Versteck des Goldes markiert. Leo meint allerdings, daran sei gar kein Zweifel möglich, weil nämlich der Baum, wenn er dem Eigenheimbau oder der Anlage eines Ziergartens im Wege gestanden hätte, nicht abgehackt, sondern mit der Wurzel ausgegraben worden wäre, und dabei hätten die Bauarbeiter auf den Schatz stoßen müssen, was ein großes Aufsehen verursacht und in allen Zeitungen gestanden hätte, aber ebendas sei ja nicht geschehen. Ich bezweifle jedoch diese Argumentation, denn warum sollte der Eigentümer des Grundstücks nicht eigenhändig und ohne Zeugen den Baum ausgegraben, das Gold gefunden und seinen Fund geheimgehalten haben?
Ganz zu schweigen von dem Zweifel, der den Gewährsmann selbst betrifft, Onkel Leo, den meine Mutter den Traumtänzer der Familie nannte. Leo war, als sein Vater und sein Onkel, will heißen mein Großvater und mein Großonkel, angeblich diesen Bankraub begingen, um die vier Monate alt. Er will am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages 1931, also als Dreijähriger, von dem Vorgang erfahren haben, aus einem Gespräch, das Wilhelm und Heinrich bei einem Glas Wein mit gedämpften Stimmen in Heinrichs Wohnzimmer führten, während die Frauen in der Küche das Mittagessen vorbereiteten. Die Brüder hätten auf ihn, der unter dem Tannenbaum mit seinem Weihnachtsgeschenk spielte, einem hölzernen Wäglein mit kleinen Milchkannen aus Blech und einem hölzernen Pferd davor, nicht geachtet. Natürlich habe er dabei nur den Kern der Geschichte erfahren und ihre Bedeutung noch nicht verstanden. Aber was ihm zu Ohren gekommen sei, habe er durch spätere Beobachtungen, schließlich auch Nachforschungen ergänzen können, und so habe sich ihm mit fortschreitendem Alter die ganze Wahrheit erschlossen.
3
Vergangene Nacht, als ich gegen drei aufwachte und nicht mehr einschlafen konnte, sind mir noch mehr der waghalsigen Argumente eingefallen, mit denen Leo jedesmal, wenn die Rede auf den vergrabenen Goldschatz kam, mir zu beweisen versucht hat, daß seine Geschichte sich tatsächlich ereignet habe und der Schatz noch immer an dem bewußten Ort liegen müsse. Natürlich habe ich schon, als er mir das zum ersten Mal erzählte, meine Skepsis erkennen lassen, wenn auch sehr zurückhaltend, da der Anlaß keine respektlosen Fragen erlaubte. Das war vor fünfundzwanzig Jahren, als ich nach zwei enttäuschenden Semestern die Nase von der Literaturwissenschaft voll hatte, nicht wußte, was ich tun und was aus mir werden sollte, bis Onkel Leo mich an die Hand nahm, seine undurchschaubaren Beziehungen spielen ließ und mich am Ende bei der Bank unterbrachte. Sobald der Lehrvertrag unterschrieben war, lud er mich zu einem Abendessen ein, wohl auch, weil er spürte, daß ich diesen Schritt ins richtige Leben mit großem Zagen tat, und zwischen Vorspeise und Hauptgang kam er dann auf das zu sprechen, was er den Familienschatz nannte (und noch immer nennt).
Anfangs dachte ich, er wolle mich bloß unterhalten und mit einem seiner üblichen Späße ein wenig aufheitern, fand diesen neuesten Einfall allerdings reichlich makaber, denn die Unterstellung, daß ausgerechnet ich als angehende Bankangestellte einer Sippe von Bankräubern entstammen sollte, reizte mich nicht im geringsten zum Lachen. Aber da Leo nicht nur vorab mit einer gewissen Feierlichkeit erklärt hatte, ich sei nun alt und erwachsen genug, ein überaus heikles Kapitel der Familiengeschichte zu erfahren, sondern mir auch, während er mich darin einweihte, mehrfach zu verstehen gab, daß es sich bei seiner Offenbarung um einen Vertrauensbeweis handele, für den ich zuvor noch nicht reif gewesen sei, und überdies um die Weitergabe eines Geheimnisses, von dem außer ihm niemand mehr wisse, wurde mir schließlich klar, daß er selbst die Geschichte für wahr hielt.
Ich mochte ihm nicht geradeheraus sagen, daß ich kein Wort davon glaubte, aber ich fragte ihn, wieso meine Mutter, wenn ihr Vater nicht nur als Bankräuber erfolgreich gewesen, sondern meines Wissens auch nie verhaftet oder gar überführt worden sei, denn zeit ihres Lebens unter Geldmangel habe leiden müssen. Leos Antwort war so einleuchtend und so schwer nachprüfbar wie stets, wenn jemand eine seiner Geschichten in Zweifel zieht: Die Brüder hatten das Gold ruhen lassen wollen, bis Gras über den Raub gewachsen war; aber dann versäumten sie die Zeit, zu der sie ihren Schatz hätten heben können.
Meinungsverschiedenheiten, die nicht zuletzt aus den Unterschieden der beiden Charaktere und ihrer jeweiligen Lebenslage entstanden, trugen zu dem Versäumnis bei. Wilhelm, der Älteste von sechs Geschwistern, war dank des Elektrobetriebs, den er in der Kleinstadt unterhielt, als Handwerksmeister so angesehen, daß die Bank in der nahen Großstadt ihn mit den Arbeiten in ihrem Tresorkeller beauftragt hatte, bei denen er von dem Goldtransport erfuhr und die Einzelheiten auskundschaften konnte. Wilhelm wollte sein Leben in der Kleinstadt verbringen, sein Wunschtraum war es, die dort ansässige, stagnierende Eisenhütte zu kaufen, in der sein Vater als Former allmorgendlich um sechs Uhr angetreten war, und durch eine Wiederbelebung dieses Unternehmens der bedeutendste Mann am Ort zu werden.
Heinrich, der Zweitälteste, der den Beruf des Handlungsgehilfen erlernt hatte und als Vertreter in Büroartikeln schon viel herumgekommen war, wollte hingegen die Kleinstadt verlassen und in Köln oder Leipzig, München oder Berlin mit einer eigenen Firma Geschäfte großen Zuschnitts tätigen. Heinrich versuchte, sobald das Gold unter dem Pflaumenbaum verwahrt lag, seinem Bruder klarzumachen, daß er nicht in seiner Werkstatt hocken bleiben und eines schönen Tages die Eisenhütte kaufen könne, ohne daß jedermann und sehr bald auch die Polizei ihn fragen werde, woher er denn so viel Geld habe. Aber es gelang Heinrich nicht, Wilhelm davon zu überzeugen, daß es am sichersten sei, auf ein paar Jahre auszuwandern, nach Kanada vielleicht oder Australien, und alsdann mit einem vorgeblich dort erworbenen Vermögen heimzukehren.
Vielleicht mußte Heinrich selbst erkennen, daß es auch auf diese Weise nicht einfach war, das Gold zu waschen, vielleicht litt er aber auch wie Wilhelm an dem Zweifel, ob der zeitraubende Umweg über das Ausland sich lohnen und ihm früh genug, um sie noch auskosten zu können, die gesellschaftliche Stellung einbringen würde, nach der er strebte. Die Brüder konnten sich jedenfalls nicht entschließen; der Familienschatz blieb ungeteilt und ungenutzt unter dem Pflaumenbaum liegen, bis es zu spät war, ihn auszugraben: Mitte der dreißiger Jahre, nachdem die Nazis ans Ruder gekommen waren, wurde der Obstgarten der Familie mitsamt dem ganzen Berghang über der Kleinstadt beschlagnahmt, unter Bewachung gestellt und enteignet. Die Wehrmacht richtete auf dem Hang eine Beobachtungsstation ein, die eine eventuelle Annäherung des Feindes auf dem linken Rheinufer, sei es über Grund oder in der Luft, rechtzeitig erkennen und melden sollte, und wer versucht hätte, den Zaun, mit dem der Berg abgegrenzt wurde, zu übersteigen und sich dem Pflaumenbaum zu nähern, wäre auf der Stelle als Spion festgenommen, wenn nicht sogar vorsorglich erschossen worden.
Nach dem Krieg übernahm die amerikanische, danach die französische Besatzungsmacht den Berg, bis er 1955, als die Westdeutschen dank der Pariser Verträge wieder selbst Soldat spielen durften, dem Vermögen der Bundesrepublik Deutschland anheimfiel. Da jedoch das deutsche Volk zu dieser Zeit mit dem französischen Erbfeind nicht nur versöhnt, sondern bereits eng befreundet war und die Annäherung des Feindes nicht mehr von Westen, sondern ausschließlich von Osten her erwartet wurde, was bedeutete, daß der nur nach Westen abschüssige Berg seinen strategischen Wert als Beobachtungsstützpunkt eingebüßt hatte, erhob schließlich auch die Bundeswehr nicht den Anspruch darauf, den sie mittels einer großzügigen Auslegung ihres Verteidigungsauftrages durchaus hätte geltend machen können. So wurde der Berghang Ende der fünfziger Jahre reprivatisiert, als Bauland für Eigenheime parzelliert und an ein gutes Dutzend Interessenten verkauft, die sich rechtzeitig in die Anmeldeliste des Projekts ›Wohnen über dem Strom‹ eingetragen hatten oder nachträglich von ihren Freunden bei der Stadtverwaltung auf einen der vorderen Plätze rangiert worden waren.
4
Warum ich Onkel Leo eine hier sehr naheliegende Frage nicht zuvor gestellt habe, verstehe ich nicht, aber heute früh, als ich meinen Teams, die durch zwei Krankmeldungen und eine Abstellung zur Verkaufsschulung dezimiert waren, beim Füllen der Kassentresore half und diese verdammten fetten Bündel von Geldscheinen in die Hände nahm, von denen nicht eines mir gehörte, bin ich plötzlich darauf gekommen: Wieso hat Leo, der angeblich ja als einziger noch von dem Goldschatz wußte, nicht den ehemaligen Obstgarten der Familie reklamiert, als der Berg reprivatisiert wurde? Ich weiß im einzelnen nicht mehr, was er mir von der Beschlagnahme und Enteignung durch die Nazis erzählt hat, aber dabei ist es doch vermutlich nicht rechtmäßig zugegangen. Er hätte ja nach dem Krieg nicht gerade behaupten müssen, daß die Familie zu den Verfolgten des Naziregimes gehört habe, aber irgendeinen Anspruch hätte er schließlich anmelden können, oder irre ich?
Zum Beispiel müßte doch allen Familien, die wie die unsere auf dem Berghang ihr Obst oder ihre Tomaten oder Stangenbohnen gezogen und damit vielleicht sogar einen Teil ihrer Existenz bestritten hatten, zumindest ein Ankaufsrecht eingeräumt worden sein, damit sie, wenn sie es wollten, ihr früheres Eigentum zurückerwerben konnten, zu einem ermäßigten Quadratmeterpreis, versteht sich, um sie dergestalt zu entschädigen, was ja auch nichts Außergewöhnliches gewesen wäre, da zu dieser Zeit die Regierung Adenauer, wie zumindest Leo es darstellt, sich überaus spendabel zeigte und an alle möglichen Leute, deren Stimmen sie einheimsen wollte, Entschädigungen verteilte, so an Vertriebene, die in Wahrheit froh gewesen waren, ihrer alten Heimat den Rücken kehren zu können, oder Ausgebombte, die schon vor ihrem sogenannten Totalschaden nichts anderes als Gerümpel besessen hatten.
Freilich hat Leo, darauf würde ich wetten, das Geld nicht auf der hohen Kante gehabt, um so ein Ankaufsrecht zu nutzen, als der Berg verhökert wurde; aber natürlich hätte jede Sparkasse ihm den erforderlichen Kredit gegeben. Vielleicht hat er das Angebot ignoriert, weil er sich hätte verpflichten müssen, auf dem Grundstück ein familiengerechtes Eigenheim zu errichten, und weil die bloße Vorstellung, irgendeine Bindung einzugehen, diesen Wirrkopf, der von einem Abenteurerleben in Übersee träumte, in Panik versetzte. Daß er das Grundstück mit Gewinn hätte wiederverkaufen können, ist ihm anscheinend nicht in den Sinn gekommen und ebensowenig, daß er als der Eigentümer sämtliche Obstbäume, die noch darauf standen, hätte unbehelligt ausgraben können, um den Schatz zu finden, von dem er mir doch beharrlich erzählt, er liege heute noch dort.
Diese Überlegung machte mich so wütend, daß ich Leo um ein Haar angerufen hätte, noch bevor wir die Schalterhalle öffneten. Ich beherrschte mich, aber im Verlauf des Tages wurde mein Bedürfnis immer größer, diesen alten Narren am Abend ohne Erbarmen mit der Alternative zu konfrontieren, die mir auf der Hand zu liegen schien: Entweder hat er damals in geradezu unverantwortlicher Indolenz die Chance verschenkt, nicht nur sich selbst, sondern schließlich ja auch mich bis ans Lebensende finanziell abzusichern, aus dem Joch der Abhängigkeit zu befreien und vielleicht sogar mit einem bißchen Luxus auszustatten, ganz zu schweigen von dem, was ich für meine Tochter, die immer tiefer in die Bredouille zu geraten scheint, und meinen kleinen Enkelsohn hätte tun können, der vielleicht jetzt schon unter den Problemen seiner Mutter leiden muß; oder alles, was Leo mir über den Familienschatz erzählt hat, war der pure Unsinn, nichts als ein Tagtraum seiner infantilen Phantasie, den er selbst so wenig ernst genommen hat, daß er nicht einen Finger rührte, als sich ihm die Gelegenheit bot, den Traum an der Wirklichkeit zu messen.
Ich hatte nicht mehr daran gedacht, daß es Donnerstag war, einer der zwei Tage der Woche, an denen er für uns beide ein Abendessen kocht. Als ich nach Hause kam, war er dabei, die Gedecke aufzulegen, und es roch so verlockend nach dem Gulasch und den Kohlrabi, die auf dem Herd standen, daß ich ihn vor allem anderen fragte, wie lange er noch brauche, bis wir uns an den Tisch setzen könnten. Er lachte, öffnete eine Flasche seines kalifornischen Roten und trug das Essen auf. Ich geriet wieder einmal in den Zwiespalt zwischen einer Sympathie, die sich nicht nur mit Dankbarkeit erklären läßt, und fast schon zorniger Abneigung gegen diesen verdammten Kerl, der mir mit seinem Seidenschal im offenen Hemdkragen und den kackgelben Mokassins, mit den gespitzten Lippen und den Mümmelbewegungen beim Kosten des Weins auf die Nerven ging, dessen Fürsorge mir aber so wohltat, daß ich ihn hätte umarmen können.
Leo war zeit seines Lebens ein Luftikus, aber um mich hat er sich zeit meines Lebens mit großer Sorgfalt gekümmert, wann immer er ahnte, daß ich das gebrauchen konnte. Ich weiß nicht, ob er die Verpflichtung, mein Patenonkel zu sein, ernster genommen hat, als das üblich ist, oder ob er vielleicht in mir die Tochter sah, die er gern gehabt hätte, wenn er dazu nicht eine Mutter gebraucht und seine Furcht, auf diese Weise an die Kette eines Weibs zu geraten, hätte überwinden müssen. Er hat mich jedenfalls nicht nur bei der Bank untergebracht, er hat mir und Walter auch die Wohnung besorgt, als ich im ersten Jahr nach der Lehre schwanger wurde und Walter bei seiner Versicherung noch so kümmerlich wenig verdiente, daß wir uns schon darauf einstellten, zu dritt mit dem Baby in meinem Miniapartment zu hausen. Onkel Leo war dagegen, er sprach einen Freund an, der mit der Sanierung von Altbauten sich eine goldene Nase verdient hatte, und ob der nun mit meinem Paten eine Leiche im Keller hatte oder ihm bloß etwas schuldig war, weiß ich nicht, aber der Freund überließ uns die Dreizimmerwohnung in einem seiner schönen Häuser ablösefrei und zu einer Miete, die wir aufbringen konnten, ohne uns zu ruinieren.
Leo war auch zur Stelle, als Walter sechs Jahre später den Unfall hatte und starb. Ich konnte in den ersten Tagen keinen klaren Gedanken fassen, war wie betäubt von meinem panischen Schrecken, aber Onkel Leo regelte, was immer es zu regeln gab, von den Anzeigen bis zum Kopfkissen des Sarges, und als alles vorüber war, erklärte er mir, ohne mich unter Druck zu setzen, daß es nach seiner Meinung das beste sei, wenn ich so bald wie möglich wieder arbeiten ginge. Er besorgte für Bärbel, die gerade in die Schule gekommen war, im Handumdrehen den Platz im Kinderhort, und ich vermute, daß er mittlerweile auch einen Freund im Vorstand der Sparkasse hatte, den er unwiderstehlich für mich und meine Lage interessieren konnte, jedenfalls wurde ich, sobald ich mich gemäß seinem Rat dort beworben hatte, ohne jede Komplikation von heute auf morgen eingestellt.
Auf Leos segensreiche Präsenz reagierte ich zum erstenmal mit einem leichten Unbehagen, als er mir vor neun Jahren eröffnete, er wolle sich zur Ruhe setzen, und kurze Zeit später die Zweizimmerwohnung neben der meinen bezog. Er erklärte mir, er habe sich seine Lebensversicherung beim Versorgungswerk der Journalisten ausbezahlen lassen und die erforderlichen Schritte eingeleitet, um die neue Wohnung zu kaufen, die er mir testamentarisch vererben werde, so daß ich nach seinem Tod und wenn Bärbel einmal ausgezogen sei, mich zu günstigen Bedingungen kleinersetzen könne, ohne meine vertraute Umgebung aufgeben zu müssen.
Ich wußte nicht recht, was ich davon halten sollte. Natürlich mußte ich dafür dankbar sein, daß er mich zur Eigentümerin einer recht hübschen Wohnung machen wollte, aber es ging mir entschieden gegen den Strich, daß er nun auch noch zu regeln versuchte, wo ich meinen Lebensabend verbringen würde. Außerdem fragte ich mich, ob er mit seinen sechzig Jahren nicht reichlich früh in Pension gegangen war und wieviel Geld er denn wohl von der Versicherung bekommen haben mußte, wenn er glaubte, davon nicht nur die Wohnung bezahlen, sondern auch bis an sein Ende leben zu können. Zwar kündigte er an, er werde nun Bücher schreiben, aber ich wurde den Verdacht nicht los, daß er sich Tür an Tür mit mir einquartiert hatte, um sich für seine alten Tage beizeiten eine Pflegekraft zu sichern.
Vielleicht hätte ich spätestens die Hilfe ablehnen sollen, mit der er vor drei Jahren abermals zur Stelle war, als Bärbel Knall auf Fall die Schule abbrach und mit ihrem Lover Benny nach München verschwand, um dort das wahre Leben zu leben. Sobald feststand, daß sie nicht zurückkommen würde, fragte Leo mich, was ich davon hielte, wenn er Bärbels Zimmer gegen eine Beteiligung an meiner Miete als sein Arbeitszimmer einrichte und tagsüber benutze, solange ich zum Dienst in der Sparkasse sei. Ich hielt sehr wenig davon, aber ich ging auf den Vorschlag ein, vielleicht auch, weil ich mich ein wenig vereinsamt fühlte, meine Freundin Tine war mit ihrem Paul gerade ans Ende der Welt gezogen, nach Australien, und ohne Bärbel erschien mir die Wohnung gräßlich leer, aber nicht zuletzt war mir schon klargeworden, daß Bärbel ohne einen monatlichen Scheck von mir über kurz oder lang verhungern würde und ich Leos Mietzuschuß sehr gut gebrauchen konnte. So hat Leo einen Teil der Bücher und Papiere, von denen seine zwei Zimmer und der Flur bereits überquollen, seither bei mir untergebracht, hält sich den vermutlich größten Teil des Tages in meinen vier Wänden auf, kocht zweimal die Woche in meiner Küche ein Essen für uns beide und verbringt nicht selten auch den Abend auf meinem Sofa, bevor er sich in seine Wohnung zurückzieht.
5
Das Gulasch und die Kohlrabi waren so gut, daß mir darüber mein Zorn beinahe verlorengegangen wäre, aber es gelang mir, als die Töpfe leer waren, mich noch einmal ein wenig aufzupumpen. Ich blieb am Tisch sitzen, ließ ihn allein das Geschirr abräumen und starrte so lange mit abwesendem Blick auf mein Weinglas, bis er mich fragte, ob irgend etwas schiefgelaufen sei. Nein, nein. Nach einer Pause hob ich die Augen, sah ihn an, lächelte, schüttelte den Kopf und sagte, mir sei nur über Tag ganz unversehens der Schatz unter dem Pflaumenbaum eingefallen, warum, das wisse der liebe Himmel, aber seither beschäftige mich die Frage, auch das natürlich ohne jeden vernünftigen Grund, wie denn die Verwaltung der Kleinstadt sich über die ehemaligen Eigentümer der Gärten auf dem Berghang habe hinwegsetzen und das Areal, ohne sie zu fragen, an irgendwelche hergelaufenen Bauherren habe verschleudern können, als seien noch immer die Nazis am Ruder und nicht demokratisch gewählte und ihren Wählern verantwortliche Gremien.
Ich hätte es mir denken können, daß er sich durch solch eine aufgedonnerte Frage nicht in Verlegenheit bringen ließe, und seine Auskunft fiel denn auch wieder einmal ebenso einleuchtend wie unwiderlegbar aus: Die Beschlagnahme durch die Nazis war Rechtens, jedenfalls nach dem damals geltenden Recht, und den Eigentümern waren sogar Entschädigungen gezahlt worden, wenn auch nur Pfennigbeträge für den Quadratmeter, aber immerhin so viel, daß Dattelbachs Jakob, dem das bucklige Gemüsefeld neben dem Obstgarten der Familie gehört hatte, zweiundzwanzig Tage lang ohne Unterbrechung im Suff leben konnte und noch immer Bares bei sich trug, als er in der zweiundzwanzigsten Nacht aus dem Schifferstübchen im Rheinhafen hinausgeworfen wurde, wobei er dem starken Antrieb, mit dem man ihn auf den Weg brachte, fatalerweise keinen Widerstand leistete, sondern schnurstracks vornüber stolpernd die Geleise der Hafenbahn und den Rand des Kais hinter sich ließ, ins Leere trat und in das dunkle Wasser stürzte, so daß man ihn drei Tage später stromab an einem sandigen Uferbogen fand, das Gesicht nach unten und die Beine im Wasser schaukelnd.
Nach dem Krieg hat die Stadtverwaltung überdies, sobald der Rat das Stadterweiterungs-Projekt ›Wohnen über dem Strom‹ beschlossen hatte, die ehemaligen Eigentümer über die Einzelheiten informiert und ihnen eine Option auf die Grundstücke eingeräumt. Ach ja? Etwa auch ihm, Leo? Ja, ja, aber zu der Zeit war er in Südamerika, das könnte 1958 gewesen sein, als er zum erstenmal auch in großen Zeitungen gedruckt wurde, er war nach Venezuela gekommen, weil er eine Reportage über die Bohrtürme im Maracaibo-See oder eine Schiffsreise auf dem Orinoco hatte schreiben wollen, das waren Themen, die den meisten Redaktionen gefielen, weil die bloßen Namen ihre Stubenhockerphantasie anregten, aber dann hatte er vier Tage nach der Ankunft in Caracas großen Dusel gehabt, der Staatspräsident, ein Oberst Marcos Pérez Jiménez, war gestürzt und übrigens im darauffolgenden Jahr durch den nachmals berühmten Castro-Gegner Rómulo Betancourt ersetzt worden, was eigentlich keine ernstzunehmende Revolution war, aber die Phantasie der Redaktionen nicht minder anregte, er brachte jedenfalls eine ganze Reihe von Berichten unter, verdiente zum erstenmal richtiges Geld und konnte sich einige Zeit lang ein gutes Leben machen.
Wie schön – ein gutes Leben, das wird ihm aber Auftrieb gegeben haben! O ja, das hat es sicherlich. Und die Option, was ist aus der geworden? Hat er zu spät davon erfahren? Nein, nein, das nicht. Soweit er sich erinnern kann, hat seine Schwester, meine Mutter, ihm das Angebot der Stadt nach Caracas geschickt oder vielleicht erst nach Quito, wohin er anschließend reiste, er hat ihr auch eine Vollmacht ausgestellt, damit sie ihn bei eventuellen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung vertreten konnte. Aber als er 1960 zu Besuch in die Heimat kam, war der ganze Berg schon verkauft.
Dann hat also meine Mutter den Rückkauf versäumt? Aber nein, sie hat gar nichts versäumt. Nur waren sie und er, Leo, ja nicht die einzigen Mitglieder der Familie, die zu befragen waren, ob sie die Option nutzen wollten; darüber entscheiden konnte nur eine vielköpfige Erbengemeinschaft, zu der nicht nur zwei noch lebende Schwestern Wilhelms und Heinrichs gehörten, sondern neben meiner Mutter und ihrem Bruder Leo auch sämtliche anderen Abkömmlinge der sechs Geschwister und nicht zuletzt »die Holzköpp«, ein Zweig der Sippe, der auf den zugigen Höhen des Waldgebirges im Osten der Stadt hauste und wegen seines ungehobelten Auftretens bei Familienfesten und Leichenbegängnissen verschrien war, Vetter Konrad aus Wurzbach über Kleinberg hat tatsächlich bei der Primizfeier von Theisens Hubert, als er den Abort hinter dem Haus nicht fand, in eine aus dem Dachfenster einsehbare Ecke des Hofs geschissen, Pardon. Ja, das Amtsgericht hat die Erbengemeinschaft aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Angebot der Stadt zu äußern, aber weder meine Mutter noch er, Leo, haben Lust gehabt, sich mit dieser Verwandtschaft auf eine Auseinandersetzung einzulassen, die ohnehin aussichtslos gewesen wäre.
So war das also. Es ist schlicht und einfach aussichtslos gewesen. Ich fand diese Auskunft nicht im geringsten zufriedenstellend, aber ich wußte auch nicht, was ich dagegen hätte einwenden können, also ließ ich ihn in der Küche stehen, ging ins Wohnzimmer, legte mich aufs Sofa und schaltete den Fernsehapparat ein. Nach einer Weile kam er hinterher, hockte sich neben mir in den Sessel, warf einen Blick auf den Bildschirm, räusperte sich, sah mich an. Er fragte, ob ich Geldsorgen hätte. Ich? Wie er denn darauf komme? Nun ja, er wundere sich, daß ich mich so plötzlich für den Familienschatz interessierte, von dem ich ihm doch auch schon einmal gesagt hätte, die ganze Geschichte hänge mir zum Hals heraus. Ich antwortete, ja, das tue sie in der Tat; aber ich hätte, als ich darauf zu sprechen kam, auch gesagt, daß dieser obskure Schatz mir ohne jeden Anlaß in den Sinn gekommen sei, und keineswegs, daß ich mich dafür interessierte. Er schwieg eine Weile, dann fragte er, ob etwa Bärbel in Schwierigkeiten stecke.
Auch das hätte ich mir denken können. Er läßt sich so leicht nicht hinters Licht führen, und jetzt wird er mir tagelang mit kleinen, wie beiläufig gestellten Fragen zusetzen, um das aus mir herauszulocken, was ich ihm absolut nicht sagen will, weil es ihn erstens nichts angeht und zweitens ich mit jedem Detail, das ich zu berichten hätte, ihm eingestehen müßte, daß die Bedenken gegen Benny, die er zurückhaltend, aber deutlich genug äußerte, nachdem Bärbel ihren Auserkorenen mit nach Hause gebracht hatte, um ihn einmal kostenlos satt zu füttern, sich höchstwahrscheinlich bewahrheiten werden, Bedenken, von denen ich nichts habe wissen wollen.
Ja, ja, Onkel Leo hat mich vor diesem Kabelträger und seinen großkotzigen Plänen, sich im Filmgeschäft selbständig zu machen, gewarnt, und er hat auch Bärbel zu warnen versucht, aber sie ist ihm wie zu erwarten über den Mund gefahren, und ich habe ihr auch noch beigestanden, denn Leo schien mir nun wirklich der allerletzte, um einem jungen Burschen Traumtänzerei vorzuwerfen. Ich verdächtigte ihn außerdem, sich bloß aufzublasen, weil er sich einbildete, Bärbel gehöre ebenso wie ich zu seinem Beritt, in dem kein anderer etwas zu suchen habe, was ein unfairer Verdacht war, denn mit Bärbels Schulfreunden, selbst mit solchen, die offenkundig nicht mehr als den Gedanken im Kopf hatten, sie zu bumsen, ist er immer sehr verständnisvoll und ohne jede feindselige Arroganz umgegangen, wie gräßlich ihre Frisur und ihr Outfit auch gewesen sein mochten, und meine gelegentlichen Liebhaber hat er ausnahmslos höflich und sogar mit Respekt behandelt, obwohl einige darunter waren, die ich selbst schon nach der ersten Nacht nicht mehr sehen konnte.
Ich beantwortete seine Frage mit einem vagen Laut, der so klingen sollte, als sei ich es leid, dergleichen mißtrauische Vermutungen über Bärbel zu diskutieren, und um weiteren Fragen wenigstens an diesem Abend aus dem Weg zu gehen, tat ich, als schliefe ich angesichts des Fernsehprogramms ein. Er blieb noch eine Weile sitzen, dann stand er auf, ging mit sachten Schritten in Bärbels Zimmer, will heißen, sein Arbeitszimmer, und wenig später hinüber in seine Wohnung. Ich lauschte, bis ich hörte, daß der Riegel an seiner Tür zuschnappte, dann schlief ich tatsächlich ein. Halb im Traum überfiel mich ein Gedanke, der mich jäh wach werden ließ: Er hat erkannt, da bin ich ganz sicher, daß ich in Nöten bin, weil Bärbel vermutlich Geld braucht, um die geschäftliche Katastrophe abzuwenden; aber zum erstenmal hat er mir nicht angeboten, mir mit einem Darlehen auszuhelfen.
Ich richtete mich auf, starrte auf den Bildschirm, ohne wahrzunehmen, was darauf stattfand. Ein zweiter Gedanke fuhr mir durch den Kopf, ich war ihm gelegentlich nachgegangen, hatte ihn aber fast schon vergessen gehabt: Davon, daß er seine Zweizimmerwohnung kaufen und mir testamentarisch vermachen werde, hat Leo nicht mehr gesprochen; er hat es mir ein einziges Mal gesagt, damals, als er in die Wohnung einzog, aber seither nie mehr erwähnt. Offenbar ist daraus nichts geworden, so wie aus den Büchern, mit denen er Geld verdienen wollte.
6
Noch an demselben Abend bin ich in Bärbels Zimmer, in Leos Arbeitszimmer, gegangen, auf leisen Sohlen und zur Wohnungstür lauschend, als könne er jeden Augenblick zurückkommen und mich auf frischer Tat ertappen, ich schlug hastig in zweien seiner Lexika nach und fand schwarz auf weiß, was ich nicht hatte glauben mögen, weil er es mir so verdächtig ausführlich erzählt hatte: 1958 ist in Venezuela tatsächlich ein Diktator namens Marcos Pérez Jiménez gestürzt worden. Und wenn ich die Skrupel, in der Habe meines Onkels herumzuschnüffeln, noch ein paar Minuten länger hätte unterdrücken können, dann hätten sich vielleicht auch die Berichte finden lassen, die Leo darüber geschrieben hat, die Ausschnitte aus den Zeitungen, er verwahrt sie alle in einer langen Reihe von Aktenordnern auf der obersten Etage seiner Bücherregale, die Blätter aus den frühen Jahren sind schon ein wenig muffig, sie riechen vage nach dem Büroleim, mit dem die Ausschnitte auf das rauhe Manuskriptpapier geklebt wurden.
Ich verließ das Zimmer und schämte mich ein wenig. Ich mochte allerdings auch nicht ausschließen, daß ich keinerlei einschlägige Berichte in den Ordnern hätte finden können. Hernach, als ich wieder auf dem Sofa lag, überlegte ich, was ich denn unternommen hätte, wenn 1958 in Venezuela nichts anderes passiert wäre, als daß abermals die Erdölproduktion gesteigert worden und die reichen Leute noch reicher und die armen noch ärmer geworden wären, desungeachtet aber kein Mensch an eine Revolution gedacht hätte, jedenfalls nicht so augenscheinlich, daß ein Lexikon oder eine Zeitung darauf eingegangen wäre. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich Leo zur Rede gestellt und ihm unter die Nase gerieben hätte, daß er sich geirrt oder mich absichtlich habe für dumm verkaufen wollen. Hin und wieder habe ich auf eine seiner Geschichten, wenn ich sie allzu hanebüchen fand, so unverblümt reagiert, aber im nachhinein war ich meistens nicht sehr zufrieden. Zum Beispiel bei unserer Auseinandersetzung über John Dillinger.
Von seiner Erinnerung an Dillinger, den Gangster, der 1933 zum Staatsfeind Nummer eins der USA erklärt worden war, hat Onkel Leo mir schon vor vielen Jahren erzählt, und mir gefiel diese Geschichte, allerdings weniger wegen ihres schießwütigen Hauptdarstellers als wegen der anheimelnden Lebensumstände, in denen Leo ihn kennenlernte (oder denjenigen kennenlernte, von dem er später glaubte, es sei Dillinger gewesen). Das war Mitte der dreißiger Jahre, und der kleine Leo hatte mit seinen Eltern und seiner Schwester schon den etwas überstürzten Umzug in die Großstadt, in der wir beide heute leben, hinter sich gebracht, nachdem Heinrich Theisen, sein Vater, im Februar 1932 mit dem Laden, den er zum Verkauf von Büchern und Schreibwaren unter eigener Firma nicht weit von Wilhelms Elektrowerkstatt eröffnet hatte, pleite gegangen war, was ihm nur die Wahl ließ, entweder seiner Heimat sofort, aber ganz anders als geplant den Rücken zu kehren oder Tag um Tag die hämische Genugtuung der Kleinstädter zu ertragen, die seinen geschäftlichen Elan von Beginn an mißgünstig beobachtet hatten.
Ich will nicht abschweifen, aber natürlich drängt sich hier die Frage auf, wieso Heinrich, der Bankräuber, keinen Weg gefunden hat, die Pleite mit Hilfe des Familienschatzes abzuwenden. Onkel Leo meint, die Brüder hätten noch immer zuviel Furcht gehabt, durch einen allzu jäh aufscheinenden Reichtum, eine über Nacht wiederhergestellte Liquidität doch noch auffällig zu werden, die Neider zu mobilisieren und damit Denunzianten, die das Interesse der Polizei hätten auf sie lenken können. Und nach wie vor hätten sie ja vor dem Problem gestanden, einen Käufer zu finden, der ihnen einen Batzen von ihrem Gold gegen Reichsmark abgenommen und den Kaufpreis bezahlt hätte, ohne peinliche Fragen zu stellen.
Meine Zweifel an dieser Erklärung hat Leo durch eine Erinnerung erstickt, die seine Augen feucht werden ließ, als er sie mir anvertraute: Wie sein Vater ihn eines Wintermorgens, vielleicht in dem ominösen Februar 1932, an die Hand nahm und auf den Berghang führte, die windschiefe Pforte des Obstgartens aufschloß und mit ihm unter den bereiften Bäumen einherging, die Nase hob und schnüffelte, als wolle er das säuerliche Aroma der Äpfel und Birnen, das jeden Herbst die Luft erfüllte, noch einmal wahrnehmen; wie er hinausblickte auf das von kaltem Dunst verhüllte Tal des Rheins und schließlich unter einem Pflaumenbaum stehenblieb, den Baum und das Erdreich darunter betrachtete, eine Schuhspitze in das Erdreich drückte, mit einem Kopfnicken »Ach ja!« sagte, sein Taschentuch zog und die Tränen abwischte, die ihm aus den Augen drangen.
Einige Zeit später ging Heinrich wieder auf Reisen, als Vertreter in Büroartikeln. Die Pleite muß sein Verlangen nach der Welt, ihren großen Geschehnissen und Geschäften eher vertieft haben, und vielleicht deshalb erlaubte er sich, solange er selbst daran nicht teilnehmen konnte, eine Ausgabe, für die seine Einnahmen strenggenommen nicht reichten: Des Freitagnachmittags, wenn er von der Reise heimkehrte, brachte er die neuesten illustrierten Zeitschriften mit, oder er schickte, wenn er nicht zum Einkauf gekommen war, seinen Sohn mit abgezähltem Geld in den Tabak- und Zeitungsladen um die Ecke. Leo, sieben oder acht Jahre alt, genoß den Botengang auf die schmale Hauptstraße des Vororts, das Gedränge auf den Gehsteigen, das Klingeln der Straßenbahnen, den satten Geruch des Ladens nach Tabak und Druckerschwärze, den Anblick der Gasflamme, die wie ein ewiges Licht rotblau und still auf einer kleinen Säule am Rand der Theke brannte, damit die Kunden unverzüglich ihre Zigarren anstecken und kosten konnten.
Auf dem Heimweg versuchte er, wenigstens die Titelseiten und die Rückseiten der Blätter in sich aufzunehmen, was schwierig war, weil er nicht stehenbleiben konnte, ohne das Mißfallen von Erwachsenen zu erregen, die der Meinung waren, die Illustrierten seien Gift für ein Kind, und weil, wenn er weiterging und zugleich die Blätter betrachtete, das Risiko unvermeidlich war, entweder einem Erwachsenen in den Weg zu laufen oder von ihm umgerannt zu werden. Immerhin waren es zumindest drei Zeitschriften, die er auf dem kurzen Weg bis nach Hause zu verarbeiten hatte, und zwar nach seiner Erinnerung die Berliner Illustrirte Zeitung, der Illustrierte Beobachter, mit dem die Nazis den anderen, noch der Weimarer Republik verbundenen Blättern das Wasser abgraben wollten, und eine Illustrierte, die sich bereits Der Stern nannte – auch das eine Behauptung Leos, die ich nicht glauben mag, von der ich aber auch nicht weiß, wie ich sie zu widerlegen vermöchte.
Die Existenz des Illustrierten Beobachters freilich hat Leo mir eindrucksvoll beweisen können, er hat eine Titelseite des Blatts aus dem September 1939 über den Krieg hinweg gerettet und hütet sie noch immer in seinen Archivalien, den Abdruck einer Kohlezeichnung, die unter dem Kopf der Illustrierten die ganze Seite ausfüllt, ein deutscher Soldat, Stahlhelm, grimmiges Lächeln, blitzende Augen, der mit seinem Gewehrkolben einen hölzernen polnischen Grenzadler zertrümmert, darüber in einer wie vom Sturm gepeitschten Schrift die Zeile: »So schlagen wir zu!« Vater Heinrich, der den Schmierenschauspieler Hitler verabscheute, hatte die Seite als Dokument der Kriegsbesoffenheit des Führers und seiner Gefolgschaft aufbewahrt; Sohn Leo, der bis zum bösen Erwachen im Frühling 1945 sich für Großdeutschland und den siegreichen Kampf der Wehrmacht begeisterte, sie zu seiner heimlichen Erbauung beiseite geschafft.
Wahrscheinlich war es auch der Illustrierte Beobachter, der den kleinen Leo mit dem amerikanischen Gangsterwesen bekannt machte. Das Thema war ja doch vorzüglich geeignet, die Dekadenz der westlichen Demokratie im allgemeinen und die entarteten gesellschaftlichen Zustände der USA im besonderen bloßzustellen. Die Wirkung auf Leo war jedoch kontraproduktiv; er fühlte sich fasziniert von der Welt, die ihm da vorgeführt wurde, was allerdings auch darauf zurückzuführen sein dürfte, daß er den Kitzel spürte, gegen ein Verbot zu verstoßen, als er die Geschichte verschlang, denn Vater Heinrich zensierte die Illustrierten, bevor Leo sie in die Hand bekam, und die Blätter, in denen Bedenkliches wie die Reportage über das Gangsterwesen stand, schloß Heinrich weg, bevor er sie als Einwickelpapier dem Gemüsehändler überließ.
Leo mußte also auch in diesem Fall eine Gelegenheit abwarten, bei der er allein in der Wohnung war, aber sobald sich die ergab, an einem frühen Sommernachmittag, als der Vorort noch dösend das Mittagessen verdaute, rückte er einen Stuhl an den Bücherschrank, kletterte auf den Sitz, griff über die Kopfleiste des Schranks und tastete nach dem Schlüssel, öffnete damit die Seitentür und nahm die Ilustrierte aus dem dunklen Fach, das nach Bohnerwachs, Alleskleber und der Knetmasse roch, mit der Heinrich die Typen seiner Schreibmaschine reinigte. Leo ließ vorsorglich den Stuhl stehen, den Schlüssel stecken, setzte sich nahebei an den Wohnzimmertisch und schlug das Blatt auf, betrachtete die Fotos, las, was ihn interessierte, las hingebungsvoll, jedoch mit einem Ohr ständig auf die schattige Straße drunten und den dämmrigen Hausflur hinauslauschend, um nicht überrascht und überführt zu werden.
Was er in diesem stillen, sonnenwarmen Gehäuse unbeobachtet, aber nicht ungefährdet, was er in einer animierenden Mischung aus Furcht und Begierde las, hat sich ihm als die Karriere John Herbert Dillingers eingeprägt. Sie begann nach seiner Erinnerung an einem Sommerabend auf dem Dach eines Mietshauses in New York, vielleicht auf der unteren Eastside, vielleicht in Brooklyn. Der junge John, ein untersetzter, kräftiger Bursche von sechzehn Jahren, füttert seine Tauben, schaut ihnen eine Weile zu, blickt dann über die niedrige Mauer, die das Flachdach umgibt, hinunter auf das Dach des Nachbarhauses. Als es dort und auch ringsum nichts Besonderes zu sehen gibt, streckt er sich auf der alten Matratze aus, die er in einem Verschlag neben seinem Taubenhaus bereithält. Er schaut in den Himmel, dessen lichtes Blau allmählich stumpf und dunkel wird, lauscht auf die Verkehrsgeräusche, die aus der Straßenschlucht empordringen, und fällt in einen Halbschlaf.
Das Ächzen der Tür, die aus dem Aufbau des Treppenhauses auf die Dachfläche führt, weckt ihn. John schlägt die Augen auf und sieht Sally, die Frau eines stiernackigen italienischen Straßenhändlers, der mit ihr ein Apartment im obersten Stockwerk bewohnt und sie alle paar Tage durchprügelt. Sally, in der offenen Tür verharrend, hält mit der Rechten über der Brust einen hellblauen Bademantel zusammen, der gut zu ihren roten Haaren paßt. Sie lächelt John an, kommt dann mit ein wenig schleppenden Schritten zu ihm, bleibt neben der Matratze stehen, beugt sich lächelnd über ihn und streckt die Rechte nach ihm aus, der Bademantel fällt auseinander, John sieht, daß Sally darunter nackt ist. Er hebt die Hand und setzt die Finger in ihren fleischigen Schenkel. Sally schlägt mit beiden Händen den Bademantel zurück und hockt sich über John.
Zwei Wochen später findet der Italiener den jungen John mit Sally in seinem Ehebett, beide nackt und so verbissen sich zum Höhepunkt voranarbeitend, daß sie die Heimkehr des Hausherrn nicht wahrnehmen. Der Italiener schlägt seine Pranken in Johns Schultern, reißt ihn empor und schleudert ihn über den Rand des Betts, John fällt krachend gegen den Kleiderschrank, er versucht, auf die Füße zu kommen, während der Italiener sich ihm mit verzerrtem Gesicht und gespreizten Fingern nähert. Sally reißt die Schublade des Nachttischs auf, greift hinein und wirft John eine Pistole zu. John feuert viermal auf den Italiener, er trifft ihn in den Bauch, die Brust und zweimal in den Hals, der Italiener starrt ihn mit weit aufgerissenen Augen an, greift sich an die Kehle, das Blut schießt ihm durch die Finger, er grunzt und bricht zusammen.
John flieht, bevor die Polizisten die Treppe emporgepoltert kommen. Die Leiche, die er hinterläßt, qualifiziert ihn für die Aufnahme in eine Gang, in der er unaufhaltsam aufsteigt und deren Führung er übernimmt, nachdem er seinen Vorgänger auf die gleiche Weise wie den Italiener, diesmal allerdings mit nur einem Schuß, aus dem Weg geräumt hat. Er wird über New York hinaus tätig, bringt es im Mittleren Westen auf ein rundes Dutzend Morde, wird schließlich auch vom Bundeskriminalamt der USA verfolgt, aber nicht gefaßt, weil die auf Zahnstochern herumkauenden, ihre Füße auf den Schreibtisch legenden Agenten des Amtes offenbar nicht fähig sind, mit Verbrechern wie Dillinger fertigzuwerden, im Unterschied zur deutschen Polizei.
Sein Ende findet er auf eine Weise, die ihn, wenn ihm dazu noch die Zeit geblieben wäre, an seinen Anfang hätte erinnern können: Er liegt im Schwenksessel eines Friseurs in Chikago, eingehüllt in einen blendendweißen Umhang, mit sahnigem Schaum eingeseift für die Rasur, den Duft der Zigarre, die er im Aschbecher neben dem Sessel abgelegt hat, und die herben Wässerchen riechend, mit denen der Meister ihn hernach einstäuben wird, als ein schwarzgekleideter Mann mit Weste und schwarzem Hut die Tür des Salons aufstößt und viermal auf ihn feuert, wobei Dillinger in den Bauch, die Brust und zweimal in den Hals getroffen wird. Seine beiden Leibwächter, die es sich mit den neuesten Magazinen in der Sitzecke bequem gemacht haben, verfolgen den Täter, schießen auf der belebten Straße auch mehrmals in die Richtung, in der er verschwunden ist, müssen die Jagd aber unverrichteter Dinge aufgeben. Als sie schweißnaß in den Friseursalon zurückkehren, liegt Dillinger mit stieren Augen in dem Schwenksessel, die Rechte um den Hals gekrallt, aus dem das Blut auf den weißen Umhang rinnt.
Ich bin mir nicht sicher, ob nicht die fleischige Sally mitsamt der Art, in der sie ihren Bademantel trug, für den kleinen Leo das Wichtigste an John Dillingers Lebenslauf war und dafür gesorgt hat, daß er ihn in so lebhafter Erinnerung behielt; jedenfalls hat er mir versichert, daß die Geschichte so und nicht anders in der Illustrierten gestanden habe, die er sich an jenem stillen Sommernachmittag zu Gemüte führte, und ich sah keinen Anlaß, daran zu zweifeln, bis ich eines Tages durch Zufall, als ich in der Stadtbibliothek noch nicht genug Lektüre für den nächsten Monat gefunden hatte und suchend an den Regalen vorbeischlenderte, auf ein Buch stieß, das unter dem Titel Illegal eine Art Geschichte der Verbrechensbekämpfung anbot. Ich blätterte eher gelangweilt darin, begann aber zu lesen, als ich den Namen John Herbert Dillinger fand. Und ich traute meinen Augen nicht, ich las, daß Dillinger nicht von einem professionellen Killer, sondern von Beamten des FBI, und nicht im Sessel eines Friseurs, sondern auf der Straße erschossen wurde, als er mit zwei Frauen ein Kino besucht hatte und nach der Vorstellung ins Freie trat.
Leo hatte mich am Morgen oder am Abend zuvor mit irgendeiner seiner nervtötenden Marotten geärgert, ich weiß nicht mehr, um was es gegangen war, ich lieh jedenfalls das Buch aus und trug es voller tückischer Vorfreude nach Hause. Als er am Abend klingelte und sich, ohne daß ich ihn dazu aufgefordert hätte, auf meinem Sofa niederließ, fragte ich ihn nach einer Weile wie beiläufig, ob ihm der Name Ana Cumpanas etwas sage. Cumpanas? Ana? Nein; das klinge auch eher wie ein ausgedachter Name. Sei es aber nicht, sagte ich; Ana Cumpanas sei die Freundin John Dillingers gewesen, die ihn für fünftausend Dollar dem FBI verraten habe und mit einer anderen Frau dabeigewesen sei, als die Agenten ihn auf offener Straße gestellt und erschossen hätten.
Er begriff sofort, was ich damit sagen wollte, sah mich stirnrunzelnd an, schüttelte den Kopf, als falle es ihm schwer zu glauben, daß ich so platterdings den Wahrheitswert einer Erinnerung bestritt, an der er mich hatte teilhaben lassen. Ich stand auf, holte von meinem Schreibtisch das Buch, in das ich an den beiden Stellen, die von Dillinger handelten, Lesezeichen eingelegt hatte, und schob es aufgeschlagen vor ihn. Er blickte auf das Buch, sah wieder mich an, nahm das Buch und las. Er las schweigend und ohne eine Reaktion zu zeigen. Erst als er das Buch zugeklappt und abgelegt hatte, schüttelte er den Kopf, aber nicht sehr nachdrücklich. Er rieb sich die Stirn, räusperte sich, sagte dann, ohne mich anzusehen, er könne sich eigentlich nicht vorstellen, daß die Naziredakteure die Geschichte so grob verfälscht hätten, nur um die amerikanische Polizei als unfähig darzustellen. Ich sagte, nein, das könne ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Er griff wieder nach dem Buch, schlug das Titelblatt auf und studierte es, blätterte es um und studierte das Impressum. Nach einem Zögern sagte er, den Namen des Verfassers habe er noch nie gehört, auch den Verlag kenne er nicht; aber es sei wohl nicht anzunehmen, daß der Verfasser sich die Geschichte über Dillinger aus den Fingern gesogen und der Lektor sie ungeprüft habe durchgehen lassen. Nein, sagte ich, das sei wohl nicht anzunehmen. Er räusperte sich, öffnete den Mund, als ob er etwas hinzufügen wolle, schloß den Mund aber wieder. Nachdem er eine lange Zeit geschwiegen hatte, sagte ich, ich könne mir andrerseits nur schwer vorstellen, daß seine Erinnerung nicht zuverlässig sei, nicht wahr, und schon gar nicht, daß er sich seine Geschichte aus den Fingern gesogen habe. Er lachte, als hätte ich ihm zu Gefallen einen kleinen Scherz machen wollen, aber er gab keine Antwort. Nachdem ich eine lange Zeit geschwiegen hatte, stand er auf, räusperte sich und fragte, ob er das Buch bis zum anderen Morgen ausleihen könne.
Nicht einmal diese Gnade habe ich ihm gewährt. Ich sagte, ich wolle selbst noch ein wenig darin lesen, er könne es haben, sobald ich damit fertig sei. Er nickte, sagte gute Nacht und ging. Erst als ich hörte, daß er seine Wohnungstür verriegelte, erst als die Stille sich ausbreitete und schwer herniedersank, wurde mir klar, wie tief ich ihn getroffen hatte. Ich glaubte ihn zu sehen, wie er steifbeinig sich in sein Bett streckte, wie er das Licht löschte, sich zur Wand drehte und die Decke über die Schulter zog, wie er alsbald die Decke wieder von sich warf, sich auf den Rücken legte und das Licht wieder einschaltete, weil ihm plötzlich heiß geworden war, zu heiß, um schlafen zu können.
Ich fühlte mich hundeelend. Ich war mir sicher, daß er sich nicht nur mit dem Gefühl abquälte, eine beschämende Niederlage erlitten zu haben, und nicht nur mit der Enttäuschung, daß ausgerechnet ich, seine Patentochter, die er zeitlebens zu beschützen und vor Kummer zu bewahren versucht hatte, ihn so hinterhältig beschuldigte, ein Phantast, wenn nicht sogar ein Lügner zu sein. Damit hatte ich ihm weh genug getan, aber mehr als das: Ich hatte ihn um die Gewißheit seiner selbst gebracht. Er hatte, das glaubte ich aus seiner Reaktion erkannt zu haben, sich die Geschichte seiner Bekanntschaft mit John Dillinger nicht ausgedacht, sie nicht genießerisch erfunden, um sie erzählen zu können. Er glaubte vielmehr, sie tatsächlich erlebt zu haben, und um so peinlicher mußte ihn jetzt die Frage bedrängen, ob er sich selbst, ob er seinen Erinnerungen, seinen Wahrnehmungen, seinen Vorstellungen von der Welt, in der er lebte, noch trauen könne.
Am liebsten wäre ich auf der Stelle hinübergegangen, hätte an seiner Tür geklingelt, ihm die Wange getätschelt, sobald er in seinem Pyjama erschienen wäre, und ihm gesagt, ich hätte es nicht so gemeint. Wahrscheinlich hätte ich auch noch gesagt, die Frage, ob der Autor des Buchs sich seine Dillinger-Story womöglich aus den Fingern gesogen habe, erscheine mir durchaus angebracht. Ich tat nichts dergleichen, und ich fühlte mich hundeelend.
7
Daß jemand die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die ihn umgibt, nach seinem Gusto ummodelt und das Ergebnis dieses Aneignungsprozesses mit der Wirklichkeit selbst verwechselt, ist keine besondere Eigenschaft Leos, keine seiner Verschrobenheiten. Ich habe ähnliches nicht nur getan, als ich noch meine Kurzgeschichten schrieb und diese ziemlich abenteuerlichen Erfindungen in den Augenblicken, in denen ich daran glaubte, zum Schreiben berufen zu sein, für ein wahrhaftiges Abbild der Wirklichkeit hielt, will heißen der Außenwelt, die ich festnageln wollte. Ich tue ja noch immer nichts anderes, wenn ich zum Beispiel mich zufällig an eine der vielen Geschichten erinnere, die ich im Lauf der Jahre von Leo gehört habe, und sie mir, was hin und wieder geschieht, so deutlich vergegenwärtige, als erlebte ich selbst sie noch einmal oder sei gar die erste, der sie widerfährt, bis ich am Ende dieses Vorgangs nicht mehr zu unterscheiden vermag, was daran aus Leos Erzählungen stammt oder was vielmehr ich, ohne mir dessen bewußt zu sein, hinzugefügt habe, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus der Welt jedenfalls, so wie ich sie wahrnehme.
Es war also kein billiger Trost, daß ich Leo zwei Tage nach unserem gemeinsamen Erlebnis mit John Dillinger wie beiläufig sagte, ich hätte genug von dem Buch gelesen, er könne es haben, und nach dem stummen Nicken, mit dem er antwortete, hinzufügte, es sei mir übrigens auch schon einmal oder sogar mehr als einmal passiert, daß sich in eine meiner Erinnerungen ein Name eingeschlichen habe, der dort fehl am Platz gewesen sei, was mich nicht gehindert habe, zunächst einmal steif und fest zu behaupten, er gehöre ebendorthin und ich hätte recht, so geschehen zu meiner Schande bei der mündlichen Abiturprüfung, als meine Philosophielehrerin den Satz »Die Vergangenheit ist das einzig Wirkliche im Leben« zitierte und mich fragte, wer das geschrieben habe. Ich antwortete, ohne zu zögern, der Satz stamme von Emile Zola, ließ mich von der Frage, ob ich dessen sicher sei, nicht irritieren und hätte mir, weil ich auch nach einer erneuten sanften Warnung stur bei Zola blieb, um ein Haar den Unwillen der gesamten Prüfungskommission zugezogen, wenn nicht meine Lehrerin unauffällig, aber nachdrücklich den Kopf geschüttelt und die Brauen hochgezogen hätte, woraufhin ich sagte, ich wisse es wohl doch nicht.
Diese Geschichte schien Leo keineswegs zu überzeugen, was mich im nachhinein nicht wunderte, denn ich hatte sie mir ausgedacht, und es war natürlich reichlich plump, zur Entschuldigung von Leos Gedächtnisschwäche ausgerechnet eine Sentenz über die Vergangenheit heranzuziehen und zu allem Überfluß auch noch eine, die mehr oder weniger besagte, wer sich nicht erinnern könne, der habe keine Ahnung von der Wirklichkeit; aber ich hatte in meinem Zitatenlexikon nichts Besseres gefunden, und es schien mir auch einigermaßen plausibel, daß ich Anatole France mit Zola verwechselt hätte. Leo lächelte, aber er schwieg. Ich wollte es dabei nicht bewenden lassen, also entwickelte ich eine Art von Gedächtnistheorie, ich legte ihm dar, die Reportage, an die er sich erinnere, habe wahrscheinlich die Karriere eines anderen Gangsters beschrieben, aber John Dillingers Name sei wohl der bekannteste und meistzitierte dieser Szene gewesen, ein Synonym gewissermaßen für die amerikanische Bandenkriminalität, und so habe in seiner Erinnerung ebendieser Name irgendwann und unmerklich den von Sallys tatsächlichem Boyfriend verdrängt.
Leo zuckte die Schultern. Nach einer Weile fragte er, wer denn der Autor gewesen sei, nach dem meine Lehrerin mich gefragt habe. Ich sagte, der Satz stehe irgendwo bei Anatole France, und ich wartete begierig darauf, daß er das Stichwort aufnehmen, die Gelegenheit nutzen und wieder zu erzählen anfangen würde, als sei nichts geschehen, denn eines unserer Lieblingsbücher, er hat es mir geschenkt, als ich fünfzehn oder sechzehn war, stammt von Anatole France, das ist Die Bratküche zur Königin Pédauque, wo der rotnasige Bruder Angelus vom Kapuzinerorden sich die nackten Füße in der Herdasche wärmt und für ein Glas Wein und ein Stück Pute den kleinen Jakob, genannt Jakobus Bratspießdreher, das Buchstabieren lehrt, bevor er den Esel, den er aus dem Stall des Vikars entführt hat, mit gestohlenen