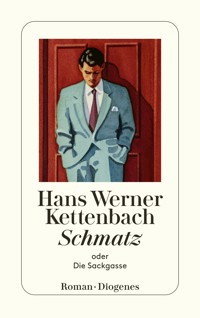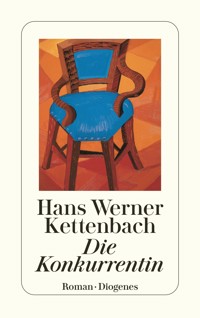
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine sympathische Frau strebt das höchste Amt der Stadt an. Doch sie hat starke Gegner, die versuchen, ihr den Weg zu verlegen. ›Die Konkurrentin‹ ist ein satirischer Politthriller über die Rituale und Taktiken, ohne die in der Demokratie keine Wahlen zu gewinnen sind. Es ist zugleich ein ergreifender Roman über den Konflikt zweier ungleicher Schwestern und damit die Erinnerung an ein dramatisches Kapitel deutscher Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Die Konkurrentin
Diogenes
1
Ich bin ziemlich sicher, daß irgendwer irgend etwas ausgraben wird, irgendeine kleine, ein wenig anrüchige, nicht völlig keimfreie Geschichte aus ihrem Leben, ihrem Hintergrund, vielleicht auch bloß ein abgestandenes, längst vergessenes Gerücht. Das wird passieren, sobald sie tatsächlich versuchen sollte, Oberbürgermeisterin zu werden. Und es spricht auch nicht dagegen, daß ihr Lebenslauf ja kein Geheimnis ist, natürlich ist er immer wieder beschrieben worden, immer dann, wenn sie in dieser pittoresken Karriere als Politikerin einen Schritt weitergekommen war, und natürlich ist sie in den vergangenen Jahren zudem über alles mögliche interviewt worden. Nur hat zum Beispiel nie jemand sie gefragt, was denn aus ihrer Schwester geworden sei, und sie hat, da niemand sich dafür zu interessieren schien, auch nie ein Wort darüber verloren. Aber es gibt ihre Schwester noch, o ja.
Und wenn es nicht die Geschichte von der Schwester ist, dann eben eine andere, ähnlich unerfreuliche, ja, und warum nicht gar eine über das kleine Mißgeschick, das sie noch immer zu ängstigen scheint, obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben habe, sie davon zu überzeugen, daß man ihr deswegen allenfalls eine läßliche Sünde ankreiden könne. Mag sein, daß ich mit derlei Rabulistik ihr protestantisches Gemüt schon überfordert habe. Daß sie sich so schwer damit getan hat und tut, dürfte freilich nicht zuletzt daran liegen, daß in dieser Sache ich als Entlastungszeuge soviel tauge wie der Bock zum Gärtner. Denn schuld daran war ich nicht weniger als sie.
Ich war es, der neben ihr saß, als sie nach diesem geselligen Abend ihrer Fraktion das Auto aus seinem Parkplatz hinausmanövrierte und ziemlich heftig den Kotflügel eines anderen Autos rammte. Und ich war es, der sie anzischte: »Fahr weiter, fahr weiter!«, was sie dann auch tat. Wir hatten beide zuviel getrunken, und selbstverständlich hatte sie Angst vor den Zeitungen, es hatten sich ein paar Journalisten, auch Fotografen, unter den Gästen herumgetrieben, und es wäre für die Meute ein gefundenes Fressen gewesen, wenn die Ratsfrau vor der dramatischen Kulisse eines Streifenwagens ins Röhrchen hätte pusten müssen. Ich weiß nicht mehr, ob auch ich vor irgend etwas Angst hatte, aber mit Sicherheit wollte ich mich nicht in eine peinliche Auseinandersetzung über den Fahrstil meiner Frau verwickeln lassen; ich wollte möglichst bald in mein Bett kommen.
Vielleicht tauchen, sobald die Zeitungen und die Lokalsender berichten, daß sie noch höher klettern möchte, die beiden Gestalten wieder auf, die ich schattenhaft zwischen den Autos sah, als wir ein wenig zu schnell durch die Ausfahrt des Parkplatzes davonfuhren. Es waren, nahm ich an, eine Frau und ein Mann, ein Paar, das wie wir dem allgemeinen Aufbruch hatte zuvorkommen wollen und durch das häßliche Geräusch der Karambolage auf uns aufmerksam geworden war. Ich glaubte erkannt zu haben, daß die beiden hinter uns her blickten. Und vielleicht hatten zuvor auch sie uns erkannt, als sie uns auf den Parkplatz folgten, mit Namen erkannt und gesehen, daß die Ratsfrau sich ans Steuer setzte. Vielleicht hatten sie überlegt, ob sie Anzeige erstatten sollten, aber am Ende hatten sie nicht in den Geruch von Denunzianten kommen wollen, es hätte ihrem eigenen Ansehen abträglich sein können. Oder es war ihnen bloß zu aufwendig, zu lästig gewesen.
Doch jetzt erinnern sie sich daran. Und vielleicht sieht die Sache jetzt anders aus. Sollte so jemand tatsächlich zum Stadtoberhaupt gewählt werden, zum Repräsentanten aller Bürger?
Neider. Konkurrenten. Und die, versteht sich, nicht nur bei den Roten, nein, nein, auch in ihrer eigenen Partei ist daran ja kein Mangel. Das hat sich noch halbwegs in Grenzen gehalten, als sie Bürgermeisterin wurde und damit immerhin zweite Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Zwar hätten einige ihrer politischen Freunde schon damals allzugern die Frage aufgeworfen, ob die Partei, die den größten aller Bundeskanzler hervorgebracht habe, sich unbedingt blamieren müsse und ob es mittlerweile etwa genüge, ein hübsches Gesicht, Holz vor der Hütte und einen strammen Hintern zu haben, um sich für ein belangvolles politisches Amt zu qualifizieren. Aber sie trauten sich nicht, sie fürchteten, als Chauvis und Hornochsen, beschränkte Reaktionäre abgestempelt zu werden; das Zeitalter der Emanzipation hatte nun mal den berüchtigten Wind der Veränderung losgelassen, selbst die Schwarzen hatten ihn wahrgenommen, wenn auch nur als Durchzug, und manch einer von ihnen litt bereits an einer chronischen Gänsehaut. Aus einigen Winkeln und Hinterzimmern der Partei war ein Grummeln zu vernehmen, aber mehr nicht.
Allerdings bezweifle ich, daß es auch diesmal dabei bleiben würde. Gewiß, es gibt hier und da schon eine Oberbürgermeisterin, und eine von den Roten hat ja schon vor vielen Jahren die Kerle, die ihr dieses Amt streitig machen wollten, gleich reihenweise aus dem Feld geschlagen, im Ruhrpott war das, ein handfestes Weib nach meiner Erinnerung. Aber die war als Kandidatin nun mal von den Roten aufgestellt worden, und die scheuten damals vor nichts zurück, womit sich demonstrieren ließ, daß sie den Fortschritt verkörperten und die Schwarzen den Mief und Müll von gestern. Desungeachtet ist die goldene Amtskette auch heute noch kein Schönheitspreis, und sie wird von allzu vielen Leuten innig begehrt, heute nicht weniger als damals. Von meiner Frau zum Beispiel, wenn ich sie richtig verstehe.
Es waren nur ein paar vage Sätze, in denen sie mir bislang von der Idee einiger Köpfe (Möchtegern-Drahtzieher wäre vermutlich auch nicht falsch) ihrer Partei berichtete, ob nicht sie und kein anderer bei der Wahl des Oberbürgermeisters gegen den Amtsinhaber der Roten antreten sollte. Auf meine Frage, ob sie denn wolle, erwiderte sie, diese Idee sei ja nur das Gedankenspiel von ein paar Leuten und die Entscheidung werde wahrscheinlich ohnehin zwischen den beiden Flügeln der Partei getroffen, von denen jeder selbstredend seinen eigenen Favoriten habe, Männer, na klar, und keineswegs gewillt, wegen einer Frau zurückzustecken. Und als ich sie fragte, ob denn unter diesen Umständen nicht gerade sie tatsächlich gute Chancen habe, und sei es nur, weil sie der Partei eine neue Runde dieser öden, nervtötenden Flügelkämpfe erspare, lautete die Antwort, so könne man das nicht sehen.
Es war unüberhörbar, daß sie die Kandidatur recht gern, allzu gern übernehmen möchte. Und ich mache mir Sorgen. Ich fürchte, es könnte böse für sie ausgehen, wenn sie sich so weit vorwagt und so viele andere Ehrgeizlinge herausfordert.
2
Um diesen Punkt abzuschließen, ein für allemal: Sicherlich würde sich heute nur noch ein Masochist, nein, nur ein Lebensmüder mit dem Argument hervorwagen oder auch bloß mit der Andeutung, eine Frau wie sie gehöre eher ins Bett als in die Politik. Aber nicht wenige ihrer Parteifreunde werden genau so denken, wenn nicht sogar genau so empfinden, sozusagen, nämlich in den verborgenen Tiefen ihres Genitalbereichs, und ausschlaggebend ist ja nicht das, was sie bei der Diskussion über die Kandidaten daherschwätzen, sondern wem sie am Ende ihre Stimme geben, hinter dem Paravent der geheimen Wahl, bei der niemand ihre Diskussionsbeiträge als zielbewußte Irreführung erkennen kann. Und daß auf der anderen Seite die Frauen unter den Delegierten dieser Wahlversammlung sich rückhaltlos mit ihrer Geschlechtsgenossin solidarisieren würden, kann ich mir schon gar nicht vorstellen. Ich habe oft genug die giftigen Blicke beobachtet, wenn wir bei einem Empfang oder irgendeinem anderen Auftrieb, an dem ich in ihrem Schlepptau teilnehmen durfte, erschienen und alsbald die Kerle sich an sie heranmachten.
Sie ist nicht ganz ohne Schuld daran. Sie ist … wie soll ich es nennen?
Paßt die ausgeleierte Metapher, daß sie gern mit dem Feuer spielt? Vielleicht läßt es sich so beschreiben, ja. Sie spielt gern mit dem Feuer, noch immer und trotz der vierundfünfzig Jahre, die ihr freilich niemand ansieht. Sie hat es schon mit neunzehn getan, als sie mit einem verstauchten Daumen, den sie sich bei einem Handballspiel eingehandelt hatte, zu mir in die Praxis kam. Ich überwies sie sicherheitshalber und nicht zuletzt, weil ich schon auf den ersten Blick fürchtete, daß ich an dieser Behandlung ein allzu großes Gefallen finden könnte, an den Orthopäden.
Wahrscheinlich hat sie mich durchschaut, schon auf den ersten Blick. Ich habe sie nie danach fragen wollen, und sie hat mir auch nie offenbart, daß es so war. Sie kam jedenfalls immer wieder zu mir zurück, mal zur Kontrolle des Daumens, in dem sie ein jähes, sehr schmerzhaftes Stechen verspürt habe, mal mit einem leichten Fieber, hin und wieder auch mit Symptomen, die ich kurzerhand simuliert genannt hätte, wenn sie, wenn Lene, wenn dieses wahr und wahrhaftig bildschöne Weib nicht bei der Befragung über derlei Molesten solch eine Augenweide gewesen wäre und bei jeder näheren Untersuchung solch ein Abenteuer für meine Fingerkuppen.
Sie kam so lange zurück, bis ich eines Tages sehr plötzlich Witwer mit zwei Kindern geworden war, und sobald sie das erfahren hatte, überzeugte sie mich im Handumdrehen nicht nur davon, daß die siebzehn Lebensjahre, die ich älter war als sie, einer Ehe und dem solcherart gefestigten gemeinsamen Glück nicht im Wege wären; sie trieb mir ebenso meine Zweifel daran aus, daß sie einem zehnjährigen Jungen und einem sechsjährigen Mädchen die Mutter ersetzen und beide großziehen könnte. Sie hat es tatsächlich gekonnt, und sie ist auch nach der Geburt unserer gemeinsamen Tochter, die sie mit einundzwanzig zur Welt brachte, dieser Aufgabe ohne Abstriche gerecht geworden. Es gab keinen Unterschied zwischen René und Clara auf der einen, Birgit auf der anderen Seite, alle drei waren gleichermaßen Lenes Kinder, und sie war allen dreien gleichermaßen die Mutter, eine perfekte Mutter, könnte man sagen, wenn das nicht so penetrant nach Frauen-Schrifttum klänge.
Allerdings hat sie sich nie von dieser Aufgabe absorbieren lassen, und auch von keiner anderen der vielen Aufgaben, die sie übernommen und zielstrebig gelöst hat. Was sie darüber hinaus noch wollte, all das, was ihr nicht minder wichtig war, das hat sie nie aus den Augen verloren. Zum Beispiel ihren Sport. Ihren Theaterabend. Und zum Beispiel, nun ja: das Spiel mit dem Feuer.
Hin und wieder hat sie in unserer Umgebung für Unruhe gesorgt. Hin und wieder gab es Ereignisse wie das unter Beteiligung des Steuerberaters, der mit seiner Frau und den vier Kindern im Haus gegenüber wohnte. An einem frühen Mittwochabend im Oktober, es war zu Beginn des Quartals, und ich war mit der Abrechnung früher fertig geworden, als ich erwartet hatte, ich kam gegen sechs nach Hause, die Blätter der Bäume waren schwer vom Regen, sie waren noch grün, und während ich aus dem Auto stieg und genießerisch die Luft einsog, sah ich im Garten gegenüber die Frau des Steuerberaters. Sie hatte mich anscheinend nicht bemerkt, sie verschwand ohne Gruß hinter der dichten Hecke, als ob sie dort etwas zu tun hätte, was mich wunderte, denn für die Gartenarbeit ließ der Steuerberater einen Gärtner kommen, ich hatte weder sie noch ihren Mann je im Garten arbeiten sehen.
Ich schloß meine Haustür auf und wollte eintreten, als mir aus dem Wohnzimmer der Steuerberater entgegenkam. Er begrüßte mich ein wenig überschwenglich, so kam es mir vor, erzählte mir ein wenig überhastet etwas schwer Verständliches von einem sehr günstigen Angebot zur Kapitalanlage, das er mir habe zeigen wollen, er habe den Prospekt zurückgelassen, und wenn ich interessiert sei, könne er mir in den nächsten Tagen noch ein paar Informationen dazu geben, jetzt sei es leider zu spät dafür geworden, seine Frau warte wahrscheinlich mit dem Essen, einen schönen Abend noch, und verschwunden war er.
Ich begrüßte Lene, die sich im Hintergrund gehalten hatte, sie stand in der Tür des Wohnzimmers, im verdämmernden Licht des Herbsttages, da die Lampen noch nicht brannten. Ich schaltete die Lampen ein und fragte, wo die Kinder seien. Sie sagte, die Kinder seien noch unterwegs, René habe mit einem Freund ins Kino gehen wollen, und Claras Flötenstunde sei auf fünf verlegt worden, sie müsse aber jeden Augenblick nach Hause kommen, und die Kleine sei müde gewesen, sie habe sie in ihren Korb gelegt, und dort schlummere sie jetzt friedlich. Ich war mir nicht sicher, aber mir schien, als sei sie ein wenig außer Atem. Sicher war ich mir, daß auf ihrer Stirn ein feiner Schweißfilm haftete.
Erst ein paar Monate später kam ich darauf, daß die Frau des Steuerberaters seit diesem Abend nicht mehr in meiner Praxis erschienen war, auch keines seiner Kinder und er selbst auch nicht, obwohl er von einer chronischen Gastritis und sie von einem hartnäckigen endogenen Ekzem geplagt wurde, welche Übel ich zuvor regelmäßig und bei beiden mehrfach im Jahr behandelt hatte. Ich fragte Lene nicht, was sie davon halte. Vielleicht spielten ja die Kinder noch immer miteinander, vielleicht gab es noch immer sogar die gelegentlichen Gespräche über den Gartenzaun. Ich weiß es nicht. Mir fiel allerdings auch auf, daß wir von diesen Nachbarn nicht mehr eingeladen wurden. Zwar hatte derlei Umgang ohnehin nicht allzu oft stattgefunden, ich mochte die Leute nicht besonders, die zu ihnen kamen, seine Klientel im wesentlichen, ein dümmliches, hochnäsiges Volk, und die mochten mich nicht, vermute ich. Aber der Schnitt war deshalb so auffällig, weil auch Lene die beiden nicht mehr zu uns einlud. Ich fragte sie nicht nach dem Grund.
Ich habe sie nie gefragt bei solchen Gelegenheiten, Ereignissen wie an diesem Oktoberabend. Es gab einige davon, im Laufe unserer vierunddreißig Ehejahre. Ein vager Glanz in ihren Augen, eine ungewohnte, verhaltene Aura, die ich manchmal schier zu riechen glaubte. Allerdings nur selten dann, wenn ich nach Hause kam, wie an dem Abend, an dem der Steuerberater seine Empfehlung zur Kapitalanlage hinterlassen hatte. Ein wenig öfter schon, wenn sie nach Hause kam, gegen elf, auch schon mal gegen Mitternacht, von der Gymnastikgruppe oder hernach von einer Versammlung der Bürgerinitiative, dann der Partei. Ich sprach nie aus, was ich befürchtete. Ich fürchtete vielmehr, daß sie mir ungefragt offenbaren könnte, woher sie kam und was sie erlebt hatte.
Das war feige, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie ich anders die Abende hätte überstehen sollen, an denen sie gegangen war, um an diesem Training, jener Versammlung, Diskussion, Vorstandssitzung teilzunehmen, oder zuletzt, um die Veranstaltungen zu garnieren, bei denen sie den Oberbürgermeister vertreten mußte, Repräsentationspflichten, die bekanntlich lange dauern konnten. Und es wird auch keiner mir zu sagen wissen, wie ich anders die Nächte hätte überstehen sollen, in denen sie zu Parteitagen, Kongressen, zu Informationsreisen des Ausschusses für dieses oder jenes unterwegs war.
Ich versuchte immer wieder mir klarzumachen, daß ich keinerlei triftigen Grund für meinen quälenden Verdacht hatte; den Verdacht, ja, sie sei mir untreu. Ich versuchte mir klarzumachen, daß ich an primitiver nackter Eifersucht litt, Eifersucht auf jeden, der bei ihr sein konnte, wenn es mir verwehrt war. Ja, ja, der kurze Atem, der dünne Schweiß auf ihrer Stirn; der Glanz in den Augen, die Empfindung, einen merkwürdigen Geruch wahrzunehmen, ohne ihn exakt definieren zu können. Aber das alles waren doch keine Beweise. War es nicht ebensogut möglich, daß all das, was mich quälte, nur in meinem Kopf existierte, Hirngespinste, erzeugt von meiner Eifersucht? Natürlich war das möglich. War es nicht sogar wahrscheinlich?
Um diesen Punkt nun wirklich ein für allemal abzuschließen: Einmal habe ich mich um ein Haar mit einem Kegelbruder geprügelt, der eine dumme, boshafte Anspielung hatte fallenlassen, eine grinsende Bemerkung über jüngere Ehefrauen, von denen manche schwerer zu hüten seien als ein Sack Flöhe. Die anderen Kegelbrüder trennten uns, und er entschuldigte sich sofort, er sagte, er habe nur so dahergeredet und es tue ihm leid. Ich war später ein paarmal in Versuchung, ihn unter vier Augen zu fragen, ob er tatsächlich nur dahergeredet habe. Ich ließ das. Aber wenn er mehr gewußt hat, als er auszusprechen den Mut hatte, dann könnte es auch einige andere geben, die mehr wissen.
Vielleicht solche, die beim Training dabei waren, wenn sie unentschuldigt fehlte. Oder solche, die miterlebt haben, daß sie sich von einer Preisverleihung, bei der sie anstelle des Oberbürgermeisters das Grußwort sprach, sehr früh zurückzog, früher jedenfalls, als der Oberbürgermeister es sich erlaubt hätte. Oder solche, die mit ihr in Tokio, in Moskau oder Brasilia, als der Umweltausschuß dort ein bahnbrechendes System der Müllverwertung studierte, oder auf einem Parteitag in Hamburg oder München in demselben Hotel gewohnt und mitbekommen hatten, wie während der Nacht oder im Morgengrauen irgendein hohlköpfiger, breitschultriger Parteifreund mit blauschwarzem Bartschatten auf den Wangen und an Kinn und Hals ein Zimmer verließ, in dem er nichts zu suchen hatte. Lenes Zimmer.
Schluß jetzt. Ich fürchte, daß ihr Traum von einem krönenden Abschluß ihrer Karriere mit einem widerlichen Knall zerplatzen könnte, wenn irgendeine Information dieser Art oder gar mehrere zugleich ans Tageslicht gerieten und dort breitgetreten würden. Ich fürchte, meine Frau könnte, wenn sie tatsächlich versuchen sollte, Oberbürgermeisterin zu werden, eine sehr bittere Enttäuschung erleben. Einen niederschmetternden Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholen wird.
3
Es war mir gar nicht willkommen, aber es hat mir am Ende gutgetan, mich einmal wieder mit etwas anderem zu beschäftigen als mit Lenes Zukunftsplänen. Am Freitagmittag rief Clara an, sie saß noch in der Praxis, erwiderte auf meine Frage, ob sie mal wieder kein Ende finde, ich hätte gut reden, das Wartezimmer sei gerade mal halbleer und jetzt habe auch noch die Frau angerufen, die am nächsten Morgen zu ihr kommen und Max und Jule hüten sollte, und habe ihr abgesagt, weil sie auf der Treppe ausgerutscht sei und nicht mehr auftreten könne, der Fuß, also werde sie nach der Praxis auch noch einen Hausbesuch mehr machen, um nach dem Fuß zu sehen, und wenn kein Wunder passiere, dann müsse sie das Seminar absagen, an dem sie morgen habe teilnehmen wollen, aber Wunder passierten ja leider nie.
Was für ein Seminar?
Na ja, die Einladung eines Pharmaherstellers, ein Ausflug mit Luxusbussen zu einem Schloßhotel in der Umgebung, ein Vortrag, dann das Mittagessen im Fünf-Sterne-Restaurant des Hotels, noch ein Vortrag, dann der Kaffeeklatsch mit Spezialitäten der hauseigenen Patisserie und am frühen Abend die Rückfahrt, nichts Weltbewegendes, aber sie habe sich halt darauf gefreut, einmal rauszukommen, wenn auch nur für die paar Stunden, und das könne sie sich jetzt natürlich abschminken.
Ich fragte, ob sie mit dem Wunder, das passieren müsse, etwa mich gemeint habe. Sie lachte, und dann sagte sie, nein, nein, aber es hätte ja sein können, daß ich nichts Besonderes zu tun gehabt und Lust bekommen hätte, mit den Kindern irgend etwas zu unternehmen, sie brauche mir doch nicht zu sagen, daß Jule und Max sofort dabei gewesen wären, die beiden ließen sich von mir natürlich zehnmal lieber hüten als von der Frau mit dem Fuß.
Ich schaute aus dem Fenster, der Himmel war blau, die Sonne schien, und ich erinnerte mich, daß es dem Wetterbericht nach auch am Wochenende so bleiben sollte. Ich fragte Clara, wann die Kinder das letztemal im Zoo gewesen seien. Sie sagte, ach, das sei doch auch schon wieder eine ganze Weile her, mit mir seien sie das letztemal im Zoo gewesen, natürlich, mit wem denn sonst, sonst schwinge sich doch keiner dazu auf, und sie komme ja leider nicht dazu.
Ich fragte, ob es ihr recht sei, wenn ich Birgit Bescheid sagte, denn wenn ich mit Jule und Max in den Zoo ginge, könnten wir doch auch Daniel wieder mitnehmen, vielleicht seien Birgit und Rudi ja auch ganz froh, wenn sie den mal einen Samstag lang los seien. Clara sagte, natürlich sei ihr das recht, das sei ja wunderbar, und Jule würde sich ganz besonders freuen, wenn Daniel mitkäme, denn Daniel sei viel folgsamer als Max, so nenne Jule das jedenfalls, seit Max sich von ihr nicht mehr so leicht herumkommandieren lasse.
Am Samstagmorgen um Viertel vor neun brach ich auf, Lene verabschiedete mich mit einem Kuß und dem Wunsch, daß der Tag für mich nicht zu strapaziös werde. Sie wartete auf den Fahrer, er sollte sie zu einer Reihe von Terminen bringen, die sie wahrscheinlich bis zum Nachmittag beanspruchen würden, ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der Partei und seinen Stellvertretern in der Bezirksvertretung, in deren Bereich wir wohnen und der auch Lene einmal angehört hat, danach das Jubiläum eines Kleingartenvereins mit der Prämierung irgendwelcher dickster oder längster Erzeugnisse, danach ein Mittagessen in dem Seniorenheim, dessen Kuratorium sie angehört, und schließlich ein Straßenfest in einem Vorort, den die Roten bei der letzten Kommunalwahl zum ersten Mal, wenn auch nur knapp, an Lenes Clique verloren haben.
Um neun traf ich vor dem Haus ein, in dem Birgit und Rudi die obere Etage bewohnen, Daniel stand bereits vor der Tür, an der Hand seiner Mutter und in einer neuen, kurzen Hose, die ihm bis über die Knie reichte. Er kletterte auf den Rücksitz, schlug mir von hinten auf die Schulter, »Hallo, Opa!«, und hatte keinen Blick mehr für Birgit übrig, die bei der Abfahrt hinter uns her winkte. Ebenso erging es Clara, sie tauchte halb angezogen am Fenster ihres Schlafzimmers auf und warf mir Kußhände zu, während Jule ihren Bruder auf den Rücksitz schob, hinterherstieg und die Tür mit Schwung zuknallte, auch die Geschwister fanden keine Zeit, ihrer Mutter zu winken, Max verlangte, daß der Vetter zur Seite rücke, und Daniel schickte sich schon an, dem Geheiß zu folgen, aber Jule stieß ihren Bruder über Daniel hinweg und sagte, Daniel sei der kleinste und müsse in der Mitte sitzen, und als Daniel zu greinen begann, weil Max ihm weh getan habe, und Max lautstark erklärte, der müsse überhaupt nicht in der Mitte sitzen, entschied ich mich, »Ruhe!« zu brüllen.
Sie waren plötzlich mucksmäuschenstill, und ich sagte, wenn es noch einmal Streit gebe, würde ich sie alle miteinander rausschmeißen, mitten auf der Straße, egal wo, und allein in den Zoo gehen. Ich hörte, daß Max unterdrückt zu kichern begann, aber nachdem Jule ein scharfes Zischen von sich gegeben hatte, hörte er auf damit. Es gelang mir auch, einige weitere Scharmützel, die sich unterwegs anbahnten, zu unterbinden, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam, und als wir am Kassenhäuschen des Zoos anlangten, stieg meine Zuversicht, daß der Tag einen insgesamt zufriedenstellenden Verlauf nehmen werde. Auf dem Schild neben dem Schalter des Kassenhäuschens stand nämlich aufgeschrieben, was alles an besonderen Sehenswürdigkeiten die Besucher erwartete, und das war nicht wenig.
Jule, die sich sofort daran gemacht hatte, das Schild laut vorzulesen, stockte bei dem ersten Eintrag und sagte, ach, sie habe keine Lust, sich wegen Max und Daniel so viel Arbeit zu machen, das könne ich ja tun, also tat ich es. Der erste Eintrag betraf die Przewalski-Pferde (Equus przewalskii) ein Mitglied der Herde, die Stute Irina, hatte ein Fohlen bekommen, dessen Taufe noch bevorstand. Eine Geburt war auch aus dem Gehege der Bisons (Bison bison) zu vermelden, dort hatte Jackie ein Stierkälbchen mit Namen Joe zur Welt gebracht, und schließlich waren bei den Erdmännchen (Suricata suricatta) mehrere Erdmännchenfrauen, die nicht namentlich benannt wurden, sogar mehrfach Mutter geworden.
Jule, die mit stumm sich bewegenden Lippen mitgelesen hatte, sagte, da ständen aber auch noch ein paar Wörter zwischen so Haken oder so, die hätte ich nicht vorgelesen. Ich antwortete, das seien die lateinischen Namen dieser Tiere. Oder auch andere Namen, die die Forscher sich ausgedacht hätten. Jule fragte zweifelnd: »Bison bison?« Ja, sagte ich, zum Beispiel Bison bison.
Max sagte, das glaube er nicht. Er wisse genau, daß diese Tiere Bison hießen, er kenne die, das seien die mit den Hörnern und den dicken Köpfen. Die hießen nicht Bison bison. Er lachte: »Daniel heißt ja auch nicht Daniel-Daniel.« Daniel sah Max betroffen an, und Jule sagte, Max habe keine Ahnung, nämlich auf dem Schild stehe Bison bison, und wenn er nicht zu dumm wäre, könnte er es lesen.
Ich sagte, merkwürdig sei der Name schon, und vielleicht sei er ja falsch geschrieben; mir falle gerade ein, daß das Rind auf lateinisch bos heiße, und vielleicht solle auf dem Schild Bos bison stehen, aber jemand habe sich vertan. Nein, sagte Max, das sei genauso falsch; die hießen bloß Bison. Daniel fragte, wann wir denn zu dem Stierkälbchen gingen oder besser erst mal zu dem kleinen Pferd.
Ich deckte mich mit Prospekten ein, und so konnte ich die Zeit, bis die Stute Irina mit ihrem Fohlen aus einer hinteren Ecke des Geheges angetrödelt kam, mit Informationen über den General Nikolai Michailowitsch Przewalski und seine Forschungsreisen durch Zentralasien überbrücken, wenn ich leider auch, da mein Faltblatt darüber keine Auskunft gab, nicht zu sagen wußte, ob der General das Urwildpferd mit einem Lasso eingefangen hatte oder vielleicht, indem er es mit Zuckerstücken und Äpfeln in einen Käfig lockte. Ich äußerte Zweifel daran, daß es zu dieser Zeit bereits Würfelzucker gegeben habe, aber daß ich mich nicht einmal dafür verbürgen konnte, brachte mir einige Minuspunkte ein, die ich allerdings am Bisongehege kompensierte. Dort stand tatsächlich Bos bison angeschrieben, was Jule sofort vorlas und Max ein wenig unmutig hinnahm, obwohl er ja mit seiner Behauptung, diese Tiere hießen gar nicht Bison bison, vielleicht recht gehabt hatte.
Nachdem wir auch die Erdmännchen mit ihren Erdfrauen und -kindern besucht und am Affenfelsen, versteht sich, eine ziemlich lange Zeit verbracht hatten, wollte Daniel unbedingt noch ins Vogelhaus, und ich ahnte schon, daß mir eine abermalige Prüfung bevorstand. Er sah sich, während wir in der dumpfen, von pausenlosem Gekrächze und Geschrei erfüllten Luft an den Volieren vorbeigingen, nach allen Seiten um, spähte in die Höhe und suchte alle Winkel ab, die möglichen Verstecke im Laub unter dem Glasdach, lief zweimal sogar zurück, weil er offensichtlich fürchtete, nicht gründlich genug gesucht zu haben. Aber er sprach kein Wort, und er legte auch keinen Protest ein, als Jule sich die Nase zuhielt und mit erstickter Stimme sagte, so wie hier stinke es sonst nirgendwo und jetzt wolle sie aber raus hier.
Er äußerte sich erst im Restaurant, als sie ihre Tabletts mit Fischfilet und Knackwurst und Pommes frites und Kartoffelsalat zum Tisch getragen und ich die Becher mit dem braunen Gesöff, ohne das sie in diesem Ambiente keinen Bissen geschluckt hätten, am Automaten der Theke abgefüllt und ihnen gebracht hatte. Er machte sich ebenso wie Jule und Max über die Köstlichkeiten her, aber unversehens ließ er die Gabel sinken, sah zum Fenster hinaus und sagte: »Einen Vogel Greif haben sie noch immer keinen.« Ebenso unversehens wandte er sich wieder seinem Teller zu. Jule und Max starrten ihn kauend an, dann wandten sie den Blick zu mir.
Ich sagte: »Ich hab dir doch gesagt, daß es den Vogel Greif nicht gibt. Nicht in Wirklichkeit. Den gibt es nur im Märchen, das ist ein Fabeltier. Einen Vogel Greif können die hier gar nicht haben.«
Daniel schwieg. Max zog die Nase hoch, trank glucksend einen langen Schluck, setzte den Becher ab, ächzte, pickte sich die Gabel voller Fritten und stopfte sie in den Mund. Dann sagte er kauend: »Ja, aber die Pferde waren auch nicht immer im Zoo. Die sind ja auch erst hierhingekommen, weil der General sie gefangen hat.«
Daniel sah mich gespannt an. Ich musterte Max mit einem Blick, der ihm die Lust an dieser Diskussion nehmen sollte, und fragte: »Und was soll das heißen?« Max gab keine Antwort. Jule sagte mit vollem Mund: »Der Opa hat dich was gefragt. Man gibt Antwort, wenn man gefragt wird.«
Daniel sagte: »So ein General … so einer könnte ja wieder in so ein Land reisen. Und dann könnte er ja auch den Vogel Greif finden. Genauso wie die Pferde.«
Ich sagte: »Nein, das könnte er eben nicht, Herrgott noch mal, jetzt hör doch mal, was ich dir sage!«
Die drei aßen eine Weile schweigend weiter. Dann sagte Daniel: »Du hast uns aber gesagt, daß der Herzog Ernst und der Graf Wetzel den Vogel Greif überlistet haben. Und der dumme Hans hat ihn auch überlistet. Das hast du uns gesagt.«
Max sagte: »Stimmt genau. Das hat er uns sogar vorgelesen. Und so ein General ist bestimmt schlauer als der dumme Hans.«
Ich sagte: »Ich will jetzt kein Wort mehr davon hören! Den Vogel Greif gibt es nur im Märchen, basta!« Nach einem Zögern setzte ich, um jeden neuen Angriffspunkt auszuschließen, hinzu: »In den Sagen auch noch, aber sonst nirgendwo!« Mir war eingefallen, daß ich ihnen gesagt hatte, die Geschichte vom Herzog Ernst sei kein Märchen, sondern eine Sage, und ich war sicher, daß sie das nicht vergessen hatten, sondern nach meinem Basta-Satz bereits darüber nachdachten.
Ich war sehr unzufrieden mit mir. Und nicht zuletzt fürchtete ich, daß ich wieder Ärger mit Birgit bekommen würde. Es war Daniel durchaus zuzutrauen, daß er zu Hause auf die Frage, wie es denn im Zoo gewesen sei, ganz beiläufig sagen würde: »Aber einen Vogel Greif haben sie noch immer keinen.«
4
Ich bin sogar ziemlich sicher, daß es Birgit wieder gelingt, sich aufzuregen. Dabei hat diese Geschichte ganz ohne mein Dazutun angefangen, schuld daran war eigentlich Lene. In ihrem Arbeitszimmer, dem Zimmer, in dem einst René wohnte, bevor er zu seinem Freund zog, hat sie statt der Poster eine Holztafel mit dem Wappen von Pommern aufgehängt, ihrer Heimat, oder genaugenommen nicht ihrer Heimat, denn ihre Familie wurde ja von dort vertrieben, noch bevor Lene gezeugt war, ihre Mutter brachte sie auf einer Etappe des langen Trecks in den Westen zur Welt; allerdings war die Familie seit ewigen Zeiten in Kolberg ansässig gewesen.
Das Wappen zeigt den Vogel Greif, was ich nicht erkannte, bevor Lene es mir sagte. Er sieht in dieser heraldischen Version nicht gar so bedrohlich aus, wie ich ihn aus meiner Lektüre in Kindertagen in Erinnerung hatte, aber Daniel, der mich eines Tages fragte, was das für ein Tier sei, war tief beeindruckt, als ich ihm erklärte, das sei der Vogel Greif und eigentlich sei er ein Löwe, er habe, wie man sehe, auch Tatzen an den Hinterbeinen, aber den Kopf eines Adlers und wie ein Adler einen scharfen Schnabel und Flügel und an den Vorderbeinen Krallen.
Ich wußte nicht mehr genau, wann und auf welche Weise ich das erste Mal von diesem Tier erfahren hatte, aber ich vermutete, daß es durch ein Märchen geschehen war. Ein paar Tage später blätterte ich bei den Brüdern Grimm nach und fand tatsächlich das Märchen vom Vogel Greif und dem niederträchtigen König, der dem dummen Hans seine Tochter verspricht, wenn der ihm eine Feder aus dem Schwanz des Vogels Greif bringe, woraufhin der Hans sich auf den Weg macht, die Frau des Greifen findet und sie für sich einnimmt, so daß sie ihn unter dem Bett ihres Mannes lagern läßt und der Hans während der Nacht, als der Greif zu schnarchen begonnen hat, ihm eine Feder aus dem Schwanz reißen kann. Die Sache spitzt sich dann freilich lebensgefährlich zu, weil der Greif aufwacht und seine Frau weckt und sagt: »Frau, es riecht nach Mensch, und es ist mir, als hätte mich jemand am Schwanz gezerrt«, aber die Frau sagt: »Du hast gewiß geträumt«, und damit gibt er sich zum Glück zufrieden, und so kann der Hans am nächsten Morgen, als der Greif davongeflogen ist, unter dem Bett hervorkriechen und mit seiner Feder zum König und der schönen Königstochter gehen.
Die Geschichte weckte so viele fast handgreifliche, anregende, quasi würzige Erinnerungen in mir, das dicke, ein wenig stockig riechende Buch, die fein gestrichelten Holzschnitte, auf denen der Hans mit seinem Wanderstecken im Wald zu sehen war, die Frakturschrift, die heute keiner mehr lesen lernt, das Buch vor meiner Nase, am Winterabend unter der Lampe, am Sommertag im Schatten der Hofmauer, ich fand mich, als ich mich daran erinnerte, so animiert, daß ich mich ein wenig gründlicher nach dem Vogel Greif umsah. Auf verschlungenen Wegen, über das Lexikon und die mesopotamische Kunst und den Physiologus, gelangte ich schließlich zum Herzog Ernst, dessen Name in meinen Ohren ein fernes Glöckchen läuten ließ, und ich erlebte die zweite Offenbarung, als ich mich an das Buch erinnerte und es in einem Winkel meiner Regale wiederfand.
Es ist eine schwergewichtige Ausgabe der Deutschen Volksbücher, aus den zwanziger oder dreißiger Jahren, und der Herzog Ernst steht darin zwischen dem hörnern Siegfried und der schönen Melusine. Vielleicht habe ich, als der Knabe, der ich war, die schöne Melusine zuerst gelesen, weil ich mir von ihr etwas Unkeusches oder zumindest eine Anregung dieser Art versprach, aber den tieferen Eindruck hat zweifellos der Herzog Ernst hinterlassen, nämlich die schaurige Vorstellung, wie er mit seinem Schiff und seinen Gefährten in den Sog des Magnetberges gerät, an dessen Fuß sie unwiderstehlich scheitern, gleich tausenden Seefahrern zuvor, so daß nur ihrer sieben überleben. Hier nun treten die Greifen auf, sie stoßen im Steilflug von den düsteren Bergen herab, krallen sich die Toten vom Wrack des Schiffes und tragen sie hinauf in ihr Nest, wo ihre gefräßigen Jungen sich darüber hermachen.
Die Situation ist hoffnungslos, wie man sich denken kann, zumal die sieben nur noch einen halben Laib Brot haben, aber um so triumphaler wirkt dann die List, auf die Graf Wetzel, der getreueste der Gefährten, verfällt: Der Herzog und er lassen sich von den anderen in Tierhäute einnähen und aufs Deck legen, die Greifen wittern den Hautgout, halten die beiden für angegangenes, leckeres Futter und bringen sie hinauf ins Nest, aber an diesen vermeintlichen Leichen knabbern und reißen und zerren die Jungen vergebens, der Herzog und Graf Wetzel befreien sich, sobald die alten Greifen wieder aufs Meer hinausgeflogen sind, aus ihren Häuten, sie geben den Jungen was über die Schnäbel und steigen aus dem Nest und bergab in einen Wald, in dem sie sicher sind und mit ihren Abenteuern fortfahren können.
Es wird ein gutes halbes Jahr her sein, daß ich meine Enkel mit diesen Informationen über den Vogel Greif bekannt gemacht habe, es war ein regnerischer Sonntagnachmittag, an dem Birgit und Rudi sich eine Vorstellung des Nederlands Dans Theater ansehen wollten, und als ich Carla anrief und ihr sagte, daß ich auf Daniel aufpaßte und gegen Jule und Max als Gesellschafter nichts einzuwenden hätte, war sie hocherfreut, ich weiß nicht, wie sie den freien Nachmittag nutzte, wahrscheinlich mit ihrem aktuellen Liebhaber, sie hatte jedenfalls Verwendung dafür. Die drei wurden bei mir abgeliefert, ich war allein zu Hause, weil der Oberbürgermeister krank geworden war und die Ehrenkarten zu ebender Vorstellung, die auch Birgit und Rudi sehen wollten, an Lene übergeben hatte, mit der Bitte, an seiner Statt daran teilzunehmen. Lene hatte mich gefragt, ob ich sie begleiten wolle, aber ich war ja schon engagiert. Ich hatte allerdings auch keine Lust auszugehen.
Das Märchen vom Vogel Greif las ich den dreien vor, weil ich nicht sicher war, daß ich aus dem Gedächtnis die diversen Aufgaben, die der dumme Hans zu lösen hat und löst, vollständig und richtig zusammenbekommen würde, und als sie damit noch nicht genug hatten, ließ ich den Herzog Ernst folgen, aber den erzählte ich ihnen, und zwar nicht nur, weil die Darstellung in meinem angegilbten Buch sich allzu angestrengt um den Volkston bemüht und darüber ziemlich pompös geraten ist, ich erzählte die Geschichte auch deshalb in meinen Worten, weil ich sie ein wenig desinfizieren wollte, sie sollte nicht ganz so penetrant nach toten Seefahrern und Aasfressern und deren bekleckerter Behausung riechen.
Einen heiklen Effekt hatte ich vorausgesehen, und der trat auch ein: Das Happy-End ist natürlich insofern keins, als nach dem Herzog und dem Grafen Wetzel die nächsten beiden der sieben Überlebenden sich in Tierhäute einnähen lassen und von den düpierten Greifen in die Freiheit getragen werden, und dann noch einmal zwei, aber einer bleibt nun mal übrig, der niemanden mehr hat, um sich einnähen zu lassen, und das hatte Jule sofort ausgerechnet, sie fragte, was denn aus dem letzten geworden sei. Ich versuchte, mich und den Herzog Ernst herauszureden, ich verwies darauf, daß der siebte am Ende ja allein das halbe Brot habe essen und so überleben können, aber Max sagte: »Ja, ja, wenn die anderen nicht auch noch was davon gegessen haben!«, und als ich erwiderte, der siebte hätte damit aber wenigstens so lange aushalten können, bis ein anderes Schiff ihn rettete, sah Daniel mich finster an, schüttelte den Kopf und sagte: »Was für ein Schiff? Das Schiff wäre doch auch an dem Magnetberg kaputtgegangen!« Sie waren nicht völlig zufrieden, am Ende fiel ein Schatten auf den Herzog Ernst, weil er sich selbst, jedoch nicht alle seine Gefährten gerettet hatte, aber vielleicht hatte er diesen Verlust an Ansehen ja auch verdient, ich konnte es jedenfalls nicht ändern.
Einen anderen, den zweiten Effekt dieser Märchen- und Sagenstunde hatte ich freilich nicht im geringsten vorausgesehen. Am nächsten Tag rief Birgit mich an und fragte, welcher Teufel mich denn geritten habe, daß ich den Kindern ausgerechnet die widerliche Geschichte vom Vogel Greif erzählt hätte, eine absolute Horrorgeschichte, und ob es mir egal sei, wenn die Kinder jetzt unter Alpträumen litten. Ich fragte sie, was sie gegen die deutsche Literatur einzuwenden habe und ob sie etwa ihren Deutschunterricht an den Erfordernissen eines Damenstifts orientiere. Sie erwiderte, daß ich uneinsichtig sei, überrasche sie nicht, aber vielleicht täte ich mir selbst den Gefallen, noch einmal über diesen Fall nachzudenken.
Sie ließ es damit bewenden, wahrscheinlich, weil ihr eingefallen war, daß sie mich als Hüter ihres Sohnes hin und wieder durchaus gebrauchen konnte, aber sie schickte, um dem Monitum Nachdruck zu verleihen, noch einmal Rudi vor, den Gatten, der an derselben Schule wie sie unterrichtet, allerdings Mathematik und Physik, und das merkt man auch, der Kerl hat in seinem Leben vermutlich noch kein Buch aufgeschlagen, das nicht aus Zahlen besteht, und er kam mir in diesem Fall gerade recht. Bei irgendeiner Familiengeselligkeit faßte er mich zwischen Tür und Angel am Arm, lächelte und sagte, es sei wohl doch schon ein bißchen lange her, daß ich Kinder aufgezogen hätte. Ich fragte, ob er auf den Herzog Ernst abziele. Er lächelte und sagte: »Na ja …« Ich fragte ihn, ob er das Buch schon einmal gelesen habe, und er sagte: »Na ja, das …« und lächelte. Ich sagte, er solle es mal lesen; wenn er wolle, könne ich es ihm leihen. Damit hatte sich sein Beitrag erledigt.
Freilich bin ich nicht streitsüchtig, und es wäre mir lieber, wenn der Vogel Greif in meiner Familie in Vergessenheit geriete, abgesehen von Lenes Wappen, aber auf dem bedroht er ja auch nur die Feinde Pommerns. Ich beugte jedenfalls, als wir den Zoobesuch beendet hatten, weiteren Verwicklungen vor. Daniel war nach dem Essen müde geworden, und die beiden anderen schienen auch keine große Lust mehr zu haben, ich fuhr mit ihnen zu uns nach Hause, ließ aber die Aufforderung, ihnen etwas vorzulesen oder zu erzählen, gar nicht erst aufkommen, sondern setzte sie vor den Fernsehapparat. Nachdem Daniel ebendort ein Nickerchen gemacht hatte und Max und Jule sich darüber zu streiten begannen, welches Programm am schönsten und demzufolge einzuschalten sei, holte ich die Gesellschaftsspiele hervor, aber nach der zweiten Partie Mensch ärgere dich nicht sagte Jule dann doch, sie würde lieber ein Märchen hören, Max und Daniel pflichteten ihr bei, und ich traf sofort die vorbedachte Auswahl, ich holte Selma Lagerlöfs Nils Holgersson vom Regal und begann das erste Kapitel zu lesen: »Es war einmal ein Junge …«
Sie waren noch immer gebannt bei der Sache, als Lene nach Hause kam, es war gegen fünf, sie wirkte abgespannt, und als ich sie fragte, wie der Tag gewesen sei, antwortete sie nur einsilbig. Sie sagte auch nicht viel, nachdem die Kinder abgeholt worden waren, machte mir ein kaltes Abendbrot, wollte selbst nichts mehr essen, sie meinte, sie habe keinen Hunger mehr, wir setzten uns vor den Fernsehapparat und sahen uns ein amerikanisches Gerichtsdrama an.
5
Ausgerechnet Nelles. Irgendeinen Drecksack dieses Kalibers hatte ich zwar befürchtet, ich hatte ihn kommen sehen, ja doch, aber nicht diesen, nicht gerade Herrn Doktor Günther Nelles, Chef der Firma Baudewin & Nelles, des nur zweit- oder drittgrößten, doch vermutlich gesündesten, mit Sicherheit rabiatesten Immobilienhandels der Stadt, und im Nebenberuf Ratspolitiker der Schwarzen. Günni Nelles also, den ich schon als Zehnjährigen kennenlernte, da seine Mutter eine meiner ersten Patientinnen nach der Niederlassung war, und der mir desungeachtet nie zur Behandlung anvertraut wurde, er sei, so erklärte mir die Mutter, als wäre ihr das ein wenig peinlich, nun einmal kerngesund, so gesund wie sein Vater, der ebenfalls meine Dienste nicht beanspruchte, bis er eines Tages umfiel und tot war. Den jungen Nelles allerdings bekam ich dann doch noch in die Finger, wenn beim ersten Mal auch nicht in der Praxis, sondern in unserem Haus, als eine ganz spezielle Art von Notfall, in einer schwülen, schweißtreibenden Sommernacht.
Ich weiß nicht mehr, welches der Kinder krank war, wahrscheinlich Birgit, die damals wohl noch in den Kindergarten ging und sich dort so gut wie jeden Infekt einfing, den es einzufangen gab. Wir waren jedenfalls todmüde ins Bett gefallen, konnten noch nicht lange geschlafen haben, es war irgendwann zwischen Mitternacht und ein Uhr früh, als die Türklingel uns weckte, jemand drückte ein paarmal hintereinander auf den Knopf, ich kam nur mit Mühe zu mir, griff nach meinem Morgenmantel und kämpfte mit den Ärmellöchern. Noch bevor ich in die Diele kam, klingelte es schon wieder.
Ich öffnete. Vor mir stand Günni Nelles, in einem hocheleganten, cremefarbenen Jackett, das er über die Schultern gehängt hatte, mit offenem Kragen, den Knoten der teuren Krawatte hatte er weit aufgezogen; an seiner linken Flanke hing ein ziemlich langer Zipfel des kakaobraunen Hemds über den Gürtel der Sommerhose. Mit dem rechten Arm stützte Günni ein spillriges, grell geschminktes Mädchen in einem Minirock, der gerade noch ihren Schritt bedeckte. Sie ließ den Kopf zur Seite hängen, blickte ins Leere. Ihr Gesicht war bleich wie der Tod, abgesehen vom Lippenstift, den Lidschatten und einer blutenden Platzwunde über dem linken Auge, das angeschwollen war und sich zu verfärben begann.
Günni öffnete den Mund, aber ich nahm ihm das Mädchen ab und führte sie in mein Arbeitszimmer, er schloß die Haustür und kam stumm hinterhergetrottet.
Während ich die Wunde versorgte, fragte ich: »Wie ist das passiert?« Das Mädchen wandte die Augen zur Seite und schwieg.
Günni räusperte sich, dann sagte er: »Wir haben Streit bekommen.«
Ich fragte: »Was soll das heißen? Haben Sie sie geschlagen?«
Günni gab einen unwilligen Laut von sich, schüttelte den Kopf, aber er antwortete nicht. Das Mädchen sagte: »Ich bin hingefallen. Er hat mich gestupst.«
Ich sagte: »Wollen Sie mich für dumm verkaufen?«
Günni sagte: »Sie haben doch gehört, was sie gesagt hat. Oder sind wir hier bei der Polizei?«
Ich forderte ihn auf, hinauszugehen und in der Diele zu warten. Er fragte: »Warum?«
Ich sagte: »Erstens, weil ich es gesagt habe. Und zweitens, weil ich Ihre Bekannte untersuchen muß. Also raus jetzt!«
Er sah das Mädchen von der Seite an, aber sie tat, als nehme sie den Blick nicht wahr. Nach einem geräuschvollen Räuspern ging er hinaus.
Als ich sie mir genauer ansah, fand ich in ihrer rechten Handfläche eine massive Hautabschürfung, die sich bis über das Handgelenk erstreckte. Ich fragte: »Sind Sie auf die Straße gefallen?« Sie sagte: »Ja«, und nach einer kleinen Pause: »Hab ich doch gesagt.«
Ich seufzte. Dann sagte ich: »Ich kann Sie nicht zwingen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich nehme an, Sie haben Ihre Gründe. Aber passen Sie auf, daß Sie am Ende nicht die Dumme sind.« Sie gab keine Antwort.
Nachdem ich sie versorgt hatte, sagte ich: »Bitte, kommen Sie morgen nachmittag in meine Praxis. Die Wunden, die Sie da haben, müssen behandelt werden, sonst könnten Sie ernstere Probleme bekommen.« Ich gab ihr meine Karte. Sie las die Aufschrift. Ich sagte: »Und jetzt brauche ich noch Ihren Namen und Ihre Adresse.«
Sie fragte: »Wieso? Er hat gesagt, er bezahlt das.«
Ich sagte: »Das will ich hoffen. Aber meine Patientin sind Sie und nicht er. Also?«
Sie zögerte, aber dann sagte sie mir, sie heiße Nina, Nina Raschke, und wohne am Königsberger Ring Nummer so- undso. Ich kannte die Wohnblocks dort, sie lagen nicht weit vom Straßenstrich.
Ich brachte sie hinaus. Günni stand an der Haustür und starrte durch das Guckfenster hinaus ins Dunkel. Als er unsere Schritte hörte, wandte er sich um, griff an seine Gesäßtasche und zog ein Portemonnaie hervor. Das Hemd hing noch immer aus der Hose heraus. Er fragte: »Wieviel macht das?«
Ich sagte: »Darüber bekommen Sie eine Rechnung.« Ich deutete auf den Hemdzipfel. »Und vielleicht ziehen Sie sich mal wieder an, bevor Sie sich vor Ihren Eltern blicken lassen. Oder wohnen Sie nicht mehr bei ihnen?«
Er sah irritiert auf den Hemdzipfel, stopfte ihn hinter den Gürtel. »Ich brauche aber keine Rechnung. Was haben Sie denn gegen Bargeld?«
»Gar nichts. Aber zuerst bekommen Sie Ihre Rechnung. Und einen guten Rat gebe ich Ihnen kostenlos dazu.« Ich warf einen Blick auf die spillrige Nina, die die Schultern hochgezogen und die Arme unter der Brust verschränkt hatte, als friere sie; dann sah ich ihn an. »Ich kümmere mich auch weiter um Frau Raschke. Und wenn ich feststellen muß, daß Sie sich noch einmal so danebenbenehmen, dann bekommen Sie Ärger. Aber nicht zu knapp.«
Er starrte mich an, schluckte. Dann öffnete er die Tür und ging hinaus. Sie folgte ihm. Auf der Schwelle hielt sie ein. Sie wandte sich zu mir um und sagte: »Danke.«
6
Mit Günni Nelles also muß Lene rechnen. Auch über diesen neuen Stand hat sie mich eher zögerlich informiert. Am Samstagabend und am Sonntag verlor sie darüber kein Wort, erst beim Frühstück gestern, am Montagmorgen, kurz bevor ihr Fahrer klingelte, sagte sie beiläufig, es habe sich wohl herumgesprochen, daß ein paar Leute sie eventuell ins Rennen schicken wollten, und das habe anscheinend andere Leute aufgestört. Es heiße, diese anderen hätten mit Nelles gesprochen, und der sei bereit, sich als Kandidat der Partei für die Wahl des OB aufstellen zu lassen. Ich sagte, das wundere mich nicht, denn wahrscheinlich warte er doch schon seit Jahren auf eine Chance, wieder ins Geschäft zu kommen. Mich wundere nur, daß diese anderen Leute ausgerechnet ihn durchbringen wollten, denn auf dem linken Flügel der Partei gebe es für ihn doch gewiß nichts zu erben.
O nein, o nein, von wegen, sagte sie; das sei schon lange nicht mehr so wie zu der Zeit, als er aus dem Fraktionsvorsitz gekegelt worden sei. Seither habe er sich mehr und mehr von den Aktivitäten des rechten Flügels zurückgezogen. In den vergangenen Jahren sei er ein paarmal sogar als Vermittler zwischen den beiden Flügeln aufgetreten, und das nicht ohne Erfolg. Sie lachte, aber es klang ein wenig aufgesetzt. Dann sagte sie, das sei ja eben das Raffinierte an diesem Schachzug.
Es klingelte, der Dienstwagen stand vor der Tür. Sie raffte ihre Sachen zusammen, gab mir einen Kuß und sagte, es könne spät werden am Abend. Ich ging mit ihr zur Haustür, gab dem Fahrer die Hand. Sie warf mir eine Kußhand zu, als der Wagen abfuhr. Ich winkte zurück, blieb in der Tür stehen, bis der Wagen um die Ecke verschwunden war.
Ich brauchte eine Weile, aber am Ende glaubte ich klar zu erkennen, warum dieser neue Stand sie so spürbar irritiert: Die Leute, die sie gefragt haben, ob sie für das Amt kandidieren wolle, haben sie ja nicht zuletzt deshalb gefragt, weil sie mit keinem der beiden Flügel der Partei verheiratet ist, was bedeutet, daß sie nicht nur mit den Stimmen der gleichermaßen Ungebundenen, sondern auch mit einigen, wenn nicht sogar vielen Stimmen von beiden Flügeln rechnen könnte. Ich selbst bin doch, ohne daß ein Experte es mir vorgesagt hätte, darauf gekommen, daß sie vielleicht die besten Chancen hätte, nominiert zu werden, weil ihre Kandidatur weder den Rechten noch den Linken einen Vorwand böte, erneut die Messer gegeneinander zu zücken; und auf dieses klassische Verfahren der innerparteilichen Willensbildung, das nicht nur die Roten, sondern auch die Schwarzen in der Stadt schon bei allen möglichen Anlässen mehr gelähmt als stimuliert hat, würde vermutlich eine Mehrheit auch der schwarzen Gefolgschaft gern verzichten.
Wenn allerdings Herr Doktor Nelles persönlich, um wieder ins Geschäft zu kommen, sich mittlerweile die Rolle des Unabhängigen, sogar des Vermittlers angeeignet hat und diese Schau, was ihm zuzutrauen ist, ohne Versprecher und ohne Stolpern durchzieht, dann steht es nicht gut um Lenes Träume. Er ist nun mal, so sagt man doch, ein gestandener Mann, nicht wahr, ein erfahrener, ein wetterfester, einer mit Durchsetzungsvermögen, und selbst wenn es nach der Schönheit ginge, könnte er mithalten, nicht mit einem strammen Hintern natürlich, obwohl er auch darüber zumindest früher verfügte, wie ich mich erinnere; wohl aber mit breiten Schultern und einer noch immer passablen Taille, und zudem hat er, wie ich beim letzten Presseball feststellen konnte, sich mittlerweile eisgraue Schläfen zugelegt, auch der kohlschwarze Burt-Reynolds-Schnurrbart, der ihn schon seit vielen Jahren schmückt, ist eisgrau meliert, was auf das perfekteste mit seinem Sonnenbank-Teint und den blauen, eisblauen Augen kontrastiert.
Herr Doktor Nelles wird, so fürchte ich, Lenes Träume kaputtmachen. Er wird sie rundum demontieren. Ausgerechnet Nelles. Es ist zum Kotzen.
7
Nina Raschke, um ihre Geschichte und die von Günnis Anfängen als gestandener Mann zu vervollständigen, kam pünktlich am Tag nach unserer ersten Begegnung in meine Sprechstunde. Statt des Minirocks trug sie Jeans, statt der Kriegsbemalung nur ein wenig Lippenstift. Ich sah mir ihre Blessuren und das schillernde Auge an, sagte ihr, das heile aber sehr schön, und während ich die Wunde über dem Auge frisch verpflasterte, sagte sie unvermittelt: »Er hat mir da eine verpaßt. Voll drauf, mit der Faust.«
Ich beschäftigte mich mit der Wunde. Erst nach einer Weile fragte ich: »Warum?«
Sie ließ einige Zeit verstreichen, dann sagte sie: »Ich bin zu ihm ins Auto gestiegen. Auf der Insterburger Allee.«
»Gehen Sie da anschaffen?«
»Ja. Das heißt, manchmal. Nur, wenn ich Geld brauche.«
»Klar. Und was dann?«
»Wir sind ein Stück weitergefahren, in eine Seitenstraße. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Fuchshecke.«
»Ist das dieser Fahrweg am Bahndamm?«
»Ja.« Sie sah mir eine Weile zu, als ich mir ihre Hand vornahm, dann sagte sie: »Na ja, wir sind dann auf den Rücksitz gegangen. Und bis dahin war eigentlich alles ganz normal. Er hatte eine Fahne, das hab ich gerochen, aber das haben die meisten. Bloß dann …« Sie schüttelte den Kopf, verzog das Gesicht.
Nach einer Weile sagte sie, ihre Stimme klang unversehens, als drücke ihr jemand den Hals zusammen: »Ich hab doch tatsächlich vergangene Nacht davon geträumt. Ich hab die ganze Scheiße noch mal geträumt, das müssen Sie sich mal vorstellen!«
Ich sagte: »Legen Sie eine Pause ein, wenn es Sie zu sehr mitnimmt.«
»Nein, nein.« Sie schluckte. »Ich schaff das schon. Von so einem Arschloch lass’ ich mich doch nicht fertigmachen.« Sie schluckte noch einmal, holte Atem. Dann sagte sie: »Ich hatte meinen Slip kaum runter, da fällt der über mich her. Rammt mir seinen Ständer rein, ich denke, der reißt mich auf bis an den Bauchnabel, oder er kommt hinten wieder raus, tatsächlich. Und dann fängt er an zu ficken wie Nachbars Lumpi, was sag ich, wie ein Stier, wie ein Bekloppter, ich denke, der fickt mich durch den Sitz, tatsächlich, ich denke, ich lande auf der Straße.«
Sie schüttelte den Kopf, holte tief Atem.
Ich fragte: »Sie haben sich gewehrt?«
»Na klar. Zuerst hab ich geschrien. ›He, he, langsam!‹ oder so was. ›Bist du bescheuert?!‹ Aber der hat überhaupt nicht reagiert. Fickt weiter wie … wie eine Maschine.« Sie schluckte. »Ich hab tatsächlich Angst gekriegt. Ich hab’s geschafft, einen Arm freizubekommen, und dann hab ich ihn am Ohr gepackt und den Daumen aufs Auge gesetzt und zugedrückt. Und da ist er in die Höhe gegangen, und ich unter ihm raus, hab nach ihm getreten und hab ihn voll zwischen den Beinen erwischt, und ich hab die Tür aufbekommen und mich rausgezogen.«
Sie holte Atem. »Na ja, und er gleich hinter mir her, rafft mit einer Hand seine Hose hoch und mit der anderen packt er mich, ich hab mich in meinem Slip verheddert, und dann haut der Saukerl mir mit der Faust aufs Auge, und ich falle hinter das Auto und auf die Seite und rutsche mit der Hand über den Schotter, da haben sie so Schotter auf der Straße, oder wie das heißt.«
»Splitt.«
Sie sah mich fragend an.
Ich sagte: »Rollsplitt. Dieses schwarze Zeug, das nach Teer riecht. Ich hab’s an Ihrer Hand gesehen.«
Sie lächelte mich an. Dann sagte sie: »Sie sind top, was?«
»Ich weiß nicht, ob ich top bin. Aber ich geb mir Mühe.« Als sie zu nicken begann und nicht aufhörte, mich anzulächeln, sagte ich: »Und wie ging’s weiter?«
Sie seufzte. Nach einer Weile sagte sie: »Ich glaube, ich hab Schwein gehabt. Ein Auto ist in die Straße gekommen. Eine Kollegin mit einem Freier. Sie sind an uns vorbeigefahren und ein Stück weiter stehengeblieben. Als das Auto herankam, hat er sich hinter sein Auto geduckt, neben mich, er hat gesagt, ich soll still sein. Wenn ich still bin, gibt er mir einen Hunderter. Und als das Auto vorbei war, hat er mich hochgezogen und mich wieder in sein Auto gesetzt, und dann ist er eingestiegen und hat mir den Hunderter gegeben.«
»Haben Sie keine Angst gehabt? Ich meine …«
»Klar hab ich Angst gehabt. Und dann hab ich gemerkt, daß ich blute. Ich hab gesagt, ich blute, und er hat das Licht eingeschaltet, und als er das da oben gesehen hat, hat er mir ein Taschentuch gegeben und gesagt, er fährt mich zum Arzt.«
»Und dann hat er Sie zu mir gebracht?«
»Ja. Aber vorher hat er gefragt, ob ich auch die Klappe halte. Wenn ich die Klappe halte, gibt er mir noch zwei Hunderter extra, hat er gesagt. Aber nur, wenn ich die Klappe halte. Ich soll sagen, ich bin hingefallen.«
Ich fragte sie, ob der Verband ihr lästig sei, sie bewegte die Finger und sagte, nein, alles okay. Ich fragte sie, ob er ihr das Geld gegeben habe. Sie sagte, ja, gestern abend nur hundertfünfzig, weil er nicht mehr bei sich hatte, aber die restlichen fünfzig habe er ihr heute morgen gebracht.
8
Ein paar Tage später erschien auch Günni in der Praxis. Ich war einigermaßen überrascht, als die Helferin mir die Karte, auf die sie seine Daten eingetragen hatte, hereinbrachte, aber er war mir sehr willkommen, ich ließ ihn zunächst einmal ausgiebig warten. Als er schließlich eintrat, hatte er erkennbar mit seinem Unmut zu tun; es war ihm offenbar nicht entgangen, und das sollte es ja auch nicht, daß die Helferin drei Patienten, die nach ihm gekommen waren, vor ihm ins Sprechzimmer geschickt hatte. Er nickte mir zu, grummelte: »’n Tag« und pflanzte sich, ohne eine Aufforderung abzuwarten, in den Sessel vor meinem Schreibtisch, rückte sich mit ein paar heftigen Bewegungen zurecht. Ich sagte: »Guten Tag«, aber ich sah ihn nicht an dabei; ich tat, als läse ich zum erstenmal die Eintragungen auf der Karte, dann blickte ich auf. »Ihre Mutter hatte mir schon gesagt, daß Sie Ihr Studium mit Erfolg abgeschlossen haben.«
Er räusperte sich, schwieg.
»Betriebswirtschaft, nicht wahr?«
Er nickte.
»Und wie ich sehe, haben Sie mittlerweile sogar schon promoviert?«
Er starrte mich schweigend an.
»Meinen Glückwunsch.« Ich legte die Karte ab. »Das haben Sie ja erstaunlich schnell geschafft.« Ich nahm die Karte wieder auf, warf einen Blick darauf. »Mit vierundzwanzig Jahren. Wirklich bemerkenswert.«
Ich legte die Karte wieder ab. Er schwieg noch immer. Er traute diesem Kompliment wohl nicht. Anscheinend überlegte er angestrengt, worauf ich hinauswollte.
Ich sagte: »Und jetzt wollten Sie sich erkundigen, wie es Frau Raschke geht?«
Er schluckte, dann sagte er: »Nein.« Als ich ihn, indem ich wie erstaunt die Augenbrauen hob, auf dieser Antwort sitzenließ, rückte er sich abermals zurecht. Dann sagte er: »Ich habe Beschwerden.«
»Aha. Was für Beschwerden?«
Nach einem Zögern sagte er: »Beim Urinieren.«
»Beim Urinieren?« Mir schwante, warum er zu mir und ausgerechnet wieder zu mir gekommen war, aber ich dachte nicht daran, ihm die Peinlichkeit der Offenbarung zu ersparen. Ich musterte ihn stumm, mit einem leichten Stirnrunzeln.
»Ja.« Er schluckte, dann sagte er: »Ich habe … das brennt. Jedesmal beim Urinieren spüre ich … ja, so ein Brennen.« Er zögerte, dann sagte er: »Im Glied.« Und dann mochte ich meinen Ohren nicht trauen, aber dieser Kerl besaß doch tatsächlich die Frechheit, vor mir auch noch den Ahnungslosen zu spielen. Er sagte: »Ich nehme an, ich hab mir da eine Erkältung geholt. Eine Blasenerkältung. Beim Tennis vielleicht. Nach dem Tennis, meine ich. Durch die Transpiration.«
Ich stand auf. »Ach ja. Dann lassen Sie mal die Hosen runter.« Er stand auf und lockerte den feinen Ledergurt.
Ein frischer, schleimiger Eitertropfen war aus der Urethra hervorgetreten und saß auf der Spitze der Eichel, die gelblichen Spuren der vorangegangenen hatten die Unterhose eingefärbt. Der Befund war ziemlich eindeutig. Ich sagte: »Sie haben eine Gonorrhöe, so wie’s aussieht.«
Er fragte, tatsächlich mit einem Unterton von Empörung: »Wie bitte?!«
»Eine Gonorrhöe. Noch nie gehört? Einen Tripper. Sie haben sich einen Tripper geholt. Oder falls Sie das besser verstehen: Sie haben sich die Pfeife verbrannt. Und zwar nicht beim Tennis.«
Ich hatte ihn gereizt, aber er versuchte noch immer, die Schau durchzuziehen. Er sagte: »Das kann doch nicht wahr sein!«
Ich konnte mir nicht verkneifen, diese Vorlage zu verwerten. Ich antwortete: »Doch, doch, das haben Sie sich bestimmt nicht beim Tennis geholt. Der Tennisarm ist zwar hinreichend bekannt, aber der Tennispimmel wäre etwas völlig Neues.«
Er starrte mich an, seine Kinnmuskeln arbeiteten. Offenbar geriet er, weil ich nicht mitspielte, immer mehr ins Kochen, und ich genoß es. Ich fragte ihn, wann er das letztemal Geschlechtsverkehr gehabt habe. Er zögerte, dann murmelte er: »Na, mit dieser … dieser Nutte.« Ich sagte, ich würde einen Abstrich nehmen, um bei der Diagnose sicherzugehen, und in zwei Tagen müsse er wiederkommen.
Er fragte: »In zwei Tagen? Kann man das denn nicht sofort behandeln?«
Ich sagte, doch, sicher, ich würde ihm jetzt schon mal eine Spritze setzen, aber er solle nicht glauben, daß der Fall damit ausgestanden sei. Außerdem könnten weitergehende Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.
Ich wählte das stärkste Kaliber von Nadel aus, das sich verantworten ließ, und zog das Penicillin auf. Er fragte: »Was für Komplikationen?« Ich sagte, zum Beispiel eine Epididymitis. Und was das sei? Ich sagte, eine Nebenhodenentzündung. Könne schmerzhaft werden. Er schwieg still. Ich ließ ihn die Spritze sehen, und während ich die Backe präparierte, fragte ich, ob er gegen Penicillin allergisch sei.
»Penicillin? Ich glaube nicht …« Er äugte über die Schulter, zog die Augenbrauen zusammen. »Was heißt das, allergisch? Ich meine, in diesem Fall? Kann das gefährlich werden?«
Ich sagte: »Das werden wir gleich sehen.« Dann trieb ich ihm die Nadel in die Backe. Zu dieser Zeit gab es die Umfragen noch nicht, dank deren wir mittlerweile wissen, was Frauen an Männern sexy finden, aber den knackigen Hintern, der diese Hitlisten meist anführt, hatte der junge Herr Nelles ganz unbestreitbar. Und da er den Muskel anspannte, als erwarte er das Fallbeil, müssen der Einstich und die Injektion ihm ziemlich weh getan haben, ich hörte das leise Zischen, mit dem er die Luft einzog, aber er sagte kein Wort.
Bevor er das Gefühl, nun sei er fürs erste aus dem Schneider, genießen konnte, sagte ich, diese Dosis müsse ich ihm, falls Komplikationen auftreten sollten, sechs bis acht Tage lang täglich verabreichen. Er wollte etwas erwidern, aber dann zog er es vor zu schweigen. Ich sagte, unabhängig davon müsse dieser Fall, wie er sicher wisse, gemeldet werden.
»Gemeldet?« Er starrte mich an. »Wieso denn? Wem denn gemeldet?«
Ich hob die Augenbrauen, schüttelte den Kopf ein wenig, als sei mir so viel Ignoranz noch nicht begegnet, und sagte, nach dem Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten unterläge der Tripper ebenso wie der weiche Schanker, die Syphilis und die venerische Lymphknotenentzündung der sogenannten Meldepflicht. Im Unterschied zu Leuten wie ihm hielten die Gesundheitsbehörden den Tripper nämlich nicht für eine Erkältung, sondern für eine Seuche, und das sei er auch.
Er murmelte: »Ja, ja, okay, aber …« Er brauchte eine Weile, bevor er es fertigbrachte, mir in die Augen zu sehen. »Muß das denn sein? Ich meine … daß Sie mich melden?«
Ich fragte ihn, ob er eine Verlobte oder eine feste Freundin habe. Er zögerte, aber schließlich nickte er. Ich sagte, wenn er mit dieser Frau oder irgendeiner anderen sexuell verkehre, bevor ich die Behandlung abgeschlossen und ihm den Verkehr ausdrücklich erlaubt hätte, dann könne er sich auf sehr unangenehme Konsequenzen gefaßt machen, dafür würde ich sorgen. Er streifte mich mit einem giftigen Blick, aber er nickte. Ich sagte, und wenn seine Freundin oder sonst jemand unbedingt mit ihm ins Bett wolle, was ja nicht völlig auszuschließen sei, Frauen kämen manchmal ja auf die verrücktesten Ideen, dann solle er ihr sagen, er habe keine Lust oder er könne nicht oder er leide an temporärer Impotenz oder wolle nicht oder was auch immer; beiwohnen dürfe er ihr jedenfalls nicht. Er ließ die Kinnmuskeln spielen, atmete schwer, aber er nickte abermals.
Damit schien er mir fürs erste ausreichend bedient, ich entließ ihn.