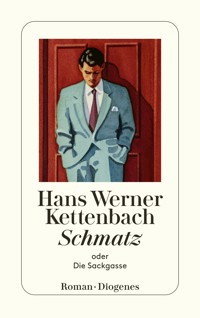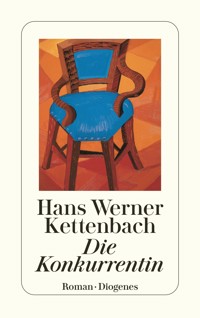7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
HWK nicht nur als Schriftsteller, sondern als kritischer Publizist, als Historiker und lebensfroher Rheinländer, der mit liebevollem Blick fürs Detail und die Anekdote Geschichte erlebbar macht. Und dabei ein überraschendes Spektrum verschiedenster literarischer Genres vorzuweisen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Tante Joice und die Lust am Leben
Geschichten und anderes
Diogenes
Vorwort
Es war schwierig, einen Titel für die vorliegende Sammlung auszuwählen; doch diese Bemühung hat mich auch auf eine wunderbare Entdeckungsreise geführt. Sie hat in mir die Erinnerung wachgerufen an die Zeiten, in denen ich zu schreiben anfing, und an das, was mich damals bewegte.
Zuerst wollte ich diese Sammlung mit nur einem Wort überschreiben, dem Wort Miszellen. Allerdings habe ich damit bei meiner Lektorin und bei einigen anderen Leuten, die etwas von Büchern verstehen und davon, wie man sie an den Leser bringt, keine Sympathien gefunden. Also habe ich mich von meiner Überschrift getrennt, schweren Herzens, wie man sogleich verstehen wird: Auf den sonderbaren Titel Miszellen bin ich nämlich schon vor gut sechzig Jahren gekommen.
Das passierte in einer Zeit, in der ich allenfalls ein Dutzend beschriebener Blätter hütete, die ich einer solchen Sammlung wie dieser hier hätte zuordnen können, nämlich im heißen Sommer 1947 in München. Dort bewarb ich mich um einen Studienplatz, und dazu gehörte es, dass ich im sogenannten Bautrupp der Universität 1000 Arbeitsstunden beim Wiederaufbau der zerbombten Universitätsgebäude abzuleisten hatte.
Einen passenden Arbeitsplatz hatte die Universität höchstselbst mir vermittelt: Ich war durch ihr Sekretariat als Bauhilfsarbeiter bei der Firma Julius Berger untergebracht worden und klopfte mit anderen Studienanwärtern Steine, an sechs Tagen in der Woche und auf einem Trümmerfeld an der Ludwigstraße, auf dem zuvor das »Haus des Rechts« gestanden hatte.
Um auch die erforderliche »Zuzugsgenehmigung« für München zu bekommen und zu behalten, jobbte ich außerdem in drei, auch schon mal vier Nächten in der Woche bei den Amerikanern. Mit einem weißen Papphelm ausgestattet und dergestalt autorisiert, diente ich der Besatzungsmacht als Nachtwächter in einem Kfz-Park der Militärregierung für Bayern.
Und ich schrieb. Nach dem Fragment eines empfindsamen Romans (»Sonate, Roman in drei Sätzen«), den ich noch in der Schulzeit angefangen hatte, schrieb ich kleinere Stücke, etwa Feuilletons (eines, an das ich mich noch vergangene Woche sehr deutlich zu erinnern glaubte, über den Vollmond, offenbar mit elegischer Grundstimmung, nämlich betitelt: »Und keiner denkt an den Mond«), auch Erzählungen (davon eine über einen Bauhilfsarbeiter, der eines Abends auf dem Kirmesplatz den Berufskämpfer einer Boxbude trotz dessen Spezialität, dem heimtückischen »Rundschlag«, durch K.o. besiegt, die Prämie von 20 Mark kassiert, hernach aber zum Kirmesplatz zurückkehrt und dem Berufskämpfer, der im Dunkel schwer geschlagen vor seinem Zirkuswagen hockt, zehn Mark von seinem Gewinn abgibt), schließlich auch philosophisch angehauchte Betrachtungen (so drei Seiten »Über das Reisen«).
Wann ich die Zeit fand, dergleichen zu schreiben, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich schrieb ich am freien Sonntag, wenn ich ein wenig von dem versäumten Schlaf nachgeholt und die Kirchenglocken von Pullach im Isartal, wo ich wohnte, mich geweckt hatten. Aber ich schrieb unermüdlich.
Und ich las. Mit dem Kriegsende war unser Verlangen nach allem, was bis dahin verboten oder uns versagt gewesen war, übermächtig ausgebrochen. Ich hatte noch während der Schulzeit die Buddenbrooks verschlungen, die in einem Winkel unseres Bücherschranks die Naziherrschaft überlebt hatten. Und auf der provisorischen Bühne der Stadt Köln lernte ich Paul Claudel und Jean Giraudoux und Thornton Wilder, auch Paul Hindemith kennen.
Noch dazu bekam ich einen unerwartet ergiebigen Tipp von einem meiner ortskundigen Kollegen auf dem Bauplatz, und so fuhr ich eines Nachmittags in meinem ersten, dem glutheißen Sommer 1947 in München, nach Feierabend nicht mit der Isartalbahn nach Hause, sondern ging in das nahegelegene Amerikahaus. Nach meiner Erinnerung lag es in einer Seitenstraße der Ludwigstraße, ein ehemals herrschaftliches Wohnhaus offenbar, gut erhalten, vielleicht auch schon so früh im Auftrag der Besatzungsmacht penibel wiederaufgebaut, das Treppenhaus mit Marmor ausgekleidet und angenehm kühl, der rote Kokosläufer auf den Stufen befestigt mit Stangen aus Messing, die golden schimmerten.
Ich fragte nach Ernest Hemingway, dessen Namen ich vermutlich im Feuilleton der Neuen Zeitung aufgelesen hatte, und war tief beeindruckt, als die Bibliothekarin mich zum Katalog des Hauses führte, die Karteikarten mit dem Namen Hemingways aufblätterte und mir sagte, das alles könne ich ausleihen. Ich ließ mir sofort einen Sammelband von Kurzgeschichten reservieren, mochte mich aber zunächst von dem Katalog und seinen tausendfachen Verheißungen nicht trennen.
Ich durchkämmte Karteikasten nach Karteikasten, machte irgendwann eine Pause, weil die Füße mir weh taten, und setzte mich auf die niedrige Fensterbank, rauchte eine selbstgedrehte Zigarette und sah durch das offene Fenster hinaus auf die enge Straße und die noch ramponierten Häuser gegenüber, hinter deren Dachfirsten die Sonne groß und rot verschwand. Dann zog ich den nächsten Kasten auf.
Ganz am Ende des Katalogs fand ich eine Rubrik, die einen merkwürdigen Titel trug: »Miscellaneous«. Ich kannte das Wort nicht, aber im Handwörterbuch, das aufgeschlagen vor den Regalen lag, fand ich seine Bedeutung: Vermischtes, Verschiedenartiges; und für das zugehörige Hauptwort »Miscellanea«: Miszellen, eine Sammlung unterschiedlicher, vermischter Texte.
Später, bei der Zeitung, hatten wir ein besonderes Ressort Vermischtes, das war die Sex-and-Crime-Seite, im Zeitungsjargon auch das Ressort Mord und Totschlag genannt. Damit hatte die Bibliothek des Amerikahauses freilich nichts im Sinn; sie hatte unter »Miscellaneous« vielmehr solche Bücher registriert, die sich nicht unter einem einfachen, klar unterscheidbaren Merkmal – wie zum Beispiel dem Namen des Autors – einordnen ließen. Was dabei herauskam, war ein ziemlicher Kuddelmuddel, Quer durch den Garten oder Von jedem etwas oder Dieses und jenes; aber auch mir, obwohl ich darüber nachdachte, wollte dafür kein besserer Begriff als dieses schillernde Wort »Miszellen« einfallen.
Das Problem ging mir jedenfalls nicht mehr aus dem Kopf. Ich leistete bis zum Herbst meine 1000 Stunden auf dem Bauplatz ab, wurde immatrikuliert und konnte studieren, musste allerdings in den Semesterferien regelmäßig jobben, um Geld verdienen und weiterstudieren zu können. Eine der edleren Tätigkeiten, die ich ausübte, war die eines Aktendieners in der Registratur eines Versicherungskonzerns. Jeden Morgen fand ich auf meinem Arbeitsplatz zwischen den Regalen die Zettel mit den Chiffren der Akten, die von den Sachbearbeitern angefordert wurden. Und jeden Abend musste ich die Aktenstapel wieder eingeordnet haben, die von den Sachbearbeitern zurückgekommen waren. Dafür zahlte mir der Konzern eine Deutsche Mark die Stunde – 1,00 DM.
Aber selbst hier, in der doch weitgehend von eindeutigen Zahlen beherrschten Welt der Assekuranz, erschienen Fälle, die sich der Einordnung in ein logisches System widersetzten. Unter welcher Chiffre zum Beispiel sollte man den Vorgang einer Versicherung ablegen, die von mehreren Kunden gemeinsam abgeschlossen und bezahlt worden war, bis diese Kunden sich entzweiten und jeder für sich den Konzern mit höchst unterschiedlichen Forderungen beanspruchte? Und wie sollte man in diesem System gar eine Akte wiederfinden, die einmal an einem falschen Platz eingeordnet worden war? So etwas passierte ja alle Tage, und natürlich entlud sich der Zorn der Führungskräfte dann über uns, die Domestiken des Geschäfts.
Ich will nicht behaupten, dass ich unter diesen und ähnlichen Fragen litt; aber die Problematik meines Jobs beschäftigte mich doch so sehr, dass ich mir eine Art Theorie der Miszellen zurechtlegte. Sie lautete etwa, dass jeder Versuch, die Vielgestaltigkeit des Lebens in ein dürres rationales System zu pressen, zum Scheitern verurteilt ist – am Ende hängt das System, sei es ein Katalog, sei es eine Registratur, sich notgedrungen ein verlegenes Schwänzchen an, die Rubrik Miszellen oder Allerlei oder Übriges, in das der undefinierbare Rest hineingestopft wird.
Die Theorie wiederum brachte mich auf den Plan eines großen literarischen Werks, eines Zyklus von Erzählungen, dem ich den Titel »Ozean – du Ungeheuer!« geben wollte. Die am weitesten ausgeführte, aber noch nicht vollendete dieser Geschichten handelte von einem schon älteren Versicherungsangestellten, Eduard Klöser, der in der Registratur eines mächtigen Unternehmens arbeitet, an dem System der Aktenablage einiges auszusetzen findet und insgeheim ein neues, revolutionäres System dieser Ablage ersinnt.
Meinem Helden ist freilich klar, dass er seine stockkonservativen, herb parfümierten Vorgesetzten mit den Seidenkrawatten und den schlohweißen Einstecktüchlein in der Brusttasche von seiner Erfindung nicht wird überzeugen können. Also lässt er sich eines Abends bei Dienstschluss unbemerkt in der Registratur einschließen und begibt sich ans Werk.
Den Ablauf der Nacht gedachte ich, neben der Hauptsache – Klösers Versuch einer Neuordnung der Akten –, mit der Darstellung seiner Hoffnungen auf Anerkennung, Beförderung und Belohnung sowie mit philosophischen Gedanken über das Problem des Ozeans auszugestalten. Die Pointe erschien mir jedenfalls zwingend: Am anderen Morgen findet man Klöser, tot auf dem mit Akten bedeckten Boden liegend, halb begraben unter einem Haufen anderer Akten, die er vermutlich im Sterben aus dem Regal gerissen hat. Der Ozean hat sich als unbezwingbar erwiesen.
Eine andere dieser Erzählungen schließlich sollte die Erfindung eines »Farbklaviers« durch einen erfolglosen Komponisten behandeln, einer Art Lichtorgel, mit der sich Farben und Formen in einer unendlichen Vielzahl mischen und auf eine Leinwand projizieren ließen. Heute schafft man so etwas mit einem simplen Computer und dem entsprechenden Programm. Aber damals, anno 1947 und danach, als ich davon hörte, dass Norbert Wiener die Kybernetik erfunden hatte und der erste, zimmergroße Computer gebaut worden war, schmeichelte ich mir eine Zeitlang (nun ja, ich war jung), ich sei zeitgleich mit dem Professor Wiener demselben Problem auf die Spur gekommen – der Organisierung des Unermesslichen.
Miszellen also. Es waren immerhin völlig unterschiedliche, vermischte Texte, deren Aufnahme in diesen Band ich in Erwägung gezogen habe. Das fing an mit Gedichten, die ich im Alter von acht für meine Mutter und mit zwanzig im Austausch mit meinem Münchner Studienkollegen Peter Hacks geschrieben habe, es ging dann weiter mit den schon erwähnten Feuilletons und dem Bruchstück des Romans »Sonate«, auch einem fragmentarischen Drama in nordischem Versmaß (ich war ja doch einige Jahre lang unter den Nazis zur Schule gegangen), und es setzte sich fort in Hunderten von Reportagen und Artikeln, die ich für die Zeitung geschrieben habe, sowie einigen autobiographischen Notizen.
Eine Reihe von Erzählungen kam hinzu, von Glossen, Wortbeiträgen fürs Radio, am Ende auch Hörspielen und Drehbüchern und nicht zuletzt eine Spezies, die ich bei den ersten Plänen für diese Sammlung hier »Essays« nennen wollte. Nachdem ich aber in einem Band geblättert hatte, in dem Essays von Schleiermacher (»Versuch über die Schaamhaftigkeit«), Kleist und Arthur Schopenhauer (»Über das Interessante und das Langweilige«) veröffentlicht worden sind, erinnerte ich mich zum Überfluss an noch mehr Beispiele solchen Kalibers und nahm Abstand von dieser Bezeichnung; sie schien mir nicht ganz angemessen.
Auch einige andere Gattungsbegriffe, die mir hernach im Zorn über mich selbst und meine Hervorbringungen einfielen, so Besinnungsaufsatz, auch Traktat oder Schnurrpfeiferei, waren zu offensichtlich nicht verwendbar, und so gab ich schließlich den ganzen Versuch auf, die Texte, die ich im Lauf von gut sechzig Jahren aus den verschiedensten Anlässen und oft auch ohne jeden benennbaren Anlass geschrieben habe, zu systematisieren und in strenger Marschordnung vorzuführen. Der Leser wird also gebeten, sich überraschen zu lassen, wenn schon einmal auf eine Geschichte etwas ganz anderes folgt – Geschichten und anderes eben.
Ich habe natürlich längst nicht alles, woran ich zu Beginn gedacht hatte, in diesen Band aufgenommen. Manches hielt einer kritischen Prüfung denn doch nicht stand (so das Drama im Stabreim); anderes kam nicht mehr in Frage, weil es mittlerweile unter den Trümmern des Historischen Archivs der Stadt Köln begraben lag. Dieser, ein ziemlich großer Teil meiner Texte, hatte nur auf Papier existiert, weil zu der Zeit, als sie entstanden, die elektronische Aufzeichnung noch nicht möglich, für mich jedenfalls nicht erschwinglich war.
Das Historische Archiv der Stadt Köln hatte aber, bevor es am 3. März 2009 dem U-Bahn-Bau zum Opfer fiel und in einem gewaltigen Kladderadatsch in die Baugrube abstürzte, meinen Nachlass – genauer: »Vorlass« – bereits übernommen und in einem schönen gedruckten Verzeichnis von 62 Seiten auch schon registriert. Was freilich von den säuberlichen Einträgen als Manuskript noch vorhanden ist, weiß ich bis zur Stunde nicht. Mag sein, dass das eine oder andere Stück noch aus dem Schutt und dem Grundwasser auftaucht und wider Erwarten sogar noch zu entziffern ist – in diese Sammlung hier kann ich es jedenfalls nicht mehr aufnehmen.
An einiges erinnere ich mich (es steht ja auch in dem Verzeichnis des Archivs), und es tut mir leid darum. Nicht so sehr um das einzige Theaterstück, das ich vollendet habe (»Das Recht der Enthüllung, Schauspiel in drei Akten«); es war wohl doch arg juvenil. Mehr bedauere ich den Verlust eines vielstimmigen Hörspiels mit dem Titel »Armee des Glücks«, das die Freuden und Leiden von Lottoschein-Auswertern behandelte. Ich selbst bin, um Geld zu verdienen, während des Studiums als solcher tätig gewesen, zusammen mit einer Reihe von Freunden.
Wir fuhren regelmäßig des Sonntagabends mit der Straßenbahn hinaus in einen Kölner Vorort, wanderten ein Stück durch den Wald und stellten uns mit hundert oder auch mehr anderen Auswertern, meist Studenten und Hausfrauen, in dem großen Saal einer hölzernen Baracke ein. An den langen Tischen fand jeder einen Platz und daran einen Apparat mit zwei großen Rollen. Die Lottoscheine, die hinter transparente Folie geklebt und in langen Bändern aufgerollt worden waren, wurden uns von speziellen Boten gebracht, und wir werteten sie aus, indem wir die Bänder auf unsere Apparate spannten, sie Stück um Stück an uns vorbeirollten und mit einer Schablone jeden Schein auf einen eventuellen Gewinn prüften.
Montagmorgens in der Frühe wanderten wir durch den Wald zurück, ein jeder um 13,50DM reicher – den Lohn, den die Lottogesellschaft uns für die Nacht zahlte. Eine Nacht voll von widersprüchlichen Empfindungen, Anfällen von Schlafsucht, amourösen Begierden, je nachdem, welche Frau einem gegenüber oder zur Seite saß, leichtem Bangen vor dem Rausschmiss, wenn man (das heißt, die Nummer, unter der das Lotto einen führte; Namen wurden nicht genannt) über den Lautsprecher als eines der schwarzen Schafe genannt wurde, die am vorangegangenen Sonntag die meisten Treffer übersehen hatten. Eine Nacht voll von Träumen, die umso hitziger wurden, je mehr man unter der stereotypen Arbeit litt.
Es hätte ein gutes Hörspiel werden können. Aber ich will meinen verschüttgegangenen Werken nicht allzu innig nachtrauern; der Kölner tröstet sich bei solchen Gelegenheiten ja auch mit dem Grundsatz: »Watt fott es, es fott!« Zudem scheint mir die Erinnerung an die Leistungen, die man früher einmal vollbracht hat, nicht unbedingt zuverlässig zu sein. Als Beispiel mag das Feuilleton »Über den Vollmond« dienen, das ich zu Beginn dieses Vorworts erwähnt habe und das, laut meinem Gedächtnis, die sentimentale Betrachtung eines jungen Mannes gewesen sein musste, der vermutlich verliebt und vom Weltschmerz ergriffen war.
Vor ein paar Tagen habe ich den Text, den ich im Dreck der Kölner U-Bahn-Grube untergegangen glaubte, wiedergefunden – in einer vergessenen Kopie, die ich aus einem Stapel alter Papiere herausfischte. Das gute Stück handelte, obwohl ich darauf geschworen hätte, mitnichten vom Vollmond, sondern von einer Mondfinsternis. Nicht einmal die Überschrift war elegisch gestimmt, sie lautete vielmehr staubtrocken »Im Kernschatten«; und im Übrigen war diese Glosse ziemlich aggressiv. Sogar datieren könnte ich sie noch, hätte ich nur besser aufgepasst, als unser Physiklehrer uns beibrachte, Mondfinsternisse zu berechnen (»damit ihr wisst, was da passiert, wenn ihr demnächst des Nachts in Russland auf Wache steht«). So kann ich nur vermuten, dass ich sie etwa 1947 schrieb, womit sie das älteste Stück der Sammlung wäre (in die ich sie natürlich aufgenommen habe).
Es freut mich sehr, dass dieser Band erscheinen konnte. Ich danke den vielen Helfern, die zu seinem Gelingen beigetragen haben, so den Kolleginnen und Kollegen vom Archiv des Kölner Stadt-Anzeigers. Und ich wünsche ihm viele Leser, denen es Freude macht, darin zu blättern.
HWK
Testamentsvollstreckung
Erzählung
Die Dritte Avenue hat sechs Fahrbahnen. Er hatte gerade erst die zweite Fahrbahn hinter sich gebracht, als die Ampel auf der anderen Seite zu blinken begann: DON’T WALK. Stehenbleiben. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er Angst, er werde es zu dem Gehsteig gegenüber nicht mehr schaffen, vorbei an den drohenden Stoßstangen, den Kühlerhauben, die bebend auf ihr grünes Licht warteten.
Als er die andere Seite erreicht hatte, als die Meute hinter ihm aufheulte und losbrach, begannen seine Beine zu zittern. Er stützte sich mit einer Hand am Mast der Ampel ab, wischte mit der anderen über die Stirn. Er betrachtete die Hand. Die knochigen Finger, die pergamentene fleckige Haut des Handtellers waren nass von Schweiß. Es wurde Zeit, dass er wieder nach Hause kam.
Er stieg vorsichtig die beiden Stufen zu Larrys Laden empor, ging steil aufgerichtet, ohne einen Blick zur Seite zu wenden, über den ächzenden Holzboden bis in den hinteren Winkel, schob die Tür des Kühlschranks auf, sie ließ sich so schwer bewegen, und nahm zwei Büchsen Bier heraus. Er zögerte, nahm dann auch noch eine Tüte Milch. Auf dem Rückweg durch die schmale Gasse zwischen den Regalen fürchtete er, er werde schwanken, anstoßen und etwas von den Brettern herunterreißen, Waschpulver, Spülmittel. Cornflakes, die Gläser mit dem gemahlenen Kaffee.
Larry, die weiße Schürze über der breiten Brust, Ärmel hochgerollt und haarige Unterarme, beide Fäuste auf den Ladentisch gestemmt, sah ihm entgegen. »Irgendwas nicht in Ordnung, Mister Mitchell?«
»Was soll nicht in Ordnung sein? Alles bestens.«
»Sie sehen ein bisschen blass aus.« Larry schlug eine von seinen braunen Tüten auf, packte das Bier und die Milch hinein. »Heute keine Tomaten?«
Er schüttelte den Kopf, hielt sich verstohlen mit Daumen und zwei knochigen Fingern am Rand des Ladentischs fest. »Pack mir noch ein paar Streichhölzer ein.« Larry griff nach den Streichhölzern, aber er sah auf die knochigen Finger.
Er schaffte den Rückweg über die sechs Fahrbahnen. Es trieb ihn nur einmal zur Seite, ziemlich weit, aber er fing sich sofort wieder, steuerte geradeaus. Er atmete flach, er hatte nicht den Mut, die kühle Oktoberluft in sich hineinzuziehen, obwohl es ihn danach verlangte. Er spürte, dass das Mädchen, das am Eingang von Stacy’s Bar lehnte, ihn anstarrte.
Als er die abgewetzte Haustür hinter sich ins Schloss drückte, erloschen die Autohupen, das Kreischen der anfahrenden und abbremsenden Reifen, es erlosch das funkelnde Licht des Vormittags. Er tastete sich im Halbdunkel zum Briefkasten. Hinter der Wohnungstür des Hausmeisters überschnitten sich zwei aufgebrachte Stimmen. Ronnie stritt mit seiner Frau.
Der Monatsscheck der Rentenversicherung war angekommen. Er hielt den Umschlag vor die Augen, um sich zu vergewissern, steckte ihn dann in die Innentasche seiner Jacke. »Lumpen. Betrüger.« Er begann, eine Hand auf dem Geländer, mit der anderen die Tüte an die Brust pressend, die fünf Treppen hochzusteigen. Ab und zu blieb er stehen, sah im Halbdunkel auf die Tüte hinab, sprach zu ihr: »Das sind doch die allergrößten Lumpen. Betrüger. Ausbeuter.« Er stieg weiter, blieb wieder stehen: »Jetzt können sie bald die paar Kröten auch noch sparen.«
Als er die Wohnungstür hinter sich schloss, fühlte er sich erleichtert. Auf dem Weg in die Küche wurde es für den Bruchteil einer Sekunde wieder leer und schwarz in seinem Schädel, er rannte heftig gegen den Türpfosten, aber er achtete nicht auf den grellen Schmerz, der seine Schulter durchfuhr. Er stellte die Milch und eine der Bierbüchsen in den Kühlschrank, die andere Büchse und die Streichhölzer nahm er mit ins Wohnzimmer.
Es störte ihn, dass die Laken und die Wolldecke noch immer zerwühlt auf der Schlafcouch lagen, aber er ließ sie liegen. Er öffnete die Büchse, füllte das Bier in den gläsernen Humpen und nahm einen langen Schluck. Dann kniete er, sich mit beiden Händen haltend, vor dem breitgeschwungenen, düsteren Aufsatzschrank nieder, der das Zimmer fast zu einem Viertel ausfüllte, schloss die Tür auf und zog die Schachtel mit den Papieren hervor. Er blieb ein paar Sekunden lang knien, starrte ins Leere, erhob sich unvermittelt mit einer jähen Kraftanstrengung, als hätte er sich selbst, diese alten, spröden Knochen überlisten müssen, und brachte die Papiere auf den Tisch.
Ein paar Briefe von Martha, an den Rändern schon vergilbt, er blätterte sie wieder durch, obwohl er sie schon tausendmal und mehr gelesen hatte. Das Hochzeitsfoto, zwischen den Topfpflanzen eines Fotografen in der 23. Straße aufgenommen, 1952, Martha trug damals die Haare noch hochgesteckt. Und Kate, im Kinderwagen sitzend, ein rundes Puppengesichtchen, runde Ärmchen und winzige Finger.
Er betrachtete eine Weile das Bild seiner Tochter, schob es dann mit einer heftigen Bewegung zur Seite. Er griff, als hätte er keine Sekunde mehr zu verlieren, mit fliegenden Fingern in die Papiere hinein, fand Pete Conways Brief, zog ihn heraus und hielt ihn vor sich, das Blatt zitterte ein wenig. Er las den Brief noch einmal, den er schon seit Jahren auswendig kannte.
Herrn Stanley Mitchell, darunter sein Geburtsdatum und die volle Adresse. Seine Lippen begannen, im Lesen sich zu bewegen.
Lieber Stan,
du wirst dich wundern, dass ich einen Brief an dich so förmlich beginne. Aber dies ist ein Testament. Ich fühle mich sehr schlecht, das Herz, und ich fürchte, dass es jeden Augenblick zu Ende gehen kann.
Du weißt, dass ich deine Tochter Kate immer sehr gerngehabt habe. Und dass ich es nie verstehen konnte, warum du dich mit ihr so zerstritten hast. Kate mag manches falsch gemacht haben, aber sie ist ein gutes Kind. Der größte Teil der Schuld trifft dich, mit deiner Rechthaberei und deinem Starrsinn, ich sage dir damit nichts Neues.
Ich vermache hiermit deiner Tochter Kate Mitchell alles, was ich besitze. Mit der Einrichtung des Ladens werden es um die 120.000 Dollar sein. Den Laden kann sie vielleicht übernehmen. Das wäre in meinem Sinne. Ich lasse morgen früh den Anwalt zu mir kommen, damit alles seine Richtigkeit hat.
Ich überlasse Kate alles, weil ich weiß, dass sie gut für dich sorgen wird. Und ich schicke dir dieses Testament, damit du ihr die Nachricht überbringen musst und damit du – wie ich zuversichtlich hoffe – bei dieser Gelegenheit endlich das Wort der Versöhnung findest, das du ihr schon so lange schuldest.
Aufrichtig, dein Peter Conway.
Folgten Petes Geburtsdatum und seine volle Adresse und das Datum des Briefs.
In der Nacht darauf war Pete gestorben Mit dem Anwalt hatte er nicht mehr sprechen können.
Er stand auf und ging ans Fenster. Er hob die morsche Gardine hoch und sah hinunter in den Hof. Nichts hatte sich verändert. Das geteerte Flachdach, unter dem die Küche des chinesischen Restaurants lag. Einer dieser gelben Kerle stapelte an der Mauer die schwarzen glänzenden Kunststoffsäcke mit den Abfällen. Überreste von Hunden und Katzen wahrscheinlich. Der zum Sterben einsame Baum im Hof nebenan trug noch immer die verschossenen Blätter. Auf einigen Etagen des steilen Bürohauses gegenüber, mit dem sie ihn vor sieben Jahren eingemauert hatten, brannten die Leuchtröhren.
Er drückte das Kinn gegen die Fensterscheibe und sah nach oben. Der Fleck blauen Himmels, der vorhin noch über der Öffnung des steinernen Schachts geleuchtet hatte, war verschwunden. Trübe Wolken, es sah nach Regen aus.
Er ließ die Gardine sinken, blieb aber am Fenster stehen. Er starrte auf den Rahmen, von dem die Farbe abblätterte. Dieser Pete war zeit seines Lebens ein Narr gewesen. Es hatte nicht in seinen Kopf hineingepasst, dass die Menschen schlecht sind, schlecht, kaltherzig und selbstsüchtig. Kate ein gutes Kind! Du meine Güte!
Ja, natürlich, dem Onkel Pete war sie um den Bart gestrichen, seit sie sich bewegen konnte, und das hatte ihm gutgetan, diesem alten Hagestolz, der sich nie in seinem Leben getraut hatte, eine Frau anzufassen. Der alte Narr hatte sie auch dann noch in Schutz genommen, als sie durchgebrannt war, mit neunzehn und zwei Monate nach Marthas Tod.
So naiv wie Pete war er nie gewesen. Er hatte das alles kommen sehen. Schon mit vierzehn hatte sie angefangen, ihren Hintern zu schwenken. Er hatte alles versucht. Er hatte im Guten mit ihr geredet. Er hatte sie durchgewalkt. Er hatte ihr, als sie mit achtzehn diesen Kerl anschleppte, sie wagte es tatsächlich auch noch, einen solchen Kerl nach Hause mitzubringen, er hatte ihr prophezeit, dass das ein schlimmes Ende nehmen werde. Ein Jazzmusiker. Nicht einmal ein richtiger Musiker, Schlagzeuger bloß, zwei Stöcke und eine Trommel, das war alles.
Und mit so einem Kerl war seine Tochter durchgebrannt, zwei Monate nach dem Tod ihrer armen Mutter. Es kam dann genau so, wie er es ihr prophezeit hatte. Drei Jahre später ließ der Stinker sie sitzen. Das Kind war bei der Geburt gestorben, zum Glück, konnte man nur sagen. Sie trieb sich ein paar Jahre lang an der Westküste herum, kellnerte, brachte es sogar zur Kassiererin in einem Fischrestaurant.
Er kniff die Augen zusammen. Ein feines Restaurant musste das gewesen sein! Eine Bruchbude wahrscheinlich.
Damals nahm er ihre Post noch an. Aber er schrieb ihr nicht zurück, auch dann nicht, wenn sie eine Adresse angab. War es nicht das mindeste, das er verlangen konnte, dass sie heimkehrte und Auge in Auge um Verzeihung bat und ihre Schuld einsah und bekannte und ein neues Leben begann?
Sie dachte gar nicht daran. Ein paar Jahre später, sie war in New Orleans gelandet, sie hatte einen anderen Kerl gefunden und lebte mit dem zusammen, unverheiratet natürlich, aber sie schien sich zu dieser Zeit obenauf zu fühlen, sie hatte ihm aus New Orleans doch tatsächlich einen frechen Brief geschickt, sie hatte geschrieben, er müsse nun endlich einsehen, dass sie nur ihr eigenes Leben habe leben wollen und dass sie es ja auch lebe, verdammt noch mal. Und nun solle er doch endlich ein Einsehen haben und ihr wenigstens einmal schreiben, wie es ihm gehe, sie mache sich solche Sorgen.
Er stieß die Luft durch die Nase. Die Art von Sorgen kannte er. Verlogenes, leeres Gewäsch.
Auf diesen Brief hatte er ihr geantwortet, zum ersten und zum letzten Mal. Er schrieb, er wolle nichts mehr von ihr hören und er wolle sie nie mehr sehen, sie brauche es gar nicht erst zu versuchen, es sei denn, sie sei bereit, das einzusehen, was sie ihm angetan habe und ihrer toten Mutter, und sich selbst ja übrigens auch, und dafür um Verzeihung zu bitten. Und zum Schluss wolle er ihr nur noch prophezeien, dass sie in der Gosse enden werde, und das sehr bald, denn die Jüngste sei sie ja nun auch nicht mehr.
Seither hatte er die Annahme ihrer Post verweigert. Er hatte gehofft, dass dieses letzte Mittel sie zur Vernunft bringen und dass sie eines Tages vor der Tür stehen und eingestehen würde, was alles sie falsch gemacht hatte, und dass sie ihn fragen würde, wie es denn nun weitergehen solle, verzeih mir, Dad, und kannst du mir nicht helfen?
Aber sie kam nicht. Sie schrieb nur immer wieder, obwohl er alle ihre Post zurückgehen ließ. Er öffnete keinen der Briefe, aber er las alle ihre Karten, bevor er sie dem Postboten zurückgab. Er wusste, dass sie vor zwei Jahren nach New York zurückgekommen war, sie wohnte auf der West Side, die Gegend war nicht gut, wie hätte sie es auch sein können. Von einem Kerl fand er nichts mehr auf den Karten. Der aus New Orleans schien sich auch auf Französisch verabschiedet zu haben. Genau so, wie er es vorhergesehen hatte.
Er wandte den Kopf und sah zum Tisch, auf dem Petes Brief lag. Jahr um Jahr war verstrichen, aber nichts war geschehen. Als Pete ihm diesen Brief schickte und starb, hatte sie sich noch in New Orleans herumgetrieben. Er hatte keinen Augenblick geschwankt. Ja, natürlich hatte er ihr den Brief übergeben wollen. Aber er hätte es nur dann getan, wenn sie aus eigenem Antrieb gekommen wäre und ihm versprochen hätte, ein neues Leben anzufangen.
Sollte er etwa zusehen, wie sie das Vermögen, das ein Mann wie Pete durch harte Arbeit zusammengebracht hatte, mit irgendeinem Kerl, irgendeinem verkrachten Trommler durchbrachte? Sie hätte doch, mit so viel Geld in den Fingern, nur den letzten Rest an Besinnung verloren.
Er hatte geradezu gefürchtet, dass Pete seinen letzten Willen auch noch auf einem anderen Stück Papier hinterlassen oder irgendjemandem etwas davon gesagt haben könnte. Zum Glück war es nicht so. Der Nachlassverwalter hatte ihn aufgesucht und um Auskünfte gebeten. Petes Vermögen fiel, da weit und breit kein Verwandter aufzutreiben war, dem Staat anheim.
Er hatte sich das wohl überlegt, o ja. Wenn sie doch noch gekommen wäre, hätte er diesen Brief herausgeholt und wäre mit ihr zum Gericht gegangen, und der Staat hätte Petes Geld wieder herausrücken müssen. Er hätte einfach gesagt, der Brief habe zwischen anderen alten, sorgfältig versiegelten Papieren gelegen, die Pete ihm hinterlassen hatte, Gedichten, tatsächlich, und ein paar Kurzgeschichten, die Pete geschrieben hatte, der alte Heimlichtuer hatte zu seinen Lebzeiten kein Wort davon gesagt, dass er abends in seinem Zimmer hinter dem Laden saß und Gedichte schrieb und Kurzgeschichten.
Er hätte ganz einfach gesagt, er habe gezögert, die Siegel aufzubrechen, und jetzt erst habe er das Paket geöffnet und zu blättern angefangen und dabei den Brief gefunden. Der Staat hätte Petes Geld herausrücken und es Kate, der rechtmäßigen Erbin, geben müssen.
Er hatte Jahr um Jahr gewartet. Aber sie war nicht gekommen. Sie schrieb alle diese Briefe und Karten, die er alle zurückgehen ließ, aber sie kam nicht. Manchmal war er zur Tür gegangen und hatte gelauscht und plötzlich die Tür geöffnet, weil er glaubte, einen zögernden Schritt auf den Flurdielen gehört zu haben. Er hatte sich vorgemacht, dass sie eines Tages doch noch kommen würde, aber er hatte in Wahrheit gewusst, dass sie niemals kommen würde. Er hatte es doch gewusst, dass sie schlecht war, leichtsinnig und unbelehrbar. Und kaltherzig. Selbstsüchtig.
Wieder schien eine mächtige Pumpe sein Gehirn aus dem knochigen Schädel herauszusaugen, es war, als ob die Nacht schlagartig einbräche. Er krallte, nach einem Halt suchend, beide Hände in die Gardine. Als er wieder zu sich kam, sah er, dass er das morsche Gewebe halb aus der Schiene gerissen hatte. Er spürte, dass es höchste Zeit wurde.
Er wandte sich um und ging steifbeinig, er kam sich selbst wie eine Marionette vor, an den Tisch zurück. Er zog den Aschbecher heran, die große, eiserne Schale, in die er früher, als er hin und wieder noch rauchte, seine Pfeife ausgeklopft hatte. Seine Finger zitterten, als er nach den Streichhölzern griff.
Er würde den Schandmäulern diesen Triumph nicht gönnen. Zeit seines Lebens war er ein anständiger Mensch gewesen. Nun gut, er hatte Martha ein paarmal betrogen, aber es war immer nur dann geschehen, wenn er zu viel getrunken hatte. Und war er Kate nicht immer ein guter Vater gewesen? Hatte er sie nicht geliebt, wie man einen Menschen nur lieben kann? Hatte er nicht zumindest alles für sie getan, was in seinen Kräften stand, und hätte sie bei ihm nicht den Himmel auf Erden haben können, wenn sie nicht so schlecht, so leichtsinnig, so unbelehrbar gewesen wäre, so kaltherzig und selbstsüchtig?
Er war weiß Gott immer ein anständiger Mensch gewesen, und deshalb würde er keinem dieser Schandmäuler einen bequemen Vorwand liefern, ihm Böses nachzusagen. O ja, er wusste, was passieren würde, wenn ihnen Petes Brief in die Finger fiele. Sie würden herumerzählen, er habe seine Tochter um ein Vermögen gebracht, aus Rachsucht, aus Rechthaberei, aus bloßer Selbstgerechtigkeit. Einen Rabenvater würden sie ihn nennen, und einen Betrüger. Und Kate hätte nichts Eiligeres zu tun, als mit diesem Brief zum Gericht zu gehen und der öffentlichen Wohlfahrt Petes Geld abzuknöpfen und es mit irgendeinem miesen Stinker durchzubringen.
Er rieb ein Streichholz an und hielt die Flamme an Petes Testament. Das mürbe Papier brannte wie Zunder. Er versengte sich die pergamentenen Fingerspitzen, als er den letzten Rest in die Schale schob.
Wieder schien die Nacht hereinzubrechen.
Es dauerte eine Weile, bis sie von ihm wich. Er nahm wahr, dass es klingelte. Er stierte in die Schale, in der das Papier sich aufwölbte, rotglühende Ränder an kohlschwarzen Fetzen, bevor es zusammensank und zerfiel.
Es klingelte noch einmal. Er rief: »Wer ist da?«
»Ronnie, Mister Mitchell. Machen Sie auf, bitte!«
Er ging, sich rechts und links an den Wänden des schmalen Flurs abstützend, zur Tür und öffnete. Der Hausmeister stand auf dem Treppenabsatz, er blickte ein bisschen verlegen. »Entschuldigen Sie, Mister Mitchell … Besuch für Sie.«
Dann sah er Kate. Sie trat einen zögernden Schritt näher, Ronnie machte ihr Platz. Sie war alt geworden. Mein Gott, sie sah ja fast aus wie Martha in ihren letzten Jahren. Sie war rundlich. Ihr Haar war schütter geworden und grau. Er starrte ihr ins Gesicht, er suchte nach den Beweisen all dessen, was er ihr vorausgesagt hatte, und er fand sie, die scharfen Falten. Er entdeckte sie, die Spuren eines liederlichen, eines vergeudeten Lebens.
Sie machte einen entschlossenen Schritt nach vorn, an Ronnie vorbei, trat ein und schloss die Tür. Sie nahm ihn unter den Arm und führte ihn, er empfand Müdigkeit und Erleichterung zugleich, sie führte ihn zu der Schlafcouch und setzte ihn behutsam nieder, auf die zerwühlten Laken, die Wolldecke, und setzte sich neben ihn und schlang einen Arm um seine Schulter.
»Sei mir nicht böse, Dad.« Er spürte ihre Lippen, sie waren warm, auf der kalten, spröden Haut seiner Wange. »Sei mir nicht böse. Ich hab mit Ronnie telefoniert. Jede Woche. Seit ich wieder in New York wohne. Gestern hat er mir gesagt, er glaubt, dass es dir nicht gutgeht. Ich konnte doch nicht so tun, als ob ich es nicht wüsste.«
Er saß da, starr aufgerichtet. Er roch den beizenden Hauch, den das verkohlte Papier ausströmte.
»Und, Dad, bevor du etwas sagst … Ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut.« Sie zog ihn an sich, er spürte ihre warmen Lippen an seinem Ohr. »Ich bitte dich um Verzeihung, Dad. Ich hab alles ganz falsch gemacht. Du hast recht gehabt. Ich bereue es so sehr, was ich dir angetan habe, und Mum. Und mir selbst. Du wirst mir jetzt sagen, wie es weitergehen soll, nicht wahr, Dad? Du wirst mir helfen. Ich bitte dich um Verzeihung, hörst du?«
Geschrieben 1977 in New York
Veröffentlicht 1987 in Klugmann/Mathews (Hrsg.),
Schwarze Beute 2, Rowohlt Verlag, Reinbek 1987
Fassung vom Mai 2006
Tante Joice und die Lust am Leben
Vom Alter, vom Älterwerden und vom Altsein
Alt zu werden ist nur beschissen. Der Satz stammt nicht von mir (ich würde dergleichen auch lieber für mich behalten, als es herumzuerzählen; wer weiß, ob nicht das Schicksal zuhörte und in Zorn geriete und mich wegen Unbotmäßigkeit auf der Stelle bestrafte, mit dem Tode oder gar mit einem weiteren Altersdefekt). Das herbe Diktum, dass es beschissen sei, in die Jahre zu kommen, beschissen und nichts, aber auch gar nichts anderes, habe ich vielmehr bei Henning Mankell aufgelesen.
Allerdings möchte auch der die Urheberschaft nicht beanspruchen; stattdessen schreibt er sie einem alten Fischer zu, den er in seiner Kindheit gekannt und zur Sommerzeit oft besucht habe. Jeder mag für sich entscheiden, was davon zu halten ist, dass nach Mankells Bericht dieser Fischer zwar nicht in ebender Minute, in der er sich so lästerlich äußerte, wie vom Blitz getroffen zu Boden sank und ablebte, immerhin aber nur zwei Jahre später tot war, von jetzt auf gleich (»er hatte in seinem Boot einen Herzanfall erlitten«).
Nun ist der Satz so, wie Mankells Fischer ihn gesagt haben soll, ja auch zweifelhaft. Was heißt denn »alt werden«? Das Älterwerden beginnt doch unleugbar schon mit dem Tag der Geburt, nicht wahr, und mich zumindest hat es jahrzehntelang mit einem nicht abreißenden Segen höchst erwünschter und auch durchweg angenehmer Erfahrungen beglückt – dem ersten Spinat nach der ewigen Muttermilch, der ersten Nacht ohne Windel, dem ersten Schultag, der ersten Liebe (diese bereits im Kindergarten, und auch noch zu Zwillingen), dem ersten Bier und so weiter und so fort, von einigen noch anregenderen Offenbarungen und Errungenschaften des Älterwerdens ganz zu schweigen. Die Frage ist nur, wann das Älterwerden ins Altsein umschlägt. Aber darüber kann man ziemlich lange streiten.
Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern hierzulande liegt gegenwärtig [2001] bei 74, die von Frauen bei 80 Jahren. Frauen von Ende und Männer von Anfang siebzig sind demnach eindeutig alt, nämlich ziemlich moribund. Doch die Messdaten der Lebenserwartung nehmen beständig zu, und wer weiß, vielleicht bringen wir es ja irgendwann wieder so weit wie der Urvater Methusalem, der dem ersten Buch Mose zufolge 969 Jahre alt geworden ist, oder wenigstens wie sein Sohn Lamech, der es zwar nur auf 777 Jahre brachte, aber noch im Alter von 182 Jahren imstande war, seinen Sohn Noah zu zeugen, so ein Kerl, so ein begnadeter!
Wer das für bloße Aufschneidereien der Bibel hält, der sei auf ein Beispiel aus jüngerer Zeit hingewiesen, Joice Heth mit Namen, eine schwarze Sklavin in Amerika. Sie diente am Ende eines langen Lebens dem Erfinder des Showbusiness, Phineas T. Barnum aus Bethel, Connecticut, und verhalf ihm zu einem kleinen Vermögen. Barnum, der nach mehreren anderen Broterwerben einen Lebensmittelladen in New York betrieb, hatte an einem Julitag des Jahres 1835 einen interessanten Tipp bekommen: Ein Geschäftsfreund erzählte ihm, dass es in Philadelphia gegen Eintrittsgeld eine Negerfrau zu sehen gebe, die mehr als 160 Jahre alt sei.
Der an jeder Art von Geldverdienen stark interessierte Barnum reiste nach Philadelphia und vergewisserte sich, dass dieses Phänomen, besagte Joice Heth, tatsächlich existierte. Sie gehörte der Familie Bowling aus Paris, Kentucky, und war laut vorhandener und vorgewiesener Kaufurkunde 1727 im Alter von 54 Jahren von einem Augustin Washington für 33 Pfund an seine Nachbarin abgetreten worden. Augustin war kein Geringerer als der Vater von George Washington, dem nachmaligen Freiheitshelden und ersten Präsidenten der USA. Auf Befragen erklärte Joice Heth denn auch, sie sei bei der Geburt von »dear little George« dabei gewesen, habe ihn gewindelt und großgezogen.
Barnum erkannte auf der Stelle die Goldmine, die in der alten Frau, einem eingeschrumpften Lebewesen aus Haut und Knochen, verborgen lag. Er kratzte 1.000 Dollar zusammen, erwarb die Nutzungsrechte an »Tante Joice«, unter welchem Namen er sie fortan annoncierte, schaffte sie zur Schaustellung nach New York und hernach von einer Stadt in die andere, von einem Wirtshaussaal in den nächsten. Tante Joice brachte ihrem neuen Herrn, der durch sie seine Profession als Entertainer entdeckte und später mit Liliputanern, Elefanten und einer Meerjungfrau das Publikum faszinierte, pro Woche mehr als 1.500 Dollar ein.
Freilich: Wie erging es ihr selbst dabei, in dem Alter von 162 Jahren, das sie bis zu ihrem Tod in Barnums Diensten erreichte?
Fabelhaft, befanden die Zuschauer der Vorführungen. Tante Joice rauchte, mit angezogenen Knien auf einem Sofa liegend, ihre Maiskolbenpfeife, blieb auf keine Frage, die man ihr stellte, die Antwort schuldig, erzählte auch ungefragt Dutzende von Geschichten aus den vergangenen Zeiten und sang auf Verlangen alte Kirchenlieder, von denen sie mehr Strophen vorzutragen wusste, als irgendwer im Publikum kannte.
Fast möchte man wünschen, 162 Jahre alt zu werden und noch immer so lebendig zu sein wie Tante Joice. Allerdings könnte der Wunsch einem vergehen, wenn man die Details hinzunimmt, die sich bei näherer Betrachtung der Tante herausstellten und die gleichfalls aktenkundig sind: Joice Heth war fast völlig gelähmt, sie konnte ihre Beine nicht mehr strecken und außer ihrer Zunge nur noch ihre rechte Hand bewegen, sie hatte nicht einen Zahn mehr im Mund, ihre Augen waren erblindet und lagen so tief in den Höhlen, als wollten sie für immer darin verschwinden. Das ganze Menschlein wog gerade noch 46 Pfund.
Als sie im Februar 1836 starb, ließ Barnum sie von einem Arzt, der bei einer früheren Untersuchung das hohe Alter der Probandin für durchaus plausibel erklärt hatte, obduzieren. Diesmal halbierte der Doktor seine Schätzung, er befand aufgrund des Zustands von Tante Joice’ Koronargefäßen, sie sei nicht älter als 80 Jahre. Barnum bedauerte, dass er und sein Publikum wohl doch einer Täuschung zum Opfer gefallen seien, ließ den Leichnam gleichwohl in einem Mahagonisarg beerdigen und investierte den erheblichen Gewinn, der unter dem Strich übrigblieb, zwei Monate später in einen Wanderzirkus, mit dem er abermals reüssierte.
Vielleicht taugt die Geschichte von Tante Joice ja nicht unbedingt dazu, Mankells Fischer zu widerlegen oder die eine oder andere Hoffnung auf ein biblisches Alter zu stärken; aber zumindest kann man daraus lernen, dass der Mensch imstande ist, sowohl mit dem Alter als auch mit dem Tod gelassen und unerschrocken fertigzuwerden – das bewies nicht nur Tante Joice, die bis zuletzt mit Genuss ihre Pfeife rauchte und ihre Kirchenlieder sang, sondern auch Barnum, der angesichts des Verlustes seiner Einkommensquelle keineswegs den Mut verlor, sondern umgehend sich eine neue, eben den Zirkus, erschloss. Solche Nervenstärke ließ er dann abermals erkennen, als seine eigenen Tage gezählt waren: Der Mann, der sich selbst den Titel »Prinz von Humbug« verliehen hatte, stimmte zu, als die New York Sun ihn fragte, ob er schon einmal seinen Nachruf gedruckt lesen möchte, und die Zeitung veröffentlichte den Nachruf, zwei Wochen vor Barnums Tod und zu seinem großen Vergnügen. Und am Todestag selbst, noch einmal aus dem Koma erwachend, wollte er nichts anderes wissen als die Summe der Einnahmen, die sein Zirkus an diesem Tag kassiert hatte.
Mag sein, dass sensible Naturen über diesen Gemütsathleten die Nase rümpfen und glauben, dass ein Mensch, der höheren Ansprüchen genügen will, auf andere Art mit dem Tod umzugehen hat. Schon richtig, nur lassen das Alter und der Tod auch die erhabensten Charaktere hin und wieder ziemlich unvorteilhaft aussehen.
Zum Beispiel den Geheimen Rat Johann Wolfgang von Goethe. Vor dem Tod seiner Frau Christiane, die im Alter von 51 Jahren unter grausamen Schmerzen an einer Urämie zugrunde ging, ergriff er die Flucht, er wurde unpässlich, zog sich in sein abseits gelegenes Schlafzimmer zurück, verkroch sich in den Kissen, bis das Drama vorüber war, und vermerkte hernach in seinem Tagebuch: »Gut geschlafen und viel besser. Nahes Ende meiner Frau. Letzter fürchterlicher Kampf ihrer Natur. Sie verschied gegen Mittag.« Und dann, nach der Schilderung eines festlichen Ereignisses, das an demselben Tag in Weimar stattfand: »Meine Frau um 12 Nachts ins Leichenhaus. Ich den ganzen Tag im Bett.«
Weniger gleichmütig begegnete er seinem eigenen Tod. Zwar war es dem 83-Jährigen vergönnt, in seinem Lehnstuhl sitzend einzudämmern, und auch seine letzten Äußerungen scheinen Ruhe und Frieden zu atmen: Er soll bekanntlich nur noch »Mehr Licht!« verlangt haben, was als Ausdruck seines unablässigen Strebens nach Erkenntnis interpretiert wurde (allerdings auch als ein Hörfehler, weil er in Wahrheit »Millich!« gemurmelt und dergestalt um einen Schluck Milch gebeten habe); und seine Schwiegertochter Ottilie, die an seiner Seite saß, will gehört haben, dass er zu ihr sagte: »Gib mir dein Pfötchen!«
Aber nach dem Bericht des Arztes, der ihn kurze Zeit vorher besucht hatte, konnte von Ruhe und Frieden nicht die Rede sein: »Ein jammervoller Anblick erwartete mich. Fürchterliche Angst und Unruhe trieben den seit langem nur in gemessener Haltung sich zu bewegen gewohnten hochbejahrten Greis mit jagender Hast bald ins Bett, wo er durch eine jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich versuchte, bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl. Der Schmerz, welcher sich mehr und mehr auf der Brust festsetzte, presste dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geschrei aus. Die Gesichtszüge waren verzerrt, das Antlitz aschgrau, die Augen tief in ihre lividen Höhlen gesunken, matt, trübe; der Blick drückte die grässlichste Todesangst aus.«
Nun sollte auch über den Dichterfürsten, dem am Ende die Contenance abhandenkam, niemand die Nase rümpfen. Denn niemand weiß, wie er selbst sich hält, wenn er spürt oder erkennt oder auch nur ahnt, dass es ans Sterben geht. Vielleicht werde ich nicht anders als Goethe meine Umgebung mal durch Stöhnen, mal durch lautes Geschrei belästigen, vielleicht werde ich wie er aus dem Bett zu fliehen versuchen und verzweifelt ausprobieren, ob die Lebenskräfte, wenn ich mich nur auf einen Lehnstuhl setze, womöglich wiederkehren.
Aber was soll das auch? Muss man sich denn so etwas ausmalen, muss man überhaupt sich im Voraus über sein Ende den Kopf zerbrechen?
Ja. Doch. Wahrscheinlich muss man es, und je eher, desto besser. Denn der bewusste Ernstfall kann, wie man weiß, jeden Tag eintreten, jede Minute (und das ja nicht nur im Alter, sondern in jeder Lebensphase). Natürlich lässt sich streiten und vielleicht sogar witzeln über den Unterschied zwischen Altwerden und Älterwerden und Altsein; oder über die zunehmende Lebenserwartung und darüber, ob es denn erstrebenswert ist, so steinalt zu werden wie Methusalem oder auch nur Tante Joice. Aber jede solche Diskussion, jede solche Witzelei, jede Auseinandersetzung mit dem Alter landet unausweichlich beim Tod. So wie das Leben, ja.
Am Ende seiner »Rede über das Alter« hat Jacob Grimm gesagt: »Wir sind da angelangt, wo eingeräumt werden soll, was niemand leugnen mag: Das Alter liegt hart an des Lebens Grenze, und wenn der Tod in allen Altern eintreten oder ausbleiben darf – im Greisenalter muss er eintreten und kann nicht länger ausbleiben.« Ähnlich fast anderthalb Jahrhunderte später Hans Wollschläger: In einem tiefschürfenden Essay über das Altern, der im Jahr 2000 erschienen ist, hat er gerade erst angehoben, er hat seinen Gegenstand noch gar nicht beim Namen genannt, da spricht er schon von dem, was darauf – und daraus – folgt, eben dem Tod: »Sein Dasein allein lässt einem derartig die Luft wegbleiben, dass die Wörter nicht mehr von der Zunge kommen: Eine Lebe-Welt, in der alles, aber auch Alles von ihm abgeschlossen wird, und zumeist auch noch auf die haarsträubendste Weise, ist das unglaubliche Absurdum selber.«
Allerdings ist wohl auch in diesem Punkt ein wenig Vorsicht geboten, der Verzicht auf allzu schnelle und griffige Urteile empfehlenswert. Denn nicht wenige der Sterblichen scheinen sich für ihr Ende, obwohl es doch nach aller Erfahrung unausweichlich ist, gar nicht zu interessieren. Und das gilt nicht nur für junge Leute, die ganz andere Sorgen, Flausen im Kopf und vor allem Hoffnungen haben, es gilt auch nicht nur für die schon Angegrauten, die nicht altern wollen und auf das sogenannte Anti-Aging setzen und mit Pillen und Packungen und Kuren und Fitness-Gestrampel krampfhaft versuchen, schon auf Erden einen Zipfel vom ewigen Leben zu erhaschen – es gilt merkwürdigerweise und nicht zuletzt auch für die ganz und eindeutig Alten.
Der Fotograf Harald Wenzel-Orf hat unter dem Titel »Mit hundert war ich noch jung« einen Band über »Die ältesten Deutschen« vorgelegt, 50 Frauen und Männer, die die Hundert erreicht und zum Teil schon weit überschritten hatten. Nur ein halbes Dutzend von ihnen erwähnte in den Interviews den Tod, aber das nicht zuletzt, weil sie sich offensichtlich miserabel fühlten. So Dr. Arthur T. (105): »… die Lebensumstände sind jetzt so, dass ich so schnell wie möglich auf den Friedhof kommen will.« Deutlicher Anna R. (108): »Wie lange muss ich mich noch quälen, ich hab ja nichts mehr vom Leben. Es ist jetzt genug.« Und am härtesten Rosalia H. (III), eine Russlanddeutsche: »Ich bin für mein Leben müd. Schlag mich tot! Bring mich hin, wo dass mich die Vögel fressen!«
Doch das sind Ausnahmen. Die wenigen anderen, die laut dieser Sammlung von unretuschierten Porträts ebenfalls auf den Tod zu sprechen kommen, schieben ihn beiseite, so wie Gertrud H. (109): »Sterben müssen wir ja alle, da denke ich nicht dran.« Oder die gleichaltrige Edith P.: »Angst vor dem Sterben habe ich nicht, denn das ist ein natürlicher Vorgang.« Oder Elsa Th. (104): »Ans Sterben denke ich gar nicht. Ich sage immer: Wenn die Zeit kommt, dann musste!«
Die weitaus meisten sprechen stattdessen von dem, was ihnen auf ihre alten Tage noch Freude macht. Es sind simple, sehr bescheidene Freuden. Kurt O. (103) genießt jeden Morgen, bevor er zur Arbeit in seine Druckerei geht, sein Frühstück: »Haferflocken, Traubenzucker und heiße Milch darüber, zwei Zwieback mit Butter, zwei Löffel Honig und eine Tasse Kakaomilch.« Clothilde R. (108) trinkt jeden Tag einen Sherry, Ottilie W. (104) darf mit ihrer Tochter in die Kaufhalle fahren und sich aussuchen, »was ich gern habe: ›Ritter-Sport-Schokolade‹, ›Nimm 2‹ und Orangensaft.« Und Anna St. (105) hat sich einen Spaß erlaubt, als der Oberbürgermeister sie an ihrem 103. Geburtstag besuchte, einen Korb mit »einhundertdrei Fläschle Piccolo« mitbrachte und meinte: »Da haben Sie was fürs ganze Jahr zu trinken!« Anna erwiderte: »Ja, aber das Jahr hat dreihundertfünfundsechzig Tage!«
Selbst über das, was unwiederbringlich vorüber und nicht mehr möglich ist, scheint mancher sich freuen zu können, nämlich dank der Vorstellung, wie wohl man sich fühlen würde, wenn es noch möglich wäre. Die deutschstämmige Paulina M. (109), die nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 1941 aus ihrer Heimat im Kaukasus nach Kasachstan umgesiedelt worden und von dort dann nach Deutschland gekommen ist, erinnert sich an ihre einstige Beweglichkeit: »Wenn meine Füß gut wären, tät ich herumspringen!« Und den auf Gott vertrauenden, zuversichtlichen Spruch, den sie bei ihrer Kommunion lernte, hat sie nicht vergessen:
»Jesu, geh voran
Auf der Lebensbahn,
Und wir wollen nicht verweilen
Dir getreulich nachzueilen …«
So hat denn auch ein Wissenschaftler, der Gerontologe Dr. Christoph Rott vom Deutschen Zentrum für Alternsforschung in Heidelberg, eben erst in einer einschlägigen und begehrten Publikation, dem Senioren-Ratgeber (kostenlos erhältlich in Apotheken), festgestellt: »Wir müssen das Klischee ›alt gleich krank und unzufrieden‹ korrigieren.« Dr. Rott hat eine Umfrage unter Hochbetagten, die meisten davon pflegebedürftig, veranstaltet. Und dabei hat er herausgefunden, dass mehr als die Hälfte dieser Alten »mit ihrem Leben recht oder sehr zufrieden« waren.
Haben sie aufrichtig geantwortet? Wahrscheinlich, ja. Es mag sein, dass auch der eine oder andere von denen, die meinten, sie seien mit ihrem Leben sehr zufrieden, jene quälenden Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen durchaus kennt (Charles Simic: »In einem gewissen Alter ist es eben immer drei Uhr morgens«) – dann, wenn der erste Schlaf sich verflüchtigt hat und nicht mehr wiederkehren will, weil aus der Dunkelheit urplötzlich Ängste hervorbrechen und ihn verdrängen. Die Angst, schwerkrank zu werden, arge Schmerzen leiden zu müssen. Die Frage, wie lange man noch wird sehen und hören und gehen können. Vielleicht die grässliche Vorstellung, am Ende im Sarg zu liegen und wieder wach zu werden, unter der Erde; und ob man nicht darum bitten soll, dass der Arzt, um jedes Risiko auszuschließen, vor der Einsargung einem die lange Nadel durchs Herz treibt, mit der man einstmals den Scheintod zu überlisten versuchte?
Mag schon sein, dass auch manche Alte, die behaupten, sie seien zufrieden, solche quälenden Stunden allzu oft erleben und durchstehen müssen. Doch warum sollten sie sich nicht trotzdem und umso mehr auf den nächsten Tag freuen, der ihnen vergönnt ist, auf das Frühstück mit Traubenzucker und Kakaomilch oder den Besuch im Supermarkt, den Piccolo oder den Sherry? Oder, wenn es denn sonst nichts mehr zu genießen gibt, auf den Genuss der Schadenfreude, wie die beiden Alten, die bei der Muppet-Show aus ihrer Loge zusehen und jedes Malheur, das sich auf der Bühne ereignet, mit ihrem keuchenden Gelächter begleiten?
Oder, in Gottes Namen, sich freuen auch auf strikt verbotene Lüste, wie jene beiden anderen, die hochbetagten Richter aus dem Alten Testament, die sich auf ihren gichtkrummen Füßen anschlichen, als die schöne Susanna die Hüllen fallen ließ und ins Bad stieg, und sich am Anblick ihres makellosen Hinterns ergötzten?
(Eben habe ich nachgelesen und mich erinnert, dass dieses Abenteuer böse ausging, weil die Verehrer nämlich – wie es bei Rembrandt auch zu sehen ist – handgreiflich wurden, so dass die tugendhafte Susanna ihnen auf die Finger klopfte, woraufhin die alten Strolche sie wegen Ehebruchs anklagten und ein Todesurteil erwirkten, was ihnen freilich übel bekam, weil der wackere Daniel dafür sorgte, dass die falsche Anklage widerlegt und die Lüstlinge in eigener Person mit dem Tode bestraft wurden. Aber so weit muss es ja nicht kommen; vielleicht findet sich ja auch eine Susanna, die sich ohne solche Weiterungen belauern lässt.)
Wie unterschiedlich dergleichen kleine Freuden oder – nun ja, also gut: – Laster auch sein mögen, sie haben eines gemeinsam: Wer ihnen frönt, der hängt an ihnen, und das bedeutet zugleich, er hängt am Leben. Das betrifft nach aller Erfahrung merkwürdigerweise auch die Gläubigen, denen doch ein Jenseits vor Augen steht, mit dem das Diesseits sich nicht messen kann. Es betrifft vielleicht sogar die Hochgemuten, die den Tod herausfordern, wie beim Aesop die gute Ehegattin, welche fürchtete, ihren Mann, den die Ärzte schon aufgegeben hatten, zu verlieren: »Durchaus wollte die Frau, dass der Tod sie an seiner Statt holen sollte, sie bat, sie weinte, sie schrie, bis der Tod endlich in einer schrecklichen Gestalt vor ihr erschien. Und den Augenblick war sie mit ihrem Kompliment fertig: Ich bitte sehr, Herr Tod, sich nicht zu irren, sprach sie; die Person, derenwegen Sie kommen, liegt dort im Bette.«
Gilt es auch für die Einsamen? Für die, denen die Freunde und Verwandten weggestorben sind? Hängen auch sie am Leben, trotzdem? Ich weiß es nicht. Paul M., mit 100 Jahren einer der jüngsten von Wenzel-Orfs ältesten Deutschen, hat gesagt: »Es ist nicht schön, so alleine. Wissen Sie, das Essen schmeckt alleine auch nicht richtig, und eigentlich macht alles keinen Spaß alleine …«
Das hat mich an die Zeit erinnert, die ich in New York verbracht habe. In den Coffee Shop, in den ich oft zum Frühstück ging, kamen regelmäßig auch einige alte Frauen, jede allein und jede für sich. Sie freuten sich, wenn man ihnen einen guten Morgen wünschte, und antworteten freundlich, wenn man sie ansprach, aber sie drängten sich niemandem auf. Sie tranken ihren Kaffee und aßen ihren Toast, und dann verschwanden sie wieder, jede für sich unter Millionen von Menschen, jede allein in irgendein kleines Apartment in dieser riesigen Stadt, in dem sie den Rest des Tages und die Nacht verbrachten, einsam und ohne Echo, in einer erstickenden Stille, die nur hin und wieder von der Sirene eines Streifenwagens oder einer Ambulanz zerrissen wurde.
Und doch bin ich sicher, dass es Lebensfreude war, die sie empfanden, wenn sie sich am anderen Morgen wieder auf den Weg zum Coffee Shop machten. Ich wollte sie immer danach fragen, aber ich hab’s nie getan; vielleicht hätten sie es als zudringlich empfunden.
Diese Erinnerung wiederum ruft eine andere hervor, eine Erinnerung an die Zeit, in der ich zwölf, dreizehn Jahre alt war und die Schulferien meist in einem Dorf am Fuß des Westerwaldes verbrachte. Durch das Dorf floss ein breiter Bach, der das Schaufelrad einer Mühle mit Bäckerei antrieb, in der noch Korn gemahlen und gleich neben dem Mühlrad zu Brot verarbeitet wurde, man konnte das Brot, wenn es frisch aus dem Ofen kam, bis hinüber ans andere Ufer des Baches riechen. Und die Hauptstraße, eine schmale Gasse, führte ein Stück lang an dem Bach vorbei, sie war von dem Bach durch eine halbhohe Mauer aus Bruchsteinen getrennt, und mitten im Dorf beschrieb der Bach eine Kurve, und die Mauer folgte ihm, so dass zwischen der Hauptstraße und der Mauer ein kleiner Platz frei geblieben war, inmitten der kleinen alten Häuser und ungefähr so groß wie ein Wohnzimmer.
An den Sommerabenden kamen sie aus den Häusern, gemächlich und einer nach dem anderen, sie kamen hinaus auf den kleinen Platz, Frauen und Männer, Alte und Junge, die größeren Kinder, die noch nicht ins Bett gehen mussten, auch ein paar Hunde gesellten sich dazu und die eine oder andere Katze, die es mit der Mäusejagd anscheinend nicht so eilig hatte. Die Jüngeren brachten zwei, drei Küchenstühle mit, die Stühle standen ein wenig wacklig auf dem Kopfsteinpflaster, aber die Großmutter konnte sich darauf niederlassen und Zachers Erwin, der ein schlimmes Bein hatte, man gab darauf acht, dass sie nicht umkippten.
Wir schwangen uns auf die Mauer und ließen die Beine baumeln und warteten darauf, dass die Alten ihre Pfeifen gestopft hatten und zu diskutieren anfingen, was sie auch taten, gemächlich und einer nach dem anderen, es ging meist um den Krieg und wie lange er wohl noch dauern würde, und schließlich kamen die Geschichten dran, es waren meist die Frauen, die sie erzählten, Geschichten von früher, von Verwandten und Nachbarn, die nach Amerika ausgewandert waren und von denen man schon lange nichts mehr gehört hatte, und andere von Leuten, die schon lange tot waren, spannende Geschichten, aber auch lustige, und manche waren gruselig.
Die Dämmerung wurde dichter, man konnte den Sommer riechen, das frische Wasser des Bachs, das Ufergras und den dunklen Wald, der Wald stieg hinter dem Bach den Berghang hinauf, steil hinauf bis zur Schneise des Bahndamms, der auf halber Höhe am Hang entlangführte, und dahinter noch weiter hinauf bis auf den Kamm des Berges, man konnte die gezackten Wipfel der Fichten sehen, sie zeichneten sich ab gegen das diffuse Licht der Sterne, die allmählich an dem weiten, dunkelnden Himmel hervortraten.
Irgendwann, vielleicht um neun, vielleicht auch um 9.06 Uhr oder 9.07 Uhr, man konnte jedenfalls die Uhr danach stellen, irgendwann rührte es sich dann in dem schwarzen Schlund des Tunnels, aus dem die Bahngeleise herauskamen, ein Rollen und Schlagen, und unversehens erschienen die Stirnlampen der kleinen Dampflokomotive, die schnaufend und funkenstiebend ihre drei Wägelchen die sanfte Steigung emporschleppte, der Spätzug auf den Westerwald. Wir hörten die Glocke vor dem Übergang des nächsten Holzpfads läuten. Wir sahen den roten Lichtern nach, die im Wald verschwanden. Und bald darauf sagte dann der Erste: »Gode Nacht!«, und seine Frau folgte ihm, die Großmutter wurde ins Haus geführt, und ein anderer ließ Zachers Erwin den Arm über seine Schultern legen und brachte ihn bis an die Haustür, vielleicht auch bis ans Bett.