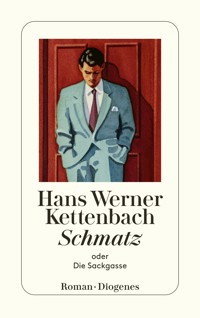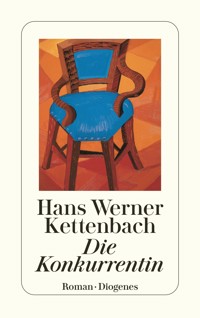8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Faber ist freier Feuilletonjournalist. Aber insgeheim sehnt er sich danach, auch einmal politische Schlagzeilen zu machen. Nebenbei arbeitet er als Lektor für einen kleinen Verlag. Eines Tages gerät ihm ein Manuskript in die Hände, das nach einem Schlüsselroman aussieht: Da packt ein Insider der politischen Szene aus und berichtet Skandalöses über höchste Regierungskreise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Der Feigenblattpflücker
Diogenes
1
Es war ein miserabler Roman. Das Manuskript, in der gestochenen Schrift eines Computers geschrieben, handelte unter dem Titel Die Demaskierung von einem Politiker namens Dr. Peter Stahl, der am Sitz der Bundesregierung seinen Geschäften nachging, oder eben nicht seinen Geschäften, sondern der Berufung, das Wohl des Volkes zu mehren, was diesem Stahl titanische Kräfte und Arbeitstage von sechzehn Stunden abverlangte. Die vielerlei machtgierigen Konkurrenten nämlich, die ihn umwimmelten, hatten nichts anderes im Sinn, als ihre politischen Ämter zu ihrem höchsteigenen Profit, wollte heißen: zum Schaden des Volkes zu nutzen.
Welches Amt der Romanheld selbst bekleidete, ließ sich dem Manuskript nicht eindeutig entnehmen. Vieles wies allerdings darauf hin, daß man sich Dr. Stahl als Staatssekretär oder gar Minister vorzustellen hatte. So verfügte er nicht nur über eine Entourage von Leibwächtern, Sekretärinnen und Referenten, sondern nahm auch regelmäßig an den Sitzungen des Kabinetts teil, während derer er in der Form des inneren Monologs das Auftreten und die Heuchelei anderer Teilnehmer scharf analysierte, zum Beispiel so:
Knebel scheint wieder nicht ausgeschlafen zu haben. Die neue Bettgenossin? Irgendwann wird der Kanzler den Sumpf erkennen, der sich hinter dieser ehrbaren Fassade suhlt, und dann ist es aus mit Herrn Bundesminister Knebel.
Daß es sich bei diesem Roman um das Machwerk eines Stümpers handelte, hatte Faber schon vermutet, als ihm bei seinem allwöchentlichen Besuch im Verlag Die Truhe das Manuskript mit zwei anderen zur Begutachtung ausgehändigt worden war. Das Epos von Peter Stahl, gut dreihundert Seiten auf mattgelbem, gediegenem Papier, war beim Verlag eingegangen mit einem Begleitbrief, dessen gedruckter Kopf als Absender einen Dr. Erwin Meier-Flossdorf auswies, Rechtsanwalt in der Provinzhauptstadt N., mit Angabe der Sprechstunden und der Bankverbindungen.
Meier-Flossdorf schrieb, er biete dem Verlag beigeschlossenen Roman Die Demaskierung im Auftrag des Autors zur Veröffentlichung an. Der Autor sei eine hochrangige Persönlichkeit, ein (um das hier ausnahmsweise angebrachte Modewort zu verwenden) Insider der Politik, der seine geheimen Kenntnisse in literarischer Form zu angebotenem Manuskript verarbeitet habe. Aus naheliegenden Gründen müsse die Identität des Autors unter allen Umständen verborgen bleiben. Dieserhalb dürfe der Roman nur unter dem gewählten Pseudonym – Helmut Michelsen – veröffentlicht werden. Kontakte zum Autor, auch die vertragliche Regelung der Veröffentlichung incl. des zu zahlenden Honorars etc. etc., seien einzig durch die Kanzlei des Unterzeichnenden vollziehbar, welcher über Generalvollmacht des Autors verfüge.
Seinen Zweifel daran, daß eine hochrangige Persönlichkeit dieser Art imstande sei, einen Roman zu schreiben, hatte Faber auf den ersten zehn Seiten des Manuskripts hinreichend bestätigt gefunden und alsbald begonnen, die Stichwörter für einen gnadenlosen Verriß zu notieren. Aber je mehr er las, um so mehr zweifelte er auch daran, daß hinter Helmut Michelsen sich ein Insider der Politik verbarg. Die Intrigen, die da geschildert wurden, waren zu hanebüchen, die Machtgier, Liebedienerei und Skrupellosigkeit der politischen Amtsträger zu hemmungslos, als daß sie Erfahrungen der Realität hätten entstammen können. Faber argwöhnte mehr und mehr, daß der Rechtsanwalt Meier-Flossdorf selbst diesen Roman ins Diktiergerät gesprochen und von seiner Sekretärin ins reine hatte schreiben lassen, ein lehrhaftes Schreckensbild der hohen Politik, wie ein in der Provinzhauptstadt residierender, von seiner Regierung enttäuschter Spießbürger es sich ausmalen mochte.
Auch diese Vermutung hatte Faber schon für seine Begutachtung notiert, als er, das Manuskript mit wachsendem Überdruß nur noch durchblätternd, eher zufällig auf eine Passage stieß, die jäh sein Interesse weckte. Es war die Schilderung eines Erlebnisses, das dem Dr. Stahl nicht am Sitz der Regierung, sondern in seinem Heimatort draußen im Lande widerfuhr, im behaglichen Wohnzimmer seines Hauses, an einem regnerischen Novemberabend, vor dem Kamin, in dem die Buchenscheite blutrot glühten und verstohlen knisterten: Der Sohn des Politikers, Rechtsreferendar Jürgen Stahl, kommt unerwartet zu Besuch und beichtet dem Vater zu dessen Erschütterung, daß er seiner Freundin, einer Schönheit mit dem ominösen Namen Eva, bei einer Abtreibung behilflich gewesen ist. Jürgen wollte das Kind, sein Kind, aber Eva, die als Model Karriere machen möchte, hat auf der Abtreibung bestanden, und seither zerquält sich Jürgen mit seiner Schuld als Komplize.
Am Ende dieser Beichte hatte der Autor des Romans seinen reuigen Sünder auch den Tatort beschreiben lassen:
Jürgen atmete schwer auf. »Ich mußte es dir sagen, Vater. Ich werde allein nicht fertig damit. Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, wie solltest du!, wie mir zumute war, als ich sie an der Schwelle dieser sogenannten Klinik abgeliefert habe. Ich bin vor dem Haus auf und ab gegangen, auf und ab, wie ein gefangenes Tier. Auch bin ich bis zur Telefonzelle an der Straßenecke gegangen, aber auf dem Fuße wieder zurück. Dieses Haus, ich werde es nie vergessen, Vater! Es ist aus Backsteinen errichtet, es trägt einen Giebel über dem Portal und rechts und links davon übereinander zwei Reihen von hohen, schmalen Fenstern. Vor dem Portal steht ein Weidenbaum, der im Regen stand. Der Regen tropfte von den frischen, grünen Blättern – wie Tränen, Vater. Ich wußte, daß hinter einem dieser undurchsichtigen Fenster ein Mensch ermordet wurde, nein!, nicht ermordet – abgeschlachtet ist der richtige Ausdruck! Mein Sohn wurde da abgeschlachtet … oder war es meine Tochter? Egal, ich würde es nie erfahren! Verstehst du, was ich meine, Vater?«
Stahl strich Jürgen übers Haar. Wie einst, als Jürgen noch ein Kind war.
Faber hielt ein mit der Lektüre. Er kannte dieses Backsteinhaus mit den hohen, schmalen Fenstern. Es stand in einem Vorort von Venlo, Holland. Es war ein eher großes Haus, das nicht zwei, sondern vier Geschosse zählte. Aber in allen anderen Merkmalen deckte sich die Beschreibung mit der Realität dieses Hauses in Venlo. Faber war vor drei Jahren dort gewesen. Er hatte Kirsten in die Klinik gebracht, sie hinter der breiten Tür zu den Operationsräumen verschwinden sehen, hatte sich auf eine der Bänke im Flur gesetzt. Nach ein, zwei Minuten war er aufgestanden und hinausgegangen. Er hatte von der gegenüberliegenden Seite der schmalen Straße das Haus betrachtet, die Fassade aus rotbraunen Backsteinen, den Ziergiebel über dem Portal, die Fenster zur Rechten und zur Linken. Ein kalter Wind hatte die hängenden Zweige des Weidenbaums bewegt. Eine Frau war in die Telefonzelle an der Straßenecke gegangen und hatte endlos telefoniert.
Faber machte sich daran, das Manuskript noch einmal von der ersten Zeile an zu lesen, und las es bis zur letzten. Er achtete nicht mehr auf die stilistischen Mißgriffe des Autors, sondern legte ein Verzeichnis derjenigen Episoden an, in denen die gröbsten Verstöße der handelnden Personen gegen Sitte und Gesetz beschrieben wurden. Nach gut vier Stunden, in denen er von der Lektüre nicht abließ, notierte er als letzten Punkt seiner Liste, versehen mit zwei Ausrufezeichen, die pompöse Apotheose, in die das Werk gipfelte: Eine drohende Staatskrise kann nur dank des Eingreifens von Stahl abgewendet werden. Dieser nämlich findet heraus, daß ein Mitglied des engsten Beraterkreises um den Regierungschef sich von einem internationalen Waffenkonzern hat bestechen lassen – ausgerechnet derselbe Berater, der zuvor den makellosen Stahl mit haltlosen Verdächtigungen beim Kanzler anzuschwärzen versuchte.
Stahl öffnet dem Kanzler die Augen. Der unwürdige Paladin wird, um katastrophale Folgen für das Ansehen der Republik zu vermeiden, unter dem Deckmantel von Krankheitsgründen vorzeitig pensioniert. Der Kanzler dankt Stahl mit einem stummen, aber ungewöhnlich langen Händedruck und geleitet ihn persönlich zum Portal des Kanzleramtes. Stahl schickt Fahrer und Leibwächter voraus und geht, die Brust in tiefen Atemzügen weitend, zu Fuß zurück zu seinem Amtssitz, zerschlagen und ermattet wie nach einem schweren Kampf, aber im Bewußtsein seiner Mission: Es gab unendlich viel zu tun. Es war nicht vorüber. Es würde nie vorüber sein.
Als Kirsten gegen sieben an Fabers Tür klingelte, war er dabei, das Manuskript noch einmal durchzublättern. Er ließ es liegen, half Kirsten bei der Vorbereitung des Abendessens, putzte das Gemüse, wusch Teller, Tassen und Gläser ab, die er seit zwei Tagen hatte stehenlassen, deckte den Tisch. Aber sobald sie gegessen hatten, holte er das Manuskript in die Küche und schlug die Stelle auf, an der die Beichte des Rechtsreferendars Jürgen begann. Er reichte Kirsten, die einen Stuhl herangezogen und die Beine darauf gelegt hatte, das aufgeschlagene Manuskript.
»Liest du das mal, wenn du nicht zu müde bist? Diese Seite und die nächste.«
»Was ist das?« Kirsten legte den Daumen zwischen die Blätter, schloß das Manuskript und las das Titelblatt.
Faber wies auf den Titel. »Ein Roman. Von Helmut Michelsen.«
»Das sehe ich. Muß ich Herrn Michelsen kennen?«
»Nein. Ich kenne ihn auch nicht.«
»Na, Gott sei Dank, das ist ja tröstlich.«
»Es ist auch ein ziemlich miserabler Roman. Aber vielleicht hat das Manuskript andere Qualitäten. Du brauchst nur diese beiden Seiten zu lesen.«
Kirsten seufzte. Sie schlug das Manuskript wieder auf und begann zu lesen. Nach einer Weile sah sie Faber an, dann las sie weiter. Sie las die beiden Seiten, schlug auch die folgende noch auf und überflog sie, schloß das Manuskript mit einer heftigen Bewegung und warf es auf den Tisch. Sie stand auf und verließ die Küche.
Faber folgte ihr. Sie hatte sich im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt und die Augen geschlossen.
Er berührte ihre Schulter. »Was ist denn?«
Sie schlug die Augen auf. »Warum zeigst du mir diese widerliche Salbaderei? Findest du das etwa gut?«
»Natürlich nicht. Ich hab doch gesagt, es ist ein miserabler Roman.«
»Und warum sollte ich ausgerechnet diese miserable Stelle lesen?«
Faber hob die Schultern. »Weil ich mir darüber nicht sicher war. Es tut mir leid, ich hab nicht … Ich wollte nur wissen, ob du das Haus, das da beschrieben wird, und die Straße und das ganze Drum und Dran … ob das für dich genauso eindeutig erkennbar ist wie für mich.«
Kirsten wandte sich ab. Faber setzte sich neben ihre Füße. »Es gibt da ja merkwürdige Erfahrungen. Du liest die Beschreibung eines Ortes und bist fast sicher, ihn wiederzuerkennen. Aber was dir vorschwebt, ist ein ganz anderer Ort. Du verwechselst ihn nur, weil du vergessen hast, wie es tatsächlich war. Oder vielleicht hast du es auch verdrängt.«
Kirsten sagte: »Streng dich nicht an, ich kann dich beruhigen. Was dieser Schmierfink beschreibt, das ist die Klinik in Venlo. Ich hab’s nicht vergessen und auch nicht verdrängt.«
Faber legte eine Hand auf ihr Knie. »Es tut mir wirklich leid. Ich hätte dir vielleicht vorher sagen sollen, was mich an diesem Manuskript interessiert.«
Er wartete auf eine Reaktion, aber Kirsten rührte sich nicht. Faber sagte: »Es könnte ein Schlüsselroman sein, und zwar ein höchst brisanter. Er beschreibt Dutzende von geradezu unglaublichen politischen Skandalen. Und vor allem beschreibt er, wie sie vertuscht werden. Ich hab das anfangs alles für Quatsch gehalten. Das Produkt eines moralisierenden Phantasten. Aber als ich diese Stelle über Venlo gefunden habe, bin ich nachdenklich geworden.«
Kirsten schwieg. Faber stand auf und holte den Brief des Anwalts Meier-Flossdorf von seinem Schreibtisch. »Das solltest du auch noch lesen.«
Sie sah ihn an. »Reicht es dir noch nicht?«
»Ich will dir doch nur erklären, warum ich dich gebeten habe, diese Passage zu lesen.« Faber legte den Brief auf ihren Schoß und ging in die Küche. Er nahm die Weinflasche und die beiden Gläser, die auf dem Küchentisch standen, brachte sie ins Wohnzimmer und reichte Kirsten ihr Glas. Sie schüttelte den Kopf. Faber stellte das Glas ab und setzte sich mit seinem Glas wieder ans Fußende des Sofas.
Kirsten hob den Brief auf und las ihn. Sie stieß die Luft durch die Nase. »Eine hochrangige Persönlichkeit! Das könnte sogar stimmen.«
»Warum?«
»Weil es zu einer hochrangigen Persönlichkeit passen würde, sich so über eine Abtreibung auszuschleimen.« Sie ließ den Brief fallen. »Also gut. Dieser Autor hat einen Sohn, der mit seiner Freundin in Venlo war und dem Vater darüber berichtet hat. Und was ist daran interessant?«
»Denk doch mal nach.« Faber nahm einen Schluck Wein. »Über die Schleimerei brauchen wir nicht zu streiten, da sind wir uns einig. Wir beide wissen aber auch, daß die äußeren Fakten stimmen. Von der Zahl der Stockwerke einmal abgesehen. Und wenn nun unser unbekannter Autor sich in dieser Episode im wesentlichen an die Fakten hält … ist es dann nicht vorstellbar, daß er auch in anderen Fällen die Realität beschrieben hat? So exaltiert oder so unglaublich die Beschreibung auch klingen mag?«
»In welchem Fall zum Beispiel?«
»Zum Beispiel bei dem Skandal, der den Höhepunkt dieses Elaborats darstellt.« Faber stand auf, er wollte in die Küche gehen und das Manuskript holen, hielt ein und setzte sich wieder. »Da geht es um einen Kanzlerberater, der sich hat bestechen lassen. Der Mann wird entlarvt, aber dann siegt wieder einmal die Staatsräson, der Skandal bleibt unter der Decke, der Mann wird vorzeitig pensioniert, angeblich, weil er an einer schweren Herzkrankheit leidet.«
Faber stand auf und goß sich Wein ein. »Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, daß vor zwei oder drei Jahren tatsächlich ein Mann aus dem Kanzleramt vorzeitig pensioniert worden ist. Aus Gesundheitsgründen. Das müßte sich feststellen lassen.«
Kirsten sah ihn an. »Worauf willst du hinaus, Alex?«
»Worauf ich hinaus will?« Faber betrachtete den Wein in seinem Glas. »Stell dir vor, dieses Manuskript würde veröffentlicht.«
»Ich denke, es ist ein miserabler Roman?«
»Natürlich ist es das. Zumindest in der Form, die es jetzt hat.« Er sah sie an. »Aber als Schlüsselroman könnte das Buch eine Sensation werden.«
»Eine was?« Sie zog die Brauen zusammen.
Faber wußte, daß er die Deckung verlassen hatte. Das Reizwort Sensation, das ihr seit jeher zuwider war, trieb den Test in die entscheidende Phase. Eine Ausflucht gab es nicht mehr, er mußte in die Offensive gehen, mit allen Rechtfertigungen, selbst den erbärmlichsten, die sich auftreiben ließen, und ebendas wollte er. Faber wiederholte das obszöne Wort: »Eine Sensation.«
Nach einer Weile sagte sie: »Das könnte so ein Buch doch nur werden, wenn nachgewiesen würde, daß der Autor tatsächlich ein Insider ist. Sonst ließe sich doch alles, was an Schweinereien darinstehen mag, als pure Phantasterei abtun.«
»Na ja, ganz so einfach wäre das wohl nicht. Wie will man denn in jedem Fall das Gegenteil beweisen? Aber im Prinzip hast du natürlich recht.« Faber lächelte. »Damit das Buch tatsächlich zur Sensation würde, müßte man schon den Autor identifizieren.«
Er sprach weiter, bevor sie antworten konnte. »Ein paar Ansatzpunkte gäbe es dafür. Dieser Rechtsanwalt zum Beispiel, er ist vermutlich ein guter Freund des Autors. Er muß sogar ein sehr guter, alter Freund sein, sonst hätte der Autor ihm nicht dieses Manuskript anvertraut. Vielleicht stammen sie beide aus N., vielleicht sind sie dort zusammen aufgewachsen oder zur Schule gegangen. Oder zur Universität.« Faber setzte sich wieder. »Man müßte feststellen, ob es einen Minister oder Staatssekretär gibt, der aus N. stammt. Und wenn man den findet, dann läßt sich auch feststellen, ob er einen Sohn hat. Der Sohn könnte einen weiteren Ansatzpunkt liefern.«
»Das meinst du doch wohl nicht ernst, Alex!« Kirsten nahm Meier-Flossdorfs Brief von ihrem Schoß, warf ihn neben sich auf das Sofa. »Willst du tatsächlich diesen Mann identifizieren?«
»Ich sage nicht, daß ich das will. Ich sage nur, daß es vielleicht möglich wäre. Und daß dann das Buch mit Sicherheit ein Renner würde.«
»Ein Renner! Die Rechnung geht doch hinten und vorn nicht auf. Der Mann würde das Manuskript doch gar nicht mehr erscheinen lassen, er würde es sofort zurückziehen, wenn er erführe, daß sein Pseudonym nichts mehr wert ist.«
»Natürlich würde er das.« Faber lachte. »Das wäre ja auch eine törichte Dramaturgie. Nein, nein … natürlich dürfte er vor der Veröffentlichung nicht erfahren, daß es jemandem gelungen ist, ihn zu identifizieren. Zuerst müßte das Buch auf dem Markt sein. Ein paar Tage vielleicht. Und dann erst dürfte man die Story über den Autor veröffentlichen.«
Kirsten stand auf. Sie nahm Meier-Flossdorfs Brief vom Sofa, legte ihn auf den Schreibtisch, wandte sich zurück zu Faber. »Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und das Schlimme daran ist, daß du das gar nicht mehr zu merken scheinst.«
Faber schüttelte den Kopf. »Was soll das denn nun? Soll das ein Argument sein?«
»Nächsten Monat wirst du zweiundvierzig, Alex. Alt genug, um zu wissen, was man tut und was man läßt. Und was man kann und was man nicht kann. Aber du bist nicht zufrieden mit deinem Schicksal. Du träumst immer noch davon, deinen Namen unter einer Schlagzeile zu lesen. Der Aufreißer, der die Welt verändert. Die Feuilletons genügen dir nicht, die Buchbesprechungen, die Theaterkritiken, das, was du kannst und was du wirklich gut machst, erstklassig sogar. Nein, nein – eine Regierung müßte man stürzen, nicht wahr? Und da fällt dir nichts Besseres ein, als die Spur eines … eines Schweinehundes aufzunehmen, der ein paar andere Schweinehunde denunzieren möchte, und den jetzt du denunzieren möchtest. Darauf läuft es doch hinaus, das ist es doch. Willst du wirklich im Dreck wühlen, Alex? Willst du mit einer Enthüllungsstory berühmt werden?«
Faber lächelte. »War’s das? Oder hast du noch mehr auf dem Herzen?«
»Ja, noch etwas, ich hätte es beinahe vergessen: Bist du nicht verpflichtet, alle Informationen, die du durch den Verlag bekommst, vertraulich zu behandeln? Willst du den Job bei Vogelsang loswerden? Bei dem dürftest du dich doch nicht mehr blicken lassen, sobald er erführe, daß du hinter einem Autor herspionierst. Einem Autor, der seine Identität nicht preisgeben will!«
»Das laß mal meine Sorge sein.« Faber stand auf und leerte den Rest der Flasche in sein Glas. »Und nun zu deiner Predigt.« Er setzte sich wieder, trank, lächelte Kirsten an. »Im Dreck wühlen. Kann es sein, daß ich das schon einmal gehört habe?«
Faber tat sich schwer. In den vier Jahren, seit er Kirsten bei der Lesung eines Autors aus der DDR kennengelernt hatte, eines Autors, der aus Kirstens Heimatstadt stammte, hatte sie Faber immer wieder einmal die Perversionen der schreibenden Zunft im Westen vorgehalten, der Literaten, der Journalisten. Ja, ja, es war pervers genug, wie im Osten das Abbild der Welt, damit es in Druck gehen durfte, retuschiert und verschleiert werden mußte. Aber war es weniger pervers, wie die Zunft im Westen ohne Not dieses Abbild, um ein Gelüst darauf zu wecken, als Sensation aufputzte und verhökerte?
Faber hatte sich gelegentlich amüsiert über Kirstens Empörung, sobald irgendeine Zeitung einen seiner abgewogenen Berichte mit einer reißerischen Überschrift versehen hatte. Und doch hatte er sich durch solch zorniges Engagement bestätigt gefühlt, es hatte ihm wohlgetan. Es hatte den seit einiger Zeit immer empfindlicher nagenden Zweifel gelindert, ob das, was er schrieb, überhaupt einer pfleglichen Behandlung durch die Redaktionen wert war.
Mit Kirstens Empörung hatte er gerechnet, als er ihr darlegte, was sich aus dem Angebot des Dr. Meier-Flossdorf herausholen lasse. Aber er war nicht darauf vorbereitet, daß sie diese Spekulation, daß sie schon das bloße Nachdenken über einen solchen Coup als das Symptom einer Lebenskrise auslegen und ihn mit einer Diagnose konfrontieren würde, die er eher als Demütigung denn als Hilfe empfinden mußte. Faber vermied es, darauf einzugehen.
Er konzentrierte sich auf die Frage, ob er im Dreck wühlen wolle, versuchte, sie als naiv abzutun, als Floskel aus abgestandenen Predigten. Indessen merkte er, daß er selbst immer tiefer in eine Predigt hineingeriet. Er verbreitete sich über die Korruption, die doch offenkundig weithin (um ein Haar hätte er gesagt: wie ein Krebsgeschwür) wuchere, in der Politik wie in der Wirtschaft. Im Journalismus nicht? Na, bitte schön, auch im Journalismus. Aber wo auch immer: Gab es denn, um die Korruption zurückzudrängen, ein anderes Mittel, als sie bloßzustellen, durch Enthüllungsstorys, jawohl, durch Sensationen in Gottes Namen, und was war denn daran verwerflich, wenn die Veröffentlichung, so geschmacklos ihre Form auch sein mochte, dem Interesse der Allgemeinheit diente?
Sie stieß die Luft durch die Nase. »Interesse der Allgemeinheit! Kann es sein, daß ich das schon mal gehört habe?«
»Ja, das kann sein. Nur hast du anscheinend nicht lange genug darüber nachgedacht. Aber du hast ja noch Zeit, noch dreizehn Jahre, bis du so alt bist wie ich und wissen mußt, was man zu tun und was man zu lassen hat.«
Kirsten wandte sich ab und ging in die Küche. Nach einer Weile hörte Faber das Klappern des Geschirrs. Er folgte Kirsten, nahm eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank und öffnete sie. »Laß das Geschirr, ich mach das nachher. Ich muß mir jetzt diese Talkshow ansehen.« Kirsten schwieg. Faber brachte den Wein ins Wohnzimmer, schaltete den Fernsehapparat ein und setzte sich mit seinem Notizblock davor.
Es fiel ihm schwer, sich auf die Sendung zu konzentrieren, ein chaotisches Gequatsche zwischen der Moderatorin, die ihre Respektlosigkeit inszenierte, einem angestrengt schlagfertigen Minister, einer gealterten Schauspielerin, der ein nervöses Lidzucken zu schaffen machte, einem noch nicht alten, aber bereits verfetteten Schlagersänger und einem sehr jungen Fußballprofi, der unlängst für eine Ablösesumme von etlichen Millionen Mark den Verein gewechselt hatte und jede zweite Antwort mit einem »Na ja, das ist richtig, aber …« einleitete. Während Faber eine Beurteilung des Ministers notierte, die er wegen ihres beleidigenden Charakters in seiner Besprechung nicht würde verwenden können, kam Kirsten herein. Sie küßte Faber auf die Stirn. »Es tut mir leid, Alex.« Er gab keine Antwort. Sie goß sich ein Glas Wein ein und setzte sich vor den Fernsehapparat.
Als die Sendung zu Ende war, schaltete Faber den Apparat aus. Er schrieb noch ein paar Sätze in seinen Notizblock, reckte sich und legte den Block beiseite. Kirsten sagte: »Ich verstehe ja, daß diese Arbeit dich manchmal ankotzt. Aber ist das nicht mit jeder Arbeit so?«
»Doch, doch. Das ist es wohl.«
»Warum bist du dann so unzufrieden, Alex? Es geht anderen doch auch nicht besser.«
Faber schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Es tut mir leid, Kirsten, aber du hast nichts verstanden.«
»Ich habe dich sehr gut verstanden.«
»Du hast gar nichts verstanden.«
Kirsten trank ihr Glas leer, sie stellte es ab und stand auf.
Faber sagte: »Was sich hinter diesem schlechten, diesem widerlichen Manuskript versteckt, liebe Kirsten, das könnte die Welt sein, so wie sie ist. Und nur das ist das Interessante daran. Interessant ist dieses Manuskript nicht als Abbild der Welt, natürlich nicht, es ist nun mal ein miserabler Roman, darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Leider wird mir ebendas nicht erspart bleiben, denn fatalerweise verdiene ich mein Brot dadurch, daß ich Worte verliere über Abbilder der Welt, die schlechten wie die guten, ich kann sie mir nicht aussuchen. Aber das können wir jetzt einmal außer Betracht lassen.«
Er versuchte einen neuen Anlauf. »Was du nicht verstanden hast, ist ganz einfach: Dieses Manuskript bietet eine Chance, sich die Wirklichkeit … anzueignen. Oder sagen wir einen Einstieg, um an die Wirklichkeit heranzukommen. Sich mit der Welt, so wie sie ist, auseinanderzusetzen, und nicht mit irgendeinem Abbild von ihr.«
Kirsten sagte: »Es bleibt also dabei: Du willst den Mann identifizieren.«
»Auch das hast du offenbar nicht verstanden. Oder du willst es nicht verstehen. Ich habe nichts anderes gesagt, als daß es vielleicht möglich wäre, die Identität des Autors aufzudecken. Und ich habe in der Tat einige Konsequenzen entwickelt, die sich daraus ergeben könnten.«
Kirsten ging hinaus. Faber lauschte, aber er konnte nicht erkennen, was sie tat. Er stand auf und folgte ihr. Sie hatte ihren Mantel angezogen, stand vor dem Garderobenspiegel, die Einkaufstasche in einer Hand, und richtete mit der anderen ihr Halstuch.
Faber räusperte sich. »Wolltest du nicht hierbleiben?«
»Heute nicht.« Sie küßte ihn auf die Wange. »Schlaf gut, Alex.« Bevor Faber ihr gute Nacht sagen konnte, zog sie die Wohnungstür hinter sich zu.
2
Am nächsten Morgen, die Fenster der Stadt funkelten in der Oktobersonne, fuhr Faber zur Redaktion der Zeitung, die die Fernsehkritik bei ihm bestellt hatte. Er brach schon vor zehn Uhr auf, wie stets darauf bedacht, seine Arbeit zu tun, während es noch still war in den Zimmern der Redaktion und niemand einem mit der Frage lästig fiel, wie lange man das Terminal noch brauche.
Vom Boten, der den Frühdienst versah und dabei war, die Post und die Zeitungen auf seinen Karren zu sortieren, ließ Faber sich den Hauptschlüssel der Kulturredaktion geben. Nachdem er in alle Zimmer des Ressorts hineingeschaut und sich mit Befriedigung vergewissert hatte, daß noch niemand außer ihm zur Arbeit erschienen war, setzte er sich an das Terminal des Musikredakteurs, zog seine Notizen heraus, sah sie durch und legte sie neben sich auf das Klappbrett des Terminals. Er stand noch einmal auf und sah aus dem Fenster hinunter auf die Einkaufsstraße vor dem Zeitungshaus. Die Kellnerin des Cafés gegenüber schloß die Glastür auf, trat hinaus und hielt das Gesicht in die Sonne, schloß die Augen und lächelte.
Faber überlegte, ob er, wenn der Konditor das schöne Wetter nutzen und vielleicht zum letztenmal in diesem Jahr die weißen Tische und Stühle vor die Tür stellen würde, einen Kaffee im Freien trinken sollte. Er schob die Entscheidung auf und setzte sich wieder ans Terminal. Nach zwanzig Minuten hatte er seine Besprechung der Talkshow geschrieben. Er warf einen Blick aus dem Fenster. Die Tische und Stühle waren bereits aufgebaut. Faber sah seinen Text auf dem Bildschirm noch einmal durch, legte ihn ab und schrieb eine Notiz an den Fernsehredakteur, die er auf dessen Schreibtisch hinterließ.
Er stand schon vor dem Café, hatte sich schon für einen Platz entschieden, an dem die warme Sonne ihm ins Gesicht scheinen würde, als er plötzlich umkehrte. Dieses Mal fuhr er mit dem Aufzug ein Stockwerk höher als zuvor. Er wanderte an den Türen der Sportredaktion vorbei, las die Namensschilder, blieb hier und da stehen, ging weiter bis zum Haupteingang der politischen Redaktion. An der Tür steckte der Schlüssel. Faber blickte zurück. Er war allein auf dem langen Flur.
Er klopfte an und öffnete die Tür. Wie er es gehofft hatte, fand er in dem weitläufigen Zimmer nur einen der vielen Schreibtische besetzt. Ein Nachrichtenredakteur, dessen Name Faber nicht einfiel, war dabei, einen dicken Packen von Agenturmeldungen durchzusehen und zu sortieren. Er hob die Augenbrauen und lächelte. »Das ist aber ein seltener Besuch. Wollen Sie fremdgehen?«
»Nein, nein.« Faber lachte. »So vermessen bin ich nicht. Ich suche nur eine Liste der Kabinettsmitglieder. Der gegenwärtigen und wenn möglich auch derjenigen, die bis vor zwei, drei Jahren dazugehörten. Haben Sie vielleicht so etwas?«
»Das denke ich aber doch. Wie wär’s denn mit dem Handbuch der Bundesregierung?« Der Redakteur stand auf, nahm einen in Kunststoff gebundenen, kleinen Ordner vom Regal und gab ihn Faber. »Da stehen aber nur die gegenwärtigen drin, glaube ich. Sobald eine Ersatzlieferung kommt, fliegen normalerweise die alten raus. Sie können sich da niederlassen.« Er wies auf einen Schreibtisch am Fenster. »Die Kollegin kommt frühestens in einer Stunde.«
Faber setzte sich an den Schreibtisch. Er brauchte einige Zeit, um die losen, für eine rasche Auswechslung hergerichteten Blätter durchzugehen, auf denen die Mitglieder der Bundesregierung samt Foto, Wohnort und Geburtsort verzeichnet standen.
Einen Minister oder Staatssekretär, der in N. geboren war oder dort wohnte, fand er nicht. Auch von den leitenden Beamten stammte keiner aus N. Faber schlug die Blätter zurück und wollte sie noch einmal durchgehen, um sich zu vergewissern, daß er in den biographischen Abrissen nicht die Erwähnung eines Studiums an der Universität von N. übersehen hatte. Er gab das auf, weil ihn unversehens der Zweifel am Wert eines solchen Indizes überfiel.
Faber sah eine Weile hinaus auf die Dachgärten der Häuser gegenüber, die Sträucher, Pflanzen und kleinen Bäume, deren Blätter sich in einem sanften Wind bewegten. Als er merkte, daß der Nachrichtenredakteur ihm einen Seitenblick zuwarf, schlug er den Ordner zu, gab ihn zurück und bedankte sich. Auf dem Weg zum Aufzug begegnete ihm ein anderer Bote und die Sekretärin der politischen Redaktion. Faber beschleunigte seinen Schritt. Er drückte ein paarmal auf den Knopf des Aufzugs, der auf einer der unteren Etagen stand und sich nicht bewegen wollte. Faber fluchte. Nach einem Faustschlag auf den Knopf lief er die Treppen bis zum Souterrain hinunter. Er ging ins Archiv der Zeitung.
An einem kleinen Schreibtisch, der unter einem vergitterten Fenster zwischen zwei Bücherregalen stand, fand er den Archivar Engels. Der Archivar, einer der ältesten Mitarbeiter der Zeitung, ein kleiner, magerer Mann mit struppigen Haaren, der stets in einem weißen, glattgebügelten Kittel auftrat, war damit beschäftigt, ein Butterbrot zu essen. Vor ihm auf dem Schreibtisch standen auf einer Serviette die Butterbrotbüchse, eine Thermoskanne und ein Becher.
Faber, der mit Engels die zwiespältige Erfahrung gemacht hatte, daß dieser für einen freien Mitarbeiter nicht unwilliger, aber auch nicht williger tätig wurde als für einen Redakteur, näherte sich mit der gebotenen Rücksicht. »Morgen, Herr Engels. Ich wollte Sie aber nicht beim Frühstück stören.«
»Würden Sie sowieso nicht schaffen. Außerdem war das schon das zweite.« Engels steckte den Rest seines Butterbrots in den Mund. »Wer viel arbeitet, der muß auch viel essen.« Er trank den Becher leer, schraubte ihn auf die Kanne, schloß die Büchse und faltete die Serviette zusammen. »Wo brennt’s denn?«
»Brennen tut’s nicht. Ich wollte nur wissen, ob vor einiger Zeit … ich glaub jedenfalls, mich daran zu erinnern, daß vor nicht allzu langer Zeit ein Mann aus dem Kanzleramt vorzeitig pensioniert worden ist. Weil er krank war, glaube ich. Vor zwei oder drei Jahren.«
»Da haben Sie ausnahmsweise mal recht, Herr Faber.« Der Archivar verstaute seine Ausrüstung in einer Aktentasche, die er unter dem Schreibtisch hervorzog. »Der hatte was am Herz. Keinen Infarkt, aber irgendeine Krankheit haben sie bei einer Untersuchung gefunden, und da mußte er aufhören, von einem Tag auf den anderen.« Er schob die Aktentasche mit dem Fuß unter den Schreibtisch, legte Daumen und Finger um die Wangen. »Aber wie hieß der Kerl noch mal?« Er drückte die Wangen zusammen, ließ ein paarmal die Lippen schnappen. »Irgendwas mit Köhler.«
Faber folgte ihm zu den Schubkästen, in denen die Mappen der Mikrofilme aufbewahrt wurden. Engels fuhr einen der schweren Kästen auf seinen Rollen heraus, ließ den Finger durch die Reiter mit den Namensschildern wandern. »Seit wann schreiben Sie denn für die Politik?«
»Ich schreib nicht für die Politik. Der Fall interessiert mich nur.«
»Wenn Sie das bloß privat wissen wollen, darf ich Ihnen gar keine Auskunft geben.«
»Aber lieber Herr Engels …«
»Nix da, lieber Herr Engels. Beim nächstenmal kommen Sie und wollen wissen, wann Max Schmeling gegen Joe Louis gewonnen hat. Ich kenn das doch. Moment mal!« Er zog eine Mappe heraus, las die Aufschrift. »Das muß er sein. Wie bin ich denn auf Köhler gekommen? Kohlgrüber hieß der.«
Es war eine dünne Mappe. Faber sah dem Archivar über die Schulter. Kohlgrüber, Traugott, Ministerialdirektor.
Engels überließ ihm die Mappe nicht ohne ein mißbilligendes Kopfschütteln. Faber ging zu einem der Lesegeräte und legte das einzige Jacket von Mikrofilmen, das die Mappe enthielt, unter das Objektiv. Während er den Fokus scharf stellte, spürte er, daß sein Puls schneller ging.
Die ersten Meldungen über Kohlgrüber, die das Archiv registriert hatte, waren vor sieben Jahren veröffentlicht worden, durchweg Einspalter in verschiedenen Zeitungen, in denen zu lesen stand, der Ministerialdirigent Traugott Kohlgrüber (45) sei aus dem Verteidigungsministerium in die Planungsabteilung des Kanzleramtes versetzt worden. Kohlgrüber, der seine Laufbahn im Wirtschaftsministerium der Landesregierung in N. begonnen hatte, gelte als Experte in Rüstungsfragen. In seinem neuen Amt solle er vornehmlich den Bundeskanzler auf dem Gebiet der internationalen Rüstungskontrolle beraten.
In den folgenden Meldungen wurde Kohlgrüber jeweils nur beiläufig erwähnt. Die Meldungen waren unter seinem Namen wie unter anderen archiviert worden, weil er als Mitglied von Delegationen, die die Regierung zu internationalen Konferenzen entsandte, genannt worden war. Einmal tauchte er auch als Referent eines Symposiums über neue Strategien der Verteidigung auf.
Vor vier Jahren hatten, wiederum in Einspaltern, mehrere Zeitungen berichtet, Kohlgrüber sei zum Ministerialdirektor befördert worden. Eine Woche später war ein zweispaltiges Porträt veröffentlicht worden, das Kohlgrübers frühes Engagement in der Allianz, der Partei des Bundeskanzlers, erwähnte und ihn einen der Berater nannte, die entscheidend zur Urteilsbildung des Kanzlers beitrügen. Kohlgrüber meide, so hatte der Korrespondent der Zeitung geschrieben, das gesellschaftliche Leben. Nur selten einmal erscheine er mit seiner Frau auf einem der Empfänge der Hauptstadt. In seiner Freizeit widme er sich seiner einzig bekannten Leidenschaft, einer wertvollen Sammlung von Erstausgaben, mit der er schon als Schüler in der Kleinstadt Bracklohe begonnen habe.
Die letzten Berichte über Kohlgrüber waren an einem Tag im August des vorvergangenen Jahres erschienen. Darin hieß es im wesentlichen gleichlautend, der Ministerialdirektor könne sein Amt nicht mehr ausüben, weil er seit einiger Zeit an schweren Herzrhythmusstörungen leide. Er habe zum großen Bedauern des Bundeskanzlers seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragen müssen, die bereits bewilligt worden sei. Unterdessen habe Kohlgrüber eine klinische Behandlung angetreten. Nach deren Abschluß wolle er sich in sein Haus in Fahrenholz, einem ländlichen Ort nahe von N., zurückziehen. Er werde, wenn seine Gesundheit es erlaube, in besonderen Fällen aber auch weiterhin dem Bundeskanzler als Berater zur Verfügung stehen.
Faber schaltete das Lesegerät aus und ging zu Engels, der an einen großen Schreibtisch umgezogen war und eine Zeitung vor sich ausgebreitet hatte. »Kann ich mir ein paar Fotokopien machen, Herr Engels?«
»Stück zwei Mark fuffzig.«
Als Faber die letzte Seite des Jackets belichtete, kam Engels zu ihm. »Das sind doch mindestens zehn Blatt.«
Faber nahm die Kopien aus dem Apparat und zählte sie. »Das sind genau fünf. Und dafür wollen Sie Geld haben?«
»Gehen Sie ganz schnell. Aber beim nächstenmal bezahlen Sie, das sag ich Ihnen.«
Auf der Treppe zum Erdgeschoß blieb Faber stehen. Er nahm die Kopien aus der Tasche, faltete sie auf, überflog die ersten Blätter und las noch einmal die Berichte über Kohlgrübers Abschied. Erst als er Schritte hörte, die sich näherten, stieg er die letzten Stufen zum Erdgeschoß empor. Er hatte den Ausgang des Zeitungshauses schon erreicht, als er umkehrte. Die Tür des Aufzugs wollte eben zugleiten, Faber fing sie mit beiden Händen ab und zwängte sich hinein.
Die Tür zum Sekretariat der Kulturredaktion stand offen, schon auf dem Flur hörte Faber die Stimme der Sekretärin, die anscheinend einen lästigen Anrufer abzuwimmeln versuchte. Er trat ein, nickte der Sekretärin zu, die die Augen verdrehte, um ihm zu bedeuten, daß der Anrufer nicht lockerließ. Durch die offenstehende Tür zum Zimmer nebenan sah Faber den Ressortleiter März, der hinter seinem Schreibtisch saß und ebenfalls telefonierte. März hob die Hand, Faber erwiderte den stummen Gruß. Er beeilte sich, die Gelegenheit zu nutzen, gab der Sekretärin durch Gesten zu verstehen, daß er ein Telefongespräch führen müsse, sie nickte.
Faber ging zwei Zimmer weiter und setzte sich an den Schreibtisch des Fernsehredakteurs. Er zog sein Notizbuch heraus und wählte die Telefonnummer, die hinter dem Namen Manthey verzeichnet stand, dem Namen des Redakteurs, der das Kulturressort der Lokalzeitung von N. leitete und hin und wieder einen Beitrag von Faber druckte. Während er die Nummer wählte, versuchte Faber, die Erklärung des Anrufs, die er sich zurechtgelegt hatte, beschleunigt zu rekapitulieren und zu überprüfen. Er fühlte sich ertappt, als die saftige Stimme Mantheys sich sofort meldete.
»Tag, Manfred. Hier ist Alexander Faber.«
»Alex, mein Freund! Wie geht es dir? Hast du was Schönes anzubieten?«
»Im Augenblick nicht.« Faber räusperte sich. »Ich hab bloß eine private Frage. Tut mir leid, daß ich dich damit so überfalle.«
»Das macht doch nichts. Solange du mich nicht anpumpen willst, stehe ich jederzeit zur Verfügung.«
»Nein, nein.« Faber lachte. »Es geht zwar um Geld, aber nicht um meins. Leider.«
»Aha. Und womit kann ich dienen?«
»Also, um dir erst mal zu erklären, um was es geht … Ich hab eine Bekannte, die eine Erbschaft gemacht hat.«
»Das möchte ich auch. Wo ist das Problem? Will sie dir nichts abgeben?«
»Langsam, langsam.« Faber lachte. »Es ist wirklich nur eine Bekannte. Irgendein alter Freund von ihr, der in der Nähe von N. gewohnt hat und vor ein paar Wochen gestorben ist, hat sie in seinem Testament bedacht. Aber da gibt’s auch ein paar Großnichten und Großneffen und wer weiß was noch, und die fechten jetzt das Testament an.«
»Täte ich auch. Warum sollen die denn für die schönen Stunden büßen, die der alte Lustmolch sich genehmigt hat?«
Faber lachte. »Laß mich doch mal ausreden!«
»Rede, Alex, rede!«
»Meine Bekannte bekommt also mit dem Nachlaßgericht in N. zu tun. Und nun ist ihr ein Anwalt aus N. empfohlen worden, der angeblich in solchen Fällen sehr ordentlich arbeitet.«
»Wie heißt der Rechtsverdreher denn?«
»Einen Augenblick …« Faber tat, als blättere er nach dem Namen. Nach einer kleinen Pause sagte er: »Dr. Erwin Meier-Flossdorf.«
»Ach ja, Erwin! Das hätte ich mir fast denken können.«
»Kennst du den?« Faber griff nach einem Notizzettel und begann zu schreiben.
»Das bleibt einem in N. nicht erspart, mein Lieber. Erwin spielt hier den großen Zampano. Stadtverordneter der Allianz, Vorsitzender des Kulturausschusses, wuselt auch im Landesvorstand der Partei, tanzt auf allen Hochzeiten. Wenn du dir nicht zu fein wärest, unsere schöne Stadt zu besuchen, könntest du ihn übrigens am übernächsten Wochenende in voller Größe besichtigen. Sag mal, das wäre doch überhaupt eine Gelegenheit, da könnten wir endlich mal wieder gemeinsam einen zur Brust nehmen!«
»Ja, das wäre nicht schlecht. Und wo könnte ich den Herrn besichtigen?«
»Auf dem Landesparteitag der Allianz, da bringt Erwin das sensationelle Kulturprogramm ein, Sekunde mal«, er ächzte, »irgendwo hab ich doch die Einladung herumliegen.«
»Was denn für ein Kulturprogramm?«
»Na, das ist doch überhaupt das Größte, seit zwei Jahren basteln die daran, als Landespartei, mußt du dir vorstellen, ja, hier hab ich’s, hör dir das Motto an: Ein Bundesland beweist Kultur, damit wollten die sich ein ganzes Wochenende lang beschäftigen, aber jetzt ist ihnen ihr Landesvorsitzender weggestorben, sie müssen auf dem Parteitag einen neuen wählen und die Kulturdebatte abkürzen, Erwin wird stocksauer sein.«
Faber sah, daß März sich näherte. Er sagte: »Entschuldige, Manfred, aber ich muß Schluß machen. Kannst du mir ein paar Unterlagen über diesen Parteitag schicken?«
»Du bist aber wirklich ein bißchen pervers. Na bitte sehr, ich schick dir was, damit du dich daran weiden kannst.«
März blieb in der offenen Tür stehen, legte die Hand an den Rahmen.
Faber sagte: »Sehr schön. Ich bedanke mich, und bis bald mal wieder.« Er wollte den Hörer auflegen, als er Manthey schreien hörte: »He, he, was ist denn!« Faber nahm den Hörer wieder ans Ohr: »Ja?«
»Du wolltest doch wissen, ob ich Erwin deiner Freundin empfehlen kann, oder hast du das vergessen?«
»Nein, nein, natürlich nicht.«
»Warum willst du dann auflegen? Also, wenn du mich fragst: Erwin würde ich nicht nehmen. Der macht viel zu viel. Und wahrscheinlich würde er zu so einem Fall ohnehin einen von seinen jungen Männern abkommandieren. Ich würde an deiner Stelle …«
Faber ließ ihn nicht ausreden. »Das hilft mir sehr. Noch einmal herzlichen Dank.« Er legte auf.
März kam herein. Faber sagte: »Entschuldigung, das ist ein sehr ergiebiger Informant, aber leider ziemlich zeitraubend.«
März schüttelte den Kopf. »Nichts zu entschuldigen. Es tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe. Aber ich muß zu einem Termin und wollte Sie vorher noch etwas fragen.«
»Ja?« Faber steckte sein Notizbuch und die Zettel, die er während des Telefonats beschrieben hatte, in die Tasche.
»Haben Sie morgen abend schon etwas vor?« März lächelte. »Ich weiß, es ist leider wieder mal der Samstagabend.«
»Ja.« Faber zögerte. Dann sagte er: »Nein, ich hab noch nichts vor.«
»Wunderbar. Das heißt, so wunderbar ist es natürlich nicht. Die Frau Rudolf ist krank geworden. Könnten Sie die Premiere im Studio übernehmen?«
Faber nickte. »Ja, gut. Mache ich.«
»Danke. Ich werde Herrn Leistenschneider Bescheid sagen. Der hat am Sonntag Dienst.« März hob die Hand und ging.
Faber blickte ihm nach. Dann nahm er die Zettel aus der Tasche. Er sah sie durch und machte sich daran, ein paar überhastet geschriebene Stellen, die schwer zu entziffern waren, zu verdeutlichen. Plötzlich sprang er auf, raffte die Zettel zusammen und ging eilig ins Sekretariat.
März stand bereits an der Tür. Faber fragte: »Haben Sie eigentlich den Parteitag in N. besetzt? Den von der Allianz?«
März sah ihn verständnislos an. »Parteitag in N.?«
»Ja, da soll doch ein Kulturprogramm verabschiedet werden. Ich find das ganz interessant, daß eine Landespartei ein eigenes Kulturprogramm entwickelt.«
»Ach richtig!« März schüttelte den Kopf. »Na, sagen Sie mal, ist das denn nicht eine abstruse Idee?«
»Finden Sie?«
März lächelte. »Ich muß gestehen, ich hab die Einladung weggeworfen. Allerdings bin ich auch davon ausgegangen, daß der Herr Knabe für die Politik da hingeht, der hat sein Büro ja in N. Und wahrscheinlich wird der auch was über dieses Kulturprogramm machen.«
»Na gut. Ich wollte Sie nur gefragt haben.« Während März noch nachdachte, sagte Faber: »Ich bin drauf gekommen, weil mich zwei Sender angerufen haben, die an einem Kommentar oder einem Feature interessiert wären.«
März hob die Schultern: »Also, wenn Sie sowieso hinfahren, dann können Sie uns natürlich auch was anbieten.«
Faber nickte. »Gern. Wenn ich tatsächlich hinfahre. Ich muß zuvor noch einiges klären.«
3
Was immer es zu klären gab, Faber schob es auf. Die unangenehme Vermutung, daß er nicht nach Hause gehen wollte, weil er fürchtete, Kirsten könne auf den Gedanken kommen, ihn anzurufen, um ihn ins Verhör zu nehmen, verdrängte er, indem er sich durch einen Blick aus dem Fenster davon überzeugte, daß die Sonne noch immer schien und es dringend geboten war, das schöne Wetter zu nutzen. Er ließ sich im Botenzimmer eine Zeitung geben, ging hinaus auf die Straße und setzte sich an einen der Tische des Cafés.
In der Zeitung fand er die Anzeige eines Films, von dem sich behaupten ließ, er müsse ihn gesehen haben. Die nächsterreichbare Vorstellung begann in einer halben Stunde, und da Faber ohnehin nicht allzu lange vor den Fenstern der Redaktion wie ein Müßiggänger, der sich um seinen Broterwerb nicht zu kümmern braucht, in der Sonne sitzen wollte, ließ er es bei einem Cappuccino bewenden, zahlte und machte sich auf den Weg zum Kino.
Der Film, dessen Qualitäten er schon nach der ersten Viertelstunde erheblich überschätzt fand, bot ihm nicht die Ablenkung, die er davon erhofft hatte. Zwar gelang es Faber einige Male, das Rätsel, in welchem Zusammenhang Kohlgrüber, Meier-Flossdorf und der Schöpfer des Dr. Stahl stehen mochten, als zur Stunde nicht lösbar abzuschieben. Aber um so nachdrücklicher meldete sich plötzlich die Erinnerung, daß er sich verpflichtet hatte, der Redaktion einer Wochenzeitung für deren nächste Ausgabe einen Beitrag zum 80. Geburtstag eines Literaturwissenschaftlers zu liefern, zu dessen Schülern Faber gehört hatte, bevor er sein Studium abbrach. Zwei Drittel des Artikels hatte er schon vor ein paar Tagen geschrieben, die Arbeit, die ihn deprimierte, dann jedoch liegengelassen, und wenn er halbwegs sichergehen wollte, daß der Brief spätestens zum Redaktionsschluß am Montag eintreffen würde, mußte er ihn an diesem Abend noch aufgeben.
Faber blieb desungeachtet eine Weile sitzen. Er sah auf die Leinwand, ohne den Film wahrzunehmen. Unverhofft hatte ihn ein neuer Gedanke zuversichtlicher gestimmt, die Überlegung nämlich, Kirstens schroffe Reaktion auf seine Analyse der Möglichkeiten, die in dem Epos von Peter Stahl steckten, wäre weniger schroff, weniger verletzend ausgefallen, wenn er ihr zur Einleitung nicht ausgerechnet die Passage über die Klinik in Venlo zu lesen gegeben hätte. Er hatte offenbar unterschätzt, wie schwer die Erinnerung an dieses Haus Kirsten belastete.
Freilich war es ihre Entscheidung gewesen, die Schwangerschaft abzubrechen, er hatte ihr weder den Vorschlag gemacht noch ihr zugeredet, wenn auch der bloße Gedanke an die Komplikationen, mit denen er hätte fertig werden müssen, wenn das Kind geboren worden wäre, ihm Angst eingejagt hatte. Er hatte ihr lediglich nicht widersprochen, als sie zugleich mit der Eröffnung, sie sei schwanger, ihm ihre Entscheidung mitteilte. Wie hätte er denn auch die Begründung widerlegen können, sie müsse, wenn sie die Schwangerschaft nicht abbreche, ihr Examen auf unbestimmte Zeit aufschieben, wenn nicht für immer darauf verzichten?
Er hatte ihr auch nicht widersprochen, als sie von dem ersten Termin bei einem Arzt, den sie um die Anerkennung einer sozialen Indikation des Abbruchs gebeten hatte, voller Empörung zurückkam und erklärte, einer solchen Demütigung werde sie sich nicht ein zweitesmal aussetzen. Er hatte durchaus verstanden, daß sie die Aufforderung des Arztes, sie solle sich die Tragweite eines solchen Schrittes doch noch einmal gründlich überlegen, als Bevormundung empfand, als die beleidigende Unterstellung, sie habe sich zuvor keine Gedanken darüber gemacht. Und nicht zuletzt hatte er verstanden, daß sie über ein Recht, das der Staat, in dem sie aufgewachsen war, ihr gewährt hätte, nicht mit sich handeln lassen mochte.
So war er dann auch nur ihrem Wunsch und ihrer eigenen Entscheidung gefolgt, als er die Regelung des Problems in die Hand genommen und die Adresse in Holland ausfindig gemacht hatte. Die Konditionen und den Termin des Eingriffs hatte hinwiederum nicht er, sondern Kirsten selbst mit dem Sekretariat der Klinik verabredet. Er hatte sie lediglich nach Venlo gebracht und dort gewartet, bis sie wieder ins Auto steigen konnte. Seine eigenen Empfindungen während der Wartezeit waren zu verworren gewesen, als daß er darüber hätte sprechen wollen. Und daß sie selbst weder auf der Rückfahrt noch später einmal sich äußerte über das, was sie bei dieser Reise nach Venlo erlebt hatte, war ihm nicht nur der Bequemlichkeit halber willkommen gewesen; er hatte es auch als den zu respektierenden Beschluß verstanden, das Thema als erledigt zu betrachten und es der Vergangenheit zu überantworten.
Er mußte sich getäuscht haben. Sie trug offenbar noch immer an dieser Erinnerung, vielleicht sogar um einiges schwerer als er selbst.
Faber verließ das Kino und fuhr nach Hause. Er fühlte sich ermutigt durch die Hoffnung, Kirsten werde, wenn er sich noch einmal und diesmal verständnisvoller für sein unbedachtes Vorgehen entschuldigte, in der Lage sein, über sein Gedankenexperiment mit diesem fragwürdigen Roman in Ruhe und sachlich zu diskutieren. Immerhin hatte er mittlerweile den so plötzlich pensionierten Kohlgrüber aufgespürt, seine Spekulation war also offenbar nicht so schockierend haltlos, wie sie ihr in der gefühlsbeladenen Situation des Vorabends erschienen sein mochte.
Fabers Hoffnung verlor sich, je näher die Stunde rückte, in der Kirstens Dienst im Büro eines Architekten in der Regel beendet war. Wenn sie tatsächlich anrufen sollte, würde sie – die Vermutung beunruhigte ihn immer mehr – vor allem anderen ihn fragen, ob er noch immer plane, die Identität von Helmut Michelsen zu enthüllen. Faber konzentrierte sich darauf, seinen Artikel für die Wochenzeitung möglichst schnell zu beenden. Er begnügte sich immer häufiger schon mit der ersten Formulierung, die ihm einfiel, unterdrückte, als er die letzte Zeile in den Computer geschrieben hatte, den Gedanken, es müsse sich ein besserer Schluß finden lassen, druckte den Artikel aus, überflog ihn, steckte ihn in den Umschlag und verließ damit die Wohnung.
Auf der Treppe glaubte er das Rufzeichen des Telefons zu hören. Er kehrte noch einmal zurück, lauschte an der Wohnungstür und stellte erleichtert fest, daß er sich getäuscht hatte.
Der Himmel war noch immer klar, aber es dämmerte schon. Faber brachte den Brief zu einem Kasten, der am nächsten Morgen geleert werden würde. Er blieb eine Weile vor dem Briefkasten stehen, sah die Straße auf und ab, in der die Menschen unterwegs waren, um ihre Einkäufe fürs Wochenende zu erledigen. Faber überlegte, was er selbst noch bis zum Montag brauche. Ihm fiel einiges ein, aber schließlich wandte er sich in die Richtung, die von seiner Wohnung wegführte, und ging an allen Läden vorbei.