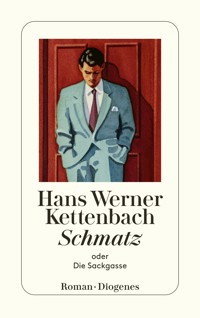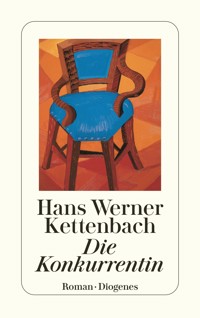9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine sehr junge Frau begegnet Kamp, der vom Leben schon lange nichts mehr erhofft. Kamp versteht nicht, warum Claudia immer wieder zu ihm kommt. Er argwöhnt, dass ein krimineller Plan dahintersteckt, und als Claudia wieder einmal untertaucht, sieht er sich bestätigt. Kamp beschließt, die törichten Hoffnungen zu begraben und sich aufs Sterben einzurichten. Aber Claudia kommt zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hans Werner Kettenbach
Sterbetage
Roman
Die Erstausgabe erschien 1986
im Diogenes Verlag
Covermotiv: Gemälde von Henri Matisse,
›La Leçon de Peinture‹, 1919
Copyright © Succession H. Matisse / 2021, ProLitteris, Zürich
Foto: © National Galleries Scotland, Bequeathed by Sir Alexander Maitland 1965
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2022
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21644 8
ISBN E-Book 978 3 257 60104 6
[5] 1
Kamp wacht auf gegen zwei in der Nacht. Nichts Beunruhigendes, nur das Übliche. Der Schlaf ist von ihm gewichen, lautlos, von einer Sekunde zur anderen. Vielleicht war es ein böser Traum, was ihn vertrieben hat. Aber Kamp weiß sich auch dieses Mal nicht zu erinnern. Der Schlaf hat nichts zurückgelassen.
Kamp lauscht. Das Hochhaus ist still. Er hat einmal ausgerechnet, daß es mindestens einhundertfünfzig lebende Menschen sein müssen, die in diesem Wabenbau sich jede Nacht zur Ruhe betten. Wo zwei beieinander schlafen, kann einer, wenn er erwacht, des anderen Atemzüge hören. Aber bis in Kamps Wabe dringt kein Laut. Die Aufzüge hängen regungslos in ihren finsteren Schächten. Es muß schon endlos lange her sein, daß die letzte Wohnungstür zugeschlagen ist, der Riegel des Sicherheitsschlosses ist eingeschnappt, ein Geräusch wie ein Schuß, der auf den Korridoren verhallt.
Vielleicht wird ein Zug die Brücke überqueren. Um diese Zeit sind die Güterzüge unterwegs. Stünde Kamp auf und sähe er aus dem Fenster, dann könnte er den nächsten vielleicht schon entdecken, die Stirnlampen der Lokomotiven ziehen ihre Bahn quer durch die stillen Lichter der Stadt. Aus der Höhe von Kamps Balkon ist das Rollen und Schlagen der schwarzen Räder nicht zu hören, aber sobald sie auf die Brücke fahren, rührt sich das Gitterwerk der Bögen, es dröhnt und singt. Kamp kann es hören wie einen Orgelton von weither.
Kamp hebt den Kopf. Als der Orgelton einsetzt, steht er auf. Er will nicht warten, bis die Brücke wieder verstummt, [6] die Stille sich wieder auf seine Ohren legt und ihn bei lebendigem Leibe begräbt. Er tritt an die Balkontür, die scharfe Januarluft beißt seine Haut.
Gut drei Stunden wird es noch dauern, bis unten auf den Parkplätzen eine Autotür zugeschlagen wird und der erste Motor zu näseln beginnt. Vier Stunden, bis die Zeitung im Briefkasten liegt. Kamp reibt sich die Brust und die Arme. Dann zieht er sich an.
Er verstaut den Wollschal fest im Mantel, setzt die Pelzmütze auf und streift die gefütterten Handschuhe über. Bevor er die Wohnungstür schließt, nimmt er den Handschuh der Rechten wieder ab, er zieht die Tür behutsam ins Schloß, und den Schlüssel hält er ganz fest, während er ihn umdreht, der Riegel soll nicht lärmen.
Ist es nur Rücksicht auf den Schlaf der anderen? Die Frage belästigt ihn wieder, im Aufzug denkt Kamp darüber nach. Er senkt den Kopf, betrachtet die Spitzen seiner Schuhe. Und wieder erinnert er sich, daß er das früher jeden Morgen getan hat, wenn er hinunterfuhr. Er wußte, daß seine Schuhe blank waren, aber er konnte es nicht lassen, sich im Aufzug dessen noch einmal zu vergewissern. Lächerlich.
Und was ist das jetzt?
Er weiß, daß es ihm unangenehm wäre, einem seiner Hausgenossen zu begegnen, auch wenn er ihn nicht einmal flüchtig kennte. Selbst einem Betrunkenen würde Kamp jetzt nicht gern begegnen. Es ist nichts Ungewöhnliches, es ist jedenfalls erklärlich, wenn ein Mensch nachts um zwei betrunken nach Hause kommt. Aber warum sollte ein Mensch nachts um zwei seine Wohnung verlassen? Ist es normal, um diese Zeit spazierenzugehen?
Was für ein Mensch muß das sein, der in der Schlafenszeit spazierengeht, in einer bitterkalten Nacht?
Niemand begegnet Kamp. Er tritt hinaus, legt eine Hand gegen die Haustür und läßt sie langsam ins Schloß gleiten. Bevor er die Außentreppe hinuntergeht, sieht er sich um. Er [7] zieht die Luft ein. Es riecht nach Schnee. Er geht die Treppe hinunter, zählt automatisch die Stufen, die sieben Schritte bis nach unten. Dann geht er in Richtung des Friedhofs, den Schotterweg am Spielplatz vorbei. Die Lichtkreise der Laternen kommen ihm vor wie Inseln, und jedesmal, wenn er eine der Inseln hinter sich läßt, muß er die schwarze Nacht durchqueren, die aus den Büschen fließt.
Schnee wäre schön. Schneefall, Flocken, die wie ein endlos sinkender Schleier die alte Welt verhüllen und über Nacht ihr ein neues, sanftes Gesicht verleihen. Den ganzen vergangenen Winter hat es nicht geschneit. Kamp hat Woche um Woche darauf gewartet, aber die Veränderung wollte sich nicht einstellen, die Welt war jeden Morgen genau so nackt und grau wie am Tag zuvor.
Tiefer Schnee, und die Welt ist nicht wiederzuerkennen. Als Kamp Schritte hinter sich hört, hat er Mühe, sich zurechtzufinden, einen Augenblick lang wundert es ihn tatsächlich, daß die Schritte nicht gedämpft und knirschend klingen, sondern spitz und hart auf den Schotter des Weges stoßen. Er wendet den Kopf und sieht auf der zurückliegenden Insel eine schnell sich nähernde Gestalt. Es könnte eine Frau sein. Er blickt wieder nach vorn.
Die Schritte werden schneller, sie überholen ihn. Kamp wirft einen Blick zur Seite. Eine sehr junge Frau, ein Mädchen eher noch, sie sieht starr geradeaus, legt, als sie Kamp passiert, ein paar Laufschritte ein, die Haare wehen. Sie trägt keinen Mantel, nur eine kurze Jacke, eine enganliegende, dünne weiße Hose, Stiefeletten.
Kamp geht langsamer. Er will ihr nicht Angst einjagen. Es sieht so aus, als hätte sie schon Angst. Was tut sie um diese Zeit auf diesem Weg? Der Weg führt zum Friedhof.
Kamp bleibt stehen. Er überlegt, wieviel Vorsprung er ihr lassen soll, als er sieht, daß das Mädchen den Schritt verlangsamt. Sie überquert die nächste Insel, bleibt im Halbdunkel dahinter stehen. Dann setzt sie sich auf die Bank zwischen [8] den Büschen. Kamp erkennt die Beine in der weißen Hose. Sie schlägt die Beine übereinander.
Ein Strichmädchen. Der Gedanke übt einen jähen Reiz auf ihn aus, er starrt auf das schwärzliche Gestrüpp zu seiner Seite, und ihm ist, als sähe er satte Farben daraus hervorbrechen, die ineinander verlaufen, ein feuchtes Rot quillt über und breitet sich aus. Kamp streicht sich über die Augen. Er ruft sich zur Ordnung. Er wendet sich ab und geht zurück.
Am Fuß der sieben Stufen bleibt er stehen. Er ist mit sich unzufrieden. Warum sollte ein Strichmädchen ihn davon abhalten, seinen Weg zu gehen, am Friedhof vorbei, Grabsteine hinter der Hecke, danach die schmale Straße hinunter zum Fluß und das Ufer hinab bis zur Brücke, schwarzes, gurgelndes Wasser am Pfeiler, und weiter, noch weiter?
Er geht ein paar Schritte auf und ab. Wäre sie ein Strichmädchen, dann hätte sie ihn angesprochen. Sie hätte ihn wenigstens angesehen, im Vorübergehen angelächelt. Sie wäre langsamer gegangen. Aber sie ist an ihm vorbeigelaufen, als hätte sie Angst.
Kamp macht sich wieder auf den Weg zum Friedhof. Der Gedanke beunruhigt ihn, daß sie verschwunden sein könnte, die Nacht hat sie verschluckt, was mag aus ihr geworden sein? Er geht ein wenig schneller.
Schon von weitem sieht er die Beine in der weißen Hose. Sie sitzt noch immer auf der Bank. Sie wird sich den Tod holen. Ein rötlicher Lichtpunkt glüht auf. Sie raucht.
Kamp wartet darauf, daß sie ihn ansieht, während er sich der Bank nähert. Er wird sie anlächeln, aber keinen Zweifel daran lassen, daß er seines Weges gehen will, ein flüchtiges Nicken vielleicht, das Lächeln, um ihr klarzumachen, daß sie von ihm nichts zu befürchten hat.
Aber sie sieht ihn nicht an. Sie sieht starr geradeaus, zieht an ihrer Zigarette, nimmt keine Notiz von ihm. So hat es Kamp schon ein paar Schritte an der Bank vorübergetrieben, als er sich überwindet und stehenbleibt. Er wendet sich [9] zurück und sagt: »Entschuldigen Sie, es geht mich nichts an. Aber Sie sollten da nicht sitzen bleiben. Es ist wirklich zu kalt.«
Sie zieht an ihrer Zigarette.
Kamp sagt: »Sie werden sich den Tod holen.«
Sie sagt, ohne ihn anzusehen: »Das ist doch mein Problem, oder?«
»Natürlich ist das Ihr Problem. Aber was hat das für einen Sinn, wenn Sie sich hier den Tod holen?«
Sie läßt den Zigarettenstummel fallen, setzt die Sohle darauf und dreht sie, verschränkt die Arme und sagt: »Hau ab.«
Kamp will in einem Anflug von Zorn sich abwenden und weitergehen, als er die Tränenspuren auf ihren Wangen erkennt, sie schimmern auf, als sie sich mit verschränkten Armen zurücklehnt. Kamp zögert. Dann sagt er: »Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
Sie sieht ihn an. »Bist du schwerhörig, Opa? Ich hab gesagt, du sollst abhauen.«
Kamp sieht sie schweigend an.
Sie sagt: »Du glaubst doch wohl nicht, daß du mich auf eine so blöde Tour anmachen kannst. Hau ab und geh zu deiner Else.« Sie wirft den Kopf zur Seite, die Haare wehen.
Kamp wendet sich ab und geht. Als er die Friedhofsecke erreicht, hört er hinter sich die spitzen, harten Schritte, sie läuft hinter ihm her. Er geht weiter. Sie holt ihn ein, paßt sich seinem Schritt an, geht neben ihm, ohne ihn anzusehen. Nach einer Weile sagt sie, ihr Atem geht schnell: »Entschuldigen Sie, ich hab’s nicht so gemeint.« Sie hebt das Gesicht, sieht ihn an: »Können Sie mir sagen, wie ich zur Straßenbahn komme?«
»Das geht hier lang. Ich werd’s Ihnen zeigen.« Er geht noch ein paar Schritte, bleibt dann stehen und hält seine Uhr vor die Augen. »Aber um diese Zeit bekommen Sie keine [10] Straßenbahn. Ich weiß nicht, wann die erste geht. Jedenfalls nicht vor zwei Stunden.«
Sie sieht die düstere Friedhofshecke entlang. »Scheiße.«
»Das hilft Ihnen auch nicht. Sie frieren doch jetzt schon wie ein Schneider.«
Sie verschränkt die Arme, nickt: »Saumäßig.«
Kamp schüttelt den Kopf. Dann sagt er: »Vielleicht haben Sie Glück und erwischen ein Taxi. Der Taxistand ist gleich neben der Haltestelle. Ich kann Sie hinbringen, wenn Sie wollen.«
Sie nickt, ohne ihn anzusehen. »Ja.« Aus der Jackentasche zieht sie ein Taschentuch, sie wischt die feuchten Spuren von den Wangen, schneuzt sich laut, wischt unter den Augen her und noch einmal über die Wangen bis hinab zum Kinn. Sie verstaut das Taschentuch wieder. »Aber ich hab kein Geld dabei. Hab keins eingesteckt.«
»Ach so.« Kamp weiß, daß er unausweichlich in Verlegenheit geraten wird, schon steigt die Scham in ihm auf, er will sie nicht wahrhaben, schaut auf zum schwarzen Himmel, spürt eine Schneeflocke auf seinem Gesicht, sieht die nächsten heruntersinken. »Jetzt fängt es auch noch an zu schneien.«
Sie legt den Kopf in den Nacken. »Tatsächlich.« Dann sieht sie ihn an. »Ich weiß nicht. Ich hab mich ja bei Ihnen bestimmt nicht beliebt gemacht. Aber könnten Sie mir vielleicht was leihen? Zehn Mark würden langen, glaube ich. Für das Taxi.«
Kamp will etwas sagen, aber er bringt es nicht heraus, er räuspert sich heftig.
Sie sagt: »Ich geb Ihnen meine Adresse, und Sie geben mir Ihre Adresse, ich schick’s Ihnen morgen zurück. Oder bringe es vorbei. Sie können sich darauf verlassen.«
»Das brauchen Sie nicht zu sagen, ich glaub Ihnen.« Kamp muß sich noch einmal räuspern. »Aber ich hab auch nicht so viel dabei.« Seine Stimme verliert sich in einem Murmeln: »Ich will gern einmal nachsehen«, er knöpft den Mantel auf, [11] schlägt ihn zurück und zieht das Portemonnaie aus der Hosentasche. Er geht ein paar Schritte bis unter die nächste Laterne, öffnet das Portemonnaie und schiebt mit einem Finger die Münzen hin und her. »Nein, das reicht nicht.« Er hält ihr das Portemonnaie entgegen, versucht zu lachen. »Sieben Mark und ein paar Groschen. Es tut mir leid.«
Sie kommt langsam heran, mit verschränkten Armen, leicht vornübergebeugt, sie streckt die Knie nicht beim Gehen. Sie schüttelt den Kopf. »Macht doch nichts. War auch eine ziemlich blöde Frage.«
»Ach was. Das ist schon in Ordnung. Ist doch selbstverständlich. Ich hätte Ihnen ja gern geholfen.« Er könnte den Fall damit auf sich beruhen lassen, was geht ihn dieses Mädchen an, vorhin noch hat sie ihn behandelt wie ein Stück Dreck, so sind sie, diese großmäuligen, rücksichtslosen, egoistischen Kinder. Kamp möchte gern zornig werden, um endlich gehen zu können. Aber er weiß schon, daß er nichts auf sich sitzen lassen wird, nicht den Schatten eines Verdachts, nicht den geringsten Anlaß für einen verächtlichen Gedanken. Er muß auch das noch sagen: »Es ist wirklich dumm, aber ich habe auch zu Hause kein Geld mehr.«
Sie nickt.
Er sagt: »Ich wollte morgen früh zur Sparkasse gehen. Um Geld abzuheben.«
»Klar.« Sie sieht auf zum Himmel. Die Flocken fallen dichter. Hier und da setzt sich eine auf die schulterlangen, dunkelblonden, strähnigen Haare, auf die dunklen Augenbrauen, die Wimpern. Ein kleiner Mund, sie preßt die Lippen fest zusammen, ein rundes Kinn. Kamp glaubt im matten Licht der Laterne zu erkennen, daß es angeklebte Wimpern sind, sie sind sehr lang. Sie fährt mit den Fingerspitzen über die Brauen und den Haaransatz, schüttelt heftig die Haare. »Zeigen Sie mir noch den Weg zur Straßenbahn?«
»Natürlich.« Aber Kamp bleibt stehen. Plötzlich streift er den Handschuh ab, knöpft den Mantel wieder auf. »Jetzt [12] ziehen Sie zuerst mal meinen Mantel über, damit Sie sich wenigstens ein bißchen aufwärmen.«
»Kommt gar nicht in Frage.« Sie geht voraus, bleibt stehen, winkt ihm. »Kommen Sie. Und knöpfen Sie den Mantel zu. Wollen Sie sich auch noch was holen?«
Eine Weile gehen sie stumm nebeneinander. Dann sagt sie: »Wie kommen Sie denn jetzt nach Hause?«
»Ich wohne gleich da hinten.« Er hebt den Daumen über die Schulter: »Da, wo Sie hergekommen sind.«
»Ach da?« Sie sieht ihn an. »Und warum sind Sie mitten in der Nacht unterwegs?« Sie lacht. »Haben Sie Streit mit Ihrer Frau?«
Kamp sagt: »Meine Frau ist tot.« Er räuspert sich. »Ich konnte nicht schlafen.«
»Entschuldigung. Tut mir leid.« Sie schüttelt die Haare. »Ich hab wirklich nicht meinen stärksten Tag.«
»Das war nicht schlimm. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.« Nach einer Weile sagt er: »Sie ist schon lange tot.«
Noch fünfzig Schritte, sechzig höchstens bis zur Straße hinter dem Friedhof. Bald werden sie den unebenen Gehsteig erreicht haben, festgestampfte Erde unter einer dünnen Lage Splitt, die Körner glitzern im Laternenlicht. Gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, das Gitter des Schulhofs. Vielleicht tragen die kleinen Backsteinsäulen, die das Gitter halten, schon weiße Mützen, wenn er zurückkommt. Aber er muß gar nicht bis zur Haltestelle mit ihr gehen. Es genügt, wenn er sie bis zur Ecke der Schule bringt, hohe, alte Fenster, schwarz und tot, und ihr den Weg weist, sie kann ihn gar nicht verfehlen, die Querstraße immer geradeaus und an der Ampel links.
Er mag diese Querstraße nicht. Sie ist eng und doch so öde, die nackten Fassaden der Neubauten, dazwischen die unbebauten Grundstücke, einst Gärten, in manchen werden noch immer die Kohlköpfe in Reihen gezogen. Im Herbst, unter [13] dem nassen Himmel, schlägt einem der strenge Geruch in die Nase.
Der Schnee wird die Öde zudecken und begraben.
Noch zwanzig Schritte bis zur Straße, zehn nur noch. Die Flocken stieben schon im Lichtkreis der Laterne über dem Schulhof.
Kamp bleibt stehen. Sie geht noch ein paar Schritte, bleibt stehen, sieht ihn fragend an.
Kamp sagt: »Ich weiß nicht, ob Sie das wollen, aber…«
»Was denn?«
»Sie könnten mit zu mir kommen. Und warten, bis die erste Straßenbahn fährt.«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein. Das möchte ich nicht.«
»Sie werden sich wirklich den Tod holen. In einer halben Stunde ist alles zugeschneit.«
Sie wendet sich ab und geht weiter. »Ich hab doch gesagt, daß ich nicht möchte.«
Er schließt zu ihr auf. Er geht mit ihr über den glitzernden Gehsteig, überquert mit ihr die Straße und führt sie am Gitter der Schule vorbei. An der Ecke bleibt er stehen. Er weist die Querstraße hinunter, noch ist sie schwarz und naß. »Sie müssen immer geradeaus gehen, dann kommt eine Ampel, da biegen Sie nach links ab. Und dann können Sie die Haltestelle schon sehen. Es ist nicht sehr weit.«
Sie nickt, sieht die Straße hinunter. Sie streicht die nassen Haare zurück. Kamp sagt: »Also, kommen Sie gut nach Hause.« Sie nagt an der Unterlippe. Dann sieht sie ihn an und sagt: »Vielleicht gehe ich doch besser mit Ihnen.«
Kamp atmet schwer auf, hebt den Blick zum Himmel. Er möchte ihr am liebsten sagen, daß sie sich nicht jede Minute etwas anderes einfallen lassen kann und daß er es jetzt leid ist und sie sehen soll, wo sie bleibt. Er hat sich schon erleichtert gefühlt. Es hat ihn zwar geärgert, daß sie sein Angebot ausgeschlagen hat, als sei es eine Zumutung, aber die Aussicht, sie loszuwerden und sich sagen zu können, sie habe es [14] nicht anders gewollt, hat ihn zugleich erleichtert. Nun bedrückt ihn die Ahnung, daß er sich auf eine Situation eingelassen hat, die Verwicklungen hervorbringen und ihm zu schaffen machen wird. Kamp ist zornig, auf dieses Mädchen und auf sich selbst.
Sie sagt: »Mir ist wirklich unheimlich kalt.«
Kamp erwidert barsch: »Also los, kommen Sie.« Er kehrt um und schlägt einen weit ausgreifenden Schritt an, sie muß immer wieder ein paar Laufschritte einlegen, um gleichauf zu bleiben. Auf dem ganzen Rückweg sprechen sie kein Wort. Kamp streicht ab und zu die Flocken von den Wimpern und vom Schnurrbart. Sie löst die Arme nicht, läuft mit verschränkten Armen neben ihm her.
Als Kamp die Haustür aufschließt, schreckt ihn die Vorstellung, daß die Türen eines Aufzugs auseinanderfahren und einer der Hausgenossen herauskommt, er macht ihnen stumm, mit einem neugierigen Blick den Weg frei und sieht ihnen nach. Die dünne weiße Hose wird ihr am Hinterteil kleben, wahrscheinlich kann man im hellen Licht der Vorhalle den Slip darunter erkennen.
Im Aufzug schaudert sie heftig zusammen. Sie hebt den Kopf, die nassen Haare hängen ihr strähnig über die Wangen. Sie lächelt ihn an: »Ich muß schlimm aussehen.« Ihre Zähne schlagen aufeinander. Kamp schüttelt den Kopf. Um die Augen und neben der Nase hat sie schwarze Flecke, es sind die Reste des Lidschattens, durch die Tränen verschmiert.
Als Kamp die Wohnungstür aufschließt, sagt sie: »Wie hoch sind wir denn hier?«
»Neunzehnte Etage. Rund fünfzig Meter.«
»Du meine Güte. Ist Ihnen das nicht unheimlich?«
»Nein. Warum?« Er nimmt ihr die Jacke ab. Darunter trägt sie einen dünnen Pullover mit kurzen Ärmeln. »Wie können Sie nur mit solchen Sachen rausgehen?«
»Ich bin mit dem Auto abgeholt worden.« Sie hebt einen [15] Fuß, hält ein. »Darf ich die Stiefel ausziehen? Ich werd Ihnen sonst den Teppich versauen.«
Kamp zeigt ihr die Toilette und die Küche. »Haben Sie Hunger?« Sie schüttelt den Kopf. Er führt sie ins Wohnzimmer. »Ins Bad geht es durch mein Schlafzimmer.« Er weist auf die Tür, tut auch einen Schritt darauf zu, bleibt dann aber stehen. Der Gedanke fällt ihm schwer, daß dieses Mädchen sein Schlafzimmer und sein Bad betreten soll.
Sie steht auf Strümpfen vor ihm, reibt sich die Oberarme. »Wenn Sie vielleicht nur ein Handtuch hätten. Dann könnte ich mir die Haare trocken reiben.« Sie gräbt die Finger in die Arme, aber es nutzt nichts, sie zittert.
»Natürlich.« Kamp geht zur Schlafzimmertür. In der Tür bleibt er stehen, wendet sich um. Sie sieht ihn an. Er sagt: »Sie können auch baden, wenn Sie wollen.«
Sie schüttelt stumm den Kopf, reibt sich mit hochgezogenen Schultern die Arme.
»Das wäre aber vielleicht ganz gut. Dann kommt das Blut wieder in Bewegung.«
Sie bekommt die Zähne kaum auseinander, als sie sagt: »Nein. Ich möchte nicht.«
»Wie Sie wollen.«
Als Kamp sich abwendet, sagt sie: »Vielleicht könnte ich duschen.«
Kamp legt die Hand an den Türrahmen, schnauft, schüttelt den Kopf. »Sagen Sie immer erst das Gegenteil von dem, was Sie wollen?«
Ihre Zähne schlagen einmal heftig aufeinander. Dann bringt sie heraus: »Ich kann’s auch lassen. Muß ja nicht sein.«
»Ich hab’s Ihnen doch angeboten, Herrgott noch mal. Also los, kommen Sie.«
Sie folgt ihm auf ihren dünnen Strümpfen. Kamp macht im Schlafzimmer kein Licht, er schaltet die Lampe im Bad ein, läßt die Tür halb offen stehen, während er im Wäscheschrank sucht. Er bringt ihr zwei Handtücher und einen seiner [16] Schlafanzüge. Sie löst eine Hand vom Arm und weist auf den Schlafanzug: »Was soll ich denn damit?«
»Anziehen. Oder wollen Sie sich in Ihren Sachen hinlegen?«
»Ich will mich überhaupt nicht hinlegen. Ich kann im Sitzen warten.«
Kamp starrt sie an. Er holt Atem. Dann sagt er: »Ich werde Ihnen jetzt auf dem Sofa im Wohnzimmer ein Bett machen. Und dann können Sie sich hinlegen oder hinsetzen oder meinetwegen auch im Stehen warten. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gleich wieder gehen.«
Er zieht die Tür heftig zu, wendet sich ab, hält ein, kehrt um. Er klopft an die Tür. Eine dünne Stimme sagt: »Ja?«
»Wenn Ihnen der Schlafanzug nicht reicht, können Sie den Bademantel drüberziehen. Er hängt am Haken hinter der Tür.«
»Danke.«
Kamp versucht, seine Gedanken zu ordnen, während er das Laken zwischen die Polster des Sofas stopft und glattstreicht. Er möchte einen Plan entwerfen, nach dem sich diese Geschichte reibungslos und möglichst schnell abwickeln läßt, er hat sich nun einmal darauf eingelassen, das ist nicht mehr zu ändern, aber sie soll nicht länger dauern als unbedingt nötig.
Der Anblick des Kopfkissens, des Federbetts auf dem Sofa stört seinen Gedankengang. Der Anblick erinnert ihn, Kamp widersetzt sich vergeblich, an die Zeit, als seine Schwägerin hin und wieder zu Besuch kam, sie war noch nicht vierzig, als sie Witwe wurde, die Wochenenden allein zu Hause fielen ihr schwer. Hast du was dagegen, wenn Gerda am Samstag noch mal kommt? Was soll ich denn dagegen haben, frag doch nicht so.
Der fremde Geruch im Wohnzimmer, süßlich-herb, nicht viel mehr als ein Hauch, aber unverwechselbar, wenn er sonntags morgens in die Küche ging, leise. Das Wohnzimmer [17] noch im Halbdunkel, die Vorhänge geschlossen. Der rotbraune Haarschopf sah unter dem Federbett hervor, ein nackter Fuß, die weiße Wade, und über dem Sessel die Strumpfhose, der Büstenhalter. Nur ein vager Geruch.
»Heinz?« Die Stimme aus dem Bad, verhängt vom dumpfen Sprudeln des Badewassers.
Er war zur Tür gegangen, hatte sie einen Spalt geöffnet, warme Dampfschwaden. »Ja?«
»Weck doch Gerda, sie soll dir beim Frühstück helfen. Sie hat lange genug geschlafen.«
Er hatte die Tür des Badezimmers geschlossen. Er hatte die Tür des Schlafzimmers hinter sich zugezogen. Das Federbett auf dem Sofa, die Ausdünstung des Schlafes. Warme Haut, wie ungewollt bloßliegend. Der Augenaufschlag, aber ein Lächeln, kein Erschrecken. Ein wohliges Recken, das dünne Nachthemd spannte sich. Die Hand pendelte träge, sie ließ sich wie unabsichtlich zu einer Berührung nieder. Das Bein bewegte sich, es gab noch mehr von seiner Blöße frei. Warme Haut, sie floh die Berührung nicht. Sie nahm sie auf, und dann drängte sie sich ihr entgegen, immer heftiger, das Federbett wurde zurückgestoßen, ein unterdrückter Laut, der weiße Hals bog sich nach hinten, die Finger einer Hand krampften sich um den Mund, sie verschlossen ihn, und dann gerieten die Schultern in Bewegung, sie nahmen den Rhythmus auf, hoben und senkten sich immer schneller, es mußte schnell gehen, schnell, ja, und dann zogen die Schultern sich plötzlich zusammen, verharrten zitternd vier, fünf Sekunden lang, bevor sie breit auseinander fielen.
Das Federbett und das Kopfkissen Zusammenlegen, schnell. Das Laken abziehen, hatte es Spuren abbekommen? Ein paar hastige halblaute Worte, ein unterdrücktes, beklommenes Lachen. Die Klinke der Schlafzimmertür behutsam nach unten drücken, die Tür öffnen. Ein Plätschern aus dem Badezimmer. Flüsternd: »Alles in Ordnung.« Und dann laut: »Mach den Kaffee aber nicht zu stark, Gerda!«
[18] Kamp starrt auf das Federbett. Gleich morgen früh wird er den Bettbezug hinunterbringen in die Waschküche, und den Kopfkissenbezug und das Laken. Er hat erst vor zwei Tagen gewaschen, die Maschine wird nicht voll werden. Aber er wird das Zeug gleich morgen früh waschen. Ihm fällt ein, daß er ja auch den Schlafanzug waschen muß, den vor allem. Und die Handtücher natürlich. Er zieht die Brauen zusammen. Das ist wahrscheinlich schon zu viel für eine Maschine.
Aber vielleicht wird sie sich ja tatsächlich gar nicht hinlegen. Kommt raus aus dem Badezimmer in dieser lächerlichen Hose, dem jämmerlichen Pullover, und setzt sich in den Sessel, verschränkt die Arme. Die Aussicht, sich mit ihr unterhalten, zwei oder drei Stunden überbrücken zu müssen, ist Kamp zuwider, aber zugleich beruhigt ihn, daß er dann dieses Mädchen nicht in seinem Wohnzimmer allein lassen muß.
Kamp sieht sich um. Der kleine Schreibtisch ist aufgeräumt, neben dem Telefon steht nur die Schale mit den Bleistiften und Kugelschreibern. Auf der Schreibunterlage liegt noch die Zeitung. Kamp geht zum Wohnzimmerschrank, öffnet die Seitentüren.
Die Flasche mit dem Rotwein, noch verschlossen, die Weinbrandflasche, zu zwei Dritteln voll, er überzeugt sich, indem er die Flasche gegen das Licht hält. Die Ordner mit den Papieren, die Briefmarkensammlung. Die kleine grüne Geldkassette, darin das Sparbuch, sonst nichts, er braucht nicht hineinzusehen. Das Fotoalbum. Er schließt die Schranktüren ab, hält die Schlüssel eine Weile in der Hand, betrachtet sie, steckt sie dann in die Hosentasche.
Um vier, spätestens um halb fünf wird er auf die Uhr sehen und sagen: »Jetzt werden Sie eine Straßenbahn bekommen.« Vielleicht ist sie eingeschlafen, im Sitzen, der Kopf ist auf die Schulter gesunken. Er wird sie leicht an der Schulter berühren, sie wird die Augen aufreißen, wird um sich sehen, ihn aus weit aufgerissenen Augen ansehen. Er wird sagen: »Es tut mir [19] leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Aber jetzt werden Sie eine Straßenbahn bekommen.« Sie wird nicken, aufstehen, hastig die Stiefeletten überstreifen. Er wird ihr in die Jacke helfen.
Kamp lauscht. Er hört gedämpft noch immer das Rauschen der Dusche. Er öffnet die Balkontür und geht hinaus. Hinter der Brüstung hat sich schon ein dünner Streifen von Schnee angesammelt, immer mehr Flocken taumeln über die Brüstung, schweben nieder und setzen sich ab. Zwei, drei Meter jenseits der Brüstung wird der weiße Schleier schon undurchdringlich. Kamp kann die Dächer in der Tiefe nicht mehr erkennen. Die Lichter der Stadt sind erloschen wie hinter einer Nebelwand.
Ihn fröstelt. Er schließt die Tür, bleibt stehen, sieht eine Weile zu Boden. Plötzlich schließt er den Wohnzimmerschrank auf, nimmt die Rotweinflasche heraus und bringt sie in die Küche. Er zieht den Korken, gießt die Hälfte der Flasche in den Blechtopf, zögert, gießt noch etwas nach. Zucker einrühren, nicht zu viel. Ein Stück Zitronenschale. Er darf nicht vergessen, die Zitrone aufzubrauchen. Nelken, es sind noch ein paar im Tütchen, zwei werden genügen, nein, drei. Aber Zimt.
Er hat keine Zimtstangen. Er hat sie beim Einkäufen immer wieder mal gesehen, vage Erinnerungen, früher standen sie im Küchenschrank, aber er hat sie nie gekauft, wozu braucht man sie eigentlich? Zum Glühwein, ja. Er überlegt eine Weile, dann schüttet er aus dem Tütchen gemahlenen Zimt auf den Wein, rührt um, beugt sich über den Topf, um zu sehen, ob der Zimt sich aufgelöst hat.
Als er den dampfenden Wein in die Glaskaraffe gießt, erscheint sie in der Schlafzimmertür, lautlos, auf bloßen Füßen. Die Beine des Schlafanzugs hat sie hochgeschlagen. Über dem Schlafanzug hat sie den Bademantel fest zusammengebunden, aber er hängt ihr um die Schultern. Auf dem Arm trägt sie ihre Sachen.
[20] Sie lächelt Kamp an: »Vielen Dank, das war eine Wahnsinnsidee von Ihnen. Ich fühl mich schon wieder als Mensch.« Sie legt ihre Sachen auf den Sessel, schlägt das Federbett zurück, setzt sich aufs Laken, zieht die Beine an, stellt die Füße auf den Rand des Sofas.
Kamp gießt zwei Gläser ein. Sie deutet mit dem Finger darauf: »Was ist das?«
»Glühwein.«
»Ich möchte aber nichts mehr trinken.«
»Dann lassen Sie’s eben stehen.«
Sie fängt an, ihre Zehen zu befühlen, bringt im Hocken die Hände auf beiden Seiten nach vorn und befühlt auf beiden Seiten die Zehen. Sie hat schlanke, glatte Füße, gerade Zehen.
Sie sagt: »Glühwein hab ich noch nie getrunken. Bekommt man davon nicht einen dicken Kopf?«
Kamp nimmt sein Glas und trinkt vorsichtig. Sie sieht ihm zu, bis er das Glas abstellt. Dann sagt sie: »Ich kann’s ja mal versuchen.«
»Sie müssen vorsichtig sein, das ist sehr heiß.«
Sie nippt mit spitzen Lippen. »Hui, ist das heiß«, nippt noch einmal. »Das schmeckt gut. Aber ich lasse es ein bißchen abkühlen.«
»Nicht zu lange, sonst wirkt er nicht.«
Sie nickt, befühlt wieder ihre Zehen und betrachtet sie.
Die Stille kehrt zurück, aber dieses Mal bedrückt sie Kamp nicht. Der Schnee hüllt das Haus ein, wie in eine warme Decke, er läßt keine Lücke, keine Spalte offen, durch die die Kälte einbrechen könnte oder ein zugiger Wind. Irgendwann wird dieses Mädchen wieder etwas sagen, vielleicht eine Frage stellen oder nur ein Wort fallen lassen, es wird ihn anrühren wie eine Hand, und er wird antworten, es wird sein, wie wenn zwei Hände ineinander greifen, und gleich über ihnen das Dach, kein himmelhohes Flachdach, nein, ein niedriger Giebel, und dieses winzige Dach trägt ein dickes Polster von Schnee, Schneewehen ringsum an den niedrigen Wänden, nur [21] das winzige Fenster schaut noch heraus, ein still leuchtender Fleck in der Dunkelheit.
Kamp fährt sich mit der Hand über die Augen. Sie schaut auf: »Sind Sie noch nicht müde?«
»Es geht.« Er räuspert sich. »Wann müssen Sie raus morgen früh?«
»Ich? Ich hab nichts Besonderes vor. Aber Sie müssen doch sicher raus?«
Kamp greift nach seinem Glas, trinkt.
Sie sagt: »Schmeißen Sie mich früh genug raus, damit ich Ihnen hier nicht im Weg bin. Oder vielleicht haben Sie einen Wecker für mich?«
Kamp sagt: »Das ist nicht nötig«, will noch etwas sagen, schweigt.
Sie blickt wieder von ihren Zehen auf: »Haben Sie Urlaub?«
Kamp trinkt sein Glas leer, stellt es ab, steht auf. »Ich werde Sie wecken.« Er zeigt auf die Karaffe: »Trinken Sie das, bevor es kalt wird. Das wird Ihnen guttun.«
Sie nickt, lächelt. »Und vielen Dank noch mal.«
Kamp sieht sich um. Er sieht, daß er den Schlüssel der Schranktür hat steckenlassen, als er den Rotwein zurückstellte. Er tut einen halben Schritt, hält ein, hebt in einer ziellosen Bewegung die Hand. Dann sagt er: »Die Lampe hat einen Fußschalter, gleich neben Ihnen.«
Sie beugt den Kopf vor über ihr Knie. »Okay. Ich werd mich jetzt auch hinlegen. Ich bin auf einmal hundemüde.«
Als er sich in der Schlafzimmertür umdreht, hat sie sich schon ausgestreckt, sie zieht das Federbett hoch unters Kinn.
Kamp sagt: »Also, gute Nacht.«
»Gute Nacht.« Sie lächelt ihn an. »Ich heiße Claudia.«
Er nickt, ein paarmal.
Sie legt sich auf die Seite, blickt über die Schulter. »Was bedeutet das H in Ihrem Namen?«
»Das H? Was meinen Sie?«
[22] »Auf dem Türschild steht H. Kamp.«
»Ach so.« Er räuspert sich. »Heinz.«
Als er aus dem Bad zurückkommt, ist der Lichtstreifen unter der Tür erloschen. Er ist schon auf dem Weg zur Tür, senkt schon den Kopf, um zu lauschen, kehrt jäh um und bleibt stehen. Er schüttelt heftig den Kopf. Nach einer Weile fängt er an, sich auszuziehen. Im Schlafanzug geht er noch einmal auf den Balkon, hält eine Hand hinaus in die dichten Flocken, spürt sie schmelzen auf seiner Haut. Dann streckt er sich aus, schlägt das Federbett auf beiden Seiten ein. Mit einer Regung von ungläubigem Erstaunen spürt er, wie der Schlaf sich still auf seine Lider senkt, aber bevor er noch darüber nachdenken kann, schläft er, tief und traumlos.
2
Als Kamp am darauffolgenden Abend aus der Stadtbibliothek zurückkam, fand er das Schloß seiner Wohnungstür zerbrochen. Er starrte, den Schlüssel in der Hand, ungläubig auf die Abdeckplatte des Schlosses, sie hing abgeknickt am Türknauf. Kamp streckte einen Finger aus und berührte die Abdeckplatte. Sie ließ sich zur Seite heben. Er bückte sich. In der Öffnung, Holzsplitter an den Rändern, erkannte er den Zylinder des Schlosses, er saß schräg und locker, Kamp konnte ihn mit zwei Fingern bewegen.
Er richtete sich auf, holte tief Atem. Dann legte er eine Hand auf die Tür. Er verstärkte den Druck allmählich und so behutsam, als könne er anders noch mehr Schaden anrichten. Die Tür hielt stand. Er legte beide Hände auf das Holz, lehnte sein Gewicht dagegen. Die Tür rührte sich nicht.
Kamp starrte auf das Schloß. Vielleicht waren die Einbrecher gestört worden, hatten die Flucht ergriffen. Aber er [23] konnte die Tür nicht mehr aufschließen. Sie hatten ihn aus seiner Wohnung ausgesperrt. Verzweiflung packte ihn, das würgende Gefühl, seine Zuflucht verloren zu haben. Wo sollte er bleiben? Auf dem Korridor, auf der Straße? An welchem Ort konnte er sich nun noch verkriechen?
Er raffte sich auf, ging zum Aufzug. Auf halbem Wege kehrte er um. Er versuchte, die Abdeckplatte geradezubiegen, wenigstens den Anschein herzustellen, als sei seine Wohnung unversehrt. Aber das Metall war sperrig. Die Platte knirschte unter Kamps verbissener Anstrengung, sie rieb sich an ihrer Halterung, aber der häßliche, ekelhafte Knick ließ sich nicht ausbeulen.
Der Hausmeister reagierte ungehalten, ja, ja, was solle er denn machen, vor zwei Monaten hätten sie’s gleich an drei Wohnungstüren versucht, er könne ja schließlich nicht Tag und Nacht auf der Lauer liegen, dafür werde er nicht bezahlt, und die Mieter täten besser daran, untereinander ein bißchen aufzupassen, statt ständig fremde Leute ins Haus zu schleppen, ihm begegneten zu jeder Tages- und Nachtzeit Gesichter, die er noch nie gesehen habe, er könne doch nicht jeden fragen, was er hier zu suchen habe.
Kamp wandte sich ab ohne Gruß. Er ging in die Telefonzelle vor dem Haus und rief die Polizei an. Eine ruhige Stimme, ja, alles klar, die Kollegen kämen gleich. Kamp klammerte sich an die Auskunft. Er schlug im Telefonbuch unter Schlüsseldienst nach, wählte die erste Nummer, wurde nach zwei Sätzen unterbrochen, das werde aber heute nicht mehr gehen, morgen früh vielleicht, Augenblick mal, um zehn sei es möglich.
»Und wo bleibe ich bis dahin?« Kamp erschrak über seine eigene Stimme, sie klang gepreßt, fast erstickt, er erkannte sie kaum. Ja, du lieber Gott, das passiere vielen Leuten, er werde doch wohl Bekannte haben, sonst müsse er eben für die eine Nacht ins Hotel gehen. Kamp räusperte sich. Er sagte: »Ich habe nicht so viel Geld eingesteckt.« Dann sagte er: »Und [24] meine Bekannten wohnen nicht hier.« Ein Seufzer des Überdrusses am anderen Ende, das sei natürlich besonderes Pech, aber man müsse sich heutzutage tatsächlich auf so eine Situation einstellen, da helfe nichts, gar nichts, Zustände wie in Chicago.
Kamp, den Hörer ans Ohr pressend, sah plötzlich das runde Gesicht von Frau Klose, Hertha, vor sich, die Löckchen über der Stirn, gepflegtes Grau, mit einem leichten Blauschimmer, die gepolsterten Wangen, die weichen, beweglichen, geschminkten Lippen. Dem Gedanken, an ihrer Tür zu klingeln und sie zu fragen, ob sie ihn für die Nacht aufnehmen wolle, widersetzte er sich sofort. Er sagte: »Können Sie es wirklich nicht einrichten, daß noch jemand kommt? Ich stehe sonst auf der Straße.«
In Gottes Namen also. Er könne einem wirklich ganz schön auf die Nerven gehen, das müsse man ihm lassen. Aber eine Stunde werde es noch dauern, da sei nichts zu machen. Was habe er noch mal gesagt, im wievielten Stock?
»Im neunzehnten. Klingeln Sie bitte beim Hausmeister.« Kamp fühlte sich von einer zentnerschweren Last befreit. Als er vor der Haustür ankam, fuhr der Streifenwagen vor. Zwei junge Kerle, die Mützen setzten sie auf, als sie ausstiegen. Einer trug ein Schreibbrett in der Hand. Im Aufzug lächelte er Kamp an: »Schöner Schreck in der Abendstunde.« Kamp nickte.
Sie nahmen seine Personalien auf und stocherten eine Weile mit einem Schraubenzieher in dem zerbrochenen Schloß herum, versuchten vergeblich, die Tür zu öffnen. Einer kniete nieder, drückte den Zylinder beiseite und spähte durch die Öffnung. Kamp sagte: »Da sehen Sie doch nichts, ich hab doch das Licht nicht eingeschaltet.«
»Doch, ich sehe was.«
Kamps Atem stockte.
»Sieht aus wie Leuchtziffern. Eine elektrische Uhr. Kann das sein?«
[25] »Das ist das Radio.«
»Na, wenn das noch drinsteht, dann haben Sie wahrscheinlich Schwein gehabt. So was nehmen sie immer als erstes. Wahrscheinlich sind sie gestört worden.«
Als die beiden gegangen waren, wurde Kamp bewußt, daß sie keine Fingerabdrücke genommen hatten. Waren sie dazu nicht verpflichtet? Aber vielleicht hätte es sowieso keinen Sinn gehabt. Vielleicht hatten die Einbrecher die Tür abgewischt. Über das merkwürdige Gefühl der Erleichterung, das er bei dieser Überlegung empfand, gab Kamp sich keine Rechenschaft, er unterdrückte es.
Zweimal schaltete er das Flurlicht wieder ein. Als es zum zweitenmal ausgegangen war, blieb er im Dunkeln stehen. Nach einer Weile bückte er sich, tastete nach dem Zylinder, drückte ihn zur Seite und versuchte durch die Öffnung zu sehen. Er ließ sich auf ein Knie nieder, aber er konnte nichts erkennen. Er stand wieder auf, ein wenig mühsam, klopfte sich das Knie ab, trat ans Flurfenster. Unter dem dunklen Himmel lag die Welt wie frisch geputzt, die Lichter funkelten über der dichten Schneedecke.
Kamp versuchte nachzudenken, sich den Fall zu erklären, seine Gedanken in die Richtung zu zwingen, der sie auszuweichen versuchten. Er kam nicht sehr weit. Die Angst stieg wieder in ihm auf, seine Wohnung könne vielleicht doch verwüstet sein, seine Ordnung zerstört.
Der Kerl ist in Wut geraten, weil sie nichts fanden, was für sie von Wert gewesen wäre, das Briefmarkenalbum, lückenhaft, kärglich, sie haben es zerrissen, die Fetzen über das Wohnzimmer verstreut, die Bücher aus dem Regal gefegt, seine Schallplatten zerbrochen, der Plattenspieler, er war ihnen nicht kostbar genug, sie haben den dünnen Arm geknickt. Und sein Bett. Was mögen sie mit seinem Bett gemacht haben? Vielleicht haben sie die Matratze aufgeschlitzt, aus bloßem Zerstörungstrieb.
Kamp trat dicht an seine Tür heran. Er legte die Hand auf [26] das Holz. Er stand noch immer da, als der Mann vom Schlüsseldienst aus dem Aufzug kam und die Flurbeleuchtung einschaltete. »Hallo? Ach, da sind Sie ja. Ich dachte schon, erst machen Sie mich verrückt, und dann sind Sie weggegangen. Na, dann wollen wir mal.« Er öffnete seinen Werkzeugkoffer.
Es war ein älterer Mann, nicht viel jünger als Kamp, struppiges graues Haar. Während er eine Zange auswählte, sah er auf: »Ist Ihnen nicht gut?«
»Warum?«
»Ich dachte, Sie sehen ein bißchen grau aus im Gesicht. Na ja, ist ja auch kein Wunder.«
Kamp sagte: »Die Polizisten haben gemeint, daß sie vielleicht gar nicht in die Wohnung reingekommen sind.«
»Die haben ja keine Ahnung.« Der Mann setzte seine Zange an und brach den Zylinder heraus. »Daß die Tür noch zu ist, das hat überhaupt nichts zu sagen. Die Brüder sind heute so raffiniert, die sperren Ihnen jedes Schloß auf, wenn sie genug Zeit haben. Und wenn sie gehen, ziehen sie die Tür natürlich zu, und das Schloß schnappt wieder ein.«
Der Mann setzte einen Haken in die nackte Öffnung, tastete ein paarmal hin und her. Als Kamp das Geräusch hörte, mit dem die Klinke zurücksprang, wurde ihm kalt. Er ging auf steifen Beinen in die Wohnung hinein, ging langsam durch alle Zimmer, öffnete die Schränke. Alles war an seinem Platz.
Als Kamp zurückkam, war der Mann schon dabei, die Öffnung von Splittern zu säubern. »Na?«
»Es sieht so aus, als ob nichts fehlt.«
»Dann waren sie auch nicht drin. So was machen die doch nicht umsonst. Wahrscheinlich sind sie gestört worden.«
Kamp ging ins Wohnzimmer. Er ließ sich im Sessel nieder, langsam, beide Hände auf die Lehnen stützend. Seine Arme und Beine schienen einem fremden Willen [27] ausgeliefert, sein Kopf war leer. Er fühlte sich so schwach, als hätte er eine gewaltige körperliche Anstrengung hinter sich gebracht.
Sein Gehirn begann mühsam zu arbeiten, als der Mann die Rechnung geschrieben und sie ihm gegeben hatte, sie lautete, mit Montage (Nachtzuschlag), Anfahrt und vierzehn Prozent Mehrwertsteuer, auf einhundertneunundfünfzig Mark und fünfundsechzig. Kamp, der den Schock wehrlos hinnahm, brauchte ein paar Sekunden, um sich seinen Kontostand in Erinnerung zu rufen. Doch, es war möglich, es blieben ihm noch gut fünfzig Mark, und bevor die Miete abgebucht wurde, mußte die Überweisung vom Arbeitsamt eingegangen sein. Er schrieb den Scheck aus, der Mann verglich die Scheckkarte, klappte seine Brille zusammen und sagte, so, nun könne Kamp sich aber in aller Ruhe hinlegen, so schnell kämen die nicht wieder, und mit dem neuen Schloß hätten sie kein so leichtes Spiel.
Kamp brachte den Mann zur Tür, probierte das Schloß aus, es ging sehr leicht. Er schloß die Tür ab, nachdem er auch noch die beiden Reserveschlüssel ausprobiert hatte. Er legte beide in die Blechdose mit den anderen Schlüsseln, warf die alten Schlüssel weg. Eine Weile dachte er nach, dann rückte er die Blechdose an das hintere Ende der Schreibtischschublade, man konnte sie nicht sehen, wenn man die Schublade aufzog. Er ging noch einmal durch die Wohnung, öffnete hier einen Schrank, zog dort eine Schublade heraus. Vor dem Spiegel im Badezimmer blieb er stehen.
Er fand sich nicht verändert. Das Haar, gescheitelt, ein wenig dünn auf den Seiten der Furche, aber noch immer dunkelbraun. Grau nur an den Schläfen. Nicht richtig graue Schläfen, damit wäre er sich vielleicht auch albern vorgekommen, solche Leute hatte er nie gemocht, sie wirkten auf ihn immer so, als hätten sie sich zurechtgemacht. Nur vereinzelte graue Haare an den Schläfen. Eisgrau der Schnurrbart allerdings, und das hatte ihn manchmal auch gestört. Toll, ganz toll sehe er aus mit diesem Schnurrbart, hatte Frau Klose [28] gesagt, vor anderen Leuten, es war ihm peinlich gewesen. Aber diesen Schnurrbart, ziemlich breit, hatte er schon getragen, bevor alle diese Jünglinge anfingen, ihre einfältigen, ihre glatten Gesichter mit Bärten zu maskieren.
Glatt war sein Gesicht wahrhaftig nicht. Die Doppelkerbe zwischen den Augenbrauen, ziemlich tief. Unzählige Fältchen unter den Augen, sie pflanzten sich fort bis in die Wangen hinein. Schon vor einiger Zeit war ihm aufgefallen, daß die Lider an den Außenseiten der Augen überhingen. Ähnliche Veränderungen zu beiden Seiten des Kinns, erschlaffende Haut, ihm fiel ein häßliches Wort dafür ein, das er einmal gelesen und das sich ihm eingeprägt hatte: Hautsäcke. Hertha, Frau Klose. Irgendwann, es konnte ja nicht mehr lange dauern, würden sie sich fortsetzen in lange, fleischlose Falten den Hals hinab, der Kehlkopf würde hervortreten.
Sie waren nicht zu übersehen, die Altersspuren. Und vielleicht machten sie tatsächlich aus dem Menschen, der sich noch immer als derselbe empfand, einen ganz anderen Menschen, unmerklich für ihn selbst. Unmerklich bis zu dem Tag, an dem er erstmals zu spüren bekam, daß andere ihn anders behandelten, weil der Anblick seiner Altersspuren sie dazu herausforderte.