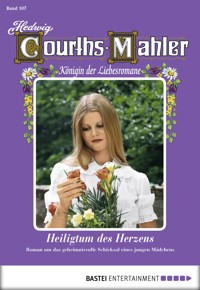Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Millionenerbin Juanita Trebin heiratet den charmanten Dolf Falkner. Doch schon bald nach der Trauung stellt sich heraus, dass die junge Frau heimtückisch von ihrem frischgebackenen Ehemann getäuscht wurde. Juanita ist am Ende. Da begegnet sie Gerd wieder, einem Freund aus Kindertagen. Mit der Zeit entwickeln die beiden Gefühle füreinander, doch Gerd ist auch Dolf Falkners Stiefbruder ... -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Deines Bruders Weib
Saga
Deines Bruders Weib
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1915, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950502
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
I
Bernhard Falkner saß in dem Privatkontor seiner Fabrik draußen am Südende der Stadt. Diese Fabrik, in der Teppiche gewebt wurden, war ein großer, roter Ziegelbau, der von drei Seiten einen mächtigen Hof umschloß. Die vierte Seite des Hofes begrenzte die Mauer, die das Grundstück von der Straße abschloß und in der zwei große Tore zur Ein- und Ausfahrt der Wagen und eine schmälere Pforte für Fußgänger angebracht waren.
Hunderte von Arbeitern und Beamten bevölkerten dieses Gebäude. Oben unter dem Dache befanden sich die Zeichensäle, wo die Teppichmuster entworfen und die Detailzeichnungen angefertigt wurden. Drunten hörte man das Schwirren und Fauchen der Maschinen, das Klappern der Webstühle, und einer Anzahl geöffneter Fenster entströmte feuchter Dampf und ein eigentümlicher Geruch von Farbe und feuchter Wolle.
In dem großen Hofe standen Wagen, die mit Teppichballen beladen wurden, die ein Fahrstuhl von oben herab beförderte. Bernhard Falkner war an dieses Geräusch so gewöhnt, daß es ihn nicht mehr störte. Seit zweiundzwanzig Jahren war er Besitzer dieser Fabrik. Er hatte sie selbst erbauen lassen, als er sich mit seiner ersten Frau vermählte. Das große Vermögen, das sie ihm in die Ehe brachte, hatte ihm das ermöglicht, denn er selbst hatte nur über ein bescheidenes Kapital verfügt. Die Fabrik hatte bald einen guten Ruf bekommen, sie war leistungsfähig, und es fehlte nicht an lohnenden Aufträgen. Mit den Jahren hatte Bernhard Falkner, der ein tüchtiger, begabter Kaufmann war, sein Unternehmen noch vergrößert und verbessert. Es war viel Geld eingekommen, aber er hatte auch, dank seiner verschwenderischen zweiten Frau, viel verbraucht. Und nun sollte er, gerade zu einer Zeit, da er allerlei Fehlschläge gehabt hatte, seinem Sohne das mütterliche Erbteil auszahlen, das bisher in seinem Geschäft gesteckt hatte. Dreihunderttausend Mark aus solch einem Betrieb zu ziehen — das war keine Kleinigkeit. Und Bernhard Falkner saß auch heute wieder mit sorgenvoller Stirn und rechnete. Wenn seine Frau auch übertrieben hatte, wenn sie behauptete, daß ihn das Auszahlen der Summe ruinieren müsse, so kam er doch in eine verteufelt ernste und unangenehme Lage.
Trotzdem dachte er nicht daran, seinen Sohn zu bitten, ihm das Kapital noch länger zu überlassen. Nicht nur, daß er Gerhard so fremd geworden war, hinderte ihn daran, sondern auch der Gedanke, daß dessen Mutter wohl aus besonderen Gründen kurz vor ihrem Tod so testiert hatte. Er vermochte auch heute noch nicht ruhig an den Tod seiner ersten Frau zu denken.
Unmutig warf er endlich die Feder hin. Was half ihm alles Rechnen. Es änderte nichts an der Tatsache, daß er in die schwierigste Lage kam, wenn er das Geld auszahlen mußte. Vielleicht hätte er das gleiche Kapital an anderer Stelle aufnehmen können. Aber das hatte auch seine Schattenseiten, und so leicht war es nicht, eine solche Summe zu beschaffen. Zudem war der Termin unheimlich schnell nahegerückt, ohne daß er hätte Deckung schaffen können.
Trübe starrte er vor sich hin.
Sein gutgeschnittenes, kluges Gesicht erinnerte sehr an das seines Sohnes Gerhard. Nur waren dessen Züge schon jetzt markanter, energischer als die des Vaters. Vielleicht lag das auch daran, daß Bernhard Falkners Mund und Kinn durch einen Bart verdeckt waren. Der verbarg vielleicht die charakteristischen Linien, die bei Gerhard so deutlich hervortraten. Auch andere Augen hatte Bernhard Falkner. Sie waren dunkelblau, fast schwarz und hatten einen weniger bestimmten, weniger herben Ausdruck, als die grauen Augen des Sohnes.
Alles in allem war Bernhard Falkner, trotzdem er fast fünfzig Jahre zählte, noch ein sehr stattlicher und gutaussehender Mann.
Mit einem Seufzer hob er endlich das Haupt.
»Du rächst dich — noch aus dem Grabe heraus, Maria«, stöhnte er leise, mit der schmalen Hand nervös durch das graumelierte Haar fahrend.
Wie schon oft in den letzten sechzehn Jahren, seit dem Tode seiner ersten Frau, regte sich auch heute wieder das Gewissen in seiner Brust. Er wußte, daß er sich an Maria versündigt hatte, daß er sie gekränkt und beleidigt hatte mit seiner Leidenschaft für Helene, seiner zweiten Frau. Auch regte sich oft eine leise Stimme in ihm, die ihn anklagen wollte, daß Maria wohl mit Absicht aus dem Leben geschieden sei, weil sie es nicht ertragen konnte, daß er sie verraten hatte. Aber diese Stimme brachte er stets mit Gewalt zum Schweigen. Daran wollte er nicht glauben, weil er sonst die Last nicht hätte tragen können. Der Mahner in seiner Brust ließ sich nie ganz zum Schweigen bringen. Und der Anblick seines ältesten Sohnes weckte immer wieder von neuem die Erinnerung an seine Schuld.
Nur dann fühlte er sich ganz frei von aller Gewissensnot, wenn Helene bei ihm war. Dann wußte er, daß er nicht anders hatte handeln können, daß das Gefühl, welches ihn zu ihr gezogen hatte, zu mächtig gewesen war, um sich dagegen auflehnen zu können.
Helenes Zauber wirkte auch jetzt noch mit der alten Macht auf ihn ein, und in ihrer Nähe war er zu glücklich, um Gewissensbissen Raum geben zu können.
Aber wenn er hier draußen in der Fabrik allein war, stiegen zuweilen Marias ernste, leidvolle Augen vor ihm auf, dann sah er sie wieder bleich und kalt, mit dem tiefen Schmerzenszug um den blassen Mund, auf ihrem letzten Lager liegen. So jung hatte sie sterben müssen — so jung.
Bernhard Falkner war kein Mensch, der sich leicht über solche Erinnerungen hinwegsetzen konnte. Und jetzt, da er durch die Bestimmung in Marias Testament in eine schlimme Lage zu kommen drohte, sah er darin eine Art Vergeltung. Er hatte es nicht gewagt, Gerd zu bitten, ihm das Kapital zu belassen. Etwas wie Furcht war in ihm, daß sein Sohn ihm kalt seine Bitte abschlagen könne, mit einem vorwurfsvollen Hinweis auf seine Mutter. Denn daß Gerd ahnte, auf welche Weise seine Stiefmutter zur Nachfolgerin seiner Mutter geworden war, das ging deutlich genug aus seinem Verhalten hervor.
Gerechterweise hätte er es seinem Sohne nicht verdenken dürfen, daß dieser sich feindlich gegen seine Stiefmutter stellte; aber wenn Helene in Frage kam, schaltete bei ihm überhaupt jedes klare Denken aus. Und sie wußte ihren Mann so sehr gegen Gerd zu beeinflussen, daß sich Vater und Sohn fremd und kalt — fast feindselig gegenüberstanden. Sie sprachen fast nur noch bei den gemeinsamen Mahlzeiten das Nötigste miteinander. Niemals waren sie allein, das suchte Frau Helene zu hintertreiben. Daß seine Frau ihn geflissentlich und mit Vorsatz, ohne sonderlich wählerisch in ihren Mitteln zu sein, seinem Sohne entfremdete, ahnte Bernhard Falkner nicht. Solch eine niedrige Handlungsweise traute er seiner Gattin nicht zu. In Gerds Augen glaubte er nur immer Trotz, Starrsinn und einen stillen Vorwurf zu lesen, und da verschloß er sein Herz vor ihm. Ihm war immer, als stehe Maria wie ein mahnender Schatten zwischen ihm und seinem Sohne.
Gerd Falkner war auch noch zu jung, um abgeklärt und milde richtend der Schuld eines Menschen gegenüberzustehen. Die Jugend ist hart und herb im Urteil, weil sie noch nicht weiß, wie leicht es ist, schuldig zu werden. Gerd war streng gegen sich selbst und andere. Und wenn er auch den Vater trotz allem liebte, schuldig fand er ihn doch, und wenn es auch schmerzte, er mußte ihn verurteilen. Sein Vater hätte das wohl begreifen müssen — aber er wollte es nicht. Er wehrte sich gegen das Gefühl, wie ein Schuldiger vor seinem Sohne zu stehen.
Aber er wußte, daß Gerd mit allen Fibern seines Empfindens aus dem Vaterhause strebte, daß er sich nur widerwillig bisher der väterlichen Macht beugte, die ihn festhielt, bis er mündig war. Es war ihm gewiß, daß Gerd pünktlich sein Vermögen einfordern und fortgehen würde. Nichts würde ihn daheim halten. Stand er doch seiner ganzen Familie im Innersten feindlich gegenüber. Wie aber sollte er für Gerd das Geld flüssig machen, ohne sich selbst in die peinlichste Lage zu bringen? Darüber hatte er in der letzten Zeit oft vergeblich gegrübelt und sich auch schon ohne Erfolg bemüht, Ersatzkapital herbeizuschaffen. Nun lagen nur noch vier Wochen vor ihm bis zu Gerds Geburtstag. Und er wußte keinen Rat. Sollte er wirklich gezwungen sein, Gerd zu bitten, ihm das Kapital noch zu überlassen und sich vorläufig mit Auszahlung der Zinsen zu begnügen?
Er seufzte tief und sorgenvoll auf. Auch das Auszahlen der Zinsen würde ihm schwerfallen. Es war seltsam, welche Summen sein Hauswesen verschlang. Er mußte, so schwer es ihm fallen würde, Helene bitten, sich einzuschränken. So ging es nicht mehr weiter.
Mit trüben Augen starrte er vor sich hin. Da ließ der Kontordiener den Postboten herein, der verschiedene Einschreibesendungen brachte.
Mechanisch begann Bernhard Falkner die Briefe durchzusehen, als er wieder allein war. Es waren meist wichtige geschäftliche Abmachungen. Der Umsatz steigerte sich erfreulich von Jahr zu Jahr. Wenn man sehr sparsam sein würde und das Geschäft so weiter ging, dann konnte man vielleicht die Zinsen Gerds entbehren, und mit der Zeit ließ sich auch das Kapital herausziehen. Nur jetzt noch nicht — jetzt noch nicht.
Zuletzt kam ihm ein Brief in die Hände, der oben den Vermerk »Privat« trug. Er betrachtete ihn kopfschüttelnd. Das Kuvert zeigte weder Firmenaufdruck, noch eine bekannte Handschrift, dafür aber ausländische Marken. Auf dem Poststempel entzifferte Bernhard Falkner den Namen einer kalifornischen Stadt. Er konnte sich nicht denken, was für private Nachrichten ihm von dort übermittelt werden könnten.
Langsam führte er den Brieföffner in das Kuvert und schlitzte es auf. Mehrere engbeschriebene Bogen entnahm er demselben und faltete sie auseinander, um zuerst nach der Unterschrift zu sehen.
»Justus Trebin.«
Er zuckte zusammen. Der Name entfuhr seinen Lippen in höchster Betroffenheit, und eine Weile starrte er wie gelähmt darauf nieder.
Was für Erinnerungen löste dieser Name in ihm aus. Justus Trebin! Diese beiden Worte klangen aus der Vergangenheit zu ihm herüber und zauberten die Gestalt des einstigen Jugendfreundes vor seine Augen.
Wie lange hatte er wohl diesen Namen nicht mehr gehört, wie lange den einst von ihm fast Unzertrennlichen nicht mehr gesehen? Von der Schule an waren sie einander zugetan gewesen — wie Brüder — bis, ja, bis Justus die Heimat verließ, für immer.
Und er hatte ihn vergessen über all dem privaten Erleben und der Geschäftigkeit seines Berufs. Jetzt aber stand er plötzlich wieder wie leibhaftig vor ihm, der große blonde Mensch mit den treuen, ernsten Augen, dem tiefen, träumerischen Gemüt — ein echter Germane mit allen Schwächen und Tugenden seines Volkes.
Justus Trebin!
Bernhard Falkner atmete tief und gepreßt und sah starr vor sich hin. Aus der Vergangenheit stieg mahnend empor, was Justus Trebin aus der Heimat getrieben hatte. Die Zeit wurde lebendig, da er selbst um Maria, Gerds Mutter, gefreit hatte.
Justus Trebin hatte Maria ebenfalls geliebt — wohl mit einer treueren, besseren Liebe als er selbst. Aber Maria hatte ihm den Vorzug gegeben — und da Justus dem Freunde die Geliebte nicht neiden wollte und doch nicht ruhig Zeuge seines Glückes sein konnte —, ging er still und klaglos aus ihrem Weg. Er verließ die Heimat, um nie wiederzukehren, um nichts mehr von sich hören zu lassen. Und nun, nach zweiundzwanzig Jahren ein Lebenszeichen von ihm!
Wenn er damals geahnt hätte, von wie kurzer Dauer das Glück gewesen war, um das er den Freund beneiden mußte — ob er dann auch fortgegangen wäre? Ob er dann nicht um den Besitz der Geliebten gekämpft hätte? Wie würde er selbst vor dem Freunde bestanden haben, wenn dieser ihn gefragt hätte: Hast du Maria so glücklich gemacht, wie sie es verdiente?
Ach — Maria wäre wohl glücklicher geworden mit Justus Trebin. Er hätte ihr die Treue nicht gebrochen — er nicht.
Justus Trebin war damals nach Mexiko gegangen, wo ein bedeutend älterer Bruder von ihm große Besitzungen hatte. Eltern und Verwandte besaß er nicht mehr, und der Bruder hatte ihn schon oft gebeten, zu ihm zu kommen. Justus hatte sich aber nicht von dem Freunde — und von Maria trennen wollen. Erst als Maria ihn zurückwies und Bernhard ihre Hand reichte, folgte er des Bruders Ruf.
Bernhard Falkner begann zu lesen:
»Mein lieber alter Freund Bernhard!
Denkst Du zuweilen noch der Zeit, da der Schreiber dieser Zeilen Dein unzertrennlicher Begleiter war, da wir beide einander in inniger Freundschaft zugetan waren? Es ist lange, lange her, mein Bernhard, daß wir einander das letzemal in die Augen schauten. Du weißt, weshalb ich fortging aus der Heimat. Den beiden Menschen, denen mein ganzes Herz gehörte, konnte ich nichts mehr sein, so war mir die Heimat verleidet, und ich ging zu meinem Bruder, dem allein ich mich noch zugehörig fühlte.
Du wirst fragen, weshalb ich nie von mir hören ließ. Lieber Bernhard — ich konnte Maria nicht vergessen. Eine Frau wie sie kann man nicht vergessen, wenn man sie einmal geliebt hat. Und Du weißt, ich habe sie namenlos geliebt.
Wirf meinen Brief nicht empört von Dir, Bernhard, wenn Du ihn in den Händen hältst, bin ich nicht mehr am Leben. Und einem Sterbenden zürnt man nicht, weil er einmal ausspricht, was ihm jahrelang das höchste Glück, das tiefste Leid war.
Warum ich Dir heute schreibe, nach so langer, langer Zeit, da ich doch so lange schwieg? So wirst Du fragen. Mein lieber Freund — ich weiß, daß mir nur noch kurze Zeit zum Leben bleibt und habe Dir eine große, große Bitte ans Herz zu legen, Dir und Deiner Maria. Ich hoffte, Dich noch selbst aufsuchen zu können, um Dir ein Vermächtnis zu übergeben und in der Heimat zu sterben. Aber mir ist, als könne ich dies Ziel nicht mehr erreichen, und so will ich für alle Fälle niederschreiben, was ich von Dir erbitte im Gedenken an unsere alte Freundschaft. Kahn ich nicht mehr zu Dir kommen, so soll der Brief für mich sprechen, der nur in Deine Hände gelangen wird, wenn ich bereits ein toter Mann bin.
Laß Dir erst aus meinem Leben erzählen.
Ich ging damals zunächst nach Mexiko und blieb mehrere Jahre auf den Plantagen meines Bruders. Er hatte jedoch noch Besitzungen in Kalifornien, und seit neun Jahren lebe ich auf diesen kalifornischen Besitzungen. Kurz bevor ich für immer hierher übersiedelte, hatten mein Bruder und seine Frau bei einem räuberischen Überfall während eines Aufstandes das Leben verloren. Die Besitzungen waren verwüstet und konfisziert, und nur mit Mühe rettete ich mir und einer Nichte meiner Schwägerin, die im Hause meines zehn Jahre älteren Bruders lebte, das nackte Leben. Mercedes war ein stilles, sanftes Geschöpf — sie liebte mich schon lange, und so wurde sie meine Frau, nachdem wir auf den kalifornischen Besitzungen meines Bruders in Sicherheit waren, dessen alleiniger Erbe ich war, da er kinderlos starb.
Mercedes schenkte mir ein Töchterchen, das wir nach meiner verstorbenen Schwägerin Juanita tauften. Bei dem Aufstand, der meinem Bruder das Leben gekostet hatte, erhielt auch ich, als ich Mercedes rettete, einen Streifschuß in die Lunge. Nur mühsam schleppte ich mich mit ihr in den Wald, wo uns dann ein treuer Diener meines Bruders auffand und uns unter Gefahr seines eigenen Lebens über die Grenze geleitete.
Pedro, so hieß der treue Diener, blieb dann für immer bei uns. Wochenlang lag ich jenseits der Grenze in einer Farm, dem Tode nahe. Auf dem Krankenbett ließ ich mir Mercedes antrauen, damit sie als meine Erbin ein Anrecht auf den mir zugefallenen Besitz hatte.
Aber ich genas unter Mercedes’ und Pedros treuer Pflege. Wir setzten unsere Reise fort und gelangten auf den nun mir gehörenden Besitzungen an.
Aber die überstandenen Strapazen, die Schrecken des Aufstandes hatten unsere Gesundheit schwer geschädigt. Nachdem Mercedes unserem Töchterchen das Leben gegeben hatte, siechte sie dahin. Sie erholte sich nicht wieder, und auch ich war mit meiner Gesundheit gar nicht mehr zufrieden. Fünf Jahre nach der Geburt unseres Töchterchens starb meine Frau. Ich habe sie herzlich betrauert, denn wenn ich sie auch nicht so lieben konnte, wie ich Maria geliebt habe, so war sie mir doch sehr teuer geworden, und ich hatte ja außer ihr und meinem Kinde keinen Menschen auf der Welt, der zu mir gehörte.
Nun war ich allein mit meiner kleinen Juanita — und ich wußte, daß auch mir kein langes Leben beschieden sein würde. Der Arzt hatte es mir auf meine Bitte nicht vorenthalten, daß meine Jahre gezählt seien.
Mir ließ der Gedanke keine Ruhe: Was wird aus deinem Kind, wenn du stirbst? Wem konnte ich meine kleine Juanita anvertrauen? Und da dachte ich an die beiden Menschen, die mir einst die liebsten auf der Welt waren, und ich malte mir aus, wie mein armes Kind von Euch aufgenommen würde, wenn ich es Euch ans Herz legte. Ich sah dann Maria liebevoll bemüht, meiner kleinen Juanita die Mutter zu ersetzen, sah in Dir ihren zweiten Vater. Und es kam wie ein süßer Trost über mich. Juanita würde nicht verlassen sein, sie würde bei Euch eine zweite Heimat und ein liebevolles Verstehen finden. Kannst Du mir nachfühlen, mein Bernhard, wie mich der Gedanke beglückte, daß Maria meinem Kind eine Mutter sein würde? Sie, die beste und edelste der Frauen — was würde sie meinem Kind für eine herrliche Erzieherin sein.
Der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Und mit ihm war eine heiße Sehnsucht in mir erwacht, Euch und die Heimat noch einmal wiederzusehen, ehe ich sterbe. So begann ich wegen des Verkaufs meiner Güter in Unterhandlung zu treten und mich langsam von meinen Besitzungen zu lösen. In wenigen Wochen ist alles abgeschlossen, mein Besitz ist zu Geld gemacht, das ich auf deutschen Banken angelegt habe. Aber die fortwährenden Aufregungen der letzten Zeit haben meine Kräfte aufgezehrt, und zuweilen kommt die Angst über mich, daß ich mein Vorhaben, nach der Heimat zu reisen, nicht mehr ausführen könne. Deshalb schreibe ich für alle Fälle diesen Brief an Dich und erkläre meinen letzten Willen so genau und ausführlich, als wäre es gewiß, daß ich Dich nicht mehr sehen und sprechen kann. Denn Du sollst der Vormund meiner Tochter sein, gleichviel, ob Du und Maria Euch entschließen könnt, mein Kind bei Euch aufzunehmen — oder nicht.
Ich bitte Euch aber mit der ganzen Kraft meiner Seele, nehmt Juanita bei Euch auf, gebt ihr eine Heimat. Es ist mir ein so tröstlicher Gedanke, daß mein Kind in Eurem Schutz zurückbleibt. Kann ich Euch nicht mehr erreichen, dann soll mein alter treuer Diener Pedro meine Tochter und meine Aufzeichnungen zu Euch bringen, während er diesen Brief als Anmeldung vorausschicken soll.
Bei unserem dortigen Konsul habe ich mich nach Dir erkundigt und erfahren, daß Du mit Deiner Frau und zwei Söhnen noch in demselben Haus wohnst, in das Du mit Maria nach Eurer Hochzeit einzogst. Ich sehe nun im Geiste mein Kind in Eurer Mitte und flehe Euch nochmals an — nehmt es voll Liebe auf.
Meine Tochter kommt nicht mit leeren Händen zu Euch. Alle Kosten, die Euch durch ihren Aufenthalt in Eurem Hause verursacht werden, sollen Euch reichlich vergütet werden, denn Ihr habt selbst Kinder, denen Ihr nichts entziehen dürft. Juanitas Erbe beträgt nach deutschem Gelde etwas über zwei Millionen Mark. Dieses Geld ist, wie ich schon bemerkte, vorläufig auf deutsche Banken überwiesen worden. Du, mein Bernhard, sollst als Juanitas Vormund darüber bestimmen, wie es ferner gut und sicher angelegt wird. Ich habe mir nur vorbehalten, Bestimmungen zu hinterlassen, in welcher Weise diese Vermögensangelegenheiten geregelt werden sollen, falls sich Juanita einmal sehr jung verheiraten sollte. Auch in diesem Fall sollst Du, mein Bernhard, das Bestimmungsrecht behalten, ob der künftige Gatte meiner Tochter über ihr Vermögen verfügen darf, oder ob ihm nur die Nutznießung davon zustehen soll. Du wirst in diesem Fall, davon bin ich überzeugt, so gewissenhaft urteilen, ob Juanitas künftiger Gatte Vertrauen verdient, wie ich es selbst tun würde. Bis zu Juanitas Mündigkeit sollst Du aber auf jeden Fall ihr Vermögen verwalten.
Genaue Bestimmungen über das alles findest Du in meinen Aufzeichnungen. Du siehst daraus, wie fest ich Dir vertraue und wie ruhig ich meinen Besitz in Deine Hände lege, so ruhig wie meines Kindes Seele in die Hände Deiner Maria.
Solange Juanita in Deinem Hause weilt, steht Dir von ihren Zinsen jährlich eine Summe von fünfzehntausend Mark zu, als Erziehungsbeitrag, denn ihr Aufenthalt soll Dir keine Unkosten verursachen. Wird sie später in Gesellschaft eingeführt, so erhält sie natürlich außerdem ein entsprechendes Nadelgeld. Das alles findest Du noch ausführlich aufgezeichnet. Es soll da nicht gespart werden, wenn ich auch wünsche, daß sich Nita ganz in Euren Haushalt einfügt, ohne Euch Störungen zu verursachen. Meine kleine Nita ist ein sanftes, gutherziges Kind und steht jetzt im achten Lebensjahr. Ich hoffe, Ihr gewinnt sie lieb und schenkt ihr ein Plätzchen in Eurem Herzen. Bedenkt, daß sie eine Waise ist und niemanden auf der Welt hat. Sterbe ich, ehe ich Nita zu Euch bringen kann, so wird Pedro sich sofort mit ihr aufmachen, zugleich wird dieser Brief an Dich abgehen. Pedro wird mit Nita wohl bald nach diesem Briefe bei Dir eintreffen. Er geht, sobald er meinen Auftrag ausgeführt hat, hierher zurück. Ich habe ihm ein Häuschen und ein Stück Land geschenkt, wo er sich zur Ruhe setzen soll. Pedro ist ein kluger, gebildeter Mensch, er wird Dir gern Einzelheiten aus meinem Leben berichten, denn er ist mir völlig ergeben und war schon meinem Bruder ein treuer Beamter. Er ist ein Landsmann von meiner Frau, ein Spanier, kann sich aber zur Not auch in deutscher Sprache mit Dir verständigen.
So, mein Bernhard, ich hoffe, Du wirst nun alles Nötige wissen. Und nochmals lege ich Dir die heiße Bitte ans Herz, Dir und Maria — nehmt meine Nita bei Euch auf. Ich weiß, Ihr werdet es tun, denn ich kenne Euch beide und habe zu keinem Menschen so großes Vertrauen wie zu Euch. Es bleibt mir auch keine Wahl. Sollte es Euch aber doch aus irgendeinem Grunde unmöglich sein, meine heiße Bitte zu erfüllen — so muß Nita mit Pedro hierher zurückkehren und bei ihm bleiben. Aber er ist Junggeselle und kann Nita natürlich nicht das sein, was Ihr für sie sein könntet. Nun leb wohl, mein Bernhard — diesmal für immer. Und einen letzten Gruß für Maria! — Heißen Dank Euch beiden im voraus für alles, was Ihr meinem Kinde zuliebe tut. Alles Glück der Welt für Euch — laßt mein Kind daran teilnehmen, damit seine Jugend nicht ohne Sonne und Wärme ist.
Leb wohl, mein Bernhard!
Dein treuer Freund Justus Trebin«
Es waren seltsame Gefühle, die Bernhard Falkner beim Lesen dieses Schreibens beherrschten. Justus Trebin hatte geglaubt, daß Maria noch am Leben war. Der Konsul, bei dem er sich erkundigt hatte, hatte vielleicht gar nicht gewußt, daß Maria Falkner gestorben und an ihre Stelle längst eine andere getreten war. Sicher war es Justus Trebin hauptsächlich darum zu tun gewesen, seine kleine Tochter den Händen der Frau zu übergeben, die er einst namenlos geliebt und verehrt hatte, die er nie hatte vergessen können. Ob er sein Kind wohl auch in das Haus des Freundes geschickt haben würde, wenn ihm gesagt worden wäre: »In Bernhard Falkners Haus und Herzen wohnt jetzt eine andere als Maria?« — Aber gleichviel — Justus war tot, da er seinen Brief in den Händen hielt. Und sein Kind war auf dem Wege hierher und konnte jeden Tag eintreffen. So sollte die kleine Juanita auch eine Heimat finden in seinem Hause. Das war er dem einstigen Freund schuldig, der vertrauensvoll alles, was er hinterließ, in seine Hände legte. Und er wollte der kleinen Waise ein guter Vormund, ein treuer Schützer und Hüter sein und ihr Vermögen in ehrlicher, uneigennützigster Art verwalten, so wie es Justus von ihm erwartet hatte. Es war ja nicht daran zu denken, daß er das heimatlose Kind von seiner Schwelle gehen ließ.
Das war das erste, das Bernhard Falkner klar wurde.
Aber dann dachte er an Helene.
Was würde sie zu dem kleinen Fremdling sagen?
Er stützte den Kopf nachdenklich in die Hand. Obwohl er Helene noch immer leidenschaftlich liebte, mußte er sich doch eingestehen, daß sie wenig dazu geschaffen war, einem fremden Kind die Mutter zu ersetzen, Pflichten zu übernehmen, die ihr Mühe und Lasten auferlegten.
Es würde nicht leicht sein, sie zu dieser Aufgabe zu überreden.
Grübelnd sann er über die ganze Sache nach. Und plötzlich kam ihm ein Gedanke, der ihn zusammenzucken ließ. Er sprang auf und starrte vor sich hin. Und dann entfaltete er den Brief noch einmal und überlas von neuem die Stelle, wo von dem Vermögen der kleinen Juanita die Rede war. Wie von einem Gedanken überwältigt sank er wieder in seinen Sessel zurück. Seine Augen weiteten sich und glänzten wie neubelebt, und seine Brust hob sich unter einem tiefen Atemzug.
Das war ja die Rettung aus seiner verzweifelten Lage, da schickte ihm der Himmel eine Hilfe, mit der er nie gerechnet hatte.
Zwei Millionen Mark sollte er nach eigenem Ermessen anlegen! Wer wollte ihm verdenken, wenn er davon dreihunderttausend Mark in seinem eigenen Geschäft anlegte anstelle des auszuzahlenden Kapitals seines Sohnes? Er konnte es mit ruhigem Gewissen tun, denn sein Geschäft war gut fundiert. Und dann — der Erziehungsbeitrag für die kleine Juanita — würde der nicht reichlich den Ausfall von Gerds Zinsen decken?
War das nicht ein Glücksfall ohnegleichen? Wurde ihm da nicht mit einem Male alle Sorge abgenommen?
Daran hatte er zuerst gar nicht gedacht. Aber nun kam ihm die Erkenntnis wie eine Erleuchtung.
Und wenn er das alles Helene auseinandersetzte, dann würde sie sicher die kleinen Unannehmlichkeiten mit in kauf nehmen, die ihr die Anwesenheit des Kindes verursachten. Man könnte ja genügend Personal zur Pflege der kleinen Waise engagieren, so daß Helene wenig Mühe und gewissermaßen nur die Oberaufsicht haben würde.
Bernhard Falkner war ein Mann — er wußte nicht, daß der kleinen Juanita in seinem Hause das Beste fehlen würde: die Liebe. Er kannte Helene nicht, wußte nicht, welch ein großer Unterschied es war, ob eine Frau wie Helene oder die warmherzige, feinfühlige und liebevolle Maria diesen kleinen Fremdling ans Herz nehmen würde. Justus Trebin hatte sein Kind Marias Schutz empfohlen — einer Helene hätte er es sicher nicht anvertrauen mögen. Aber das wußte Bernhard Falkner nicht, er glaubte, es sei gleich, wer Juanita aufzog, wenn es nur überhaupt Frauenhände waren.
Sichtlich belebt und froh faltete er jetzt den Brief zusammen und steckte ihn zu sich. Dann sah er nach der Uhr. Es trieb ihn, Helene über das alles zu berichten und mit ihr zu sprechen. Aber jetzt gleich konnte er doch nicht fort. Er mußte erst noch warten, bis ihm verschiedene eilige Briefe zur Unterschrift vorgelegt wurden.
II
Gerhard Falkner stand mit düsterem Gesichtsausdruck am Fenster und starrte in den Garten hinab, der die Villa seines Vaters umgab.
Die Züge des knapp Einundzwanzigjährigen erschienen hart und gereift wie die eines gereiften Mannes. Unter der vorspringenden Stirn lagen die grauen Augen tiefgebettet, und das breite, trotzige Kinn und der herbe Zug um den Mund hatten nichts Jünglingshaftes mehr. Die Art, wie er die schmalen Lippen fest aufeinander preßte, verriet, daß er sich schon viel in Selbstbeherrschung geübt hatte.
Hinter ihm, mitten im Zimmer, stand seine Stiefmutter, mit der er wieder einmal einen jener erbitterten Kämpfe geführt hatte, die ihm das Leben im Vaterhause zur Qual machten. Solange er denken konnte, hatten sie sich feindlich gegenübergestanden.
Sie stand hochaufgerichtet, die noch immer sehr schöne Frau mit dem rotgoldenen Haar und dem kalten Sprühen der seltsamen Augen. Hochgewachsen war ihre in ein elegantes Hauskleid gehüllte Gestalt, das sich weiß und gefällig ihren schönen Formen anschmiegte. Niemand hätte ihr achtunddreißig Jahre gegeben, sie hätte gut für zehn Jahre jünger gelten können. Ihr Gesicht hatte sich noch völlig den Schmelz der Jugend bewahrt. Gegen das metallisch schimmernde Haar, das zu einer kleidsamen Frisur aufgesteckt war, hob sich der eigenartige, mattweiße Teint, der an die Farbe echter Perlen erinnerte, besonders reizvoll ab. Aus diesem weißen Gesicht leuchteten ein tiefroter, feingeschwungener Mund und zwei Augen, deren seltsames Farbenspiel faszinierend wirkte. Diese schienen bei jeder Gelegenheit die Farbe zu wechseln zwischen blau, grün und grau und waren unergründlich und trügerisch wie das Meer.
Mit diesen Augen übte Frau Helene Falkner auf fast alle Menschen einen suggestiven Einfluß aus, dem sich selten jemand entziehen konnte. Und doch blickten sie kalt und seelenlos und konnten wie die eines Raubtieres flimmern. Nur selten kam aber jemand dazu, Frau Helenes Augen ruhig und objektiv zu betrachten, da sich jeder wie gebannt fühlte, der sich in das Studium dieser Augen versenken wollte.
Aber einer von den Menschen, über die sie keine Macht hatte, war ihr Stiefsohn Gerhard. Immer wieder versuchte sie vergeblich, ihre Macht an ihm zu erproben. Gerhard Falkner war jedoch trotz seiner Jugend eine zu starke Persönlichkeit, um sich leicht fremden Einflüssen unterzuordnen.
Schon als Knabe hatte er einen bewundernswert festen Willen gehabt. Seine Stiefmutter nannte das freilich Starrköpfigkeit und verklagte ihn deshalb oft bei seinem Vater. Vielleicht verdiente auch das, was sich gegen seine Stiefmutter kehrte, diesen Namen. — Er haßte sie — so glühend, wie sein ungestümer, impulsiver Charakter, den er freilich mit großer Energie zügelte, hassen konnte. Dieser Haß war mit ihm groß geworden. Er war aus tausend Schmerzen geboren und aus der Gewißheit, daß diese Frau seiner eigenen Mutter das Leben vergiftet hatte. Zu dieser Gewißheit gesellte sich noch der Verdacht, daß seine Mutter durch seine Stiefmutter in den Tod getrieben worden war.
Auch wußte er, daß seine Stiefmutter ihn vorsätzlich und mit Bedacht dem Herzen des Vaters entfremdete, und so standen sie einander feindlich gegenüber, im ewigen erbitterten Kampf.
Frau Helene Falkner haßte ihren Stiefsohn mindestens im gleichen Maße. Aber sie verstand es immer, sich meisterhaft zu beherrschen und zu verstellen, so daß kein anderer Mensch von diesem Gefühl etwas merkte, außer Gerhard Falkner selbst. Nie ließ sie sich in Gegenwart anderer hinreißen, dieses Gefühl durchblicken zu lassen, während Gerhard sie wohl durchschaute und dann zuweilen verleitet wurde, sich durch seinen ungestümen Groll selbst ins Unrecht zu setzen.
»Also, du bleibst dabei, dein Vaterhaus zu verlassen?« fragte Frau Helene kalt und beherrscht, mit stechenden Blicken nach Gerhard hinübersehend.
Er wandte sich um.
»Ja — ich bleibe dabei«, versetzte er ruhig und unbewegt.
»Und du willst wirklich von deinem Vater verlangen, daß er dir jetzt dein mütterliches Erbe auszahlt?« fragte sie lauernd.
Er fuhr sich mit der schmalen, nervigen Hand hastig durch das kurzgeschnittene Haar, das die hohe Stirn freiließ.
»Das werde ich mit meinem Vater selber besprechen.«
Sie lachte kurz und höhnisch auf.
»Weil du ganz genau weißt, daß dein Vater, ohne sich zu wehren, diese Forderung bewilligen wird. Er ist es ja gewohnt, daß sein ältester Sohn seinen Sorgen fremd gegenübersteht.«
Mit einem dunklen Blick sah der junge Mann in das schöne, kalte Frauenantlitz.
»Wie seltsam, daß du mir das zum Vorwurf machst. Wer hat mich denn meinem Vater entfremdet?«
»Dein verstockter Sinn, deine Ungebärdigkeit. Aber lassen wir das. Es handelt sich jetzt nicht um Gefühle, sondern um das Geld, das du aus der Fabrik ziehen willst. Wenn deine Mutter nur nicht so unglaublich töricht testiert hätte! Es ist ja Unsinn, einem so jungen Menschen schon sein ganzes Vermögen zu übergeben.«
Die Augen des jungen Mannes flammten jäh auf und sein Blick bohrte sich düster in den ihren.
»Schweig du von meiner Mutter — ich leide nicht, daß du nur ihren Namen nennst«, sagte er mit verhaltener Stimme, in der ein heißer, ungestümer Groll bebte.
Sie erblaßte ein wenig, warf aber den Kopf zurück und hielt seinen Blick aus.
»Warum nicht?« fragte sie spöttisch.
Schnell trat er dicht an sie heran.
»Weil ich es nicht leide — von dir nicht!« rief er im schmerzlichen Zorn.
Sie wich unwillkürlich einen Schritt von ihm zurück. Aber dann bohrten sich ihre Augen mit einem seltsam flimmernden Blick funkelnd in die seinen, als ob sie ihn damit zähmen wollte. Wie so oft schon sah sie aber ein, daß dieser Blick, der ihr sonst viel Macht über die Menschen gab, an ihrem Stiefsohn wirkungslos abprallte. Und doch hätte sie gerade ihn so gern unter ihren Willen gebeugt.
Mit verbissener Wut gab sie es auf, ihn mit ihren Blicken zu bändigen. Ihre Augen verloren den faszinierenden Ausdruck und schlossen sich einen Moment wie übermüdet. Dann sagte sie mit einem spöttischen Achselzucken:
»Spiele dich nicht auf mit dramatischen Gebärden — das ist lächerlich. Und meinetwegen denn — gehe zu deinem Vater und erledige mit ihm diese Geldangelegenheit. Aber vorher will ich dir noch eins zu bedenken geben, was dir dein Vater in seinem Stolz verschweigen wird: du wirst ihn ruinieren, wenn du darauf bestehst, daß dir dein mütterliches Erbe gerade jetzt ausgezahlt wird.«
Auch Gerhard hatte sich zur Ruhe gezwungen. Nun lag in seinen Augen ein ungläubiges Staunen.
»Das glaube ich nicht. Mein Vater weiß doch seit vielen Jahren, daß an meinem einundzwanzigsten Geburtstag diese Summe fällig ist. Er ist ein zu guter Kaufmann, um nicht beizeiten für Deckung einer Forderung gesorgt zu haben. Du hast diese Angelegenheit unbedingt zwischen uns zur Sprache bringen wollen. Nun gut — es ist geschehen. Ich habe dir Rede und Antwort gestanden, soweit ich das mit einem fremden Menschen besprechen kann und mag. Alles Übrige werde ich mit meinem Vater selbst verhandeln.«
»Gut, gut«, sagte sie gereizt, »tue, was du willst — und auf dein Haupt die Folgen. Ich habe es für meine Pflicht gehalten, dich zu warnen, weil ich weiß, daß dein Vater es nicht über sich bringen wird, dich um Aufschub zu bitten. Er wird dir auch nicht sagen, daß er in letzter Zeit schwere Verluste erlitten hat. Gerade, um dein Kapital aus der Fabrik herausziehen zu können, hat er sich zu gewagten Spekulationen verleiten lassen, die er sonst meidet. Und sie sind ihm fehlgeschlagen. Bestehst du jetzt auf das Auszahlen deines Vermögens, so ist ein Konkurs der Firma Bernhard Falkner kaum zu vermeiden. Nun sieh zu, ob du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, diesen Konkurs herbeizuführen.«
Gerhards Lippen zuckten nervös. Er konnte nicht daran glauben, was sie ihm sagte. Wahrscheinlicher war, daß sie sich vor etwaigen Einschränkungen fürchtete, die ihr auferlegt werden könnten. Sie liebte ein verschwenderisches, glänzendes Leben und veranlaßte den Vater oft zu ganz unsinnigen Ausgaben.
Bisher hatte sein Vater über die Zinsen von Gerhards mütterlichem Erbteil für seinen Haushalt verfügt. Gerhard hatte das, solange er daheim war, als selbstverständlich hingenommen, da diese Zinsen für seine Erziehung verwendet werden sollten. Er hatte nicht kleinlich nachgerechnet, daß für ihn selbst nicht der dritte Teil verbraucht wurde, denn sein Vermögen betrug dreihunderttausend Mark und wurde mit vier Prozent verzinst. Nun aber wollte er sich ganz von seinem Vaterhaus lösen. Bis zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag, der in wenigen Wochen bevorstand, hatte sein Vater Gewalt über ihn und hatte darauf bestanden, daß er daheim blieb. Nun aber wurde er frei — und keine Stunde länger wollte er in den quälenden Verhältnissen weiterleben. Der Vater stand ihm, von der Stiefmutter beeinflußt, fremd gegenüber, und es hielt ihn hier nichts zurück. Er wollte seine Studien in einer anderen Stadt fortführen, obwohl gerade für das von ihm erwählte Studium die Universität seiner Vaterstadt vorzüglich war. Mit allen Fasern seines Seins verlangte er fort von zu Hause, und er wußte nur zu gut, daß ihn die Stiefmutter nur halten wollte, um auch ferner über seine Zinsen verfügen zu können. An seiner Person lag ihr nichts. Nur zu gern hätte sie ihn gehen sehen, wenn mit ihm nicht zugleich sein Vermögen für sie verlorenging.
Und Gerhards Mutter hatte so testiert, daß man ihm sein Erbteil nicht eine Stunde länger verweigern durfte.
An dieses Geld hatte Gerhard jedoch nur soweit gedacht, als es ihm zur Freiheit verhalf. Gesprochen hatte er bisher mit niemandem darüber. Nur vor einigen Tagen waren ihm, nach einer Szene mit seiner Stiefmutter, im Unmut die Worte entschlüpft: »Nur noch einige Wochen, dann nehme ich mein Geld und schnüre mein Bündel. Und dann halten mich keine zehn Pferde mehr hier fest.«
Diese Worte hatte er zu seinem sechs Jahre jüngeren Halbbruder Rudolf geäußert, und der hatte sie schnell seiner Mutter hinterbracht.
Rudolf war der Sohn seines Vaters und seiner Stiefmutter. Zwei verschiedenere Brüder konnte es nicht so leicht geben. Sie hatten auch wenig für einander übrig. Der frühreife, schon bis ins Mark verdorbene Rudolf war seiner Mutter echter Sohn, für den in Gerhards redlicher Seele nur Verachtung lebte. Und Rudolf haßte Gerhard, weil er in ihm den größeren, überlegenen Charakter fühlte, gegen den er sich mit kleinlicher Bosheit zur Wehr setzte.
Gerhards Vermutung, daß Rudolf seine Äußerung der Mutter überbracht hatte und daß diese nun deshalb heute die Angelegenheit mit ihm zur Sprache brachte, war ganz richtig.
Gerhard stand dieser Angelegenheit nur deshalb so schroff ablehnend gegenüber, weil er instinktiv allem feindlich gesinnt war, was ihm von seiner Stiefmutter kam. Im Innern aber fragte er sich beunruhigt, ob die Behauptungen seiner Stiefmutter auf Wahrheit beruhten. Daß sie es mit der Wahrheit nie sehr genau nahm, wußte er, und er vermutete auch, daß sie absichtlich übertrieb, um ihn ängstlich zu machen, um nur ja nicht zu Einschränkungen gezwungen zu werden. Denn obwohl sie aus den bescheidensten Verhältnissen stammte, hatte sie einen großen Hang zu Wohlleben und Verschwendung, der wohl auch die Triebfeder dazu gewesen war, daß sie sich mit der zähen Beharrlichkeit ihres berechnenden Charakters an Bernhard Falkner, Gerhards Vater, gehangen und sich an seine Seite zu stellen gewußt hatte, obwohl sie erst ein Menschenschicksal zertreten mußte, um zu ihrem Ziel zu gelangen.
Helene Falkner war die Tochter eines kleinen Beamten, der mit seiner schönen Tochter hochfliegende Pläne gehabt hatte und sie zur Sängerin ausbilden lassen wollte. Ehe er sein Ziel erreicht hatte, starb er, und da hatte sich damals Frau Maria Falkner, Gerhards Mutter, der schönen jungen Waise angenommen und sie weiter ausbilden lassen. Sie hatte in ihrer edlen, gütigen Art die junge Kunstnovizin selbst in ihr Haus geführt, ahnungslos, welch bösem Geist sie dadurch Einlaß gewährte in ihr friedliches, glückliches Leben. Zum Dank für alle Güte der sanften Frau hatte Helene Alving — so hieß sie als Mädchen — ihre begehrlichen Blicke auf den Gatten ihrer Wohltäterin geworfen und ihn mit allem Raffinement einer schlauen Kokotte in ihre Netze gezogen. Und Bernhard Falkner war ihren schlauen Verführungskünsten erlegen, so daß er vergaß, was ihm bisher seine Frau gewesen war. Die unselige Leidenschaft für Helene Alving hatte ihn gegen alles andere auf der Welt blind und taub gemacht.
Zwei Jahre lang hatte Gerhards Mutter verzweifelt um ihr Glück gekämpft gegen diese Rivalin. Dann war sie kraftlos zusammengebrochen.
Und eines Morgens hatte man die sanfte, gütige Frau tot in ihrem Bett aufgefunden. Angeblich hatte sie irrtümlicherweise zu viel von einer schmerzlindernden Medizin genommen, die ihr der Arzt gegen ein nervöses Leiden verschrieben hatte.
Aber die Dienstboten und auch andere, dem Hause nahestehende Personen, erzählten sich verstohlen, die arme junge Frau habe mit Absicht eine starke Dosis des Giftes genommen, um sich das Leben zu nehmen.
Auch Gerhard hatte als Kind dergleichen Äußerungen aufgefangen und in seinem Herzen bewahrt.
Als dann, ein Jahr nach dem Tod seiner Mutter, sein Vater Helene Alving zur Frau genommen hatte, waren alle Dienstboten entlassen und durch neue ersetzt worden. Nur die Köchin Ernestine Wünscher, die man kurzweg Tina rief, war geblieben, weil sie den mutterlosen Gerhard so treu gepflegt hatte und eine ruhige, verständige Person war, die mit niemandem klatschte. Bernhard Falkner hatte es nicht vermocht, Tina zu entlassen, obwohl seine zweite Gattin gar nicht mit ihrem Bleiben einverstanden gewesen war. Tina hatte aber dann doch einen vertrauenerweckenden Eindruck auf ihre neue Herrin gemacht und war jetzt noch im Hause.
Zwischen Gerhard Falkner und Tina, die nun schon nahe an die vierzig war, bestand ganz im geheimen ein seltsames Verhältnis, das nur ihnen selbst bekannt war. Tina hing mit großer Liebe an ihrem jungen »Herrn Gerd« und teilte im tiefsten Innern seinen Haß und Abscheu gegen seine Stiefmutter. Nur seinetwegen war sie damals im Hause geblieben. Tina wußte mehr von all den Dingen, die im Hause vorgegangen waren, als sonst jemand. Sie hatte das Leid und die Verzweiflung von Gerhards Mutter gesehen, war Zeuge gewesen, wie »die rothaarige Hexe« sich an ihren Herrn gehängt und ihn »behext« hatte, und war fest davon überzeugt, daß nur sie allein an allem Leid und Ungemach schuld war. Sie wartete noch immer darauf, daß Bernhard Falkner dahinterkam, was für ein »schlechtes, falsches Weibsbild« die neue Gnädige war. Aber dieser schien blind und taub zu sein der schönen Frau gegenüber. Er liebte sie noch immer mit blinder Leidenschaft und ließ sich dermaßen von ihr beeinflussen, daß in seinem Hause nur das geschah, was sie wünschte. Er war willenlos in ihren Händen, und wo sie ihn hinführte, da ging er mit.
So hatte sie auch sein Herz gegen Gerhard mehr und mehr verhärtet und hatte Mißtrauen und Unfrieden gesät zwischen Vater und Sohn. Das wußte Gerhard nur zu genau. Er liebte seinen Vater, obwohl er wußte, daß dieser seine Mutter unglücklich gemacht und ihr die Treue gebrochen hatte. Tina hatte ihm heimlich so oft versichert, daß sein Vater lange nicht so schuldig sei wie die Stiefmutter.
Es quälte Gerhard unsagbar, daß zwischen dem Vater und ihm eine trennende Mauer aufgebaut worden war, und er konnte es seiner Stiefmutter nicht verzeihen, daß sie, die ihm die Mutter geraubt, ihm auch noch den Vater entfremdet hatte. Liebeleer und einsam war seine Jugend dadurch geworden.
Sein ungestümes rasches Blut durchbrach zuweilen den Damm, den er mit für seine Jugend bewundernswerter Selbstbeherrschung selbst aufgebaut hatte, und dann vermochte er den Abscheu und die Verachtung seiner Stiefmutter gegenüber nicht zu verbergen. Auch in der eben stattgefundenen Szene war sein Gefühl wieder mit ihm durchgegangen. Aber nun hatte er sich wieder in der Gewalt, und ruhig und kalt blickten seine grauen, tiefliegenden Augen, als er sagte:
»Ich werde so zu handeln wissen, daß ich mein Gewissen nicht belaste. Jedenfalls bespreche ich das alles nur mit meinem Vater. Ich hoffe, daß ich wenigstens in dieser Angelegenheit einer Mittelsperson nicht bedarf. Wenn meinem Vater wirklich ein Konkurs droht, dann hoffe ich doch, daß er so viel Vertrauen zu mir hat, um mir das mitzuteilen. Und damit dürfte diese Angelegenheit zwischen uns erledigt sein. Ich bitte dich, mir zu gestatten, daß ich mich auf mein Zimmer zurückziehe, ich habe noch zu arbeiten.«
Kurz verneigte er sich. Die höfliche Form ließ er nie ihr gegenüber außer acht. Schnell verließ er dann das Zimmer, ohne eine Antwort abzuwarten.
Sie sah ihm nach mit einem flimmernden, funkelnden Blickund ballte die Hände. Ihr schönes Gesicht hatte jetzt einen dämonischen, unheimlichen Ausdruck.
»Wenn ich ihn beugen könnte, diesen Trotzkopf!« stieß sie zwischen den Zähnen hervor.
Und dann warf sie sich wie erschöpft in einen Sessel.
Was hatte sie nicht schon alles versucht, diesen Starrkopf zu besiegen. Es war alles vergeblich gewesen. Mit eiserner Stirn stand er ihr gegenüber und blieb immer der Sieger, obwohl sie gerade ihn so gern bezwungen hätte. Wo hatte dieser Jüngling die Kraft her, ihr stets zu widerstehen?
Und doch war etwas in ihrem tiefsten Innern, das sie zwang, seine Willenskraft anzuerkennen, fast zu bewundern. Sie, der alle Männer zu Füßen lagen, wenn sie es wünschte, sie sah in diesem Knaben ihren Meister. Und widerwillig mischte sich in ihren Haß gegen ihn ein leises Gefühl der Bewunderung.
Im Grunde war sie froh, wenn er aus dem Hause kam, denn seine Augen folgten ihr wie ein stets lebendiger Vorwurf, wie eine fortwährende Anklage.
Nicht, daß die kaltherzige Frau Gewissensbisse empfunden hätte über das, was sie getan hatte. Sie war nicht sensibel. Und ihre Natur forderte gebieterisch ihr Recht. Das Leben hatte sie in den Schatten gestellt, während andere sich im Sonnenlicht labten. Da hatte sie sich energisch Platz geschaffen unter den Auserwählten des Glücks im hellen, warmen Sonnenlicht. Daß es dabei über ein Menschenschicksal hinwegging, über ein Menschenleben, das hatte sie nicht lange beirrt. Im Lebenskampf heißt es Ich — oder du! Und sie war ein Mensch mit stark ausgeprägtem Egoismus, der sich um jeden Preis zur Geltung brachte.
Kam aber doch einmal eine Stunde, wo ihr eine andere Stimme unbequem wurde, dann waren sicher Gerhards Augen daran schuld. Und deshalb hätte sie ihn nur zu gern für immer gehen sehen — hätte er nur nicht das große Vermögen mitgenommen, das ihm seine Mutter hinterlassen hatte.
Ein wenig ruhiger geworden überlegte sie, daß sie nun, da ihr Bemühen bei Gerhard vergeblich gewesen war, ihren Mann beeinflussen mußte, daß er seinen Sohn bestimmte, ihm das Kapital zu belassen. Freilich — die Zinsen gingen auf alle Fälle verloren, die mußte er an Gerhard auszahlen, sobald dieser das Haus verließ. Und das war ein böser Ausfall in ihrem Etat. Aber es war doch immerhin besser, als das ganze Vermögen zu verlieren.
Warum Frau Maria Falkner ihren Sohn an diesem Tage, der ihn mündig und frei von der väterlichen Gewalt machte, auch zugleich in pekuniärer Beziehung unabhängig machen wollte — das konnte niemand wissen. Hatte sie vorahnend empfunden, wie sehr er sich nach dieser völligen Freiheit sehnen würde, hatte sie geahnt, daß die Frau, die ihr Leben zerstört hatte, auch ihrem Sohn Licht und Wärme im Vaterhause stehlen würde?
Frau Helene stützte den Kopf in die Hand und sah mit starren Augen vor sich hin.
Nach einer Weile wurde die Tür geöffnet, und herein trat ein bildschöner, fünfzehnjähriger Knabe. Der Ausdruck seines Gesichts wurde nur beeinträchtigt durch seine eigentümlich listigen, verschlagenen Augen.
Es war Rudolf Falkner, der Sohn Bernhard Falkners aus zweiter Ehe.
Er glich seiner schönen Mutter sehr. Dieselben feingeschnittenen Züge, dasselbe rotgoldene Haar und auch der eigenartige, mattweiße Teint. Am auffallendsten aber war die Ähnlichkeit der beiden Augenpaare. In beiden war das faszinierende Leuchten, das wechselnde Farbenspiel und zuweilen das unheimliche Flimmern und Funkeln.
Rudolf Falkner trat, die Hände in den Taschen, mit einem lauernden Blick vor seine Mutter hin. Die Haltung seiner schlanken und doch kräftigen Gestalt war lässig, aber nicht ohne eine gewisse Anmut.
»Ist Gerd fort, Mama?« fragte er, sich umsehend.
Über Frau Helenes Gesicht flog bei seinem Anblick ein stolzes, zärtliches Leuchten. Dieser Knabe war das einzige, das ihr sonst so kaltes Herz mit Liebe umfaßte. Es war freilich eine Liebe, die mehr auf Äußerlichkeiten basierte. Daß ihr Sohn ihr Ebenbild war, erfüllte sie mit zärtlichem Stolz. Sie war blind gegen die großen Fehler dieses Knaben, denn es waren ihre eigenen Fehler, die sie ihm mit ihrer Schönheit vererbt hatte.
»Er ist auf seinem Zimmer, Dolf«, antwortete sie, ihn auf die Wangen küssend.
Er machte sich ziemlich unsanft los.
»Nun — hast du es ihm ordentlich gegeben?« forschte er eifrig und schadenfroh.
»Ja, ja, mein Dolf — aber es hat wenig genützt.«
»Also wird er das Geld nicht in Papas Fabrik stehen lassen?« fragte der frühreife Bengel hämisch.
Frau Helene seufzte.
»Wohl kaum. Er will selbst mit Papa sprechen.«
Dolf machte eine verächtliche Bewegung.
»Natürlich, weil er weiß, daß Papa schwach ist und es ihm gibt. Er nimmt dann das schöne Geld und geht damit ab in die weite Welt. Der hat’s gut.«
Frau Helene zog ihn zärtlich an sich. Aber Dolf zeigte immer nur ein liebenswürdig gewinnendes Wesen, wenn er sich Vorteile davon versprach. Seiner Mutter war er sicher. Da lohnte es sich nicht wie bei dem Vater, sich zu verstellen und sich in ein günstiges Licht zu setzen. Er machte sich unwirsch los.
»Ach, laß doch, Mama, ich bin doch kein Schoßkind mehr.«
Sie lächelte ihm zu, trotz seiner Unart.
»Fühlst dich schon als Mann, Dolf! Nun, ich wollte dich nur trösten, daß du hinter Gerd zurückstehen mußt. Laß es dich nicht kränken, mein lieber Junge. Papa wird ja schon über diese Schlappe hinwegkommen, es sind bedeutende Aufträge eingelaufen. Und laß mich dann nur sorgen, du sollst nicht zu kurz kommen, das verspreche ich dir.«
Dolf schob die Unterlippe vor.
»Wenn es aber zum Krachen kommt in der Fabrik?« fragte er altklug.
Sie schüttelte den Kopf.
»So schlimm wird es nicht werden. Aber sollte Gerd mit dir darüber sprechen, dann laß ihn nur im Glauben, daß er Papa ruiniert, wenn er das Geld fordert.«
Dolf lachte verschmitzt.
»Aber Mama — ich bin doch nicht dumm.«
»Nein, mein lieber Dolf, du bist mein kluger, vernünftiger Sohn. Wie gut, daß ich mich mit dir darüber aussprechen kann. Nicht einmal mit Papa kann ich so rückhaltlos sprechen wie mit dir.«
Dolf lächelte eitel und selbstgefällig.
»Nun ja, Mama — wir beide verstehen uns eben sehr gut, na — und mir kann so leicht keiner was vormachen. Aber was denkst du nun, was geschehen wird?«
»Vor allen Dingen muß ich Papa zureden, daß er von Gerd verlangt, daß er ihm das Geld läßt.«
Dolf zuckte die Achseln und warf sich in einen Sessel in entschieden anmutiger, aber ebenso flegelhafter Haltung.
»Da mache dir nur nicht viel Hoffnung. Papa wird Gerd kein gutes Wort geben, er ist ihm gegenüber zurückhaltend wie zu einem fremden Menschen.«
Frau Helene seufzte.
»Das liegt natürlich an Gerds starrsinnigem Wesen.«
Dolf schnitt eine Grimasse.
»Daran wohl nicht allein. Papa macht sich nichts aus Gerd, weil du ihn nicht leiden magst. Mich hat Papa viel lieber — ich kann ihn um den Finger wickeln, wenn ich will. Aber Gerd ist auch wirklich ein Ekel, so greulich zugeknöpft und finster. Er dünkt sich natürlich über mich erhaben. Pöh! So’n Schaf! Ich finde ihn unausstehlich, und er mag mich auch nicht leiden. Es ist gar nicht, als ob wir Brüder wären.«
»Er mag dich nicht, weil du mein Ebenbild bist.«
Dolf sah sie forschend an.
»Was hat er nur eigentlich gegen dich?«
»Nichts, nur daß ich seine Stiefmutter bin.«
»Na ja — angenehm mag das nicht sein, eine Stiefmutter zu haben. Und ich bin ihm wohl ein Dorn im Auge, weil er doch durch meine Geburt die Hälfte des väterlichen Erbes verliert. Aber daran ist doch nun nichts mehr zu ändern, und wenn er so klug wäre, wie er sich immer aufspielt, dann hätte er sich längst damit abgefunden. Er ist ja zu dämlich. Weißt du — im Grunde bin ich sehr froh, daß er fortgeht.«
»Ich auch, das glaube mir.«
»Es ist ja so dumm von ihm, daß er studieren will; ewig die blöde Ochserei.«
»Dir kann es ja nur lieb sein, Dolf. Denn wenn Gerd auch Kaufmann werden wollte wie du, dann erhielte er wohl gar als Ältester die Fabrik. Es ist sehr gut, daß du dich entschlossen hast, Kaufmann zu werden.«
»Na, ich bitte dich, Mama, das liegt doch auf der Hand. Und dann brauche ich nicht so zu büffeln. Wenn ich mein Einjähriges in der Tasche habe, dann ist Schluß, dann lasse ich mich von Papa ein paar Jahre auf Reisen schicken. Ich denke da an einen bequemen Volontärposten im Ausland, wo ich mich amüsieren kann. Dann diene ich mein Jahr ab in irgendeinem flotten Regiment, na — und wenn ich dann bei Papa ins Geschäft eintrete, dann gibt er mir sicher bald Prokura und ich bin mein eigener Herr.«
Frau Helene sah ihren frühreifen Sprößling zärtlich an.
»Du bist wirklich ein kluger Junge, mein Dolf. Wie du dir das schon alles so vernünftig ausgedacht hast.«
Er lächelte eitel.
»Na, man macht sich doch beizeiten seinen Lebensplan. Ich habe mir gleich vorgenommen, Kaufmann zu werden, damit ich einmal Papas Fabrik erbe. Gerd hat ja schon von seiner Mutter eine Menge Geld. Da muß ich sehen, daß ich nicht zu kurzkomme.«
»Davon spricht man aber nicht, Dolf«, warnte die Mutter.
Er lachte überlegen.
»Doch nur zu dir, Mama.«
»Nun ja — Papa dürfte so etwas nicht hören.«
»Aber Mama — ich bin doch kein Idiot. Papa ist ein bißchen komisch in solchen Dingen.«
Was Dolf mit »komisch« bezeichnete, das war der sehr ehrenhafte, rechtliche Kern im Wesen seines Vaters. Bernhard Falkner war durchaus kein schlechter Mensch, wenn er sich auch durch Helenes faszinierendes, kokettes Wesen hatte in Schuld und Unrecht verstricken lassen. Er glaubte noch heute, daß seine Frau, gleich ihm, nur aus übergroßer Liebe gefehlt hatte, als sie sich in seine Arme warf, obwohl damals seine erste Frau noch lebte. Keine Ahnung hatte er von Helenes wirklichem Charakter. Ebenso hielt er seinen Sohn Dolf für einen gutherzigen, offenen und ehrlichen Charakter. Wenn er Zeuge hätte sein können von dieser Unterhaltung zwischen Mutter und Sohn — er wäre entsetzt gewesen.
Bernhard Falkner saß noch an seinem Schreibtisch in seinem Privatkontor, als der Kontordiener die Tür öffnete und meldete:
»Herr Gerhard Falkner.«
Bernhard Falkner stutzte und sah sichtlich überrascht auf. Es war noch nie vorgekommen, daß ihn Gerd hier aufsuchte.
Gerhard Falkner war bald nach der Unterredung mit seiner Stiefmutter aufgebrochen. Es drängte ihn, mit dem Vater über die Geldangelegenheit zu sprechen, noch ehe die Stiefmutter in sicher entstellender Weise dem Vater über die Unterredung Bericht erstattete. Und einem raschen Impuls folgend, war er nun herausgekommen in die Fabrik, um ungestört mit dem Vater sprechen zu können.
»Guten Tag, Vater«, sagte er, diesem die Hand reichend.
»Guten Tag, Gerd«, erwiderte dieser, die Hand des Sohnes nur flüchtig berührend und ihn forschend betrachtend. »Was führt dich zu mir? Du siehst mich erstaunt über deine Anwesenheit, da du mir doch sonst geflissentlich aus dem Wege gehst.«
Gerd preßte die Lippen aufeinander, und seine Stirne zog sich im Schmerz zusammen.
»Du irrst, Vater, ich gehe dir nie aus dem Wege«, sagte er dann herb.
»Nun — darüber wollen wir nicht streiten. Also — was wünschst du?«
Gerd hob die Augen und sah ihn fest an.
»Ich wollte etwas mit dir besprechen, Vater — über meine Vermögensangelegenheit.«
Ein finsterer Zug glitt über des Vaters Gesicht.
»Eilt es dir so sehr damit? Noch ist der Termin nicht herangekommen, an dem ich zur Auszahlung des Geldes verpflichtet bin.«
»Nein, Vater, das weiß ich. Aber vorhin hat meine Stiefmutter mit mir über diese Sache gesprochen. Und sie hat mir gesagt, daß es deinen Ruin herbeiführen könnte, wenn ich auf der Auszahlung des Geldes bestünde. Und da bin ich gekommen, um dich zu fragen, ob das wirklich so ist.«
»Und wenn es so wäre?« fragte der Vater scharf.
»Dann würde ich dich bitten, das Kapital ruhig im Geschäft stehenzulassen und mir nur die Zinsen auszuzahlen, weil ich doch meine Studien an einem anderen Ort fortsetzen will.«
Vor einer Stunde noch hätte Bernhard Falkner dies Anerbieten seines Sohnes mit großer Erleichterung angenommen. Aber der Brief Justus Trebins hatte viel geändert. Jetzt glaubte er, es nicht mehr nötig zu haben, von seinem Sohne gleichsam eine Gnade anzunehmen. Er war sehr froh, nicht von ihm abhängig sein zu müssen. Und es erfüllte ihn mit einer gewissen Genugtuung, daß er dieses Anerbieten zurückweisen konnte, obwohl er von Gerds Entgegenkommen angenehm überrascht war. Er wollte das nur nicht zeigen, da man ihm glaubhaft gemacht hatte, daß Gerd ihm im Herzen feindlich gegenüberstehe.
So sagte er noch immer kalt und ungerührt:
»Ich brauche dein Geld nicht — du wirst es ausgezahlt bekommen. Du willst mein Haus verlassen — daran kann ich dich nicht mehr hindern. Das Für und Wider ist ja zwischen uns bereits erwogen worden. Ich wäre allerdings wegen der Auszahlung deines Kapitals in eine sehr peinliche Lage gekommen, wenn mir nicht Ersatz dafür angeboten worden wäre. Aber selbst wenn ich diesen Ersatz nicht gefunden hätte, hätte ich dich nicht bitten mögen, dein Vermögen in meinem Geschäft zu belassen.«
Gerd wurde einen Schein blasser.
»So wenig gelte ich dir?«
Sein Vater machte eine abwehrende Bewegung.
»Laß das. Unser Verhältnis zueinander ist nun einmal nicht so, wie es sonst zwischen Vater und Sohn üblich ist.«
»Ist das meine Schuld, Vater?« rief Gerd schmerzlich.
Sein Vater fuhr sich über die Stirn. Etwas in Gerds Ton und Haltung rüttelte an seinem Herzen. Aber er verhärtete es absichtlich. Helenes Einflüsterungen wirkten zu mächtig in ihm nach.
»Deine Schuld? Nun — vielleicht nicht, ich will es nicht untersuchen. Laß uns nicht von Dingen reden, die nicht mehr zu ändern sind. Ich weiß, du strebst mit allen Sinnen aus deinem Vaterhaus hinaus und hast nichts mehr mit uns gemein. Du wirst auch wohl freiwillig nicht dahin zurückkehren.«
Gerds Gesicht rötete sich jäh. Die kalten Worte des Vaters zeigten ihm wieder einmal zur Genüge, wie sehr ihn die Stiefmutter vom Herzen des Vaters verdrängt hatte. Er wußte nicht, daß sich trotz dieser kalten Worte das Herz des Vaters schmerzlich zusammenzog bei dem Gedanken daran, daß er sich bald für immer von Gerd trennen mußte. Ganz hatten Helenes Einflüsterungen doch nicht vermocht die Stimme des Blutes in ihm zu ersticken. Aber Gerd wußte das nicht, und der Groll auf die Stiefmutter trieb ihm jäh und ungestüm das Blut in den Kopf.
»Nicht — solange ich meine Stiefmutter im Vaterhause finde!« rief er im ungestümen Groll.
Des Vaters Gesicht verfinsterte sich, und seine Augen blitzten zornig.
»Schweig! Kein Wort gegen meine Frau!« rief er scharf und zurechtweisend.
Gerd lächelte bitter.
»Nein — kein Wort mehr über sie. Nur eins laß dir in dieser Stunde sagen, Vater — vielleicht ist es mir nicht vergönnt, noch einmal ungestört mit dir zu sprechen. Wenn das Leben sich mehr und mehr trennend zwischen uns schieben sollte, so daß wir uns vielleicht kaum noch die Hände reichen können — vergiß nicht, daß ich dich liebhabe, trotz alledem, was zwischen uns stand und stehen wird. Ich habe nie vergessen und werde nie vergessen, daß du mein Vater bist. — Das wollte ich dir sagen.«
Gerd hatte in tiefer Erregung gesprochen und atmete nun auf.
Ein warmes, überquellendes Gefühl wollte aus dem Herzen des Vaters emporsteigen. Aber er zwang es nieder wie eine Schwäche und blieb nach außen kalt und unbewegt.