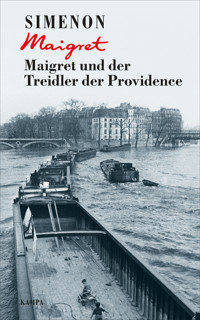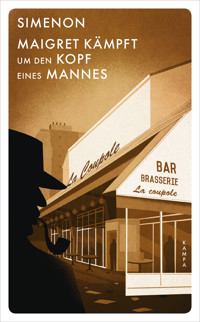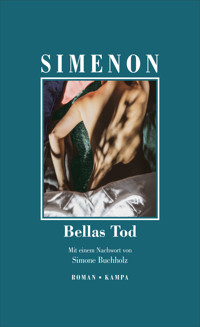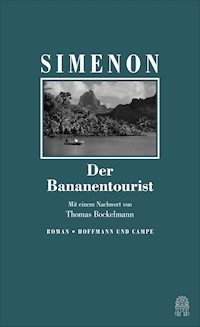
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
»Ich halte Simenon für den besten Realisten, besser als Zola oder Balzac.« -Anaïs Nin Der junge Oscar Donadieu, Erbe einer einflussreichen Reederdynastie, kehrt seiner Familie den Rücken und macht sich auf den Weg nach Tahiti. Hier will er sein Leben als »Bananentourist« verbringen, wie die Einheimischen Leute wie ihn nennen – im Einklang mit der Natur, fernab von Heimat und Zivilisation. Nach einer anstrengenden Schiffsreise, mit einem Mörder an Bord und allerlei unangenehmen Begegnungen, verbringt er einige Tage unter lauter europäischen »Stammgästen«, dann zieht es ihn in die Wildnis. Doch seine selbst gewählte Einsamkeit wird unverhofft gestört ... Mit einem Nachwort von Thomas Bockelmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Georges Simenon
Der Bananentourist
Die großen Romane – Band 79
Aus dem Französischen von Barbara Heller
Mit einem Nachwort von Thomas Bockelmann
Hoffmann und Campe
1
Siebenunddreißig Tage waren vergangen, seit die Ile-de-Ré Marseille verlassen hatte; bei der Abfahrt hatte Frost geherrscht, und als man aus Gibraltar auslief, waren bis auf zwei alle Passagiere krank gewesen; nach der Eintönigkeit der Atlantikdünung hatte man sich in die Tanzvergnügen Guadeloupes gestürzt, und selbst der Missionar, der zweiter Klasse reiste, hatte Zivilkleidung angelegt, um die Familie Nicou zu begleiten; in Panama hatten die Damen Parfum gekauft, so billig wie nirgendwo sonst, und beim Durchqueren des Kanals hatte man, wie es die Tradition will, an Deck gespeist; das Schiff näherte sich der südlichen Hemisphäre; man hatte von fern die Galapagosinseln gesehen, hatte Pelikane und Fliegende Fische fotografiert; Muselli, der für die Passagiere der ersten Klasse zuständig war und Hawaiigitarre spielen konnte, hatte einen auf Kinderfaustgröße geschrumpften Indianerkopf gekauft; man war am anderen Ende der Welt, und das Schiff zerschnitt mit dem Surren einer Werkzeugmaschine geduldig die allzu glatte, allzu glitzernde Fläche des Pazifiks, deretwegen alle eine Sonnenbrille tragen mussten; die Linie auf der Karte im Salon wurde jeden Tag ein wenig länger und würde bald die winzigen Punkte der Marquesas-Inseln berühren; seit siebenunddreißig Tagen befand man sich nicht mehr in Frankreich und auch nirgendwo sonst. Und doch war Sonntag!
Ein richtiger Sonntag, ein Sonntag wie jeder andere, und dabei hätte man meinen können, in dem scheinbar unendlichen Raum, in dem die Ile-de-Ré sich bewegte, gleiche jeder Tag dem anderen. Gewiss, um zehn Uhr morgens war ein vietnamesischer Steward, eine kleine Glocke – ähnlich der eines Ministranten – schwingend, über das ganze Schiff gegangen; gewiss, im Speisesaal der ersten Klasse, der den Passagieren der zweiten Klasse zu diesem Anlass ausnahmsweise offenstand, hatte der rothaarige Missionar, der dreißig Jahre auf den Neuen Hebriden zugebracht hatte, eine Messe gelesen.
Wie kam es aber, dass der Tag um drei Uhr nachmittags, um die Zeit der Mittagsruhe also, noch immer sonntäglich wirkte? Warum war es nicht ein Tag wie jeder andere, mit den Mahlzeiten zu festgesetzter Stunde, den Bridgerunden in der ersten und den Beloterunden in der zweiten Klasse, der Schachpartie zwischen dem Missionar und Oscar Donadieu, den herumrennenden Kindern, die ihr Essen vor den Erwachsenen bekamen, die ihrerseits wieder lernten, mit kleinen Scheiben auf ein Ziel zu werfen?
Warum lag ein sonntäglicher Duft in der Luft, ein Leuchten, eine sonntägliche Trägheit? Die Messe bot dafür keine hinreichende Erklärung und auch die kunstvolle Torte nicht, die zu Mittag serviert worden war.
Man war um die halbe Welt gereist, und doch war Sonntag wie überall, ein ausgedehnter, strahlender, träger Sonntag, ein Sonntag, der zugleich an ein ländliches Fest erinnerte.
Denn an diesem Abend sollte ein Fest stattfinden. Drei Tage vor der Ankunft in Tahiti waren die Passagiere der ersten und der zweiten Klasse geladen, gemeinsam zu den Klängen eines Plattenspielers zu tanzen. Die drei jungen Mädchen von der Besatzung hatten sich Schleifen in den Farben der Schifffahrtsgesellschaft an die weißen Kleider geheftet und verkauften Tombolalose. Im Speisesaal hatte Muselli, der Vorsitzende des Festkomitees, zusammen mit dem Oberkellner die von den Passagieren gestifteten Gewinne aufgebaut: Bonbonschachteln, Likörflaschen, Kleinigkeiten, die es beim Friseur zu kaufen gab, Nippsachen, die man in den verschiedenen Häfen erstanden hatte und deren man schon wieder überdrüssig war.
Weil Sonntag war, musste Oscar Donadieu, der nie Mittagsschlaf hielt, auf seine Schachpartie mit dem Missionar verzichten, und so hatte er seinen langen Körper auf dem Vorschiff ausgestreckt, auf den nackten Holzplanken an Deck, wo von Zeit zu Zeit ein Windhauch die Planen bewegte.
Er schlief nicht und dachte an nichts. Zu lange schon lebte man nicht mehr im eigenen Rhythmus, sondern in dem des Schiffes, sodass man zu denken aufgehört hatte, und wenn er die Augen schloss, so tat er es weder um zu dösen noch um die Dinge nicht mehr sehen zu müssen, denn in dem hellen Schein, der durch die Lider drang, sah er sie alle vor sich: Er wusste, dass das Wasser sich hinter den drei glitzernden Linien des Vorstevens ins Unendliche dehnte, er wusste, dass der rotgestreifte Schornstein keinen schwarzen Rauch ausstieß, sondern dass sein Hauch das Graublau des Himmels kaum bewegte.
Zehn Meter weiter, im Speisesaal der ersten Klasse, übte Muselli Note für Note das Gitarrenstück, das er am Abend spielen würde. Er hatte auch ein junges Mädchen ausfindig gemacht, das ihn auf dem Klavier begleitete.
Nicou, der Gendarm aus Surgères, lag gewiss ausgestreckt in seinem Khakianzug auf dem Rücken und machte, mit einer alten Zeitung über dem Gesicht, seinen Mittagsschlaf. Und ebenso gewiss saß seine Frau mit ihrem Nähzeug neben ihm und schob dann und wann die Zeitung, die sein aus dem offenen Mund entweichender Atem verrutschen ließ, an ihren Platz zurück.
Jaubert, der Funker, der Einzige, den Donadieu beneidete, saß oben in seiner Kajüte, in einer Welt für sich, aus der er nur zu den Mahlzeiten herabstieg.
Nur drei Tage noch, aber das schien lang. Es war Sonntag, und die Minuten verrannen noch langsamer, waren noch lastender als an anderen Tagen.
Warum hatte Donadieu plötzlich das Gefühl, sein Puls sei stehen geblieben? Mit einem Mal war eine Leere entstanden, als hätte das Schiff den Kontakt mit dem Meer verloren, und es dauerte eine Weile, bis man merkte, dass es das Stampfen der Maschinen war, das aufgehört hatte.
Alle spürten es, im selben Augenblick, in allen Winkeln des Schiffes. Man empfand keine Beunruhigung, aber doch ein unbehagliches Gefühl, und Nicou, der Gendarm, schob mit hochrotem Kopf seine Zeitung beiseite und fragte seine Frau mit einer Stimme, die noch von weit her zu kommen schien:
»Was ist?«
Es war nichts, und doch war es beeindruckend: An Backbord, so nah, dass man Stimmen an Deck vernahm, war ein Schiff aufgetaucht, das der Oléron aufs Haar glich. Auf dem Schiff drängten sich Passagiere in weißer und khakifarbener Kleidung an der Reling, und einige kamen mit Ferngläsern, die sie aus ihren Kabinen geholt hatten, herbeigeeilt.
Mit einem Schlag waren alle da, die Erster-Klasse-Passagiere auf ihrer Gangway, zu der Reisende der zweiten Klasse keinen Zutritt hatten, die anderen, unter ihnen Donadieu, auf dem Vorderdeck, das ihr Revier war.
Die Matrosen sahen mit unbeteiligter Miene zu dem anderen Schiff hinüber, der Ile-d’Oléron, die von den Neuen Hebriden, Neukaledonien und Tahiti kam.
»Was ist los?«, fragte Nicou einen Matrosen.
Doch dieser zuckte nur die Schultern. Er wusste nichts. Es war ihm gleichgültig. Die beiden Schiffe hatten im Abstand einer Kabellänge angehalten, und die Ile-d’Oléron ließ ein Boot zu Wasser.
Oscar Donadieu hatte es den anderen gleichgetan: Er war aufgestanden und lehnte nun, die Ellbogen aufgestützt, an der Reling. Mit seiner kurzen Hose und seinem Bürstenhaarschnitt sah er aus wie ein hochaufgeschossener Junge von einer Jugendgruppe oder dem Christlichen Verein Junger Männer.
»Wissen Sie, was hier vor sich geht?«, fragte ihn eine junge Frau aus der zweiten Klasse, eine Lehrerin namens Blanche Lachaux, die zu ihrem Verlobten nach Nouméa reiste, der dort Lehrer war.
»Nein … Ich weiß auch nicht …«
Nicht einmal diese Worte konnte er aussprechen, ohne zu erröten, weil er trotz seiner fünfundzwanzig Jahre den Umgang mit Frauen nicht gewohnt war!
»Vielleicht ist jemand krank geworden, und wir müssen ihn nach Papeete zurückbringen?«
»Vielleicht, ja …«
Oben in der ersten Klasse waren sie offenbar schon im Bilde, denn die bedeutenderen Passagiere hatten sich um den Zahlmeister versammelt, der große Reden schwang, und Bondon, der Staatsanwalt aus Nouméa, nickte dazu mit dem Kopf. Die Erster-Klasse-Passagiere wussten immer alles, da sie mehr oder weniger mit den Offizieren lebten, das heißt mit dem Kapitän, dem Leitenden Ingenieur, dem Zahlmeister und dem Schiffsarzt. In der zweiten Klasse hatte man nur junge Offiziere, die bei Tisch den Vorsitz führten und ihr Essen hastig hinunterschlangen, um sich dieser lästigen Pflicht rasch zu entledigen.
»Es scheint der Kapitän zu sein, der ins Boot steigt …«, sagte Nicou, der sich mit einem gewaltigen Fernglas bewaffnet hatte. »Sehen Sie selbst! … Wie viele Streifen können Sie erkennen? …«
Das Verwirrendste aber war noch immer, dass das Brummen des Motors verstummt war und das Schiff sich selbst überlassen schien, bei einem Wellengang, den man noch vor einer Stunde nicht vermutet hätte.
Donadieu stand in unmittelbarer Nähe des Fallreeps. Er sah das Boot, in dem sich in der Tat ein Kapitän und zwei Offiziere befanden, längsseits kommen. Obgleich er von oben hinunterblickte, sah er bei einer Kopfbewegung des Kapitäns dessen Gesicht und erkannte zu seiner Überraschung Lagre, einen früheren Kapitän seines Vaters aus der Zeit, als der alte Donadieu noch gelebt hatte und der größte Reeder in La Rochelle gewesen war.
Lagres Auftauchen allein wäre nicht so ungewöhnlich gewesen. Doch schon zu Beginn der Reise, unmittelbar nach der Abfahrt aus Marseille, war ein sanguinischer Mann, nachdem er die Passagierliste studiert hatte, mit Frau und Tochter verlegen und respektvoll auf ihn zugetreten:
»Entschuldigen Sie … Sind Sie zufällig mit den Donadieus aus La Rochelle verwandt? …«
Er hatte bejaht. Der andere war noch mehr ins Stottern geraten, und seine Frau war ganz gerührt gewesen.
»Dann sind Sie der junge Monsieur Oscar? … Verzeihen Sie, dass ich Sie einfach anspreche … Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt … Aber ich sagte zu meiner Frau … Mein Name ist Nicou, ich bin Gendarmeriemarschall, aus Surgères … Sie kennen mich nicht … Aber Ihr Vater kannte mich, er hat mir sozusagen meinen Posten verschafft … Wenn man daran denkt, was Sie alles durchgemacht haben, Sie Ärmster! …«
Seitdem war Nicou unverändert geblieben, geniert und beflissen, geniert vor allem deshalb, weil Donadieu zweiter Klasse reiste und mit ihm am selben Tisch saß, und mehr noch vielleicht wegen der Pfadfinderkleidung, die Donadieu inzwischen trug.
Und jetzt auch noch Lagre! Was war mit Lagre gewesen? Oscar erinnerte sich dunkel, dass irgendetwas vorgefallen war, aber er war damals noch ein Kind gewesen und hatte nicht darauf geachtet.
Das Manöver ging weiter. Kapitän Lagre von der Ile-d’Oléron betrat das Fallreep, und Kapitän Maurin von der Ile-de-Ré ging ihm entgegen.
Warum waren die beiden Männer so ernst? Warum gaben sie sich nicht die Hand, sondern wechselten nur einen betont steifen militärischen Gruß?
Das Auffallendste war das Gesicht Lagres, seine Augen. Es war, als erlebe er diesen Augenblick, ohne sich dessen bewusst zu sein, ohne zu wissen, wo er sich befand. Sein Blick ging ins Leere, sodass Donadieu fürchtete, er werde eine Stufe verfehlen.
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen …«
Und dann verstand man überhaupt nichts mehr. Man sah Chabannes, den Ersten Offizier des Schiffes, mit seinen Koffern hinuntersteigen und in dem Boot Platz nehmen, das sich sogleich entfernte. Dann setzten plötzlich und vollkommen unerwartet die Maschinen wieder ein, und die Ile-d’Oléron, deren Kapitän man nun an Bord hatte, entschwand nach und nach den Blicken.
Natürlich war immer noch Sonntag. Aber jetzt war es ein besonderer Sonntag, ein Sonntag mit einem öffentlichen Zwischenfall; es bildeten sich Gruppen, die Leute wollten Einzelheiten wissen.
»Lagre … Lagre …«, murmelte Oscar vor sich hin und runzelte die Brauen, als könne er damit sein Gedächtnis auffrischen.
Was war mit Lagre gewesen? Warum war von ihm häufiger die Rede gewesen als von den anderen Kapitänen seines Vaters? Warum verband sich sein Name in der Erinnerung an seine Kindheit mit einer ganz besonderen Person?
»Lagre … Ferdinand Lagre …«
Der Vorname fiel ihm wieder ein, ein Beweis, dass irgendetwas sich ihm damals eingeprägt hatte.
»Ferdinand Lagre …«
»Haben Sie gesehen, wie blass er war?«, fragte ihn plötzlich Nicou, der Gendarm, der schon eine ganze Weile neben ihm stand.
»Ja …«
Nein! Er war nicht blass gewesen. Es war komplizierter, befremdlicher. Nichts war normal an dem, was sich abgespielt hatte und noch immer abspielte. Von seinem Platz aus konnte Donadieu sehr gut die Kommandobrücke sehen und unmittelbar daneben die Gangway, auf der der Kapitän bei jedem Zwischenstopp seinen Freunden Champagner oder einen Aperitif anbot. Die Gangway war jedoch leer, und neben dem Steuermann stand jetzt der Zweite Offizier, Gallet, ein Bursche von vierundzwanzig Jahren, und hielt Wache.
Nun entspann sich eine Diskussion, die eines sonntäglichen Dorfplatzes wahrhaft würdig gewesen wäre. Mademoiselle Blanche Lachaux, die Lehrerin, die zu ihrem Verlobten reiste, kam ganz aufgeregt angelaufen.
»Ich war oben in der ersten Klasse«, erklärte sie, »um mit Madame Muselli, die mich eingeladen hatte, eine Tasse Tee zu trinken … Sie haben mich aufgefordert zu gehen und gesagt, Zweiter-Klasse-Passagiere hätten keinen Zutritt …«
An Bord waren zwei junge Amerikaner, die wie Donadieu nach Tahiti wollten. Sie ließen sich die Worte übersetzen und waren empört. Madame Nicou protestierte:
»Vorhin, als Sie Monsieur Muselli auf dem Klavier begleitet haben, hatten sie doch auch nichts dagegen? … Wenn sie uns brauchen, holen sie uns, und wenn sie uns nicht mehr brauchen, pferchen sie uns auf dem Vorschiff zusammen, und dann heißt es ›Zutritt verboten‹! Aber sie selber kommen zu uns, und der alte Engländer sonnt sich jeden Tag halb nackt auf dem Vorschiff, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll …«
Donadieu lehnte noch immer an der Reling. Der Missionar versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Von der Ile-d’Oléron war nur noch ein ferner Rauchschleier zu sehen.
»Warum feiern wir nicht einfach unser eigenes Fest, nur wir allein? … Und wer wird dann das Nachsehen haben? … Wir bestimmt nicht, denn die guten Leute sind doch hier bei uns! …«
Die achtzehnjährige Annie Nicou sollte singen. Blanche Lachaux konnte als Einzige an Bord Klavier spielen, und zwei Jungen und ein Mädchen würden einen Sketch aufführen.
»Warten Sie, ich rede mit ihnen …«, beharrte der Missionar.
Oscar Donadieu hörte wider Willen zu. Auf dem Achterdeck stand, seit sich das Schiff südlich der Wendekreise befand, eine Art Schwimmbecken, ein großer, mit Segeltuch ausgelegter Tank, der gerade für zwei Schwimmzüge reichte. Die Ile-de-Ré war nämlich nur ein kombiniertes Fracht- und Passagierschiff, und ihre erste Klasse entsprach allenfalls der zweiten eines normalen Passagierschiffes.
Donadieu zog seine Badehose an, stieg in das Schwimmbecken, wo er eine gute halbe Stunde für sich allein war, und widmete sich dann gewissenhaft seinen gymnastischen Übungen.
So war es jeden Tag. Er teilte sich seine Zeit selbst ein, machte fast alles allein. Dass er mit dem Missionar Schach spielte, rührte daher, dass dieser ihn eines Tages, als er am Schachbrett gegen sich selbst spielte, überrascht und sich als Gegner angeboten hatte.
Donadieu verachtete niemanden, weder Nicou, der ein Schützling seines Vaters gewesen war und dessen respektvolles Mitgefühl ihm lästig war, noch die beiden Amerikaner, die sich mit knapper Not die Überfahrt leisten und niemals einen Fuß in die Bar setzen konnten, weder Gorlia aus Marseille noch …
Er war einfach lieber allein. Ihm graute davor, dass die Leute ihn mit ihren Angelegenheiten behelligen könnten, und er errötete, wenn ihn jemand auf seine Familie ansprach, so wie Nicou es tat, der ihm immer wieder glaubte versichern zu müssen:
»Ihr armer Vater, was für ein Mann! … Wer hätte gedacht, dass er durch einen so dummen Unfall ums Leben kommen würde … Nachts ins Hafenbecken zu fallen …«
Er zog alle Register:
»Stark wie eine Eiche war er …«
Oder auch:
»Ein Gentleman im wahrsten Sinne des Wortes und ein Patron – so etwas gibt es nicht noch einmal …«
Und schließlich:
»Wenn das Unglück in ein Haus einzieht …«
Oscar empfand dabei eher Scham. Es ging niemanden etwas an, dass nach dem Tod seines Vaters die Familie zerbrochen und die Reederei nach einem schmerzlichen Skandal zugrunde gegangen war.
Ebenso peinlich war es ihm, aus Nicous Mund zu erfahren, dass dessen Aufenthalt auf Tahiti mit einer Beförderung verbunden war, die ihm obendrein auch noch beträchtliche Zulagen bescheren würde.
»Ich mache mir ein wenig Sorgen wegen meiner Tochter, ich möchte nicht, dass sie einen Mann aus den Kolonien heiratet …«
Bei allem Respekt hatte Nicou eines Abends gewagt, ihn rundheraus zu fragen:
»Stimmt es, dass Sie ganz allein auf Tahiti leben wollen?«
»Warum nicht?«
»Hätten Sie nicht …?«
Er brach mitten im Satz ab, denn er befürchtete, zu viel gesagt zu haben. Es schmerzte ihn, mit ansehen zu müssen, dass Donadieus Sohn als Bananentourist auf der Insel leben wollte.
Das war das Wort. Oscar hatte es an Bord zum ersten Mal gehört. Er hatte den Funker genötigt, es ihm zu sagen. Der Funker und er waren morgens als Erste auf den Beinen und begegneten einander hin und wieder um fünf Uhr früh im Schwimmbecken.
»Machen Sie sich nichts daraus … So nennen wir Passagiere, die zu den Inseln reisen, weil sie dort in der Natur leben wollen, fernab von der Welt, frei von Geldsorgen, als Nahrung Kokosnüsse und Bananen … Sehen Sie! Die beiden Amerikaner, die mit Ihnen reisen … Solche Leute gibt es auf jedem Schiff … Sie haben gerade genug Geld für die Überfahrt … Sie suchen sich eine leerstehende Eingeborenenhütte und richten sich darin ein, und nach ein paar Monaten tauchen sie krank und blutarm bei der Polizei oder ihrem Konsul auf und wollen nach Hause befördert werden …«
Was kümmerte es Donadieu! Er hatte mit den beiden Amerikanern nur wenige Worte gewechselt, doch er wusste, dass er anders war als sie.
»Es gibt auch Leute, die aus irgendwelchen Gründen in Vergessenheit geraten wollen …«
Auch das galt nicht für ihn, doch er sprach es nicht aus. Es war ihm gleichgültig, dass man ihn für einen Bananentouristen hielt und dass Nicou ihn bemitleidete. Er legte niemandem Rechenschaft ab, er war niemandem Rechenschaft schuldig.
»Ferdinand Lagre …«
Seit ungefähr zwei Stunden dachte er an ihn, ohne sich dessen bewusst zu sein, und als es zum Abendessen läutete, fiel es ihm plötzlich ein:
›Die Taufe von …‹
Das war es! Als er zwölf Jahre alt war, hatte er bei Lagres erstem Kind, das auf den Namen Oscar getauft wurde, Pate gestanden. Es war eine unerfreuliche Erinnerung, denn seine Schwester Martine hatte ihm weisgemacht, er müsse bei der Zeremonie Zylinder und Gehrock tragen, und er hatte bitterlich geweint, bis sein Vater von dem Scherz erfahren hatte und in Zorn geraten war.
»Meinst du nicht, dein Bruder ist schon so nervös genug?«
Oscar war Taufpate des kleinen Lagre. Im Moment aß er. Zu seiner Rechten saß wie immer der Funker. Die Stimmung war gedrückt, weil die Verbindung zu den Erster-Klasse-Passagieren abgebrochen und das Fest in Gefahr war.
Der Funker war nicht gesprächig. Donadieu begegnete ihm anders als den anderen, weil er ihm ein wenig ähnlich war. An diesem Abend aber war er noch ernster als sonst und rührte sein Essen kaum an.
Donadieu stellte ihm keine Fragen, und Jaubert selbst sagte nichts. Nach dem Essen aber standen sie zusammen beim Ladebaum, während die Erster-Klasse-Passagiere Musik machten, um den Anschein zu erwecken, als amüsierten sie sich.
»Ist der Mann, der an Bord gekommen ist, wirklich Kapitän Lagre?«, fragte Donadieu nach einiger Überwindung.
»Kennen Sie ihn?«
»Ja …«
»Kennen Sie seine Familie? Stimmt es, dass er in Jonzac eine Frau und zwei Kinder hat?«
»Ja …«
»Wissen Sie, warum er an Bord ist?«
»Nein …«
Jaubert zündete sich eine Zigarette an und erklärte unwillig, um es schnell hinter sich zu bringen:
»Vorgestern, nachdem die Ile-d’Oléron in Papeete ausgelaufen ist, hat Lagre dem Dritten Offizier, Henri Clerc – alle nannten ihn Riri –, eine Kugel in den Kopf geschossen … Henri Clerc war fünfundzwanzig …«
Nicou versuchte, als Antwort auf die Fröhlichkeit in der ersten Klasse ein Fest zu improvisieren, und fragte nach Glühbirnen. Der südliche Himmel glitt mit all seinen Sternbildern über den Köpfen dahin, und Schwaden warmer Luft mischten sich mit dem kühleren Hauch der Nacht.
»Er hat die Nachricht selbst nach Papeete übermittelt und um Instruktionen gebeten … Papeete hat einen Funkspruch nach Frankreich geschickt … Man konnte ihm schlecht das Kommando bis zurück nach Marseille überlassen … Die Gesellschaft hat ihre Anweisungen durchgegeben, und das alles innerhalb weniger Stunden …«
Während Jaubert sprach, dachte Donadieu an die kleine Kabine ganz oben, wo der Funker sonst immer saß, umgeben von den Echos der Welt.
»Man hielt es für besser, ihn in Papeete vor Gericht zu stellen, zumal der Grund des Verbrechens eine kleine Eingeborene ist, eine gewisse Tamatéa …«
Er zog seine Uhr aus der Tasche. In der Dunkelheit konnte er die Zeit wohl kaum ablesen, doch beeilte er sich zu erklären:
»Ich muss wieder hinauf … Um diese Zeit sendet Barranquilla …«
Und er ging, nicht so sehr, weil die Pflicht ihn rief, als vielmehr, weil er in einer Welt für sich lebte, in der die Stunden nicht normale Stunden waren, sondern Sendezeiten, die sich mit den Meridianen änderten, einer Welt, in der die Hauptstädte der Erde durch Kilowattleistung und Wellenlänge der Stationen definiert waren.
Unberührt von der Schlacht zwischen den Passagieren erster und zweiter Klasse ging Donadieu zu Bett.
Er hatte es nachts im Schlaf schon undeutlich wahrgenommen, war aber dennoch überrascht, in einer Kabine aufzuwachen, in der die Gegenstände sich im Rhythmus der Pazifikwogen von allein bewegten und die Morgentoilette eine Qual war.
Er brauchte dringend frische Luft und stieg nach oben. Das Vordeck war von Wellen überspült und die Fläche des Meeres vom weißen Staub der Gischt bedeckt, die ein jäher Wind pfeifend vor sich her trieb.
Beim Gehen musste er sich dauernd irgendwo festhalten, an einem Pfosten, einem Ladebaum, an der Reling, und einen Moment lang glaubte er, es werde ihm nicht gelingen, den Aufgang zum Oberdeck zu erklimmen. Alles war grau, feindselig, nass. Seine Mütze flog davon und wurde von einer Welle verschluckt.
Vielleicht hatte er den Funker gesucht, doch er war nicht erstaunt, als ihm am Ende der Gangway, wo zwischen den Beibooten nur ein schmaler Durchgang blieb, Kapitän Lagre gegenüberstand. Gleichzeitig erblickte er drei Meter weiter einen Matrosen, und er begriff.
Wie alle schüchternen Menschen hielt er den Kopf gesenkt und sprach zu schnell, schrie schließlich, um das Tosen des Sturmes zu übertönen:
»Kapitän, Sie erkennen mich wahrscheinlich nicht wieder …«
Der andere sah genauso aus wie am Tag zuvor, mit seinen ruhigen und erstaunten Augen, seinem verschlossenen Gesicht.
»Ich muss gestehen, nein …«
Der Matrose war im Zweifel, ob er die Unterhaltung zulassen durfte, und blickte sich beunruhigt um, in der Hoffnung, ein Offizier werde auftauchen und ihm die Verantwortung abnehmen.
»Ich bin Oscar Donadieu …«
Lagres Gesicht war, obwohl er Seemann war, blass und matt, er hatte harte Züge, und sein Haar war grau. Er runzelte die Brauen wie ein Mensch, der sein Gedächtnis angestrengt durchforscht, und versuchte ein Lächeln zustande zu bringen, was ihm jedoch nicht glückte.
»Ah! …«, murmelte er nur.
»Erinnern Sie sich? …«
»Ja, ich erinnere mich! Ihr Vater war sehr gut zu mir …«
Diese Worte brachte er jedoch so schroff hervor, dass sie gewissermaßen ihre Bedeutung verloren.
»Ich habe gestern gehört …«
»Ja!«, seufzte Lagre.
Oscar Donadieu vermochte kaum zu sprechen, seine Kehle war wie zugeschnürt. Zum ersten Mal in seinem Leben stand er einem Menschen gegenüber, der getötet hatte. Lagre blickte unverwandt aufs Meer hinaus. Donadieu versuchte, es ihm gleichzutun, doch vergebens.
»Als Sie gestern an Bord gekommen sind, kamen Sie mir irgendwie bekannt vor …«
»Ah! …«
Donadieu begriff, dass der Kapitän, der zum Mörder geworden war, ihn wahrscheinlich genauso aufdringlich fand wie er selbst den guten Nicou.
»Ich bitte um Verzeihung …«
»Wofür?«
»Dass ich Sie belästige …«
»Aber, nein! Ich weiß Ihre Geste sehr zu schätzen … Und Sie, wie hat es Sie hierher verschlagen?«
Nun, da nicht mehr von ihm selbst die Rede war, sah Lagre seinem Gegenüber ins Gesicht, mit einem Blick, der ohne Wärme, aber doch menschlich und zumindest neugierig war.
»Ach, das ist nicht so interessant …«, stammelte Oscar hastig.
»Machen Sie eine Vergnügungsreise?«
»Nicht ganz … Ich denke, ich werde mich auf Tahiti niederlassen … Nicht in Papeete selbst, sondern irgendwo auf der Insel oder auch auf einer anderen Insel des Archipels …«
Über ihnen, zwischen ihnen war der Sturm, der ihnen die Kleider an den Körper presste, die Worte vom Mund riss und beide Männer zwang, sich an der Reling festzuhalten; dazu das Kreischen eines schlechtgeölten Motorblocks, das wie der Schrei einer Möwe klang, und die Umrisse des beunruhigten Matrosen.
»Was für eine Idee!«
»Wie bitte?«, schrie Donadieu, der ihn nicht verstanden hatte.
»Ich sagte, eine seltsame Idee …«
Und Lagre rauchte seine Pfeife! Und seine Züge waren ruhig! Und doch war er ein Mörder!
»Ich dachte …«
»Was?«
»Ich weiß nicht … Sie brauchen vielleicht …«
Als Antwort kam nur ein Schulterzucken.
»Ich bitte um Verzeihung …«
»Aber nein … Sie sind ein netter Junge … Ich wusste gar nicht, was aus Ihnen geworden ist, und ich freue mich, Sie wohlauf zu sehen … Vielleicht sollten Sie lieber auf dem Schiff bleiben und nach Frankreich zurückkehren …«
»Warum?«
»Nur so … Haben Sie Feuer?«
»Ich rauche nicht …«
»Schade …«
Donadieu wusste nichts mehr zu sagen. Das Schlingern des Schiffes machte ihn noch befangener. Er schwieg eine Weile, wie ein Mensch in einem Sterbezimmer, das er aus Höflichkeit nicht zu verlassen wagt.
Er war froh, als er Coufigue, den Zahlmeister, kommen sah, der auf Lagre zutrat und leise zu ihm sagte:
»Kapitän, Kapitän Maurin lässt Ihnen ausrichten, dass es Zeit ist, in Ihre Kabine zurückzugehen …«
Als er hinunterging, erfuhr Donadieu, dass es um Mitternacht einen kleinen Eklat gegeben hatte, weil Muselli, der Administrator aus der ersten Klasse, in stark angeheitertem Zustand in die zweite Klasse eingedrungen war und Nicou, der nicht weniger getrunken hatte, sich ihm in den Weg gestellt und ausgerufen hatte:
»Nein, Monsieur … Bedaure, aber bei uns gibt es keine Hierarchie … Wir sind alle Passagiere …«
Um elf Uhr, als die meisten Passagiere bereits seekrank waren, aber noch standhaft an Deck ausharrten, wies jemand auf einen gräulichen Dunstschleier zwischen den Wogen und verkündete:
»Fakarava! …«
Alle wussten, dass dies eines der schönsten Atolle im Pazifik war, doch man konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten, und am nächsten Tag erschienen nur fünf Personen zum Mittagessen. Donadieu hatte keinen Appetit. Der Funker sagte zu ihm:
»Das sind nur die Ausläufer eines Taifuns … Übermorgen ist alles wieder ruhig … Vor uns ist ein Touristenschiff auf Weltreise, die Leute konnten in Tahiti nicht an Land gehen …«
Oscar hörte ihn zwar und verstand auch halbwegs, was er sagte, doch eine halbe Stunde später hatte er sich hingelegt und stand erst wieder auf, als das Pochen der Maschinen erneut aufgehört hatte.
Man lag vor Tahiti und wartete auf den Lotsen. Es regnete in Strömen. In die grauen Wolken ragte ein pechschwarzer, zuckerhutförmiger Berg zweitausend Meter hoch empor. Man erahnte dunkles Grün und einige rote Dächer. Rings um die Insel brach sich das Meer an dem Korallengürtel, den es durch eine schmale Öffnung zu passieren galt.
Die Passagiere fanden sich wieder zusammen, gezwungen lachend, unsicher auf den Beinen und mit leerem Kopf. Auf Deck lagen bereits Gepäckstücke, und an den Bars wurden Runden für jene ausgegeben, die bis nach Neukaledonien oder den Neuen Hebriden weiterreisten.
Aus einer Motorschaluppe stieg ein Lotse in Ölzeug – er stammte ursprünglich aus Paimpol – und kletterte zur Kommandobrücke hinauf.
Das Schiff bewegte sich mit halber Kraft vorwärts. Beim Passieren des Korallenriffs beugten sich alle über die Reling, und als man ruhiges Wasser erreicht hatte, nahm man in Augenschein, was von Papeete zu sehen war: die Pfähle des Kais, wellblechgedeckte Häuser und zwei- oder dreihundert europäisch gekleidete Menschen, die unter ihren Regenschirmen von einem Fuß auf den anderen traten.
Ein Küstenwachboot mit Polizeiflagge kam längsseits, und seine Insassen schlossen sich oben mit dem Kapitän ein.
Die beiden Amerikaner, die wie Donadieu kurze Hosen trugen, hatten ebenfalls Regenmäntel angezogen. Und wie Donadieu erkannten sie am Kai die vier, fünf Taxis, die wie in jedem Hafen der Welt in einer Reihe standen und auf Fahrgäste warteten.
Nicou besah sich die Uniformen der Zollbeamten und entdeckte einen Gendarmen.
Der Anker rasselte hinab. Die Schiffsschraube drehte sich rückwärts und rührte den Schlick auf, der das Schiff gelb umspülte.
Es war der 8. Februar.
2
Oscar Donadieu konnte sich von niemandem verabschieden. Das war nicht weiter schlimm. Vielleicht lag es am Regen, denn es regnete, wie es der junge Mann noch nie hatte regnen sehen. Der Wind hatte sich entweder gelegt, oder er wurde von dem düsteren Zuckerhut Tahitis ferngehalten. Vom Unwetter war, wenn man von den weißen Schaumkronen auf dem offenen Meer und den Palmwedeln, die im Hafenbecken schwammen, absah, nichts mehr zu bemerken.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: