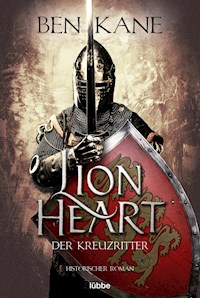9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Forgotten Legion-Chronicles
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Hüte dich vor den Iden des März!" Augur Spurinna zu Julius Cäsar
Sie kämpften zusammen in der Vergessenen Legion, wagten gemeinsam die Flucht aus der Gefangenschaft der Parther - doch in Alexandria verlieren Tarquinius und Romulus sich aus den Augen. Während Romulus mit Cäsars Truppen gegen die Feinde Roms zieht und droht, als flüchtiger Sklave erkannt zu werden, bleibt Tarquinius schwer verletzt zurück. Erst nach vielen Monaten begegnen die Gefährten einander wieder: in den Straßen Roms, wo die Verschwörung um Cäsars Ermordung bereits unaufhaltsam voranschreitet ...
Endlich da: der fulminante Abschluss der Bestseller-Trilogie aus England
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 881
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
1. KAPITEL: ÄGYPTEN
2. KAPITEL: JOVINA
3. KAPITEL: PHARNAKES
4. KAPITEL: DER TEMPEL DES ORCUS
5. KAPITEL: VISIONEN
6. KAPITEL: »VENI, VIDI, VICI.«
7. KAPITEL: DIE AFFÄRE
8. KAPITEL: RHODOS
9. KAPITEL: GEFANGENSCHAFT
10. KAPITEL: CÄSARS SPIELE
11. KAPITEL: DER ÄTHIOPISCHE STIER
12. KAPITEL: ROMULUS UND CÄSAR
13. KAPITEL: SCHICKSALSFÄDEN
14. KAPITEL: SABINA
15. KAPITEL: RUSPINA
16. KAPITEL: LABIENUS UND PETREIUS
17. KAPITEL: HEIMKEHR
18. KAPITEL: VATER UND SOHN
19. KAPITEL: VIER SIEGE – VIER TRIUMPHZÜGE
20. KAPITEL: DIE SUCHE
21. KAPITEL: GEFAHR
22. KAPITEL: GEMELLUS
23. KAPITEL: WIEDER VEREINT
24. KAPITEL: ZWIST
25. KAPITEL: VERSCHWÖRUNG
26. KAPITEL: DAS KOMPLOTT
27. KAPITEL: DIE IDEN DES MÄRZ
ANMERKUNGEN DES AUTORS
GLOSSAR
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, dem Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debütromans DIEVERGESSENE LEGION ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
Ben Kane
DERBLUTIGEWEG
Roman
Aus dem Englischen vonDr. Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2010 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »The Road to Rome«
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Werner Bauer, BerlinIllustration Karte und Vignetten: Markus Weber,Agentur Guter Punkt, MünchenTitelillustration: © arcangel/Collaboration Js; © shutterstock/Frank Fischbach; shutterstock/tourdottk; shutterstock/S. BorisovUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3970-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine wundervollen Eltern Kyranund Helen Kane,denen ich in Liebe und Dankbarkeit
1. KAPITEL:ÄGYPTEN
ALEXANDRIA, WINTER 48 V.CHR.
»Beeilung, verdammt!«, rief der Optio und hieb den Legionären in unmittelbarer Nähe mit der flachen Klinge über den Rücken. »Cäsar braucht uns!«
Sein Trupp aus zehn Mann benötigte kaum eine Ermunterung. Ihr nächtlicher Vorposten befand sich auf dem Heptastadion, dem schmalen, künstlichen Fahrdamm, der die Docks mit einer vorgelagerten, langen Insel verband und der den Hafen in zwei Teile schnitt. Mit Wasser zu beiden Seiten bot dies eine isolierte Stellung – kein wünschenswerter Aufenthaltsort, wenn man bedachte, was gerade vor sich ging.
Der gelbe Schein des Pharos, des riesigen Leuchtturms der Stadt, wurde durch die brennenden Schiffe am Kai eindrucksvoll verstärkt. Cäsars Männer hatten das Feuer gelegt, das sich rasch auf den Schiffen ausgebreitet hatte. Jetzt griffen die Flammen auf die nahen Lagerhäuser und Bibliotheksgebäude über und wuchsen zu einer Feuersbrunst an, die die Szenerie taghell erleuchtete. Nachdem sich ihre Trupps, die in die verdunkelten Seitenstraßen zurückgedrängt worden waren, neu gesammelt hatten, kamen die ägyptischen Soldaten wieder zu Tausenden heraus, um sich gegen Cäsars Linien zu werfen. Die Legionäre waren weniger als hundert Schritt vom Heptastadion entfernt, einer Stelle, die wie geschaffen war, um einen Feind aufzuhalten.
Romulus und Tarquinius marschierten bereitwillig an der Seite der Legionäre. Sollte es der brüllenden Masse der ägyptischen Soldaten gelingen, die römischen Reihen zu durchbrechen, würden alle Legionäre den Tod finden. Selbst wenn es die Ägypter anfangs nicht schaffen sollten, war die Wahrscheinlichkeit, das Ganze zu überleben, immer noch gering. Die Legionäre waren ihren Feinden zahlenmäßig weit unterlegen und hatten keinen sicheren Rückzugsweg. Die ganze Stadt wimmelte von feindlich gesinnten Einheimischen, und der Damm führte auf eine Insel, von der es kein Entrinnen gab. Dort lagen nur die römischen Triremen und Liburnen, aber wegen der ausschwärmenden feindlichen Truppen war es nicht möglich, sicher an Bord zu gelangen.
Romulus zog eine Grimasse und warf der Trireme, die gerade entkommen war, einen sehnsüchtigen Blick nach. Das Schiff näherte sich inzwischen der westlichen Hafenausfahrt, mit Fabiola, seiner Schwester, an Bord. Nach beinahe neun Jahren der Trennung hatten sie sich nur Momente zuvor wiederentdeckt. Fabiola war auf dem Weg hinaus zum Meer, in Richtung Sicherheit, und daran vermochte Romulus nichts zu ändern. Merkwürdigerweise war er nicht verzweifelt. Und er wusste den Grund dafür: Allein das Wissen, dass Fabiola noch am Leben war, ließ sein Herz vor unbändiger Freude hüpfen. Mit Mithras’ Hilfe hätte sie ihn hören müssen, als er ihr zurief, er sei in der 28. Legion, und so mochte sie ihn eines Tages wiederfinden. Nach all seinen Gebeten um die lange verloren geglaubte Schwester hatten die Götter ihm endlich eine Antwort gewährt.
Jetzt aber, wie schon so oft, ging es darum, die eigene Haut zu retten.
Nachdem man sie in die Legionen zwangsrekrutiert hatte, waren Tarquinius und er ein Teil von Cäsars kleinem Einsatzkommando in Alexandria geworden: Teil eines Kommandos, das gerade überwältigt zu werden drohte. Romulus konnte jedoch seinem neuen und gefährdeten Rang etwas Trost abgewinnen. Falls das Elysium auf ihn wartete, würde er es weder als Sklave noch als Gladiator betreten. Auch nicht als Söldner oder Gefangener. Romulus straffte die Schultern.
Nein, dachte er grimmig, ich bin ein römischer Legionär. Endlich. Mein Schicksal gehört mir, und Tarquinius wird mich nicht länger kontrollieren. Keine Stunde zuvor hatte ihm sein blonder Freund enthüllt, dass er für den Totschlag verantwortlich gewesen war, der Romulus ursprünglich zur Flucht aus Rom gezwungen hatte. Der Schock hallte immer noch in Romulus nach. Zweifel, Zorn und Kränkung vermischten sich zu einem giftigen Wirbel, der ihm Schwindel verursachte. Doch er schob den Schmerz von sich und begrub ihn für später.
Schwer atmend erreichte die Gruppe die rückwärtigen Linien von Cäsars Aufstellung, die nur aus sechs Reihen bestand. Gebrüllte Befehle, das metallische Aufeinanderprallen der Waffen und die Schreie der Verwundeten waren plötzlich sehr nah. Der Optio besprach sich mit dem nächsten Offizier, einem nervös wirkenden Tesserarius. Sein Helm mit Querbusch und sein Schuppenpanzer ähnelten denen des Optio, und er trug einen langen Stab, der dazu diente, die Legionäre in Reih und Glied zu halten. Während er und andere Unteroffiziere im Hintergrund blieben, um einzelne Soldaten am Ausscheren zu hindern, befanden sich die Centurionen direkt an der Front oder in deren Nähe. In einer derart verzweifelten Schlacht stärkten diese hartgesottenen Veteranen die Zuversicht aller. Schließlich wandte sich der Optio an seine Männer: »Unsere Kohorte steht genau hier.«
»Vertrau nur deinem Glück«, murmelte ein Soldat. »Genau in der Mitte von der verdammten Linie.«
Der Gesichtsausdruck des Optio ließ ein anerkennend dünnes Lächeln erahnen. Genau hier würden sie die meisten Todesopfer zu beklagen haben. »Im Moment habt ihr es noch leicht. Seid dankbar«, sagte er. »Verteilt euch, in Zweierreihen. Verstärkt diese Centurie.«
Mürrisch befolgten die Männer seine Anordnung.
Romulus und Tarquinius fanden sich zusammen mit vier anderen an der Front der zwei schmalen Reihen wieder. Sie protestierten nicht dagegen, denn neue Rekruten hatten halt damit zu rechnen. Romulus war größer als die meisten und konnte über die Köpfe der Männer hinweg sehen, auch vorbei an den steifen Büscheln auf den bronzenen Helmen. Hier und dort ragte eine Centurienstandarte in die Luft, und über der rechten Flanke erhob sich der silberne Adler, der Talisman einer jeden Legion – kein anderes Feldzeichen rief so viele Gefühle in den Soldaten hervor wie der silberne Adler der Legion. Romulus’ Herz raste, als er das bedeutende Symbol Roms erblickte, das ihm in all den Jahren in der Fremde ans Herz gewachsen war. Mehr als alles andere hatte der Adler Romulus geholfen, sich daran zu erinnern, dass er ein Römer war. Gebieterisch, stolz und unnahbar, scherte der Talisman sich nicht um den Rang der Männer; was zählte, waren einzig Tapferkeit und Kühnheit in der Schlacht.
Dahinter jedoch gab es nur ein Meer von hassverzerrten Gesichtern und glänzenden Waffen, das sich in großen, rollenden Wogen auf sie zuwälzte.
»Sie tragen Scuta«, rief Romulus verwirrt. »Sind das Römer?«
»Das war einmal«, spie der Legionär zu seiner Linken. »Aber die Bastarde sind zu Einheimischen geworden.«
»Dann sind das wohl Gabinius’ Männer, würde ich sagen«, bemerkte Tarquinius und bekam ein schroffes Nicken als Antwort. Manche starrten neugierig herüber, besonders diejenigen, die die linke Gesichtshälfte des Haruspex sehen konnten. Einst hatte Vahram, der Primus Pilusder Vergessenen Legion, Tarquinius brutal gefoltert: Zurückgeblieben war auf der Wange eine aufliegende rote Narbe in Form einer Messerklinge.
Dank Tarquinius war Romulus vertraut mit der Geschichte von Ptolemäus XII., dem Vater der jetzigen Herrscher von Ägypten, der mehr als zehn Jahre zuvor abgesetzt worden war. Verzweifelt hatte Ptolemäus sich an Rom gewandt und unglaubliche Goldsummen geboten, damit man ihn wieder auf den Thron beförderte. Schließlich hatte Gabinius, der Prokonsul von Syrien, die Gelegenheit ergriffen. All das hatte sich zu jener Zeit zugetragen, als Romulus, Brennus, sein gallischer Freund, und Tarquinius noch zu Crassus’ Armee gehörten.
»Richtig«, knurrte der Legionär. »Sie sind hiergeblieben, nachdem Gabinius in Ungnade nach Rom zurückkehrte.«
»Wie viele sind übrig geblieben?«, fragte Romulus.
»Ein paar Tausend«, kam die Antwort. »Aber sie bekommen eine Menge Hilfe. Nubische Plänkler und judäische Söldner größtenteils, und kretische Schleuderer und Bogenschützen. Alles zähe Bastarde.«
»Es gibt auch Infanterie«, sagte ein anderer Mann. »Entlaufene Sklaven aus unseren Provinzen.«
Seine Worte lösten ein verärgertes Grollen aus.
Romulus und Tarquinius wechselten Blicke. Es war von allergrößter Wichtigkeit, dass ihr Status, besonders der von Romulus, geheim blieb. Sklaven durften nicht in der regulären Armee kämpfen, das wusste jeder. Den Legionen beizutreten – nichts anderes bedeutete die Zwangsverpflichtung für Romulus faktisch – brachte einem die Todesstrafe ein.
»Diese verräterischen Hurensöhne kommen gegen uns nicht an«, proklamierte der erste Legionär. »Wir werden sie in Grund und Boden rammen.«
Es war genau der richtige Spruch. Auf den zuvor besorgten Gesichtern machte sich ein zufriedenes Grinsen breit.
Romulus hielt sich mit einer Antwort zurück. Die Nachfolger des Spartakus hatten den Legionen schon bei mehr als einer Gelegenheit Niederlagen beschert.
Er selbst konnte es mit drei Durchschnittslegionären gleichzeitig aufnehmen. Hatte er eine neue Heimat zu verteidigen, konnte sich ein ehemaliger Sklave als schwer zu schlagen erweisen. Allerdings war dies weder der richtige Augenblick noch der richtige Ort, um solche Gedanken zur Sprache zu bringen. Aber wann überhaupt?, fragte sich Romulus mit einem Hauch von Bitterkeit. Niemals.
Die Waffen kampfbereit, warteten sie ab, während der Zusammenprall verzweifelter wurde. Schauer von feindlichen Wurfspeeren und Steinen flogen in ihre Reihen, hier und dort wurden Männer niedergemäht. Ohne Schilde blieb Romulus und Tarquinius nichts anderes übrig, als sich zu ducken und zu beten, wenn der Tod über sie hinwegpfiff. Es war beängstigend. Als die Verluste in den eigenen Reihen zunahmen, bot sich den Männern die Gelegenheit, Waffen oder Helme der gefallenen Kameraden zu ergattern. Ein untersetzter Soldat in der Reihe vor Romulus kam zu Fall, durchbohrt von einem Speer. Romulus zog dem zuckenden Mann den Helm ab, ohne viel Bedauern zu fühlen. Die Bedürfnisse der Lebenden waren dringlicher als die der Sterbenden. Selbst der schweißgetränkte Innenfilz, den er sich hastig als Erstes über den Kopf stülpte, fühlte sich wie ein Schutz an. Tarquinius nahm das Scutum des gefallenen Soldaten an sich, und es dauerte nicht lange, bis Romulus auch einen Schild besaß, von einem anderen Opfer.
Der Optio gab ein anerkennendes Brummen von sich. Die zwei zerlumpten Wanderer besaßen nicht nur gute Waffen, sie kannten sich auch mit militärischer Ausrüstung aus.
»Schon besser«, sagte Romulus und hob seinen ovalen Schild am horizontal angebrachten Griff hoch. Seit der letzten Schlacht der Vergessenen Legion vor vier Jahren waren sie nie wieder so vollständig ausgerüstet gewesen. Düster hielt er den Blick geradeaus gerichtet. Es fiel ihm immer noch schwer, sich nicht wegen Brennus schuldig zu fühlen: Sein gallischer Freund war gestorben, damit er und Tarquinius entkommen konnten.
»Schon mal im Kampf gestanden?«, wollte der Legionär wissen. Bevor Romulus antworten konnte, schlug ihm ein Schildbuckel in den Rücken.
»Vorwärts!«, schrie der Optio, der sich hinter sie gedrängt hatte. »Die Reihe vor euch lässt nach.«
Sie stemmten sich gegen die vordere Linie und schoben sich Schritt für Schritt dem Feind entgegen. Dutzende von Gladii waren zum Stoß bereit. Schilde wurden angehoben, bis von den Gesichtern der Männer nur noch die funkelnden Augen unter den Helmrändern sichtbar waren. Die Legionäre bewegten sich Schulter an Schulter vorwärts, ein jeder geschützt durch den unmittelbaren Kameraden. Tarquinius stand rechts von Romulus, der redselige Legionär zu seiner Linken. Beide waren für seine Sicherheit genauso verantwortlich, wie er es für die ihre war. Das war einer der Vorteile des Schildwalls. Obwohl Romulus auf Tarquinius wütend war, glaubte er keineswegs, dass der Haruspex nicht seine Pflicht tun würde.
Es war ihm entgangen, wie ausgedünnt ihre Reihen inzwischen geworden waren. Plötzlich sank der Soldat vor ihm in die Knie, ein kreischender feindlicher Krieger sprang in die Bresche und überraschte Romulus. Bekleidet mit einem stumpfkegligen phrygischen Helm und einer grob gesponnenen Tunika trug er sonst keinerlei Rüstung. Ein ovaler, stachelbewehrter Schild und eine Rhomphaia, ein merkwürdiges Schwert mit einer langen, gebogenen Klinge, waren seine einzigen Waffen. Dies war ein thrakischer Peltast, wie Romulus erkannte, und das erschreckte ihn gleich doppelt.
Ohne nachzudenken machte er einen Satz nach vorn, um dem Gegenüber den Buckel seines Scutums ins Gesicht zu rammen. Doch der Angriff schlug fehl, weil der Thraker die Attacke mit dem eigenen Schild abfing. Sie fochten für ein paar Augenblicke, wobei jeder versuchte, einen Vorteil für sich herauszuholen. Doch nichts dergleichen ergab sich, sodass Romulus rasch Respekt für die Schwertkunst seines Gegners empfand. Dank der gebogenen Klingenform konnte der Thraker über die obere Kante des Scutums stoßen und dem Gegner ernsthafte Verletzungen zufügen. Ein paar Herzschläge später hätte Romulus beinahe ein Auge eingebüßt und war einer hässlichen Verletzung am linken Oberarm nur um Haaresbreite ausgewichen.
Im Gegenzug hatte Romulus seinen Gegner mit einem flachen Schnitt am rechten Unterarm gezeichnet. Erfüllt von dunkler Befriedigung, verzog er den Mund zu einer Grimasse. Obwohl der Schnitt den Gegner nicht kampfunfähig machte, stellte er doch eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Blut sickerte aus der Wunde und lief dem Peltasten am Arm bis zum Schwertgriff hinab. Der Mann stieß einen Fluch aus, während sie weiter Hiebe und Stiche wechselten, doch keiner war imstande, am Schild des Gegners vorbeizukommen. Bald sah Romulus, dass der Thraker seinen Arm nicht mehr heben konnte, ohne vor Schmerz zusammenzuzucken. Eine kleine Möglichkeit eröffnete sich hier, die er sich nicht entgehen lassen würde.
Romulus schob sein linkes Bein und den Schild vor und schwang sein Schwert in einem kraftvollen Bogen – ein Schlag, mit dem er einem unaufmerksamen Gegner den Kopf hätte vom Rumpf trennen können. Darauf musste der Peltast eingehen, wenn er seine rechte Gesichtshälfte nicht einbüßen wollte. Die beiden Eisenklingen trafen sich unter einem Schauer von Funken. Romulus drückte die Waffe des Gegners nach unten. Ein Stöhnen entrang sich den Lippen des Thrakers, und da ahnte Romulus, dass er den Mann unter Kontrolle hatte. Es war an der Zeit, den Zweikampf zu beenden, solange der Gegner vom Schmerz überwältigt war. Romulus nutzte den Schwung des Schwerthiebs und warf sich gegen seinen Widersacher, wobei er sein ganzes Körpergewicht in den Schild legte.
Der Peltast hielt dieser Wucht nicht stand, er geriet aus dem Gleichgewicht und taumelte rückwärts, wobei er im Fallen seinen Schild verlor. Sofort setzte Romulus nach, den Schwertarm zum entscheidenden Stoß bereit. Ihre Blicke trafen sich ein letztes Mal – als würde ein Scharfrichter seinem Opfer einen letzten Blick gönnen. Ein schneller, nach unten gerichteter Stoß, und der Thraker war tot.
Romulus richtete sich ruckartig auf und hob das Scutum gerade noch rechtzeitig. Ein weiterer Gegner stellte sich ihm in den Weg, ein stoppelbärtiger, langhaariger Kerl in römischer Militärkleidung. Noch einer von Gabinius’ Männern.
»Verräter«, zischte Romulus. »Bekämpfst du jetzt also deine eigenen Leute?«
»Ich kämpfe für mein eigenes Land«, knurrte der feindliche Soldat. Sein Latein bewies Romulus’ Vermutung. »Was zum Scheißdreck machst du hier?«
Betroffen wusste er zunächst keine Antwort.
»Cäsar folgen«, fauchte der redselige Legionär. »Dem besten Feldherrn der Welt.«
Ein höhnisches Grinsen war die Antwort, und Romulus nutzte seine Chance. Er stieß mit dem Kurzschwert nach vorn, genau oberhalb des Kettenhemdkragens, und stach seinem Feind tief in den Hals. Mit einem Schrei ging der Mann zu Boden und erlaubte Romulus einen kurzen Blick auf die feindlichen Linien. Doch er wünschte sofort, er hätte sich diesen Anblick ersparen können: ägyptische Soldaten, so weit das Auge reichte, und alle drängten entschlossen vorwärts.
»Wie viele Kohorten haben wir hier?«, fragte Romulus. »Vier?«
»Ja.« Der Legionär rückte wieder zu ihm auf. Der schweren Verluste wegen bildeten sie inzwischen einen Teil der Frontlinie. Mit Tarquinius und den anderen bereiteten sie sich darauf vor, dem nächsten Ansturm zu begegnen, einer Welle, die sich aus Legionären und leicht bewaffneten Nubiern zusammensetzte. »Sie sind aber alle unterbesetzt.«
Ihre neuen Feinde waren nur in Lendenschurze gekleidet; viele hatten eine einzige lange Feder im Haar. Die schwarzhäutigen Krieger besaßen lange ovale Lederschilde und Speere mit breiten Spitzen. Die Reicheren unter ihnen trugen verzierte Stirnbänder und goldene Armreifen. Diese Krieger hatten ebenfalls kurze Schwerter, die in Stoffgürteln steckten, und führten Langbögen mit sich. Hinter der linken Schulter jedes Einzelnen ragte ein Köcher hervor. Da sie die begrenzte Reichweite der römischen Wurfspeere kannten, hielten sie in einer Entfernung von fünfzig Schritt an und legten die Pfeile in aller Ruhe auf ihre Bogensehnen. Derweil warteten ihre Kameraden geduldig ab.
Romulus war erleichtert, als er sah, dass die Nubier nicht wie die Parther Kompositwaffen trugen, denn deren Schäfte konnten ein Scutum mit Leichtigkeit durchschlagen. Allerdings war das nur ein schwacher Trost. »Wie stark sind wir jetzt noch?«, fragte er.
»Zusammen mit der fünften Kohorte, die unsere Triremen bewacht, sind wir ungefähr fünfzehnhundert Mann.« Der Legionär nahm Romulus’ überraschte Miene wahr. »Was erwartest du?«, knurrte er. »Viele von uns haben sieben Jahre Krieg geführt. Gallien, Britannien, noch mal Gallien.«
Romulus sah Tarquinius grimmig an. Diese Männer waren hartgesottene Veteranen, aber sie waren den Feinden zahlenmäßig stark unterlegen. Als Antwort erhielt er nur ein entschuldigendes Achselzucken. Er biss die Zähne zusammen. Sie waren nur hier, weil Tarquinius seinen Rat missachtet und darauf bestanden hatte, das Dock und die Bibliothek zu erkunden. Immerhin, Romulus hatte Fabiola gesehen. Falls er in diesem Scharmützel sterben sollte, dann wenigstens in der Gewissheit, dass es seiner Schwester gut ging.
Die erste Salve der nubischen Pfeile schoss in die Luft und zischte in einem tödlichen Schauer auf sie herab.
»Schilde hoch!«, brüllten die Offiziere.
Im nächsten Moment hagelten die feindlichen Geschosse mit der Wucht von Hammerschlägen auf die erhobenen Scuta. Zu Romulus’ Erleichterung besaß so gut wie kein Pfeil die nötige Durchschlagskraft, sodass nur wenige Männer getroffen wurden. Sein Puls beschleunigte sich indes, als er bemerkte, dass einige der steinernen und eisernen Pfeilspitzen mit einer dicken braunen Paste beschmiert waren. Gift! Das letzte Mal hatte er so etwas im Kampf gegen die Skythen in Margiana gesehen: das gefürchtete Scythicon. Selbst ein kleiner Kratzer durch eine der mit Widerhaken versehenen Spitzen ließ einen Mann unter Schmerzensschreien sterben. Umso erleichterter war Romulus, seinen Schild in der Hand zu halten.
Eine weitere Salve folgte, bevor die Nubier begannen, auf Cäsars Linien zuzuhalten. Unbelastet von schwerem Gerät, wie es die abtrünnigen Römer mitschleppten, gewannen sie schnell an Tempo. Unter wildem Kriegsgeschrei erreichten sie bald Laufgeschwindigkeit. Hinter ihnen folgten Gabinius’ frühere Soldaten, die den Legionären den entscheidenden Schlag versetzen sollten. Romulus biss die Zähne zusammen und wünschte, Brennus wäre bei ihnen. Die feindliche Formation stand mindestens zehn Reihen tief, Cäsars Abteilung war inzwischen kaum noch halb so stark.
Wie auf ein Stichwort erschallte eine Serie von Trompetenstößen. Von hinten kam der Befehl »Rückzug zu den Schiffen!« Die Stimme klang ruhig und gemessen und stand in seltsamem Kontrast zur allgemeinen Unruhe.
»Das ist Cäsar!«, erklärte der Legionär mit einem stolzen Grinsen. »Der gerät nie in Panik.«
Sofort setzten sich ihre Reihen seitwärts in Bewegung und rückten langsam auf den westlichen Hafen zu.
Es war nur eine kurze Strecke, aber keine einzige Sekunde durften sie in ihrer Wachsamkeit nachlassen. Als die Nubier den Ausbruchsversuch bemerkten, brüllten sie vor Zorn und rückten wieder energisch vor.
»Weitermachen!«, rief der Centurio, der Romulus am nächsten stand. »Stoppt, kurz bevor sie angreifen. Bleibt in der Formation und treibt sie zurück. Dann weiter vorrücken.«
Romulus musterte die Triremen und Liburnen, ungefähr zwanzig an der Zahl. Alle würden an Bord Platz finden – aber welche Richtung sollten sie einschlagen?
Wie immer drängte sich Tarquinius mit der Antwort in seine Gedanken. »Zum Pharos.« Er zeigte auf den Leuchtturm. »Da drüben, das Heptastadion ist nur fünfzig bis sechzig Schritte breit.«
Mit neuem Selbstvertrauen grinste Romulus. »Das können wir bis zum jüngsten Tag verteidigen.«
Allerdings waren die Schiffe immer noch außer Reichweite, und, einen Herzschlag später, krachten die Nubier mit solcher Wucht in die römische Formation, dass die vordersten Reihen um mehrere Schritte zurückgedrängt wurden. Schreie gellten durch die Nachtluft, und Soldaten verfluchten das von den Göttern gesandte Schicksal. Romulus sah, wie ein Legionär zu seiner Rechten einen Speer durch den Unterschenkel bekam und wild um sich schlagend zu Boden ging. Ein anderer erhielt zu Romulus’ Entsetzen einen Stich durch die Wange, sodass die Klinge auf der anderen Seite des Gesichts wieder austrat. Blut spritzte aus der Wunde, als die Waffe zurückgezogen wurde. Der Soldat ließ Scutum und Schwert fallen, griff mit beiden Händen an sein entstelltes Gesicht und stieß einen hohen, spitzen Schrei aus. Romulus verlor beide Verletzten aus den Augen, als eine Masse von Nubiern auf seine Formation einstürmte.
Wüste Beleidigungen gellten ihnen in einer fremden Sprache aus rot verzerrten Mündern entgegen. Mit klatschenden Geräuschen prallten die Lederschilde gegen die Schilde der römischen Legionäre, die breiten Speerspitzen zuckten vor und zurück, stets auf der Suche nach der geeigneten Lücke, um sich tief ins Fleisch der römischen Soldaten zu bohren. Der strenge Geruch der schwarzen Kämpfer stieg Romulus in die Nase. Schnell tötete er den nächsten Mann in Reichweite und stieß ihm sein Schwert in einer einzigen leichten Bewegung unterhalb des Brustbeins in den Leib. Auch sein nächster Gegner war einfach ins Jenseits zu befördern; er lief Romulus praktisch in die Klinge. Der Nubier war tot, bevor er es überhaupt bemerkte.
Rechts von Romulus erledigte auch Tarquinius seine Gegner mit Leichtigkeit, aber der redselige Legionär zu seiner Linken war in Schwierigkeiten. Bedrängt von zwei hünenhaften Nubiern, traf ihn bald ein Speer durch die rechte Schulter und lähmte ihn völlig. Er war erledigt, als einer seiner Feinde seinen Schild herunterzog, während der andere ihm die Kehle durchstach. Doch dies sollte die letzte Untat des Nubiers sein. Romulus schlug dem Mann die Hand ab, die den Speer hielt, und schlitzte ihm im selben Zug den Leib von den Lenden bis zum Schlüsselbein auf. Ein Legionär aus der hinteren Reihe rückte vor in die Bresche, und gemeinsam töteten sie den zweiten Krieger.
Doch die Toten wurden sofort ersetzt.
Wir brauchen Reiterei, dachte Romulus im Weiterkämpfen. Oder ein paar Katapulte. Eine andere Taktik, um die langsam aussichtslos werdende Lage zu verbessern. Kleine Gruppen von Legionären hatten die Triremen erreicht und schwärmten an Bord, aber die Mehrheit blieb in einem Kampf gefangen, den sie nicht gewinnen konnte. Panik flackerte auf in den Herzen der Männer, und instinktiv wichen sie zurück. Die Centurionen brüllten Befehle, um die Männer zum Bleiben anzuhalten, die Standartenträger schwenkten ihre Feldzeichen in dem Versuch, wieder Zuversicht herzustellen, aber es half alles nichts. Die Soldaten büßten immer mehr an Boden ein. Der Feind verdoppelte seine Anstrengungen, als er Blut witterte.
Romulus behagte das alles überhaupt nicht. Er konnte sehen, wie die Situation immer schneller außer Kontrolle geriet.
»Bleibt in Bewegung!«, schrie eine Stimme hinter ihm. »Haltet eure Formation. Fasst Mut, Kameraden. Cäsar ist hier!«
Romulus riskierte einen Blick über die Schulter.
Eine geschmeidige Gestalt in einem vergoldeten Brustharnisch mit rotem Umhang drängte sich zu ihnen durch. Sein Helm mit dem Federbusch war eine ausgezeichnete Schmiedearbeit, die Wangenklappen eingelegt mit Gold- und Silberfiligran. Cäsar trug ein Schwert mit verziertem Elfenbeingriff und ein gewöhnliches Scutum. Romulus nahm ein schmales Gesicht wahr, mit hohen Wangenknochen, einer geschwungenen Nase und durchdringenden dunklen Augen. Cäsars Züge erinnerten ihn an jemanden, aber er hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Das ruhige Verhalten des Feldherrn gab ihm jedenfalls neuen Mut. Wie die Centurionen war auch er bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, und wo ein Anführer wie Cäsar stand, würden die Soldaten nicht wegrennen.
Betroffen sah Tarquinius vom Feldherrn zu Romulus und wieder zurück.
Romulus bemerkte davon nichts.
Die Neuigkeit ging wie ein Lauffeuer durch die Reihen. Sofort änderte sich die Atmosphäre, die Panik verschwand wie Nebel in der Sonne. Befehle missachtend, warfen sich die neubelebten Legionäre wieder nach vorn und überraschten den unaufmerksamen Feind. Bald hatten sie den verlorenen Boden wieder wettgemacht, und es entstand eine kurze Verschnaufpause. Zwischen den Linien war der Grund übersät mit blutigen Körpern, sich windenden Verletzten und weggeschleuderten Waffen. Beide Seiten verharrten und beobachteten einander mit Argwohn. Heißer Atem waberte in kleinen Wolken in der Luft, Schweiß rann ungehindert aus dem Filzfutter unter den Bronzehelmen.
Dies war Cäsars Moment.
»Erinnert ihr euch an unsere Schlacht gegen die Nervier, Kameraden?«, fragte er laut. »Damals trugen wir gemeinsam den Sieg davon!«
Die Legionäre brüllten ihre Zustimmung. Ihr Sieg gegen den tapferen Stamm war einer der am härtesten erkämpften im gesamten gallischen Feldzug gewesen.
»Und Alesia?«, fuhr Cäsar fort. »Da kamen die Gallier an wie lästige Bienenschwärme. Aber wir haben sie trotzdem geschlagen!«
Wieder erscholl zustimmendes Gebrüll.
»Sogar in Pharsalos, wo uns jeder bereits als zurückgeschlagen ansah«, setzte Cäsar nach und schloss alle mit theatralischer Geste ein, »habt ihr, meine Kameraden, den Sieg errungen.«
Romulus sah, wie echter Stolz in den Gesichtern der Männer aufleuchtete; er fühlte, wie die alte Entschlossenheit zurückkehrte. Cäsar war einer von ihnen. Ein Soldat. Romulus fühlte, wie sein Respekt gegenüber diesem Mann wuchs. Dies war ein hervorragender Anführer.
»Cä-sar!«, skandierte ein wettergegerbter Veteran, »Cä-sar!« Alle nahmen den Schrei auf, auch Romulus.
Sogar Tarquinius stimmte ein.
Cäsar ließ seine Männer einen Moment lang jubeln, dann begann er, sie noch einmal in Richtung der Triremen zu drängen.
Sie hätten es beinahe geschafft. Eingeschüchtert durch den römischen Gegenangriff und die kühnen Worte Cäsars, hielten sich die ägyptischen Truppen für zwanzig Herzschläge zurück. Bald war die Kante des Docks nur noch einen Steinwurf entfernt. Von Matrosen angeführt, hatten wieder mehrere hundert Legionäre die Schiffe bestiegen, während einige der niedrig gebauten Triremen in den Hafen hinausfuhren. Die drei Ruderreihen jedes Schiffs tauchten tief ins Wasser und zogen sie weiter hinaus. Endlich, wütend über das Entkommen ihrer Feinde, handelten die ägyptischen Offiziere. Sie ermahnten ihre Männer, die begonnene Sache durchzuziehen, und stürmten vorwärts, rasch gefolgt von einer Masse aufgewühlter Soldaten, die nur eins versprach: Vernichtung.
»Verteilt euch!«, befahl Cäsar. »Bildet eine Linie vor den Triremen.«
Seine Männer beeilten sich zu gehorchen.
Alles geht viel zu langsam, dachte Romulus mit einem Anflug von Furcht. Manöver wie dieses konnten nicht gelingen, wenn eine feindliche Streitmacht aus nur dreißig Schritt Entfernung anrückte.
Tarquinius hob den Blick zum sternbedeckten Himmel, auf der Suche nach Zeichen. Woher kam der Wind? Würde er bald wechseln? Er musste es wissen, aber ihm war keine Zeit vergönnt. Einen Augenblick später waren die Ägypter bei ihnen. Eine Streitmacht im Moment des Rückzugs anzugreifen, war eine der besten Möglichkeiten, eine Schlacht zu entscheiden, und das spürten die Gegner instinktiv. Speere stießen vor und verabreichten Legionären, die sich gerade zur Flucht wandten, den Todesstoß. Schwerter, geschwungen von Gabinius’ früheren Soldaten, bohrten sich in schwache Kettenpanzer oder verletzliche Achselhöhlen; manch einem Legionär wurde der Schild aus der Hand geschlagen. Die bronzenen Helme gaben unter den schweren Schlägen nach, Schädeldecken knackten. Tödliche Pfeilsalven sirrten durch die Luft, ein Hagel aus Steinen ging über ihren Köpfen nieder. Als Romulus die tödlichen Felsbrocken sah, sank ihm das Herz. Mit den feindlichen Schleuderern in Reichweite würden die Todesopfer auf römischer Seite rasant zunehmen.
Die Gesichter der meisten Legionäre waren jetzt von Furcht verzerrt. Andere starrten schreckerfüllt zum Himmel und beteten laut. Cäsars Rufe zum Sammeln nützten nichts mehr. Er verfügte einfach nicht über genügend Männer, um die Ägypter aufzuhalten. Der Kampf wurde zum verzweifelten Versuch, nicht vollends aufgerieben zu werden. Immer noch schlug und stach Romulus nach seinen Gegnern, und tatsächlich konnte er seinen Platz behaupten. Tarquinius war auf seine Weise erfolgreich, mit einer Behändigkeit, die seiner Jahre spottete. Der Soldat, der sich Romulus zur Linken angeschlossen hatte, erwies sich ebenfalls als geschickter Kämpfer. Zusammen bildeten sie ein furchteinflößendes Trio – was die Gesamtsituation betraf, machte es leider kaum einen Unterschied.
Als die römischen Linien zurückwichen, ließen immer mehr Männer ihr Leben, und das schwächte den Schildwall. Zuletzt brach die Testudo ganz zusammen, während kreischende Nubier die Formation durchbrachen. Mit ihren auffälligen roten Umhängen und den vergoldeten Brustpanzern wurden die Centurionen als Erste angegriffen, und deren Tod senkte die Moral noch mehr. Trotz Cäsars Anstrengung drohte aus dem Kampf ein ungeordneter Rückzug zu werden. Als der erfahrene Feldherr dies spürte, zog er sich zum Dock zurück. Sofort machte sich Furcht in den Kohorten breit. Männer wurden umgerannt und zu Tode getrampelt, als die Soldaten zu Hunderten überhastet auf die scheinbare Sicherheit der Triremen zuhielten. Andere wurden vom Kai in das dunkle Wasser gestoßen und versanken in Sekundenschnelle in ihren schweren Rüstungen.
»Wir schaffen es nicht!«, rief Tarquinius.
Romulus warf einen Blick über die Schulter. Nur wenige Schiffe konnten gleichzeitig bestiegen werden, und weil die Legionäre in ihrer kopflosen Hast nicht warten wollten, schwebten die nächstgelegenen Schiffe in echter Gefahr, überladen zu werden. »Die Narren«, sagte er. »Sie werden versinken.« Er weigerte sich indes, in Panik zu geraten. »Was sollen wir machen?«
»Schwimmen«, antwortete der Haruspex. »Zum Pharos.«
Romulus schauderte, als er daran dachte, wie sie sich in der Schlacht am Hydaspes durch Schwimmen gerettet hatten. Brennus war aus freien Stücken am Ufer des Flusses zurückgeblieben und hatte dem Tod ins Angesicht geschaut. Romulus litt nach wie vor bei dem Gedanken, seinen Kameraden im Stich gelassen zu haben. Scham und Reue stiegen in ihm hoch, doch er zwang sich dazu, sein Denken auf das Hier und Jetzt zu richten. Was geschehen ist, ist geschehen, dachte er. »Kommst du mit?«, fragte er den Legionär zu seiner Linken.
Ein knappes Nicken kam als Antwort.
Wie ein Mann bahnten sie sich ihren Weg durch die verwirrten und verängstigten Soldaten um sie herum. In dem Durcheinander, das jetzt herrschte, war es ein Leichtes, aus der bedrängten römischen Formation auszubrechen und sich ans Wasser heranzuwagen. Sie mussten extrem vorsichtig sein. Die Steinplatten waren glitschig von Blut und übersät von Körperteilen und weggeworfener Ausrüstung. Sie ließen die brennenden Lagerhäuser weit hinter sich und bewegten sich bald im Halbdunkel. Glücklicherweise war das Gelände leer. Die Kämpfe waren auf das Gebiet um die Triremen beschränkt, und die ägyptischen Kommandeure hatten nicht daran gedacht, Männer nach Westen an die Docks zu schicken, um eine Flucht zu verhindern.
Das Versäumnis spielt keine Rolle, dachte Romulus und starrte zurück auf das Getümmel. Der bisherige Mut von Cäsars Männern war inzwischen wilder Panik gewichen. Unter Missachtung aller Anweisungen der Offiziere kämpften und rangelten sie, um zu entkommen. Er deutete auf eine Trireme, die zweite vom Kai aus. »Die sinkt bald.«
Der Legionär beschattete seine Augen mit einer Hand und fluchte. »Cäsar ist dort an Bord!«, schrie er. »Sollen die dreckigen Ägypter im Hades schmoren!«
Romulus blinzelte ins Licht hinaus und entdeckte schließlich den Feldherrn inmitten des Gedränges. Trotz der Rufe des Trierarchen – des Kapitäns – und seiner Matrosen drängten immer mehr Soldaten an Bord.
»Wer soll uns führen, wenn er tot ist?«, rief ihr Begleiter.
»Um den kannst du dir später Sorgen machen. Lass uns erst mal selber überleben«, gab Romulus knapp zurück und entkleidete sich bis auf die zerlumpte Militärtunika. Seinen Gürtel schnallte er sich sofort wieder um, sodass er sein Schwert in der Scheide und den Pugio genannten Dolch, der sowohl als Waffe wie auch als Werkzeug diente, bei sich behalten konnte.
Tarquinius tat es ihm gleich.
Der Legionär sah vom einen zum anderen. Dann, grässliche Verwünschungen murmelnd, ahmte er sie nach. »Ich bin nicht gerade der beste Schwimmer«, bekannte er.
Romulus grinste. »Du kannst dich an mir festhalten.«
»Ein Mann sollte wissen, wer ihm die Haut rettet. Ich bin Faventius Petronius«, sagte der andere und streckte ihm den rechten Arm entgegen.
»Romulus.« Sie umfassten einander die Unterarme. »Er heißt Tarquinius.«
Es blieb keine Zeit für weitere Höflichkeiten. Romulus sprang ins Wasser, Füße zuerst, der Haruspex folgte ihm. Petronius zuckte mit den Schultern und kam nach. Da sie weit genug vom Schlachtgetümmel entfernt waren, blieben die Sprünge ins Wasser unbemerkt. Mit kraftvollen Bewegungen schwamm Tarquinius sofort hinaus ins Hafenbecken. Sie brauchten Licht, um etwas sehen zu können, aber sie mussten auch weit genug draußen bleiben, um die feindlichen Wurfgeschosse meiden zu können. Mit Petronius, der sich verzweifelt festhielt, schwamm Romulus hinterdrein.
Wie schön es doch wäre, Fabiolas Schiff einzuholen, dachte Romulus. Es war natürlich längst in der Nacht verschwunden, ohne Zweifel in Richtung Italia. Derselben Richtung, die er seit einer Ewigkeit einzuschlagen versuchte. Trotz seiner eigenen Notlage gab Romulus die Hoffnung nicht auf. Wieder und wieder hatte Tarquinius gesagt, es gebe für ihn einen Weg zurück nach Rom. Dieser Traum ließ ihn durchhalten. Mit jedem Schwimmzug stellte sich Romulus seine Rückkehr nach Hause vor und dachte daran, wie er wieder mit Fabiola vereint sein würde. Es würde sich anfühlen, als käme man ins Elysium. Danach würde es dann einiges an unerledigten Geschäften zu regeln geben. Tarquinius zufolge war ihre Mutter schon lange tot, aber ihr Tod musste gerächt werden. Dazu musste Romulus den Kaufmann Gemellus töten, ihren früheren Besitzer.
Der Hall von ins Wasser klatschenden Körpern, begleitet von Rufen und Schreien, zerrte Romulus’ Aufmerksamkeit zurück in die Gegenwart. Dutzende von Legionären sprangen von der äußersten Trireme, die unter dem Gewicht zu vieler Männer im Sinken begriffen war. Die verzweifelten Männer erwartete jedoch im Wasser kein besseres Schicksal als an Bord, denn die meisten wurden sofort von dem Gewicht ihrer Rüstung unter Wasser gezogen, während die anderen, die schwimmen konnten, von den feindlichen Schleuderern und Bogenschützen unter Beschuss genommen wurden, die bereits auf dem Heptastadion postiert worden waren.
Romulus war entsetzt angesichts ihrer misslichen Lage, aber er konnte so gut wie nichts dagegen tun.
Petronius verfolgte das Geschehen ebenfalls mit wachem Blick, das sich vor ihren Augen abspielte. Einen Moment später verstärkte er seinen Griff an Romulus’ Schulter. »Ruhig«, keuchte Romulus. »Willst du mich erwürgen?«
»Entschuldige«, prustete Petronius und entspannte sich. »Aber sieh nur! Cäsar springt gerade vom Schiff!«
Romulus wandte den Kopf. Im Schein der Feuersbrunst im östlichen Hafen konnte er die Gestalt ausmachen, die zuvor die Legionäre zum Zusammenhalten angetrieben hatte. Cäsar versuchte nicht länger, seine Männer zu kontrollieren, auch er musste jetzt die Flucht ergreifen. Er hatte sich des Helms und des roten Umhangs entledigt, kurz darauf schleuderte er den vergoldeten Brustpanzer fort. Umgeben von einer Gruppe von Legionären wartete Cäsar, bis alle fertig waren. Dann, eine Hand voll Pergamente fest im Griff, stieg er mit einem Schritt von der Seitenreling ins Wasser. Seine Männer sprangen ringsherum in die Fluten, dass die Fontänen in alle Richtungen stoben. Sobald sich ein schützender Kordon gebildet hatte, begann Cäsar, auf den Pharos zuzuschwimmen, eine Hand immer in der Luft, um seine Schriftstücke trocken zu halten.
»Bei Mithras, der hat Mut«, kommentierte Romulus.
Petronius kicherte. »Cäsar fürchtet sich vor nichts.«
Ein Schauer von Pfeilen und Steinen erinnerte sie daran, dass dies kein Ort zum Verweilen war. Während die Mehrzahl der ägyptischen Soldaten nach wie vor die Kohorten attackierte, die auf dem Dock festsaßen, hasteten andere weiter zum Heptastadion. Von dort aus konnten sie unbeantwortete Salven auf die hilflosen Legionäre im Wasser abfeuern.
Romulus war entsetzt angesichts der Treffsicherheit der Schleuderer. Das Licht, das über die ruhige Oberfläche des Wassers fingerte, war nicht allzu hell. Er hatte gehofft, dass ihre Strecke einigermaßen sicher sein würde, weil sie unterhalb der Docks entlangführte und teils durch das Heptastadion verdeckt wurde. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Die Schleuderer legten Steine von der Größe eines Hühnereis in ihre Schlingen und wirbelten diese ein oder zweimal über dem Kopf, bevor der Stein losflog. Es vergingen vielleicht ein oder zwei Herzschläge, bevor der nächste Steinhagel niederging, ein dritter und vierter in schneller Folge. Bald war die Luft voller Geschosse, die den Legionären schlimme Verluste zufügten.
Und schon bald brauchten die feindlichen Schleuderer und Bogenschützen neue Ziele. Wegen der Entscheidung, weiter hinaus zu schwimmen, war Cäsars Gruppe bisher verschont geblieben, genau wie sie selbst. Der Status quo würde aber nicht anhalten. Weil es auf dem Heptastadion kaum Truppen Cäsars gab, konnten die Ägypter eine Parallelstrecke laufen und von dort ungestraft den tödlichen Steinhagel auf sie herabregnen lassen.
»Schneller«, drängte Tarquinius.
Eine Kaskade von Geschossen und Steinen traf das Wasser keine zwanzig Schritt weit entfernt und ließ Romulus’ Puls in die Höhe schnellen. Petronius’ Atem kam stoßweise von hinten. Man hatte sie entdeckt. Romulus steigerte die Geschwindigkeit seiner Schwimmzüge und versuchte, nicht seitwärts zu schauen.
»Diese Schleuderer können ein Strohbündel aus sechshundert Schritt Entfernung treffen«, murmelte Petronius.
Weitere Steine schlugen ein, noch näher diesmal. Romulus richtete den Blick unweigerlich auf die sich scharf abzeichnenden Silhouetten der Feinde, die ihre Schleudern nachluden. Lachen hallte durch die Luft, und die Lederschlingen wirbelten hypnotisch über ihren Köpfen, entluden sich – schon wieder.
Glücklicherweise kam die Insel langsam näher. Cäsar war dem Meer entstiegen und gab bereits Befehle, brachte seine Männer dazu, das Ende des Heptastadions zu verteidigen. Romulus stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Sicherheit winkte, und zweifellos würde es eine Atempause geben, wenn sie erst einmal die Ägypter zurückgeworfen hatten. Wenn es so weit war, würde er Tarquinius dazu zwingen, ihm alles über den Kampf vor dem Bordell zu erzählen.
Immer noch in Führung, drehte sich der Haruspex um, um irgendetwas zu sagen. Ihre Blicke trafen sich, der Ausdruck in seinen Augen war steinern und doch voller Entschlossenheit. Tarquinius’ Stimme erstarb, und so starrten sie einander nur an. Der stille Austausch war umso beredter und verstrickte Romulus’ Herz in einen Widerstreit gegensätzlicher Gefühle. Ich schulde ihm so viel, dachte er, und trotzdem ist er der verdammte Grund dafür, dass ich aus Rom fliehen musste. Wäre er nicht gewesen, hätte mein Leben anders ausgesehen. Er erinnerte sich an das schlichte hölzerne Schwert, das Cotta besaß, sein alter Ausbilder im Ludus, und runzelte die Stirn. So ein Rudis hätte inzwischen auch mir gehören können.
Tarquinius stand auf. Er hatte das seichte Uferwasser erreicht. Schreie der frustrierten Schleuderer wehten herüber. Sie luden ihre Waffen nach und verdoppelten ihre Anstrengungen, das Trio zu Fall zu bringen. Hastig abgeschossene Steine klatschten harmlos hinter ihnen ins Wasser.
Derweil drückte Romulus seine Stiefel in den Schlamm der seichten Uferböschung. Petronius seufzte erleichtert auf. Zwei Züge noch und er würde ebenfalls stehen können. Der Veteran ließ los und verpasste Romulus einen Knuff an die Schulter. »Meinen Dank, Kamerad. Ich bin dir was schuldig.«
Romulus deutete auf die Hauptmacht der Ägypter, die sich für einen vollen Frontalangriff auf dem Heptastadion bereit machte. »Hier gibt es reichlich Gelegenheit, mich auszuzahlen.«
»Kommt hier herüber!«, schrie ein Centurio wie aufs Stichwort. »Jedes Schwert zählt.«
»Wir machen besser, was er sagt«, riet Tarquinius.
Das waren die letzten Worte, die er an jenem Tag sprach.
Mit einem befremdlichen Schwirren zischte ein Felsbrocken zwischen Romulus und Petronius durch die Luft. Er traf Tarquinius seitlich am Kopf und brach ihm hörbar den Wangenknochen. Der Haruspex öffnete den Mund zu einem stummen Schrei. Dann fiel er, vom Aufprall halb herumgedreht, rückwärts in das hüfthohe Wasser. Halb bei Bewusstsein, sank er auf der Stelle.
2. KAPITEL:JOVINA
BEI ROM, WINTER 48 V.CHR.
»Fabiola!«, durchbrach Brutus die Stille. »Wir sind bald da.«
Docilosa lüftete den Seitenvorhang, sodass ihre Herrin aus der Sänfte schauen konnte. Der Morgen dämmerte schnell, aber die Gesellschaft war schon seit mehr als zwei Stunden unterwegs. Keine der beiden Frauen hatte sich über den frühen Aufbruch beschwert. Beide wollten so schnell wie möglich Rom erreichen, das Ziel ihrer Reise. Decimus Brutus, Fabiolas Liebhaber, ging es nicht anders. Er hatte einen dringenden Auftrag seines Herrn Julius Cäsar an Marcus Antonius zu überbringen, den Oberbefehlshaber der Reiterei. Es wurden weitere Truppen in Ägypten benötigt, um die Blockade zu brechen, der Fabiola und Brutus erst vor Kurzem entronnen waren. Die feindlichen Barrikaden hielten Cäsar und seine paar tausend Soldaten noch immer in Alexandria eingeschlossen.
Zwischen den hohen Zypressen am Straßenrand konnte Fabiola viele Grabmale aus gebrannten Ziegeln erkennen. Ihr Puls ging schneller, sobald sie in Sicht kamen. Nur die Reichen konnten sich solche Gräber an den Zufahrtsstraßen nach Rom leisten. Kein Vorübergehender hätte die grandiosen Bauwerke übersehen können, und so bewahrten sie die sonst vielleicht allzu zerbrechliche Erinnerung an ihre toten Auftraggeber. Brutus hatte recht: Es war nicht mehr weit. Die meisten Mausoleen säumten, über viele Meilen hinweg, die Via Appia Richtung Süden, aber verstreute Mausoleen ließen sich praktisch entlang jeder Route finden, die sonst in die Hauptstadt führte. Diese Straße, die den römischen Hafen Ostia mit der Stadt verband, bildete da keine Ausnahme. Bemalte Statuen der Götter und Ahnenbildnisse der Verstorbenen schmückten die Gräber, aber zwischen ihnen trieben sich Halsabschneider und billige Huren herum. Nur wenige wagten es daher, sie bei Nacht zu passieren. Selbst das matte Frühlicht milderte nicht den Schrecken, der zwischen den wispernden Bäumen und drohend vorkragenden Bauwerken lauerte. Fabiola war froh über ihre starke Eskorte: eine halbe Centurie Elitesoldaten und Sextus, ihr treuer Leibwächter.
»Jetzt kannst du bald endlich ein Bad nehmen«, sagte Brutus, während er näher herangeritten kam.
»Dank sei den Göttern«, antwortete Fabiola. Ihre Reisekleider klebten ihr auf der Haut.
»Der Bote, den ich gestern vorausgeschickt habe, wird dafür sorgen, dass alles im Domus vorbereitet ist.«
»Du bist so fürsorglich, mein Liebster.« Sie schenkte Brutus ein strahlendes Lächeln.
Brutus sah mehr als zufrieden aus, als er sein Pferd an die Spitze der Kolonne traben ließ. Wie Cäsar war er kein Mann, der seine Leute aus den hinteren Reihen dirigierte.
Fabiola rümpfte die Nase, als sich der unverwechselbare Gestank von menschlichen Exkrementen bemerkbar machte. Schwer und stechend, war er genau so vertraut wie der Duft von frischem Brot, nur weit weniger angenehm. Wie auch immer, dies war und blieb Roms vorherrschender Geruch, und damit war sie aufgewachsen. Genau in dem Moment, als die Gesellschaft sich der Stadt auf eine Meile genähert hatte, stellte dieser Geruch sich wieder ein. Hunderttausende von Plebejern hatten keinen Zugang zum Abwassersystem, das war die Ursache. Der Kontrast zur Sauberkeit Alexandrias hätte kaum krasser sein können. Diese Seite des Hauptstadtlebens jedenfalls hatte sie nicht vermisst. Obwohl die leichte Morgenbrise den Gestank erträglicher machte als träge Sommerluft, war er doch allgegenwärtig.
Zuerst hatte Fabiola sich auf die Rückkehr gefreut. Vier lange Jahre war sie jetzt von ihrer Geburtsstadt fort gewesen. Der letzte ihrer zeitweiligen Aufenthaltsorte – Ägypten – war ein fremdartiges Land, dessen Bewohner die römischen Herren mit ihren Regierungsansprüchen hassten. Ihre eigene Abneigung hatte sich in dem Moment gewandelt, als Romulus in den kriegsgeschüttelten Docks aufgetaucht war, ausgerechnet in der Nacht, als sie Alexandria verlassen hatte. Natürlich hatte Fabiola bleiben und ihm helfen wollen. Ihr Zwillingsbruder war am Leben und diente in der römischen Armee! Zu ihrer immensen Enttäuschung hatte Brutus sich geweigert, ihre Abfahrt aufzuschieben. Die Lage war zu ernst gewesen. Konfrontiert mit Fabiolas Verzweiflung, entschuldigte er sich, blieb aber fest entschlossen. Sie hatte kaum eine andere Wahl, als sich seiner Beurteilung der Lage zu beugen. Die Götter hatten es für gut befunden, Romulus bis hierher ihren Schutz zu gewähren, und mit ihrer Hilfe würde sie ihn eines Tages wiedersehen. Wenn sie doch nur verstanden hätte, was er ihr zugerufen hatte. Sein Schrei war in dem Chaos völlig untergegangen, als ihre Trireme ablegen musste. Sie konnte nur vermuten, dass er ihr seine Armeeeinheit hatte zurufen wollen. Den Umständen zum Trotz hatte dieses Treffen die junge Frau mit neuer, starker Lebenslust erfüllt.
Fabiola ließ ihren Gedanken freien Lauf, und ihr drehte sich schier der Magen um, als sie an den dreckverkrusteten Eimer dachte, in den sie und die anderen Sklaven in Gemellus’ Haus ihre Notdurft hatten verrichten müssen. Nie wieder, dachte sie stolz. Wie weit habe ich es doch seitdem gebracht. Selbst das Bordell, in das sie der Kaufmann verkauft hatte, hatte einigermaßen saubere Aborte gehabt. Und doch zählte diese kleine Verbesserung kaum gegenüber der Erniedrigung durch Fremde, die ihren Körper für körperliche Gelüste benutzten. Die harte Wirklichkeit des Lupanar brach den meisten Frauen den Lebensmut, nicht aber Fabiola. Ich habe überlebt, weil ich musste, dachte sie. Sie hatte Gemellus Rache geschworen, und als sie herausfand, wer ihr und Romulus’ gemeinsamer Vater war, hatte sie beschlossen, ihrer neuen Karriere zu entkommen – auf welche Weise auch immer.
Die Liste der reichen Besucher war einer der wenigen Pluspunkte des Hurenhauses gewesen. Nachdem eine freundliche Prostituierte ihr geraten hatte, einen passenden Adligen für sich zu gewinnen, hatte Fabiola sich gut umgesehen und unter Einsatz ihres beträchtlichen Charmes mehrere nichtsahnende Kandidaten in ihre Netze gezogen.
Sie hob den schweren Stoff und äugte mehrmals zu Brutus hinüber, der wieder neben der Sänfte ritt. Auch Sextus befand sich in Reichweite, bei Tag war das praktisch sein ständiger Aufenthaltsort. Nachts schlief er direkt vor ihrer Tür. Fabiola nickte ihm zu, wie immer froh, ihren Leibwächter so dicht bei sich zu wissen. Dann bemerkte Brutus sie und schenkte ihr ein Lächeln. Fabiola warf ihm eine Kusshand zu. Er war Karrieresoldat und ein loyaler Gefolgsmann Cäsars, noch dazu war er mutig und liebenswürdig. Nach ein paar Besuchen im Lupanar war er ihrem Zauber völlig erlegen. Nicht, dass sie sich aus diesem Grund für ihn entschieden hätte, natürlich.
Es war Brutus’ enge Verbindung zu Cäsar, die bei Fabiolas Entscheidung letzten Endes den Ausschlag gegeben hatte. War es ihr Bauchgefühl gewesen? Bis auf den heutigen Tag vermochte Fabiola das nicht sicher zu beantworten. Glücklicherweise hatte sich ihre Entscheidung, auf Brutus zu setzen als den besten Kandidaten, für sie ausgezahlt. Vor fünf Jahren hatte er sie aus dem Bordell freigekauft und sie als Herrin seines neuen Latifundiums in der Nähe von Pompeji eingesetzt.
Der Vorbesitzer war kein anderer als Gemellus gewesen! Fabiolas Lippen kräuselten sich zu einem Triumphlächeln. Bis heute fühlte es sich wie süße Rache an, diesen Mann ruiniert zu wissen. Nicht, dass sie davor zurückschrecken würde, den Hurensohn auch noch umzubringen, sollte sich die Gelegenheit ergeben. Mehrere Versuche, ihn aufzuspüren, waren leider fehlgeschlagen, und so war er in Fabiolas Erinnerung verblasst, wie so vieles in ihrer Vergangenheit. Aber sie hatte lebhafte Erinnerungen an ihren kurzen Aufenthalt auf seinem Latifundium. Furcht durchzuckte Fabiola, und ängstlich musterte sie die Straße.
So dicht vor der Stadt gab es reichlich andere Reisende in beide Richtungen. Händler zerrten beladene Maultiere hinter sich her; Bauern fuhren auf die geschäftigen Märkte. Kinder kamen vorbei, die Ziegen und Schafe auf die Weide trieben, Leprakranke hinkten an selbstgemachten Krücken einher und ausgemusterte Veteranen marschierten zusammen nach Hause. Ein reizbar wirkender Priester stelzte vorbei, eine Gruppe kahl rasierter Akolythen im Schlepptau, denen er irgendeine religiöse Sache erläuterte. Eine Reihe von Sklaven in Halsketten folgte unglücklich einem kräftigen Mann, der ein Lederwams trug und eine langstielige Peitsche schwang. Bewaffnete Wachen schritten beide Seiten der Kolonne ab, um jeden Fluchtversuch zu vereiteln. Der Anblick war nichts Besonderes; schließlich herrschte in Rom ein großer Bedarf an Sklaven. Nichtsdestoweniger zuckte Fabiola in ihre Sänfte zurück, als sie die schlurfenden, niedergeschlagenen Männer und Frauen passierten. Die Galle kam ihr hoch. Mehr als vier Jahre danach versetzte sie der Gedanke an Scaevola – einen bösartigen Sklavenfänger, mit dem sie aneinandergeraten war – immer noch in Angst und Schrecken.
Aber sie würde sich auch dadurch nicht aufhalten lassen.
Bis sie Romulus in Alexandria gesehen hatte, war Fabiolas größte Entdeckung gewesen, dass Cäsar tatsächlich ihr Vater war. Nur einmal hatte man sie mit dem Feldherrn allein gelassen, der ihrem Bruder unglaublich ähnlich sah. Er hatte die Gelegenheit ausgenutzt und versucht, sie zu vergewaltigen. Es war nicht nur die Gier in seinen Augen gewesen, die Fabiola von Cäsars Schuld überzeugte. Seine rauen Worte – »Sei still, oder ich tue dir weh« – hallten immer noch in ihr nach. Irgendwie hatte sie beim Hören gewusst, dass er diese Worte nicht das erste Mal gebrauchte. Mit diesem Beweis im Herzen hatte sie seitdem abgewartet und ihn beobachtet. Ihre Gelegenheit zur Rache würde eines Tages kommen.
Auch wenn Cäsar vielleicht gerade in Alexandria größte Gefahren durchstehen musste, so wollte Fabiola doch keineswegs, dass er dort sein Ende fand. Ein Tod durch einen fremden Mob würde ihren Durst nach einem wohlgesponnenen Rachekomplott nicht stillen. Aber sobald Cäsar Ägypten verließ, warteten weitere Kriege auf ihn. In Africa und Hispania waren die republikanischen Streitkräfte noch stark vertreten. Die Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt nach Rom verschaffte Fabiola die perfekte Gelegenheit, ihre Ränke zu schmieden; Männer zu rekrutieren, die Cäsar töten würden, sobald er zurückkam. Sie würde reichlich Verschwörer um sich scharen, wenn sie herumerzählte, was sie bereits Brutus gesagt hatte: dass der Feldherr plane, sich zum neuen Herrscher von Rom zu machen.
Allein die Idee war ein Gräuel für jeden lebenden Bürger Roms. Brutus’ Haus bot allerdings nicht den richtigen Ort für ein Komplott; lächelnd vertraute Fabiola darauf, dass die Götter ihr ein passendes Hauptquartier zeigen würden.
Es dauerte viele Wochen, bis Fabiola sich sicher genug fühlte, um ohne Brutus auszugehen. Kaum hatte sie Rom betreten, kehrte ihre Furcht vor Scaevola mit aller Macht zurück. Schiere Panik überkam sie, wenn sie allein aus dem Haus ging; also war sie ganz zufrieden damit, im Domus zu bleiben. Es gab reichlich zu tun: Der Haushalt musste in Ordnung gehalten werden; dann gab es Feste für Brutus’ Freunde zu organisieren, und schließlich waren da noch die Lektionen, die ihr Griechisch-Lehrer für sie zusammenstellte. Fabiola hatte ihn auch deshalb angestellt, weil sie Lesen und Schreiben lernen wollte, was ihr Selbstvertrauen enorm steigerte. Sie verschlang jedes Manuskript, dessen sie habhaft werden konnte. Es war leicht zu sehen, warum Jovina ihre Prostituierten als Analphabeten gehalten hatte. Unwissenheit machte die Mädchen leichter formbar. Brutus kam jeden Abend erschöpft nach Hause und war beeindruckt von ihrem bohrenden Interesse an Politik, Philosophie und Geschichte.
Seitdem er die Nachricht über Cäsars Zwangslage an Marcus Antonius, Cäsars offiziellen Stellvertreter, weitergereicht hatte, war Brutus an der Regierung der Republik beteiligt gewesen, zusammen mit Antonius und anderen Hauptunterstützern des Feldherrn. An ein Nachlassen war nicht zu denken: Rom war unruhiger denn je. Verunsichert von dem Mangel an Informationen über Cäsar – vor Brutus’ Rückkehr hatte man über drei Monate lang nichts über Cäsars Verbleib gewusst – hatte die Bevölkerung mit Demonstrationen begonnen. Angestachelt von ein paar machthungrigen Politikern, verlangten unzufriedene Adelige, die bis über die Ohren in Schulden steckten, einen kompletten Schuldenerlass von Cäsar, der sie auszahlen sollte. Damit machten sie eine Farce aus einem früheren Gesetz, das ihre Schulden teilweise aufheben sollte. Gänzlich Unzufriedene hatten sich sogar zu Republikanern erklärt. Die Lage wurde noch dadurch verschärft, dass Hunderte von Veteranen aus Cäsars bevorzugter Legion, der 10., nach Italia zurückgeschickt worden waren und zur Unruhe beitrugen. Empört über Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer Pensionen in Form von Geld und Land, gingen sie regelmäßig auf die Straße.
Marcus Antonius hatte wie immer übertrieben hart reagiert: Soldaten wurden eingesetzt, um die ersten Ruhestörer zu zerstreuen, und bald danach hatte es das erste Blutvergießen in der Stadt gegeben. Das Vorgehen erinnere ihn eher an eine Züchtigung aufständischer Gallier denn an eine Beruhigung römischer Bürger, wetterte Brutus daheim bei Fabiola. Während das Risiko einer Rebellion durch die Pompeius-Anhänger langsam nachließ, hatte Antonius wenig unternommen, um die Veteranen zu beschwichtigen. Seine Standardmethode zur Befriedung hatte sich als gegenläufig erwiesen. Von Natur aus diplomatischer als der hitzköpfige Magister Equitum hatte Brutus sich mit den Anführern der 10. getroffen und sie vorläufig beruhigt. Trotzdem gab es noch viel zu tun, bis die Situation wieder stabil sein würde.
Als der Frühsommer kam, beruhigte sich Fabiola, weil Brutus mit anderen Dingen beschäftigt und abgelenkt war – und weil es nirgends eine Spur von Scaevola gab. Ihr war eine ungeheuerliche Idee gekommen, und schließlich entschloss sie sich zu einem Besuch im Lupanar, dem Bordell, das während ihrer Zeit als Prostituierte ihr Zuhause gewesen war. Brutus sollte jedenfalls nichts davon erfahren. Je weniger ihr Liebhaber im Moment wusste, umso besser. Leider bedeutete die Geheimhaltung auch, dass keiner von Brutus’ Legionären sie eskortieren konnte. Furcht stieg in ihr hoch, wenn sie daran dachte, wie sie nur mit Sextus zusammen durch die Straßen laufen würde, aber es gelang ihr, das Gefühl zu unterdrücken. Weder konnte sie sich für immer hinter den dicken Mauern des Hauses verstecken, noch wollte sie andauernd zum Ausgehen auf eine Abteilung Soldaten zurückgreifen.
Geheimhaltung war das Allerwichtigste.
Also ignorierte sie Docilosas Skepsis und den brummigen Protest des Optio, der Brutus’ Männer befehligte, und ging mit Sextus auf den Palatin. Diese Vorstadt wurde größtenteils von den Reichen bewohnt, aber wie in allen Teilen Roms gab es auch hier viele Insulae, die hohen, hölzernen Mietshäuser, in denen die übergroße Mehrheit der Bevölkerung lebte. Über den offenen Ladenfronten auf Straßenniveau erhoben sich die Wohnungen drei, vier, fünf Stockwerke hoch. Doch schlechte Beleuchtung, Rattenplagen und fehlende Latrinen kennzeichneten diese Wohnquartiere, offene Feuerbecken machten diese Insulae zu Todesfallen. Krankheiten lauerten hier, Ausbrüche von Cholera, Ruhr oder Pocken waren keine Seltenheit. Täglich brachen irgendwelche Insulae zusammen oder gingen in Flammen auf, sodass alle Bewohner verbrannten. Nah aneinandergebaut, ließen sie wenig Licht in die schmalen, überfüllten und matschigen Straßen. Nur die größten Durchfahrtsstraßen der Hauptstadt waren gepflastert, noch weniger waren breiter als zehn Schritt. Jeden Tag wimmelte es dort von Bürgern, Händlern, Sklaven und Dieben, was alles zu der beklemmenden Enge beitrug.
Fabiola, die geborene Städterin, hatte das offene Land um ihr Latifundium lieben gelernt. Sie hatte angenommen, noch immer an Menschenmassen gewöhnt zu sein – bis sie und Sextus den Domus um gerade einmal hundert Schritte hinter sich gelassen hatten. Von allen Seiten bedrängt, flammte sofort ein Bild von Scaevola in ihrer Erinnerung auf. Beim besten Willen schaffte sie es nicht, es wieder loszuwerden. Sie fühlte sich wie gelähmt und fiel zurück.
Sextus sah ihr gequältes Gesicht und legte die Hand ans Schwert. »Was ist los mit Euch, Herrin?«
»Es geht mir gut«, sagte sie und zog die Kapuze ihres Umhangs enger um den Kopf. »Nur ein paar schlechte Erinnerungen.«
Er fasste sich an seine leere Augenhöhle, sein eigenes Andenken an Scaevolas Hinterhalt. »Ich weiß, Herrin«, knurrte er. »Trotzdem, wir bleiben besser in Bewegung. Keine Aufmerksamkeit erregen.«
Fabiola war entschlossen, sich nicht länger von ihrer Furcht lähmen zu lassen, und folgte ihm. Schließlich war es späterer Vormittag, die sicherste Tageszeit, zu der normale Bürger ihren Geschäften nachgingen. Frauen und Sklaven machten Einkäufe bei den Bäckern, Metzgern und Gemüsehändlern. Weinhändler prahlten und logen über die Güte ihrer Erzeugnisse und boten jedem, der zuhören wollte, einen Probeschluck an. Schmiede schufteten hart über ihrem Amboss, während nebenan Tischler und Töpfer bei einem Becher Acetum lässig Neuigkeiten austauschten. Der Gestank aus den nahen Gerbereien und Walkereien hing in der Luft. Geldwechsler saßen an niedrigen Tischen und starrten wütend auf die Bettler, die ihrerseits gierige Blicke über die ordentlichen Geldstapel gleiten ließen. Rotznasige Straßenjungen rannten durch die Menge, jagten einander und klauten, was sie konnten. Ein Tag in Rom wie jeder andere.
Bis auf die zahlreichen Soldaten von Antonius natürlich, dachte Fabiola. Das alte Gesetz, das Soldaten den Aufenthalt in der Stadt verwehrte, hatte Cäsar selbst außer Kraft gesetzt. Da jetzt andauernd Unruhen drohten, waren mehr von ihnen unterwegs denn je. Dieses Wissen verlieh Fabiola Kraft. Zusammen mit Sextus würden diese Legionäre sicherstellen, dass ihr nichts passieren konnte. Fabiola reckte ihr Kinn vor. Das Lupanar war nicht mehr weit. »Los, komm«, rief sie.
Sextus grinste, ihre Entschlossenheit war er gewohnt.
Wenig später hatten sie eine Straße erreicht, die Fabiola besser kannte als jede andere in Rom. Nahe beim Forum stand hier das Lupanar. Wieder drohten ihre Füße zu versagen, aber diesmal hatte sie die Furcht besser unter Kontrolle. Heute war sie keine verängstigte Dreizehnjährige mehr, hierher gezerrt zum Verkauf. Bald hatte sich Fabiolas innere Unruhe in Aufregung verwandelt. Jetzt überholte sie Sextus sogar.
»Herrin!«
Sie achtete nicht auf seinen Ruf. Die Menge teilte sich ein paar Schritte vor dem Eingang, und Fabiola blieb vor Erstaunen der Mund offen. Nichts hatte sich verändert. Auf jeder Seite des Eingangsbogens ragte ein steinerner Penis in leuchtenden Farben aufrecht aus der Mauer, ein beredtes Zeugnis der Geschäftsidee. Draußen stand ein kahl rasierter Hüne, der eine metallbeschlagene Keule umfasste. »Vettius«, sagte sie, ihre Stimme heiser vor Bewegung.
Der riesige Mann reagierte nicht.
Fabiola schlug die Kapuze zurück und ging näher heran. »Vettius.«
Der Türsteher hob eine Braue, als er seinen Namen hörte, und blickte sich um. »Erkennst du mich nicht?«, fragte sie. »Habe ich mich so verändert?«
»Fabiola?«, stotterte er. »Bist du das?«
Sie nickte, mit Freudentränen in den Augen. Dies war einer der treuesten Freunde, die sie jemals gehabt hatte. Als Brutus sie freigekauft hatte, hatte sie sich verzweifelt dafür eingesetzt, dass er die beiden Türhüter auch noch befreite. Aber Jovina, gerissen wie sie war, hatte alle Angebote abgelehnt. Das Paar war einfach zu wichtig für ihr Geschäft. Sie zurücklassen zu müssen, hatte eine große Lücke in Fabiolas Herz hinterlassen.
Vettius stürzte auf sie zu, um sie zu umarmen, hielt aber abrupt inne. Sextus hatte sich blitzschnell schützend vor Fabiola gestellt. Obwohl der andere ihn weit überragte, zog er sein Schwert und fuhr den Hünen an: »Zurück!«
In einem Herzschlag wandelte sich Vettius’ Miene von überrascht zu ärgerlich, aber bevor er antworten konnte, hatte Fabiola Sextus beschwichtigend eine Hand auf den Arm gelegt. »Er ist ein Freund«, erklärte sie und ignorierte die Verwirrung ihres Leibwächters. Mit einem Stirnrunzeln trat Sextus beiseite und erlaubte Fabiola und Vettius einander anzusehen. »Es ist so lange her«, sagte sie gerührt.
Der hohlwangige Wachmann war sich jetzt seines niederen Standes bewusst und versuchte nicht noch einmal sie zu umarmen, sondern begnügte sich mit einer ungeschickten Verbeugung. »Beim Jupiter, es tut gut, dich zu sehen, Fabiola«, brachte er hervor. »Die Götter müssen meine Gebete erhört haben.«
Fabiola wurde sofort auf die Sorge in seiner Stimme aufmerksam. Plötzlich bekam sie es mit der Angst. »Ist alles in Ordnung mit Benignus?«
»Aber ja!« Ein schiefes Lächeln leuchtete auf in seinem unrasierten Gesicht. »Der alte Narr ist da drin. Schnarcht sich gerade die Seele aus dem Leib, schätze ich. Er hatte Spätschicht gestern Nacht.«
»Mithras sei Dank«, hauchte sie. »Was ist es dann?«
Er schaute sich unsicher um.
Jovina, dachte Fabiola und erinnerte sich an ihre eigene Vorsicht, als sie noch hier gelebt hatte. Zumindest das Gehör der alten Vettel war offenbar noch so scharf wie früher.
Vettius beugte sich tief zu ihrem Ohr hinunter. »Die Moral hier ist seit Monaten schrecklich. Wir haben auch massenhaft Kunden verloren.«
Fabiola war schockiert. Zu ihrer Zeit war das Lupanar jeden Tag gut gelaufen. »Warum?«
Dem Türhüter blieb keine Zeit, zu antworten.
»Vettius!«
Fabiola fühlte, wie der Ekel augenblicklich in ihr hochstieg. Vier Jahre lang hatte diese zänkische Stimme sie aufgerufen: Schon als Mädchen hatte Fabiola sich von potenziellen Kunden begutachten lassen.
»Vettius!« Diesmal klang Jovina gereizt. »Komm herein.« Mit einer entschuldigenden Grimasse an Fabiola gehorchte der Türhüter.
Sie und Sextus blieben dicht hinter ihm.