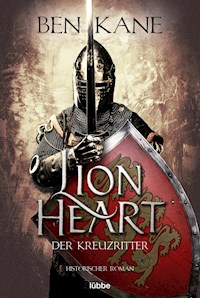9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Forgotten Legion-Chronicles
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
IHR KAMPF FÜR FREIHEIT, EHRE UND VERGELTUNG BEGINNT
Rom, 56 v. Chr. Die Zwillinge Romulus und Fabiola sind Sklaven. Als 13-Jährige werden sie getrennt: Fabiola wird an ein Bordell verkauft, Romulus an eine Gladiatorenschule. Dort freundet der junge Sklave sich mit Brennus an, dem besten Gladiator Roms. Als Romulus beschuldigt wird, einen Patrizier ermordet zu haben, flüchten die beiden Freunde gemeinsam. Sie schließen sich Auxiliartruppen an, die weit nach Osten ziehen. Noch ahnen Romulus und Brennus nicht, was sie am Ende der Reise erwartet: ein Platz in der Vergessenen Legion, dem größten Mysterium der römischen Antike.
Auftakt einer historischen Abenteuerserie von Bestsellerautor Ben Kane
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 897
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
Zitat
VORBEMERKUNG
PROLOG
1. KAPITEL: TARQUINIUS
2. KAPITEL: VELVINNA
3. KAPITEL: OLENUS
4. KAPITEL: BRENNUS
5. KAPITEL: ROMULUS UND FABIOLA
6. KAPITEL: IM LUDUS MAGNUS
7. KAPITEL: DAS LUPANAR
8. KAPITEL: EIN KNAPPES ENTKOMMEN
9. KAPITEL: LENTULUS
10. KAPITEL: BRUTUS
11. KAPITEL: PROPHEZEIUNG
12. KAPITEL: FREUNDSCHAFT
13. KAPITEL: INTRIGE
14. KAPITEL: RUFUS CAELIUS
15. KAPITEL: DIE ARENA
16. KAPITEL: SIEG
17. KAPITEL: DER STREIT
18. KAPITEL: FLUCHT
19. KAPITEL: FABIOLA UND BRUTUS
20. KAPITEL: DIE INVASION
21. KAPITEL: PARTHIEN
22. KAPITEL: POLITIK
23. KAPITEL: ARIAMNES
24. KAPITEL: PUBLIUS UND SURENA
25. KAPITEL: VERRAT
26. KAPITEL: RÜCKZUG
27. KAPITEL: CRASSUS
28. KAPITEL: MANUMISSIO
29. KAPITEL: DER LANGE MARSCH
30. KAPITEL: MARGIANA
NACHWORT
GLOSSAR
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, dem Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debütromans DIEVERGESSENE LEGION ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
Ben Kane
DIEVERGESSENELEGION
Roman
Aus dem Englischen vonDr. Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Ben Kane
First published as »The Forgotten Legion« by Preface
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Werner Bauer, Berlin
Illustration Karte und Vignetten: Markus Weber, Agentur Guter Punkt, München
Titelillustration: © Steve Stone
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer
E-Book-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1480-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für C.V. und P. v. G.,
Am Euphrat verlor Crassus seine Adler, seinen Sohn und seine Soldaten und am Ende sein eigenes Leben. »Parther, warum frohlockt Ihr?«, sprach die Gottheit. »Ihr möget die Standarten zurückgeben, solange es einen Racheengel gibt, der den Tod des Crassus rächen wird.«
– Ovid, »Fasti«
VORBEMERKUNG
INSEINER NATURGESCHICHTE (HISTORIA NATURALIS) beschreibt Plinius der Ältere, wie die römischen Überlebenden der Schlacht bei Carrhae, 53 v. Chr., nach Margiana verschleppt wurden.
Dieses Gebiet im heutigen Turkmenistan liegt etwa 1500 Meilen von jenem Ort entfernt, an dem die Männer gefangen genommen wurden. Die 10 000 Legionäre, die ursprünglich als Grenzwächter eingesetzt waren, sind somit weiter nach Osten vorgedrungen als die meisten Römer in der Antike.
Aber die Geschichte dieser Männer endet nicht hier.
Im Jahre 36 v. Chr. hielt der chinesische Geschichtsschreiber Ban Gu schriftlich fest, dass Soldaten aus der Armee des Jzh-jzh – ein hunnischer Kriegsherr und Herrscher über eine Stadt an der Seidenstraße – in einer »Fischschuppen-Formation« kämpften. Diese Bezeichnung einer taktischen Kriegsformation ist einzigartig in der chinesischen Literatur, und viele Historiker sind sich einig, dass sich diese Formation auf den »Schildwall«, die römische Testudo, bezieht. Zu jener Zeit kämpften nur die Mazedonier und die Römer in einer solchen Formation. Unter diesen Umständen kann man wohl davon ausgehen, dass der griechische Militärdrill über mehr als 100 Jahre in dieser Region Einfluss hatte. Interessanterweise fand die Schlacht jedoch nur siebzehn Jahre nach Carrhae statt, in einem Gebiet, das weniger als fünfhundert Meilen von der Grenze zu Margiana entfernt liegt.
Noch weiter östlich, in China, liegt die heutige Stadt Liqian. Die Herkunft des Namens ist nicht gesichert, doch gehen Wissenschaftler davon aus, dass die erste Siedlung zwischen 79 v. Chr. und 5 n. Chr. gegründet wurde, und zwar unter dem Namen Li-jien, was im alten Chinesisch »Rom« bedeutet. Ungewöhnlich viele Einwohner des heutigen Liqian entsprechen dem kaukasischen Phänotyp – blonde Haare, gebogene Nasen und grüne Augen. Gegenwärtig werden DNA-Analysen unter Leitung einer örtlichen Universität durchgeführt, um festzustellen, ob die Menschen von Liqian tatsächlich Nachfahren jener 10 000 Legionäre sind, die von Carrhae aus in Richtung Osten marschierten und in den Nebeln der Geschichte verschwanden.
Jene »Vergessene Legion«.
PROLOG
ROM, 70 V. CHR.
Es war Hora Undecima, die elfte Stunde; der Sonnenuntergang tauchte die weitläufige Stadt in ein rot glühendes Licht. Zwischen den dicht gedrängten Gebäuden stand die Luft, und nur gelegentlich sorgte eine leichte Brise für etwas Abkühlung in der sommerlichen Hitze. Die Menschen kamen aus ihren Häusern und Wohnungen, beendeten ihr Tagewerk, plauderten vor den Auslagen der Geschäfte oder standen vor den offenen Straßentavernen. Eifrige Kaufleute buhlten um die Aufmerksamkeit der Kunden, während kleine Kinder auf den Türschwellen spielten, gut behütet von ihren wachsamen Müttern. Aus dem Viertel unweit des Forums wehte der rhythmische Gesang aus einem der Tempel herüber.
Die späte Stunde lud ein zu unbeschwerter Geselligkeit, und die Menschen wähnten sich sicher in ihrem gewohnten Umfeld, doch in den Seitengassen und kleinen Innenhöfen wurden die Schatten länger. Das Sonnenlicht verschwand von den hohen Steinsäulen und Götterstatuen, sodass die Straßen und Plätze ein düsteres und wenig einladendes Grau annahmen. Am längsten genossen die sieben Hügel im Herzen Roms den Schein der untergehenden Sonne, bis einmal mehr Dunkelheit in der Hauptstadt des Reiches Einzug hielt.
Trotz der vorgerückten Stunde tummelten sich auf dem Forum Romanum noch immer viele Menschen. Im Schatten der Tempel und des Senats hatten Händler, Wahrsager, Rechtsgelehrte und Schreiberlinge in den Basilicae – den großen überdachten Plätzen – ihre Stände aufgeschlagen und gingen ihrem jeweiligen Gewerbe nach. Zwar war es bereits spät am Tag, doch womöglich wollte noch jemand sein Testament aufsetzen, einen Blick in die Zukunft wagen oder eine Anklage gegen einen Widersacher festhalten. Fahrende Händler drehten dort ihre Runden und boten Fruchtsäfte feil, noch warm von der Hitze des Tages. Politiker, die bis jetzt im Senat tätig gewesen waren, eilten nun ins Freie und blieben nur dann zu einem kurzen Gespräch stehen, wenn sie auf ein bekanntes Gesicht aufmerksam wurden. Sklaven, die den Tag über auf ihre Herren gewartet hatten, sprangen von den Brettspielen auf, die sie mit Steinen flüchtig auf die breiten Marmorstufen geritzt hatten. Rasch trugen sie ihre Herren in Sänften fort und kümmerten sich nicht weiter um ihre sonnenverbrannten Schultern.
Auf den Stufen vor den Tempeln verweilten einige hartnäckige Bettler, in der Hoffnung auf Almosen. Manch einer von ihnen war ein verkrüppelter, aber dennoch stolzer Veteran einer der Legionen, also Teil jener unbesiegbaren Armee, die zum Wohlstand und Ansehen der Republik beigetragen hatte. Diese Veteranen trugen nichts außer den Überresten ihrer zerschlissenen Uniformen – die Kettenhemden wiesen mehr Rost als eiserne Ringe auf, und die bräunlich verfärbten Tuniken wurden nur noch von Flicken zusammengehalten. Warf man diesen Männern eine Kupfermünze zu, so gaben sie ihre martialischen Erlebnisse preis – Geschichten von Blutvergießen, fehlenden Gliedmaßen und treuen Kameraden, die in fremden Ländern begraben lagen.
Und alles für den Ruhm und die Ehre Roms.
Auch auf dem Forum Boarium, wo Tiere verkauft wurden, fanden sich im abnehmenden Licht des Tages viele Bürger ein. Das Vieh, das nicht an den Mann gebracht worden war, brüllte nach einem Tag in glühender Hitze vor Durst. Schafe und Ziegen standen dicht gedrängt, zu Tode verängstigt von dem Geruch frischen Blutes von den Schlachtbänken, die nur wenige Schritte entfernt standen. Die Viehbesitzer, die aus der näheren ländlich geprägten Umgebung kamen, machten sich daran, ihre kleinen Herden für die Nacht auf die Weideflächen außerhalb der Stadtmauern zu treiben. Das Forum Olitorium, auf dem an zahlreichen Ständen gekochte Mahlzeiten sowie Obst und Gemüse angeboten wurden, konnte sich ebenfalls nicht über mangelnde Kundschaft beschweren. Der Duft reifer Melonen, Pfirsiche und Pflaumen konkurrierte mit den Aromen der orientalischen Gewürze, dem gebratenen Fisch und frischem Backwerk, das übrig geblieben war. Da die Händler ihr Obst und Gemüse loswerden wollten, priesen sie ihre Waren jedem an, der die Stände eines Blickes würdigte. Frauen der Plebejer schwatzten nach ihren Einkäufen miteinander oder machten halt an den Schreinen, um ein schnelles Gebet zu sprechen. Sklaven, die losgeschickt worden waren, um auf die Schnelle Zutaten für ein spätes Mahl zu besorgen, fluchten in der zunehmenden Dunkelheit, die jetzt Plätze und Straßen eroberte.
Doch abseits dieser offenen Plätze versuchte jeder, so schnell wie möglich die Sicherheit des eigenen Heims zu erreichen. Kein Römer, der Wert auf Anstand legte, wollte nach Sonnenuntergang auf den Straßen unterwegs sein, vor allem nicht in den düsteren Seitengassen zwischen den Insulae, den engen Wohnblöcken, in denen die meisten Bürger lebten. Denn bei Nacht waren die unbeleuchteten Straßen das Reich der Diebe und Meuchelmörder.
1. KAPITEL:TARQUINIUS
DER NORDEN ITALIAS, 70 V. CHR.
Der Rabe hüpfte auf den Schädel des toten Lamms und starrte Tarquinius an. Noch war der junge Mann mehr als fünfzig Schritte von dem schwarzen Vogel entfernt, der höhnisch krächzte und mit seinem kräftigen Schnabel an den reglosen Augäpfeln des Lamms pickte. Das Lamm war gerade einmal drei Tage alt gewesen, und das bisschen Fleisch, das es auf den Rippen gehabt hatte, hatten längst die Wölfe aus den Bergen gefressen.
Tarquinius bückte sich, hob einen Stein auf und legte ihn in seine Schleuder. Er war von schlanker Erscheinung, hatte blondes Haar und trug eine locker fallende, knielange Tunika, die auf Taillenhöhe von einem Gürtel gehalten wurde; seine Füße steckten in robusten Sandalen.
»Lass den Vogel, er hat das Lamm nicht getötet.« Olenus Aesar rückte den abgenutzten Lederhut auf seinem Kopf zurecht. »Corvus nimmt sich nur das, was übrig blieb.«
»Aber ich mag es nicht, wenn er die Augen herauspickt.« Langsam schwang Tarquinius den ledernen Streifen seiner Schleuder, wohl mit der Absicht, das Geschoss abzufeuern.
Der alte Mann verfiel in Schweigen und schirmte seine Augen gegen die grelle Sonne ab. Eine ganze Weile hatte er schon die Bussarde beobachtet, die hoch oben in den warmen Aufwinden mit breiten Schwingen ihre Kreise zogen.
Tarquinius wartete gespannt ab und hielt dabei das Geschoss bereit. Seitdem der Haruspex, der Wahrsager, ihn vor Jahren zu seinem Schüler erkoren hatte, hatte der junge Etrusker gelernt, auf jedes Wort und jede Geste seines Lehrers und Meisters zu achten.
Olenus zuckte die knochigen Schultern unter dem Umhang aus grob gesponnenem Stoff. »Kein guter Tag, einen heiligen Vogel zu töten«, teilte er seinem Schüler mit.
»Warum nicht?« Mit einem Seufzer ließ er die Schleuder sinken. »Was ist nun wieder?«
»Mach nur, Junge.« Olenus lächelte nachsichtig, was Tarquinius jedes Mal zur Weißglut brachte. »Tu, was du nicht lassen kannst.« Mit ausladender Geste deutete er auf den Vogel. »Du bestimmst deinen Weg selbst.«
»Ich bin kein Junge mehr.« Tarquinius’ Miene verfinsterte sich. Verstimmt ließ er den Stein zu Boden fallen. »Ich bin fünfundzwanzig!«
Kurz bedachte er seinen Lehrer mit einem düsteren Blick, stieß dann einen durchdringenden Pfiff aus und hob den rechten Arm. Ein schwarz-weißer Hund, der in der Nähe gewartet hatte, sprang auf und lief los, wobei er auf der steilen Anhöhe einen weiten Bogen beschrieb und die Schafe und Ziegen im Blick behielt, die das kurze Gras fraßen. Die Tiere spürten die Absicht des Hütehundes und trabten die Anhöhe weiter hinauf.
Unterdessen hatte der Rabe sein Mahl beendet und flog mit kräftigem Flügelschlag davon.
Fast wehmütig schaute Tarquinius dem Vogel nach. »Wieso durfte ich dieses verdammte Vieh nicht töten?«
»Wir stehen hier auf dem Boden, auf dem sich einst der Tempel des Tinia erhob. Er war der mächtigste unserer Götter …« Olenus unterbrach sich, um die Spannung zu erhöhen.
Tarquinius schaute zu Boden und entdeckte einen roten Tonziegel, der aus dem Boden ragte.
»Und die Zahl der Bussarde dort oben beläuft sich auf zwölf.«
Tarquinius richtete den Blick zum Himmel, blinzelte gegen die Sonne und begann zu zählen. »Warum sprecht Ihr immer in Rätseln?«
Olenus klopfte leicht mit seinem Lituus, einem kleinen gebogenen Stab, auf den zerbrochenen Ziegel. »Das ist nicht das erste Mal heute, oder?«
»Ich weiß, dass die Zahl Zwölf für unser Volk heilig ist, aber …«, Tarquinius schaute dem Hund nach, der inzwischen die Herde zusammengetrieben hatte, ganz nach dem Wunsch des jungen Etruskers, »… was hat das mit dem Raben zu tun?«
»Das Lamm war das zwölfte an diesem Morgen.«
Tarquinius überlegte kurz und zählte im Stillen. »Aber von dem Lamm, das in der Senke lag, habe ich Euch noch gar nicht erzählt«, stellte er voller Erstaunen fest.
»Und Corvus gedachte genau an der Stelle zu speisen, an der früher Opferzeremonien abgehalten wurden«, fügte der Wahrsager in rätselhaftem Ton hinzu. »Sollten wir ihn dann nicht besser in Frieden lassen?«
Tarquinius runzelte die Stirn und ärgerte sich, dass ihm die Bussarde nicht selbst aufgefallen waren. Auch den Bezug zu dem geheiligten Boden hatte er übersehen. Mit seinen Gedanken war er bereits zu sehr mit der Jagd auf die Wölfe beschäftigt.
Es war tatsächlich an der Zeit, einige dieser Räuber zu stellen. Rufus Caelius, sein übellauniger Herr, tolerierte diese Ausflüge in die Berge nur, weil er Tarquinius dann später über Olenus und den Zustand der Herden ausfragen konnte. Dem Patrizier würde es gewiss missfallen, dass schon wieder Tiere fehlten. Tarquinius hatte bereits ein ungutes Gefühl, wenn er nur daran dachte, zu den großen Besitztümern seines Herrn am Fuße des Berges zurückzukehren – dem Latifundium.
»Woher wusstet Ihr von dem Lamm in der Senke?«
»Habe ich dir nicht in all den Jahren beigebracht, stets die Augen offen zu halten?« Olenus drehte sich um und schien Dinge zu sehen, die schon lange nicht mehr existierten. »Dies hier bildete einst das Zentrum der mächtigen Stadt Falerii. Tarquin, der Gründer von Etrurien, markierte die heiligen Grenzen der Stadt mit einem bronzenen Pflug im Umkreis von einer Meile. Vor vierhundert Jahren drängten sich an der Stelle, an der wir jetzt stehen, deine Volksgenossen, die alten Etrusker, und kamen ihren Geschäften nach.«
Tarquinius versuchte sich das Treiben vorzustellen, das der Seher ihm schon so oft beschrieben hatte – die herrlichen Gebäude und Tempel, die den Vestalinnen geweiht waren, dazu die breiten, mit Lavagestein gepflasterten Straßen. Der junge Mann malte sich aus, wie die Menge bei Faustkämpfen, Wagenrennen oder Gladiatorenkämpfen jubelte. Die Edlen verliehen den siegreichen Wettkämpfern Kränze und veranstalteten üppige Bankette in großen Marmorhallen.
Die Bilder alter Pracht verblassten, und Tarquinius kehrte in die Wirklichkeit zurück. Alles, was von Falerii – der Perle des alten Etrurien – übrig geblieben war, waren einige umgestürzte Säulen und zahllose Stücke zerbrochener Tonziegel. Erneut vergegenwärtigte er sich das Ausmaß des Verfalls. Die Geschichte seines Volkes war schmerzvoll, das hatte Tarquinius in all den Jahren in Gegenwart des Haruspex begriffen. »Sie haben unsere ganze Art zu leben übernommen, nicht wahr?«, stieß der junge Mann wütend hervor. »Die römische Zivilisation hat die etruskische nachgeahmt.«
»Bis hin zu den Fanfarenklängen, mit denen Zeremonien und Truppenbewegungen in der Schlacht eingeleitet werden«, fügte Olenus trocken hinzu. »Ja, sie haben uns alles gestohlen. Nachdem sie uns vernichtet hatten.«
»Diese Hurensöhne! Was gibt ihnen das Recht dazu?«
»Es war im Himmel vorherbestimmt, Tarquinius. Das weißt du doch.« Olenus sah den jungen Mann forschend an, ehe er den Blick über die Landschaft schweifen ließ, die sich in südöstlicher Richtung erstreckte. Am Fuße des Berges glitzerte ein See und reflektierte das Licht der Sonne. »Hier stehen wir genau im Herzen des alten Etrurien.« Ein Lächeln schlich sich in Olenus’ Züge. »Der See Vadimon dort in der Ferne, und die Grundpfeiler der heiligen Stadt unter unseren Füßen.«
»Wir sind fast die letzten echten Etrusker auf Erden«, sagte Tarquinius verbittert. Nachdem das Volk seiner Vorväter sich an die römische Lebensweise hatte anpassen müssen, hatten nur wenige Familien die Tradition aufrechterhalten, nur innerhalb der eigenen Kultur zu heiraten. Seine Familie hatte sich indes daran orientiert. Und über Generationen hinweg waren die alten Geheimnisse und Rituale von einem Haruspex zum nächsten weitergegeben worden. Olenus entstammte einer altehrwürdigen Familie von Wahrsagern, die ihre Wurzeln in der Blütezeit der etruskischen Kultur hatte.
»Es war unser Schicksal, erobert zu werden«, antwortete Olenus. »Vergiss nicht: Als der Grundstein des Tempels vor vielen Jahrhunderten gelegt wurde …«
»… fand man ein blutendes Haupt im Boden«, vervollständigte der junge Mann den Satz.
»Mein Vorfahr, Calenus Olenus Aesar, behauptete, dieses Zeichen sage voraus, dass das Volk über ganz Italia herrschen würde.«
»Aber er irrte sich! Sieh uns doch nur an!«, rief Tarquinius aus. »Wir sind kaum besser gestellt als Sklaven.« Tatsächlich verfügte so gut wie kein Etrusker über politischen Einfluss. Die meisten waren inzwischen verarmte Bauern oder – wie Tarquinius und dessen Familie – Arbeiter auf den großen Latifundien.
»Calenus war der beste Wahrsager in unserer Geschichte. Wie kein Zweiter war er der Leberschau mächtig!« Olenus gestikulierte mit seinen knochigen Händen. »Schon damals wusste dieser Mann, was die Etrusker in jenen Tagen nicht begreifen konnten oder wollten. Unsere Städte schlossen sich nie zusammen, und als Rom später mächtig genug geworden war, fiel eine Stadt nach der anderen. Obwohl dieser Prozess über hundertfünfzig Jahre dauerte, sollte sich Calenus’ Vorhersage als richtig erweisen.«
»Mit jenem Volk meinte er also diejenigen, die uns bezwangen.«
Olenus nickte.
»Alles Bastarde, diese Römer.« Tarquinius warf einen Stein nach dem Raben, der längst fortgeflogen war.
Er konnte nicht ahnen, dass der Wahrsager insgeheim die Schnelligkeit und Kraft des jungen Mannes bewunderte. Der Stein flog so schnell, er hätte glatt einen Menschen töten können.
»Wahrlich schwer hinzunehmen, mein Junge, selbst für mich«, sagte Olenus und seufzte.
»Wenn ich nur daran denke, wie sie sich über uns erheben.« Der junge Etrusker nahm einen Schluck Wasser aus einem Ziegenbalg, den er dann seinem Lehrer und Mentor reichte. »Wo liegt denn nun die Höhle von hier aus?«
»Es ist nicht mehr weit.« Der Seher tat einen kräftigen Zug. »Aber heute ist nicht der richtige Tag dafür.«
»Ihr habt mich den ganzen Weg bis nach hier oben geschleppt für nichts? Ich dachte, Ihr würdet mir die Leber und das Schwert zeigen!«
»Das war auch meine Absicht«, antwortete Olenus milde. Doch dann wandte er sich ab und ging langsam bergab, wobei er sich auf seinem Lituus abstützte und leise vor sich hin summte. »Aber heute verheißen die Omen nichts Gutes. Es wäre besser, wenn du jetzt zum Latifundium zurückkehren würdest.«
Von dem legendären Kurzschwert, dem Gladius, hatte Tarquinius erstmals vor acht Jahren erfahren – einst gehörte es Tarquinius, dem letzten etruskischen König von Rom. Zur selben Zeit erzählte sein Mentor ihm von der bronzenen Leber, an der die Wahrsager ihre Kunst erlernten. Tarquinius konnte es kaum abwarten, dieses alte metallene Artefakt zu sehen. Sein Lehrer hatte ihm schon oft davon erzählt, aber der junge Mann wusste, dass es nichts brachte, mit Olenus zu streiten. Ein paar Tage länger würde er warten können. Er schnallte sich seine Tasche fester auf den Rücken, ehe er sich vergewisserte, dass alle Schafe und Ziegen die Anhöhen verlassen hatten.
»Ich muss ohnehin mit Pfeil und Bogen hierher zurückkehren«, sagte er. »Um ein paar Tage die Wölfe zu jagen.« Tarquinius gab sich gelassen. »Man darf diesen Bestien nicht das Gefühl geben, sie könnten alles tun …«
Olenus gab ein Schnauben von sich.
Der junge Mann verdrehte enttäuscht die Augen, ahnte er doch, dass er die Leber erst dann zu Gesicht bekommen würde, wenn der Haruspex den Zeitpunkt für gekommen hielt. Daher pfiff Tarquinius den Hund zu sich und folgte Olenus über den schmalen Pfad bergab.
Auf halbem Weg trennte der junge Etrusker sich von dem Alten, der in einer kleinen Berghütte hauste und dort mit dem Hund an einem Feuer schlief. Der Abend war zwar mild gewesen, aber Olenus war die kühle Luft bis auf die Knochen gedrungen.
Der junge Mann folgte dem Verlauf der ausgetretenen Pfade und kam durch große Felder, Olivenhaine und Weingärten, die Caelius’ stattliche Villa umstanden. Als Tarquinius schließlich das Gebäude erreichte, strahlte das dicke Mauerwerk aus Kalkstein die Wärme des Tages ab. Hinter dem eigentlichen Herrenhaus lagen die erbärmlichen Unterkünfte der Sklaven und die schlichten Behausungen der zum Dienst verpflichteten Arbeiter. Auf dem Weg zu diesen Unterkünften begegnete Tarquinius keiner Menschenseele. Die meisten Arbeiter standen bei Sonnenaufgang auf und gingen bei Sonnenuntergang zu Bett, und daher war es nicht schwer, sich im Schutz der Dunkelheit davonzuschleichen.
Am Eingang zum kleinen Innenhof blieb Tarquinius stehen und spähte in die Düsternis. Er sah niemanden.
Doch dann durchbrach eine Stimme die Stille.
»Wo hast du dich den ganzen Tag herumgetrieben?«
»Wer da?«, zischte der junge Mann.
»Du kannst von Glück reden, dass der Vorarbeiter schon schläft. Der hätte dir eine Tracht Prügel verabreicht!«
Tarquinius entspannte sich. »Olenus hat mir viel über unsere Vorfahren beigebracht, Vater. Das ist viel wichtiger, als immer nur auf den Feldern zu schuften.«
»Warum die Mühe?« Die Frage hing in der Luft, als sich ein kleiner, untersetzter Mann aus den Schatten löste, eine Amphore in der Hand. »Wir Etrusker sind erledigt. Dafür hat Sulla, der Schlächter, schon gesorgt.«
Tarquinius stieß einen Seufzer aus. Ein immer wieder vorgebrachtes Argument. Als viele der etruskischen Familien vor nunmehr zwei Jahrzehnten eine Gelegenheit gesehen hatten, etwas mehr Eigenständigkeit zu erlangen, hatten sie sich während des Bürgerkriegs auf Gaius Marius’ Seite geschlagen: ein unberechenbares Spiel, das letzten Endes schiefgelaufen war. Tausende aus dem etruskischen Volk hatten ihr Leben verloren. »Marius unterlag, und so verloren auch wir«, wisperte er. »Aber das bedeutet nicht, dass die alten Wege in Vergessenheit geraten dürfen.«
»Das war die letzte Gelegenheit für uns, den alten Ruhm wiederzuerlangen und aufzusteigen!«
»Du bist betrunken wie immer.«
»Dafür habe ich wenigstens einen Tag lang gearbeitet«, entgegnete sein Vater. »Du aber folgst diesem exzentrischen Narren auf Schritt und Tritt und lauschst seinem Geschwafel und seinen Lügengeschichten!«
Tarquinius senkte die Stimme. »Das sind keine Lügen! Olenus lehrt mich die geheimen Rituale und das alte Wissen unserer Vorfahren. Einer von uns muss ja das Andenken bewahren. Ehe alles in Vergessenheit gerät.«
»Mach, was du willst. Die Republik kannst auch du nicht mehr verhindern.« Sergius schlürfte laut seinen Wein. »Nichts vermag noch die verdammten Legionen aufzuhalten.«
»Geh wieder ins Bett.«
Sein Vater starrte auf den Schrein in einer entlegenen Ecke des Innenhofs. Die Öllampen dort waren erloschen. »Selbst unsere Götter haben uns verlassen«, murmelte er.
Tarquinius konnte den Anblick seines betrunkenen Vaters nicht länger ertragen und drängte ihn zu der kleinen, feuchten Unterkunft der Familie. Der Wein hatte aus dem einst stolzen Krieger einen einsamen, trübsinnigen Trunkenbold gemacht. Noch vor ein paar Jahren hatte sein Vater ihm heimlich beigebracht, wie man mit Waffen umging. Daher konnte Tarquinius inzwischen nicht nur ein Gladius, sondern auch eine etruskische Streitaxt führen.
Unter Seufzern sackte Sergius auf die Strohmatratze, die er mit Fulvia, Tarquinius’ Mutter, teilte. Kaum dass der Mann lag, schnarchte er bereits. Tarquinius legte sich derweil auf ein Lager auf der anderen Seite des Raums und lauschte dem Schnarchen. Er machte sich Sorgen um seinen Vater. Wenn Sergius in diesem Maße weitertrank, würde er nur noch ein paar Jahre zu leben haben.
Es dauerte lange, bis Tarquinius in den Schlaf fand, doch dann träumte er in wilden Bildern.
Er sah, wie Olenus ein Lamm in einer unbekannten Höhle opferte, dem Tier den Bauch aufschlitzte und die Innereien deutete. Im Traum schaute sich Tarquinius in der düsteren Kaverne um, konnte aber nirgends Anzeichen der bronzenen Leber oder des Schwerts entdecken, von denen Olenus schon so oft erzählt hatte.
Die Miene des alten Mannes veränderte sich, während er die Organe des Opfertiers betrachtete. Tarquinius rief ihm etwas zu, doch Olenus schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. Dem alten Mann schien gar nicht bewusst zu sein, dass Tarquinius ebenfalls in der Höhle war. Stattdessen schaute er immer wieder voller Furcht zum Eingang der Kaverne.
Aber der junge Mann vermochte sich nicht zu erklären, was Olenus Angst machte. Der Haruspex hatte unterdessen die dunkelrote Leber auf einen flachen Basaltstein gelegt und studierte sie aufmerksam. Doch immer wieder glitt sein Blick zum Höhleneingang, und seine Furcht ließ allmählich nach. Es dauerte geraume Zeit, bis Olenus schließlich zufrieden nickte und sich an der Wand der Höhle niederließ. Dort wartete er.
Obwohl Tarquinius sah, dass sein Lehrer zufrieden war, überkam ihn eine nagende Furcht, die schließlich unerträglich wurde.
Als er es nicht mehr länger aushielt, rannte er zum Eingang der Höhle.
Von dort aus schaute er den steilen Abhang hinunter und sah, dass Caelius mit zehn Legionären die Anhöhe erklomm. Die Männer verzogen grimmig das Gesicht. Sie hatten ihre Schwerter gezogen. Vor ihnen liefen große Jagdhunde.
»Lauft, Olenus! Lauft!«, schrie Tarquinius.
Erst jetzt schien der Haruspex ihn wahrzunehmen, wandte sich ihm zu und begann zu kichern. »Ich soll fortlaufen? Den Hals würde ich mir dort draußen brechen.«
»Aber Soldaten kommen, um Euch zu töten! Caelius führt sie an.«
In Olenus’ Blick war indes keine Spur von Furcht.
»Ihr müsst fliehen! Jetzt!«
»Meine Zeit ist gekommen, Tarquinius. Ich gehe zu meinen Vorfahren. Du bist der letzte Haruspex.«
»Ich?« Der junge Etrusker erschrak. Trotz all der Dinge, die er von dem alten Mann gelernt hatte, war ihm nie in den Sinn gekommen, dass er zum Nachfolger des Olenus bestimmt sein könnte.
Olenus nickte ernst.
»Die Leber und das Schwert?«
»Du hast beides bereits.«
»Nein, habe ich nicht!« Tarquinius gestikulierte wild.
Erneut schien Olenus seinen Schüler nicht zu hören. Dann stand er auf und ging auf die Gestalten zu, die sich dem Eingang der Höhle näherten.
Tarquinius spürte, dass ihn jemand am Arm packte. Langsam entschwand die Höhle aus seinem Blickfeld, als er aus dem unruhigen Schlaf erwachte. So gern hätte er gewusst, was Olenus widerfahren war, aber er konnte nichts mehr sehen. Erschrocken fuhr Tarquinius aus dem Schlaf hoch. Vor seinem Nachtlager stand seine Mutter und sah ihn voller Sorge an.
»Tarquinius?«
»Es ist nichts«, wiegelte er ab und spürte seinen klopfenden Herzschlag. »Leg dich wieder schlafen, Mutter. Du brauchst Ruhe.«
»Du hast mich mit deinem Geschrei geweckt«, hielt sie ihm anklagend vor. »Vater wäre auch aufgewacht, wenn er nicht wieder betrunken wäre.«
Tarquinius krampfte sich der Magen zusammen. Olenus hatte ihm immer eingeschärft, nichts von den Dingen zu erzählen, die er lernte. »Was habe ich denn gesagt?«, fragte er verunsichert.
»Deine Worte waren schwer zu verstehen. Irgendetwas von Olenus und einer bronzenen Leber. Das letzte dieser Artefakte ging vor Jahren verloren.« Fulvia zog die Stirn kraus. »Hat der alte Mann etwa eine gefunden?«
»Darüber hat er kein Wort verloren«, sagte Tarquinius, um seine Mutter zu beruhigen. »Geh wieder zu Bett. Im Morgengrauen musst du aufstehen.«
Tarquinius stand auf und half seiner Mutter quer durch den Raum zu der Schlafstatt. Sie zuckte zusammen, da ihr gekrümmter Rücken schmerzte, und hatte Schwierigkeiten, sich auf die Strohmatte zu legen. Die vielen Jahre auf den Feldern hatten den Körper seiner Mutter ausgelaugt.
»Mein starker, kluger Arun.« Fulvia benutzte den heiligen Ausdruck für den jüngsten Sohn. »Dir ist gewiss Großes vorherbestimmt. Ich spüre das.«
»Still jetzt.« Tarquinius schaute sich beklommen um. Denn Caelius missfiel es, wenn auf seinem Grund und Boden uralte nichtrömische Ausdrücke benutzt wurden. »Versuch zu schlafen.«
Aber Fulvia ließ sich nicht beirren. »Ich wusste es schon, als ich dein Geburtsmal sah – es war dasselbe, das Tarquin hatte. Daher konnten wir dir keinen anderen Namen als Tarquinius geben.«
Nachdenklich rieb er über das rötliche, dreieckige Mal seitlich am Hals. Er konnte es immer nur dann sehen, wenn er sein Spiegelbild in der ruhigen Oberfläche eines Teichs betrachtete. Doch der Haruspex hatte des Öfteren darauf Bezug genommen.
»Daher wunderte es mich nicht, dass Olenus sich eines Tages für dich interessierte. Fortan lehrte er dich die heiligen Rituale und drängte dich dazu, die Sprachen der fremden Sklaven zu lernen.« Sie war sichtlich stolz auf ihren Sohn. »Immer wieder habe ich deinen Vater darauf hingewiesen. Bis er eines Tages zuhörte. Aber seitdem dein Bruder im Kampf gegen Sulla fiel, geht es Sergius nur noch darum, wann er seinen nächsten Weinkrug bekommt.«
Traurig betrachtete Tarquinius seinen schlafenden Vater. »Einst war er stolz darauf, zu den Kriegern der Rasenna zu gehören.«
»Tief in seinem Innern wird er immer Etrusker sein«, flüsterte seine Mutter.
»Es gibt viele Gründe, warum wir stolz auf unser Volk sein können.« Er gab seiner Mutter einen Kuss auf die Stirn, und Fulvia lächelte und schloss die müden Lider.
Die Kunst der Wahrsagerei ist lebendig, Mutter. Die Etrusker werden nicht in Vergessenheit geraten. Aber diese Worte sprach er nicht laut aus. Denn während Sergius mit niemandem sprach, neigte Fulvia zum Schwatzen. Auf keinen Fall durfte Caelius erfahren, warum Tarquinius regelmäßig die Hütte des alten Olenus aufsuchte.
Kurz darauf legte Tarquinius sich wieder auf sein Strohlager. Als er dann einschlief, deutete sich am östlichen Firmament bereits das blasse Grau des frühen Morgens an.
Während der folgenden Tagen ergab sich keine Gelegenheit, Wölfe zu jagen oder dem alten Olenus einen Besuch abzustatten. Die Ernte stand bevor, und in dieser Zeit hatten die Arbeiter auf den Latifundien alle Hände voll zu tun. Zumal sich das Arbeitspensum der Sklaven und anderen Erntehelfer – zu diesen zählte Tarquinius’ Familie – vervierfacht hatte.
Rufus Caelius war aus Rom zurückgekehrt, um die bedeutende Aufgabe persönlich zu beaufsichtigen. Viele glaubten, er sei nur deshalb in der Hauptstadt gewesen, da er seine schlechte Finanzlage mit frischem Kapital aufzubessern gedachte. Der Rotschopf war ein typischer Vertreter der römischen Oberschicht: gewandt im Krieg, aber miserabel in der Geschäftswelt. Als vor zehn Jahren der Preis für Korn aufgrund zunehmender Importe aus Sizilien und Ägypten gesunken war, hatte Caelius es versäumt, diese Entwicklung in seine Kalkulationen miteinzubeziehen. Während umsichtige Nachbarn fortan auf ihren Latifundien lukrativere Oliven oder Wein anbauten, blieb der stämmige, ehemalige Offizier hartnäckig bei seinem Weizen. Innerhalb von nur zehn Jahren geriet der einst profitable Besitz an den Rand des Ruins.
In relativ kurzer Zeit wurden Tausende kleiner Landbauern in ganz Italia aufgrund von billigen Getreide-Importen in den Bankrott getrieben, darunter auch Tarquinius’ Familie. Die Großgrundbesitzer schlugen Kapital aus dieser Situation und verdoppelten ihre Anbauflächen auf Kosten der kleineren Bauern. Da rasch Arbeitskräfte fehlten, schloss man die Lücke mit Sklaven – die stets den menschlichen Preis der römischen Eroberungen darstellten.
Sergius war Bürger Roms und hatte Glück, dass er und seine Familie Arbeit bei einem Mann wie Caelius fanden, auch wenn sie schlecht bezahlt wurden. Aber zumindest erhielten sie ihren Lohn. Andere hatten nicht so viel Glück, da die Zahl der Sklaven stetig zunahm und kaum noch Arbeit übrig blieb. Die Einwohnerzahl in den Städten schnellte nach oben, weil sich immer mehr mittellose Bauern gezwungen sahen, ihre Höfe zu verlassen. Die Folge war, dass noch mehr Getreide für die Congiaria benötigt wurde, für die Verteilung an die Armen.
Falls es wirklich Caelius’ Ansinnen gewesen war, Geldverleiher in Rom aufzusuchen, so schien er erfolgreich gewesen zu sein. Denn der Patrizier erfreute sich bester Laune und ließ jeden Morgen Arbeitsfeiern im Innenhof veranstalten. Tarquinius wurde für die Ernte eingeteilt, wie jeden Sommer, seit seine Familie vor acht Jahren auf dem Landgut eingetroffen war.
Auf riesigen Feldern wurden Weizen und Hafer geschnitten und zu Garben gebunden. Eine Plackerei, die den Arbeitern von morgens bis abends alles abverlangte. Nach vielen Tagen in der Sonne hatte Tarquinius’ Haut einen tiefen Mahagoni-Ton angenommen. Zur Freude mancher Sklavinnen hellte die Sonne sein Haar weiter auf. Da er es fast bis auf Schulterlänge trug, verdeckte es das Geburtsmal am Hals.
Fulvia war inzwischen zu gebrechlich, um noch auf den Feldern zu arbeiten, und brachte stattdessen den Erntehelfern Speisen und Getränke – gemeinsam mit anderen älteren Frauen. Zuvor hatte Caelius versucht durchzusetzen, dass die Männer den ganzen Tag über ohne Pause schufteten, aber vor zwei Jahren waren zu viele Arbeiter kraftlos und halb ausgetrocknet zusammengebrochen. Einer war sogar gestorben. Daraufhin erkannte der Patrizier, dass eine kurze Pause für die Arbeiter billiger für ihn war als tote Arbeiter.
Am vierten Tag brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Als Fulvia am frühen Nachmittag mit einem Eselkarren kam – beladen mit Wasserkrügen, Brot und Wurzelgemüse –, war sie mehr als willkommen. Sie brachte den Karren im Schatten eines weit ausladenden Baums zum Stehen, sodass die Arbeiter sich um sie scharen konnten.
»Ich habe hier ein Stück Käse«, flüsterte sie Tarquinius zu und klopfte leise auf ein in Tuch gehülltes Paket.
Ihr Sohn zwinkerte ihr zu.
Die Arbeiter trugen nichts als Lendenschurze und Sandalen und benutzten kurzstielige Sensen, die Caelius zur Verfügung stellte. Damit die Sklaven indes nicht fliehen konnten, hatte man ihnen die Füße so mit Ketten zusammengebunden, dass sie nur kleine Schritte machen konnten. Wie bei Großgrundbesitzern üblich, kamen auch Caelius’ Arbeiter aus dem gesamten Mittelmeerraum. Männer aus Judäa, Hispania und Griechenland schwitzten neben Nubiern und Ägyptern. Während der Pausen wechselte man nicht viele Worte, und schon bald waren die Körbe mit Essen leer. Den Spatzen, die erwartungsvoll zu Füßen der Arbeiter auf und ab hüpften, blieben nur wenige Krumen.
Maurus, einer der griechischen Sklaven, kaute wehmütig auf dem letzten Bissen Brot. »Was würde ich alles für ein Stück Fleisch geben! Vielleicht bekommen wir etwas bei der Vinalia Rustica.«
»Dafür ist Caelius viel zu geizig! Außerdem hat er im Augenblick Geldsorgen«, sagte Dexter in schroffem Ton. Er war der Vilicus, der Gutsverwalter, ein zäher ehemaliger Legionär aus dem Süden. »Aber ich wette, dass Olenus genug zu essen hat, wie?«
Die anderen sahen Tarquinius an, wussten sie doch, dass der junge Mann zwischendurch die Hütte des Wahrsagers in den Bergen aufsuchte.
»Der alte Hexer gibt ihm bestimmt Lamm zu essen, möchte ich behaupten!«, rief einer der Arbeiter.
»Ach so, deshalb gehst du also in die Berge?«, fragte Maurus mit scharfem Unterton und starrte Tarquinius nicht gerade freundlich an.
»Nein, ich kann nur manchmal euer Gejammer nicht mehr hören«, erwiderte der junge Etrusker schlagfertig.
Die Männer brachen in lautes Lachen aus, sodass die Vögel aufflogen.
Der Vorarbeiter musterte Tarquinius argwöhnisch, und ein seltsamer Ausdruck schlich sich in seinen Blick. »Mir scheint, du verbringst eine Menge Zeit dort in den Bergen. Was ist es, das dich dorthin zieht?«
»Der will doch nur dieser verdammten Hitze entkommen!«, spöttelte Sulinus, ein untersetzter Sklave.
Die Männer murmelten zustimmend. Es war wirklich unerträglich heiß; der noch nicht geschnittene Weizen schimmerte in der flirrenden Hitze, und die Ähren wiegten sich im leichten Wind.
Tarquinius ging auf die Bemerkung nicht ein, und das Zirpen der Zikaden trat wieder in den Vordergrund.
»Also?« Dexter rieb sich über eine alte Narbe aus dem Krieg.
»Also was?« Tarquinius täuschte Erstaunen vor, aber in Wirklichkeit ließ ihn die plötzliche Neugier des Vorarbeiters aufhorchen.
»Isst dieser verrückte Wahrsager jeden Tag Fleisch?«
»Nur, wenn er ein totes Lamm findet.« Allein bei dem Gedanken lief Tarquinius das Wasser im Mund zusammen. Natürlich hatte er des Öfteren geröstetes Lammfleisch bei Olenus gegessen. »Sonst nicht. Der Herr würde es ohnehin nicht dulden.«
»Der Herr!«, höhnte Dexter. »Caelius hat keinen blassen Schimmer, wie viele Schafe oder Ziegen dort oben grasen. Ich habe oft gehört, wie er sagte, dass ihm pro zehn Schafe acht Lämmer in einem Jahr genügen.«
»Kein guter Ertrag«, fügte Maurus trotzig hinzu.
»Olenus ist der Einzige, der die Herden bis zum Gipfel treibt.« Sulinus machte das Zeichen gegen das Böse. »Ich sage euch, in den alten Städten der Toten gibt es zu viele Geister und wilde Bestien.«
Furcht schlich sich in die Mienen der Männer.
Unweit der Ruinen von Falerii zogen sich ganze Reihen von Gräbern über die Grabfelder: mahnende Überreste der Ahnen. Nur wenige Bewohner der Latifundien wagten sich in die Nähe dieser Gräberfelder, und wenn nur bei Tageslicht. Zudem war der Berg bekannt für schwere Unwetter und umherstreunende Wölfe. Es hieß, die Götter der Etrusker seien dort noch gegenwärtig.
»Deshalb lässt Caelius ihn gewähren.« Tarquinius wollte das Gespräch auf andere Themen lenken, da ihm die Bilder des Albtraums lebendig vor Augen standen. »Dieser Abschnitt ist fast geschafft.« Er deutete auf das Feld. »Bis Sonnenuntergang könnten wir die Garben fertig haben.«
Dexter war überrascht. Normalerweise machten sich die Männer nach der Pause nur unter Androhung von Strafen wieder an die Arbeit. Er nahm einen Schluck Wasser aus dem Krug. »Also, an die Arbeit, Leute. Bringt mich nicht dazu, die hier zu benutzen«, knurrte er und zeigte auf die Peitsche, die in seinem Gürtel steckte.
Die Arbeiter trotteten durch die Stoppeln zu dem Weizen. Einige bedachten Tarquinius mit wütenden Blicken, aber keiner begehrte gegen den eisernen Willen des Aufsehers auf. Oder gegen seine Peitsche. Dexter war angestellt worden, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen, was er mit ausgesprochener Härte tat.
Fulvia wartete, bis die anderen sich entfernt hatten, ehe sie ihrem Sohn heimlich das Stoffbündel zusteckte. Sie lächelte verschwörerisch.
»Hab Dank, Mutter.« Er küsste sie auf die Stirn.
»Die Götter mögen dich segnen«, sagte sie voller Stolz.
»Dexter?« Sowie seine Mutter den Karren gewendet hatte, eilte Tarquinius hinter dem stämmigen Vilius her. »Hier ist schmackhafter Ziegenkäse für dich.«
»Zeig her!« Gierig griff Dexter nach dem Bündel. Dann kostete er von dem Käse und grinste breit. »Meinen Glückwunsch an Fulvia. Woher hat sie diesen Käse?«
»Sie hat ihre Quellen.« Alle wussten, dass die Helfer in den Küchen an Speisen kamen, von denen die Arbeiter nur träumen konnten. »Ich hatte gehofft …«
»Aha, du willst wieder einmal früher Schluss machen, wie?«, rief Dexter. »Das kostet aber mehr als ein Stück Käse, junger Freund. Caelius packt mich bei den Eiern, wenn er spitzkriegt, wie du dich wieder heimlich davonstiehlst.«
»Darum geht es mir nicht.« Tarquinius riskierte eine Tracht Prügel, da er ungefragt antwortete, aber der Ausdruck auf Dexters Gesicht machte ihm Sorgen. »Ich hatte gehofft, du könntest mir sagen, ob der Herr etwas mit Olenus im Sinn hat.«
Dexters Augen verengten sich.
Der Haruspex lebte seit geraumer Zeit am Rande der Ländereien und wurde nur toleriert, weil er sich auf das Hüten von Schafen und Ziegen verstand und ein Leben in Abgeschiedenheit führte. Wie die meisten Römer duldete es auch Caelius nicht, dass alte etruskische Rituale abgehalten wurden. Und Dexter dachte in dieser Hinsicht wie sein Herr.
Tarquinius spürte, dass der Vorarbeiter etwas wusste.
Keiner der beiden sagte ein Wort.
»Bring mir etwas Fleisch, und ich werde drüber nachdenken«, antwortete Dexter dann. »Und jetzt an die Arbeit mit dir.«
Tarquinius tat, wie ihm geheißen. Sobald der Weizen geerntet war, würde er seinem Herrn anbieten, die lästigen Wölfe zu jagen. Da Caelius wusste, dass diese Bestien während des Sommers seine Herden auf den Anhöhen dezimierten, würde er Tarquinius erlauben, sich auf den Weg zu machen … noch vor der Ernte der Oliven und Weintrauben.
Auf diese Weise wäre es Tarquinius ein Leichtes, ein Lamm für Dexter zu töten. Es war ein Spiel mit dem Feuer, denn Tarquinius konnte sich nicht darauf verlassen, dass sich der Vorarbeiter an die Abmachung hielt. Aber der junge Mann sah keine andere Möglichkeit herauszufinden, was Caelius zu tun gedachte. Nach all den Jahren in Olenus’ Nähe waren Tarquinius’ Sinne geschärft. Es war nicht bei dem Traum allein geblieben. Denn jetzt hatte Dexters Bemerkung Tarquinius’ Argwohn erregt. Der junge Mann war sich sicher, dass Caelius etwas mit dem Haruspex im Sinn hatte.
»Und etwas mehr Eifer!« Dexter ließ seine Peitsche knallen. »Du warst es doch vorhin, der nicht schnell genug an die Arbeit kam!«
Tarquinius umfasste ein Bündel Ähren mit der linken Hand und hielt es bereit für die Sichel. Mit fließender Bewegung bückte er sich und schnitt die reifen Ähren dicht überm Boden ab. Dann legte er sie hinter sich ab und wandte sich den nächsten Ähren zu. Neben ihm vollführten die anderen Arbeiter dieselben geschmeidigen Bewegungen und drangen Schritt um Schritt weiter auf dem Getreidefeld vor. Hunderte von Jahren hatten die Etrusker auf diese Weise den Weizen geerntet, und dieses Wissen um die Vorfahren verlieh Tarquinius eine innere Ruhe bei der Arbeit. Immer wieder malte er sich das Leben seiner Ahnen vor der römischen Invasion aus.
2. KAPITEL:VELVINNA
ROM, 70 V. CHR.
Nicht weit vom Forum entfernt streunten sieben junge Patrizier durch eine staubige Seitengasse. Ihre teuren weißen Togen wiesen Weinflecken auf – untrügliche Anzeichen des abendlichen Zechgelages. Mehr als die Hälfte aller Tavernen auf den sieben Hügeln hatten die jungen Männer bereits aufgesucht. Jetzt unterhielten sie sich laut und in überheblichem Ton und scherten sich nicht darum, ob sie andere damit belästigten. In einigem Abstand trotteten Sklaven hinter den Männern her, private Leibwachen, bewaffnet mit Knüppeln und Messern. Einige hielten Fackeln in den Händen.
Unruhe kam in die kleine Gruppe, als der stämmigste der Gefährten ins Stolpern geriet und gegen eine Hauswand fiel. Er fluchte leise, ehe er sich übergab und dabei seine Sandalen nur knapp verfehlte.
»Nun komm schon!« Ein hagerer, sauber rasierter Mann mit leicht gebogener Nase und kurzem Haar krümmte sich vor Lachen. »Wir haben noch einige Stunden vor uns, Kamerad!«
In einem der oberen Stockwerke flog ein Fensterladen krachend auf. »Mach das gefälligst woanders, du Bastard!«, schimpfte jemand.
Der füllige Patrizier starrte hinauf zum Fenster, das in der Dunkelheit nur zu erahnen war, und wischte sich mit dem Ärmel der Toga über den Mund. »Ich gehöre zu den Equites der Republik und kotze, wo ich will! Und jetzt verzieh dich, es sei denn, du willst eine Tracht Prügel!«
Eingeschüchtert von dem gesellschaftlichen Stand des Mannes und den bedrohlich wirkenden Leibwächtern, drückte der Hausbesitzer rasch den Fensterladen zu.
Die angetrunkenen Freunde bogen sich vor Lachen.
Nur jemand Törichtes wagte es, sich mit einer Gruppe aus höheren Kreisen anzulegen. Im Grunde waren alle Bürger Roms gleich, aber tatsächlich wurde die Stadt von einer Elite aus Senatoren oder der berittenen Garde der Equites beherrscht, in gewisser Weise auch von den wohlhabenden Großgrundbesitzern. Diese privilegierten Familien der Aristokratie bildeten eine verschworene Sippschaft, in die man nicht ohne Weiteres aufsteigen konnte, es sei denn, man verfügte über immensen Reichtum. So kam es, dass nur einige wenige die Geschicke der Republik lenkten.
Der stämmige Mann vom Rang eines Eques musste sich erneut übergeben. »Ach, die verdammten Plebejer!«, schimpfte er und legte einem seiner Gefährten eine fleischige Hand auf die Schulter. »Nichts für ungut, alter Freund. Meine Beine wollen im Augenblick nicht richtig mitmachen.«
»Die Plebejer taugen zu nichts«, pflichtete ihm der Gefährte bei. »Außer zur Arbeit und zum Kriegsdienst.«
Die meisten der Gefährten grinsten daraufhin, nur der untersetzte Rotschopf an der Spitze der kleinen Schar wurde allmählich ungeduldig. »Nun kommt endlich! Wir wollen heute noch im Lupanar ankommen, schon vergessen?«
Bei der Erwähnung des berühmtesten Bordells in Rom horchten die jungen Patrizier auf. Die Qualität dieses Etablissements war in ganz Italia bekannt. Selbst die angetrunkensten Gefährten wirkten begeistert.
»Du bist erst zufrieden, wenn du was zum Vögeln hast, wie, Caelius?«, ließ sich der hagere, schmalbrüstige Mann vernehmen, und ein Hauch von Missgunst lag in seiner Stimme.
»Ist das beste Hurenhaus in der Stadt. Du solltest es auch mal probieren.« Caelius rieb sich bereits in freudiger Erwartung die Hände. »Nach einem ordentlichen Zechgelage findest du nirgendwo schönere Weiber, sag ich euch.«
»Ich habe gehört, dass eine neue Lieferung Sklavinnen aus Germanien dort eingetroffen ist.« Der stämmige Patrizier räusperte sich. »Aber zuerst brauche ich noch mehr Wein!«
»Und dann ab ins Hurenhaus!« Caelius klopfte ihm auf die Schulter.
»Wenn ich dann noch einen hochkriege!«
»Und ich erst!« Der Älteste der Gruppe, ein fünfundvierzigjähriger Mann, lachte aus vollem Halse.
»Kommst du? Oder braucht deine Frau dich zu Hause?«
Der hagere Mann lächelte ohne Groll. Diese spitze Bemerkung hatte er schon unzählige Male über sich ergehen lassen. Aber er wusste, dass die Scherzbolde im Grunde nur neidisch auf die edle Abstammung seiner Gemahlin waren. Und es stimmte, er vergötterte sie. Im Augenblick konnte ihn kein noch so anzüglicher Kommentar aus der Ruhe bringen. Die Kameraden bewunderten ihn für seine Selbstbeherrschung, und diese Eigenschaft gedachte er weiterhin zu pflegen.
»Wenn die Frauen dort wirklich so gut aussehen, würde ich vielleicht in Versuchung geraten. Aber ich schätze, dass es sich eher um syphilitische Vetteln handelt!«
Die anderen lachten, immerzu darauf bedacht, dem mächtigen Freund zu gefallen. Denn vor ihnen stand ein Politiker, der die blutigen Säuberungen eines Sulla überlebt hatte, des Nachfolgers der beiden Diktatoren in Rom: Lucius Cornelius Cinna und Gaius Marius. Trotz vieler Drohungen hatte er sich geweigert, sich von seiner Frau scheiden zu lassen – der Tochter eines Feindes von Sulla. Nachdem die Familie des hageren Mannes über Monate versucht hatte, Sulla umzustimmen, widerrief Sulla die Todesstrafe schließlich. Die Vorhersage des Diktators, Roms führende Familien würden letzten Endes durch ihn zu Fall gebracht, war somit substanzlos geworden. Seither gehörte der junge ehrgeizige Patrizier in der Öffentlichkeit zu jenen aufstrebenden Politikern, denen noch eine große Zukunft bevorstand.
»Vergnüg dich doch mit einem Knaben«, gab Caelius scharf zurück. »Und überlass uns die Weiber.«
Der Patrizier rieb sich die leicht gebogene Nase. »Ich dachte, die Knaben wären alle bei dir zu Hause.«
Caelius ballte die Hand zur Faust.
»Hört auf damit, ihr zwei! Wir sind doch Freunde«, sagte Aufidius, und seine sonst immer fröhliche Miene wurde ernst. Der stämmige Mann war bei allen wegen seiner Gutmütigkeit beliebt.
Der hagere Römer, ganz Politiker, zuckte die Schultern. »Ich jedenfalls verspüre nicht den Wunsch, mich weiter zu streiten.«
»Da hörst du es, Caelius. Sollten wir diese unschönen Zwischentöne nicht besser vergessen?«
Der Rotschopf verbiss sich einen Kommentar und nickte schließlich. »Also gut«, murmelte er.
Das Einlenken kam nicht von Herzen, so viel stand fest, aber Aufidius ließ es dabei bewenden. »Wo ist das nächste Wirtshaus?«, wandte er sich an die anderen.
»Gleich auf der anderen Seite des Forums. Hinter dem Tempel des Castor.« Der stämmige Eques übernahm die Führung. »Folgt mir.«
Kurz darauf betraten die Freunde ein Wirtshaus, in dem es nach billigem Wein und Körperausdünstungen roch. Einfache Binsenlichter schwärzten die Steine im Mauerwerk und flackerten in eisernen Halterungen. Das unstete Licht warf lange, tanzende Schatten. Es war eines jener Wirtshäuser mit einer schlichten Gaststube im Erdgeschoss und kleineren Wohnungen in den darüberliegenden Stockwerken. Die Gäste redeten laut durcheinander. An einigen Tischen wurde gewürfelt, an anderen wurden Wetten abgeschlossen, wer beim Kräftemessen Sieger bleiben würde.
Trotz der Leibwächter fühlten sich die meisten der Neuankömmlinge nicht sonderlich wohl in der Umgebung. Dieses gewöhnliche Wirtshaus war vollkommen anders als die gehobenen Tavernen, die die Patrizier sonst aufzusuchen pflegten. Viele Gäste beäugten die Freunde argwöhnisch, denn es war nicht an der Tagesordnung, gemeinsam mit Männern eines privilegierten Standes in einem Raum zu sitzen.
»Was glotzt du so?«, knurrte Caelius.
Die Zecher an einem der Tische schauten rasch weg.
Mit einem bösartigen Grinsen suchte Caelius kurz den Blick seiner Leibwächter. Auf ein kurzes Nicken seines Herrn traten die kräftigen Sklaven hinter die Zecher, die Augenblicke zuvor die Dreistigkeit besessen hatten, einen Mann wie Caelius kritisch zu mustern. Als Caelius erneut nickte, zerrten die Sklaven zwei der Gäste von den Stühlen und stießen sie hinaus ins Freie, während ein anderer Sklave am Eingang Wache hielt. Unschlüssig und verunsichert nahmen die übrigen Gefährten Platz, während die Schreie der Männer von draußen in die Gaststube hallten. Selbst der groß gewachsene Türsteher tat so, als habe er nichts bemerkt.
»So wirst du dir auf Dauer keine Freunde machen, Caelius«, lautete der Kommentar des hageren Mannes.
»Wer braucht schon Abschaum als Freunde?«
»Züchtige die Plebejer nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt.« Sein Blick huschte zur Tür. »Ansonsten lass sie lieber in Ruhe.«
»Du weißt immer alles besser, wie?«, ereiferte sich Caelius.
»Diese Leute sind keine deiner Sklaven.«
»Wir Equites können machen, was uns gefällt.«
»Wenn du möchtest, dass sie dich für einen Sitz im Senat unterstützen, solltest du vielleicht vorher über dein Handeln nachdenken.«
Caelius zog verächtlich die Lippe hoch, blieb dem hageren Mann jedoch eine Antwort schuldig.
»Wir Equites gehören zu den einflussreichsten Männern im mächtigsten Staat des gesamten Erdkreises. Diese Leute wussten das bereits, Caelius. Herrsche mit Respekt über sie, nicht, indem du Angst und Schrecken verbreitest.«
Einige der Kameraden nickten zustimmend, doch der Rotschopf setzte eine finstere Miene auf.
»Gibt es hier in der Nähe kein netteres Lokal?« Aufidius senkte vorsichtshalber die Stimme. »Dieser Ort ist ein Scheißloch.«
Die Männer sahen Caelius an, den selbst ernannten Kenner der Bordelle.
»Ganz recht, da ist selbst Pferdepisse besser, und die Gäste hier sind nicht mein Niveau. Das Lupanar ist gleich um die Ecke«, fuhr Caelius fort und genoss es sichtlich, wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Rasch leerte er seinen Becher. »Heben wir noch einen. Dann können wir es einer der blonden Huren besorgen!«
Die Kameraden nickten, nur nicht der hagere Mann.
»Ich gehe von hier aus nach Hause«, sagte er.
»Was? Du willst uns schon verlassen?« Der stämmige Eques schenkte seinem Freund nach und schob ihm den vollen Becher über den Tisch, sodass der Wein über den Rand schwappte.
»Ich muss mich noch für eine Debatte morgen im Senat vorbereiten.«
»Die genialen Einfälle kommen einem leichter, wenn man eine Nacht die Stuten zugeritten hat!« Aufidius machte eine obszöne Geste und erntete johlendes Lachen von den Kameraden.
»Ich möchte im nächsten Jahr Quästor werden, mein Freund. Eine solche Stellung fällt einem nicht einfach so in den Schoß.« Als Gehilfe der älteren Magistraten hätte der hagere Mann dann Gelegenheit, mehr über die komplizierten Vorgänge im Rechtssystem der Republik zu lernen. Vielleicht wäre es ihm sogar möglich, Einblicke in die öffentlichen Kassen zu erhalten. Alles in allem eine vielversprechende Erfahrung im politischen Alltag, und die Quästur war ein weiterer wichtiger Schritt in der Ämterlaufbahn in Richtung Prätur.
»Bei Jupiters Eiern, nun bleib doch mal locker«, höhnte Caelius, ahnte er doch, dass er ohne einen einflussreichen Sponsoren keine Chance mehr hätte, eine einträgliche Stellung zu ergattern.
»Der Mann hat recht«, räumte Aufidius ein. »Ist man einmal in der Magistratur, sind Nächte wie diese eher selten.«
»Dessen bin ich mir bewusst.«
»Dann bleib noch bei uns!«
»Bedaure, aber mir ist der Pfad der Republik lieber. Ihr könnt meinetwegen die ganze Nacht vögeln.«
»Hör mal, du bist hier nicht der Einzige, der eine wichtige Position innehat.«
»Vergebt mir«, beeilte er sich zu sagen. »Ich wollte niemanden beleidigen.«
»Ach, ja?« Caelius umfasste die Tischkante so fest, dass das Weiße an seinen Knöcheln sichtbar wurde. »Du bist noch lange kein Quästor, Mann. Du gehörst zu den Equites wie wir auch! Aufgeblasener Schwanz!«
Der Blick des hageren Mannes wurde frostig, und die beiden Kontrahenten sahen einander in die Augen.
»Komm schon, Caelius«, mischte sich Aufidius ein. »Je eher eine Hure deinen Zorn mildert, desto besser für alle von uns!«
Der Rotschopf rang sich ein Lächeln ab.
Doch der Blick des hageren Mannes blieb eisig.
»Caelius’ Eier brauchen Zuwendung, mehr als alles andere!«
Die meisten lachten über den derben Scherz.
Die Equites zechten und plauderten noch eine Weile weiter, doch das Gemeinschaftsgefühl war verflogen. Schließlich gerieten die Gespräche vollends ins Stocken, was in dem allgemeinen Lärmpegel der Wirtsstube nur den Männern um Caelius und Aufidius auffiel.
»Also«, brach Aufidius das Schweigen, »wer kommt mit ins Lupanar?« Er leerte seinen Becher und erntete zustimmendes Nicken.
Die Männer folgten Caelius hinaus auf die von Furchen durchzogene Straße. Wenige Schritte vom Eingang entfernt lagen die zwei unvorsichtigen Zecher bewusstlos im Dreck.
Caelius versetzte einem der beiden einen Tritt in die Rippen. »Die werden uns nicht so schnell vergessen«, höhnte er.
Doch der hagere Mann schürzte missbilligend die Lippen.
Die Kameraden waren noch nicht weit gekommen, als Caelius mit einer jungen Frau zusammenstieß, die es offenbar in der Dunkelheit eilig hatte. Die Frau sackte auf die Knie und ließ den Korb fallen, den sie unterm Arm gehabt hatte. Fleisch und Gemüse flogen in hohem Bogen auf die Straße.
Caelius sah auf einen Blick, dass es sich bei der jungen Frau um eine Sklavin handelte – das verrieten ihm die leichten Ketten an den Handgelenken. Voller Wut schlug er der verschreckten Frau mit der flachen Hand ins Gesicht. »Pass gefälligst auf, wo du hinläufst, du elendes Miststück!«
Die Frau schrie auf, fiel in den Dreck und versuchte, ihre schlanken, wohlgeformten Beine zu bedecken, da der Saum ihres schlichten Hemds verrutscht war.
»Sie hat es doch nicht böse gemeint, Caelius«, mischte sich Aufidius ein und half der jungen Frau auf die Beine.
Sie war etwa siebzehn Jahre alt und mit ihrem dunklen Haar und den blauen Augen ausgesprochen hübsch. In Gegenwart der angesehenen Männer war sie verunsichert und senkte demütig den Blick.
»Es tut mir leid, mein Herr«, murmelte sie schließlich und wandte sich zum Gehen.
Doch Caelius wollte es nicht auf sich beruhen lassen, hatte er doch längst bemerkt, wie attraktiv das Mädchen war. Mit einem Schritt war er bei ihr, drehte sie zu sich und riss an ihrem leichten wollenen Hemd, sodass ihre kleinen, festen Brüste zum Vorschein kamen. Das Mädchen schrie vor Angst und versuchte sich züchtig zu bedecken, aber Caelius’ Blut war längst in Wallung geraten. Unbarmherzig riss er weiter an ihrem Hemd, bis die junge Frau schließlich mit bloßen Schultern dastand und sich nur noch mit ihren Händen bedecken konnte.
Sie wich einen Schritt zurück, sah sich aber von Caelius’ Leibwachen in die Enge getrieben, die auf Befehle ihres Herrn warteten. Der jungen Frau wurde schlagartig bewusst, dass niemand einer einsamen Sklavin zu Hilfe eilen würde. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelten sich Roms Straßen in das Territorium der Gesetzlosigkeit. Nur unvorsichtige Bürger wagten sich im Dunkeln ohne Leibwachen auf die Straßen. Und wenn doch einzelne Gestalten durch die Gassen huschten, so handelte es sich um Sklaven, die einen Botengang zu erledigen hatten … wie im Fall dieser jungen Frau.
»Ich bitte Euch, Herr.« Die Stimme des Mädchens war brüchig. »Es war nicht meine Absicht …«
Caelius packte sie grob beim Arm. »Glaub mir, es dauert nicht lange.«
Einige aus der Gruppe murmelten zustimmend. Nur der hagere Mann und Aufidius schwiegen unschlüssig.
Das Mädchen zitterte vor Angst und warf den anderen Männern stumme, flehende Blicke zu.
»Lass sie gehen.« Der hagere Mann trat entschlossen vor.
»Was hast du da eben gesagt?«, jaulte Caelius ungläubig.
»Du hast mich schon verstanden.«
»Im Hades sollst du verrotten!« Bebend vor Zorn kam Caelius einen Schritt auf seinen Kontrahenten zu. »Sie ist nur eine verdammte Sklavin!«
Der hagere Mann zog einen Dolch mit ungewöhnlich langer Klinge aus den Falten seiner Toga hervor. »Langsam reicht es mir mit dir.« Lässig umfasste er die Spitze des Dolches mit Daumen und Zeigefinger. »Tu, was ich sage. Lass sie gehen!«
Caelius’ Blick huschte zu den Leibwachen.
Doch der hagere Mann kam ihm zuvor und holte drohend zum Wurf aus. »Du hast diesen Dolch in der Brust, ehe deine Leute auch nur einen Schritt gemacht haben.«
»Beruhige dich, mein Freund!«, versuchte Aufidius die Situation zu entschärfen und sah besorgt aus. »Was bringt es, wenn wir uns gegenseitig Schaden zufügen?«
Der Hagere lächelte. »Das hängt jetzt wohl ganz von Caelius ab.«
Die übrigen Männer schauten tatenlos zu. Der Streit zwischen Caelius und dem Patrizier schwelte schon seit Monaten und hatte einen kritischen Punkt erreicht. Keiner der Anwesenden wagte es, sich dem einflussreichen und ehrgeizigen Politiker in den Weg zu stellen.
Caelius’ Miene verfinsterte sich, doch schließlich gab er das Mädchen frei.
Der hagere Mann gab ihr mit einer kleinen Geste zu verstehen, zu ihm zu kommen. »Genießt das Lupanar«, sagte er und deutete gebieterisch die Straße hinunter.
»Erst passt es ihm nicht, dass zwei unwürdige Plebejer Prügel beziehen«, murrte Caelius. »Und jetzt hindert er einen Eques daran, eine Sklavin zu nehmen? Der Mann ist doch vollkommen verweichlicht oder dem Irrsinn verfallen«, setzte er halblaut hinzu.
»Weder noch.« Aufidius schüttelte den Kopf. »Dafür ist er viel zu klug.«
»Was ist er also dann?«
Aufidius ignorierte diese Frage und schlug dem aufgebrachten Rotschopf stattdessen überschwänglich auf die Schulter. »Zeit für mehr Wein, was, Caelius?«
Caelius ließ Aufidius gewähren und hatte nichts dagegen, in Richtung Lupanar geführt zu werden. Die anderen folgten hinterdrein und waren froh, dass der Streit nicht eskaliert war.
Zum Glück war es zu keinem Blutvergießen gekommen. Aber das konnte sich jederzeit ändern.
»Wir sehen uns morgen im Senat«, rief der hagere Mann den anderen nach.
Schweigend stand er da und hielt die Sklavin am Arm fest, bis die Gruppe weit genug entfernt war. Zwei Leibwachen warteten in den Schatten der Häuser. Das Mädchen schaute nervös zu ihm auf, in der Hoffnung, ihren Weg fortsetzen zu können, aber als der Patrizier sie dann durchdringend ansah, loderte Verlangen in seinem Blick. Er umfasste ihren Arm fester und zog die junge Frau in eine Seitengasse.
Sie wimmerte vor Angst. Ihr war klar, was ihr widerfahren würde. Jetzt war ihr vermeintlicher Retter derjenige, der ihr Gewalt antun würde.
»Still, oder ich tu dir weh!«
Ein Stück weit die Straße hinunter musste sich der stämmige Eques erneut übergeben und sah, wie der Hagere mit der Sklavin im Dunkel der Gasse verschwand. »Hat er wahrscheinlich so geplant, damit er sie für sich hat«, grummelte er. »Ich sag euch, dieser Mann wird sich nicht mit dem Amt eines Quästors zufriedengeben.«
»Ja, leider, er wird es noch bis zum Konsul bringen«, beklagte sich Caelius. Dem Rotschopf war entgangen, dass der hagere Patrizier die junge Frau in eine Seitengasse gezerrt hatte.
Seit Jahrhunderten wurde Rom von zwei jährlich gewählten Konsuln regiert, die von Militärtribunen, Magistraten und dem Senat unterstützt wurden. Ein System, das sich als tragfähig erwiesen hatte, vorausgesetzt, alle Beteiligten hielten sich an das geltende Recht. Historisch betrachtet, waren die beiden Konsuln – die tatsächlichen Herrscher Roms – jeweils für die Dauer eines Jahres im Amt. Mit dieser im Gesetz verankerten Regelung sollte verhindert werden, dass ein Konsul seine Macht missbrauchte und allein herrschte. Doch seitdem sich dreißig Jahre zuvor ein Bürgerkrieg an der Frage der Verleihung des Stimmrechts entzündet hatte, befand sich Roms Demokratie im Niedergang, und innerhalb einer Generation waren die wichtigen Ämter von einer Hand zur anderen gegangen. Ehrgeizige Patrizier wie Marius, Cinna und Sulla hatten diesen Trend begründet und einen geschwächten Senat gezwungen, die Kompetenzen eines Konsuls zu erweitern. Von da an hatten nur einige begünstigte Patrizier Zugang zu diesem Amt gefunden, über das die wohlhabendsten und einflussreichsten Familien in Italia mit Argusaugen wachten. Nichtsdestoweniger war es für machthungrige Männer ein Anreiz, Konsul zu werden.
»Eines Tages wird dieser Schwanz einen Fehler machen«, knurrte Caelius. »Jeder macht Fehler.« Der Rotschopf kochte immer noch vor Zorn, merkte jedoch, dass er im Augenblick zu betrunken war, um seinen Erzrivalen auszustechen. Daher zog er seine Gefährten mit sich und hielt mit unsicheren Schritten auf das Lupanar zu.
Derweil verschwand der hagere Mann mit der jungen Frau tiefer in den Schatten der Seitengasse, in der die Bewohner der umliegenden Gebäude ihren Unrat und zerbrochene Tongefäße hinterlassen hatten. Als der Mann eine geeignete Stelle gefunden hatte, riss er der jungen Sklavin das Hemd ganz vom Leib und drückte sie zu Boden. Sie stürzte unglücklich und konnte nicht verhindern, dass der Mann einen Blick auf den weichen Flaum ihrer Scham erhaschte. Rasch drückte der Patrizier ihr die Schenkel auseinander, raffte seine Toga und kniete sich hin. Das Mädchen schrie vor Angst, doch der junge Römer kannte keine Gnade, drang mit einem Stoß in sie ein und stöhnte vor Lust.
Tief und rhythmisch trieb der hagere Mann sich zwischen ihre Schenkel. Seine Ehefrau fühlte sich schon seit geraumer Zeit unwohl, und daher waren seine körperlichen Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Seit Monaten hatte er keinen Beischlaf mehr gehabt, nicht zuletzt deshalb, weil er voller Ehrgeiz versucht hatte, seine politische Karriere voranzutreiben.
Die junge Frau sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an.
»Wenn du mich noch einmal so anstierst, schneide ich dir die Kehle durch!«
Hastig kniff sie die Augen zusammen und schob sich eine Hand in den Mund, um ihr Wimmern zu dämpfen. Tränen lösten sich aus ihren Wimpern, während sie sich bewusst machte, dass sie das Schicksal vieler Sklavinnen teilte, die ihren Herren ausgeliefert waren.
Mit lautem, lustvollem Stöhnen erreichte der Mann seinen Höhepunkt und stieß ein letztes Mal in die wehrlose Frau, die unter ihm lag.
Sie öffnete die Augen nicht, als er sich erhob und die Toga richtete.
Mit einem zufriedenen Lächeln betrachtete der hagere Mann sein Opfer. Selbst mit der Schwellung im Gesicht und den tränenüberströmten Wangen war dieses Mädchen eine wahre Schönheit. Jetzt, da er seine Lust gestillt hatte, konnte er getrost nach Hause zurückkehren, denn er musste noch an seiner Rede über die öffentlichen Ausgaben feilen. Falls er mit seiner Rhetorik Anklang im Senat fand, konnte er sich der Hoffnung hingeben, in das Amt des Quästors gewählt zu werden. Da er das Priesteramt des Jupiter bekleidet und seinen Militärdienst abgeleistet hatte, war er fortan fest entschlossen, seine Karriere innerhalb der Ämterlaufbahn – des Cursus Honorum – mit allen Mitteln voranzutreiben.
Sein Vater wäre sicher stolz gewesen, wenn er gesehen hätte, wie weit es sein einziger Sohn inzwischen gebracht hatte. Obwohl er in den Stand der Patrizier hineingeboren worden war, war seine Familie nie wohlhabend gewesen. Im Senat hatte sich sein Vater mit eisernem Willen bis zum Prätor hochgearbeitet, in jenes Amt, das eine Stufe unterhalb des Konsuls lag. Kurz darauf war sein Vater jedoch gestorben.