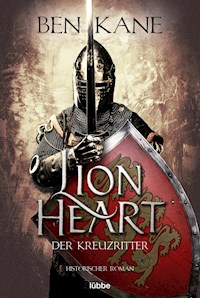9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Forgotten Legion-Chronicles
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Vergessene Legion marschiert weiter ...
Parthia, 53 vor Christus. Monate sind seit der verheerenden Niederlage von Carrhae vergangen. Die Legionäre, die die Schlacht überlebt haben - die Vergessene Legion -, werden von den siegreichen Parthern gezwungen, die Grenze ihres Landes zu bewachen. Unter ihnen befinden sich auch Romulus, Brennus und Tarquinius. Dort, am Rande der bekannten Welt, droht den Gefährten immer wieder der Tod durch Angriffe der grausamen Skythen. Und noch jemand anderes hat es auf sie abgesehen: ein Mann aus den eigenen Reihen, ein Feind, der im Verborgenen lauert und alles daransetzt, die drei Freunde zu töten.
Der zweite Teil der Bestseller-Trilogie aus England
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 863
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
1. KAPITEL: DAS MITHRÄUM
2. KAPITEL: SCAEVOLA
3. KAPITEL: VAHRAM
4. KAPITEL: FABIOLA UND SECUNDUS
5. KAPITEL: ENTDECKUNG
6. KAPITEL: CHAOS BREITET SICH AUS
7. KAPITEL: HINTERHALT
8. KAPITEL: VERZWEIFLUNG
9. KAPITEL: VORZEICHEN
10. KAPITEL: NIEDERLAGE
11. KAPITEL: DER KRIEGSGOTT
12. KAPITEL: PACORUS
13. KAPITEL: VERRAT
14. KAPITEL: EIN NEUER VERBÜNDETER
15. KAPITEL: EINE NEUE BEDROHUNG
16. KAPITEL: DER WEG NACH GALLIEN
17. KAPITEL: DIE LETZTE SCHLACHT
18. KAPITEL: POMPEIUS’ GENERAL
19. KAPITEL: ALESIA
20. KAPITEL: BARBARIKON
21. KAPITEL: WIEDER VEREINT
22. KAPITEL: NEUIGKEITEN
23. KAPITEL: DER RUBIKON
24. KAPITEL: DAS ERYTHRÄISCHE MEER
25. KAPITEL: PHARSALUS
26. KAPITEL: DER BESTIARIUS
27. KAPITEL: ALEXANDRIA
ANMERKUNGEN DES AUTORS
GLOSSAR
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, dem Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debütromans DIE VERGESSENE LEGION ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
Ben Kane
DERSILBERNEADLER
Roman
Aus dem Englischen vonDr. Holger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2009 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »The Silver Eagle«
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Werner Bauer, BerlinIllustration Karte und Vignetten:Markus Weber, Agentur Guter Punkt, MünchenTitelillustration: © Arcangel/Nik Keevil;© shutterstock/Galyna AndrushkoUmschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
eBook-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2968-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine wundervolle Frau Sair.Ohne deine Liebe, deinen Halt und dein Verständniswäre die Welt für mich sehr viel komplizierter.
1. KAPITEL:DAS MITHRÄUM
IM OSTENVON MARGIANA, WINTER 53/52 V. CHR.
Etwa eine Meile vom Lager entfernt machten die Parther schließlich halt. Als das Knirschen der Sandalen und Stiefel auf dem gefrorenen Boden verklungen war, senkte sich tiefes Schweigen herab. Das gelegentliche leise Husten und das Klirren der Kettenpanzer verloren sich in der frostigen Luft. Die Abenddämmerung kündigte sich an, und noch hatte Romulus Gelegenheit, das Marschziel näher in Augenschein zu nehmen: einen eher unscheinbaren Steilhang aus verwittertem, grau-braunem Gestein, der das Ende einer niedrigen Hügelkette bildete. Der junge, kräftige Soldat spähte in die beginnende Dämmerung und versuchte zu ergründen, was die Krieger veranlasst haben mochte, diesen Ort aufzusuchen. Nirgends waren Behausungen oder sonstiges von Menschenhand Geschaffenes zu erkennen, und der gewundene Pfad, dem sie bislang gefolgt waren, schien unmittelbar am Fuße des Steilhangs zu enden. Romulus zog erstaunt eine Braue hoch und wandte sich Brennus zu, seinem väterlichen Freund. »Was, in Jupiters Namen, machen wir hier eigentlich?«
»Tarquinius weiß etwas«, erwiderte der Gallier grummelnd und zog sich den dicken Militärumhang enger um die breiten Schultern. »Wie immer.«
»Aber er sagt nicht, was!« Romulus blies auf seine Fäuste, da seine Finger sich schon fast taub anfühlten; seine edel geschwungene Nase spürte er bereits nicht mehr.
»Nun, irgendwann wird er damit herausrücken«, antwortete Brennus mit leisem Lachen.
Romulus hielt sich mit weiterem Protest zurück; mit ungebremstem Eifer würde er nichts bewirken. Geduld, dachte er bei sich. Beide Männer trugen Wämser aus grobem Stoff, darüber römische Kettenhemden. Die eng geknüpften Eisenringe boten zwar Schutz gegen Klingen, warm wurde es einem darunter aber nicht. Wollene Umhänge, Halstücher und Futterale aus Filz unterhalb der bronzenen Helme halfen ein wenig gegen die Kälte, aber die wadenlangen rostroten Hosen und schweren, mit Eisennägeln beschlagenen Sandalen – die Caligae – ließen zu viel Haut frei, die bei dieser Kälte sehr schnell wie abgestorben wirkte.
»Geh und frag ihn«, drängte Brennus den jungen Freund und grinste. »Bevor uns die Eier abfrieren.«
Romulus musste lächeln.
Beide hatten von dem etruskischen Haruspex eine Erklärung verlangt, als er kurz zuvor in ihrer schlecht gelüfteten Unterkunft aufgetaucht war. Selten gab Tarquinius etwas preis, aber er hatte erwähnt, ihr Kommandant Pacorus sei mit einer speziellen Bitte an ihn herangetreten. Mit etwas Glück, so der Etrusker, fänden sie eine Möglichkeit, Margiana verlassen zu können. Romulus und Brennus wollten ihren Freund nicht allein gehen lassen und horchten auf, da es offenbar endlich Neuigkeiten gab.
Die zurückliegenden Monate hatten für eine willkommene Unterbrechung der ständigen Kämpfe der letzten beiden Jahre gesorgt. Allmählich jedoch war das Leben in dem römisch geprägten Lager zu einer lähmenden Routine geworden. Körperliche Ertüchtigungen folgten auf den Wachdienst; die Reparatur der Ausrüstung und Waffen ersetzte den Drill auf dem Exerzierplatz. Gelegentlich schlossen sich die Freunde Patrouillen an, aber auch das bot wenig Aufregendes. Selbst die Steppenkrieger, die immer wieder plündernd in Margiana einfielen, führten während des Winters keine Beutezüge durch. Daher erschien Romulus und Brennus das Angebot ihres Freundes wie ein Geschenk des Himmels.
Romulus hingegen verfolgte an diesem Abend eigene Absichten. Es ging ihm nicht allein um den Kitzel des Abenteuers; er war vielmehr darauf aus, irgendetwas über Rom in Erfahrung zu bringen, und sei es auch nur die kleinste Andeutung. Die Stadt, in der er geboren war, lag auf der anderen Seite des Erdkreises, und zwischen Margiana und Italia lagen weit mehr als tausend Meilen unwirtliche Gegend und feindselige Völker. Wiederholt fragte er sich, ob er eines Tages nach Rom zurückkehren würde. Wie fast alle Kameraden träumte auch Romulus Tag und Nacht von der Heimat. Hier, am Ende der Welt, gab es nichts, was einem Halt geben konnte, und daher kam ihm die unerwartete Expedition wie ein Hoffnungsschimmer vor.
»Ich warte lieber hier«, antwortete Romulus schließlich. »Immerhin haben wir uns ja freiwillig gemeldet.« Ernüchtert stampfte er abwechselnd mit den Füßen auf. Der ovale Schild – das Scutum –, den er sich mit einem Lederriemen über die Schulter gebunden hatte, hüpfte auf und ab. »Du weißt ja, in was für einer Stimmung Pacorus ist. Wahrscheinlich schneidet er mir die Eier ab, wenn ich ihn frage. Da lasse ich sie mir lieber abfrieren.«
Brennus ließ ein raues Lachen folgen.
Pacorus, ihr stämmiger, dunkelhäutiger Kommandant, wartete an der Spitze der Truppe. Er trug ein reich verziertes Wams, eine anständige Hose und kurze Stiefel. Seinen Kopf zierte ein konisch zulaufender parthischer Hut, und um die Schultern hatte er sich einen langen, warmen Mantel aus Bärenfell geworfen. Da Pacorus den Mantel offen trug, war sein goldener Gürtel zu sehen, in dem zwei Krummdolche steckten und ein Schwert mit juwelenbesetztem Griff herabhing. Pacorus war ein tapferer, aber unbarmherziger Krieger und führte die Vergessene Legion – jenen Überrest der einst stolzen und riesigen Armee, die im Jahr zuvor vom parthischen Feldherrn Surena besiegt worden war. Seither gehörten Tarquinius, Brennus und Romulus zu den Soldaten unter parthischem Kommando.
Und Romulus war immer noch kein freier Mann, sondern ein Gefangener der Parther.
Was für eine Ironie des Schicksals, dachte er, dass er in seinem bisherigen Leben immer wieder einem anderen Herrn hatte dienen müssen. Seit seiner Geburt hatte er Gemellus gehört, jenem brutalen Kaufmann, der einst über Romulus’ Familie bestimmte – die aus seiner Mutter Velvinna und seiner Zwillingsschwester Fabiola bestand. Als Gemellus’ Geschäfte schlechter liefen, wurde Romulus im Alter von dreizehn Jahren an Memor verkauft, an den Lanista des Ludus Magnus, der größten Gladiatorenschule in Rom. Memor legte zwar nicht die tägliche Grausamkeit eines Gemellus an den Tag, aber als Lanista ging es ihm in erster Linie darum, Sklaven und verurteilte Verbrecher zum Kämpfen auszubilden: zu Gladiatoren, die eines Tages in der Arena den Tod fanden. Ein Menschenleben bedeutete Memor nichts. Bei diesen unliebsamen Erinnerungen spie Romulus aus. Um im Ludus zu überleben, hatte er einen anderen Menschen töten müssen. Mehr als einmal. Töten oder getötet werden. So lautete seither Brennus’ Maxime, die erneut in Romulus’ Gedanken nachhallte.
Rasch überprüfte Romulus, ob sein zweischneidiges Schwert, sein Gladius, locker in der Scheide saß und der Dolch an der anderen Seite des Gürtels griffbereit war. Diese Handgriffe waren ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen. Er grinste, als er sah, dass Brennus es ihm gleichtat. Wie alle römischen Fußsoldaten führten sie zwei Wurfspieße mit sich, die Pila genannt wurden. Die Krieger, die Pacorus für die Expedition ausgewählt hatte – seine Elitekämpfer –, unterschieden sich auf den ersten Blick von den römisch geprägten Soldaten. Sie waren schlichter gekleidet als ihr Anführer und trugen wollene Umhänge ohne Pelzbesatz. Ihre Bewaffnung bestand aus langen Messern und einem schmalen Köcher, der ihnen rechts über die Hüfte hing. Der Köcher fasste den Hornbogen der Parther und einige Pfeile. Parthische Krieger kämpften mit verschiedenen Waffen, aber bekannt und gefürchtet waren sie in erster Linie für ihren Umgang mit Pfeil und Bogen. Romulus durfte sich glücklich schätzen, nie einem parthischen Bogenschützen in der Arena begegnet zu sein. In der Zeitspanne, in der ein Mann hundert Schritte zurücklegte, feuerte ein geübter Schütze bis zu sechs Pfeile ab. Und nahezu jeder Schuss war ein Treffer.
Aber in der Rückschau hatte Romulus in der Gladiatorenschule Glück im Unglück gehabt, denn dort war er zum ersten Mal Brennus begegnet. Ohne die Hilfe des Galliers wäre er damals vermutlich an der harten Ausbildung zugrunde gegangen. Dafür war Romulus seinem Freund zutiefst dankbar. Nur einmal in zwei langen Jahren hatte Romulus eine lebensgefährliche Verletzung davongetragen – nach einem tödlichen Zweikampf mit einem Rivalen. Als dann später nach einem nächtlichen Ausflug in die Stadt ein Streit auf offener Straße eskaliert war, hatten die beiden Freunde Rom Hals über Kopf verlassen müssen. Nachdem sie sich als Söldner in die Listen eingetragen hatten, war Crassus ihr neuer Herr geworden – ein steinreicher Politiker und Feldherr und damals Mitglied des Triumvirats in Rom. Crassus, von Ehrgeiz und Machthunger zerfressen, strebte nach Anerkennung und versprach sich von dem Feldzug gegen die Parther einen glänzenden militärischen Erfolg, der ihm ewigen Ruhm hätte einbringen sollen. Seine Rivalen, Julius Cäsar und Gnaeus Pompeius Magnus, hatten es ihm im Laufe der Jahre vorgemacht. Was für ein arroganter Narr Crassus doch gewesen war, dachte Romulus. Wäre er so wie Cäsar gewesen, wären alle Soldaten wieder nach Hause zurückgekehrt. Doch anstatt Ruhm zu ernten, führte Crassus 35000 Soldaten leichtsinnig in die Schlacht gegen die Parther, die bei Carrhae in einer blutigen, schändlichen Niederlage endete. Die Überlebenden – etwa ein Drittel der ursprünglichen Truppenstärke – gerieten in parthische Gefangenschaft. Die Parther verhängten drakonische Strafen, sobald sich ein römischer Soldat den Befehlen widersetzte. Nach Crassus’ öffentlicher Hinrichtung hatten die Parther die Überlebenden vor die Wahl gestellt: Tod durch geschmolzenes Gold, das einem bei lebendigem Leib in den Mund gegossen wurde, Tod am Kreuz oder Kriegsdienst im unruhigen Grenzgebiet im Osten des Partherreichs. Erwartungsgemäß hatten sich Romulus und all die anderen für Letzteres entschieden.
Romulus seufzte, denn inzwischen war er sich nicht mehr so sicher, ob die Entscheidung richtig gewesen war. Wie es aussah, waren die ehemaligen Legionäre und Söldner dazu verdammt, ihr ganzes Leben gegen die Feinde ihrer neuen Herren zu kämpfen: gegen wilde Steppenkrieger aus Sogdia, Baktrien und Scythia.
Nun stand Romulus vor dem Felshang, um herauszufinden, ob dieses elende Schicksal abgewendet werden konnte.
Mit dem akribischen Blick seiner dunklen Augen suchte Tarquinius den felsigen Steilhang ab.
Keinerlei Hinweis.
Rein äußerlich unterschied Tarquinius sich von seinen Kameraden, denn er hatte lange, blonde Locken, die er mit einem Stoffband zusammenhielt. Er hatte ein längliches, schmales Gesicht, hervorstehende Wangenknochen, und an seinem rechten Ohr funkelte ein goldener Ring. Der Etrusker trug einen ledernen Brustpanzer, der mit kleinen, bronzenen Ringen überzogen war; ein kurzer, mit Leder besetzter Schurz – der Ausstattung eines Centurio nachempfunden – rundete sein Erscheinungsbild ab. Auf dem Rücken trug er seine kleine, abgenutzte Tasche, über die linke Schulter hatte er sich eine doppelschneidige Axt gehängt. Im Gegensatz zu seinen Kameraden hatte der Haruspex einen Umhang verschmäht. Zusätzliche Kleidungsstücke dämpften seine Sinneswahrnehmung … und im Augenblick durfte Tarquinius nichts hinderlich sein, gar nichts.
»Also?«, verlangte Pacorus zu wissen. »Kannst du den Eingang erkennen?«
Kleinere Falten gruben sich in Tarquinius’ Stirn, doch er blieb dem Parther eine Antwort schuldig. Die langen Lehrjahre bei Olenus, seinem früheren Mentor, hatten ihm vor Augen geführt, wie wichtig Geduld war. Auf andere wirkte dies jedoch des Öfteren als Selbstgefälligkeit.
Der Blick des Kommandanten huschte nach rechts.
Doch Tarquinius schaute absichtlich in die entgegengesetzte Richtung. Mithras, du Großer. Zeig mir dein Heiligtum.
Pacorus war mit seiner Geduld am Ende. »Er ist nicht mal dreißig Schritte entfernt«, neckte er den Wahrsager.
Einige der parthischen Krieger lachten.
Fast beiläufig schaute Tarquinius in die Richtung, in die Pacorus’ Blick kurz zuvor geglitten war. Lange starrte er auf das Felsgestein, aber ihm fiel nichts auf.
»Du bist ein Scharlatan. Ich hab’s immer gewusst«, grollte der Parther. »Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war, dich zum Centurio zu ernennen.«
Offenbar hat unser parthischer Kommandant vergessen, dass ich die Vergessene Legion mit der geheimen Waffe ausgestattet habe, dachte der Haruspex voller Bitterkeit. Mit dem großen Rubin, den Olenus ihm einst vor Jahren vermacht hatte – zusammen mit dem Lituus und der Karte –, hatte er einem Karawanenhändler Seide abgekauft, mit der sie bis zu fünftausend Scuta bespannt hatten. Mit Hilfe dieses Tricks hatten die Schilde der enormen Durchschlagskraft der feindlichen Hornbogen standgehalten. Zudem hatte Tarquinius darauf gedrängt, Tausende lange Speere schmieden zu lassen, mit denen man den Ansturm der Reiterei abwehren konnte. Die Parther hatten es also dem Etrusker zu verdanken, dass die plündernden Horden der Sogder, die kaum eine Stadt nordöstlich von Margiana verschont hatten, letzten Endes aufgerieben wurden. Doch Tarquinius war nicht nur ein glänzender Taktiker, er verstand sich obendrein auf die Heilkunst und hatte dank seiner Erfahrung das Leben manch eines Verwundeten retten können. Die römischen Soldaten achteten den Etrusker seit geraumer Zeit, und mit der Ernennung zum Centurio hatte auch Pacorus den Haruspex stillschweigend für dessen Verdienste belohnt. Doch nun traute er sich nicht, dem Parther zu antworten.
Nach wie vor hatte Pacorus sie alle in der Hand, er – niemand sonst – war Herr über Leben und Tod. Bislang waren Tarquinius und in gewisser Weise auch seine Freunde nur deshalb sicher vor Foltermaßnahmen oder dem Tod gewesen, weil der parthische Kommandant sich insgeheim vor den seherischen Fähigkeiten des Etruskers fürchtete. Und jetzt sah es ganz danach aus, als sei ihm diese seltene Gabe zum ersten Mal abhandengekommen.
Seitdem dieser ahnungsvolle Verdacht in ihm aufgekeimt war, war die Angst zu seinem täglichen Begleiter geworden – eine für Tarquinius neue Gefühlslage.
Über Monate hinweg hatte er sich auf seinen wachen Geist verlassen, während er nichts wirklich Bedeutsames um sich herum wahrnahm. Tarquinius betrachtete die Wolkenformationen, schloss die Windrichtung in seine Berechnungen mit ein und beurteilte sowohl den Vogelflug als auch andere Tiere. Doch nichts. Selbst die Opferungen von Hühnern und Lämmern – für gewöhnlich eine exzellente Methode der Wahrsagung – hatten sich wiederholt als nutzlos erwiesen. Die dunkelroten Lebern der Opfertiere, die generell in der Wahrsagekunst die beste Quelle von Informationen waren, hielten keinerlei Hinweise für ihn bereit. Tarquinius konnte es einfach nicht begreifen. Nun bin ich seit gut zwanzig Jahren ein Haruspex, dachte er verzweifelt. Doch nie hatte es einen derartigen Mangel an verwertbaren Visionen gegeben. Die Götter zürnen mir. Charun, der etruskische Dämon der Unterwelt, fiel ihm ein: Voller Zorn konnte dieser, einem Erdgeist gleich, wie aus dem Nichts erscheinen, um sie alle zu verschlingen. Mit seiner bläulichen Haut und den roten Haaren wandelte der Dämon in Pacorus’ Schatten, bleckte die Zähne und war kurz davor, Tarquinius zu zerfleischen, sobald der parthische Kommandant die Geduld verlor. Und das würde nicht mehr lange dauern. Man brauchte kein Haruspex zu sein, um die Körpersprache des Parthers zu deuten, wie Tarquinius sich müde vor Augen führte. Pacorus war wie ein Seil, das unter Spannung stand und jeden Moment zu zerreißen drohte.
»Bei allem, was heilig ist«, fuhr Pacorus ihn an. »Ich will’s dir zeigen.« Ruckartig entriss er einem der Wächter eine Fackel und schritt drauflos; die anderen folgten ihm. Nach etwa zwanzig Schritten blieb er stehen. »Sieh«, rief er ungeduldig und wies mit der Fackel auf das Felsmassiv.
Tarquinius bekam große Augen. Unmittelbar vor ihnen erstreckte sich ein kleines, mit flachen Steinen ausgelegtes Areal, in dessen Mitte sich eine größere, von Menschenhand geschaffene Öffnung im Erdboden befand. Mit schweren Steinplatten hatte man das annähernd rechteckige Loch gesichert. Die verwitterten Steinflächen waren von Inschriften und Einkerbungen überzogen. Tarquinius trat einen Schritt näher an das Loch und erkannte die Formen der Ritzungen: ein Rabe hier, ein halb kauernder Bulle dort, eine verzierte Krone mit sieben Zacken. Und war dieser Umriss nicht einer phrygischen Mütze nachempfunden? Die Kopfbedeckung ähnelte den spitzkegeligen Hüten, die die Wahrsager von Anbeginn der Zeiten trugen, dachte er aufgeregt und verspürte ein Kribbeln am ganzen Körper. Ein kleines, aber höchst fesselndes Detail, denn die Mütze konnte ein Hinweis auf die ungeklärte Abstammung von Tarquinius’ Volk sein.
Bevor die Etrusker viele Jahrhunderte zuvor Mittelitalia besiedelt hatten, waren sie vermutlich aus Ländern gekommen, die sehr viel weiter östlich lagen. Spuren etruskischer Zivilisation fanden sich in Kleinasien, aber der Legende zufolge stammten die Etrusker aus dem Fernen Osten. Wie übrigens Mithras. Es gab nicht viele Dinge, die Tarquinius in Aufregung versetzten, aber die Herkunft seines Volkes ließ ihn nicht kalt. Jahre seines Lebens hatte er damit verbracht, nach Beweisen zu suchen, die Aufschluss über die Vergangenheit der Etrusker hätten geben können. Doch ohne Erfolg. Vielleicht würde sich hier, im Osten, der undurchdringliche Nebel der Zeiten verflüchtigen. Olenus hatte recht behalten – wieder einmal. Hatte der alte Seher nicht vorhergesagt, dass Tarquinius mehr erfahren würde, wenn er nicht nur Parthia durchquerte, sondern den langen Marsch nach Osten antrat?
»Für gewöhnlich dürfen nur Gläubige ein Mithräum betreten«, verkündete Pacorus. »Die Strafe für Missachtung dieser Regel ist der Tod.«
Die anfängliche Begeisterung war rasch verflogen. Tarquinius verzog das Gesicht; jede Information zu dem Mithraskult war fast genauso wichtig wie das Überleben.
»Du darfst nur deshalb eintreten, da du mir die Zukunft voraussagen sollst. Und das Schicksal der Vergessenen Legion«, sprach Pacorus. »Sollten deine Worte mich nicht überzeugen, bist du des Todes.«
Tarquinius war Herr seiner Gefühle, ließ sich nichts anmerken und begegnete dem Blick des Parthers. Offenbar hatte Pacorus ihm noch mehr zu sagen.
»Aber ehe du stirbst«, setzte Pacorus in unheilvollem Ton hinzu, und sein Blick schweifte zu Romulus und Brennus, »werden deine Freunde den Tod finden, langsam und schmerzvoll. Vor deinen Augen.«
Zorn loderte in Tarquinius auf, als er seinen Blick in Pacorus’ Augen senkte. Kurz darauf war es der Parther, der den Blickkontakt unterbrach. Also verfüge ich doch noch über Macht, dachte der Haruspex, aber diese Gewissheit zerrann ihm wie Sand zwischen den Fingern. Es war Pacorus, der hier die Oberhand hatte, nicht er. Sollten die Götter ihm hernach im Mithräum keinen brauchbaren Blick in die Zukunft gewähren, würden sie alle eines schrecklichen Todes sterben. Warum nur hatte er darauf bestanden, dass Romulus und Brennus ihn an diesem Abend begleiteten? Die beiden hatten sich nicht zweimal bitten lassen und waren bereitwillig mitgekommen. Das eigene Ende bereitete Tarquinius keine Sorgen, aber es erfüllte sein Herz mit Kummer, wenn er darüber nachdachte, dass seine Freunde – der tapfere Gallier und Romulus, den er wie einen Sohn liebte – für sein Versagen würden büßen müssen. Kurz nachdem Tarquinius Crassus’ Armee beigetreten war, hatte er Brennus und Romulus kennengelernt; schnell waren die drei gute Freunde geworden. Da man sich bis dahin stets auf Tarquinius’ Voraussagen hatte verlassen können, hatten die anderen ihm voll und ganz vertraut. Nach der Schlacht von Carrhae hätten die Freunde im Schutz der Dunkelheit entkommen können, doch Romulus und Brennus vertrauten weiterhin auf Tarquinius’ Führung und blieben. Dadurch hatten sie ihr Schicksal unweigerlich mit seinem verbunden; nach wie vor verließen sich der Gallier und der junge Römer auf Tarquinius’ Rat. Es darf nicht hier enden, dachte der Etrusker entschlossen. Nein, das darf es nicht.
»So sei es«, rief er und bediente sich seines einstudierten, prophetischen Tonfalls. »Mithras wird mir ein Zeichen geben.«
Romulus und Brennus blickten ruckartig in seine Richtung, und Tarquinius sah Hoffnung in ihren Gesichtern aufflammen, insbesondere in Romulus’ Blick.
Tarquinius empfand dies als Trost und wartete.
Pacorus bleckte die Zähne. »Folgt mir«, sprach er und setzte einen Fuß auf die erste Treppenstufe.
Ohne zu zögern trat Tarquinius dicht hinter ihn.
Nur einer der Leibwächter schloss sich den beiden an, die Hand am Knauf seines Dolchs.
Derweil verteilten sich die anderen Wachen vor dem Zugang des Heiligtums und steckten ihre Fackeln in die Lücken zwischen den verlegten Steinplatten. Spuren von Asche verrieten, dass hier schon einmal Fackeln abgestellt worden waren. Romulus staunte immer noch, wie unvermutet Pacorus und Tarquinius vor aller Augen verschwunden waren – gleichsam vom Erdboden verschluckt. Zwar hatte auch er die großen, rechteckigen Steinplatten wahrgenommen, aber nie hätte er es für möglich gehalten, so dicht vor einem unterirdischen Eingang zu stehen. Da die unmittelbare Umgebung nun ausgeleuchtet wurde, entdeckte auch Romulus die Steinritzungen zu beiden Seiten des Eingangs. Mit Verzögerung begriff er: Sie standen vor einem Heiligtum, vor einem Tempel des Mithras.
Offenbar zweifelte Tarquinius nicht daran, dort unten einige lang ersehnte Antworten zu erhalten.
Da Romulus mehr wissen wollte, trat er einen Schritt vor, doch einige parthische Wächter versperrten ihm sofort den Weg.
»Niemand sonst darf hinein«, ließ ihn einer der Parther grummelnd wissen. »Das Mithräum ist ein heiliger Ort. Abschaum wie du ist hier nicht willkommen!«
»In Mithras’ Augen sind alle Menschen gleich«, hielt Romulus dagegen, weil er sich an das erinnerte, was Tarquinius ihm beigebracht hatte. »Außerdem bin ich Soldat.«
Der Parther schaute sich ein wenig verunsichert um. »Nur der Kommandant hat darüber zu befinden, wer eintreten darf«, gab er schließlich grob zurück. »Und von euch beiden war nicht die Rede.«
»Also stehen wir hier nur rum und warten?« Romulus verlor allmählich die Geduld.
»Ganz genau«, erwiderte der Krieger und trat energisch einen Schritt vor. Andere taten es ihm gleich und griffen bereits nach den Pfeilen in ihren Köchern. »Wir werden alle hierbleiben, bis Pacorus etwas anderes anordnet. Verstanden?«
Wütend begegnete Romulus dem Blick des Wächters. Obwohl die Parther und die Legionäre nun schon einige Male Seite an Seite gekämpft hatten, konnten sie einander nicht ausstehen; und aus römischer Sicht würde sich daran vorerst nichts ändern. Auch Romulus hatte für die Parther nichts als Argwohn und Abneigung übrig, denn immerhin hatten diese Krieger viele seiner Kameraden bei Carrhae abgemurkst.
Er spürte, dass Brennus ihm eine Hand auf die Schulter legte. »Belassen wir es dabei«, sagte der Gallier ruhig. »Jetzt ist nicht die Zeit für so etwas.«
Brennus hatte sich von seinem Bauchgefühl leiten lassen, als er Romulus zurückhielt. Während der letzten vier Jahre war der junge Römer ihm ans Herz gewachsen, ja, für den hünenhaften Gallier war Romulus inzwischen wie ein Sohn. Seitdem er Romulus kennengelernt hatte, war sein von Selbstvorwürfen zerrissenes Leben erträglicher geworden. Er hatte es dem Jungen zu verdanken, dass das Leben wieder einen Sinn erhielt. Und inzwischen war der siebzehnjährige Römer zu einem geschickten Kämpfer herangereift – Brennus’ dauerhafte und unnachgiebige Exerziereinheiten hatten sich demnach gelohnt. Dem Etrusker hatte Romulus es zu verdanken, dass er über vielerlei Kenntnisse verfügte; er konnte sogar lesen und schreiben! Wenn Romulus einen Schwachpunkt hatte, dann vielleicht sein aufbrausendes Temperament. Mitunter kam es vor, dass er sich von aufwallendem Zorn zu unbedachtem Handeln hinreißen ließ – aber auch nur, wenn man ihn provozierte oder er sich ungerecht behandelt fühlte. Früher war ich genau wie er, dachte Brennus.
Unterdessen atmete Romulus hörbar aus und entfernte sich ein wenig von dem Eingang zum Heiligtum, wobei er wahrnahm, dass der Parther seine Kameraden triumphierend angrinste. Es missfiel dem jungen Mann, dass er immer klein beigeben musste. Zumal er hier die Gelegenheit gehabt hätte, Zeuge eines bedeutenden Rituals zu werden! Aber auch in diesem Moment war es klüger, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. »Wieso hat Tarquinius uns überhaupt gefragt, ob wir mitkommen wollen?«, wandte er sich verdrießlich an seinen Freund.
»Als Verstärkung.«
»Für wen? Etwa für diese elenden Hunde?« Ungläubig deutete er auf die Parther. »Das sind zwanzig Mann. Mit Pfeil und Bogen.«
»Die sind deutlich in der Überzahl, schon wahr«, murmelte der Gallier und zuckte die Schultern. »Aber wen hätte er sonst fragen können?«
»Da steckt mehr dahinter«, antwortete Romulus. »Tarquinius muss einen Grund gehabt haben. Ich habe das Gefühl, dass wir hier sein müssen.«
Brennus schaute sich ausgiebig um und nahm den Anblick der kargen Landschaft in sich auf. Allmählich verloren sich die Konturen der Felswand in der Dämmerung eines weiteren kalten Abends. »Ich kann mir nicht helfen«, sinnierte er. »Ein von den Göttern verlassener Ort, würde ich sagen. Nichts als Dreck und Fels.«
Romulus war im Begriff, seinem Freund beizupflichten, als etwas seine Aufmerksamkeit erregte. In einiger Entfernung fing sich der Schein der Fackeln in einem dunklen, lauernden Augenpaar. Romulus erstarrte und spähte angestrengt in das Halbdunkel. Er hatte sich nicht geirrt: Ein Schakal beobachtete sie. Das Tier stand stocksteif da, und nur das Funkeln in den Augen verriet dem jungen Mann, dass dort keine leblose Steinfigur stand. »Wir sind nicht allein«, flüsterte er nicht ohne Begeisterung in der Stimme. »Sieh nur, dort!«
Brennus lächelte und war stolz auf seinen jungen Freund, denn das Tier war schwer auszumachen. Selbst er, Brennus, hatte den Schakal nicht bemerkt, dabei galt er von jeher als ausgezeichneter Jäger. Doch in letzter Zeit war es immer häufiger Romulus, der die Tierfährten richtig zu deuten vermochte. Er war sogar in der Lage, Spuren auf blankem Felsgestein zu verfolgen, und besaß die fast unheimliche Gabe, auch das kleinste Detail beim Fährtenlesen zu registrieren: ein kleiner, abgeknickter Zweig hier, niedergetretenes Gras dort oder unterschiedlich tiefe Pfotenabdrücke eines verletzten, lahmenden Tiers. Nur wenige Menschen besaßen diese Fähigkeit.
Brac hatte zu den besten Fährtenlesern gehört.
Alte, über lange Strecken verschüttete Gefühle regten sich in Brennus, doch der Kummer saß genauso tief wie früher: Brac, sein junger Vetter, würde ihn nie wieder auf einen Jagdausflug begleiten. Brac war tot, vor acht Jahren ermordet von den Römern – damals waren auch Brennus’ Weib Liath und sein kleiner Sohn bei dem Angriff auf das Lager ums Leben gekommen. Die Römer hatten den gesamten Stamm der Allobroger ausgelöscht. Brac war damals genauso alt gewesen wie Romulus jetzt. Da Brennus den Klauen des Kummers die Schärfe nehmen wollte, schüttelte er den Schmerz gleichsam ab und wiederholte im Stillen jene Worte, die ihm einst Ultan, der Druide der Allobroger, mit auf den Weg gegeben hatte. Jene geheimnisvolle Weissagung, die Tarquinius auf seine Weise erraten haben musste.
Eine Reise steht bevor, die dich an Orte führen wird, zu denen nie ein Allobroger vorgedrungen ist.
Und diese Reise hatte Brennus wahrlich angetreten – bis zur östlichen Grenzregion von Margiana. Vier Monate waren sie von Carrhae aus marschiert, und inzwischen war Brennus mehr als zweitausend Meilen von Gallien entfernt. Blieb abzuwarten, wo und wann seine Reise endete. Doch nun richtete der Gallier seine Aufmerksamkeit wieder auf den Schakal, auf den Romulus zeigte. »Bei Belenus«, flüsterte er. »Er verhält sich wie ein Hund, siehst du das?«
Eigenartig, aber das Tier saß dort tatsächlich wie ein Hofhund, der auf seinen Herrn wartet.
»Das ist das Werk der Götter«, gab Romulus ebenso leise zurück und fragte sich im selben Moment, was ihr Freund Tarquinius wohl dazu sagen würde. »Offenbar muss es so sein.«
»Da könntest du recht haben«, stimmte Brennus ihm ein wenig unsicher zu. »Schakale sind jedoch Aasfresser. Sie fressen alles, was an halb verwestem Fleisch herumliegt.«
Sie tauschten Blicke.
»Heute Abend werden Menschen sterben.« Ein Schauer durchrieselte den Gallier. »Ich spüre es.«
»Mag sein«, sinnierte Romulus. »Aber ich halte das für ein gutes Zeichen.«
»Wie das?«
»Ich weiß auch nicht.« Der junge Mann verfiel in Schweigen und versuchte sich an die Bemerkungen zu halten, die Tarquinius gelegentlich fallen ließ. Sorgsam konzentrierte er sich auf seinen Atem und ließ den Schakal nicht aus den Augen. Er suchte nach Luftveränderungen und irgendwelchen Anzeichen, die über die gewöhnliche Wahrnehmung hinausgingen; eine ganze Weile verharrte er in dieser Position, und sein regelmäßiger Atem umfing seinen Kopf in weißen Wolken.
Brennus ließ seinen jungen Freund gewähren.
Unterdessen hatten die Parther begonnen, Holz für ein Feuer zu suchen, und achteten nicht weiter auf die beiden Freunde.
Schließlich wandte Romulus den Blick von dem wilden Tier ab, doch er wirkte enttäuscht.
Brennus bedachte den Schakal, der unverwandt dort saß, mit einem kurzen Blick. »Und, konntest du nichts entdecken?«
Traurig schüttelte Romulus den Kopf. »Er ist hier, um über uns zu wachen, aber ich weiß nicht, warum. Tarquinius wüsste es bestimmt.«
»Mach dir keine Gedanken«, munterte der Gallier ihn auf und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Jetzt sind wir schon zu viert gegen zwanzig.«
Bei dieser Bemerkung musste der junge Mann lächeln.
Abseits des Feuers war es unangenehm kalt, aber Brennus und Romulus fühlten sich mehr mit dem Schakal verbunden als mit den Parthern. Anstatt sich am Feuer zu wärmen, kauerten sie eng nebeneinander auf einem großen Felsquader.
Schlussendlich war es genau diese Entscheidung, die ihnen später das Leben rettete.
Tarquinius spürte, wie sein Pulsschlag sich beschleunigte, als er Pacorus über die ins Erdreich gehauenen Treppenstufen hinab in die Unterwelt folgte. Zum Glück waren die Stufen gut zu erkennen, da der Parther eine Fackel in der Hand hielt. Einst hatte man die schmale Treppe in den lehmhaltigen Boden gegraben und an den Seiten notdürftig mit Holz gestützt. Weder der Kommandant noch der Leibwächter sagten ein Wort, was Tarquinius zupasskam. Denn er nutzte die Zeit der Stille, um zu Tinia zu beten, dem mächtigsten Gott der Etrusker. Und zu Mithras, auch wenn Tarquinius bislang nie ein Gebet an diesen Gott gerichtet hatte. Der Mithraskult war geheimnisvoll und vielerorts unbekannt, doch Tarquinius war schon davon fasziniert gewesen, als er zum ersten Mal in Rom davon erfahren hatte. Legionäre, die von Feldzügen aus Kleinasien zurückkehrten, hatten diese fremdartige Religion mit in die Heimat gebracht. Mithras wurde geheim und im Verborgenen gehuldigt, und die Anhänger mussten schwören, treu zu den Werten wie Wahrheit, Ehre und Mut zu stehen. Wer bei der Götterverehrung zu höheren Stufen aufsteigen wollte, musste geheime, schmerzvolle Rituale erdulden. Das war alles, was Tarquinius bislang über den Mithraskult wusste.
Natürlich war es nicht verwunderlich, Tempel der Krieger-Gottheit hier in Margiana vorzufinden, denn ebendort war der Kult am stärksten ausgeprägt, wahrscheinlich stammte er indes ursprünglich aus weiter östlich gelegenen Ländern. Tarquinius’ Lächeln war gequält. Er hätte sich gewünscht, ein Heiligtum wie dieses unter anderen Umständen betreten zu dürfen, denn Pacorus hatte ihn und seine beiden Freunde mit dem Tode bedroht. Tarquinius wusste, dass nun Tapferkeit gefragt war. Mit etwas Glück würde die Gottheit ihm nicht zürnen, denn streng genommen gehörte er nicht zu dem engeren Kreis der Anhänger und dürfte das Mithräum gar nicht betreten. Immerhin bin ich nicht nur ein Haruspex, dachte er voller Stolz. Ich bin auch ein Krieger.
O großer Mithras, ich trete voller Demut vor dich, um dich zu ehren. Ich ersuche dich um ein Zeichen deiner Gunst. Etwas, das deinen Diener Pacorus besänftigen könnte. Er zögerte einen Moment lang, ehe er aufs Ganze ging. Ich benötige ebenfalls deine göttliche Führung, um einen Weg zurück nach Rom zu finden.
Tarquinius sprach sein Gebet mit all der Inbrunst, die er aufzubringen vermochte.
Die Stille, die folgte, drückte schwer auf sein Gemüt.
Sogleich sagte er sich, nicht enttäuscht zu sein – doch sein Unbehagen blieb.
Vierundachtzig Stufen später erreichten die drei Männer das Innere des Tempels.
Abgestandene Luft wehte ihnen in einem Durchgang entgegen, eine Mischung aus Körperausdünstungen, Weihrauch und brennendem Holz. Tarquinius’ Nase zuckte, und über seine Arme lief ein Prickeln. Hier, tief unter der Erde, spürte man wahrlich eine unsichtbare Macht. Falls die Gottheit den Besuchern wohlgesinnt war, hatte Tarquinius Anlass zu der Hoffnung, seine seherischen Fähigkeiten zurückzugewinnen.
Pacorus wandte sich ihm nur halb zu. Er hatte Tarquinius’ Stimmung gespürt und lächelte mehrdeutig. »Mithras ist ein mächtiger Gott«, sprach er voller Ehrfurcht. »Und bald werde ich wissen, ob aus deinem Mund nur Lügen kommen.«
Tarquinius hielt dem Blick des Parthers stand. »Ihr werdet nicht enttäuscht sein, Herr«, entgegnete er leise.
Pacorus hielt sich mit einer Bemerkung zurück. Ursprünglich hatte er voller Ehrfurcht beobachtet, wie es Tarquinius immer wieder gelungen war, in die Zukunft zu schauen und die Lösung für ein schwieriges Problem buchstäblich aus der Luft zu greifen. Nie würde Pacorus es offen zugeben, aber dass die Vergessene Legion die plündernden Horden aus Margiana hatte vertreiben können, hatten sie einzig und allein dem Haruspex zu verdanken. Doch vor ein paar Monaten ließen Tarquinius’ einst so genaue Vorhersagen nach und wurden von eher vagen, sehr allgemeinen Bemerkungen verdrängt. Zunächst dachte Pacorus sich nichts dabei, aber das änderte sich schnell. Er brauchte dringend Prophezeiungen, denn seine Position als Kommandant der parthischen Grenzen im Osten des Reichs stand auf Messers Schneide. Natürlich war er vom Rang eines einfachen Offiziers zum Kommandanten aufgestiegen, aber seither stand er unter enormem Erfolgsdruck. Daher verließ Pacorus sich auf göttlichen Beistand, weil es für ihn um die Existenz ging.
Seit geraumer Zeit kam es immer wieder vor, dass wilde Steppenkrieger aus den Nachbarregionen in Margiana einfielen. Der Grund für diese Übergriffe lag auf der Hand. Da die Parther von Crassus’ Feldzug wussten, zogen sie vor nunmehr einem Jahr alle Soldaten aus den Garnisonen im Osten des Reichs ab. König Orodes, Herrscher über das Partherreich, ließ sämtliche Truppen nach Westen verlegen, sodass die östlichen Grenzregionen eine schwache Verteidigungslinie aufwiesen. Die Nomadenstämme nutzten die Gunst der Stunde und fielen plündernd und mordend über die Siedlungen her, die sich in Grenznähe befanden. Nach den anfänglichen Erfolgen wurden die Steppenhorden mutiger und strebten schon bald danach, ganz Margiana mit Krieg zu überziehen.
Pacorus’ Auftrag war simpel: Er sollte sämtliche Gegner zurückdrängen und den Frieden im Osten wiederherstellen. Und zwar in kürzester Zeit. Diese Pflicht musste er erfüllen, doch mit den Erfolgen wuchs auch die Gefahr für den parthischen Kommandanten, denn der König betrachtete jeden seiner Offiziere, der zu mächtig wurde, mit Argwohn. Selbst Surena, Orodes’ Feldherr, der den erstaunlichen Sieg bei Carrhae errungen hatte, war von der Missgunst des Partherkönigs nicht verschont geblieben. Je beliebter Surena in der Bevölkerung wurde, desto unruhiger wurde Orodes. Folglich ließ er seinen Feldherrn nur kurze Zeit nach der Schlacht bei Carrhae aus fadenscheinigen Gründen hinrichten. Allein diese Nachricht löste bei Offizieren wie Pacorus ein ständiges Unbehagen aus. Einerseits versuchte er, seinem Herrn und Gebieter zu gefallen, andererseits fragte er sich, auf welche Weise er die gesteckten Ziele erreichen würde – daher war er angewiesen auf Hilfe von außen, nicht zuletzt von Tarquinius.
Furcht zu schüren ist mein letzter vorteilhafter Schachzug gegenüber Pacorus, dachte der Haruspex. Doch selbst das wollte ihm nicht mehr so recht gelingen. Tarquinius wurde zunehmend von tiefer Traurigkeit befallen. Sollten ihm die Götter nichts mitteilen, so sähe er sich gezwungen, sich etwas auszudenken, das überzeugend genug klang, um den parthischen Kommandanten davon abzubringen, sie alle zu ermorden. Über Monate war es ihm gelungen, Pacorus hinzuhalten, aber inzwischen ahnte Tarquinius, dass er mit seinem Erfindungsreichtum an seine Grenzen gestoßen war.
Schweigend folgten sie dem Verlauf eines Gangs, der wie die Treppe ins Erdreich gehauen worden war. Schließlich führte der Gang in eine lang gestreckte, schmale Kaverne.
Pacorus ging von der rechten zur linken Wand und entzündete Öllampen, die in kleinen Alkoven standen.
Während die kleinen Flammen den heiligen Raum in ein mattes Licht tauchten, nahm Tarquinius nach und nach die Wandmalereien, die niedrigen Sitzbänke zu beiden Seiten und die massiven Holzpfosten wahr, die die Deckenkonstruktion trugen. Unweigerlich jedoch wanderte sein Blick zum hinteren Ende des Mithräums, denn dort standen drei Altäre vor einer Wand, die ein besonders farbenprächtiges Bild aufwies: Dargestellt war eine Gestalt, die sich in einen Umhang gehüllt hatte und eine phrygische Mütze trug. In einer Opferzeremonie beugte sie sich über einen Stier, der am Boden kauerte, und trieb dem Tier ein Messer tief in die Schulter. Mithras. Sterne funkelten auf seinem dunkelgrünen Umhang; zwei weitere, geheimnisvolle Gestalten mit brennenden Fackeln standen zu beiden Seiten der Gottheit, ein Bein über das andere gekreuzt – stumme Zeugen des geheimen Ritus.
»Die Tauroktonie, die Stiertötung«, wisperte Pacorus und neigte ehrfürchtig das Haupt. »Indem Mithras den heiligen Stier opfert, schenkt er der Welt das Leben.«
Tarquinius spürte, dass sich der Wächter, der hinter ihm stand, verneigte; er tat es dem Mann gleich.
Langsamen Schrittes ging Pacorus voraus zu den Altären. Ein kurzes Gebet murmelnd, vollführte er eine tiefe Verbeugung. »Der Gott ist unter uns«, flüsterte er und trat beiseite. »Hoffen wir, dass er dir etwas offenbart.«
Tarquinius schloss die Augen und nahm all seine Kraft zusammen. Es wunderte ihn, dass seine Handflächen schwitzten. Er konnte sich nicht erinnern, jemals Hilfe nötiger gehabt zu haben. Schon oft hatte er aus dem Stegreif Vorhersagen gewagt, aber nie unter der Gewissheit, dass ihm jemand nach dem Leben trachtete. Und hier unten in der katakombenartigen Enge des Heiligtums gab es keinen Wind, keine Wolken und keine Vögel, deren Flug man hätte beobachten können, nicht einmal ein Opfertier. Ich bin allein, dachte der Haruspex. Aus einer inneren Regung heraus kniete er nieder. Großer Mithras, hilf mir!
Langsam schaute er auf zu der göttlichen Gestalt, die in dem Bild zu erkennen war. Es kam ihm so vor, als wohnte dem Blick unter leicht gesenkten Lidern etwas Wissendes inne. Was hast du mir zu bieten?, schien die Gottheit ihn zu fragen. Doch Tarquinius hatte darauf keine Antwort. Ich werde dein treuer Diener sein.
Lange wartete er.
Nichts geschah.
»Also?«, verlangte Pacorus barsch, und seine Stimme hallte gedämpft von den Wänden wider.
Verzweiflung ergriff von Tarquinius Besitz. Sein Geist war vollkommen leer.
Wütend wandte Pacorus sich an seinen Leibwächter, der einen Schritt vortrat.
Das war es dann also, dachte Tarquinius voller Zorn. Olenus hatte sich geirrt, als er glaubte, ich werde aus Margiana zurückkehren. Stattdessen sterbe ich hier einsam in einem Mithräum. Auch Romulus und Brennus müssen sterben. All mein Streben war umsonst, ich habe mein Leben verwirkt.
Doch dann, wie aus dem Nichts, erreichte ein imaginäres Bild sein inneres Auge.
Etwa einhundert Bewaffnete schlichen sich an ein Lagerfeuer, um das zwanzig parthische Krieger saßen. Tarquinius’ Haut begann zu prickeln. Die Parther, die er sah, ahnten nichts und schwatzten untereinander.
»Gefahr!«, stieß er hervor und sprang auf. »Wir sind einer großen Gefahr ausgesetzt.«
Der Wächter blieb stehen, nahm die Hand jedoch nicht vom Griff des Dolchs.
»Von wo geht diese Gefahr aus?«, verlangte Pacorus. »Von Sogdia? Von Baktrien?«
»Ihr versteht nicht!«, rief der Haruspex. »Hier! Hier bei uns ist die Gefahr!«
Pacorus hob skeptisch die Brauen.
»Wir müssen die anderen warnen«, drängte Tarquinius. »Zurück zum Lager, ehe es zu spät ist.«
»Es ist bald Nacht, und wir haben Winter«, spottete Pacorus. »Zwanzig meiner besten Wachen stehen draußen vor dem Eingang. Ebenso deine Freunde. Und neuntausend Soldaten lagern bloß eine Meile von hier. Wer sollte uns da also gefährlich werden?«
Sein Leibwächter grinste.
»Aber die Männer draußen werden überfallen«, antwortete Tarquinius. »Jeden Moment.«
»Was? Auf diese Weise willst du also deine Unfähigkeit überdecken?«, rief Pacorus wütend. »Du bist ein verdammter Lügner!«
Anstatt der Anschuldigung entgegenzuwirken, schloss der Etrusker erneut die Augen und fühlte sich in die Bilder hinein, die er soeben gesehen hatte. Aus einem unerfindlichen Grund gelang es ihm, sich nicht von Todesangst vereinnahmen zu lassen. Ich brauche mehr, o großer Mithras.
»Bringen wir es hinter uns«, wies Pacorus den Wächter an und deutete auf Tarquinius.
Der Etrusker spürte, dass sich ihm die Klinge des Dolchs näherte, aber er blieb ruhig und gefasst. Dies war die letztmögliche Probe seiner seherischen Fähigkeiten. Viel mehr konnte er nicht tun, und um mehr konnte er die Gottheit nicht anflehen. Tarquinius spürte den leisen Luftzug am Hals, als der Leibwächter mit der Hand zum Stoß ausholte. Mit seinen letzten Gedanken war der Haruspex bei seinen unschuldigen Freunden. Vergebt mir.
In diesem Moment hallte ein warnender Ruf von weiter oben die Stufen herunter bis ins Zentrum des Heiligtums.
Entsetzen zeichnete sich in Pacorus’ Zügen ab, doch rasch hatte er die Fassung wiedererlangt. »Verräterischer Hund!«, zischte er. »Du hast vorher deinen Freunden gesagt, dass sie rufen sollen, wie?«
Tarquinius schüttelte den Kopf und schwieg.
Schließlich herrschte Stille, ehe von draußen Schreie ins Mithräum drangen, bei denen einem die Haare zu Berge standen. Auch Pacorus erkannte voller Schrecken, dass zwei Mann allein keinen solchen Lärm machen konnten.
Der Parther erbleichte. Einen Moment lang zögerte er, doch dann wandte er sich ab und verließ die Kaverne. Sein Leibwächter folgte ihm im Laufschritt.
Tarquinius stand auf und war im Begriff, den beiden Parthern zu folgen, als er von einer Woge der Kraft durchdrungen wurde.
Die Offenbarung der Gottheit war noch nicht vorüber.
Aber seine Freunde schwebten in Lebensgefahr!
Schuldgefühle vermischten sich mit Zorn. Schließlich gewann der Wunsch nach Wissen die Oberhand. Er sank wieder auf die Knie. Noch blieb ihm etwas Zeit.
Ein kurzer Augenblick nur.
Eine halbe Stunde verging. Die Temperatur, die während des ganzen Tages unter dem Gefrierpunkt gelegen hatte, fiel weiter ab. Die Parther bedienten sich an dem aufgestapelten Holz, das andere Tempelbesucher zurückgelassen hatten, und legten Scheite nach, bis die Flammen mannshoch stoben. Während einige der Männer in einer Entfernung von dreißig Schritten Wache hielten, scharten sich die übrigen um das Feuer und unterhielten sich ungezwungen. Nur gelegentlich sah einer von ihnen nach Romulus und Brennus, die lediglich geduldet wurden.
Die beiden Freunde standen zwischendurch immer wieder auf, stampften mit den Füßen auf und bewegten sich, um gegen die Kälte anzukämpfen. Doch es war nutzlos. Trotzdem verspürten sie kein Verlangen, sich zu den Parthern ans Feuer zu setzen, denn die Wachen hatten für die Fremden nichts als Verachtung übrig. Brennus hing seinen eigenen Gedanken nach und gab sich Träumereien über seine Zukunft hin, während Romulus immer wieder zu dem Schakal schaute, in der Hoffnung, den Grund für das Auftauchen des Tiers zu verstehen. Aber all seine Bemühungen waren umsonst. Schließlich erhob sich das Tier, schüttelte sich wie ein Hund und trottete in südlicher Richtung davon. Augenblicke später war das Tier aus Romulus’ Blickfeld verschwunden.
Im Nachhinein erkannte der junge Mann voller Ehrfurcht, wie bedeutsam das Verhalten des Schakals gewesen war.
»Bei allen Göttern«, murrte Brennus, und seine Zähne klapperten, so kalt war es. »Ich hoffe doch sehr, dass Tarquinius gleich fertig ist. Denn sonst müssen wir uns noch zu diesen Bastarden ans Feuer setzen.«
»Er braucht bestimmt nicht mehr lange«, sagte Romulus zuversichtlich. »Pacorus hat allmählich die Geduld mit ihm verloren.«
Alle in der Vergessenen Legion wussten, dass Männer hingerichtet wurden, wenn der Kommandant in Zorn geriet.
»Dieser Hund Pacorus kommt mir in letzter Zeit äußerst ungeduldig vor«, pflichtete Brennus seinem jungen Freund bei und zählte zum wiederholten Mal die Parther. Einfach zu viele, dachte er. »Wahrscheinlich befiehlt er den anderen bald, uns umzubringen. Schade, dass der Schakal nicht geblieben ist. Er hätte uns helfen können, was?«
Romulus wollte darauf etwas erwidern, als sein Blick auf zwei der Wachen fiel. Zunächst traute er seinen Augen nicht, doch dann gewahrte er geisterhafte Gestalten, die sich aus dem Zwielicht von hinten an die Parther heranschlichen, lange Messer in den Händen. Noch einmal vergewisserte er sich, dass er keinen Einbildungen erlag, ehe er reagierte. Doch da war es bereits zu spät. Die Parther sackten lautlos in sich zusammen, Blut spritzte aus den tiefen Halswunden.
Weder die Wachposten noch die Männer am Feuer hatten etwas bemerkt.
»Zu den Waffen!«, brüllte Romulus. »Wir werden angegriffen!«
Erschrocken sprangen die Parther auf, griffen nach den Waffen und spähten in die Dunkelheit der Felslandschaft.
Schreie gellten durch die eiskalte Luft, doch niemand war zu sehen.
Brennus war sofort bei Romulus. »Warte noch«, warnte er ihn. »Nicht bewegen.«
»Die anderen stehen zu dicht am Feuer«, bemerkte Romulus, als er erkannte, dass die Parther Zielscheiben im Feuerschein abgaben.
»Diese Narren«, entfuhr es Brennus.
Im selben Moment pfiff der erste feindliche Pfeil durch die Luft; weitere folgten aus dem Schutz der Dunkelheit rund um die Feuerstelle und gingen wie tödlicher Regen auf die Parther nieder. Ein perfekter Hinterhalt – für jeden Unbeteiligten ein bizarr-schöner Anblick. Allein der ersten Salve fiel mehr als die Hälfte der Parther zum Opfer, andere waren verwundet. Die übrigen Krieger griffen nach ihren Bögen und feuerten aufs Geratewohl in die Dunkelheit.
Romulus hatte den seidenbespannten Scutum hochgerissen und war im Begriff loszustürmen, doch Brennus hielt ihn zurück. »Aber Tarquinius …«, rief er.
»Ist sicher unten im Tempel.«
Romulus entspannte sich ein wenig.
»Gleich werden sie angreifen«, sagte der Gallier, während die Schreie um sie herum zunahmen. »Und dann wollen wir sie mit einer kleinen Überraschung empfangen.«
Brennus’ Vermutung war richtig. Allerdings hatte er nicht ahnen können, mit wie vielen Angreifern sie es zu tun hatten.
Erneut hagelte es Pfeile, ehe die Feinde im Sturmlauf angriffen. Dutzende. Sie hatten sich die Hornbögen über die Schulter geschwungen und schwangen Schwerter, Messer und kurzstielige, bösartig aufblitzende Äxte. Es konnte sich nur um Skythen handeln, denn die Männer trugen spitze, kapuzenartige Hauben aus Filz sowie Kettenhemden und Stiefel, die bis zu den Knien reichten. Diesen Steppenkriegern waren Romulus und Brennus bereits bei mehreren Scharmützeln im Grenzbereich begegnet. Obwohl die Blütezeit ihres Reichs längst überschritten war, galten die Skythen als unnachgiebige Feinde. Zumal sie ihre mit Widerhaken versehenen Pfeilspitzen mit einem tödlichen Gift einrieben: dem Scythicon. Selbst diejenigen, die nur kurz damit in Berührung kamen, starben unter entsetzlichen Qualen.
Brennus fluchte leise. Romulus krampfte sich der Magen zusammen.
Und Tarquinius war noch im Mithräum! Sie konnten ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Doch sobald sie versuchten, den Haruspex zu retten, waren sie alle dem Tode geweiht. Romulus schätzte die Zahl der Skythen, die inzwischen zu sehen waren, auf etwa fünfzig, und weitere rückten nach. Verbittert machte der junge Römer sich bewusst, wie flüchtig das Leben war. Die Vorstellung, eines Tages sicher nach Rom zurückzukehren, erschien ihm im Augenblick lächerlich.
»Die drei können den Lärm unmöglich überhört haben«, wisperte Brennus. »Pacorus ist kein Feigling. Er wird jeden Moment aus dem Tempel stürmen. Und es gibt nur einen Weg, ihnen das Leben zu retten.«
»Wir müssen rein und sie warnen«, sagte Romulus.
Brennus nickte zufrieden. »Schlag alle Skythen am Eingang des Tempels zurück. Ich hole Tarquinius und die anderen. Dann nichts wie weg.«
Romulus hatte die Anweisungen verinnerlicht und lief voraus.
Sie rannten das letzte Stück und spürten ihre von der Kälte schmerzenden Muskeln, doch angesichts der Gefahr verdoppelten sie ihre Anstrengung. Beide hielten die Speere wurfbereit. Inzwischen hatten die Skythen die überlebenden Parther eingekesselt und schauten sich nicht um. Langsam schlossen sie den Kreis enger um Pacorus’ Krieger.
Hätten wir jetzt eine ganze Centurie, dachte Romulus, würden wir sie in Stücke reißen. Doch nun mussten sie darauf hoffen, dass Tarquinius zum richtigen Zeitpunkt aus dem Eingang kommen würde. Nur so wäre die Flucht möglich. Eine vage Hoffnung.
Schreie des Entsetzens hallten von den Felswänden wider, als auch die letzten Parther erkannten, dass es um sie geschehen war.
Sie waren nur noch wenige Schritte vom Eingang entfernt, und Romulus glaubte schon, sie könnten es schaffen. Doch dann richtete sich ein schlanker Skythe auf, der soeben sein blutiges Schwert am Umhang eines toten Parthers abgewischt hatte, und entdeckte zunächst Romulus. Mit offenem Mund starrte der Mann die beiden Freunde an, ehe er einen Befehl rief und sich in Bewegung setzte. Neun seiner Gefährten folgten ihm nach, zogen ihre Waffen und griffen nach den Bögen.
»Du kümmerst dich um Tarquinius«, rief Romulus, als sie unmittelbar bei dem Einstieg stehen blieben. »Ich halte sie auf.«
Brennus vertraute seinem Freund und überließ ihm den Wurfspieß. Dann riss er eine der Fackeln aus dem Spalt zwischen den Steinplatten und eilte die Stufen hinab ins Heiligtum. »Bin gleich zurück«, rief er.
»Spute dich, sonst ist’s aus mit mir!« Romulus kniff ein Auge zu und zielte. Als Gladiator und später als Söldner hatte er so viele Stunden mit Waffenübungen zugebracht, dass ihm der Wurf des Pilum in Fleisch und Blut übergegangen war; so beschrieb auch dieser Speer eine perfekt gekrümmte Flugbahn und bohrte sich durch das Kettenhemd in die Brust des Skythen, der etwa zwanzig Schritte von Romulus entfernt war. Der Mann sackte zu Boden wie ein Maultier an der Schlachtbank.
Doch seine Gefährten hielten nur kurz inne.
Mit dem zweiten Speer traf Romulus einen stämmigen Skythen am Bauch und streckte ihn nieder. Das dritte Pilum verfehlte sein Ziel, aber das vierte bohrte sich in den Hals eines bärtigen Steppenkriegers. Inzwischen hatten die übrigen Kämpfer einen gewissen Respekt vor dem jungen Soldaten, verlangsamten ihr Tempo und legten Pfeile auf die Sehnen ihrer Bögen. Vier andere stürmten weiter in Romulus’ Richtung.
Also noch sieben dieser Hurensöhne, dachte Romulus, und sein Herz hämmerte in seiner Brust, in einer Mischung aus Kampfeswut und Furcht. Vergiftete Pfeile. Auch das noch. Was soll ich tun? Plötzlich fiel ihm Cotta ein, sein alter Ausbilder im Ludus Magnus. Wenn alles andere versagt, musst du deinen Gegner mit einem Gegenangriff überraschen. Das Element der Überraschung darfst du nicht unterschätzen. An etwas anderes konnte er nicht denken, und immer noch keine Spur von Brennus oder Tarquinius.
Mit einem Kriegsschrei auf den Lippen stürmte Romulus den Feinden entgegen.
Die Skythen grinsten angesichts dieser Unvorsichtigkeit, rechneten sie doch mit einem unerfahrenen Narren, den sie leicht ausschalten könnten.
Als Romulus auf den ersten Gegner stieß, nutzte er zunächst die verlässliche Nahkampftaktik der Legionäre aus: den Feind mit dem Schildbuckel zurückschlagen und einen gezielten Stoß mit dem Gladius folgen lassen. Alles lief so, wie er es sich gedacht hatte. Mit einer halben Drehung löste er sich von dem Gegner, der zu Boden ging, und hörte, dass sich ein Pfeil in sein Scutum gebohrt hatte. Dann noch einer. Zum Glück verhinderte die Seide, dass die Spitzen den Schild durchschlugen. Ein dritter Pfeil sirrte dicht an seinem Ohr vorbei. Da er ahnte, dass er nur wenig Zeit hatte, ehe die nächste Salve abgefeuert würde, spähte Romulus über den Rand des Scutums. Jeden Augenblick würden zwei der Skythen bei ihm sein, doch die drei Schützen griffen bereits nach den nächsten Pfeilen.
Romulus’ Mund war wie ausgetrocknet.
Dann gellte ein ihm vertrauter Kriegsruf durch die Dunkelheit.
Die Skythen zögerten; Romulus nutzte den Moment, um sich mit einem Blick über die Schulter abzusichern. Wie ein riesiger Bär, den man im Winterschlaf gestört hatte, stürmte Brennus aus dem Tempeleingang und kam in Romulus’ Richtung geeilt.
Als Nächster löste sich Pacorus mit wütendem Gebrüll aus den Schatten beim Eingang. Unmittelbar hinter dem Kommandanten erschien der stämmige Leibwächter, der drohend sein Messer schwang.
Aber keine Spur von Tarquinius.
Romulus hatte keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er wirbelte herum und konnte gerade noch den mächtigen Hieb eines Skythen abwehren. Als er zum Gegenangriff überging, verfehlte er seinen Gegner. Doch er hatte Glück und blieb unversehrt, als ein zweiter Skythe nach seinem Schwertarm schlug. Um ein Haar hätte er Romulus verstümmelt. Funken stoben in die Nacht, als die Klinge über das Felsgestein glitt. Romulus zögerte keinen Augenblick. Da der zweite Skythe zu viel Schwung in seinen Hieb gelegt hatte, war seine Flanke einen Moment ungedeckt – Romulus schnellte vor und traf den Mann oberhalb des Kettenhemds am Hals. Der Skythe war bereits tot, als Romulus sein Schwert zurückzog. Der Gefährte des Toten zeigte sich zunächst schockiert, hatte aber noch die Geistesgegenwart, Romulus mit der Schulter zu rammen.
Der junge Römer rang nach Luft und stürzte unglücklich auf den gefrorenen Boden. Doch er hatte sein Schwert nicht losgelassen. Verzweifelt stieß er nach seinem Gegner, aber er war zu langsam. Es war hoffnungslos.
Der Skythe hatte ein böses Grinsen aufgesetzt, als er drohend vor Romulus aufragte und zum tödlichen Streich ausholte.
Seltsamerweise war Romulus in diesem Augenblick mit seinen Gedanken bei Tarquinius. Wo steckte er bloß? Ob er überhaupt etwas im Tempel gesehen hatte?
Der Skythe gab einen spitzen Schrei von sich und verzog das Gesicht unter Schmerzen. Überrascht schaute Romulus auf. Im linken Auge des Feindes steckte ein Messer, das dem jungen Römer bekannt vorkam. Er hätte vor Freude jubeln mögen: Es war Brennus’ Messer. Der Gallier hatte ihm das Leben gerettet!
Romulus trat nach seinem Gegner und schickte ihn der Länge nach zu Boden. Dann vergewisserte er sich, wo die anderen waren. Brennus und Pacorus standen nur wenige Schritte entfernt und erwehrten sich Schulter an Schulter der Schar der Feinde. Der Leibwächter des Parthers lebte nicht mehr – zwei Pfeile ragten aus seinem Unterleib.
Aber es war noch nicht alles verloren.
Romulus zog den Schild wieder zu sich, setzte sich hin und schützte sich einmal mehr gegen die Pfeile der Skythen.
Keinen Moment zu früh, denn schon bohrte sich ein Pfeil in den Schild. Dennoch hatte Romulus Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen.
Die drei Bogenschützen hatte es noch nicht erwischt.
Und wie es aussah, kamen weitere Skythen gelaufen, um sich in das Getümmel zu werfen.
Ein Pfeilhagel ging nieder, als Romulus im Schutz des Scutums an Brennus’ Seite eilte.
»Gib mir deinen Schild!«, befahl Pacorus ihm.
Romulus starrte seinen Kommandanten an. Mein Leben oder seins?, schoss es ihm durch den Kopf. Jetzt sterben oder später? »Ja, Herr«, sagte er schließlich, ohne sich zu regen. »Gewiss.«
»Jetzt!«, schrie Pacorus.
Wie aus einem Guss spannten die Bogenschützen die Sehnen und schossen ihre Pfeile ab. Drei Pfeile schwirrten durch die Nacht, auf der Suche nach einem menschlichen Ziel. Sie trafen Pacorus in der Brust, am Arm und am linken Bein.
Schwer sank er zu Boden und keuchte unter Schmerzen. »Verflucht seist du«, lallte er. »Ich bin ein toter Mann.«
Weitere Pfeile sirrten durch die Luft.
»Wo bleibt Tarquinius?«, rief Romulus.
»Ist noch im Mithräum. Sah ganz danach aus, als ob er betet.« Brennus lief der Schweiß übers Gesicht. »Was meinst du, sollen wir fliehen?«
Romulus schüttelte energisch den Kopf. »Nie und nimmer.«
»Das denke ich auch.«
Gemeinsam stellten sie sich den Skythen.
2. KAPITEL:SCAEVOLA
INDER NÄHEVON POMPEJI, WINTER 53/52 V. CHR.
»Herrin?«
Fabiola riss erschrocken die Augen auf. Hinter ihr stand eine Frau mittleren Alters, die freundlich lächelte. Sie trug ein schlichtes Kleid und Ledersandalen. Fabiola erwiderte das Lächeln. Docilosa war ihre engste Vertraute, jemand, dem sie ihr Leben anvertrauen würde. »Ich hatte dich gebeten, mich nicht so anzureden.«
Docilosas Lippen zuckten. Die frühere Sklavin hatte die Manumissio noch am selben Tag erhalten wie ihre neue Gebieterin; aber alte Gewohnheiten legt man schwer ab. »Ja, Fabiola«, sagte sie schließlich, doch man merkte, wie ungewohnt die vertrauliche Anrede für sie war.
»Was gibt es?«, fragte Fabiola und stand auf. Mit ihrer schlanken Erscheinung und dem glänzenden schwarzen Haar war sie eine wahre Schönheit. Fabiola trug ein teures, aber schlicht geschnittenes Gewand aus Seide und Leinen. Ihr Schmuck an Hals und Handgelenken bestand aus getriebenem Gold. »Was ist, Docilosa?«
»Es gibt Nachrichten aus dem Norden«, sprach sie. »Von Brutus.«
Freude durchzuckte die junge Frau, doch dann schlich sich Furcht in ihre Züge. Fabiola hatte ihre Vertraute gebeten, ihr sofort mitzuteilen, sobald es Nachrichten von ihrem Liebhaber Brutus gäbe. Zweimal am Tag betete Fabiola in einem kleinen Alkoven im Atrium ihrer Villa. Offenbar hatte Jupiter ihr Flehen erhört, aber würden die Nachrichten erfreulich sein? Aufmerksam studierte Fabiola das Mienenspiel ihrer Gefährtin.
Decimus Brutus hielt sich seit geraumer Zeit in Ravenna auf, wo Cäsar, sein Feldherr, Pläne für seine Rückkehr nach Rom schmiedete. Ravenna war Cäsars Lieblingsort für die Dauer des Winters, da die Stadt genau zwischen dem transalpinen Gallien und der Hauptstadt der Republik lag. Dort, umgeben von seinen Armeen, konnte Cäsar die politische Lage aus sicherer Entfernung analysieren. Solange er sich jenseits des Flusses Rubikon aufhielt, ließ man ihn gewähren. Aber ein Feldherr durfte die Grenze zur Republik nicht überschreiten, ohne zuvor sein Kommando abgelegt zu haben – ein Verstoß kam Hochverrat gleich. Daher wartete Cäsar jedes Jahr in seinem Winterlager ab und stellte eigene Beobachtungen an. Den Senatoren missfiel dies zwar, aber sie vermochten daran nichts zu ändern. Pompeius indes, selbst ein erfahrener Feldherr und der einzige Mann in Rom, der einem Taktiker wie Cäsar militärisch gewachsen war, hielt sich bislang aus den Diskussionen heraus. Täglich änderte sich das Kräfteverhältnis in der Hauptstadt, aber eine Sache galt als sicher: Die Lage war angespannt, und Konflikte waren unausweichlich.
Daher war Fabiola überrascht angesichts von Docilosas Nachricht.
»Im transalpinen Gallien ist es zu Aufständen gekommen«, ließ sie die junge Frau wissen. »In vielen Regionen sind heftige Kämpfe ausgebrochen. Offenbar werden römische Siedler und Kaufleute in den eroberten Städten dort ermordet.«
Fabiola unterdrückte ihre Angst um Brutus und atmete langsam aus. Denk immer daran, was du hinter dir gelassen hast, dachte sie. Das Leben war schon viel schlimmer als das hier.
Mit dreizehn Jahren war Fabiola als Jungfrau in ein teures Bordell verkauft worden – von Gemellus, ihrem früheren Besitzer. Tags zuvor hatte der bösartige Kaufmann ihren Bruder Romulus an eine Gladiatorenschule verkauft. Selbst jetzt noch krampfte sich ihr das Herz bei diesem Gedanken zusammen. Fast vier Jahre hatte sie als Prostituierte im Lupanar alle Wünsche ihrer Kunden erfüllen müssen. Doch ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Fabiola schaute voller Ehrfurcht zu der Statue auf dem kleinen Altar. Jupiter erlöste mich von dem Leben, das ich so verachtete. Die Rettung war in Gestalt von Brutus gekommen, der zu Fabiolas eifrigsten Verehrern gehört hatte. Er verhandelte mit ihrer früheren Herrin Jovina, der Betreiberin des Bordells, und kaufte sie frei – für eine beträchtliche Summe. Das Unmögliche ist immer möglich, rief Fabiola sich in Erinnerung und kam innerlich etwas zur Ruhe. Brutus war gewiss in Sicherheit. »Und ich dachte, Cäsar hätte längst ganz Gallien unterworfen?«, fragte sie.
»So heißt es«, erwiderte Docilosa leise.
»Dennoch kommt keine Ruhe in diese Provinz, will mir scheinen.« Nach Beendigung seines blutigen Feldzuges war es Roms mutigstem Feldherrn – mit Hilfe von Brutus – immer wieder gelungen, Ansätze von Rebellion im Keim zu ersticken. »Was ist jetzt wieder passiert?«
»Der Häuptling Vercingetorix hat Truppen bei den einzelnen Stämmen ausgehoben«, berichtete Docilosa. »Seit Kurzem vereinigen sich Zehntausende Krieger unter seinem Banner.«
Fabiola zog die Stirn in Falten. Diese Nachrichten waren alles andere als gut. Cäsar könnte in arge Bedrängnis geraten, da der Großteil seiner Streitkräfte in Winterlagern im transalpinen Gallien stationiert war. Die gallischen Männer galten als gefürchtete Krieger, die sich lange Zeit erfolgreich gegen die römische Eroberung gestemmt hatten. Verloren hatten sie letzten Endes nur deshalb, weil Cäsar ein begnadeter Taktiker war und sich stets auf die überragende Disziplin seiner Legionen verlassen konnte. Wenn es jedoch stimmte, dass die einzelnen Stämme sich inzwischen vereinigten, konnte diese Rebellion für Cäsars Politik in Gallien durchaus gefährlich werden.
»Die Nachrichten hören sich wahrlich nicht gut an«, fuhr Docilosa fort. »In den Bergen der Grenzregion wird von starkem Schneefall berichtet.«
Fabiola presste die Lippen aufeinander. In seiner letzten Nachricht hatte Brutus noch davon gesprochen, ihr bald einen Besuch abzustatten. Aber dazu würde es jetzt wohl kaum kommen.
Und sollte Cäsar nicht imstande sein, seine Truppen rechtzeitig zu erreichen, um den Aufstand noch vor dem Frühling niederzuschlagen, würde sich die Rebellion wie ein Feuer durch die gallischen Gebiete fressen. Offenbar hat dieser Vercingetorix den geeigneten Augenblick abgepasst, dachte Fabiola voller Wut. Falls diese Revolte erfolgreich verlief, würden all die Pläne, die sie sich zurechtgelegt hatte, im Sande verlaufen. In den bevorstehenden Kämpfen würden gewiss Tausende ihr Leben lassen, aber diese hohen Verluste musste sie ignorieren. Wie ihre Wünsche auch immer aussahen, diese Männer würden ohnehin sterben. Ein rascher Sieg für Cäsar bedeutete weniger Blutvergießen. Natürlich wünschte Fabiola sich das, hieße es doch, dass auch Brutus – Cäsars ergebenster Gefolgsmann – ruhmreich aus der Schlacht hervorginge. Aber es war nicht das allein. Fabiola dachte an sich selbst und hatte klare Vorstellungen von ihrer Zukunft. Wenn Cäsar erfolgreich war, würde auch ihr Stern unaufhaltsam im Aufstieg begriffen sein.